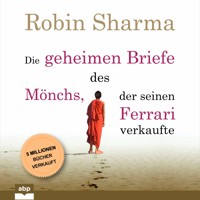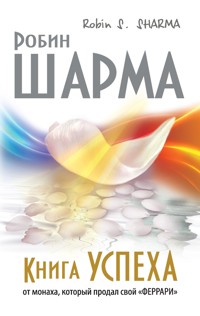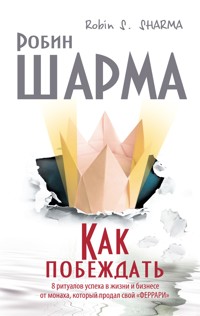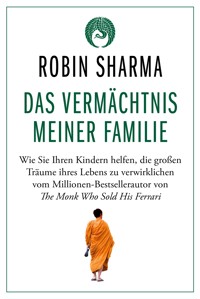9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pattloch eBook
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Fortsetzung des Weltbestsellers: Der spirituelle Roadmovie als Taschenbuch-Neuausgabe. Im spirituellen Nachfolgeroman zu "der Mönch der seinen Ferrari verkaufte" schickt der Bestsellerautor Robin Sharma den Manager Jonathan Landry auf eine abenteuerliche Reise rund um den Globus. Er ist der Neffe von Julian Mantle, jenem Mönch, der die Strapazen des Star-Anwalt-Daseins gegen ein spirituelles Leben in der buddhistischen Tradition eingetauscht hat. Nun beauftragt dieser Jonathan, ein Leben zu retten. Die faszinierende Reise der Selbstfindung führt Jonathan auf der Suche nach neun Talismanen von den Händlern am Bosporus zu den Hummerfischern nach Kanada, von einem Mönchsorden in Indien zu einem Geschäftsmann in Shanghai, von einem Architekturwunderin Barcelona zu den buddhistischen Tempeln von Kyoto und an andere mystische Orte – bis Jonathan begreift, dass es sein eigenes Leben ist, das er damit rettet … Eine Geschichte voller Weisheit, über den Buddhismus, das wahre Glück und die Rückkehr zu sich selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Robin Sharma
Die geheimen Briefe des Mönchs, der seinen Ferrari verkaufte
Aus dem Englischen von Hans Freundl
Knaur e-books
Über dieses Buch
Robin Sharmas neuester Geniestreich ist ein spirituelles Roadmovie, das an Elizabeth Gilberts »Eat Pray Love« erinnert, nur dass die Hauptfigur diesmal ein Mann ist: Jonathan, der Neffe von Julian Mantle, jenem Mönch, der seinen Ferrari verkaufte. Als der krank und alt wird, schickt er Jonathan auf eine Abenteuertour rund um den Globus – mit dem Auftrag, ein Leben zu retten. Die faszinierende Reise führt Jonathan von den Händlern am Bosporus zu den Hummerfischern nach Cape Breton Island in Kanada, von einem Mönchsorden in Indien zu einem Geschäftsmann in Shanghai, von einem Architekturwunder in Barcelona zu den buddhistischen Tempeln von Kyoto und an andere mystische Orte – bis Jonathan begreift, dass es sein eigenes Leben ist, das er damit rettet …
Inhaltsübersicht
»Geh, so weit du sehen kannst.
Wenn du dort angekommen bist,
kannst du weiter sehen.«
Thomas Carlyle
Prolog
Mein Führer ging stumm vor mir her, als behage es auch ihm nicht, hier unten zu sein. Im Tunnel war es feucht, und er war nur schwach beleuchtet. Die Gebeine von sechs Millionen Parisern ruhten hier in der Erde …
Plötzlich blieb der junge Mann vor dem Eingang zu einem weiteren Tunnel stehen. Er war durch ein kleines rostiges Eisengitter von dem Tunnel abgetrennt, aus dem wir kamen. Dieser Tunnel war dunkel. Mein Führer schob das Gitter zur Seite und machte ein paar Schritte in die Dunkelheit. Dann blieb er stehen und schaute zu mir zurück, um sich zu vergewissern, dass ich ihm folgte. Ich trat unsicher aus dem matten Licht heraus, als sein Rücken vor mir verschwand. Ich ging ein paar Schritte weiter. Da stieß mein Fuß gegen irgendetwas. Ein dumpfes Scheppern erfüllte die Luft, und ich erstarrte. Zugleich wurde es hell um mich herum. Mein Führer hatte seine Taschenlampe eingeschaltet. Plötzlich wünschte ich, er hätte es nicht getan. Die schaurige Geordnetheit war verschwunden. Überall lagen Knochen – sie waren über den Boden verstreut, lagen zwischen unseren Füßen und waren an der Mauer in ungeordneten Stapeln aufgehäuft. Das Licht der Taschenlampe verfing sich in Staubwolken und Spinnweben, die von der Decke herabhingen.
»Ça c’est pour vous«, sagte mein Führer. Er warf mir die Taschenlampe zu. Als ich sie auffing, trat er schnell hinter mich.
»Was –«, rief ich.
Bevor ich meine Frage zu Ende bringen konnte, sagte der Mann: »Il vous rencontrera ici.« Dann war er verschwunden und ließ mich allein hier zurück, fünfzehn Meter unter der Erde, ein einsamer, verlassener Mensch inmitten einem Meer von Toten.
Kapitel 1
Es war einer jener Tage, von denen man sich wünscht, sie wären schon vorbei, kaum dass sie zehn Minuten alt sind. Es begann, als ich meine Augen aufschlug und feststellte, dass beunruhigend viel Sonnenlicht durch die Fensterläden des Schlafzimmers drang. Jene Menge an Sonnenlicht, die für 8 Uhr morgens typisch ist – nicht für 7 Uhr morgens. Mein Wecker hatte nicht geläutet. Dieser Erkenntnis folgte ein zwanzigminütiges Schimpfen und Heulen (das Heulen besorgte mein sechs Jahre alter Sohn), als ich durch das Haus hetzte, vom Bad in die Küche und zur Haustür, und dabei versuchte, all die lächerlichen kleinen Dinge zusammenzuraffen, die Adam und ich für den Rest dieses Tages benötigen würden. Als ich eine Dreiviertelstunde später mit dem Wagen an seiner Schule ankam, warf mir Adam einen vorwurfsvollen Blick zu.
»Mami hat gesagt, wenn du mich am Montag zu spät zur Schule bringst, werde ich Sonntagabend nicht mehr zu Hause verbringen dürfen.«
Junge, Junge!
»Das war das letzte Mal, ich verspreche es.«
Adam stieg mit einem zweifelnden Gesichtsausdruck aus dem Auto.
»Hier«, sagte ich und reichte ihm einen prall gefüllten Plastikbeutel. »Vergiss dein Pausenbrot nicht.«
»Behalte es«, erwiderte Adam, ohne mich anzuschauen. »Ich darf keine Erdnussbutter in die Schule mitbringen.«
Darauf drehte er sich um und rannte über den leeren Schulhof. Das arme Kind, dachte ich, während ich beobachtete, wie er mit seinen kurzen Beinen auf die Eingangstür zulief. Nichts ist schlimmer, als zu spät zur Schule zu kommen, wenn alle anderen schon da sind und die Nationalhymne durch die Gänge hallt. Und dann auch noch kein Pausenbrot dabeizuhaben.
Ich warf den Plastikbeutel auf den Beifahrersitz und seufzte. Ein weiteres »Betreuungswochenende« hatte ein unrühmliches Ende gefunden. Ich hatte als Ehemann eklatant versagt. Und jetzt schien es, als würde ich auch als getrennt lebender Vater auf ähnlich grandiose Weise scheitern. Nachdem ich Adam abgeholt hatte, reihte sich anscheinend eine Enttäuschung an die andere. Obwohl ich die ganze Woche, wenn Adam nicht da war, das Gefühl hatte, mir würde etwas Wichtiges fehlen, verspätete ich mich am Freitag regelmäßig. Die versprochene Pizza und der Kinobesuch wurden vergällt durch das Thunfisch-Sandwich, das Annisha Adam mittags zu essen gab. Und dann war da noch mein Telefon, das unaufhörlich piepste, als habe es einen schlimmen Schluckauf. Es läutete im Kino und wenn ich Adam zu Bett brachte. Es läutete beim Frühstück, bei dem wir leicht angebrannte Pfannkuchen verzehrten, und wenn wir im Park spazieren gingen. Es läutete, wenn wir uns Hamburger holten, und es läutete die ganze übrige Zeit. Natürlich war das Läuten nicht das eigentliche Problem. Das bestand darin, dass ich jedes Mal darauf reagierte. Ich überprüfte meine Kurznachrichten; ich verschickte Antworten; ich telefonierte. Und mit jeder Unterbrechung wurde Adam ein wenig stiller, ein wenig distanzierter. Es brach mir das Herz, doch der Gedanke, das Ding einfach zu ignorieren oder es abzuschalten, trieb mir den Schweiß auf die Stirn.
Während ich zur Arbeit raste, dachte ich über das verkorkste Wochenende nach. Als Annisha angekündigt hatte, dass sie eine Trennung auf Probe wünsche, fühlte ich mich, als habe mich gerade ein Lastwagen angefahren. Sie hatte sich seit Jahren darüber beklagt, dass ich nie Zeit für sie und Adam fand; dass ich viel zu sehr von meiner Arbeit in Beschlag genommen werde; dass ich viel zu sehr mit meinem eigenen Leben beschäftigt sei, um auch an ihrem teilhaben zu können.
»Aber wie soll das besser werden, wenn du mich verlässt?«, fragte ich. »Wenn du häufiger mit mir zusammen sein möchtest, warum sorgst du dann dafür, dass du mich künftig noch seltener siehst?«
Immerhin hatte sie gesagt, dass sie mich nach wie vor liebe. Und dass sie wolle, dass ich weiterhin ein gutes Verhältnis zu meinem Sohn pflege.
Doch als ich schließlich in eine eigene Wohnung umzog, war ich verletzt und verbittert. Ich hatte versprochen, ich würde künftig versuchen, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Ich hatte sogar Einladungen zu einem Golfturnier und zu einem Essen mit Geschäftskunden abgelehnt. Doch Annisha sagte, das seien alles nur Kinkerlitzchen – ich sei nicht ernsthaft dazu bereit, all die Dinge abzustellen, die falsch liefen. Jedes Mal, wenn ich an diese Worte dachte, knirschte ich mit den Zähnen. Verstand Annisha denn nicht, wie sehr mich meine Arbeit forderte? Konnte sie nicht begreifen, wie wichtig es für mich war, beruflich voranzukommen? Wenn ich nicht so viel gearbeitet hätte, dann hätten wir uns unser großes Haus, die Autos und die eindrucksvollen Großbildfernseher nicht leisten können. Gut, ich gebe zu, Annisha machte sich nichts aus den Fernsehern. Aber trotzdem!
Ich nahm mir vor: Ich werde ein erstklassiger »getrennter Vater« sein. Ich werde Adam meine Aufmerksamkeit schenken; ich werde zu allen schulischen Anlässen erscheinen; ich werde mir die Zeit nehmen, ihn ins Schwimmbad oder zum Karate zu fahren; ich werde ihm Bücher vorlesen. Wenn er abends anruft, werde ich alle Zeit der Welt haben, um mit ihm zu reden. Ich werde mir seine Probleme anhören, ihm Ratschläge geben und mit ihm Spaß haben. Ich werde ihm bei den Hausaufgaben helfen, und ich werde sogar lernen, diese nervigen Videospiele mit ihm zu spielen, die er so mag. Ich werde ein wunderbares Verhältnis zu meinem Sohn aufbauen, auch wenn ein gutes Verhältnis zu meiner Frau nicht mehr möglich ist. Und ich werde Annisha beweisen, dass ich nicht irgendwelche »Kinkerlitzchen« mache.
In den ersten Wochen nach der Trennung kam ich ganz gut zurecht. In mancherlei Hinsicht war es gar nicht so schwer. Doch es schockierte mich, wie sehr ich die beiden vermisste. Ich wachte in meiner Wohnung auf und lauschte auf die schwache Stimme, von der ich wusste, dass sie nicht da war. Ich lief am Abend in der Wohnung umher und dachte nach. Jetzt ist die Zeit, zu der ich eine Gutenachtgeschichte vorlesen würde. Jetzt würde ich Adam vor dem Einschlafen umarmen.Und das ist der Moment, in dem ich mich zu Annisha ins Bett kuscheln würde, der Moment, in dem ich sie in den Arm nehmen würde. Ich konnte die Wochenenden kaum erwarten.
Aber als die Monate verstrichen, begannen auch diese Gedanken zu verschwinden. Genauer gesagt, sie wurden durch etwas anderes verdrängt. Ich nahm mir jeden Abend Arbeit mit nach Hause oder blieb lange im Büro. Wenn Adam anrief, tippte ich auf meinem Computer weiter und hörte ihm nur flüchtig zu. Manchmal vergingen Wochen, ohne dass ich daran dachte, was er wohl den Tag über machte. Als die Schulferien begannen, wurde mir klar, dass ich gar keine freie Zeit für ihn eingeplant hatte. Dann sagte ich kurzfristig ein Geschäftsessen ab an jenem Abend, als in Adams Schule das Frühjahrskonzert stattfand. Ich vergaß auch, ihn zur halbjährlichen Zahnreinigung zu bringen, obwohl mich Annisha eine Woche vorher daran erinnert hatte. Und ich begann, am Freitag zu spät zu kommen. Das war wieder so ein Wochenende gewesen, das man nicht gerade als gelungen bezeichnen konnte.
Ich winkte dem Wachmann Danny kurz zu, als ich meinen Wagen auf den Firmenparkplatz lenkte. Nachdem ich mich so beeilt hatte, wünschte ich jetzt plötzlich, ich wäre nicht hier. Ich fuhr auf meinen Platz, stellte aber den Motor nicht ab.
Zu meiner Entschuldigung muss ich erwähnen, dass es für mich völlig natürlich war, mich so sehr in die Arbeit zu stürzen. Wir hatten damals eine besonders schwierige Situation in der Firma. Seit Monaten kursierte das Gerücht, wir sollten verkauft werden. Ich hatte die letzten zwölf Wochen mit nichts anderem verbracht, als Berichte und Aufstellungen zu verfassen: Verkaufsberichte, Bestandsverzeichnisse, Personalberichte, Gewinn-und-Verlust-Rechnungen. Wenn ich abends die Augen zumachte, sah ich die Zeilen und Spalten von Tabellen vor mir. Das erwartete mich in dem Gebäude, aber ich konnte es nicht länger hinauszögern. Ich stellte den Motor ab, griff mir meine Laptop-Tasche und ging hinein.
Ich begrüßte Devin, unseren Mann am Empfang. Er beugte den Kopf konzentriert über seinen Computerbildschirm, aber ich wusste, dass er Solitär spielte. Als ich nach rechts abbog, sah ich aus den Augenwinkeln, dass Devin grinste, aber vielleicht bildete ich mir das auch nur ein. Der kürzeste Weg zu meinem Büro führt über die linke Seite, aber diesen benutzte ich schon länger nicht mehr. Devin dachte offensichtlich, dies habe damit zu tun, dass Tessas Schreibtisch auf der rechten Seite liegt. Doch das war nur ein zusätzliches Bonbon. Wenn ich nach rechts ging, musste ich nicht an Juans Büro vorbei. Juan. Verdammt. Ich weiß nicht, warum mir diese Sache nach all der Zeit noch immer so nahegeht. Das Büro wurde jetzt nicht mehr benutzt. Die Jalousien waren herabgelassen, der Schreibtischstuhl war leer. Auf dem Aktenschrank standen keine Bilder von Juans Frau und Kindern mehr, der Beistelltisch war frei von Kaffeetassen, und an den Wänden hingen keine Tafeln mehr. Doch es war, als liege der Schatten all dieser Dinge noch immer über dem leeren Raum.
Ich verlangsamte meine Schritte, als ich mich Tessas Arbeitsplatz näherte. Tessa und ich arbeiteten schon seit mehreren Jahren zusammen. Wir waren immer gut miteinander ausgekommen – wir hatten denselben Sinn für Humor. Ich war mir nicht sicher, wie es mit mir und Annisha weitergehen würde, aber ich musste zugeben, dass ich seit der Trennung häufiger an Tessa gedacht hatte.
Ich entdeckte ihr schwarzes Haar, aber sie telefonierte gerade. Daher ging ich weiter.
Kaum hatte ich die Tür zu meinem Büro hinter mir geschlossen, lief alles wieder wie gehabt. Ich überlegte, ob ich mir den neuen Prototyp ansehen sollte, bevor ich mich den dringenderen Aufgaben widmete. Ich wusste, dass das Konstruktionsteam mich über jede neue Entwicklung auf dem Laufenden halten würde, doch der Gedanke, mich ein paar Minuten im Labor abzulenken, war verführerisch.
Im Konstruktionslabor hatte ich angefangen. Einen meiner ersten Jobs hatte ich in der Entwicklungsabteilung dieser Firma bekommen, eines Autoteile-Herstellers. Es war mein Traumjob. Juan, der technische Direktor, hatte mich von Anfang an unter seine Fittiche genommen. Juan war mein Mentor.
Aber selbst wenn man seinen Job liebt, kann man nicht ständig am selben Fleck bleiben. Das ist ein Karrierekiller. Doch das brauchte mir niemand zu sagen. Ich war wie ein Hund, der so eifrig mit dem Schwanz wedelt, dass er sich fast den Rücken verrenkt. Auch meinen Vorgesetzten entging das nicht. Als mir angeboten wurde, in der Firmenhierarchie eine Stufe höher zu klettern, rief mich Juan zu sich ins Büro.
»Du weißt«, sagte er, »wenn du diese Position annimmst, wirst du mit Forschung und Entwicklung nichts mehr zu tun haben. Du wirst verkaufen und Managementaufgaben übernehmen. Willst du das?«
»Ich will vorwärtskommen, Juan«, erwiderte ich und lachte. »Und ich werde damit bestimmt nicht warten, bis du in den Ruhestand gehst.«
Juan schenkte mir nur ein schwaches Lächeln, sagte aber nichts.
Nach diesem ersten Karriereschritt stieg ich rasch weiter auf. Bald war ich verantwortlich für alle unsere Projekte und Produktentwicklungen für einen unserer wichtigsten Kunden.
Ich griff mir meine Kaffeetasse und wollte durch die Eingangshalle zum Labor gehen, aber dann blieb ich stehen. Es war nicht notwendig, dass ich dorthin ging. Ich stellte meine Kaffeetasse ab und setzte mich in meinen Schreibtischsessel. Ich schaltete meinen Computer ein, öffnete einen Ordner und richtete meine Augen auf das Zahlengewirr, das meinen Bildschirm ausfüllte.
Einige Stunden später hatte ich eine weitere Gewinn-und-Verlust-Rechnung erstellt und wollte mich gerade meinem überquellenden Posteingang zuwenden, als das Telefon läutete. Ich brauchte ein paar Sekunden, bis ich die Stimme meiner Mutter erkannte. Sie klang aufgeregt. Gütiger Himmel, dachte ich. Was ist denn jetzt schon wieder los? Meine Mutter hatte in den letzten Monaten ungewöhnlich viel Interesse an meinem Leben gezeigt. Das fing an, mich allmählich zu nerven.
»Tut mir leid, dass ich dich bei der Arbeit störe, Jonathan, aber es ist wichtig«, sagte sie. »Ich habe gerade mit Cousin Julian gesprochen. Er muss dich sofort sehen. Es ist dringend.«
Mich?, dachte ich. Warum um alles in der Welt will Julian mich sehen?
Offen gesagt, ich kannte Julian kaum. Er war nicht mein Cousin, sondern der Cousin meiner Mutter. Sie hatte ein enges Verhältnis zu Julian und dessen Schwester Catherine gepflegt, als sie alle noch klein gewesen waren, aber ich war in einem anderen Teil des Landes aufgewachsen. Entfernte Verwandte waren für mich so interessant wie die Zeitung der vergangenen Woche.
Bei meiner ersten und bisher einzigen Begegnung mit Julian war ich ungefähr zehn Jahre alt gewesen. Wir besuchten Catherine, die uns zum Essen in ihr Haus eingeladen hatte. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob auch Julians Frau anwesend war, oder ob sie damals schon geschieden waren. Um ehrlich zu sein, ich kann mich kaum an diesen Besuch erinnern, nur an eine Sache: an Julians feuerroten Ferrari. Catherine hatte davon gesprochen, und daher wartete ich auf der Treppe vor dem Haus, bis er die Zufahrt herauffuhr. Das Auto war noch prachtvoller, als ich es mir vorgestellt hatte. Julian sah, was ich für ein Gesicht machte (meine Kinnlade fiel anscheinend bis zu meinen Schuhen herunter), und lud mich zu einer kleinen Spritztour ein. Ich war noch nie in einem Auto gesessen, das so schnell fuhr. Mir kam es vor, als würden die Räder jeden Augenblick von der Straße abheben, so dass wir in der Luft schwebten. Ich glaube, ich habe während der gesamten Fahrt nicht ein Wort gesagt. Als wir wieder zum Haus zurückkamen, stieg Julian aus, aber ich rührte mich nicht von der Stelle.
»Willst du noch eine Weile im Auto sitzen bleiben?«, fragte er.
Ich nickte. Er wandte sich zum Gehen, aber ich hielt ihn auf.
»Cousin Julian?«
»Ja«, sagte er.
»Woher hast du dieses Auto?«, fragte ich. »Ich meine … das muss doch sehr viel Geld gekostet haben?«
»Das stimmt«, erwiderte er. »Wenn du auch einmal ein solches Auto haben willst, Jonathan, musst du sehr, sehr hart arbeiten, wenn du einmal groß bist.«
Das habe ich nie vergessen.
Wie ich mich erinnere, blieb Julian nach dem Essen nicht lange – Mutter und Cousine Catherine schienen enttäuscht, vielleicht sogar ein bisschen verärgert. Obwohl ich erst zehn Jahre alt war, konnte ich mir vorstellen, dass Julian wesentlich interessantere Orte kannte. Er führte jenes Leben, das auch ich führen wollte, wenn ich älter war. Ich beobachtete neidisch, wie Julians fabelhafter Sportwagen zur Straße hinunterrollte.
Nachdem meine Mutter jahrelang nicht mehr von Julian gesprochen hatte, erwähnte sie seinen Namen nun jedes Mal, wenn wir uns trafen. Vor kurzem hatte sie mir erzählt, dass es den Ferrari schon lange nicht mehr gab. Cousin Julian hatte anscheinend nach irgendeinem Erlebnis sein Leben gründlich verändert. Er hatte seinen höchst einträglichen Beruf als angesehener Rechtsanwalt an den Nagel gehängt, den Ferrari verkauft und sich einem »einfachen« Leben zugewandt. Mutter erzählte mir, dass er bei einer weitgehend unbekannten Gruppe von Mönchen, die tief im Himalaja lebten, Studien absolviert habe und dass er neuerdings häufig purpurrote Gewänder trage. Sie sagte, er sei ein völlig anderer Mensch geworden. Ich verstand nicht recht, warum sie das für eine gute Sache hielt.
Und sie hatte versucht, uns beide zusammenzubringen. Sie hatte mir vorgeschlagen, ich solle mir etwas Zeit reservieren, um ihn zu besuchen, wenn ich geschäftlich in seiner Stadt zu tun hätte. Aber, offen gesagt, wenn ich nicht einmal genug Zeit für Annisha und Adam aufbringen konnte, warum sollte ich mir dann einen Tag freinehmen, um ihn mit einem Mann zu verbringen, den ich kaum kannte? Außerdem, wenn er noch immer ein erfolgreicher Anwalt mit einem glamourösen Lebensstil und einem tollen Flitzer gewesen wäre, hätte ich darin eher einen Sinn erkennen können. Warum jedoch sollte ich meine Zeit für einen beschäftigungslosen alten Mann opfern, der keinen Ferrari mehr besaß? In meiner Stammkneipe gab es Leute wie ihn zuhauf.
»Mutter«, sagte ich, »wovon redest du? Warum will Julian mich sehen?«
Mutter wusste nichts Näheres. Sie sagte, Julian wolle mit mir sprechen. Er brauche in irgendeiner Sache meine Hilfe.
»Das ist verrückt«, erwiderte ich. »Ich habe Cousin Julian seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich kenne den Mann kaum. Es gibt bestimmt auch noch andere Leute, die ihm helfen können.«
Mutter erwiderte nichts, aber ich glaubte zu hören, dass sie leise schluchzte. Die letzten Jahre, seit mein Vater gestorben war, waren sehr schwierig für sie gewesen. »Mutter«, sagte ich, »geht’s dir gut?«
Sie schniefte ein wenig, aber dann redete sie in einem eiskalten Ton weiter, den ich von ihr gar nicht kannte.
»Jonathan, wenn du mich liebst, dann mache es. Du sollst alles tun, was Julian von dir verlangt.«
»Aber was …« Ich bekam keine Gelegenheit, meine Frage zu stellen.
»Wenn du heute nach Hause kommst, wird ein Flugticket bei dir im Briefkasten liegen.« Sie fing einen weiteren Satz an, aber dann versagte ihre Stimme. »Jonathan, ich muss jetzt weg«, sagte sie noch und legte auf.
Den Rest des Tages fiel es mir schwer, mich zu konzentrieren. Der Anruf sah meiner Mutter überhaupt nicht ähnlich – ihre Eindringlichkeit und ihre Verzweiflung verunsicherten mich. Und zudem war alles ziemlich rätselhaft. Was um alles in der Welt wollte Julian von mir? Ich dachte darüber nach, wie er sein Leben umgekrempelt hatte. War er völlig durchgedreht? Würde ich auf einen verwirrten alten Zausel treffen, der von irgendwelchen verschwörerischen Machenschaften der Regierung faselte? Einen Typen mit wirren Haaren, der im Hausmantel und in Pantoffeln über die Straße schlurfte? (Ich wusste, dass Mutter das nicht gemeint hatte, als sie von »purpurroten Gewändern« sprach, aber ich wurde dieses Bild nicht mehr los.) Ich war so sehr mit diesen Gedanken beschäftigt, dass ich an Juans Büro vorbeiging, nachdem ich abends Schluss gemacht hatte. Erst als ich in die Eingangshalle kam, erkannte ich, was ich getan hatte. Es erschien mir als ein schlechtes Omen.
Zu Hause hätte ich fast vergessen, in den Briefkasten zu schauen. Ich fummelte ein paar Minuten mit dem verbogenen Schlüssel herum, dann sprang die kleine Metalltür auf, und Handzettel von Pizzadiensten und Werbeblätter für Versicherungsangebote verteilten sich über den Boden. Als ich sie aufhob, fand ich dazwischen einen dicken Umschlag. Er war von meiner Mutter. Ich seufzte, stopfte ihn in die Tasche und ging die Treppe hoch zu meiner Wohnung.
Ich schob eine tiefgekühlte Lasagne in die Mikrowelle und öffnete den Umschlag. Darin lagen eine kurze Notiz von meiner Mutter, in der sie mir mitteilte, dass Julian gegenwärtig in Argentinien lebe, und ein Flugticket nach Buenos Aires. Du meine Güte, dachte ich. Ich soll einen Zwölf-Stunden-Flug auf mich nehmen, um mich für ein oder zwei Stunden mit einem entfernten Verwandten zu treffen? Über das Wochenende? Toll. Ich würde das ganze Wochenende in einer fliegenden Sardinendose verbringen und deshalb meinem Sohn eine Enttäuschung bereiten müssen. Oder ich würde meine Mutter noch mehr verletzen müssen, nachdem es ihr ohnehin nicht besonders gutging.
Ich verzehrte meine lauwarme Lasagne vor dem Fernseher und hoffte, dass ein tüchtiger Schluck Scotch die Kargheit meiner Mahlzeit und meine Trübsal kaschieren würde.
Den Anruf bei Annisha schob ich so lange hinaus, bis ich sicher sein konnte, dass Adam im Bett war. Annisha hält sehr viel von festen, geregelten Abläufen, und daher wusste ich, was mich erwartete. Als sie sich meldete, klang sie müde, aber nicht gerade unglücklich. Ich machte mich darauf gefasst, dass ihre Stimmung gleich umschlagen würde, und berichtete ihr von meinen möglichen Plänen für das Wochenende. Doch Annisha wusste bereits Bescheid.
»Ich habe mit deiner Mutter gesprochen, Jonathan«, sagte sie. »Du musst das machen. Adam wird Verständnis dafür haben.«
Damit war die Sache entschieden.
Kapitel 2
Das Taxi bog von der Autobahn in einen außergewöhnlich breiten Boulevard ein. Er sah wie eine typische Schnellstraße in der Stadt aus: zu beiden Seiten von Bäumen gesäumt, mit einer grünen Insel, die den Gegenverkehr abtrennte, aber er war mindestens zehn Fahrspuren breit. Ich war zum ersten Mal in Südamerika und bemerkte überrascht, wie wenig sich Buenos Aires von einer europäischen Großstadt unterschied. Ein riesiger Obelisk, der dem Washington Monument ähnelte, teilte die Szenerie vor mir, doch die Gebäude an der Straße erinnerten mich ein wenig an Paris.
Julian hatte für mich einen Nachtflug am Freitagabend gebucht. Ich war überraschenderweise während des Fluges eingeschlafen und wachte erst auf, als das Flugzeug zur Landung ansetzte. Jetzt war es Morgen, und ich befand mich in einer anderen Hemisphäre als in der, in der ich eingeschlafen war.
Die Bauten im Stil der Belle Époque, die Balkongeländer aus schwarzem Eisen und die Blumenkästen setzten sich während unserer Fahrt fort, aber schließlich kamen wir in eine Gegend, die etwas älter aussah, ein bisschen schäbiger und heruntergekommener. An den Wänden prangten Graffitis, von den Mauern bröckelte Putz ab, und die Farben der Markisen waren verblichen. Obwohl es ein kühler Herbsttag war, standen viele Fenster offen, und ich sah Vorhänge, die im Wind flatterten. An einer Straßenecke spielten Musiker vor einer kleinen Gruppe von Zuschauern.
Das Taxi wurde langsamer und hielt schließlich vor einer Hausfront. Auf dem Schild im Fenster wurden Tango-Stunden angeboten. Aus der halboffenen Haustür drang Musik. Ich überprüfte noch einmal die Adresse, die mir Julian gegeben hatte. Anscheinend waren wir bei diesem Tanzstudio richtig. Ich zeigte dem Taxifahrer das Stück Papier, um mich zu vergewissern, dass wir im richtigen Teil der Stadt und nicht irgendwo anders gelandet waren. Er nickte und zuckte die Schultern. Ich zahlte und stieg aus.
Na toll, dachte ich und spähte durch die halboffene Tür. Es war kein Scherz, als Mutter sagte, Julian habe sein Leben verändert.
Der Raum war breit, aber nicht tief. Die Wände erstrahlten in kräftigem Rot, und Lüster aus Glas hingen von der Decke herab. Männer und Frauen, die sich eng umfasst hielten, aber dennoch eine gewisse Förmlichkeit wahrten, bewegten sich im Takt der pulsierenden Musik.
Während ich die Gruppe betrachtete, löste sich ein großer, modisch gekleideter Mann von seiner Tanzpartnerin und suchte sich einen Weg durch die Tänzer. Er lächelte, als er näher kam.
»Jonathan«, sagte er. »Ich freue mich, dass du gekommen bist.« Er streckte mir die Hand entgegen, und wir begrüßten uns.
Ich brauchte eine Weile, bis ich den Mann, der hier vor mir stand, mit dem Bild in Einklang bringen konnte, das ich während meiner Anreise im Kopf gehabt hatte. Julian sah wesentlich jünger aus als damals vor zwanzig Jahren bei unserer letzten Begegnung. Seine schlanke, muskulöse Figur hatte nichts mehr gemein mit jener dicklichen, aufgedunsenen Gestalt, die hinter dem Steuer des Ferraris gesessen war. Sein Gesicht wies keine Falten auf und blickte entspannt. Seine klaren blauen Augen schienen mich zu durchbohren.
»Entschuldige bitte«, sagte Julian und deutete mit der Hand in den Raum. »Ich war mir nicht sicher, wann dein Flugzeug ankommen würde, deshalb habe ich meinen Samstagskurs nicht ausfallen lassen. Aber jetzt wo du hier bist, lass uns gleich nach oben gehen.«
Julian führte mich zu einer Tür, die ich vom Eingang aus nicht gesehen hatte. Er öffnete sie und bedeutete mir, ihm die Treppe hinauf zu folgen. Oben angekommen, ging er an mir vorbei und öffnete eine weitere Tür. »Komm rein, komm rein«, sagte er, während er den Raum betrat.
Die Wohnung war hell und geräumig, sah aber ganz anders aus, als ich mir Julians Heim vorgestellt hatte. Das Mobiliar war eine eigenartige Mischung aus Alt und Neu. Plakate von Musikern und Tänzern schmückten die Wände, und auf dem Boden stapelten sich Bücher. Es ähnelte ein wenig einer Studentenbude.
»Ich möchte mich entschuldigen, dass du so kurzfristig diese weite Reise unternehmen musstest, aber ich lebe seit ein paar Monaten in dieser wunderbaren Stadt. Ein Freund suchte einen Untermieter für seine Wohnung, und da ich schon immer Tango lernen wollte, erschien mir das als die perfekte Gelegenheit. Ich will mich kurz umziehen, dann mache ich uns Kaffee.«
Julian verschwand über einen langen, schmalen Gang. Ich setzte mich in einen Sessel, auf dem eine Baumwolldecke lag; darin waren die Worte »Sei außergewöhnlich« eingestickt. Ich hörte die Tangomusik, die von unten heraufdrang, und spürte ein Vibrieren unter den Holzdielen.
Während ich auf Julian wartete, begannen meine Gedanken zu rasen. Was tat ich hier eigentlich? Was wusste ich über diesen Mann? Ich fühlte mich unbehaglich. Irgendwie spürte ich, dass sich mein Leben für immer verändern würde, sobald Julian ins Zimmer zurückkehrte. Ich spürte, dass das, was vor mir lag, schwierig und anstrengend sein würde. Ich muss das nicht machen, dachte ich. Ich warf einen Blick über die Schulter zur Tür und überlegte, wie lange ich brauchen würde, um ein Taxi zu finden. In diesem Augenblick kam Julian zurück.
Er trug ein langes purpurrotes Gewand. Die Kapuze umhüllte seinen Kopf.
»Tee oder Kaffee?«, fragte er, während er zu einer kleinen Küche am hinteren Ende des Wohnzimmers ging.
»Kaffee, bitte«, sagte ich.
Ich fühlte mich etwas unbehaglich allein in diesem Wohnzimmer. Also stand ich auf und folgte Julian in die Küche. Während er an der Kaffeemaschine hantierte, schaute ich aus dem Fenster, hinunter auf die schmale gepflasterte Straße. Die Tanzgruppe hatte sich anscheinend gerade aufgelöst, denn mehrere Paare strömten hinaus auf den Gehsteig. Verschiedene Stimmen und lautes Gelächter lösten die Musik ab.
Schließlich wandte ich mich an Julian. »Was …« Ich zögerte und versuchte, nicht allzu taktlos zu sein. Ich nahm einen neuen Anlauf. »Wozu brauchst du mich? Warum wolltest du mich sehen?«
»Jonathan«, erwiderte er und lehnte sich an die Anrichte. »Kennst du meine Geschichte?«
Ich wusste nicht recht, worauf Julian hinauswollte. Ich sagte, ich wisse von ihm, dass er Rechtsanwalt gewesen sei, einen Haufen Geld verdient und in Saus und Braus gelebt habe. Ich sagte, ich hätte gehört, dass er einen Sinneswandel durchgemacht und seine Kanzlei aufgegeben habe. Näheres allerdings wüsste ich nicht.
»Das ist richtig«, erwiderte Julian. »Irgendwann hatte ich mehr Erfolg, als ich mir jemals hätte träumen lassen – soweit es Geld und Ruhm betraf. Doch zugleich zerstörte ich mein Leben. Wenn ich nicht von der Arbeit in Beschlag genommen wurde, rauchte ich Zigarren, trank teuren Cognac und führte ein wildes Leben mit jungen Mädchen und neuen Freunden. Ich ruinierte meine Ehe, und mein Lebenswandel forderte seinen Tribut auf Kosten meiner Karriere. Ich befand mich in einer Abwärtsspirale, aber ich wusste nicht, wie ich sie hätte aufhalten sollen. Eines Tages, als ich in einem wichtigen Fall ein Plädoyer hielt, brach ich im Gerichtssaal zusammen. Ein Herzanfall.«
Plötzlich klingelte etwas bei mir. Wahrscheinlich hatte mir Mutter davon erzählt, aber ich hatte dieser Mitteilung keine große Aufmerksamkeit geschenkt.
Julian schlug die Kapuze zurück, griff ins Regal und holte zwei Tassen hervor.
»Ich brauchte Monate, bis ich wieder gesund wurde. In dieser Zeit traf ich eine Entscheidung.«
Ich seufzte. Das war wohl die Situation, in der der geliebte Ferrari abgestoßen wurde.
»Ich verkaufte meine Villa, mein Auto, meinen gesamten Besitz. Und ich ging nach Indien und hoffte, so viel wie möglich über die Weisheitslehren der Welt zu lernen. Statt mein Vermögen weiter zu mehren, interessierte ich mich mehr dafür, meinen Selbstwert zu entdecken. Und die Jagd nach schönen Frauen wurde durch die Suche nach dauerhaftem Glück ersetzt.«
Ich unterdrückte ein Stöhnen. Das klang nach dem Anfang einer langen Geschichte. Ich wollte endlich erfahren, was das alles mit mir zu tun hatte.
»Auf meinen Reisen tief in den Himalaja hatte ich das Glück, einen außergewöhnlichen Mann zu treffen. Er war ein Mönch, einer der Weisen von Sivana. Er nahm mich mit hinauf in die Berge, in ein Dorf, wo die Weisen lebten, studierten und arbeiteten. Sie vermittelten mir viele bemerkenswerte Dinge, die ich gerne an dich weitergeben möchte.«
Julian schwieg einen Augenblick und blickte auf meine Füße. Ich erkannte verlegen, dass ich mit dem Fuß gewippt hatte wie ein ungeduldiger Kunde im Kaufhaus.
Julian lächelte. »Doch ich merke, jetzt ist dafür nicht der richtige Zeitpunkt.«
»Entschuldige«, sagte ich. »Es ist nur so, ich möchte möglichst schnell wieder nach Hause.«
»Keine Sorge«, erwiderte Julian leise. »Eine Geschichte soll man nur erzählen, wenn sie ein Zuhörer wirklich hören will.«
»Du willst wissen, warum ich dich hierhergebeten habe?«, fügte Julian hinzu.
Ich nickte.
Der Kaffee war fertig. Julian füllte zwei Tassen. »Milch? Zucker?«
Ich schüttelte den Kopf. Julian reichte mir eine der Tassen und ging zurück ins Wohnzimmer. Nachdem wir uns gesetzt hatten, fuhr er mit seiner Geschichte fort.
»Zu den Dingen, die mich die Mönche gelehrt haben, gehört die Macht der Talismane.«
»Talismane?«, fragte ich.
»Kleine Statuen oder Amulette. Es gibt neun davon. Jeder Talisman repräsentiert eine grundlegende Weisheit bezüglich des Glücks oder eines gelingenden Lebens. Jeweils für sich sind sie lediglich symbolische Zeichen, aber zusammen besitzen sie außerordentliche umgestaltende Kräfte. Sie können tatsächlich lebensrettend sein.«
»Du musst ein Leben retten?«, fragte ich. Das alles klang ein wenig melodramatisch. Oder auch etwas verrückt.
»Ja. Jemand, den ich kenne, steckt in ernsthaften Schwierigkeiten. Andere Leute haben ihm bereits zu helfen versucht, doch ohne Erfolg. Das ist unsere letzte Möglichkeit.«
»Hat es irgendetwas mit meiner Mutter zu tun?«, wollte ich wissen. Sie hatte am Telefon sehr aufgeregt geklungen.
»Ja«, antwortete Julian. »Aber Genaueres darf ich nicht sagen.«
»Wenn meine Mutter krank ist oder sonst etwas mit ihr ist, habe ich das Recht, es zu erfahren.« Ich spürte ein beklemmendes Gefühl in der Brust, und mein Atem wurde flacher.
»Deine Mutter ist nicht in Gefahr«, erwiderte Julian. »So viel kann ich sagen.«
Ich wollte mehr aus ihm herausbekommen, ihm weitere Fragen stellen, doch Julian presste die Lippen zusammen und stellte seine Kaffeetasse auf den Tisch. Anscheinend wollte er das Gespräch beenden. Ich seufzte und schaute für eine Weile auf den Boden.
»Also gut«, sagte ich dann, »aber was hat das alles mit mir zu tun? Wofür brauchst du mich?«
Julian war aufgestanden und ging zum Fenster. Er blickte auf die Straße hinunter, doch seine Augen schienen in die Ferne gerichtet zu sein.
»Als ich das Dorf verließ«, begann Julian, »haben mir die Mönche die Talismane in einem Lederbeutel ausgehändigt und mich gebeten, ihr neuer Hüter zu werden. Nachdem ich den Himalaja verlassen hatte, reiste ich eine Zeitlang umher. Eines Nachts brach in dem kleinen Hotel, in dem ich abgestiegen war, ein Feuer aus. Ich war gerade nicht da, und mein Zimmer wurde vollständig zerstört. Ich trug die Talismane bei mir, daher verlor ich nur ein Paar Sandalen. In einer anderen Herberge erzählte mir ein Mitreisender, dass er in einer Seitenstraße in Rom ausgeraubt worden sei. Ich hatte den Eindruck, dass die Talismane, solange sie sich bei den Mönchen im Dorf befunden hatten, in Sicherheit gewesen seien. Ich war der einzige Besucher, der seit sehr langer Zeit an diesem abgelegenen Ort aufgetaucht war. Aber nachdem ich nun diese Kostbarkeiten besaß, waren sie in Gefahr. Sie konnten jederzeit verlorengehen, gestohlen oder vernichtet werden.«
Julian fuhr fort, er sei zu dem Schluss gekommen, dass es sicherer sei, jeden dieser Talismane einem anderen Hüter anzuvertrauen, der ihn wieder zurückgeben würde, wenn Julian ihn brauchte. Jedem der Gegenstände habe er einen Brief mit einer Darstellung der Bedeutung des jeweiligen Talismans beigefügt. Jetzt sei es so weit, und er müsse diese Talismane zurückbekommen. Er sagte, er wolle, dass ich sie für ihn abhole.
»Was?«, platzte ich heraus. »Dafür gibt es doch Paketdienste, oder?«
Julian lächelte. »Ich glaube, du hast noch nicht begriffen, wie wichtig diese Talismane sind. Ich kann sie nicht einem Kurierdienst oder der Post anvertrauen. Sie sind über die ganze Welt verstreut, und ich brauche jemanden, den ich kenne und der sie persönlich befördert.«
»Und warum kannst du nicht selbst fahren?«, fragte ich. Mir war klar, dass ich etwas unhöflich war, doch ich hatte noch immer das Bild von Julian vor Augen, wie er unten Tango getanzt hatte.
Julian kicherte. »Ich weiß, ich vermittle nicht den Anschein, dass ich besonders viel zu tun hätte«, sagte er und wurde ernster. »Aber es ist mir wirklich nicht möglich, das selbst zu erledigen.«
Ich schwieg ein paar Sekunden. »Nichts für ungut, aber du hast gesagt, du brauchst jemanden, den du kennst, der dir diese Dinge besorgen soll. Aber mich kennst du doch eigentlich gar nicht. Ich habe dich erst einmal gesehen – da war ich zehn Jahre alt.«
»Ich kenne dich besser, als du glaubst«, entgegnete Julian. Sein freundliches Lächeln war verschwunden. Seine Augen waren dunkel, und auf seinem Gesicht lag ein feierlicher Ausdruck, der mich beunruhigte.
»Hör mir zu, Jonathan«, sagte er ruhig. »Ich kann dir nicht sagen, woher ich das weiß, aber ich weiß es: Der einzige Mensch, der die Talismane besorgen kann, bist du.«
Er schwieg einen Moment, dann fuhr er fort: »Meine Antworten für dich sind sicher nicht sehr befriedigend, aber glaube es mir, Jonathan, wenn ich dir sage, dass es bei dieser Angelegenheit um Leben oder Tod geht.«
Wir saßen längere Zeit schweigend nebeneinander. Ich dachte daran, wie meine Mutter am Telefon geschluchzt hatte. Ich dachte an den leeren Platz auf der Seite des Bettes, wo Annisha gelegen hatte. Ich dachte an den Ausdruck in Adams Augen, als ich ihm eine Enttäuschung bereitet hatte. Es kommt nicht häufig vor, dass man »der Einzige« ist – der einzige Sohn, der einzige Ehemann, der einzige Vater.
Schließlich brach ich das Schweigen.
»Wie lange werde ich dafür brauchen?«, fragte ich.
»Ich habe sämtliche Hüter angeschrieben«, antwortete Julian. »Es haben sich noch nicht alle gemeldet, aber eine erste Adresse habe ich bereits für dich – einen Freund von mir in Istanbul. Was den zeitlichen Rahmen betrifft, nun, alle Talismane zu besorgen dürfte ein paar Wochen dauern. Vielleicht einen Monat.«
Gütiger Himmel. Das bedeutete, ich musste meinen ganzen Urlaub dafür verwenden – und noch mehr. Ich holte tief Luft. Julian blickte mich an und neigte den Kopf.
»Jonathan?«, fragte er.
Ich schaute ihn an. In seinen Augen lag eine unendliche Güte. Einen Augenblick lang erinnerte er mich an meinen Vater, und mir wurde klar, wie sehr mir mein Vater fehlte. Ich erkannte auch, dass ich bereits eine Entscheidung getroffen hatte. Die Worte blieben mir im Halse stecken, daher nickte ich nur.
Julian lächelte. Dann stand er auf und strich mit einer Hand über sein rotes Gewand.
»Gut, nachdem wir jetzt das Geschäftliche erledigt haben«, sagte Julian, »werde ich dir etwas zu essen machen, und dann können wir uns hier in der Gegend ein wenig umschauen. Das Viertel heißt San Telmo. Es ist zu einem meiner liebsten Plätze auf der Welt geworden.«
Ich verbrachte einen angenehmen, wenn auch eigenartigen Nachmittag mit Julian. Er führte mich zu einem Ballsaal einige Straßen weiter, wo routinierte Tangotänzer eine kleine Show veranstalteten. Die Musik pulsierte durch meinen Körper wie ein zweiter Herzschlag, und ich bemerkte, dass Julian mit den Füßen wippte. Seine Beine bewegten sich leicht, als vollführte er im Geiste selbst die Tanzschritte. Dann spazierten wir noch eine Zeitlang durch die verschlungenen Gassen, bis es Zeit für die Rückkehr war, damit ich noch rechtzeitig zum Flughafen kam. Als wir auf dem Gehsteig vor Julians Haus standen, drang Musik aus dem Studio und erfüllte die Luft um uns herum. Julian wandte sich zu mir.
»Eines noch, Jonathan«, sagte Julian. Er zog ein kleines in Leder gebundenes Notizbuch aus einer Tasche in seinem Gewand. »Ich möchte gerne, dass du ein Journal führst, wenn du unterwegs bist.«
»Ein Tagebuch?«, fragte ich. »Wofür?«
»Kein Tagebuch, Jonathan. Ein Journal. Die Talismane verleihen jenen Macht, die sie in der Hand halten. Aber auch jene, die sie besitzen, geben diesen Zeichen Macht. Es ist für mich wichtig, etwas über deine Gedanken und Gefühle auf dieser Reise zu erfahren – und darüber, was diese Talismane für dich bedeuten, wenn du unmittelbar mit ihnen zu tun hast.«
Ich ließ meine Schultern hängen. Ich wusste nicht, was schlimmer war – mehrere Wochen meines Lebens opfern zu müssen, um durch die Welt zu reisen und für jemand anderen ein paar Dinge zu besorgen, oder darüber schreiben zu müssen. Selbstreflexion war noch nie meine Stärke gewesen.
»Ich glaube, wenn du auf dich selbst gestellt bist, wenn du diese unfassbaren Talismane in den Händen hältst, wird es dir gar nicht mehr so schwerfallen, das aufzuschreiben, was dich bewegt«, sagte Julian.
Ich wollte schon erwidern: »Ja, gewiss«, aber dann bremste ich mich. Was spielte es denn für eine Rolle? Wenn ich mich auf diese verrückte Sache einließ, konnte ich es auch auf die Weise tun, die Julian wünschte.