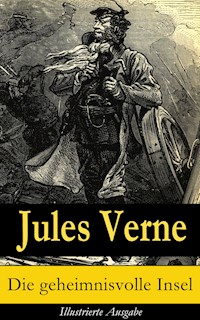
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Dieses eBook: "Die geheimnisvolle Insel - Illustrierte Ausgabe" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Diese Ausgabe enthält alle drei Bände und ist voll bebildert mit den Original-Illustrationen der Erstausgabe von 1875. Die geheimnisvolle Insel ist ein Roman des französischen Autors Jules Verne. Der Roman wurde erstmals 1874/75 von dem Verleger Pierre-Jules Hetzel unter dem französischen Titel L'Ile mystérieuse in drei Bänden veröffentlicht. Der erste Band trägt den Untertitel Les Naufragés de l'Air (Die Schiffbrüchigen des Luftmeeres), der zweite Band L'Abandonné (Der Verlassene) und der dritte Le Secret de l'Ile (Das Geheimnis). Die erste deutschsprachige Ausgabe erschien 1875/76 unter dem Titel Die geheimnißvolle Insel. Der englische Titel des Romans lautet The Mysterious Island. Der Roman erzählt die Geschichte des Ingenieurs Cyrus Smith, seines schwarzen Dieners Nab, des Kriegsberichterstatters Gideon Spilett, des Seemanns Pencroff, des Jungen Harbert und seines Hundes Top, die kurz vor Ende des amerikanischen Bürgerkriegs in einem Freiballon aus einem Kriegsgefangenenlager in Richmond (Virginia) fliehen. Die geheimnisvolle Insel ist einer der bekannteren Romane Jules Vernes. Das Buch kann als Fortsetzung seiner Romane 20.000 Meilen unter dem Meer und Die Kinder des Kapitän Grant gesehen werden, wobei es allerdings einige logische Ungereimtheiten gibt. So spielt die Handlung unmittelbar nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg, lange vor den Ereignissen in 20.000 Meilen unter dem Meer und Die Kinder des Kapitän Grant.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 952
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die geheimnisvolle Insel - Illustrierte Ausgabe
Inhalt
Erster Theil. - Die Schiffbrüchigen des Luftmeers.
Erstes Capitel.
»Steigen wir wieder?
– Nein. Im Gegentheil, wir gehen herab.
– Noch schlimmer, Herr Cyrus? Wir – fallen!
– Herr Gott! So werfen Sie Ballast aus.
– Da ist der letzte schon entleerte Sack.
– Erhebt sich der Ballon?
– Nein!
– Ich höre etwas wie Wellengeplätscher.
– Unter der Gondel ist das Meer.
– Und höchstens fünfhundert Fuß unter uns!«
Da schallte eine mächtige Stimme durch die Luft und erklangen die Worte:
»Alles, was ein Gewicht hat, hinaus damit! … Alles! Und dann sei Gott uns gnädig!«
Dieser Zuruf verhallte am 23. März 1865 gegen vier Uhr Nachmittags über der Wasserwüste des Pacifischen Oceans in den Lüften.
Gewiß hat noch Niemand den verheerenden Nordoststurm vergessen, der zur Zeit der Frühlingsäquinoctien jenes Jahres ausbrach, und welchen ein Sinken des Barometers bis auf 710mm begleitete. Unausgesetzt wüthete jener vom 18. bis zum 24. März.
In Europa, Asien und Amerika richtete er in einem 1800 Meilen breiten, den Aequator schief durchschneidenden Striche von 35° nördlicher bis zu 40° südlicher Breite ungeheure Verwüstungen an. Zerstörte Städte, aus dem Boden gerissene Wälder, durch darüber gestürzte Wogenberge verheerte Ufer, gescheiterte Schiffe, welche das Bureau Veritas nach Hunderten zählte, ganze, durch Wasserhosen nivellirte Landstrecken, Tausende von Menschen, die auf dem Lande umkamen, oder vom Meere verschlungen wurden, – das waren die traurigen Spuren, welche dieser wüthende Orkan auf seinem Wege hinterließ. An Zahl der Unfälle übertraf er noch jene, die über Habana und Guadeloupe, der eine am 25. October 1810, der andere am 26. Juli 1825, hereinbrachen.
Während dieser vielfachen Katastrophen auf dem Lande und dem Meere spielte sich auch in den wildbewegten Lüften ein ergreifendes Drama ab.
Von dem Gipfel einer Trombe gleich einer Kugel auf dem Fontainenstrahle getragen und von der wurmförmigen Bewegung der Luftmassen erfaßt, flog ein Ballon in fortwährender Drehung um sich selbst mit der rasenden Schnelligkeit von neunzig Meilen in der Stunde (= 46 Meter in der Secunde oder 166 Kilometer in der Stunde) durch den unendlichen Raum dahin.
Unter demselben schaukelte eine Gondel mit fünf Insassen, die inmitten der dichten mit Wasserstaub vermengten Dünste, welche über den Ocean dahinjagten, kaum sichtbar war.
Woher kam dieses Luftschiff, dieser Spielball des entsetzlichen Sturmes? An welchem Punkte der Erde war es aufgestiegen? Während des Orkans selbst konnte es doch nicht wohl abgegangen sein, denn jener währte schon fünf Tage lang an und gingen seine ersten Anfänge bis auf den 18. März zurück. Gewiß mußte der Ballon von sehr weit herkommen, da er binnen vierundzwanzig Stunden mindestens 2000 Meilen zurücklegte.
Jedenfalls stand den Passagieren kein Hilfsmittel zu Gebote, den seit ihrer Abreise zurück gelegten Weg abzuschätzen, da ihnen jedes Merkzeichen dafür abging. Ja, sie befanden sich sogar in der sonderbaren Lage, von dem Sturme, der sie entführte, nicht das Geringste gewahr zu werden. Sie flogen eben weiter, drehten sich um sich selbst und bemerkten weder etwas von der Drehung, noch von ihrer horizontalen Fortbewegung, da ihr Blick die dichten Nebelmassen, die sich unter der Gondel zusammen ballten, nicht zu durchdringen vermochte. Die Dunkelheit der umgebenden Wolken war eine so große, daß sie nicht einmal Tag und Nacht unterscheiden ließ. So lange sie in hohen Luftschichten dahin schwebten, traf sie kein Lichtstrahl, drang kein Geräusch von der bewohnten Erde, kein Rauschen des empörten Meeres bis zu ihnen hinaus. Nur ihr schneller Fall sollte sie über die Gefähren belehren, die ihnen über den Wassern drohten.
Von allen schwerwiegenden Gegenständen, wie Waffen, Munition, Lebensmitteln etc. entlastet, stieg der Ballon 4500 Fuß in die höheren Luftschichten auf. Nachdem sie das Meer unter ihrer Gondel gesehen, hielten sich die Passagiere in der Höhe für weit weniger gefährdet als in der Tiefe, zauderten keinen Augenblick, auch die sonst nützlichsten und nothwendigsten Gegenstände über Bord zu werfen und achteten nur darauf, kein Atom von der Seele ihres Fahrzeugs, dem Gase, zu verlieren, das sie über dem Abgrunde schwebend erhielt.
Voll Unruhe und Angst verstrich die Nacht, welche für minder energische Geister tödtlich gewesen wäre. Dann kam der Tag wieder und gleichzeitig schien die Wuth des Sturmes nachzulassen. Mit der Morgenröthe des 24. März hoben sich die durchsichtiger gewordenen Wolkenmassen; nach wenigen Stunden zerriß die Trombe. Der Wind verwandelte sich aus einem Orkan in eine »steife Brise«, d.h. seine Schnelligkeit verminderte sich etwa um die Hälfte. Noch hätte man ihn zwar mit dem Seemannsausdrücke einer »drei Reffbrise« bezeichnen können, immerhin ließ der Kampf der Elemente aber recht fühlbar nach.
Gegen elf Uhr hatten sich die unteren Luftschichten vollkommen aufgehellt. Die Atmosphäre zeigte jene nach stärkeren meteorischen. Erscheinungen gewöhnliche sicht-und fühlbare feuchte Durchsichtigkeit. Der Orkan schien nicht weiter nach Westen gereicht zu haben, sondern in sich selbst zu Grunde gegangen zu sein. Wahrscheinlich endete er nach dem Bruche der Trombe in elektrischen Entladungen, wie es auch von den Typhons des Indischen Meeres bekannt ist.
Zu derselben Zeit ward man aber auf’s Neue gewahr, daß der Ballon langsam zu den unteren Luftschichten herabsank. Es schien sogar, als falle er zusammen und zöge sich seine Hülle in die Länge, mit Uebergang aus der Form der Kugel in die eines Eies. Gegen Mittag schwebte das Luftschiff kaum noch 2000 Fuß über dem Meere. Jenes faßte 50,000 Cubikfuß1 und konnte sich, Dank seiner Capacität, sowohl lange Zeit in der Luft halten, als auch sehr bedeutende Höhen erreichen.
Die Passagiere warfen nun die letzten Gegenstände aus, welche die Gondel beschwerten, einige bis hierher aufbewahrte Nahrungsmittel, Alles, bis auf die Kleinigkeiten, die man in den Taschen zu tragen pflegt. Einer von ihnen war in den Ring geklettert, an den die Fäden des Netzes geknüpft sind, und suchte dieses Anhängsel des Luftschiffes möglichst verläßlich zu befestigen.
Landung auf dem Eiland. (S. 12.)
Augenscheinlich vermochten die Passagiere den Ballon nicht mehr in der Höhe zu erhalten, und fehlte es ihnen an Gas.
Sie waren so gut wie verloren!
Kein Festland, keine rettende Insel erhob sich aus dem Wasser, kein Landungsplatz, an dem der Anker hätte haften können.
Unter ihnen dehnte sich nur das unendliche Meer, dessen Wogen sich mit schrecklichem Ungethüm dahin wälzten, – der Ocean ohne sichtbare Grenzen, nicht einmal für jene Umschauer in der Höhe, deren Blicke einen Umkreis von vierzig (englischen) Meilen nach jeder Seite hin beherrschten! – Es war jene vom Orkane ohne Erbarmen gepeitschte Wasserwüste, die ihnen wie eine wilde Jagd entfesselter Wellen erschien, auf deren Rücken weiße Kämme schäumten. Kein Land war in Sicht, kein hilfeversprechendes Fahrzeug!
Um jeden Preis mußte also dem Niedersinken des Ballons Einhalt gethan werden, um dem Untergange in den Wogen zu entgehen. Dieses so dringliche Vorhaben beschäftigte eben die Insassen der Gondel. Trotz aller Bemühungen fiel der Ballon aber mehr und mehr und trieb gleichzeitig mit dem Winde von Nordosten nach Südwesten in rasender Schnelligkeit dahin.
Es war eine schreckliche Lage, in der sich die Unglücklichen befanden. Nicht mehr Herren ihres Luftschiffes, stand ihnen auch kein wirksames Hilfsmittel zu Gebote. Die Hülle des Ballons schwoll mehr und mehr ab; das Gas entwich durch dieselbe. Sichtbar beschleunigte sich der Fall, und kaum sechshundert Fuß trennten die Gondel noch vom Oceane.
Das Entweichen der Füllung, die durch einen Riß des Aerostaten ausströmte, war aber nicht zu hindern.
Durch Erleichterung der Gondel hatten die Passagiere sich zwar noch etwas länger in der Luft halten können, aber doch nur um einige Stunden. Die unvermeidliche Katastrophe war eben nicht abzuwenden, und im Fall vor Eintritt der Nacht kein rettendes Land auftauchte, mußten Passagiere, Gondel und Ballon ihren Untergang finden.
Eine einzige Hilfe gab es noch, und zu dieser griff man in diesem Augenblicke. Offenbar waren die Passagiere des Luftschiffes energische Leute, die dem Tode unerschüttert in’s Auge sahen. Kein Laut drängte sich über ihre Lippen. Sie hatten beschlossen, bis zum letzten Athemzuge zu kämpfen und nichts unversucht zu lassen, um ihren Fall aufzuhalten. Die nur aus Korbweidengeflecht bestehende Gondel war untauglich zu schwimmen, und hätte auf keine Weise über Wasser gehalten werden können.
Um zwei Uhr schwebte das Luftschiff kaum noch vierhundert Fuß über den Wellen.
Da erschallte eine Stimme, die eines Mannes, dessen Herz keine Furcht kannte; ihr antworteten nicht minder entschlossene Stimmen:
»Ist Alles ausgeworfen?
– Nein! Noch sind 10,000 Francs in Gold hier.«
Sofort fiel ein schwerer Sack in’s Meer.
»Steigt der Ballon?
– Ein wenig, er wird bald genug wieder sinken.
– Was können wir weiter über Bord werfen?
– Nichts!
– Doch! – Die Gondel selbst!
– Schnell Alle in die Stricke und die Gondel in’s Meer!«
In der That lag hierin das äußerste Mittel, den Aerostaten zu entlasten.
Die Stricke zwischen der Gondel und dem Ring wurden durchschnitten, und noch einmal schoß der Ballon zu einer Höhe von 2000 Fuß empor
Die fünf Passagiere hingen in den Schnüren oberhalb des Ringes und hielten sich an den Netzmaschen über der entsetzlichen Tiefe.
Das so empfindliche Bestreben eines Luftschiffes nach der Gleichgewichtslage ist bekannt, ebenso wie die Erfahrung, daß man nur den leichtesten Gegenstand auszuwerfen braucht, um eine Bewegung in verticalem Sinne hervorzurufen. Ein solcher in der Luft schwimmender Apparat stellt gewissermaßen eine mathematisch richtige Wage dar. Es leuchtet also ein, daß seine plötzliche Entlastung von einem beträchtlichen Gewichte ihn weit und schnell emportreiben muß. Derselbe Fall trat eben jetzt ein.
Nach einigem Auf-und Abschwanken in den höheren Luftschichten aber begann der Ballon wieder zu fallen, da der Riß, welcher dem Gase den Austritt gestattete, nicht zu schließen war.
Die Passagiere hatten gethan, was in ihrer Macht stand; nun gab es kein Mittel weiter, sie zu retten, und sie hofften nur noch auf die Hilfe der Vorsehung.
Um vier Uhr strich der Ballon wiederum nur vierhundert Fuß über dem Wasser hin.
Da erschallte ein lautes Gebell. In Begleitung der Passagiere befand sich auch ein Hund, der neben seinem Herrn in den Maschen des Netzes hing.
»Top muß Etwas gesehen haben!« rief einer der Passagiere. Bald darauf ertönte auch eine markige Stimme:
»Land! Land!«
Vom Anbruch des Morgens an hatte der Ballon, den der Wind unausgesetzt nach Südwesten trieb, eine gewaltige nach Hunderten von Meilen zu berechnende Entfernung durchmessen, als jetzt in seiner Fluglinie ein ziemlich hoch ansteigendes Land in Sicht kam.
Noch befand es sich freilich gegen dreißig Meilen unter dem Winde, und einer guten Stunde bedurfte es wohl, dasselbe zu erreichen, vorausgesetzt, daß der Ballon nicht aus der Richtung kam. Eine Stunde! Würde das Luftschiff sich nicht vor Ablauf dieser Zeit vollkommen entleert und seine Tragkraft eingebüßt haben?
Das war die schreckliche Frage. Deutlich sahen die Passagiere den Punkt, den es um jeden Preis zu erreichen galt. Ob jener zu einer Insel oder zu einem Continente gehörte, sie wußten es nicht, ja, sie kannten kaum die Richtung, in welcher der Orkan sie verschlagen hatte. Ob jenes Stück Erde aber bewohnt war oder nicht, ob es ein gastliches Land oder nicht, – sie mußten es zu erreichen suchen!
Seit vier Uhr konnte sich Niemand mehr darüber täuschen, daß der Ballon keine Tragkraft mehr hatte. Er streifte schon dann und wann die Oberfläche des Meeres. Mehrmals beleckten die Kämme der enormen Wellen das untere Strickwerk, vergrößerten dadurch sein ursprüngliches Gewicht, und nur zur Hälfte hielt sich der Ballon noch aufrecht, wie ein flügellahm geschossener Vogel.
Eine halbe Stunde später winkte das rettende Land in der Entfernung von nur einer Meile, doch jetzt barg der erschöpfte, schlaffe, lang gestreckte und tiefe Falten schlagende Ballon blos noch in seinen obersten Theilen etwas Gas. Auch die in den Schnüren hängenden Passagiere belasteten ihn zu sehr, und bald tauchten diese halb in’s Meer und wurden von den wüthenden Wellen geschüttelt. Die Hülle des Luftschiffes bildete eine den Wind fangende Tasche, und trieb das Ganze wie ein Fahrzeug dahin. Vielleicht erreichte es auf diese Weise die Küste!
Nur zwei Kabellängen von dieser entfernt ertönte plötzlich ein gleichzeitiger Aufschrei aus vier Kehlen. Der Ballon, von dem man ein wiederholtes Erheben nicht vermuthete, machte einen unerwarteten Sprung, nachdem ihn ein mächtiger Wasserberg getroffen hatte. So als ob er plötzlich weiter entlastet worden sei, schnellte er bis 1500 Fuß in die Höhe und begegnete dabei einer Art Luftwirbel, der ihn statt nach der Küste nur auf derselben Stelle mehrmals herumdrehte. Nach Ablauf zweier Minuten aber sank er in schräger Linie und fiel endlich außerhalb des Bereichs der Wellen auf den Ufersand nieder.
Die Passagiere halfen einer dem andern aus den Maschen des Netzes. Der von ihrem Gewichte befreite Ballon wurde wieder vom Winde ergriffen und verschwand, wie ein verwundeter Vogel, der noch einmal auflebt, in den Lüften.
Fünf Passagiere und einen Hund hatte die Gondel getragen, nur Vier warf der Ballon an’s Ufer.
Der Fehlende war offenbar durch den anschlagenden Wasserberg mit fortgeführt worden und hatte dem dadurch erleichterten Ballon Gelegenheit gegeben, sich zum letzten Male zu erheben und dann das Land zu erreichen.
Kaum setzten die vier Schiffbrüchigen, – denn diesen Namen verdienten sie wohl mit allem Rechte, – den Fuß auf’s Land, als sie bemerkten, daß Einer von ihnen fehle, und riefen:
»Wahrscheinlich sucht er sich durch Schwimmen zu retten! Zu Hilfe! Zu Hilfe!«
Fußnoten
1 Etwa 1:00 Cubikmeter.
Zweites Capitel.
Luftschiffer von Profession waren es nicht, vielleicht nicht einmal Liebhaber solcher Expeditionen, welche der Orkan an jene Küste schleuderte, sondern Kriegsgefangene, deren Kühnheit sie veranlaßt hatte, auf so außergewöhnliche Weise zu entfliehen. Wohl hundert Mal hätten sie dabei umkommen und aus dem zerrissenen Ballon in den Abgrund stürzen können! Der Himmel bewahrte sie indeß für ein ganz eigenes Schicksal auf, und am 24. März befanden sie sich, nachdem sie aus Richmond, das damals von den Truppen des Generals Ulysses Grant belagert wurde, entflohen waren, 7000 Meilen von der Hauptstadt Virginiens und Hauptfestung der Separatisten während des schrecklichen Secessionskrieges. Ihre Luftfahrt hatte fünf Tage gewährt.
Dieser Ausbruch der fünf Gefangenen, welcher mit der geschilderten Katastrophe endigte, geschah aber unter folgenden merkwürdigen Umständen:
In demselben Jahre, nämlich im Februar 1865, fielen bei einem der erfolglosen Handstreiche Grant’s zur Ueberrumpelung Richmonds einige seiner Officiere in die Gewalt des Feindes und wurden in der Stadt internirt. Einer der hervorragendsten dieser Gefangenen gehörte zum Generalstabe der Bundesarmee und nannte sich Cyrus Smith.
Gebürtig aus Massachusetts war Cyrus Smith ein Ingenieur, ein Gelehrter ersten Ranges, dem die Bundesregierung während des Krieges die Leitung des Eisenbahnwesens, das eine so hervorragende Rolle spielte, anvertraute. Durch und durch ein Amerikaner des Nordens, mager, knochig und etwa fünfundvierzig Jahre alt, zeigten sein Haar und Bart, von dem er übrigens nur einen starken Schnurrbart trug, schon eine recht grauliche Färbung. Sein schöner »numismatischer« Kopf schien bestimmt zu sein, auf Münzen geprägt zu werden; dazu hatte er brennende Augen, einen festgeschlossenen Mund, überhaupt das Aussehen eines Lehrers an der Militärschule. Er war einer jener Ingenieure, die mit Hammer und Feile, wie die Generale, die ihre Laufbahn als gemeine Soldaten begannen. Zugleich mit einer hohen Spannkraft des Geistes besaß er eine große technische Handfertigkeit. Seine Muskulatur verrieth die ihr innewohnende Kraft. Ein Mann der That und des Rathes, führte er Alles aus ohne sichtbare Anstrengung, unterstützt von einer merkwürdigen Lebenselasticität und mit jener Zähigkeit, welche jedem Fehlschlagen Trotz bietet. Sehr unterrichtet und praktisch angelegt, war ihm ein prächtiges Temperament eigen, denn er erfüllte, in jeder denkbaren Lage Herr seiner selbst, vollkommen die drei Bedingungen, deren Ensemble erst die menschliche Energie bildet: Thatkraft des Geistes und Körpers, Ungestüm des Verlangens und Macht des Willens. Als Devise hätte auch er die Wilhelm’s von Oranien wählen können: »Ich gehe an eine Sache auch ohne Hoffnung und harre auch ohne Erfolg bei ihr aus.«
Gleichzeitig war Cyrus Smith auch die personificirte Unerschrockenheit und bei allen Schlachten des Secessionskrieges gegenwärtig gewesen. Nachdem er seinen Kriegsdienst unter Ulysses Grant als Freiwilliger von Illinois begonnen, kämpfte er bei Paducah, Belmont, Pittsburg, bei der Belagerung von Korinth, bei Port-Gipson, am Black-River, bei Challanoga, Wilderneß, am Potomac, überall muthig voranstürmend, ein Soldat, würdig eines Generals, der die Worte sprach: »Ich zähle niemals meine Todten!« Hundert Mal lief Cyrus Smith wohl Gefahr, zu denen zu gehören, die der schreckliche Grant »nicht zählte«, doch trotzdem er sich bei allen Gefechten jeder Gefahr aussetzte, blieb er immer vom Glück begünstigt, bis zu dem Augenblicke, de er, in der Schlacht bei Richmond verwundet, gefangen wurde.
An demselben Tage, wie Cyrus Smith, fiel auch eine andere wichtig Persönlichkeit in die Gewalt der Südstaatler, und zwar kein Geringerer als der ehrenwerthe Gedeon Spilett, »Reporter« des »New-York Herald«, der beauftragt war, der Entwickelung des Kriegsdramas mit den Heeren des Nordens zu folgen.
Gedeon Spilett gehörte zu jenen Staunen erregenden englischen oder amerikanischen Chronisten von der Race eines Stanley und Anderer, die vor Nichts zurückschrecken, um sich von Allem haargenau zu unterrichten und es ihrem Journale in kürzester Zeit zu übermitteln. Die Zeitungen der Union, wie der »New-York Herald«, bilden eine wirkliche Großmacht, und ihre Berichterstatter sind Leute, mit denen man rechnet. Gedeon Spilett nahm einen Rang unter den Ersten derselben ein.
Ein Mann von hohem Verdienste, energisch, geschickt und bereit zu Allem, voller Gedanken, durch die ganze Welt gereist, Soldat und Künstler, hitzig im Rath, entschlossen bei der That, weder Mühen, Strapazen noch Gefahren achtend, wenn es sich darum handelte, etwas für sich und sofort für sein Journal zu erfahren, ein wahrer Heros der Wißbegierde, des Ungeborenen, Unbekannten, Unmöglichen, war er einer jener furchtlosen Beobachter, die im Kugelregen notiren, unter den Bomben schreiben, und für welche jede Gefahr nur einen glücklichen Zufall bildet.
Auch er hatte alle Schlachten in den vordersten Reihen mit durchgekämpft, den Revolver in der einen, das Skizzenbuch in der anderen Hand, ohne daß sein Bleistift bei dem Kartätschenhagel zitterte. Er ermüdete die Drähte nicht durch unausgesetzte Telegramme, wie Diejenigen, welche nur melden, daß sie Nichts zu berichten haben, sondern jede seiner kurzen, klaren und bestimmten Noten brachte Licht über irgend einen wichtigen Punkt. Nebenher fehlte es ihm nicht an guten Einfällen. So war er es, der nach dem Zusammenstoße am Black-River seinen Platz am Schalter des Telegraphen-Bureaus um keinen Preis aufgeben wollte, um seinem Journale den Ausgang der Schlacht mitzutheilen, und der deshalb zwei Stunden hindurch die ersten Capitel der Bibel abtelegraphiren ließ. Dem »New-York Herald« kostete der Scherz zwar 2000 Dollars, aber der »New-York Herald« brachte dafür auch die ersten Nachrichten.
Gedeon Spilett war von hohem Wuchse und höchstens vierzig Jahre alt. Ein blonder, in’s Röthliche spielender Backenbart umrahmte sein Gesicht. Sein Auge blickte ruhig, aber lebhaft und schnell in seinen Bewegungen, wie das Auge eines Mannes, der alle Einzelheiten seines Gesichtskreises rasch aufzufassen gewöhnt ist. Fest gebaut, hatten ihn alle Klimate abgehärtet, wie das kalte Wasser den glühenden Stahl.
Der Reporter im Kugelregen. (S. 15.)
Seit zehn Jahren wohlbestallter Reporter des »New-York Herald«, bereicherte Gedeon Spilett denselben durch seine Berichte und Zeichnungen, denn er handhabte Feder und Stift mit gleicher Geschicklichkeit. Seine Gefangennehmung erfolgte, als er einen Bericht über die Schlacht aufsetzte und eine Skizze derselben zu Papier brachte. Die letzten Worte in seinem Notizbuche lauteten: »Zu meinen Füßen liegt ein Südstaatler und …«, und Gedeon Spilett war verschollen, denn seiner unabänderlichen Gewohnheit gemäß war er auch bei diesem Treffen unverwundet geblieben.
»Herr Smith, sind Sie Richmond noch nicht satt?« (S. 20.)
Cyrus Smith und Gedeon Spilett, welche sich gar nicht oder höchstens dem Namen nach kannten, schleppte man Beide nach Richmond. Der Ingenieur genas bald von seiner Verwundung und machte während seiner Reconvalescenz die Bekanntschaft des Reporters. Die beiden Männer gefielen sich und lernten bald einander schätzen. In kurzer Zeit gipfelte ihr gemeinsames Leben nur noch in dem einen Zwecke, zu fliehen, sich der Armee Grants wieder anzuschließen und auf’s Neue für die Untheilbarkeit des Vaterlandes zu kämpfen.
Die beiden Amerikaner waren entschlossen, jede sich bietende Gelegenheit zu benutzen; doch trotzdem sie in der Stadt frei umher gingen, war Richmond aber so dicht und streng bewacht, daß eine gewöhnliche Flucht unmöglich schien.
Mittlerweile hatte sich Cyrus Smith auch sein früherer, ihm auf Tod und Leben ergebener Diener beigesellt Ein unerschrockener Neger, geboren auf einer Besitzung des Ingenieurs, erhielt er, trotzdem sein Vater und seine Mutter zu den Sklaven gehörten, von Cyrus Smith, einem Abolitionisten von Kopf und Herz, die Freiheit. Aber der Sklave wollte von seinem Herrn nicht lassen, den er über sein Leben liebte. Er war ein Bursche von dreißig Jahren, kräftig, beweglich, geschickt, intelligent, sanft und ruhig, manchmal recht naiv, immer lächelnd, dienstfertig und gutmüthig. Sein Name lautete Nabuchodonosor, doch er hörte nur auf den abgekürzten, familiären Namen Nab.
Als die Gefangennahme seines Herrn zu Nab’s Ohren drang, verließ er ohne Zaudern Massachusetts, kam vor Richmond an und gelangte durch List und Verschlagenheit, und zwanzig Mal in Gefahr den Kopf dabei einzubüßen, in die belagerte Stadt Die Freude Cyrus Smith’s, seinen getreuen Diener wieder zu sehen, und die Nab’s, seinen Herrn wieder zu finden, spottet jeder Beschreibung.
Wenn Nab auch nach Richmond hatte hinein kommen können, so war es doch weit schwieriger, heraus zu kommen, da man die föderirten Gefangenen sehr sorgsam überwachte Es bedurfte demnach einer ganz außergewöhnlichen Gelegenheit, um einen Fluchtversuch mit einiger Aussicht auf Erfolg zu unternehmen, und diese bot sich nicht nur nicht selbst, sondern ließ sich auch sehr schwer herbei führen.
Inzwischen setzte Grant seine energische Kriegführung fort. Der Sieg bei Petersburg wurde ihm lange streitig gemacht. Seine Streitmacht in Verbindung mit der des Generals Butler errang vor Richmond noch immer keine Erfolge und Nichts prophezeite bis jetzt eine nahe bevorstehende Befreiung der Gefangenen. Der Reporter, dem während der langweiligen Kriegsgefangenschaft jede Gelegenheit zu interessanten Berichten abging, konnte sich gar nicht beruhigen. Er hatte nur einen Gedanken, den, Richmond um jeden Preis zu verlassen. Mehrmals unternahm er einen dahin zielenden Versuch, immer hielten ihn unübersteigliche Hindernisse zurück.
Die Belagerung nahm ihren weiteren Verlauf, und wenn die Gefangenen Alles anwandten, um zu entwischen und die Heere Grant’s zu gewinnen, so hatten auch nicht wenige Belagerte die eiligste Absicht, davon zu gehen, um die separatistische Armee zu erreichen, und unter diesen ein gewisser Jonathan Forster, ein curagirter Südstaatler. Vermochten die föderirten Gefangenen die Stadt nicht zu verlassen, so konnten es die Conföderirten eben auch nicht, denn die Heere des Nordens schlossen diese in dichtem Ringe ein. Schon lange Zeit war jede Verbindung zwischen dem Commandanten von Richmond und dem General Lee unterbrochen, trotzdem es im höchsten Interesse der Stadt lag, Jenem ihre Lage mitzutheilen, um den Anmarsch eines Ersatzheeres zu beschleunigen. Erwähnter Jonathan Forster kam deshalb auf den Einfall, die Linien der Belagerer mit Hilfe eines Ballons zu überschreiten und auf diese Weise nach dem Lager der Separatisten zu gelangen.
Der Commandant genehmigte diesen Versuch. Sofort wurde ein Luftschiff angefertigt, und Jonathan Forster, dem fünf Begleiter in die Lüfte folgen sollten, zur Verfügung gestellt. Alle waren mit Waffen versehen, für den Fall einer nöthig werdenden Vertheidigung beim Landen, und mit Lebensmitteln für den einer längeren Dauer der Reise.
Die Abfahrt des Ballons wurde für den 18. März festgesetzt; sie sollte während der Nacht vor sich gehen, und hofften die Luftschiffer unter Voraussetzung eines mäßigen Nordwestwindes binnen wenigen Stunden in dem Hauptquartier des Generals Lee anzukommen.
Dieser Nordwestwind wehte aber nicht in erwünschter Stärke, sondern wuchs an jenem 18. März zur Macht eines Orkans, so daß die Abreise Forster’s verschoben werden mußte, wollte man nicht mit dem Luftschiffe das Leben Derjenigen, die es durch das aufgewühlte Luftmeer getragen hätte, auf’s Spiel setzen.
Gasgefüllt stand der Ballon auf dem großen Platze in Richmond, bereit aufzusteigen, sobald die Witterung es gestattete, und die ganze Stadt brannte vor Ungeduld, den Zustand der Atmosphäre sich bessern zu sehen.
Der 18. und 19. März verlief ohne jede Veränderung des stürmischen Wetters; ja, man hatte schon die größte Mühe, den Ballon, den die Windstöße immer zur Erde niederbeugten, nur zu erhalten.
Die Nacht vom 19. zum 20. kam heran, aber nur toller ward das Ungestüm des Wetters und dabei die Abreise zur Unmöglichkeit.
An demselben Tage wurde der Ingenieur Cyrus Smith auf der Straße von einem ihm unbekannten Manne angesprochen. Es war das ein Seemann, Namens Pencroff, von beiläufig fünfunddreißig bis vierzig Jahren, kräftiger Statur, sonnenverbranntem Aussehen, mit lebhaften, häufig blinzelnden Augen, aber im Ganzen einnehmendem Gesicht. Dieser Pencroff stammte aus den Nordstaaten, hatte alle Meere der Erde befahren und an Abenteuern Alles bestanden, was einem zweibeinigen Geschöpfe ohne Flügel überhaupt nur widerfahren konnte. Es bedarf nicht der Erwähnung, daß sein unternehmender Charakter ihn Alles wagen und vor gar nichts zurückschrecken ließ. Pencroff hatte sich anfangs dieses Jahres in Geschäften nach Richmond begeben, wobei ihn ein junger Mensch von fünfzehn Jahren, Harbert Brown aus New-Jersey, der Sohn seines Kapitäns, eine Waise, die er wie sein eigenes Kind liebte, begleitete. Verhindert, die Stadt vor dem Anfange der Belagerung wieder zu verlassen, befand er sich zum größten Mißvergnügen jetzt ebenfalls in derselben eingeschlossen und brütete nur über dem einen Gedanken, aus ihr auf irgend eine Weise zu entfliehen. Er kannte den Ingenieur Cyrus Smith dem Namen nach und wußte, mit welcher Ungeduld dieser Mann an seinen Fesseln nagte. An erwähntem Tage traf er auf ihn und zögerte nicht, denselben ohne jede Einleitung mit den Worten anzusprechen:
»Herr Smith, sind Sie Richmond noch nicht satt?«
Der Ingenieur maß mit dem Blicke den Mann, der ihn so anredete und halblaut hinzufügte:
»Herr Smith, wollen Sie fliehen?
– Und wie das? …« antwortete lebhaft der Ingenieur, dem diese Antwort fast wider Willen entfuhr, denn er hatte sich über den Unbekannten, der das Wort an ihn richtete, noch nicht vergewissert.
Nachdem er aber mit scharfem Blicke die Vertrauen erweckende Erscheinung des Seemanns gemustert, konnte er nicht mehr daran zweifeln, einen ehrlichen Mann vor sich zu haben.
»Wer sind Sie?« fragte er kurz.
Pencroff gab sich zu erkennen.
»Gut, entgegnete Cyrus Smith, aber welches Mittel zu entfliehen schlagen Sie mir vor?
– Dort, jenen Faullenzer von Ballon, den man unthätig angebunden hält, und der mir aussieht, als warte er ganz allein auf uns!« …
Der Seemann hatte gar nicht nöthig, den Satz zu vollenden. Der Ingenieur verstand ihn aus dem ersten Worte, ergriff ihn am Arme und zog ihn mit sich nach Hause.
Dort entwickelte der Seemann sein wirklich sehr einfaches Project, bei dem man eben höchstens sein Leben riskirte. Der Orkan tobte zwar gerade in tollster Heftigkeit, doch mußte ein geschickter und kühner Ingenieur, wie Cyrus Smith, ein Luftschiff wohl zu regieren vermögen.
Hätte Pencroff damit selbst Bescheid gewußt, er würde keinen Augenblick gezögert haben, – es versteht sich, nicht ohne Harbert, abzufahren. Er hatte manchen anderen Sturm gesehen und pflegte einen solchen nicht so hoch anzuschlagen.
Ohne ein Wort dazu zu sagen, hörte Cyrus Smith dem Seemann zu. Aber seine Augen leuchteten auf bei dieser sich darbietenden Gelegenheit, und er war nicht der Mann, sich eine solche entgehen zu lassen. Das Project erschien nur sehr gefahrvoll, aber doch ausführbar. In der Nacht konnte man wohl trotz der Wachen an den Ballon heran kommen, in die Gondel schlüpfen und die Seile kappen, die ihn fesselten. Gewiß lief man Gefahr, mit Kugeln begrüßt zu werden, auf der anderen Seite konnte der Versuch aber auch von Erfolg sein, und ohne diesen Sturm … Ja, ohne diesen Sturm wäre aber auch das Luftschiff schon längst aufgestiegen, und jetzt böte sich nicht die so lange ersehnte Gelegenheit zur Flucht.
»Ich bin nicht allein, sagte da endlich Cyrus Smith.
– Wie viel Personen gedächten Sie mitzunehmen? fragte der Seemann.
– Zwei; meinen Freund Spilett und meinen Diener Nab.
– Das wären also zusammen drei Personen, antwortete Pencroff, und mit Harbert und mir im Ganzen fünf. Nun, der Ballon sollte sechs Passagiere tragen …
– Es ist gut; wir fahren ab!« schloß Cyrus Smith.
Dieses »wir« galt auch mit für den Reporter, aber der Reporter war kein ängstlicher Mann, und sobald er von dem Vorhaben Kenntniß erhielt, stimmte er demselben bei, und erstaunte nur allein darüber, daß er auf eine so einfache Idee noch nicht schon selbst gekommen sei. Nab endlich folgte ja seinem Herrn, wohin dieser zu gehen beliebte.
»Diesen Abend also, sagte Pencroff, gehen wir zu Fünf, wie aus Neugierde, dort umher.
– Heut’ Abend um zehn Uhr, antwortete Cyrus Smith, und nun gebe der Himmel, daß sich der Sturm nicht vor unserer Aufsteigung lege!«
Pencroff verabschiedete sich von dem Ingenieur und ging nach seiner Wohnung zurück, wo der junge Harbert ihn erwart etc. Der muthige Knabe kannte den Plan des Seemanns und harrte ungeduldig auf das Resultat jenes Ganges zu dem Ingenieur. Fünf beherzte Menschen waren es also ohne Zweifel, die sich in den Orkan hinaus zu wagen entschlossen hatten.
Der Sturm mäßigte sich nicht, und weder Jonathan Forster noch dessen Begleiter konnten daran denken, ihm in der zerbrechlichen Gondel Trotz zu bieten. Der Tag war schrecklich.
Der Ingenieur fürchtete nur das Eine, daß der am Boden gefesselte und von den Windstößen häufig niedergedrückte Ballon in tausend Stücke zerreißen möchte. Mehrere Stunden lang lief er auf dem fast menschenleeren Platze zur Beobachtung des Apparates hin und her. Pencroff seinerseits that gähnend und die Hände in den Taschen dasselbe, wie Einer, der seine Zeit nicht todt zu schlagen weiß, aber mit derselben Angst, daß der Ballon zerreiße oder seine Stricke löse und in die Luft entfliehe.
Der Abend senkte sich nieder; ihm folgte eine finstere Nacht. Wolkengleich strichen dicke Nebel über die Erde; dazu fiel ein mit Schnee untermischter Regen. Das Wetter war kalt. Ueber ganz Richmond lagerten dichte Dünste. Es schien, als habe der Sturm einen Waffenstillstand zwischen Belagerern und Belagerten zu Stande gebracht, und als schweige die Kanone, beschämt durch den entsetzlichen Donner des Orkans. Verlassen dehnten sich die Straßen der Stadt; man hatte es sogar für unnöthig gehalten, den Platz, in dessen Mitte das Luftschiff hin und her schwankte, zu besetzen. Offenbar begünstigte Alles die Flucht der Gefangenen, bis auf die entfesselten Elemente! …
»Eine abscheuliche Fluth! sprach Pencroff für sich und stülpte sich seinen Hut, den der Wind entführen wollte, fester auf den Kopf. Doch was da, wir werden schon mit ihr fertig!«
Um halb zehn Uhr schlichen sich Cyrus und seine Begleiter von verschiedenen Seiten aus auf den Platz, den die durch den Sturm verlöschten Gaslaternen in tiefem Dunkel ließen. Kaum sah man den ungeheuren, auf die Erde gedrückten Aerostaten. Unabhängig von den Ballastsäcken, die mit den Schnüren des Apparates verknüpft waren, wurde die Gondel durch ein starkes Tau zurückgehalten, das durch einen im Steinpflaster befestigten Ring und auch wieder zu ihrem Rande zurücklief.
Nahe der Gondel trafen sich die fünf Kriegsgefangenen. Sie waren in Folge der Dunkelheit, bei der sie sich kaum selbst erkannten, unbemerkt geblieben.
Ohne ein Wort zu sprechen, nahmen Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Nab und Harbert in der Gondel Platz, während Pencroff auf Anordnung des Ingenieurs die Sandsäcke allmälig losknüpfte. Das war das Werk einiger Augenblicke, worauf der Seemann zu seinen Gefährten einstieg.
Jetzt wurde das Luftschiff nur noch durch das erwähnte Seil gehalten, und Cyrus Smith konnte jeden Augenblick in die Höhe gehen.
In diesem Momente sprang ein Hund mit einem Satze in den Nachen. Es war Top, der Hund des Ingenieurs, der seine Ketten zerrissen und seinen Herrn aufgespürt hatte. Cyrus Smith befürchtete eine zu große Belastung und wollte das arme Thier wieder hinausjagen.
»Bah! Das ist Einer mehr!« sagte Pencroff und warf dafür zwei Säcke Ballast aus.
Der Ballon am Abend der Flucht. (S. 23.)
Dann ließ er das Seil schießen, der Ballon ging in schräg aufsteigender Linie ab, sein Nachen stieß an zwei Schornsteine, die er über den Haufen warf, und fort war er in die Lüfte.
Die Schiffbrüchigen rufen nach Cyrus Smith. (S. 27.)
Der Orkan wüthete mit entsetzlicher Gewalt. Während der Nacht konnte der Ingenieur an ein Niederlassen gar nicht denken, und als es wieder Tag wurde, raubten dichte Nebelmassen jede Aussicht nach der Erde. Erst fünf Tage später trat eine Aufhellung ein und zeigte das grenzenlose Meer unter dem Ballon, der mit rasender Schnelligkeit dahinjagte.
Wir erzählten schon, wie von diesen am 20. März abgefahrenen fünf Passagieren vier derselben am 24. auf eine verlassene Küste geworfen wurden, über 6000 Meilen von ihrem Vaterlande entfernt1.
Der aber, welcher fehlte und dem die vier Uebrigen eilend zu Hilfe liefen, war kein Anderer, als ihr naturgemäßer Führer, war der Ingenieur Cyrus Smith!
Fußnoten
1 Am 5. April fiel übrigens Richmond in die Hände Grant’s, womit der Bürgerkrieg sein Ende erreichte. Lee zog sich nach dem Westen zurück, und die Partei der Einheit Amerikas triumphirte.
Drittes Capitel.
Den Ingenieur, welcher in den Maschen des Ballonnetzes hing, hatte ein Wellenschlag, der jene zerriß, weggeschwemmt. Auch der Hund, der seinem Herrn zu Hilfe freiwillig nachsprang, war verschwunden.
»Vorwärts!« rief der Reporter.
Sofort begannen alle Vier, Gedeon Spilett, Harbert, Pencroff und Nab, trotz Ermüdung und Erschöpfung ihre Nachforschungen.
Aus Wuth und Verzweiflung über den Gedanken, Alles verloren zu haben, woran sein Herz hing, weinte Nab helle Thränen.
Zwischen dem Augenblicke, da Cyrus Smith verschwand, und demjenigen, da seine Begleiter das Land erreichten, verflossen kaum zwei Minuten. Sie durften also hoffen, ihn noch rechtzeitig retten zu können. »Suchen wir nach ihm! rief Nab.
– Gewiß, Nab, tröstete ihn Gedeon Spilett, und wir finden ihn auch wieder!
– Lebend?
– Lebend.
– Kann er schwimmen? fragte Pencroff.
– Ja wohl, antwortete Nab, übrigens ist ja Top bei ihm! …«
Als der Seemann das Grollen des Meeres hörte, schüttelte er den Kopf.
Im Norden der Küste und etwa anderthalb Meilen von der Stelle, an welcher die Schiffbrüchigen auf den Sand fielen, war es, wo der Ingenieur verschwand. Vermochte er auch den nächsten Punkt des Ufers zu erreichen, so lag dieser Punkt doch ebenso weit von hier entfernt.
Es mochte nun gegen sechs Uhr Abends sein und wurde schon des bedeckten Himmels wegen sehr dunkel. Die Schiffbrüchigen liefen längs der Ostküste des Landes, nach dem der Zufall sie verschlagen hatte, dahin, – eines unbekannten Landes, von dem sie selbst über seine geographische Lage keine Ahnung hatten. Sie eilten über einen sandigen, mit Steinen untermischten Erdboden, dem jede Vegetation zu fehlen schien. Dieser sehr unebene, holperige Boden zeigte sich an gewissen Stellen von einer großen Menge Spalten zerrissen, die das Vorwärtskommen sehr behinderten. Aus denselben erhoben sich jeden Augenblick mit schwerfälligem Flügelschlage große Vögel, welche in der Dunkelheit nach allen Seiten hin auseinander stoben. In ganzen Gesellschaften flatterten andere, schneller beflügelte auf und zogen einer Wolke ähnlich ins Weite. Der Seemann glaubte sie als Seemöwen und Wasserschwalben zu erkennen, als er ihr mit dem Rauschen des Meeres wetteiferndes Geschrei vernahm.
Von Zeit zu Zeit standen die Schiffbrüchigen still, um laut zu rufen, und horchten, ob sie von der Wasserseite her irgend welche Erwiderung vernähmen. Sie glaubten annehmen zu dürfen, daß, wenn sie sich ganz nahe der Stelle befanden, an der der Ingenieur voraussichtlich an’s Land gekommen wäre, wenigstens das Gebell Top’s ihr Ohr erreichen müßte, im Fall der Verunglückte selbst augenblicklich nicht zu antworten vermöchte. Doch Nichts ließ sich hören außer dem Rauschen der Wellen und dem Toben der Brandung. Die kleine Truppe zog weiter und durchsuchte auch die kleinsten Ausbuchtungen des Ufers.
Nach zwanzig Minuten Wegs sahen sich die vier Schiffbrüchigen plötzlich durch eine lange Linie schäumender Wellen aufgehalten. Das Erdreich ging zu Ende. Sie befanden sich am äußersten Ende einer schmalen Landzunge, über welche das Meer brausend hereinbrach.
»Das ist ein Vorgebirge, sagte der Seemann. Wir werden zurückgehen und uns rechts halten müssen, um das eigentliche Land wieder zu erreichen.
– Wenn er aber dort wäre! erwiderte Nab und zeigte nach dem Oceane, dessen furchtbarer Wellenschaum durch das Dunkel schimmerte.
– Nun wohl, rufen wir ihn nochmals!«
Alle vereinigten ihre Stimmen zu einem durchdringenden Rufe, aber keine Antwort kam zurück. Sie warteten einen Augenblick der Ruhe ab und riefen wiederholt. – Vergeblich!
Die Schiffbrüchigen kehrten also längs der anderen Seite der Landzunge nach dem sandigen, muschelbedeckten Lande zurück. Pencroff bemerkte, daß das Terrain von dem steileren Ufer aus aufstieg, und kam auf die Vermuthung, daß es mittels eines lang hingestreckten Kammes mit einer hohen Küste, deren Gebirgsmassen im Schatten ihren unbestimmten Umriß zeigten, zusammenhängen müsse. Vögel beherbergte diese Uferstrecke nur wenige. Auch der Seegang erschien hier minder beträchtlich. Kaum hörte man ein Geräusch von der Brandung. Offenbar bildete diese Seite der Küste einen halbkreisförmigen Busen, den die vorspringende Spitze gegen den Wellenschlag der offenen See schützte.
Beim Verfolgen dieses Weges gelangte man jedoch mehr nach Süden zu, d.h. von der Stelle weg, an welcher Cyrus Smith an’s Land geschwommen sein konnte. In anderthalb Meilen Entfernung bildete das Uferland immer noch keinen aufsteigenden Winkel, durch den man nördlicher hinauf zu kommen hoffen durfte, obgleich man nach Umgehung des Vorgebirges das eigentliche Land längst wieder erreicht hatte. Trotz der Erschöpfung ihrer Kräfte drangen die Schiffbrüchigen stets muthig vorwärts, immer in der Hoffnung, eine Biegung des Landes zu finden, längs der sie ihre ursprüngliche Richtung wieder einzuschlagen vermöchten.
Wie groß war daher ihre Enttäuschung, als sie sich nach Zurücklegung zwei weiterer Meilen von Neuem auf einer höheren, von glatten Felsen gebildeten Spitze durch das Meer aufgehalten sahen.
»Wir sind auf einem Eilande, sagte Pencroff, und haben dasselbe von einem Ende zum anderen durchmessen.«
Der Seemann hatte vollkommen Recht. Die Schiffbrüchigen waren auf kein Festland, nicht einmal auf eine Insel, sondern nur auf ein Eiland geworfen worden, dessen Ausdehnung in der einen Richtung nur gegen zwei Meilen betrug, während die der anderen schwerlich viel größer sein konnte.
Gehörte nun dieses unfruchtbare Stückchen Erde, das mit Steinen besäet, keine Spur von Pflanzenleben zeigte und nur die einsame Zufluchtsstätte gewisser Meeresvögel bildete, vielleicht einem umfänglicheren Archipele an? Noch konnte man diese Frage nicht entscheiden. Als die Passagiere das Land von ihrer Gondel aus durch die Dunstmassen sahen, vermochten sie dessen Ausdehnung nicht unbehindert zu überschauen. Doch glaubte Pencroff, mit seinen an Durchdringung der Dunkelheit gewöhnten Seemannsangen, im Westen unbestimmt Massen zu erkennen, die einer hoch aufsteigenden Küste angehörten.
Etwas Genaueres ließ sich freilich über die Lage des Eilandes vor der Hand nicht feststellen, als daß man es nicht sofort verlassen konnte, da es rings vom Meere umschlossen war. Jede weitere Nachforschung nach dem Ingenieur, der keinen Laut von sich hatte hören lassen, mußte also bis zum folgenden Morgen aufgeschoben werden.
»Cyrus Stillschweigen beweist noch gar nichts, sagte der Reporter. Er kann ohnmächtig, verwundet, augenblicklich außer Stande sein, zu antworten; deshalb allein dürfen wir noch nicht verzweifeln.«
Der Reporter sprach zwar auch den Gedanken aus, auf einem vorspringenden Punkte des Eilandes ein Feuer, das dem Ingenieur als Signal dienen sollte, zu entzünden, doch suchte man vergeblich nach Holz oder trockenem Gesträuche. Sand und Steine, weiter fand sich eben Nichts.
Man begreift leicht den Schmerz Nab’s und der übrigen, welche sich dem unerschrockenen Cyrus Smith so innig angeschlossen hatten, jetzt, da es unmöglich schien, ihm Hilfe zu bringen. Entweder hatte der Ingenieur sich jetzt schon allein gerettet und eine Zuflucht auf der Küste gefunden, oder er war für immer verloren!
Wie langsam und quälend verliefen ihnen die Stunden der Nacht. Die Schiffbrüchigen litten furchtbar, ohne sich selbst darüber besonders Rechenschaft zu geben. Sie dachten gar nicht daran, einen Augenblick der Ruhe zu suchen. Sich selbst um ihres Führers willen vergessend, hoffend und sich zur Hoffnung ermuthigend, liefen sie auf dem unfruchtbaren Eilande hin und her und kehrten immer wieder zu jener nach Norden auslaufenden Landspitze zurück, an der sie der Unglücksstelle am nächsten zu sein wähnten. Sie horchten gespannt, riefen so laut als möglich, und ihre Stimmen mußten weithin dringen, da in der Atmosphäre jetzt Ruhe herrschte und das Meer stiller zu werden und sich schon zu glätten begann.
Ein lauter Ruf Nab’s schien einmal sogar von einem Echo wiedergegeben zu werden. Harbert machte Pencroff darauf aufmerksam.
»Das würde noch weiter beweisen, daß im Westen eine Küste ziemlich in der Nähe läge.«
Der Seemann nickte mit dem Kopfe. Uebrigens konnten seine scharfen Augen nicht trügen. Hatte er ein Land, und wenn auch noch so wenig davon, gesehen, so mußte ein solches auch vorhanden sein.
Dieses entfernte Echo blieb aber auch die einzige Antwort, welche Nab erhielt, sonst war tiefes Schweigen rings umher.
Allmälig klärte sich der Himmel auf. Gegen Mitternacht erglänzten einige Sterne, und wäre jetzt der Ingenieur hier gewesen, er hätte schnell erkannt, daß diese Gestirne nicht der nördlichen Halbkugel angehörten. In der That schmückte der Polarstern nicht mehr diesen neuen Horizont, und die Sternbildern des Zeniths waren nicht dieselben, welche über dem nördlichen Theile der Neuen Welt stehen, dagegen erglänzte das Südliche Kreuz sichtbar an dem anderen Pole der Welt.
Die Nacht verrann. Gegen fünf Uhr Morgens, am 25. März, begannen die Höhen des Himmels sich langsam zu erhellen. Noch blieb der Horizont in Dunkel gehüllt, und selbst als der Tag anbrach, entwickelte sich ein dichter Dunst aus dem Meere, der den Gesichtskreis bis auf kaum zwanzig Schritte einschränkte. In langen Wolken rollte jener Nebel schwerfällig dahin.
Das war ein recht unvermuthetes Hinderniß; die Schiffbrüchigen konnten rings um sich Nichts erkennen. Während die Blicke Nab’s und des Reporters über den Ocean schweiften, lugten der Seemann und Harbert nach der Küste im Westen aus, ohne eine Spur von Land entdecken zu können.
»Thut nichts, sagte Pencroff, ich sehe die Küste zwar nicht, aber ich fühle sie … dort ist sie … dort … so gewiß, wie wir nicht mehr in Richmond sind!«
Der Nebel stieg bald empor; er war nur der Vorbote schönen Wetters. Heller Sonnenschein erwärmte seine oberen Schichten, und wie durch ein dünnes Gewebe drangen die Strahlen bis auf das Eiland hindurch.
So wurden die Dunstmassen gegen halb sieben Uhr, drei Viertelstunden nach Aufgang der Sonne, durchsichtiger. Sie stiegen nach oben. Bald trat das ganze Eiland vor Augen, als tauche es aus einer Wolke empor. Kreisförmig erweiterte sich der Gesichtskreis über dem Meere, nach Osten zu endlos, nach Westen hin aber durch eine hoch aufsteigende, zerklüftete Küste begrenzt.
Ja! Dort lag das Land, dort die wenigstens vorläufig sichere Rettung. Zwischen dem Eilande und der Küste, die durch einen eine halbe Meile breiten Canal von einander getrennt waren, rauschte das Wasser schnell wirbelnd hindurch.
Einer der Schiffbrüchigen, der nur sein Herz sprechen ließ, stürzte sich, ohne seine Gefährten vorher davon zu benachrichtigen, ja, ohne nur ein Wort zu verlieren, in den Strom. Es war Nab. Ihn trieb es nach jener Küste hinüber, um in deren nördlichem Theile seine Nachforschungen fortzusetzen. Niemand vermochte ihn zurück zu halten. Vergebens rief ihn Pencroff an. Der Reporter traf Anstalt, Nab nachzufolgen.
Pencroff wandte sich an denselben.
»Sie wollen über den Canal hinüber? fragte er.
– Gewiß, antwortete Gedeon Spilett.
– Nun wohl, so vertrauen Sie mir und warten das ab. Nab wird genügen, seinem Herrn Hilfe zu bringen. Wenn wir uns in diese Strömung wagten, möchten wir Gefahr laufen, durch die Kraft derselben in’s offene Meer getrieben zu werden. Täusche ich mich nicht ganz, so hängt dieselbe nur mit der Ebbe zusammen. Sie sehen, wie der Sand allmälig bloßgelegt wird. Also fassen wir uns in Geduld; vielleicht findet sich bei niedrigem Wasser eine passirbare Furth …
– Sie haben Recht, erwiderte der Reporter, trennen wir uns so wenig als möglich.«
Indessen kämpfte Nab aus Leibeskräften gegen den Strom, den er in schiefer Richtung durchschwamm. Bei jedem Stoße sah man seine schwarzen Schultern auftauchen. Wenn er auch sehr schnell seitwärts getrieben wurde, so kam er doch dem Ufer näher. Zum Durchschwimmen der halben Meile Entfernung zwischen dem Eilande und dem Lande brauchte er wohl eine halbe Stunde und kam nur einige tausend Fuß unterhalb des Punktes an’s Ufer, welcher der Stelle, von der aus er in’s Wasser sprang, gegenüber lag.
Nab faßte vor einer hohen Granitmauer Fuß und schüttelte sich tüchtig; dann verschwand er schnell hinter einer in’s Meer vorspringenden Felsenspitze von derselben Höhe, wie der westliche Ausläufer des Eilandes.
Aengstlich verfolgten die Gefährten Nab’s sein tollkühnes Unternehmen, und erst als dieser nicht mehr zu sehen war, wandten sie ihre Blicke auf das Land, in dem sie eine Zuflucht zu finden hofften, wobei sie einige Muschelthiere, die auf dem Sand verstreut lagen, verzehrten. Die Mahlzeit war zwar knapp, indessen doch eine Mahlzeit.
Die gegenüber liegende Küste bildete eine Bucht, die nach Süden zu in einem sehr spitzen, vollkommen vegetationslosen Vorsprung mit wild zerklüftetem Umrisse auslief. Diese Spitze stand mit dem eigentlichen Uferlande durch sehr merkwürdige Linien in Verbindung und stützte sich daselbst an hohe Granitfelsen. Im Norden dagegen erweiterte sich die Bai zu einem mehr abgerundeten Küstenstriche mit der Richtung von Südwest nach Nordost und endigte zuletzt mit einem Cap von geringer Ausdehnung. Die gerade Entfernung zwischen diesen beiden Ausläufern an den Enden des Uferbogens mochte gegen acht Meilen betragen. Eine halbe Meile vom Ufer aus gesehen nahm das Eiland wohl nur einen schmalen Streifen im Meere ein und glich einem ungeheuren Wallfisch, dessen sehr vergrößerten Rumpf es darstellte. Seine größte Breite überschritt noch nicht eine Viertelmeile.
Vor dem Eilande bestand das Ufer in erster Reihe aus seinem, mit schwärzlichen Steinen gemischtem Sande, welche bei fallendem Wasser soeben wieder zum Vorschein kamen. In zweiter Reihe erhob sich eine Art Mittelwall von Urgebirge mit senkrecht abfallenden Wänden und wunderbar zerrissenem Kamme zu einer Höhe von etwa 300 Fuß. Dieser erstreckte sich wohl drei Meilen weit und endete nach der rechten Seite mit einer lothrechten, wie von Menschenhand bearbeiteten Wand. Nach links dagegen erniedrigte er sich, zerklüftet in prismatische Felsstücken in allmäliger Neigung bis zu der Stelle, wo er mit den Gesteinsmassen des Vorgebirges verschmolz.
Auf der Höhe des eigentlichen Plateaus wuchs kein einziger Baum. Jenes bildete eine glatte Fläche, ähnlich dem Tafelberge hinter der Capstadt am Vorgebirge der Guten Hoffnung, nur in verkleinertem Maßstabe. So wenigstens gestaltete sich der Anblick von dem Eilande aus. Uebrigens fehlte es rechts, hinter der erwähnten lothrechten Wand, nicht an Pflanzenreichthum, und leicht erkannte man große Strecken grüner Bäume, die sich bis über Sehweite hinaus fortsetzten. Dieses Bild erquickte das Auge, das von den langen Granitreihen ermüdet war.
Ganz zuletzt endlich überragte die scheinbare Hochebene, in einer Entfernung von mindestens sieben Meilen, ein weißer Gipfel, von dem die Sonnenstrahlen wiederglänzten. Er bestand aus einer Schneehaube, welche irgend einen entfernten Berg überdeckte.
Ob dieses Land eine Insel bilde, oder einem Continente angehöre, ließ sich vorläufig nicht entscheiden. Beim Anblick jener zerklüfteten Felsmassen, die sich zur Linken über einander häuften, hätte ein Geolog aber an deren vulkanischem Ursprunge gar nicht zweifeln können, denn offenbar waren sie die Erzeugnisse plutonischer Processe.
Aufmerksam betrachteten Gedeon Spilett, Pencroff und Harbert dieses Land, auf dem sie vielleicht lange Jahre verbringen oder gar auch ihr Leben beschließen sollten, wenn es sich außerhalb der besuchten Schiffswege befand.
»Nun, fragte Harbert, was sagst Du dazu, Pencroff?
– Ei, erwiderte der Seemann, da wird’s hübsch und nicht hübsch sein, wie überall. Wir werdens ja sehen. Jetzt scheint aber die Ebbe eingetreten zu sein. In drei Stunden werden wir wohl über das Wasser gelangen können, dann richten wir uns ein, so gut es eben geht, und suchen Mr. Smith wieder aufzufinden.«
Pencroff’s Berechnung bestätigte sich. Drei Stunden später lag bei niedrigem Meere der größte Theil des Sandes, der das Canalbett bildete, frei. Zwischen dem Eiland und der Küste blieb nur noch ein schmaler Wasserarm übrig, der leicht zu überschreiten sein mußte.
»Sind sie eßbar?« (S. 35.)
Gegen zehn Uhr entledigten sich Gedeon Spilett und seine beiden Genossen ihrer Kleidung, hielten sie in einem Bündel über dem Kopfe und wateten durch das Wasser, dessen Tiefe fünf Fuß nicht überstieg. Harbert, für den auch das zu tief war, schwamm wie ein Fisch. Alle drei gelangten ohne besondere Schwierigkeiten an das jenseitige Ufer. Dort trockneten sie sich bald an der Sonne, legten die Kleidungsstücke, die sie ja vor Durchnässung bewahrt hatten, wieder an und berathschlagten, was nun vorzunehmen sei.
Viertes Capitel.
Der Reporter sagte zu dem Seemann, daß er ihn an dieser Stelle erwarten solle, wo er ihn wieder aufsuchen werde, und ohne einen Augenblick zu verlieren, stieg er das Ufer in derselben Richtung hinan, die einige Stunden vorher der Neger Nab eingeschlagen hatte. Dann verschwand er schnell hinter einem Vorsprung der Küste; so sehr trieb es ihn, etwas vom Ingenieur zu erfahren.
Harbert hatte ihn begleiten wollen.
»Bleib’ hier, mein Sohn, sagte der Seemann zu ihm. Wir müssen eine Lagerstätte für die Nacht herrichten und sehen, ab wir etwas Solideres für die Zähne austreiben können, als jene Muscheln. Unsere Freunde werden sich bei ihrer Rückkehr stärken wollen. Jeder bleibe bei seiner Sache.
– Ich bin bereit, Pencroff, antwortete Harbert.
– Schön, versetzte der Seemann, so wird sich Alles machen; nur mit Methode. Wir sind müde, frieren und haben Hunger. Es handelt sich also darum, ein Obdach, Feuer und Nahrungsmittel zu finden. Der Wald enthält Holz, Nester und Eier; so werden wir nur noch eine Hütte zu suchen haben.
– Nun gut, sagte Harbert, so will ich eine Grotte in diesen Felsen suchen und werde gewiß eine entdecken, in der wir uns Alle verkriechen können.
– So sei es, erwiderte Pencroff! An’s Werk, mein Junge.«
Beide gingen am Fuße der hohen Mauer hin auf dem Sande, den das fallende Wasser in breiter Fläche frei gelegt hatte; doch statt sich nach Norden zu wenden, schlugen sie die Richtung nach Süden ein. Wenige hundert Schritte von der Stelle, wo sie aus Land gekommen waren, hatte Pencroff beobachtet, daß die Küste einen schmalen Spalt bildete, der seiner Meinung nach die Mündung eines Flusses darstellen mußte. Einerseits erschien es von Wichtigkeit, sich vorläufig in der Nachbarschaft trinkbaren Wassers niederzulassen, andererseits lag die Möglichkeit nicht fern, daß Cyrus Smith von der Strömung nach dieser Gegend getrieben worden sei.
Die hohe Mauer stieg wie erwähnt gegen dreihundert Fuß hoch empor, aber überall, selbst an ihrer Basis, die das Meer bedeckte, theilte kein Einschnitt das Gestein, der als Wohnung benutzbar gewesen wäre. Die steile Mauer bestand aus hartem Granit, dem die Wellen nichts anzuhaben vermochten. Auf dem Gipfel wimmelte es von einer ganzen Welt von Wasservögeln, darunter vorzüglich verschiedene Arten von Handfüßlern mit langen, zusammengedrückten und spitzigen Schnäbeln –, sehr lautes Federvieh, das über die Erscheinung eines Menschen kaum erschreckte und wahrscheinlich zum ersten Male in seiner Einsamkeit gestört wurde. Unter jenen Vögeln erkannte Pencroff mehrere »Labbes«, eine Seemövenart, welche man auch Strandjäger nennt, und daneben kleine gefräßige Möven, die in kleinen Löchern des Granits nisteten Ein Flintenschuß mitten in diese Vogelheerde hätte gewiß eine große Anzahl niedergestreckt, doch um zu schießen, mußte man zunächst ein Gewehr haben, das sowohl Pencroff als Harbert abging. Uebrigens sind diese Vögel kaum eßbar und selbst ihre Eier von sehr widrigem Geschmack.
Da meldete Harbert, der einige hundert Schritte weiter nach links gegangen war, daß er einige mit Algen überkleidete Felsen gefunden habe, welche die Fluth wenige Stunden später wieder bedecken mußte. An diesen Felswänden hingen zwischen Varecbüscheln eine Menge zweischaliger Muscheln, die für halbverhungerte Leute gewiß nicht zu verachten waren. Harbert rief also Pencroff, der eiligst herzulief.
»Ah, da sind Miesmuscheln, rief der Seemann, sie ersetzen die uns fehlenden Eier.
– Nein, solche sind es nicht, antwortete der junge Harbert, nach genauer Betrachtung der an dem Felsen haftenden Schalthiere, das sind Steinmuscheln.
– Sind sie eßbar? fragte Pencroff.
– Vollkommen.
– Nun, auch gut, so verzehren wir Steinmuscheln.«
Der Seemann konnte sich auf Harbert verlassen.
Der junge Mensch war in der Naturgeschichte gut bewandert und hatte schon von jeher eine wahre Leidenschaft für diesen Zweig des Wissens. Sein Vater hatte ihn auf diesen Weg geleitet, indem er ihm von den besten Lehrern in Boston Unterricht ertheilen ließ, welche dem intelligenten und fleißigen Kinde sehr zugethan waren. Seine Eigenschaft als Naturkundiger sollte übrigens noch manchmal in Anspruch genommen werden und bei seinem ersten Auftreten täuschte er sich nicht.
Diese Steinmuscheln bestanden aus langen Schalen und hingen gleichsam traubenweise am Gestein. Sie zählen zu jenen Familien von Mollusken, welche sich selbst in die härtesten Felsen einbohren, und ihr Gehäuse lief in zwei Spitzen aus, eine Anordnung, die sie von der gewöhnlichen eßbaren Muschel unterscheidet.
Pencroff und Harbert verspeisten eine ziemliche Anzahl dieser Steinmuscheln, welche sich im Sonnenschein halb öffneten, wie Austern, und fanden, daß sie einen sehr pfeffrigen Geschmack hatten, was sie jeden Mangel an Gewürz vollständig vergessen ließ.
Ihr Hunger war also vorläufig gestillt, nicht aber der Durst, der nach dem Genusse dieser von Natur gewürzten Schalthiere nur zunahm. Jetzt galt es, bald Trinkwasser aufzufinden, was einer so auffällig zerklüfteten Gegend kaum fehlen konnte. Nachdem Pencroff und Harbert vorsichtiger Weise einen reichlichen Vorrath an Steinmuscheln eingesammelt, den sie in ihren Taschen und Taschentüchern unterbrachten, kehrten sie nach dem Fuße des Hochlandes zurück. Zweihundert Schritte weiterhin gelangten sie nach jenem Einschnitte, von dem Pencroff voraus geahnt, daß ein wasserreicher Fluß durch ihn fließen müsse. Hier schien die Gesteinmauer durch irgend welchen mächtigen plutonischen Vorgang gespalten zu sein. Am Ufer dehnte sich eine kleine Bucht aus, die nach dem Lande zu in einen sehr spitzen Winkel auslief. Der Wasserlauf maß daselbst gegen hundert Fuß Breite, und seine Ufer stiegen höchstens zwanzig Fuß hoch an. Der Fluß drang unmittelbar zwischen die Granitmauer ein, welche sich stromaufwärts zu erniedrigen schien; dann bildete jener einen scharfen Winkel und verschwand eine halbe Meile weiter in einem Gehölz.
»Hier ist ja Wasser und dort Holz! rief Pencroff, nun sieh’, Harbert, jetzt fehlt blos noch das Haus!«
Das Wasser des Flusses war schön klar. Der Seemann überzeugte sich, daß es bei niedrigem Wasserstande, d.h. während der Zeit der Ebbe, süß sei. Nach Feststellung dieser gewichtigen Punkte suchte Harbert, freilich erfolglos, nach einem Zufluchtsorte. Ueberall erschien die Mauer glatt, eben und steil.
Nur an der Mündung des Wasserlaufes hatte der Gesteinschutt nicht eine Grotte, aber eine Anhäufung von gewaltigen Felsenstücken gebildet, denen man in Ländern mit Granitgebirgen nicht selten begegnet und die den Namen »Kamine« führen.
Pencroff und Harbert drangen ziemlich tief zwischen diesen Felsen in sandigen Gängen ein, denen auch das Licht nicht abging, da es durch die Lücken eindrang, welche die Granitstücken, von denen sich manche nur wie durch ein Wunder im Gleichgewicht hielten, frei ließen. So gut wie die Lichtstrahlen fand aber auch der Wind, – ein wahrer Corridorzug – Eingang und mit dem Winde die scharfe Kälte von Außen. Doch glaubte der Seemann, daß man durch Verstopfung einiger dieser Zwischengänge mittels eines Gemisches von Sand und Steinen diese »Kamine« zur Noth wohnlich einrichten könne. Ihre geometrische Form ähnelte dem typographischen Zeichen &, das in Abkürzung »und« oder »et caetera« bedeutet. Schloß man den oberen Ring dieses Zeichens, durch welches der Süd-und Westwind hereinblies, ab, so mußte es gelingen, den unteren Theil nutzbar zu machen.
»Das ist jetzt unsere Aufgabe, sagte Pencroff, und wenn wir Mr. Smith jemals wiedersehen, so wird er aus diesem Labyrinthe schon etwas zu machen wissen.
– Wir sehen ihn wieder, Pencroff, rief Harbert, und wenn er zurückkommt, muß er eine erträgliche Wohnung vorfinden Sie wird das von der Zeit an sein, sobald wir hier links einen Herd errichten, und darüber dem Rauche einen Ausweg lassen.
– Das muß sich ausführen lassen, mein Sohn, erwiderte der Seemann, und diese Kamine – denn Pencroff behielt den Namen mit Vorliebe bei –, sollen unsere provisorische Wohnung abgeben. Zuerst werden wir aber für Brennmaterial zu sorgen haben. Mir scheint auch, das Holz wird nicht ganz ungeeignet sein, jene Oeffnung zu verschließen, durch welche der Teufel jetzt seine Trompete bläst!«
Harbert und Pencroff verließen die Kamine, wendeten sich um die Ecke und stiegen das linke Ufer des Flusses hinan. Die Strömung in diesem war ziemlich schnell und führte einige abgestorbene Bäume mit sich. Bei steigender Fluth, von der schon die Anzeichen eintraten, mußte das Wasser wohl eine beträchtliche Strecke zurückgetrieben werden. Der Seemann dachte sofort daran, daß man Ebbe und Fluth zum Transport schwerer Gegenstände werde gebrauchen können.
Nach einem Wege von einer Viertelstunde kamen der Seemann und der junge Mensch an einem scharfen Winkel an, mit dem sich der Fluß nach links wendete. Von dieser Stelle aus setzte sich sein Lauf durch einen Wald mit prächtigen Bäumen fort. Trotz der vorgeschrittenen Jahreszeit prangten diese Bäume noch in ihrem grünen Gewande, denn sie gehörten zu jener Familie der Coniferen, welche in allen Gegenden der Erde, sowohl unter nördlichen Klimaten, als auch in den heißen Zonen vorkommen. Der junge Naturforscher erkannte sie genauer als »Deodars«, eine im Himalayagebirge sehr häufig auftretende Art von überaus angenehmem Geruche. Zwischen diesen schönen Bäumen befanden sich einige Fichtengruppen, deren dichter Schirm sich weit ausbreitete. Mitten unter dem hohen Grase fühlte Pencroff, daß er auf dürre Zweige trat, welche laut knackend zerbrachen.
»Schön, junger Mann, sagte er zu Harbert, wenn mir auch die Namen der Bäume nicht bekannt sind, so weiß ich doch, daß sie zur Kategorie des ›Brennholzes‹ gehören, und für jetzt liegt uns das zunächst am Herzen.
– Versehen wir uns mit Vorrath!« erwiderte Harbert, der sich sofort an’s Werk machte.
Das Einsammeln war nicht schwierig, da man nicht einmal Zweige von den Bäumen zu brechen brauchte, denn überall lagen große Mengen dürren Holzes umher. Wenn auch Brennmaterial nicht fehlte, so ließen doch die Transportmittel viel zu wünschen übrig. Bei seiner großen Trockenheit mußte das Holz schnell verbrennen, und wurde es deshalb nöthig, eine beträchtliche Menge desselben nach den Kaminen zu befördern, wozu das nicht hinreichte, was etwa zwei Menschen fortzutragen vermochten. Harbert hatte auf diesen Umstand aufmerksam gemacht.
»Ei nun, mein Junge, meinte der Seemann, so werden wir auf ein Mittel denken müssen, dieses Holz fortzuschaffen. Man muß für Alles ein Mittel finden. Wenn wir eine Karre oder ein Boot hätten, wäre die Sache ja sehr schnell erledigt.
– Aber wir haben ja schon den Fluß! warf Harbert ein.
– Richtig, versetzte Pencroff. Der Fluß ist für uns ein Weg, welcher sogar selbst geht, und die Holzflöße sind nicht umsonst erfunden.
– Nur läuft unser Weg aber, bemerkte Harbert, jetzt gerade in umgekehrter Richtung, da die Fluth noch steigt.
– So werden wir nur zu warten haben, bis sie wieder fällt, entgegnete der Seemann, und dann soll sie unser Heizmaterial mit nach den Kaminen führen. Komm, wir wollen unseren Lastzug vorrichten.«
Von Harbert gefolgt, begab sich der Seemann nach dem scharfen Winkel, den der Waldsaum mit dem Flusse bildete. Beide schleppten, jeder nach seinen Kräften, eine Ladung Holz, zu Bündeln vereinigt, herbei. Auch am Ufer fanden sich eine Menge trockener Zweige, mitten zwischen den Gräsern, in welche sich wahrscheinlich noch nie eines Menschen Fuß verirrt hatte. Pencroff ging sogleich daran: seinen Lastzug in Ordnung zu bringen. Eine hervorspringende Spitze des Ufers, an der sich das Wasser stieß, erzeugte eine Art stillstehenden Wirbels. In diesen brachten der Seemann und der junge Mensch einige größere und dickere Stämmchen, die sie mit Lianen verbanden. So entstand Etwas wie ein Floß, auf welchem der Holzvorrath nach und nach aufgestapelt wurde, der mindestens die Kräfte von zwanzig Mann beansprucht hätte. Binnen einer Stunde war diese Arbeit gethan, und die Holzladung, an improvisirten Tauen festgebunden, erwartete den Eintritt der Ebbe.
Da bis zu dieser Zeit noch einige Stunden verstreichen mußten, beschlossen Pencroff und Harbert, die höheren Uferberge zu besteigen, um einen ausgedehnteren Ueberblick über die Umgegend zu gewinnen.
Gerade zweihundert Schritte hinter der Flußbiegung verlief sich das Granitgebirge, das mit einigen Schutthaufen von Felsstücken endigte, in einem sanften Abhange nahe dem Saume des Waldes, wobei es fast eine natürliche Treppe darstellte. Harbert und der Seemann stiegen also daselbst in die Höhe. Dank ihren kräftigen Knieen erreichten sie den Gipfel in wenig Minuten und begaben sich nach der einen Ecke, welche die Mündung des Flusses bildete.
Die »Kamine.« (S. 37.)
Oben angelangt, galt ihr erster Blick dem Ocean, über den sie unter so furchtbaren Umständen daher geflogen waren. Im Inneren bewegt, betrachteten sie den nördlichen Theil der Küste, an dem die Katastrophe stattgefunden haben mußte.
»Das konnten Tauben sein!« (S. 43.)
Dort verschwand Cyrus Smith. Mit den Augen suchten sie, ob nicht irgendwo ein Theil des Ballons, an den ein Mann sich anklammern könnte, noch umherschwimme. Nichts! Das Meer dehnte sich als endlose Wasserwüste vor ihnen aus Auch am Ufer sahen sie Niemand, weder den Reporter, noch Nab Möglicher Weise befanden sich diese Beiden in solcher Entfernung, daß man sie nicht bemerken konnte.
»Mir sagt eine innere Stimme, rief Harbert, daß ein so unerschrockener Mann, wie Mr. Cyrus, nicht wie der erste Beste ertrunken ist. Er muß irgendwo an’s Ufer gekommen sein. Nicht wahr, Pencroff?«
Der Seemann schüttelte betrübt den Kopf. Er hoffte nicht mehr, Cyrus Smith je wieder zu sehen, wollte aber Harbert nicht alle Hoffnung rauben, und sagte:
»Ohne allen Zweifel, unser Ingenieur ist der Mann dazu, sich dann noch durchzuhelfen, wenn alle Anderen zu Grunde gingen!« …





























