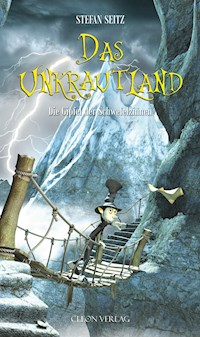Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CLEON Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein verwunschener See, Geister und eine geheimnisvolle Zauberin - all das sind Gründe, warum Miss Plim Hals über Kopf ihr Zuhause verlässt. Doch der Zielort weckt Erinnerungen. Was versteckt sich in Großmutters Gästezimmer, das Plim schon als kleines Mädchen fasziniert hat? Was verbirgt die alte Dorfschule? Und wer sind die zwei Personen, denen die Flucht aus dem mysteriösen Inselreich angeblich gelungen ist? Ein Dickicht aus Rätseln und uralten Geheimnissen wartet darauf, entschlüsselt zu werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Title Page
Inhaltsverzeichnis
Wenn die Flut kommt
Zimmer gesucht
Alte Schriften
Plunder an der Garderobe
Stilles Wasser
Der grüne Vogel
Eine Handvoll rostiger Nägel
Im Tintenzimmer
Die Besucher aus Seidenmeer
Puder für Lindis
Erinnerungen
Die Stimme im Halbdunkel
Eine Wolke am Himmel
Inhaltsverzeichnis
Wenn die Flut kommt
Zimmer gesucht
Alte Schriften
Plunder an der Garderobe
Stilles Wasser
Der grüne Vogel
Eine Handvoll rostiger Nägel
Im Tintenzimmer
Die Besucher aus Seidenmeer
Puder für Lindis
Erinnerungen
Die Stimme im Halbdunkel
Eine Wolke am Himmel
Wenn die Flut kommt
Ein kaum merkliches Lüftchen schlich durch den Korridor. Gar lautlos fegte der Wind über den Boden und brachte die Staubflocken im Licht der Abendsonne zum Tanzen. Mit einem Glitzern schwebten sie durch die Luft. Einige von ihnen vollzogen Spiralen und Kreise, wirbelten empor bis zur Decke, bevor sie anschließend wieder zurück auf den hell erleuchteten Boden sanken. Wahrlich, inzwischen war es nicht mehr zu verkennen: Der Frühling hatte Einzug gehalten und das mit all seiner Kraft. Schon im Lauf der vergangenen Wochen hatte der Stand der Sonne sichtlich an Höhe gewonnen, während die Tage nach und nach länger geworden waren. Von den Bergen floss das Schmelzwasser zu Tal, der Himmel zeigte sich wolkenlos klar, und die Abende waren lau. So verhielt es sich mittlerweile im ganzen Land, von Klettenheim bis hinab zur Ginsterklause. Der Winter des Jahres 833 schien gänzlich vorüber zu sein.
Aber noch viel deutlicher fiel dieser Jahreszeitenwechsel im fernen Süden aus, in einer versteckten und abgelegenen Region jenseits der Bleiberge. Wie so oft hatte sich die eisige Winterszeit hier schon früher verabschiedet, sodass Bäume und Sträucher bereits in voller Blüte standen. In hellen Bahnen schimmerten dort die Strahlen der untergehenden Sonne zu den Fenstern herein und tauchten den Korridor in ein strahlendes rötliches Licht.
Es war ein ausgesprochen weitläufiger Gang, der hier im Sonnenlicht lag. Er zeigte sich schnurgerade und stieg durch lange flache Stufen zum Ende hin an. Dicke Steinblöcke aus Muschelkalk bildeten seine Wände, die in mehreren Klaftern Höhe mit einer gewölbten Decke aus Sandstein überspannt waren.
Auf den ersten Blick sah dieser Korridor nicht sonderlich viel anders aus als ein Flur in der Bibliothek von Hohenweis, ihres Zeichens die Hauptstadt des Unkrautlandes. Zwar waren die Mauern dort keineswegs so schief, verfallen und brüchig wie hier, aber es bestand durchaus eine gewisse Ähnlichkeit. Es hätte auch ein Gebäudetrakt in der altehrwürdigen Akademie sein können. Ja, selbst das Rathaus besaß vergleichbare Gänge.
Und dennoch, etwas an diesem Gang erschien ungewöhnlich. Etwas, das überhaupt nicht zu den Bauten entlang der Wiesen und Wälder gepasst hätte, und das einen großen Unterschied zu ihnen darstellte. Schnell wurde es klar: In diesem Gang herrschte ein ungewöhnliches Klima. Die Luft war warm und feucht, und zu den Fenstern drang leise das Rauschen von Wellen herein.
Das Geräusch war ausgesprochen beruhigend inmitten der Abendstimmung. Es war so angenehm gleichmäßig, entspannend und fließend. Nur ganz selten ertönte ein kurzes Platschen, oder das Schwappen des Wassers war zu vernehmen. Ansonsten war es still.
Doch mit dieser Ruhe sollte es schon sehr bald vorüber sein. Von der Rückseite der Tür am oberen Ende des Korridors näherten sich Schritte, und ein aufgebrachtes Geplapper wurde hörbar.
Wenig später ging die Tür auf. Mit Schwung drehten sich ihre Flügel zur Seite und gaben den Blick auf einen gewaltigen Saal preis, der dahinter im Schein zahlreicher Öllampen lag. Ein dicker Kobold mit Helm und Lanze kam herausgeschritten und trottete schweigend die flachen Stufen hinunter. Im Gefolge hatte er eine Vogelscheuche, die ihm dicht auf den Fersen war.
Voller Hektik sprang die Vogelscheuche hinter dem Kobold her, während sie ohne Punkt und Komma auf ihn einredete. Die zappelnde Vogelscheuche schien ganz offensichtlich einiges auf dem Herzen zu haben. Händeringend überschüttete sie den Kobold mit Erklärungen, wobei sie in einer fast schon aufdringlichen Manier an ihm dranklebte.
Es war eine durchaus unangenehme Situation, besonders für den Kobold. Denn während ihm die Vogelscheuche allem Anschein nach gerade ihre gesamte Lebensgeschichte erzählte, stupste sie ihn auch noch ständig an und zupfte lästig an seinem Wams. Der Anblick der beiden war mehr als befremdlich. Wenige Augenblicke später ging die Tür wieder zu.
Dem Kobold brummte der Kopf. Knurrend schlurfte er den Gang entlang, wobei er nicht im Geringsten die Miene verzog. So wie es aussah, musste es sich bei ihm wohl um den Hausmeister oder um eine Art Wächter handeln. Die Aufmachung des rundlichen Gesellen deutete jedenfalls ganz darauf hin. Über seinem Wams aus Strickwolle trug er eine Arbeitsschürze und an seinem Gürtel einen Ring voll rostiger Schlüssel. Das Visier seines Helms hing dem Burschen so tief ins Gesicht, dass er kaum noch etwas sehen konnte. Aber das kümmerte ihn nicht. Im Schneckentempo und mit leerem Blick schritt der Kobold voran, ohne sich auch nur ein einziges Mal nach der Vogelscheuche umzudrehen. Man merkte es ihm deutlich an: Er wartete nur darauf, dass seine Schicht bald vorüber sein würde.
Die Vogelscheuche ruderte mit den Armen. Ihr Name war Chuck, und Chuck war mächtig in Rage … ein Umstand, der sich bei der ohnehin schon so gesprächigen Vogelscheuche wieder einmal in einem hysterischen Redefluss äußerte. So war das immer bei Chuck, und Chuck hatte auch grundsätzlich Probleme.
Aber in diesem Moment waren seine Probleme sage und schreibe so groß, dass er während des Redens kaum noch Luft holen konnte. Denn weder wusste Chuck, wie er hierherkommen war noch was er an diesem rätselhaften Ort zu suchen hatte. Ja, wo er überhaupt sei, löcherte er den Wächter. Das wollte er doch allzu gerne wissen. Bis vor zwei Tagen hatte er schließlich noch im Gemüsegarten von Miss Plim gestanden und sorgsam ihre Beete behütet. Das war eine wichtige Tätigkeit, wie Chuck ständig betonte … sehr, sehr wichtig. Außerdem hatte er zusätzlich seinen Dienst als Wäscheständer vollzogen, was er ebenfalls als äußerst bedeutend befand.
Das und vieles mehr erzählte er dem rundlichen Wächter, der ihm bei seinen Ausführungen überhaupt nicht mehr zuhörte. Zähneknirschend schritt dieser voran und geradewegs auf den Ausgang zu.
Doch Chuck war mit seinen Erklärungen bei Weitem noch nicht fertig, ganz im Gegenteil. Genau genommen gab es da noch viele andere Sachen, die ihm auf der Seele lagen und die er unbedingt einmal loswerden wollte. Jetzt, da er endlich jemanden gefunden hatte, der allem Anschein nach für ihn zuständig war.
Denn die Sache mit dem Wäscheständer war eigentlich nur so eine kleine Nebentätigkeit, erklärte er dem Kobold. Eine unfreiwillige, um genau zu sein. Feuchte Wäsche vertrug er nämlich ganz und gar nicht. Davon bekäme er Pusteln, die ganz furchtbar juckten. Es war eine Art Ausschlag, wie er dem Kobold bis ins Kleinste beschrieb. Außerdem war ihm diese Aufgabe schrecklich unangenehm. Ach was, unangenehm. Peinlich war ein viel besserer Ausdruck. Denn was sollte man nur von jemanden denken, der stundenlang mit nassen Schürzen und Damenstrümpfen über den Armen im Garten steht? Eine Blamage war das, um es treffend zu formulieren. Eben das versuchte er Miss Plim schon seit einer Ewigkeit klarzumachen, aber sie wollte ja nicht auf ihn hören. Es war immer das Gleiche mit ihr, jammerte er. Stets wusste sie alles besser.
In seinem Redefluss streckte Chuck die Hand aus, um erneut am Wams des Wächters zu zupfen, als dieser plötzlich stehenblieb. Schlagartig drehte der Kobold sich um.
»Jetzt reicht es mir«, platzte es aus ihm heraus. »Schluss mit dem Unfug! Wäre es dir genehm, vielleicht ein bisschen mehr Abstand zu halten?!«
Erschrocken wich Chuck zurück.
»Äh, wer? Ich?«
»Na, wer denn sonst?!« Der Kobold warf die Hand über den Kopf. »Außer dir ist doch sonst niemand hier, oder?«
Ein wenig verwirrt blickte Chuck sich um. Aber der Wächter war mit seiner Ansprache noch nicht fertig.
»Und außerdem«, schimpfte er, »die ganze Zeit dieses Anstupsen und An-mir-Herumzupfen. Wo kommen wir denn da hin? Ich bin doch nicht dein Kumpel.« Wütend stampfte er mit dem Fuß. Dann streckte er entschlossen den Finger aus und deutete zurück in den Gang. »Wir machen das jetzt anders«, setzte er an, »pass mal auf: Du bleibst von nun an mindestens einen Schritt von mir weg und behältst deine Hände bei dir, verstanden? Das nennt man Sicherheitsabstand. Sonst ist das ja nicht auszuhalten. Ich komme mir vor wie im Streichelzoo.«
»Oh, wirklich?« Die Vogelscheuche strahlte. »Was für ein Zufall. Also, ob Ihr es glaubt oder nicht. Genau da bin ich vor einiger Zeit gewesen. Als ich nämlich …«
»Das ist mir egal«, rief der Kobold. Er schob das Visier seines Helms zurück und riss die Augen auf. »Und falls du es genau wissen willst, mein Freund, es interessiert mich auch nicht, wie es dort ausgesehen hat oder wie viel Eintritt du gezahlt hast. Oder ob du da vielleicht zu Fuß hingegangen bist.«
»Aber sicher zu Fuß«, nickte Chuck. »Anders kann ich ja gar nicht …«
»Und das ist mir ebenfalls egal«, unterbrach ihn der Kobold. »Mir tun die Ohren weh. Dein Gebrabbel hält jetzt schon seit drei Tagen an, und es nimmt kein Ende. Eine Dauerbeschallung ist das. Obendrein ist es immer die gleiche Leier, die ich mir anhören darf.«
Voller Entrüstung verschränkte Chuck die Arme.
»Jetzt beschwert Euch bloß nicht«, murrte er. »Schließlich werden mir hier auch immer die gleichen Fragen gestellt.« Er schüttelte fassungslos den Kopf. »Genau«, fuhr er fort, »die ganze Zeit wollen alle von mir wissen, ob ich mit Zauberkräutern umgehen kann.«
»Und?«, rief der Kobold. »Kannst du?«
»Tja, das kommt darauf an«, schnurrte Chuck.
»Auf was?«
»Auf das Menü«, kam es wie geschossen. »Ich zaubere nämlich fantastische Gerichte, müsst Ihr wissen.« Er rollte mit seinen Knopfaugen und kräuselte hingebungsvoll die Finger. »So ein bisschen Kopfsalat mit ein paar Stängeln Geisterwurz ...«
»Hier geht es aber nicht um Kochrezepte«, stöhnte der Wächter. »Wie oft soll ich dir das eigentlich noch sagen? Es geht um Alchemie und Zauberkünste. Das müsstest du doch inzwischen mitbekommen haben, oder?«
Chuck war völlig überfordert. Ratlos breitete er die Arme aus und ließ das Kinn hängen.
»Aber mit solchen Sachen habe ich nichts zu tun«, verteidigte er sich. »Nun glaubt mir doch bitte. Ich bin mir sicher, da muss ein ganz großes Missverständnis vorliegen.« Er wedelte mit dem Finger und kniff ein Auge zusammen. »Irgendetwas läuft hier schief«, mutmaßte er. »Ich glaube nämlich, dass ich überhaupt nicht hierhergehöre.«
Das war der springende Punkt. Mit dieser Vermutung hatte Chuck völlig recht. Er war hier tatsächlich fehl am Platz. Denn weder besaß Chuck Kenntnisse über Zauberkräuter, noch wusste er, mit ihnen umzugehen. Weit gefehlt. Diese Dinge interessierten ihn nicht. Und von etwas wie Alchemie hatte Chuck bislang noch nicht einmal gehört. Die liebenswerte Vogelscheuche hatte sich vor drei Tagen einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort befunden und war Opfer einer Verwechslung geworden – einer Verwechslung, die ihn geradewegs hierhergeführt hatte.
Denn eigentlich ist es niemand anderes als Miss Plim gewesen, auf die man es abgesehen hatte. Sie war diejenige, die der Kräuterkunde mächtig war, und die man deswegen auf geschicktem Weg an diesen Ort hatte holen wollen. Doch als Chuck während des Wäschetrocknens wieder einmal Plims frisch gewaschene Sachen angezogen hatte, war die Verwechslung vorherbestimmt gewesen. Nun befand er sich in diesem Gemäuer und sah sich unangenehmen Fragen ausgesetzt. Fragen, die ihm vor allem eine geheimnisvolle Dame stellte, die sich ebenfalls inmitten dieser Mauern befand, und die ein sehr großes Interesse an Lebenselixieren und magischem Geheimwissen hatte.
»Wir werden das morgen klären«, sagte der Wächter und wies zum Ausgang. »Nun kommst du erst einmal mit, und ich bringe dich wieder in deine Kammer.« Flink hob er den Finger. »Und denke daran«, warnte er. »Du bleibst ab jetzt einen Schritt hinter mir, verstanden?«
Er warf Chuck einen strengen Blick zu, klappte das Visier seines Helms herunter und wandte sich um. Daraufhin setzten sich die zwei wieder in Bewegung.
Wenig später gelangten sie auch schon ans andere Ende des Korridors. Der Kobold trat an die Tür, zog sie auf, und mit glühenden Strahlen hüllte die Abendsonne sie ein. Vor ihnen lag ein steinerner Hof.
Schnell hielt Chuck die Hand vors Gesicht. Von der Sonne geblendet blinzelte er zwischen den Fingern hindurch und rieb sich die Augen. Diese Reaktion war nicht weiter verwunderlich. Denn nachdem Chuck den ganzen Tag in dunklen Räumen mit Kerzenlicht und im Schein von Öllampen verbracht hatte, musste er sich erst einmal an diese Helligkeit gewöhnen. Doch bald schon nahmen die Bilder um ihn herum Form an. Chuck erblickte den Himmel, bemerkte die hauchdünnen Wolken und nahm auch die zahllosen Blütensamen wahr, die kreuz und quer durch die Luft schwebten. Kurze Zeit später schickte er sich an, dem Wächter ins Freie zu folgen.
Trotz seiner anfänglichen Schreckhaftigkeit war dieser Weg für Chuck längst nichts Neues mehr. Vielmehr war es genau derselbe Weg, den Chuck auch an den vorherigen Abenden nach seinen Befragungen zurückgelegt hatte, und den er mittlerweile in- und auswendig kannte. Und es sollte noch besser kommen: Diesen Teil des Weges mochte Chuck inzwischen sogar am liebsten. Hier draußen und unter dem freien Himmel fühlte er sich fast wie zu Hause in Plims Gemüsegarten. Die Sonne schien ihm auf den Kopf, ein warmer Lufthauch hüllte ihn ein, und irgendwo in der Ferne zwitscherten die Vögel. Chuck konnte sich kaum etwas Schöneres vorstellen.
Da gab es nur eine Kleinigkeit, die ihn aufhorchen ließ und ihn jedes Mal stutzig machte. Von irgendwoher aus der Ferne vernahm Chuck ein merkwürdiges Knurren. Was mochte das sein? – fragte er sich. Ein Schwarm Bienen war es nicht, so viel stand fest. Aber letztendlich kümmerte es ihn nicht. Voller Genuss legte er den Kopf in den Nacken, nahm einen tiefen Atemzug und schnupperte die laue Abendluft.
Leider aber blieb Chuck zum Genießen auch heute nicht viel Zeit. Bereits an der nächsten Tür zückte der Wächter den Schlüssel und sperrte sie auf. Dahinter verbarg sich eine Wendeltreppe. In engen Windungen führte sie nach unten.
»So, da wären wir«, sagte der Kobold. »Bitte nach dir. Du kennst den Weg ja inzwischen, nicht wahr?«
»Na, und ob ich den kenne«, antwortete Chuck. »Das ist für mich überhaupt kein Problem.« Er hielt die Hand in die Höhe und fing an, mit den Fingern aufzuzählen. »Ich springe einfach nur die Treppe hinunter, bis es nicht mehr weitergeht. Dann den schmalen Gang entlang bis zur zweiten Tür links, und anschließend …«
Das reichte auch schon.
»Völlig richtig«, unterbrach ihn der Wächter. »Jetzt aber los! Und keine Faxen, verstanden? Ich bleibe hinter dir.«
Mit diesen Worten deutete der Kobold auf die Treppe und wies Chuck den Weg. Dieser folgte artig … wenngleich auch mit einer leichten Verzögerung.
Denn kurz bevor sich Chuck in Bewegung setzte, wandte er noch einmal den Kopf. Blitzschnell sah er über den Wächter hinweg und betrachtete die untergehende Sonne. Ein Flackern lag in seinem Blick. Es war nicht weiter auffällig, aber es hatte fast danach ausgesehen, als wollte Chuck die Zeit im Auge behalten.
Dann machte sich die Vogelscheuche auf. Eilends betrat Chuck die Wendeltreppe und sprang die steinernen Stufen hinunter. Der Wächter schlurfte langsam hinterher.
Es waren nur wenige Windungen, bis Chuck das Ende der Wendeltreppe erreicht hatte. Hurtig ließ er die letzten Stufen hinter sich und erreichte den Gang, der von der Treppe geradeaus weiterführte. Im Vergleich zu dem geräumigen Korridor von vorhin war dieser Gang um einiges schmaler. Er zeigte sich staubiger, und hier unten war es auch nicht so hell. Mehrere Zimmertüren säumten die Wände, bevor der Gang im weiteren Verlauf scharf abbog.
Bereits an der zweiten Tür machte Chuck Halt. Er drehte sich um und hielt die Hände wie einen Trichter an den Mund.
»Ich bin angekommen«, rief er in Richtung der Wendeltreppe. »Wo seid Ihr? Dauert das noch lange?«
Die Antwort folgte sofort, wenngleich in einem weitaus gelassenerem Ton.
»Immer mit der Ruhe«, schallte es von oben. »Ich bin ja gleich da.«
Chuck blieb vor seiner Zimmertür stehen und wartete ab. Dabei wippte er ungeduldig vor und zurück, während er den gemächlichen Schritten des Wächters lauschte. Allem Anschein nach gehörte der Kobold nicht gerade zur schnellen Truppe.
Doch dann merkte Chuck plötzlich auf. Er legte verwundert den Kopf zur Seite und hielt einen Moment lang inne. Da war noch ein anderes Geräusch, fiel ihm auf, ein ungewöhnliches Tapsen. Es hörte sich beinahe so an, als würde jemand auf drei Beinen durchs Land gehen. Gebannt spitzte er die Ohren und überlegte. Die seltsamen Töne kamen hinter seinem Rücken hervor, stellte er fest, aus der Biegung des Gangs.
Voller Neugier drehte Chuck sich um. Er richtete sich auf und schärfte seinen Blick. Tatsächlich, da war wirklich jemand – ein alter Mann. Jetzt konnte er ihn deutlich erkennen. Der Mann hatte einen Gehstock dabei und kam geradewegs auf ihn zu.
Hilfsbereit sprang Chuck zur Seite.
»Zum Gruß«, rief er. »Ich bin Chuck. Sagt, wohnt Ihr etwa auch hier? Das wäre ja großartig. Dann wären wir vielleicht sogar Nachbarn.«
Der alte Mann schenkte ihm ein Lächeln. Auf der Nase trug er einen Zwicker und am Körper eine Robe aus blauem Samt. Sein langer Bart reichte ihm beinahe bis zum Bauch und war weiß wie der Schnee.
Doch leider blieb dem betagten Herrn keine Zeit, sich der Vogelscheuche vorzustellen oder gar mit ihr ein Pläuschchen zu halten. Der Wächter war mittlerweile eingetroffen und sperrte Chuck die Tür auf.
Dieser verabschiedete sich noch schnell von dem Herrn und winkte ihm hinterher.
»Dann gehabt Euch wohl«, rief Chuck. »Vielleicht besucht Ihr mich ja einmal, wenn Ihr in der Nähe seid. Ihr wisst ja jetzt, wo ich …«
In diesem Moment drückte der Wächter die Tür auf. Mit einem lauten Quietschen drehten sich die rostigen Scharniere, sodass der Vogelscheuche die Worte im Hals steckenblieben. Die Unterhaltung war damit beendet.
Sogleich setzte Chuck zur Standpauke an.
»Das klingt ja furchtbar«, bemängelte er, »geradezu entsetzlich. Was sollen denn da die Leute von mir denken? Das hat mich die vergangenen Tage bereits gestört. Wahrlich, da solltet Ihr einmal ein wenig Öl zur Hand nehmen.«
Der Wächter blies die Backen auf. »Sonst noch Wünsche?«
Diese Frage hätte er besser nicht gestellt.
»Aber in der Tat«, sprudelte es aus der Vogelscheuche heraus. »Ich dachte schon, Ihr würdet mich nie fragen. Also, was für ein Zufall, hahaha. Ich finde nämlich, dass dieses Zimmer ruhig ein wenig Aufmerksamkeit verdient hätte, meint Ihr nicht?« Er zeigte in die Kammer, die bis auf ein Bett und ein Pult nahezu leergeräumt war. »Hier fehlen eindeutig ein paar Farben.«
Der Kobold traute seinen Ohren nicht.
»Farben«, wiederholte er fassungslos.
»Aber gewiss doch«, jubelte die Vogelscheuche. »Und wenn Ihr schon einmal dabei seid, dann könntet Ihr auch gleich ein paar Vorhänge anbringen.« Er tänzelte um den Wächter herum und ruderte mit den Armen. »Drei, vier bunte Kissen würden auch nicht schaden … Bilderrahmen, Duftkerzen und eventuell eine Topfpflanze.« Er schlug dem Wächter in der altgewohnten Weise auf die Schulter und zuppelte an seinem Wams. »Jetzt passt mal auf«, sagte er, »da fällt mir etwas ein. Kennt Ihr vielleicht diesen Zimmerbrunnen …?«
Dem Kobold platzte der Kragen.
»Nein«, schimpfte er, »den kenne ich nicht. Und er interessiert mich auch nicht, falls du es wissen willst. Ich will jetzt endlich meine Ruhe haben.«
Ohne weitere Worte zu verlieren, packte der Kobold die zappelnde Vogelscheuche und schob sie zur Tür hinein. Mit einem Fiepen rutschte Chuck in seine Kammer.
Gerade wollte er noch etwas zum Besten geben, da machte der Kobold auch schon die Tür vor Chucks Nase zu. Der Schlüssel klimperte, das Schloss klackte, und schlurfend entfernten sich die Schritte des Wächters.
»… Topfpflanze«, hörte Chuck ihn aus der Ferne murmeln. »Nicht zu fassen.«
Mit diesen Worten stieg der Wächter die Treppe hinauf, und Chuck blieb alleine zurück. In Zimmer zwei kehrte Ruhe ein.
Es war ein ausgesprochen schmuckloser Raum, in dem man Chuck einquartiert hatte. In der Tat, seine Möblierungsvorschläge waren durchaus angebracht gewesen. Das Zimmer war ärmlich eingerichtet und besaß lediglich an einer der Wände ein winziges Fenster. Holzdielen bedeckten den Boden, und große Planken bildeten die Decke.
Auf den ersten Blick ähnelte dieser Raum auch eher einer ärmlichen Schreibstube als einem Gästezimmer. Von einem gemütlichen Schlafgemach konnte überhaupt nicht die Rede sein. An der Wand neben der Tür befand sich ein wackeliges Bett und an der gegenüberliegenden Seite ein Schreibpult mit Pergament, Tinte und einem Federkiel darauf. Damit sollte Chuck eigentlich seine Kräuterkenntnisse niederschreiben und magische Rezepturen zu Papier bringen. Zumindest hatte man das von ihm verlangt. Doch dieses Vorhaben machte wenig Sinn. Weder konnte Chuck vernünftig schreiben noch besaß er Kenntnisse über etwaige Dinge. Er war hier wirklich fehl am Platz.
Schweigend und mit gesenktem Kopf stand die Vogelscheuche im Zimmer. Die Abendsonne schickte ihre letzten Strahlen zum Fenster herein, während Chuck traurig die Arme hängen ließ. Wahrlich, dachte er sich, jetzt war er ganz alleine … alleine und von allen verlassen. Niemand war mehr für ihn da oder kümmerte sich um ihn. Vielleicht hatte Miss Plim ihn ja sogar längst vergessen. Wer weiß?
Ein Seufzen kam aus seinem Mund. Wie gerne würde er in diesem Moment zu Hause in Miss Plims Garten stehen und ihre Beete bewachen. Das wäre schön. Ja, selbst den Dienst als Wäscheständer hätte er jetzt ohne zu murren erledigt. Hach, wenn er doch nur wieder zu Hause wäre.
Aus der Ferne konnte er den Wächter hören, wie dieser die Tür zum Hof zuschlug und hinter sich abschloss. Von da an war kein Laut mehr zu vernehmen.
Prüfend schielte Chuck zur Tür. Er neigte aufmerksam den Kopf und lauschte. Die Sekunden vergingen für ihn wie eine Ewigkeit.
Nachdem er sich absolut sicher war, dass niemand heimlich auf dem Gang umherschlich, richtete Chuck sich auf. Er hielt den Atem an und griff langsam unter sein Leinenhemd. Ein Knistern lag in der Luft. Aufgeregt und mit zittrigen Fingern zog er ein winziges Wollknäuel hervor, das er sorgsam versteckt ins Zimmer geschmuggelt hatte. Wie einen Schatz legte Chuck es auf das Pult.
Es war ein Faden aus dem Wams des Wächters, wie man unschwer erkennen konnte. Chuck hatte seine Rolle wahrhaftig gut gespielt. Jedes Mal, wenn er dem dicken Kobold auf den Leib gerückt war, hatte ihm Chuck den Wollfaden ein kleines Stück weiter aus der Kleidung gezogen. So viel Dreistigkeit hätte man der liebenswerten Vogelscheuche gar nicht zugetraut. Miss Plim wäre bestimmt stolz auf ihn gewesen, wenn sie davon gewusst hätte. Eines Tages, so beschloss Chuck, würde er ihr vielleicht davon erzählen. Jetzt aber prüfte er den Faden eingehend im schwachen Licht und breitete ihn aus.
Der Wollfaden besaß beinahe ein Maß von zwei Schrittlängen, wie sich herausstellte. Es glich einem Wunder, dass der Wächter nichts bemerkt hatte. Selbst als Chuck den Faden von dessen Wams abgerissen hatte, war dem Wächter nichts aufgefallen. Da bestand kein Zweifel. Nach einem jahrelangen Dienst bei einer diebischen Kräuterhexe wie Miss Plim, beherrschten sogar unschuldige Vogelscheuchen so manch hilfreichen Kniff.
Anschließend schob Chuck den Faden beiseite und sorgte für ausreichend Platz auf dem Pult. Jetzt war Fingerspitzengefühl vonnöten. Er griff sich das Pergament und faltete es vorsichtig in der Mitte zusammen.
Perfekt, freute er sich, das hatte funktioniert.
Dann wiederholte Chuck diesen Schritt und faltete das Pergament ein zweites Mal … und ein drittes Mal … und ein viertes Mal … Nach einer kurzen Zeit und einer Reihe von Knicken, stand schließlich ein kleines Schiffchen vor ihm auf dem Pult.
Es war ein durchaus seetaugliches Schiffchen, wie man zugeben musste. Denn im Gegensatz zu Papier nimmt Pergament bekanntlich kein Wasser auf. Diese Erkenntnis hatte Chuck vor einiger Zeit gewonnen, als bei Miss Plim in der Hexenküche der Kessel explodiert war. Nie hätte er diesen Vorfall vergessen. Die beiden Kröten, die Miss Plim auf ihrem Regal in einem Einmachglas hielt, hatten sich dabei beinahe totgelacht. Die halbe Hexenküche hatte unter Wasser gestanden. Doch Plims blanke Pergamente waren trotz allem unversehrt geblieben.
Anschließend folgte auch schon der nächste Teil seines Fluchtplans. Chuck musste eine Nachricht anbringen. Er nahm den Federkiel, tauchte ihn in das Tintenfass und begann, etwas zu kritzeln. Es waren Buchstaben, oder genauer gesagt, es sollten Buchstaben sein. Chuck besaß eine grauenvolle Handschrift.
Aber trotz aller Schwierigkeiten hatte er es bald schon geschafft. Voller Stolz hielt Chuck das Schiffchen in die Höhe und inspizierte es.
An der Innenseite des Schiffchens stand: ICH HEISE CHUCK, BITE HELFT MIHR. In Bezug auf Rechtschrift hatte Chuck ebenfalls gehörigen Nachholbedarf.
Aber der liebe Chuck war ausgesprochen zufrieden mit sich und seinem Werk. Jetzt musste er das Boot nur noch aus dem Fenster halten und vorsichtig zu Wasser lassen – und zwar so, dass die Tinte im Inneren des Schiffchens auf keinen Fall nass werden würde. Andernfalls wäre alles vergebens gewesen. Und genau zu diesem Zweck kam der Faden zum Einsatz.
Chuck nahm den Federkiel und stach ein Loch durch die obere Spitze des Bootes. Sehr gut, freute er sich, auch das hatte geklappt. Schnell noch den Faden hindurchgesteckt, einen Knoten gemacht, und seine Postsendung war fertig.
Eilig krabbelte die Vogelscheuche auf das Pult. Die Zeit drängte, und in wenigen Minuten würde die Sonne untergehen. Chuck wusste, im Dunkel der Nacht würde gewiss niemand seine Nachricht entdecken.
Er schaute aus dem Fenster und blickte über das Wasser zu einem nahegelegenen Uferstreifen. Dahinter stieg das Land zuerst steil an und formte dann eine Ebene. Chuck konnte einen mächtigen Baum erkennen, der dort aus dem Boden ragte. Aber um diesen ging es nicht. Es war das Ufer, das Chuck im Visier hatte. Mehrere grazile Personen liefen dort umher, die Chuck bereits an den vorherigen Abenden beobachtet hatte. Vielleicht konnten sie ihm ja helfen, hoffte er. Einen Versuch wäre es zumindest wert.
Die Sonne ging unter, und im glühenden Rot setzte die Flut ein.
Jetzt oder nie, dachte sich Chuck. Das war die Gelegenheit. Er hielt das Schiffchen aus dem Fenster und seilte es ab. Seine Nerven lagen blank. Was, wenn der Faden zu kurz wäre? Was, wenn sein Hilferuf ins Wasser fallen würde und alles kaputt wäre? Noch einmal würde er diese Chance gewiss nicht bekommen.
Nein, beschloss er, es musste einfach funktionieren.
Und tatsächlich, Chuck hatte sich nicht verschätzt. Das Schiffchen setzte sanft auf dem Wasser auf und trieb in der Abenddämmerung dahin.
Sofort ließ er den Faden los. Dieser landete im Wasser, und das Schiffchen zog ihn gemächlich hinter sich her. Nun war es sich selbst überlassen, dachte Chuck. Mehr konnte er nicht tun.
Schweigend behielt Chuck das Schiffchen im Auge, wie es von der Flut über das Wasser getragen wurde. Nicht der geringste Windstoß störte die Reise, und auch die Wellen brachten es nicht zum Kentern. Sanft driftend erreichte es das gegenüberliegende Ufer und blieb im Sand liegen.
Chuck presste seinen Kopf an die Fensteröffnung. Er richtete seinen Blick auf das Schiffchen und ballte die Fäuste. Noch war es nicht überstanden, bibberte er. Noch konnte das Wasser alles zunichtemachen. Die eintreffenden Uferwellen schoben das Schiff immer wieder aufs Neue über den Strand. Sie ließen es wild auf der Stelle tanzen, drückten es vor und zurück, und warfen es von einer Seite zur anderen. Dennoch blieb Hoffnung. Die Tinte im Inneren musste nach wie vor trocken sein. Das Wasser hatte die Innenseite des Schiffes bisher nicht berührt. Doch wie lange würde das noch gutgehen?
Aber der Spuk sollte schon sehr bald ein Ende haben. Denn bereits nach kurzer Zeit geschah endlich das, worauf Chuck so innig gehofft hatte.
Eine zierliche Gestalt, mit langen Haaren und einem weißen Kleid, kam über das Ufer gelaufen und hob das Schiffchen auf. Fragend hielt sie es in die Höhe und sah es sich an. Wenig später kam noch eine Reihe anderer Personen hinzu. Sie alle sahen aus wie junge Mädchen, mit zarten Gliedmaßen und schlanken Körpern. Still standen sie beisammen und bestaunten den Fund.
Die Vogelscheuche schnappte nach Luft. In heller Aufregung blickte Chuck zu den merkwürdigen Mädchen hinüber, die offenbar gerade dabei waren, seine Nachricht zu entziffern. Konnten sie diese lesen? Seine Handschrift ließ wirklich zu wünschen übrig.
Es blieb keine andere Lösung, beschloss Chuck. Er musste so schnell wie möglich auf sich aufmerksam machen. Eilig streckte er den Arm aus dem Fenster und begann, zu winken.
Da schaute eines der Mädchen plötzlich zu ihm herüber. Sie neigte den Kopf und sah ihn fragend an. Ein leichtes Lächeln zeichnete sich auf ihrem Gesicht ab. Langsam hob sie den Arm und winkte zurück. Es war ein magischer Moment.
Nur kurze Zeit später schauten auch die anderen Mädchen zu ihm herüber. Schweigend und mit glänzenden Augen standen sie am Ufer und winkten der Vogelscheuche zu, die auf der anderen Seite hinter dem Fenster stand.
Dann löste sich die Gruppe auf. Der Reihe nach verließen die Mädchen den Strand und stiegen die steile Böschung hinauf, wo sich der mächtige Baum befand.
Chuck hob den Kopf und spähte aus. War dort oben etwa ein See? So nah am Ufer? Genau konnte er es nicht erkennen, aber es sah ganz danach aus.
Egal, dachte er sich, auf jeden Fall war seine Nachricht angekommen. Und vielleicht würden die netten Mädchen ja Hilfe holen … vielleicht.
Mit diesem Wunsch stellte sich die Vogelscheuche in eine Ecke des Zimmers, schloss die Augen und schlief ein. Draußen ging der Mond auf.
Zimmer gesucht
Gleich hinter der Gartenmauer befand sich ein Pfad. Es war ein gewöhnlicher Trampelpfad, wie ihn die meisten Grundstücke hier in der Gegend besaßen. Er war schmal, ein wenig vertrocknet, und er erweckte den Anschein, als ob er bereits seit vielen Jahrhunderten plattgetreten worden war. Keiner konnte sagen, wie lange es diesen Pfad schon gab oder wann er angelegt worden war. Möglicherweise hatte es ihn bereits vor dem Bau des Rathauses oder der alten Dorfschule gegeben, wer weiß? Eines aber war sicher: Das Grundstück, zu dem der Pfad gehörte, war eines der ältesten in ganz Krötenfels.
Besagter Pfad führte an Obstbäumen und Gemüsebeeten vorbei, bog sich um einen kleinen Teich mit zahlreichen Seerosen, bis er schließlich eine Gruppe von Kiefern erreichte, unter denen ein hohes, sehr schmales Haus stand. Die Wände waren schief, und das Dach hing in der Mitte durch, aber gegen Schnee und Stürme schien das entzückende Domizil noch immer gewappnet zu sein. Nusswinkel 11 hieß es an der Eingangstür, neben der eine verbeulte Messingglocke baumelte. Es war ein lauschiges Anwesen mit all seinen Blumen, Büschen und Sträuchern. Vom Schornstein stieg eine Rauchfahne empor, und der Geruch von Backwerk lag in der Luft. Heute war Montag, und an einem Montag wurde hier stets gebacken. Das wusste längst die ganze Nachbarschaft.
Allerdings, der leckere Geruch nach Mandeln, frischem Teig und Zimt war nicht das Einzige, was an diesem Tag aus dem Gebäude drang. Immer wieder ertönte ein schrilles Bimmeln, als ob jemand auf eine Triangel schlagen oder ein Glöckchen läuten würde. Dieses Geräusch schien doch allzu befremdlich zu sein, und es bimmelte bereits den ganzen Vormittag. War es gar eine Ofenglocke, die da klingelte? Beinahe hörte es sich so an. Aber wenn es eine Ofenglocke war, warum läutete diese dann so oft?
Letztendlich aber kümmerte es niemanden. Von dem wunderlichen Anwesen ertönten des Öfteren seltsame Geräusche. Weshalb also neugierig sein?
Das Innere des Hauses zeigte sich gemütlich, wenngleich auch ein wenig altmodisch. Doch schon beim ersten Hinsehen konnte man erkennen, dass es sich um eine Hexenküche handelte. Genauer gesagt: eine Hexenküche für ältere Damen. Dieser Zusatz fiel sofort ins Auge, wenn man das Haus betrat. Ein verzierter Schaukelstuhl stand unter der Treppe zum Obergeschoss, von dem dicke geflochtene Kordeln hingen. Es gab riesige Hutschachteln, jede Menge giftige Trockenblumen und so viel Geschirr, dass man die gesamte Hexengilde hätte bewirten können. Selbst die Anzahl an Serviettenringen, Tischdecken und Gästeschlappen hätten für einen wahren Besucheransturm gereicht.
Doch wie es bei älteren Leuten häufig der Fall ist, außer dem Schornsteinfeger oder dem Scherenschleifer kam nur selten jemand vorbei. Dennoch, man konnte ja nie wissen. Besser, man war auf alles vorbereitet, und die Teller standen schon einmal bereit.
Ein Kupferkessel stand auf der Feuerstelle, vor der sich ein mächtiger Tisch voll mit Teig, Zaubermitteln und Backwerkzeugen befand. Dieser war in eine Wolke aus Mehlstaub gehüllt, inmitten derer eine elegante ältere Dame eifrig bei der Arbeit war. Mit ganzer Kraft knetete das Mütterchen den Teig und wälzte ihn über den Tisch. Dabei grummelte sie entschlossen vor sich hin, sagte Zauberformeln auf und nickte immer wieder energisch. Fast hatte es den Anschein, als würde der Teig sie heute ärgern. Irgendetwas an der magischen Rezeptur schien offenbar nicht zu funktionieren, aber was?
Doch die alte Frau ließ sich nicht unterkriegen, von nichts und von niemanden und schon gar nicht von einem Teig. Schließlich war sie eine Hexe und eine erfahrene noch dazu. Diesem Teigklumpen wollte sie es zeigen, aber gehörig. Angespannt werkelte sie weiter.
Die Dame trug ein schwarzes Kleid, einen Wollpullover und eine mit Rüschen besetzte Schürze. Ihre schneeweißen Haare hatte sie zu einem kunstvollen Dutt zusammengebunden, in den lange seidene Bänder hineingeflochten waren. Ihr Name war Tulli. Zumindest wurde sie von allen so genannt … Oma Tulli, um genau zu sein. So stand es auch an der Haustür. Nur die Wenigsten wussten, dass sie eigentlich Entulia hieß.
Oma Tulli war überaus dünn, ging etwas gebückt und wirkte zerbrechlich wie eine Porzellanfigur. Eine Ähnlichkeit, die durch die dicke Puderschicht auf ihrer Nase noch verstärkt wurde. Aber Oma Tulli achtete nun einmal auf sich, und ungeschminkt hätte sie die Hexenküche niemals betreten. Das gehörte sich für elegante Hexen einfach so, sagte sie immer. Besonders, wenn man schon etwas in die Jahre gekommen war. Mehr über ihr Alter sprach sie nicht, und zu ihrer großen Freude ließ sich dieses auch nur schwer schätzen.
Doch wenngleich auch ihr Alter weitestgehend im Dunkeln lag, so konnte man sehr wohl erahnen, dass dieses schmächtige Mütterchen früher einmal erstaunlich hübsch gewesen sein musste. Es war eine Eigenschaft, die in ihrer Familie lag und die auch an Tulli nicht vorübergegangen war. Schon ihre Mutter war vor langer Zeit ein echter Blickfang gewesen, und nach ihrer Großmutter hatte sich einst halb Hohenweis umgedreht.
Über ihrer gepuderten Nase trug Oma Tulli eine Brille mit fingerdicken Gläsern. Zu dieser pustete sie immer wieder empor, um den Mehlstaub zu entfernen. Als ältere Dame konnte Oma Tulli mittlerweile nicht mehr so gut sehen, und noch viel schlechter stand es mit dem Gehör. Doch letztere Einschränkung sollte sich schon sehr bald ändern. Zumindest arbeitete sie daran, und zwar mit Hochdruck.
Angestrengt wälzte Tulli den Teigklumpen über den Tisch und presste ihn in Form. Dann zupfte sie sich ein Stückchen davon ab. Mit einem skeptischen Blick schob sie es in den Mund, neigte den Kopf und begann zu schmatzen. Es folgte ein Naserümpfen. Ein bisschen zu viel Zucker, wie ihr schien. Aber das war nicht weiter schlimm. Damit konnte sie im Zweifelsfall leben. Wichtiger war etwas anderes.
In Windeseile drehte Tulli sich um. Hinter ihr stand eine Kommode, auf der ein buntes Glockenspiel lag. Dieses war mehr oder weniger eine Antiquität und stammte noch aus ihrer Schulzeit. Sie nahm den Klöppel und spitzte die Ohren. Dann schlug sie mehrmals auf eines der Klangplättchen. Nun erklärte sich auch, woher das geheimnisvolle Bimmeln kam, das man bis über die Gartenmauer hören konnte. Oma Tulli arbeitete an einem Hexenkuchen. Genau genommen, an einem Hexenkuchen für Schwerhörige. Und dieser schien erste Wirkungen zu zeigen.
Tulli war hocherfreut. Ihr Gesichtsausdruck verriet, dass sie die Töne hören konnte. Sehr gut, dachte sie sich. Der Teig mit der Zaubermischung war also doch nicht so schlecht, wie sie anfangs gedacht hatte. Das musste sie gleich noch einmal ausprobieren. Mit einem siegessicheren Grinsen schwang sie den Klöppel und klopfte erneut auf das Glockenspiel.
Da bimmelte es plötzlich so laut, dass Oma Tulli der Mund offenstand. Stocksteif verharrte sie in der Hexenküche und rollte mit den Augen. Beim giftigen Nachtschatten, freute sie sich, die Zaubermischung war ja geradezu rekordverdächtig. So gut war ihr das noch nie gelungen. Ein fantastisches Ergebnis. Und das Beste war, dass das Glockenspiel fortan von ganz alleine bimmelte. Sie brauchte nicht einmal mehr den Klöppel zu benutzen.
Das lag bestimmt am Zucker, ging es ihr durch den Kopf. Eine wahrlich teuflische Mischung. Nur ein kleiner Löffel mehr, und Oma Tulli hätte vielleicht sogar ihre Nachbarn belauschen können. Toll! Was sie da wohl alles erfahren würde? Beim nächsten Kuchen wollte sie das gleich einmal ausprobieren.
Doch plötzlich veränderte sich das Klingeln und wurde zu einem Klopfen.
Ein wenig verwirrt drehte Tulli den Kopf. Was hatte denn das zu bedeuten? – fragte sie sich. War da etwa jemand an der Haustür?
Schnell putzte sie sich die Hände an der Schürze ab und trippelte durch den Raum. Dann prüfte sie ihre Haare. Sie klopfte den Mehlstaub von den Ärmeln, öffnete die Tür und spähte hinaus. Der Himmel war wolkenlos blau und die Morgensonne so grell, dass Oma Tulli zunächst überhaupt nichts erkennen konnte. Geblendet verzog sie das Gesicht.
Da ertönte plötzlich eine Stimme.
»Hallo Oma«, schallte es. »Kann ich für eine Weile bei dir einziehen?«
Oma Tulli verschlug es die Sprache. Schnell nahm sie die Brille ab und strich sie am Ärmel sauber. Dann zwinkerte sie und schaute ein zweites Mal hin. Vor ihrer Tür stand Miss Plim. Frisch und fröhlich strahlte diese sie an und grinste bis über beide Ohren.
Miss Plim war zwar fast einen Kopf größer als ihre Großmutter, doch man konnte unschwer erkennen, dass die beiden miteinander verwandt waren. Oma Tulli hatte einst auch so silbrig-blonde Haare besessen wie Miss Plim, und offen getragen waren sie auch mindestens genauso lang. Neben sich hatte Miss Plim einen Leiterwagen stehen, der über und über mit Kisten, Zauberbüchern und Kleidersäcken beladen war. Selbst ihr knatternder Rennbesen steckte unter den Sachen.
Tulli war völlig aus dem Häuschen.
»Ja, mein liebes Pausbäckchen!«, schrie sie, nachdem sie begriffen hatte, wen sie gerade vor sich hatte. »Was machst du denn hier?«
Sie fiel Miss Plim um den Hals und drückte sie so fest, dass diese kaum noch Luft bekam.
Da ertönte auf einmal ein Poltern vom Leiterwagen, und aus einer der Kisten setzte kreischendes Gelächter ein.
»Pausbäckchen«, kam es johlend unter dem Deckel hervor. »Was ist denn das für eine Name? Hast du das gehört, Taddel?«
»Na klar«, rief eine andere Stimme. »Ich lach’ mich schlapp.«
Plim wurde puterrot. Sie fauchte und schlug mit der flachen Hand auf die Kiste.
»Oma«, knurrte sie, »ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass du mich nicht so nennen sollst. Ich bin doch kein Kind mehr.«
»Ach was, so ein Unfug«, entgegnete Tulli, während sie Plim freudig in die Backe kniff. »Komm her und lass dich ansehen.«
Sie schob Plim ein klein wenig von sich fort und schaute sie stolz von oben bis unten an.
»Hach, du bist wirklich ein bildhübsches Mädchen geworden«, schwärmte sie. »Meine Güte, bildhübsch … aber viel zu dünn. Jetzt sieh dich doch einmal an. Du bist ja nur noch Haut und Knochen. Du musst unbedingt etwas essen, hörst du? Hast du Hunger? Du hast bestimmt Hunger, nicht wahr?«
»Nein«, entgegnete Plim, »habe ich nicht.«
»Schnickschnack«, winkte Oma Tulli ab, »widersprich mir nicht. Natürlich hast du Hunger. Pass auf, ich koche dir etwas. Das wird dir garantiert schmecken.« Sie richtete sich zu ihrer ganzen Größe auf und zog ihr Kleid zurecht. »Aber jetzt sag doch endlich. Was führt dich hierher?«
»Oje«, seufzte Plim, »das ist eine lange Geschichte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.«
Sie überlegte und wippte unschlüssig von einer Seite zur anderen.
»Das hat eigentlich alles mit so einem blöden und dreimal vermaledeiten Ölgemälde angefangen«, grummelte sie.
Sofort hob die Großmutter den Finger.
»Kind«, mahnte sie, »ich will nicht, dass du so schlimme Sachen sagst. Das weißt du genau.«
Plim zuckte mit den Schultern.
»Was bitte soll denn an Ölgemälde schlimm sein?«, fragte sie. »Das steht doch auch auf dem Schild vom Trödelladen.«
»Jaja«, sagte Tulli, »das ist wieder typisch. Du hörst jetzt sofort auf, mich zu ärgern.«
Dann aber lächelte sie und nahm Plim bei der Hand.
»Jetzt komm doch erst einmal herein und erzähl mir alles. Du bist nämlich wieder viel zu dünn angezogen.«
»… geht das schon wieder los«, murmelte Plim. »Das erzählt mir Primus auch die ganze Zeit.«
Tulli horchte auf. »Wer ist Primus?«
»Er ist ein Freu…«
»DAS IST IHR VERLOBTER!!!«, kam es lautstark von hinten aus der Kiste.
»Was, du bist verlobt?« Oma Tulli traute ihren Ohren nicht. »Warum sagt mir das keiner?«
Jetzt reichte es. Wie eine Wildgewordene fuhr Plim herum und riss den Deckel herunter.
»Das stimmt überhaupt nicht!«, schrie sie in die Kiste hinein. »So eine Frechheit!«
Sie griff mit beiden Händen zu und holte ein Einmachglas hervor, in dem zwei dicke Kröten saßen. Diese hielten sich vor Lachen die Bäuche. Die beiden Taugenichtse hießen Taddel und Mills, und sie waren so etwas wie Plims Mitbewohner. Man hätte auch sagen können: Zauberzutaten vom Wühltisch.
Genau genommen waren es zwei Plagegeister, die zu rein gar nichts zu gebrauchen waren, schon gar nicht zum Kochen. Bewahre, Plim würde die beiden niemals in den Mund nehmen, ganz gleich ob roh oder gekocht. Aber gemäß dem Handbuch für junge Hexen war es praktisch Pflicht, ein paar Kröten zu besitzen. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte Plim sie längst vor die Tür gesetzt. Die zwei Landstreicher hatten nur Unfug im Kopf. Für gewöhnlich schliefen sie am Tag und feierten in der Nacht. Es glich einem Wunder, dass Taddel und Mills um diese Uhrzeit schon ansprechbar waren.
Plim drehte Tulli vorsichtshalber den Rücken zu. Dann ging sie mit ihrem Gesicht ganz nahe an das Glas heran und schaute den Kröten in die Augen.
»Ich will von euch überhaupt nichts mehr hören«, zischte sie, »verstanden? Solange wir hier bei meiner Oma sind, benehmt ihr euch anständig.«
Oma Tulli stellte sich auf ihre Zehenspitzen.
»Was hast du denn da?«
»Gar nichts«, brummte Plim, während sie das Glas zurück in die Kiste stopfen wollte. »Das sind nur ein paar Zutaten zum Kochen. Die sind aber schon abgelaufen … völlig ungenießbar.«
»Oh, wirklich?« Interessiert hob Tulli das Kinn. »Die sehen ja entzückend aus.«
Wie bitte? Das waren ja ganz neue Töne. Taddel und Mills sahen einander an. Dann wandten sie sich Oma Tulli zu und setzten ihr breitestes Unschuldsgrinsen auf. Geschmeichelt winkte Tulli ihnen zu.
Plim ging sofort dazwischen.
»Die sind nicht entzückend«, warnte sie, »ganz im Gegenteil.«
»Ach, nun sei doch nicht so«, widersprach Tulli. »Ich finde sie drollig. Aber Schluss damit. Du kommst jetzt erst einmal herein und isst etwas. Es ist kalt hier draußen. Und deine Freunde nimmst du auch mit.«
»Meine was???«
Doch Oma Tulli hatte die Situation bereits unter ihre Kontrolle gebracht. Wie der Blitz schnappte sie sich das Einmachglas und eilte ins Haus.
Plim ließ verzweifelt die Arme hängen.
»Stell sie in die Waschküche«, rief sie. »Und gib ihnen nichts zu trinken außer Wasser, hörst du?«
Dann folgte sie ihr und ging hinein.
Ein Gefühl der Vertrautheit beschlich Plim, als die Tür hinter ihr ins Schloss fiel. Sie streckte die Nase in die Höhe und schnupperte. Schon am Geruch konnte sie erkennen, wo sie gerade war, und in wessen Haus sie sich befand. Kaum zu glauben, ging es ihr durch den Kopf, aber bei Oma Tulli roch es noch immer genauso wie früher. Diesen Geruch würde sie wohl niemals vergessen. Und auch sonst schien hier drinnen alles unverändert zu sein. Der blecherne Schirmständer stand nach wie vor neben der Tür, die altmodischen Tapeten klebten weiterhin an den Wänden, und auch die zahllosen anderen Kleinigkeiten, die Miss Plim seit ihren Kindheitstagen kannte, befanden sich wie gewohnt an Ort und Stelle.
»Schuhe ausziehen!«, schallte es aus der Waschküche.
Plim zog eine Schnute. Diesen Befehlston konnte sie überhaupt nicht leiden. Aber bei ihrer Großmutter war sie ausnahmsweise folgsam. Sie schnappte sich ein Paar Gästeschlappen, schlüpfte hinein und schlidderte mit Schwung über den Boden in Richtung Esstisch. Auf dieselbe Art und Weise hatte sie es auch als Kind immer getan. Beim Tisch angekommen nahm sie sich einen Stuhl und setzte sich.
Unterdessen kam Tulli aus der Waschküche gelaufen.
»Kindchen«, rief sie, während sie an Plim vorbei in die Hexenküche eilte, »ich komme gleich. Ich mache dir nur schnell etwas zu essen. Das dauert nicht lange.«
Auf Plims Gesicht zeichnete sich ein Lächeln ab.
»Ist gut«, antwortete sie, während sie Tulli hinterherschaute, »meinetwegen.«
Zwar hatte Plim bereits erwähnt, dass sie keinen Hunger verspürte, aber eine Diskussion mit Oma Tulli schien überflüssig zu sein. Ihre Großmutter würde Plim wohl nicht mehr ändern. Für sie würde Plim immer ein kleines Mädchen bleiben. Aber das war vielleicht auch gut so.
Plim lehnte sich zurück. Sie streckte ihre Beine aus und ließ ihren Blick gemächlich durch den Raum wandern. Nach einer Weile begann sie zu schmunzeln. Fast konnte sie sich selbst sehen, wie sie als kleines Mädchen mit einem Hexenbesen für Kinder durch Tullis Haus getollt war. Hier bei ihrer Großmutter, so kam es Plim vor, schien die Zeit stehengeblieben zu sein.
Es war ein einfaches Haus, in dem ihre Oma wohnte. Ein Haus, in dem man sich nur schwer verlaufen konnte. Und nach Plims Erinnerung konnte man sich hier leider auch nur schwer verstecken. Oma Tulli hatte die kleine Plim beim Versteckspiel immer gefunden.
Das ganze Erdgeschoss war der Länge nach in drei Räume unterteilt. Im mittleren Raum, dort wo man vom Garten zuerst hineingelangte, befand sich das Esszimmer. Hier war auch eine Treppe, die hinauf zum Obergeschoss führte. Links vom Esszimmer ging es in die Waschküche und rechts in Großmutters Hexenküche. Diese quoll nahezu über an Vorratsschränken mit Töpfen, Tassen und steinalten Blechdosen. Ein Hexenkessel stand bei der Wand, an der so viele Pfannen hingen, dass man sie kaum noch zählen konnte.