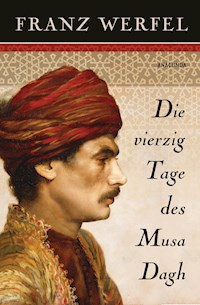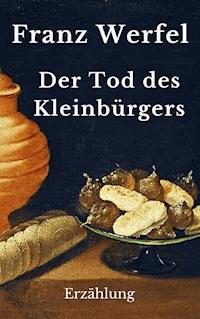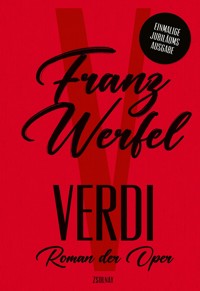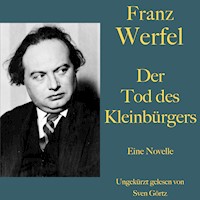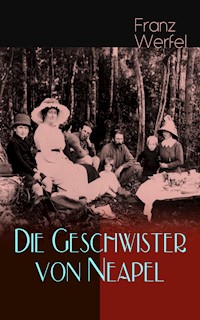
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: e-artnowHörbuch-Herausgeber: GD Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Die Geschwister von Neapel" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Die Geschwister von Neapel ist eine Familiengeschichte des alleinerziehenden Don Domenico Pascarella mit seinen sechs Kindern, drei Jungen und drei Mädchen. Es ist eine Geschichte voller fatalen Kinderliebe und Vaterverehrung. Franz Werfel (1890-1945) war ein österreichischer Schriftsteller jüdischer Herkunft mit deutschböhmischen Wurzeln. Er ging aufgrund der nationalsozialistischen Herrschaft ins Exil und wurde 1941 US-amerikanischer Staatsbürger. Er war ein Wortführer des lyrischen Expressionismus. In den 1920er und 1930er Jahren waren seine Bücher Bestseller. Aus dem Buch: "Neben dem Klavier lehnt wie immer in seiner grünen Hülle Lauros Kontrabaß, einem großen und guten Geschöpf der Vorwelt ähnlich. Es scheint, als hätten ihn die vielen Menschen und Annunziatas Akkorde geweckt, denn aus seinem mächtigen Leib dringt ein langer, ächzend abschnurrender Laut, Wehruf und zorniges Ruhegeheiß zugleich. Nichts ist geschehn, nur die vierte Saite hat sich, durch das Klavier in Schwingung versetzt, völlig entspannt."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Geschwister von Neapel
Geschichte einer Familie
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel Domenica Pascarellas Sonntagsgesang
Der Sonntag hat in jeder Stadt seine besondere Art, und nicht nur der Sonntag als solcher, sondern jeder Sonntag des Jahres und der Jahreszeit anders, und nicht nur in jeder Stadt, sondern in jedem Bezirk und Kirchsprengel verschieden. Den Sonntag verstehn am besten die Kinder, die sehr alten Leute und die Armen, die sich ergeben haben. Die Vollgültigen und Tätigen wollen ihm nicht wohl, sie hassen seine Ruhe, sie stören sie inbrünstig, indem sie das Fußball-Stadion stürmen, in dampfenden Kinosälen sich drängen und mit kriegerischen Schwärmen die Ausflugsnatur überziehn. Diesen Massen zum Trotz hat aber der Sonntag dennoch seinen Charakter nicht verloren, der gemischt ist aus Vergnügen und Schwermut, Frieden und Verzweiflung, Herdenwesen und Verlassenheit, Erwartung und Enttäuschung. Noch immer verströmt der Ruhetag Gottes den schaurig holden Opferrauch jahrtausendalter Heiligung und Sabbath-Innerlichkeit, mögen auch Hupen und Lautsprecher seine Stille immer gehässiger zerreißen.
Für die Geschwister Pascarella jedenfalls hatte er von Kind auf die größte Bedeutung. Diese Sechs, drei Brüder, drei Schwestern, besaßen auf der Welt nichts als einander, so wollte es ihre Veranlagung und das Schicksal. Wohl verbrachten sie auch viele Wochenstunden gemeinsam, aber der Sonntag gab ihrer Einigkeit und Liebe eine altgewohnte Weihe. Die kleinen Zwistigkeiten, Bevormundungen, Eifersüchteleien, die jede Lebensnähe mit sich bringt, schwanden hin, und in der Harmonie schwebte nur ein dunkel drohender Ton, das Vorgefühl, es könne so nicht ewig bleiben.
Dabei muß ernsthaft bezweifelt werden, daß es in der großen Stadt Neapel noch sechs andre junge Leute gab, die sich so widerspruchslos, so innig dem Regimente eines Vaters, wie es Don Domenico war, gebeugt hätten. Kinder der üblichen Art wären längst schon in alle Winde auseinander gestoben. Die Geschwister Pascarella jedoch warteten mit der eigentümlichen Erregung, die sie schon seit vielen hundert Sonntagen kannten, auf die Heimkunft des Vaters. Dies nämlich war einer der Bräuche, aus einem unerschöpflichen Haus-Gesetz erfließend, daß Don Domenico um fünf Uhr heimkehrte, um den Rest des Sonntags unter den Kindern in seinem Palazzo zu verbringen.
Domenico Pascarella allein nannte das Haus »Palazzo«, und mit diesem Worte steigt die erste stolze Unstimmigkeit auf, die zwischen der Wirklichkeit und der Vorstellungswelt dieses außerordentlichen Mannes klaffte. Der Palazzo war kein Palast, sondern ein dreistöckiges Miethaus in der Via Concordia, einer der zahllosen Gassen des bergauf strebenden Stadtteils, der vom Corso Vittorio Emanuele umgürtet und vom Castel Sant' Elmo gekrönt wird. Eine ganz gewöhnliche moderne Straße, ohne Aussicht, ohne Schönheit; das Haus, nicht alt, nicht neu, stammte etwa aus den neunziger Jahren. Man hätte getrost annehmen können, hier in einer ganz und gar gleichgültigen Stadt zu sein. Nur die häufigen Leichenbegängnisse, die sich von der nahe gelegenen Kirche der Santa Trinità zumeist am Samstag nach dem Mittagessen mit ihrer seltsam fröhlich-schnellen Marschmusik auf den Weg machten, sowie manche Straßensänger, heisere Ausrufer, Taschenspieler, Gaukler und Musikanten mit fahrbaren Riesen-Leierkästen zeugten für die romantischen Restbestände der Stadt Neapel.
Das Haus, welches Don Domenico als Palazzo ansprach, besaß in jedem Stockwerk eine bürgerlich geräumige Wohnung. Die mittleren hatten die Pascarellas inne und die Geschwister erinnerten sich keiner anderen Stätte ihres Lebens. Durch ein weitläufiges und dunkles Vestibül trat man in die vierfenstrige »Sala da pranzo«, den erhabenen Raum, wo sich die meisten seelischen und leiblichen Ereignisse des eigenartigen Familienlebens abgespielt hatten und abspielen werden. Neben diesem allgemeinen Versammlungsort lag der »Salotto«, ein weit kleineres Zimmer, das abgesehen von der üblichen Möbelgarnitur angejahrter Salons durch zwei ausdrucksvollere Gegenstände gekennzeichnet war – durch eine alte Empire-Uhr unter Glassturz und durch ein nicht minder altes Pianino der Firma Fritz in Wien. Die Zeit in dieser Uhr war stumm. Seitdem die Kinder sie kannten, standen ihre Zeiger auf halb Zwölf fest, um vielleicht durch diese Beständigkeit dem trotzigen Konservativismus des Hausherrn zu schmeicheln. In den Lichthaltern des Pianinos steckten zwei rote Galakerzen, ein Umstand, der darauf hinzuweisen schien, daß auch dieses Instrument die Rolle eines stummen Prunkstückes spielte. Hier jedoch täuschte der Schein. Denn Annunziata, die älteste Tochter, den andern Geschwistern weit voraus – denn sie war schon siebenundzwanzig –, übte manchmal auf diesem lebensmüden Klavier, freilich nur bei streng geschlossenen Fenstern. Und so sei denn schon an dieser Stelle ungeduldig vorweg verraten, daß sich hier im Salotto das seltene aber wundersamste Ereignis der tiefen Familiengemeinschaft abzuspielen pflegte: wenn Papa an manchem Sonntagabend sein Wesen veränderte und die Lust empfand, mit seiner unbeschreiblichen Stimme ein Stück aus der Lieblingsoper »Gioconda« unter musikalischer Beihilfe Annunziatas, Grazias und Lauros zu singen, während Placido, Ruggiero und Iride den Part des erschauernden Publikums übernahmen.
In die rechte Wand des Salotto war eine Tapetentür geschnitten. Sie führte in das Heiligtum des Hauses, in die »Stanza della Mammina«, in Mamas Zimmer, das man nur selten und dann mit einem innigen Grauen betrat. Dies empfanden am stärksten die beiden jüngsten Kinder, Ruggiero und Iride, obgleich sie an Mama kaum eine Erinnerung hatten. Ruggiero war siebzehn, Iride gar erst dreizehn Jahre alt und Mamas elfter Todestag war in einigen Wochen zu erwarten.
Die Obhut über die Stanza della Mammina lag in den Händen Annunziatas und Lauros, des Neunzehnjährigen, der Mama in Wesen und Erscheinung am meisten glich. Er und die älteste Schwester hatten alle Reliquien der armen Mutter, ihre Lieblingsdinge, die Kleinigkeiten des täglichen Gebrauches, in einer Vitrine und auf einem Tischchen, das wie ein Altar mit weißen Spitzen bedeckt war, zartsinnig geordnet und ausgestellt. Sie sorgten auch für den Blumenwechsel unter Mamas Porträt und für das Licht unterm Madonnenbild.
Mit der Sala da pranzo, dem Salotto und der Stanza della Mammina waren die Gesellschaftsräume (ein völlig unpassendes Wort übrigens) der Familie Pascarella erschöpft. Die Schlafzimmer der jungen Leute lagen auf der Hofseite des Hauses. Annunziata bewohnte mit der kleinen Iride gemeinsam eine Stube, ebenso Lauro mit Ruggiero. Nur Placido, der einundzwanzigjährige Student, und Grazia genossen die Gunst einer eigenen Kammer. Bei Placido, dem ältesten der Brüder, war diese Bevorzugung erklärlich; warum aber Grazia, die Zwanzigjährige, und nicht die um soviel ältere Annunziata ein eigenes Zimmer besaß,, wird gewiß wundernehmen. Vielleicht hatte sich diese Ungerechtigkeit deshalb eingeschlichen, weil Annunziata nach Mamas letztem Willen das Kind Iride pflegen und beaufsichtigen mußte, vielleicht war ihre ganze Wesensart daran schuld, vielleicht auch die heimliche Ausnahmestellung, die Grazia in dem Reiche Don Domenicos einnahm. Als einzige von den Kindern war diese nämlich blond, goldblond sogar, und ihre Anmut wurde von niemand bewundernder, anerkannt als von Annunziata.
Zu den beiden Zimmern Domenico Pascarellas endlich konnte man nur über eine schmale Treppe gelangen. Sie lagen einen Halbstock höher als die übrige Wohnung. So hauste der Vater, wie es in jedem Sinne seiner Überzeugung entsprach, über den Häuptern der Seinigen.
Es wird manchmal behauptet, daß der Name des Menschen zu seinem Wesen in tieferer Beziehung stehe. Mag dies nun ein bloßes Gedankenspiel sein, mag tatsächlich eine solche Durchdringung von Mensch und Nennung stattfinden, im Fall der Geschwister Pascarella zumindest paßten die Namen recht gut zu ihren Trägern. Iride hatte vom Regenbogen das Schimmernde und Unzuverlässige, Lauro vom Lorbeer die Sanftmut und die dunkle Stille. Und Grazia ließ sich gut herleiten von den Grazien oder von der Gnade. Hier aber muß diese eilfertige Allegorie schon ein Ende nehmen. Denn es ist beim besten Willen nicht möglich, die drei anderen ohne gequälte Konstruktionen mit ihren Namen in Übereinstimmung zu bringen. Ruggiero, der jüngste und lebhafteste Bruder, der die Handelsschule besuchte, trug wenigstens einen Spitznamen »Orso«, Bär, wodurch seine erstaunlichen Körperkräfte und deren täppische Verwendung zum Ausdruck gebracht wurden. Nach welcher dienstbaren und demütigen Heiligen aber hätte Annunziata heißen müssen, hatte sie doch die ganze Last der vom Vater eingesetzten Ordnung zu tragen? Sie war als Älteste für die Führung des Hauses verantwortlich. Doch nicht genug damit. Da sie ja die anderen an Jahren so weit überholt hatte, schien sich ihr eigener Weg schon abwärts zu neigen, ohne Erfüllung. Seit einigen Monaten nahm ihr Antlitz eine abweisende Blässe und Magerkeit an. Wenn Placido wirklich nach jenem römischen Feldherrn Placidus benannt war, so steht die Theorie der Wesens- und Namensverwandtschaft wahrhaftig auf sehr schwachen Füßen. Denn Placido war durchaus kein Mann der Tat, sondern ein Dichter, obgleich er sich in dieser Beziehung bisher nur einem einzigen Menschen anvertraut hatte: seiner Schwester Grazia. Für einen Dichter und Philosophen (Worte, die er niemals in den Mund nahm und am allerwenigsten von sich selbst) war seine Stirn, in die das schwarze Haar tief hineinwuchs, etwas niedrig. Sein Gesicht drückte die ständige, fast gespannte Bereitschaft aus, in allen Dingen und Momenten etwas Gutes, etwas Besonderes zu entdecken. Er hatte, um es richtig zu umschreiben, den lauernden Blick der Bejahung, der auf eine Seele schließen läßt, die viel Ekel und Kampf verbergen muß. Er besaß die längste Gestalt von allen Geschwistern. Diese natürliche Überlegenheit suchte er durch ein verträgliches Lächeln, das selten von seinen Zügen wich, gut zu machen.
Es mochte vier Uhr sein. Die feierliche Dämmerung des Wintersonntags nahm in den Zimmern der schmalen Via Concordia Platz. Man hätte ganz gut schon zu dieser Stunde das Licht einschalten können. Wie immer aber, scheuten die Geschwister auch heute davor zurück, dem heimkehrenden Vater eine strahlend erleuchtete Fensterfront darzubieten. Nicht, daß es ihnen jemals verboten worden wäre, Licht zu brennen. Diese Frage war durch keine Bestimmung des geoffenbarten Vater-Gesetzes geregelt. Dennoch aber hätte das sehr alte Feingefühl ihrer Scheu im Entzünden der großen Lüster, wie sie in der Sala da pranzo und im Salotto hingen, eine unerlaubte Überheblichkeit gespürt und die Übertretung jener unsichtbaren aber haarscharfen Grenze, die Don Domenico seinen Kindern gegenüber konsequent zu wahren wußte.
So saßen sie denn im Zwielicht. Placido und Grazia in einer Ecke des Speisezimmers, Annunziata und Lauro in der Stanza della Mammina. Die beiden Jüngsten, Ruggiero und Iride, hatten die Küche auserwählt, zu der man von der anderen Seite des Vorraums gelangte. Priscilla, die Magd, und Giuseppe waren heute frei. An solchen Sonntagen bildete die Küche einen beliebten, weil nicht ganz rechtmäßigen Aufenthalt, nicht nur für Ruggiero und Iride, sondern auch für die Großen. Hier konnte natürlich auch Licht gebrannt werden, nötigenfalls.
Die innigste Gemeinschaft mehrerer Menschen spaltet sich stets in noch intimere Zellen. Der Mensch besitzt nur eine einzige Stirnseite, um zu lieben. Wenn sie auch alle sechs davon überzeugt waren, daß jeder für jeden das Opfer des Lebens bringen würde, so bildeten sie doch seit langen Jahren schon feste Paare.
Das Paar in Mamas kleinem Erinnerungs-Salon flüsterte, wie es hier die Regel war. Lauro hatte sich erhoben und suchte das Porträt der Mutter zu entziffern. Von den Brüdern war er der schönste. Trotz der neunzehn Jahre, die er zählte, zeigte seine Wange keine Spur von Bartanflug. Die Lippen standen immer ein bißchen offen, in den Augen aber war keine Flut und Ebbe, als sei in ihnen das Kampfspiel des Lebens geglättet, ehe es noch begonnen. Seinem Anzug sah man an, daß Lauro manchen Gedanken seiner äußeren Erscheinung widmete und daß es für ihn schmerzhaft gewesen wäre, in ungebügelten Hosen, mit einem plump geschnittenen Rock oder in ausgetretenen Schuhen umherzugehen. Nichts an Lauro gemahnte an einen Schüler, obgleich er noch jünger aussah als er war und in die letzte Klasse des Gymnasiums San Tommaso ging.
Lange schon stand er vor Mama, vielleicht um sich in ihr zu suchen. Aber die Zauberkünste der Dämmerung zerrten sie immer weiter zurück ins Schattenreich. Da rief Lauro seine Schwester leise an und es klang wie eine Vogel-Lockung: »Zia!«
Annunziata fror auf einem der spitzenbedeckten Fauteuils, auf die man sich für gewöhnlich nicht setzte. Das Zimmer war ziemlich kalt, denn nur die Sala da pranzo besaß ein phantasievolles Ungetüm von Ofen. Annunziata saß aufrecht und bewegte kaum den Kopf. Es war symbolisch für ihre Stellung unter den Geschwistern, daß man aus dem Namen Annunziata die Abkürzung »Zia« für sie gewonnen hatte. Zia, das hieß ja Tante. Sonderbarerweise fiel ihr selbst diese Doppelbedeutung nicht auf. Noch einmal rief es: »Zia!« Nun stand sie auf und trat zu dem Bruder. Er starrte noch immer das Bild an, obgleich von Mama nichts mehr zu sehen war. Sie hatte sich in der Dunkelheit aufgelöst wie ein Geheimstoff. Man hätte meinen können, Lauro stelle dem Bild seine Frage und nicht der Schwester:
»Ist es wirklich wahr, daß auch sie ihm immer die Hand geküßt hat, Zia?«
Annunziata klärte Lauro eilfertig auf:
»Natürlich ist es wahr. Sie hat ihm manchmal die Hand geküßt. Wenn sie und wir Kinder an der Tür ihn erwartet haben. Komisch, daß du dich nicht mehr daran erinnerst, Lauro! Du warst doch schon mindestens acht Jahre damals. Und das weiß ich auch noch genau, daß sie es war, die uns gelehrt hat, ihm die Hand zu küssen.«
Lauro versank noch tiefer in das Angedenken des Schattens. Annunziata berührte seinen Arm, um ihn zu mahnen, daß Mamas Stunde nun zu Ende sei. Er aber war mit seinen Fragen an die ältere Schwester noch nicht fertig:
»Sie hat auch über seine Stimme geweint. Das hab ich selbst noch gesehn, glaube ich. Er singt und sie sitzt da und weint. Oder bilde ich mir das nur ein?«
»Nein, Lauro, das bildest du dir nicht nur ein. Es ist ihr fast immer so ergangen. Wenn sie ihn singen gehört hat, sind ihr die Tränen gekommen. Sie hat über seine Stimme weinen müssen. Findest du das so merkwürdig?«
»Ich finde das gar nicht so merkwürdig ...«
Annunziata bekannte wahrheitsgemäß:
»Du weißt, mir geht es ja nicht anders. Seine Stimme zwingt mich einfach dazu. Ich bin froh, daß ich am Klavier sitzen kann. Es ist übrigens sehr lange her, daß er nicht mehr gesungen hat. Vier Wochen, wie?«
»Nein, länger! Seit den Ferien ein einziges Mal. An Grazias Geburtstag ...«
Er unterbrach sich und kehrte seine stillen Augen von der erloschenen Mama ab:
»Zia, kannst du dir vorstellen, daß er nun bald alt sein wird?«
Diese Frage schien Annunziata sehr zu entrüsten:
»Was für gräßliche Gedanken du hast! Woran denkst du denn?«
Man merkte ihm die vergebliche Mühe an, etwas auszudrücken, was äußerst schwierig war:
»Ich denke ... ich denke daran, daß man über Papa nicht nachdenken soll ...«
»Das soll man auch nicht«, entschied Annunziata, als sei es ihre Pflicht, unerlaubte Übergriffe zurückzuweisen.
Gleichzeitig mit diesem Gespräch in der Stanza della Mammina fand ein anderes in der Sala da pranzo statt. Grazia hatte sich mit dem Rücken gegen ein Fenster gestellt. Ihre Gestalt wirkte ganz schwarz und fast posierend wie der Scherenschnitt eines Mädchens aus der Bourbonenzeit. Nur in ihrem aufflammenden Haar gingen die letzten Fensterstrahlen der Sonne unter. Sie suchte aufmerksam den Blick des Bruders, dessen hochgeschossene Figur mit dem vorgeneigten Kopf irgendwo in dem weiten Raum stand und sich der Schwester zu entziehen schien:
»Und warum willst du mir das neue Sonett nicht zeigen?«
Placidos Stimme entschlüpfte noch weiter ins Unsichtbare als seine Gestalt:
»Es dürfte jetzt schon ein Viertel nach vier sein und Papa kommt pünktlich.«
»Papa kommt pünktlich um fünf. Das ist eine schlechte Ausrede.«
Placido hatte seine Verteidigungsposition gewechselt und sprach nun aus einer anderen Richtung her:
»Hör, Grazia, dieses Sonett ist spottschlecht. Es war ein großer Fehler, daß ich es überhaupt erwähnt habe.«
Grazia kannte ihn nur zu gut:
»Das sagst du ja immer, Placido.«
»Und es ist auch immer wahr. Leider. Ich weiß es.«
Das Mädchen wies mit schwesterlicher Begeisterung die unerbittliche Selbsterkenntnis des Dichters zurück:
»Ich aber weiß, daß mir deine Gedichte ebenso lieb wenn nicht lieber sind als die schönsten Sachen von Carducci oder Pascoli. Von den Modernen spreche ich schon gar nicht.«
Dieser Enthusiasmus konnte ihn nicht bestechen. Er entwand sich ihrem Drängen durch folgende Entschließung:
»Ich werde das Ding umarbeiten oder wegwerfen. Wahrscheinlich wird es der einzige Vorzug dieses Sonettes gewesen sein, Graja, daß ich es dir nicht vorgelesen habe.«
Sie verließ das sterbende Fenster und ging auf Placido zu:
»Ich bin stolz, daß du mit mir darüber redest, daß du mir die Gedichte zeigst ...«
Und ohne ihn anzusehn:
»Es ist mir überhaupt das Liebste ... von allem ...«
Er ließ ihrem Geständnis keine Zeit, auszuklingen:
»Du wirst mich nicht verraten. Ich mag Geheimnisse nicht leiden. Aber die andern sollen davon doch nichts wissen. Ich bin zufrieden, wenn es zwischen uns bleibt, wenn du manchmal so gut bist, mir zuzuhören.«
Jetzt lachte Grazia:
»Glaubst du, ich werde so dumm sein, unser Geheimnis auszuplaudern? Mit Zia und Lauro habe ich nie ein Wort darüber gesprochen. Und die Kleinen ...?«
Ein kurzes Zögern, denn sie wußte, daß sie sich auf schmerzhaft heikles Gebiet wage:
»Aber wieso kommt es, daß Papa schon ein- oder zweimal Bemerkungen gemacht hat?«
Placido senkte den Kopf. Seine beinahe zusammengewachsenen Brauen bildeten einen dicken Denkstrich:
»Ich habe keine Ahnung, wieso das kommt.«
Grazia verdächtigte den Diener Giuseppe, den die Geschwister bitter haßten, wiewohl er schon seit zwei Jahrzehnten im Hause lebte. Er hatte sich immer als gehässiger Denunziant und ergebener Spion Don Domenicos entlarvt. Vielleicht war es seiner Witterung gelungen, unter Placidos Papieren Verse aufzustöbern. Der Bruder aber lehnte diesen Verdacht ab:
»Giuseppe, der boshafte Esel? Nein, Graja, ich glaube viel eher, Papa ist allwissend ...«
Er schwächte sein Glaubensbekenntnis ab:
»... wenigstens was uns betrifft.«
Zwischen Bruder und Schwester tauchte das Thema dieses Gespräches immer wieder auf. Placido war ein Tausendkünstler des Ablenkens und Entschlüpfens. Heute aber sollte er nicht entschlüpfen. Grazia fühlte es als heiße Pflicht:
»Warum gehst du nicht zu Papa und sagst ihm, daß du Philosophie studieren willst und nicht dieses langweilige Jus?«
»Ich studiere ja beides. In diesem Semester habe ich auch bei Benedetto Croce inskribiert.«
»Beides, das ist zuviel für einen Menschen«, bohrte sie weiter, »man sieht es dir an. Warum hast du nicht den Mut, zu Papa zu gehn?«
Diese aufrührerische Forderung nach Mut hätte bei jedem Kenner Don Domenicos unzweifelhaft Kopfschütteln erregt. Grazia selbst hatte noch niemals einen solchen Mutbeweis geliefert. Von ihrem Ehrgeiz für Placido hingerissen, gebrauchte sie dies schwerwiegende Wort ohne praktische Vorstellung. Er aber setzte sich nieder und verschlang die Hände über die Knie:
»Ich habe nicht den Mut, wir haben ihn alle nicht, doch ich hätte ihn vielleicht, wenn ...«
Und er sah in der werdenden Finsternis zu Grazia auf, die jetzt dicht neben ihm stand:
»... wenn Papa nicht immer recht hätte. Er hat immer so schrecklich recht. Selbst wenn er etwas ganz Falsches und Dummes sagt. In mir wenigstens, weißt du, ist etwas, nein alles, das ihm recht gibt.«
Sie waren dort angelangt, wo der Weg für die Geschwister Pascarella undurchdringlich vermauert war. Deshalb platzte Grazia kindisch heraus:
»Ich will, daß du berühmt wirst, Placido! Keiner verdient es mehr als du. Und da habe ich recht.«
Er zwang sie, sich neben ihn zu setzen:
»Und was, wenn ich den Spieß umdrehe?«
»Da gibt es nichts umzudrehen.«
»Du hast als einzige von uns allen seine Stimme geerbt. Vielleicht ist deine Stimme die schönste, die es jetzt in Italien gibt, Graja. Maestro Capironi hält sehr viel von dir ...«
»Von mir ...«, schnitt sie ab, »das ist doch alles nur ein Spaß. Ich habe die Stunden bei Capironi sehr gerne. Sonderbar genug, daß Papa sie erlaubt hat. Aber wenn du glaubst, daß ich mir irgendwelche Phantasien meinetwegen mache ...«
»Und meinetwegen machst du sie dir?«
Grazia konnte darauf nicht mehr antworten, denn ein plärrender Lärm drang aus der Küche in die Sala da pranzo.
»Ruggiero und Iride melken Priscillas Grammophon«, stellte Lauro fest, der mit Annunziata zu den beiden andern trat.
Alle liefen sie nun in die hellerleuchtete Küche, die von ihrem Licht auch dem Vorzimmer noch abgab. Auf dem Tisch stand ein ungeschlachter Grammophonkasten, der aus einem gerippten Riesentrichter sein rhythmisches Ton-Spülicht in den Raum schleuderte. Die Köchin Priscilla hatte diesen lärmenden Gegenstand samt zwei ausgeleierten Schallplatten als nacktes Strandgut aus dem Sturm einer unglücklichen Liebe gerettet. Da Domenico Pascarella mechanische Musik verabscheute und nichts dergleichen angeschafft werden durfte, erfreuten sich die unverwöhnten Geschwister an Sonntagen, wie es dieser war, an dem Grammophon der Köchin. Ruggiero, der Orso, fegte im russischen Hocketanz, mit verschränkten Armen, die Beine aus den Knien werfend, über den Steinboden. Sein Gesicht war ganz stumpf vor Eifer und die kleine feste Gestalt zitterte wie ein Motor. Auch Iride tanzte mit tiefernster Versunkenheit. Sie hielt die Finger balletthaft gespreizt, während sie zu dem unterschiedlosen Lärm allerlei auf- und niedertauchende Evolutionen erfand. Das dichte kurze Schwarzhaar blähte sich wie bei einer ägyptischen Plastik um ihr Gesicht, das dadurch mit seinen geschlossenen Augen nur noch kleiner und bleicher erschien.
Nach einer Weile beifälligen Zuschauens machte Lauro vor Grazia eine zeremoniöse Verbeugung. Sie umfaßten einander und begannen zu tanzen. Kein Fremder hätte daran gezweifelt, daß unter den Geschwistern Pascarella dieses das Paar sei, das am innigsten zusammengehörte. Die beiden Jugendkörper verschmolzen in den Schlangenwindungen des Tanzes reizend und zärtlich. Gott weiß, wo sie das so gut gelernt haben können, ging es Annunziata durch den Kopf. Die Wahrheit aber war, sie hatten es nirgends gelernt. Doch nun umfaßte auch Placido die älteste Schwester und führte sie im Wiegeschritt. Der Tanz dieser beiden freilich, der nur zögernd in Schwung kam, hatte etwas von dem entschlossenen Versuch, die Freude anderer nicht zu stören und in einer Welt mitzuspielen, die sich versagt.
Die schreckliche Grammophonplatte erhob den endlosen Schmerzensschrei eines Verwundeten. Die Nadel lief unablässig in der letzten Rille. Ruggiero sprang hinzu und befreite das leidende Wesen. Tiefatmend löste sich Grazia von Lauro. Auf ihrem Gesicht zeigte sich ein unmittelbarer Einfall. Annunziata jedoch spürte sofort, daß es kein unmittelbarer Einfall war, sondern ein Gedanke, der die Schwester jetzt nicht zum erstenmal beschäftigte. Vielleicht sogar spürte die Hellsichtige in Grazias Worten noch mehr, das sich vorbereitende Schicksal nämlich, das den Pascarella-Stamm bis in den Grund erschüttern wird. Die Worte freilich waren mehr als harmlos:
»Wißt ihr«, berichtete Grazia, »was ich von Maria« (eine entfernte Verwandte) »gehört habe? Am Karnevals-Dienstag wird im Hotel Bertolini eine fabelhafte Festa di ballo gegeben ...«
Lauro zuckte die Achseln. Das war nichts Neues. Grazia aber verteidigte das Fest:
»Nein, nicht die übliche Geschichte. Maria behauptet, Einladungen könne man nur sehr schwer bekommen. Die Leute müssen sich darum bewerben. Es soll sehr exklusiv werden. Ein Kostümball übrigens ...«
Placido ließ seinen Blick auf Annunziata ruhn und gab seine Meinung so langsam kund, als treffe er eine äußerst wichtige Entscheidung:
»Ich bin dafür, daß du auf diese Festa di ballo gehst, Graja.« Alle erschraken über solche präzise Kühnheit, Annunziata am meisten:
»Aber Papa ...« Es war ein Ausruf allgemeinen Erschauerns. Die Initiative des Lebens ging einzig und allein von Signor Pascarella aus. Er liebte es nicht, wenn seine Kinder Wünsche und Bitten vorbrachten, was auch so gut wie niemals geschah. Falls sich aber solch eine Bitte nicht vermeiden ließ, so kostete sie den Betreffenden schlaflose Nächte und Qualen der Überwindung, ehe er sie über die Lippen brachte. Nicht nur die notwendigen Dinge des Alltags bestimmte Papa, sondern auch die spärlichen Freuden. Daß aber eine Festa di ballo, eine zuchtlose Versammlung »der feindlichen Welt«, zu den erlaubten Freuden nicht zählte, wußten die Geschwister Pascarella genau. Wohl hatte Don Domenico seiner Ältesten vor langer Zeit ein einziges Mal einen Ball zugedacht, übrig blieb jedoch für die arme Annunziata nichts als die Erinnerung an eine peinvolle Nacht, in der Papas kritische Garde-Augen mit verwirrender Strahlung auf ihr lagen, in der sie sich steil benahm und unfreie Gespräche führte. Wahrscheinlich hatte der Vater mit diesem Ballbesuch nur die Absicht verfolgt, derartige Vergnügungen für alle Zeit ad absurdum zu führen.
»Willst du wirklich«, zweifelte Annunziata, »auf eine Festa di ballo gehn, Graja?«
Grazia schien ärgerlich zu werden:
»Ich auf einen Ball? ... Was fällt dir ein? ... Bin ich denn närrisch?«
Placido ließ Annunziatas Gesicht noch immer nicht aus den Augen.
Wie langgezogen war es schon, wie streng, wie lippenlos! Das unerfüllte Leben warf seine Schatten über sie, lange vor der Zeit. Mußte man Grazias Schönheit nicht davor behüten? Da setzte Lauro den Schlußpunkt unter Placidos Gedanken:
»Und ich bin unbedingt dafür, daß Graja zu diesem Ball ins Bertolini geht ... Man muß nur besprechen, wie man es möglich macht.«
Ruggiero, der die Wichtigkeit dieser lückenhaften aber heimlich erregten Aussprache nicht begriff, hatte inzwischen die andre Platte aus Priscillas Liebes-Schiffbruch aufgelegt. Sie ging mit solchem Granatengeheul los, daß zuerst alle zusammenfuhren und dann in Gelächter ausbrachen. Aber die Nadel hatte kaum ihren halben Lauf vollendet, als der neu beginnende Tanz wiederum jäh unterbrochen wurde, denn an der Wohnungstür draußen machte sich grobes Gepolter bemerkbar. Zuerst erstarrte Placido. Annunziata drückte die Faust gegen das Herz. Lauro und Grazia machten wie in einem schweren Traum, den man nicht gleich abschütteln kann, noch drei Tanzschritte, ehe sie sich ließen. Nur Ruggiero, aktiv und am rechten Fleck wie immer, versetzte der kleinen Schalldose einen Hieb, daß sie zu Boden kollerte. Knirschend aber stumm raste nun die Platte um ihren Mittelpunkt. War es möglich? Hatten sie alle über diesem frechen Lärm die Heimkunft des Vaters vergessen, der sie seit einer Stunde mit sonntäglicher Spannung entgegenwarteten? Sie waren so erschrocken, daß sie angewurzelt standen und keines die Kraft fand, Papa ins Vorzimmer entgegen zu gehn, wie es das Gesetz verlangte. Im Türausschnitt aber tauchte Giuseppes schmaler Greisenkopf auf, mit seinen ertappungsfreudigen Polizistenaugen.
Gott sei Dank! Es war nicht Papa, es war nur Giuseppe, der die Versammlung bitter hämisch musterte, als wären ihm derlei Umtriebe längst bekannt, und er brauche erst gar nicht den Betretungsfall einer überraschenden Rückkehr, um zu wissen, woran er sei. Die eingeborene Sbirren-Natur in diesem Giuseppe, ein Erbstück neapolitanischer Sklavenzeiten, war unüberwindlich. Sie hatte die Geschwister während ihrer ganzen Lebensdauer unzählige Maßregelungen, Strafen, Tränen und Verdrießlichkeiten gekostet. In einer normalen Familie wäre ein solcher Nachschleicher und Angeber nicht alt geworden. Aber die Kinder Don Domenicos erwogen nicht einmal im stillen den Gedanken, sich dieses Skorpions zu entledigen, der das volle Vertrauen Papas genoß. Doch gerade diese ergebene Duldung festigte Giuseppes Stellung von Jahr zu Jahr, so daß er die jungen Herrschaften immer gelassener beaufsichtigte und verklagte. Er unterwarf sich fanatisch der Einzigkeit Herrn Pascarellas, war aber von der unausrottbaren Einbildung besessen, diesem in der Rangordnung des Hauses der Nächste zu sein. Das mochte daher kommen, daß er das Gesetz, unter dem das Haus Pascarella stand, mit der Subtilität und Feinfühligkeit eines unerbittlichen Pfaffen hütete. Er selbst hielt sich für den großen Exekutivbeamten der Vaterschaft. Wenn es ihm auch oblag, den leiblichen Geschöpfen Don Domenicos die Kleider und Schuhe zu reinigen und ihnen bei Tische zu servieren, so bestand seiner Meinung nach zwischen diesen Geschöpfen und ihm ein gemessener Unterschied, solange der Herr seinen Anklagen ein günstiges Ohr lieh. Auch jetzt nickte er mehrmals, um anzudeuten, daß seine Überzeugung von dem ständigen Gesetzesfrevel der sechs Pascarellakinder auch ohne diesen neuen Beweis für alle Zeiten gefestigt sei:
»Eccellenza steht schon unten auf der Treppe«, verkündete er, »und Sie betragen sich wie ...«
Da er keinen Vergleich fand, der seinen Abscheu genügend stark ausgedrückt hätte, verstummte er, packte Priscillas Grammophonkasten mit angeekelten Händen und trug ihn wortlos in den Dienstbotentrakt, der an die Küche grenzte. Auch die Geschwister gingen wortlos aus der Küche und traten im Vorzimmer an.
Es gibt Bilder und Melodien, die den Menschen wie geheimnisvolle Motive seines Lebens immer wieder ergreifen. Mehr aber als alles Geformte graben sich gewisse Gerüche und Geräusche in unsre Empfindungen ein. Wer in einem eingekampferten Zimmer einst Abschied von einem nahen Menschen nahm, wird den Geruch des Kampfers mit der Erfahrung des Abschieds verbinden. Ein alter Seemann im Ausgedinge eines gottverlassenen Fischerdorfs fährt vielleicht nachts aus dem Schlaf, weil er das Rasseln des Gangspills oder das Kreischen des Hebekrans zu hören vermeint. Für die Kinder Domenico Pascarellas war und ist das Geräusch des Schlüssels, mit dem der Vater die Wohnungstür öffnete, solch ein ergreifendes Lebensmotiv. Von ihrer Kindheit her kannten sie die aus Freude und Angst gemengte Empfindung, daß dieses Geräusch minutenlang andaure: Zuerst sucht der Schlüssel, vergeblich und immer ärgerlicher scheltend, das Schloß. Dann hat er den Eingang gefunden und holt Atem, um Kraft zu sammeln. Nicht im ersten Angriff gelingt die Überwindung des Riegels. Und ist dieser endlich zurückgeschnellt, wird der Schlüssel klirrend aus dem Loch gezogen, ehe die Tür sich öffnet und Papa erscheint.
Domenico Pascarella, der jetzt die Tür hinter sich schloß, war keineswegs, wie man bisher hätte vermuten können, »una figura di ferro«, worunter die Italiener einen Mann von Eisen verstehen. Ruggiero allein schien seine kräftige, recht untersetzte, etwas dickliche Gestalt geerbt zu haben. Die beiden anderen Söhne überragten ihn hoch und Grazia ein wenig. Das weiße Haar seines kugelrunden Katerkopfes war stachlig kurz geschnitten, der ebenso weiße Schnurrbart, nicht nach der Mode gestutzt, zeigte ausgezogene Spitzen. Trotz diesem Haar, in dem kein dunkler oder grauer Faden mehr wuchs, erweckte Don Domenico in keinem Augenblick den Eindruck des nahenden Greisentums. Er war ein firmer energischer Herr ohne Alter, wie sie zumeist auf dem Gebiet des Militärs oder des Staatsdienstes gedeihen, vielleicht erst fünfzig, vielleicht schon siebzig.
Den Reigen der Begrüßung eröffneten Iride und Ruggiero, die sich mit beinahe erbittertem Eifer auf Papas Hand stürzten, um sie zu küssen. Nachdem – es schien dem Alter nach zu gehn – auch noch Lauro zum Handkuß gekommen war, schnitt Don Domenico die Zeremonie ab, indem er die drei übrigen Geschwister mit einem stummen Wink bedachte. Dann erst legte er Stock und Mantel ab, wobei ihm Placido behilflich war. Damit war nach alter Sitte der Akt des Empfanges zu Ende, ohne daß auch nur ein Wort gefallen wäre.
Ruggiero stürmte voraus und schaltete die großen Lüster im Speisesaal und im Salotto ein. Nun strahlte die Wohnung der Pascarellas im hellsten Licht, während der Hausherr sie befriedigt aber immer noch stumm durchschritt, um sich zur Waschung in seine Räume zu begeben.
Die Geschwister standen nun alle um den großen Familientisch in der Sala da pranzo, jedes hinter seinem Sessel. Nur Annunziata, die heute in Abwesenheit Priscillas das Mahl zu verwalten hatte, band eine Schürze um und verschwand in der Küche.
Es ist der Sinn jeder Familienrunde um einen großen Tisch, daß ihre Mitglieder einander zugewandt sind, während sie der Welt den Rücken kehren. Don Domenico, der jetzt den Vorsitz in der Mitte seiner Kinder übernahm (rechterhand Annunziatas leerer Stuhl und links Grazia), war von dem hohen Wert dieses Sippenverhaltens restlos überzeugt. Er mußte sich geradezu Mühe geben, damit keines der Geschwister das Behagen, ja die stille Freude merkte, die ihn immer angenehmer erwärmte. Rasch versicherte er sich, daß kein Strahl dieses Behagens die geziemende Finsternis seiner väterlichen Züge durchdringe. Da hatte er sich ein wohlgeratenes Planetensystem großgezogen, das in ihm sein Lebenszentrum, seine Sonne sah und ihn dankbar umkreiste. Lauter junge, lauter schöne Gesichter, wenn man sichs eingestand, die aufmerksam, ja gierig an ihm hingen. Und sie alle seine Kreatur, sie alle aus seinem Fleisch geholt, eine sechsfache Vervielfältigung und Erweiterung seiner selbst. Der armen Mama billigte er nicht viel Anrecht an dieser Schöpfung zu. Die sechs Geburten, und zwei mißlungene außerdem, hatte er an ihrer Seite glücklich überstanden. Nun war sie der tote Mond, er aber war noch immer die lebendige Sonne, dem sie alle dienten, den sie alle liebten, Annunziata, Grazia, Iride, Lauro, Ruggiero und Placido. Placido? Nein mit dem Jungen stimmte etwas nicht. Dieses tiefsinnige Grinsen war aufreizend. Man mußte sich beizeiten vorsehen. Und angesichts seines Sohnes Placido zog eine erzürnte Wolke über Pascarellas milden Gemütshimmel. Giuseppe stellte vor Don Domenico eine Weinkaraffe hin und reichte den Kindern mit strengem Ernst Tee und Bäckerei. Auch dies war geheiligter Sonntags-Ritus. Selbst Giuseppes hoheitsvolle Serviermiene schien ausdrücklicher als sonst zu verkünden: Seht her, ihr Unwürdige, wie euch Eccelenza durch meine Hand mit Wohltaten überschüttet! Während der Mahlzeit wurden einige Fragen der vergangenen Woche besprochen, aber so, daß weder Annunziata, noch einer der anderen Erwachsenen zuerst das Wort ergriff, sondern jeglicher abwartete, bis der Vater die betreffende Sache zur Sprache brachte. Es ging nicht laut zu an diesem Tisch, doch machte keines der Geschwister einen unglücklichen, gelangweilten oder fluchtsinnenden Eindruck, sondern alle hatten lebhaft gespannte Augen, als wohnten sie einem packenden Schauspiel bei und nicht einer häuslichen Sonntagsstunde.
Nachdem die Tassen abgeräumt waren und nur mehr das einsame Weinglas vor Don Domenico stand, schob er ein wenig seinen Stuhl vom Tisch, und es erfolgte jene Vermahnung, die nur an ganz besonderen Sonntagen stattfand. Sie diente erstens dazu, die obersten Grundsätze des Pascarella-Kanons den jungen Leuten einzuschärfen, doch überdies sollte sie die einzigartige Lage der Familie dartun, die auserwählt war und verborgen zugleich. Sooft sie schon an die Söhne und Töchter ergangen war, sie konnten ihrer nicht genug haben, da sie das Selbstbewußtsein in wohltuend grusliger Art erhöhte:
Ob sie überhaupt wüßten, eiferte der Vater, welcher Familie anzugehören sie die Ehre hätten? Was sei der ganze neapolitanische Adel gegen die Pascarellas? Diese Kammerdiener der Bourbonen, diese Packträger, die der saubere Signor Murat zu Herzogen erhoben hatte! Ein Conte Pugno-Sarti, ein Duca Dallorso, ein Ventignano, ein Spagnuoli tue so, als kenne er Domenico Pascarella nicht, wo seine, Domenicos, Ahnen in diesem Lande schon herrschaftlich gelebt hatten, als jene gute Gesellschaft noch irgendwo die Landstraßen der Welt mit zerrissenen Stiefeln bevölkerte. Er könne sich noch seines Großvaters erinnern. Das war einer der größten und reichsten Herren seiner Zeit gewesen und insbesondere Neapels. Er sehe die goldgeräderte Karosse noch vor sich, mit der er an der Seite seines Vaters ins Land gefahren sei, um den Ahnherrn auf einem seiner Schlösser in der Campagna zu besuchen. Tausend Morgen mindestens hatten dazu gehört, Weinberg und Weide, Acker und Herrschaft. Die blonden Haare des Großvaters seien im Lande ringsum berühmt gewesen. Grazias Haar bilde nur einen schwächlichen Abglanz jener Glorie, die sonnenklar beweise, daß der römische Urstamm der Pascarellas sich mit der normannischen Edelrasse gekreuzt habe, um einen Familienwert hervorzubringen, der jedes einzelne Mitglied mit strengen Pflichten belehne. Don Domenico sprach von der Ewigkeit dieser Ehre und vom vergänglichen Zufall aller Glücksgüter. Sippen wie die seine, die ohne Anfang seien, müßten dunkle, gewissermaßen unterirdische Zeiten in Ruhe und Reinheit ertragen. Schon mit seinem Vater habe der Abstieg begonnen, und als er, Domenico Pascarella, zwanzig Jahre alt war, sei er arm und verlassen dagestanden. Und noch heute im Alter plage er sich und kämpfe, um den Seinigen ein ähnliches Jugendlos zu ersparen.
Bei diesem Punkte jedoch verweilte Papa nicht lange, denn er sprach mit den Kindern niemals über die Angelegenheiten seines Berufes. Dies war eine der unergründlichen Eigentümlichkeiten des Gesetzes, das er selbst errichtet hatte. Hingegen stellte er jetzt eindringlich die Frage nach den Ursachen des Niedergangs. Er kam zu dem Schluß, daß ein eigenes Verhängnis, ein spezielles Familienverhängnis wider die Pascarellas am Werke sei. Obgleich die Geschwister noch niemals von dem Verhängnis etwas verspürt hatten, nahmen sie die Offenbarung doch gläubig hin. Nach Papas Worten hätte man meinen können, die ganze Welt sei nichts andres als ein Instrument der genannten Schicksalsfeindschaft. Außerhalb dieser Sala da pranzo gab es nur falsche Götzen, nur Verschwörer, nur wuterfüllte Hasser. Mit erhobener Stimme forderte Don Domenico seine Kinder auf, die Menschen zu meiden, keine Geselligkeit zu suchen, den sogenannten Vergnügungen, Ehren, Erfolgen und ähnlichen »Vordringlichkeiten« unbedingt aus dem Wege zu gehen. Jeder Abfall von seiner Lehre werde sich zwangsläufig an ihnen rächen. Es gebe nur eine Rettung vor dem allgemeinen Welthaß, unantastbar zu leben. Sie sollten sich fest aneinander klammern, alle sechs, dies sei der wahre Rückhalt, alles andere sündiger Wahn.
Don Domenico sprach meist nicht viel. Diese Predigt aber drang aus seinem Innern und so kleidete er sie in ernstes Pathos. Er sah nun seine Kinder der Reihe nach an, um in ihren leuchtend hingegebenen Augen die Nachwirkung zu lesen. Als sein Blick aber Placido, den ältesten Sohn, berührte, der am weitesten entfernt saß, trat des Vaters Kinn gewalttätig und höhnisch vor:
»Mein Herr Sohn Placido ist vielleicht anderer Meinung?«
Der Student zuckte zusammen:
»Wieso ich, Papa?«
Don Domenico aber schob sein Glas fort und brüllte:
»Wieso ich, wieso ich? Ecco il poeta! Ecco il philosopho!«
Unter dieser knallenden Verhöhnung duckte sich Placido, zog die Schultern hoch wie ein Kind und wurde feuerrot. Die andern sahen starr aufs Tischtuch. Nur Grazia wandte ihr Gesicht voll dem Bruder zu.
In der nächsten Minute jedoch schien Domenico Pascarella seinen unbegründeten Wutausbruch wieder vergessen zu haben. Er zog bedächtig seine Brieftasche und entnahm ihr ein Couvert, das er Annunziata mit den Worten reichte:
»Da habe ich etwas für euch!«
Auch dieser Vorgang pflegte sich alljährlich um die Weihnachtszeit abzuspielen, wenn die Eröffnung der Opernstagione im Teatro San Carlo vor der Tür stand. Trotz dem Anathema gegen die feindliche Welt und der Verwarnung vor menschlicher Geselligkeit hielt Don Domenico doch streng darauf, daß seine Familie bei dem großen gesellschaftlichen Ereignis des ersten Opernabends nicht fehle. Seit Menschengedenken hatten die Pascarellas immer die Loge Nummer drei, links, erster Rang bei dieser Gelegenheit innegehabt, zwischen den gräflichen und herzoglichen Logen der Pugno-Sarti und Dallorso. Er selbst hatte vor fünfzig Jahren zum erstenmal in Begleitung der Eltern den goldroten Raum San Carlos betreten und erinnerte sich, von seinem Vater gehört zu haben, daß dessen schöne Großmutter schon am selben Ort im Reifrock zu thronen pflegte. Nummer drei, links, erster Rang war an einem Abend des Jahres ein geheiligtes Anrecht, ein ewiges Servitut der Familie Pascarella. Diese Tradition durfte nicht unterbrochen werden. Gehörte man auch nicht mehr zu den Glänzenden und Reichen, so war man doch nicht emporgekommen, sondern nur verblaßt. Man war Familie. Stolze Bescheidenheit und Zurückhaltung vor einer durchaus haßerfüllten Welt – sonst der erste Artikel des Pascarella-Gesetzes –, sie durften bei der Eröffnung von San Carlo für einige wenige Stunden suspendiert werden. Sinnbildlich bewies man so vor den Augen jener kalten strahlenden Welt, wer man gewesen und wer man immer noch war. Drei schöne Mädchen, wohlgekleidet und onduliert, dienten zum herrlichen Symbol. Doch hatte diese Ausnahme von der großen Regel noch eine andre Wurzel in der Seele Don Domenicos, die heiße Vorliebe für Opernmusik.
Signor Pascarella hatte sich auch diesmal der Loge schon versichert, ehe noch der allgemeine Vorverkauf begann. Während er sonst seine Kinder überaus knapp hielt und das karge Taschengeld nicht überschritten werden durfte, erkundigte er sich jetzt nach den Toilettenverhältnissen der jungen Damen und bestimmte eine Summe zu deren Erneuerung. Den Söhnen ihrerseits wurde gleichzeitig gestattet, sich je eine Galeriekarte zu besorgen, denn die Pascarella-Loge durfte keinen plebejisch überfüllten Eindruck erwecken.
Freie Menschen, auch solche, die in dürftigen Umständen leben, können kaum ermessen, was für die ausgehungerten Seelen der Geschwister der kommende Theaterabend bedeutete. Es war unbegreiflich viel mehr als ein reizvolles Vergnügen, es war das Tor des Lebens, das sich blendend öffnete. Einmal im Jahr hob Papa das unerbittliche Weltverbot auf. Die Phantasie aber umspielte die winkenden Opernstunden mit dumpfen und trunkenen Hoffnungen. Die Freude der Kinder war doppelt rührend dadurch, daß sie sich, angesichts des unermeßlichen Respekts vor dem Vater, nach innen schlug. Nicht einmal Iride, die vor ihrem ersten San-Carlo-Besuch stand, wagte es, ihren Empfindungen anders Luft zu machen als durch wilde Grimassen, die sie heimlich schnitt. Don Domenico aber erlebte nun den Höhepunkt seines Sonntagsbehagens, als er mitteilte:
»Man gibt die Gioconda mit der Rasa und Montesanto.«
Der Cartellone, das Repertoire der Operngesellschaft, war ihm diesmal günstig gesinnt, das mußte selbst er zugeben. Seit Jahrzehnten war er der »Gioconda« leidenschaftlich zugetan und versäumte keine Aufführung. Auch die wohlbekannten Namen der Sänger ließen Gutes erhoffen. So ergab denn eines das andre. Papa verfiel in ein gesammeltes Schweigen, das die Geschwister mit wonnigen Ahnungen erfüllte. Dann schmunzelte er kaum merkbar, erhob sich feierlich und gab Ruggiero den halblauten Befehl:
»Schau, ob alle Türen gut geschlossen sind, auch die Küchentür!«
Die Wirkung war zauberhaft. Endlich gewährte dieser Sonntag nach langer Entbehrung wieder die Weihestunde, die für alle sieben mehr bedeutete als nur Musik. Stürmisch sperrten die beiden Kleinen die Küchentür ab, indem sie zweimal den Schlüssel umdrehten. Ein kleines Rachegelüst spielte mit, denn nun war Giuseppe gefangen und ausgestoßen. Grazia öffnete das Klavier. Annunziata entzündete die Galakerzen und selbst Placidos Wunde schien geheilt, denn er holte mit freudigen Händen den Klavierauszug von Ponchiellis Oper aus dem Kasten. Don Domenico freilich brauchte keinen Klavierauszug, denn einerseits konnte er keine Noten lesen und andererseits wußte er die ganze Gioconda, Text und Melodie, bis zum geringfügigsten Rezitativ auswendig.
Lauro aber entfernte ein grünes Tuch von einem großen Gebilde, das bisher unbemerkt im Klavierwinkel des Salotto gelehnt hatte. Und plötzlich war ein gewaltiger Kontrabaß da. Nein, kein Irrtum! Es war wirklich eine Baßgeige, die sich jetzt wie ein gutmütiges Riesentier der Vorwelt von dem Jüngling umarmen ließ. Lauro, der Ruhige, dessen klaren Grund man immer zu sehen vermeinte, überraschte die Geschwister von Zeit zu Zeit mit Ungewöhnlichkeiten. So war er eines Tages unversehens mit diesem Kontrabaß angerückt, dessen Meisterung er von einem Mitschüler, dem Sohn eines Orchesterprofessors, erlernt hatte. Von Stund an betreute er den melancholischen Giganten mit zärtlicher Fürsorge wie ein lebendiges Geschöpf, indem er ihn vor allzu großen Temperaturunterschieden schützte, nach dem Spiel vorsichtig zudeckte und seine Saiten entspannte. (Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß Lauro die Tiere innig liebte. Schon als kleines Kind hatte er sich immer einen Hund gewünscht. Zu Don Domenicos Eigenheiten aber gehörte ein wütender Hundehaß. Vor dem Kontrabaß hatte der Knabe eine Schildkröte besessen, die er in einem kleinen Korb bewahrte und mit großer List vor Giuseppes Spürsinn zu verbergen verstand.) Nun hielt Lauro das mächtige Instrument umschlungen, das in grobe Arme gehörte und breiter Brustkästen bedurfte. Es stand in seltsamem Widerspruch zu des Spielers schmächtiger Figur und zu seiner zärtlichen Aufmerksamkeit. Er neigte sich tief über die Saiten und stimmte sie, um zu des Vaters Gesang und Zias Klavierbegleitung den Baß richtig schrummen und zupfen zu können.
Don Domenico aber trat in die Mitte des Salotto, wölbte die Brust, stellte einen Fuß vor den andern und legte den Kopf zurück. So bot er den dreien, die sich als Hörerschaft niedergelassen hatten, Placido, Iride, Ruggiero, ein Bild löwenhafter Bereitschaft dar. Und wahrlich, löwenhaft schön und stark war seine ungealterte Stimme, als er nun begann:
»O monumento! Regia e bolgia dogale! Atro portento! Gloria di questa e delle età future!«
Es war nicht nur herrlicher Gesang, was auf den Wogen dieser ungelehrten Stimme den versperrten Raum überflutete, es war das tiefe Wesen dieses Mannes, das nun im Tonstrom alle Konvention durchbrach, herrisch, keinen Widerspruch duldend, niederschmetternd, im Recht. Mit geröteter Stirn und halbgeschlossenen Augen sang er sein Leben aus, verströmte er singend sein Leben, ohne es zu verlieren, ja, die Substanz dieses Lebens schien um so stärker zu werden, je mehr er von ihr hingab. Vielleicht aber war es nicht nur sein Leben, das ihm aus der Brust drang, vielleicht war es das uralte Leben aller Pascarellas, das diesen Ausweg suchte.
Die Kinder machten Katzenbuckel und starrten vor sich hin. Wie im Banne einer unerträglichen Lust. Placido konnte sich kaum beherrschen. Lauro vergaß das Schrummen und Zupfen. Annunziatas Begleitung klang immer dünner, denn schwere Tränen störten sie beim Spiel. Und da hätte ihre Mutter, die kränkliche sanfte Frau, nicht weinen sollen, der Übermacht dieser Stimme standhaltend?
Don Domenico hatte die berühmte Ansprache des Spions Barnaba an die venezianische Bocca di leone beendet, an das Löwenmaul der Inquisition, das alle Anzeigen und Verratsbriefe verschlingt. Jetzt gab er Grazia einen Wink, mit ihm das Schlußduett der Oper zu singen:
»Si, il patto mantengo – lo abbiamo giurato, Gioconda non deve – quel giuro tradir.«
Und als sich nun die dunkelgelbe Stimme des Vaters mit der hellen Stimme der Tochter im Zwiegesang umschlang, durchzuckte die Geschwister Pascarella ein Augenblick des Gefühls, so voll, so verflochten, so rätselhaft, daß die Worte sich weigern, ihn anzurühren.
Zweites Kapitel Die Welt draußen
»Ah, Maulaufreißer, Wichtigmacher!«
Diesen Ausrufen, die von jenseits des Doppelschreibtisches kamen, der nebst der eisernen Kassa und einem abweisenden Sofa das enge Studio fast vollständig ausfüllte, schenkte Don Domenico nicht die geringste Beachtung. Eines der wenigen Laster, die er an Signor Renato Battefiori gefunden hatte, war ein phantastischer Zeitungsverbrauch, der alltäglich zu dieser Stunde, um elf Uhr vormittags einsetzte. Das ging schon seit mehr als dreiundzwanzig Jahren so, Pascarella sah von seiner Arbeit auf und überzeugte sich, daß sie alle in altgewohnter Weise versammelt waren, die »Stampa«, »Corriere della Sera«, »Mattino«, »Tribuna«, »Sole«, »Giornale d'talia«. In wüsten Formationen, halbzerknüllt, flügelschlagend, abrutschbereit, bedeckten sie den Schreibtisch seines Teilhabers. Wenn er es recht überlegte, so war die Schreibtischseite Battefioris der schwerst erträgliche Umstand dieser zwanzigjährigen Gemeinschaft. Im schreienden Gegensatz zu seinem eigenen ordnungsstrotzenden Gebiet bot sie das Bild einer stets sich wandelnden Erdbebenlandschaft. Die Post von einigen Tagen, umgestürzte Aschenbecher, Regimenter von Zigarettenresten übersäten die grüne Fläche, deren Farbe unter Tintenklecks und Aschenregen kaum mehr hervortrat. Ein Wunder, daß Battefiori bei solchen anarchischen Gewohnheiten seine Sache so trefflich verstand und das Geschäft nicht nur über die Kriegsjahre, sondern auch über die verschiedenen Entwertungszeiten heil hinüber gebracht hatte. Sehr schön! Aber Battefiori sollte sich nicht zu viel einbilden, er, ein alter Junggeselle. (In dieses Wort legte der Vater einen Abgrund von Verachtung.) Die Seele, das Rückgrat, der absolute Halt der Firma war und blieb doch er allein, Domenico Pascarella. Wohl hatte der Junggeselle den Parteienverkehr und Börsendienst im kleinen Finger. Er besaß unzählige Bekanntschaften, die immer neue Verbindungen ergaben: die Tugenden eines Straßenlungerers, Kaffeehausgastes, Allerweltsfreundes, kurz eines Junggesellen. All diese bodenlosen Künste wären ohne seine, Pascarellas, Ruhe und Sicherheit nutzlos und gefährlich gewesen.
Aus dem Zeitungsgewölk tauchte jetzt für einen Augenblick eine Glatze mit fünf eisengrauen Haarsträhnen, die an ihr klebten, und ein Gesichtchen dazu, schief geneigt, fast bittflehend, das zu jenen empörten Ausrufen gar nicht passen wollte. Dieser Anblick versöhnte Don Domenico. Battefiori gehörte nicht zur feindlichen Welt, so wenig er zu seinem eigenen Hause gehörte. Er war gewissermaßen ein Anrainer des Pascarellahauses und die Azienda hier lag vor den Toren dieser Burg. (Don Domenico nannte das Büro »Azienda«, so wie er sein Wohnhaus »Palazzo« nannte.)
In Wirklichkeit lag die Azienda keineswegs vor den Toren des Palazzo, sondern ziemlich weit davon entfernt auf dem großen Platz, der sich gegenüber dem Renaissance-Prachtbau des Castel Nuovo und dem Municipio entfaltet; und zwar auf dem unteren Teil dieses Platzes, hafenwärts, und nicht etwa oben, gegen die Via Roma oder Toledo zu. Dies muß eigens deshalb betont werden, damit es niemandem einfalle, die kleinen Bankgeschäfte, die auf der erwähnten oberen Seite liegen, mit der Azienda Domenico Pascarellas zu verwechseln. Und hier öffnet sich abermals eine widerspruchsvolle Perspektive. Don Domenico war seinem Beruf nach Bankier, wollte jedoch kein Bankier sein, und einer von der Via Santa Brigida schon gar nicht. Nein, er war kein Geldmensch. Sein durch das Verhängnis zerstörter Jugendtraum hatte der Landwirtschaft gegolten. Jetzt genoß er das Vertrauen der Weinbauern, Gastwirte und kleinen Schiffsleute der Umgebung. Diese Braven aus Capua, Caserta, Marcianise, Benevento, Avellino, Majori, Salerno vertrauten ihm ihre Ersparnisse an, die er verwaltete, und basta! Alles andre gehörte auf Battefioris Pflichtseite. Im übrigen konnte er sich über den Sozius nicht beklagen. Nicht nur hatte dieser im ersten Augenblick schon erkannt, wer Don Domenico war, er hatte auch unverzüglich die Konsequenzen aus dieser Erkenntnis gezogen und sich immer bedingungslos unterworfen. Noch heute wahrte er die gebührende Form und federte respektvoll auf, wenn Don Domenico das Lokal betrat. Noch heute vermied er jeden Widerspruch und hörte mit angespannten Zügen die Wahrworte Pascarellas an, ohne sie zu unterbrechen. Für diesen waren solche Manieren nicht minder wichtig als die Tatsache, daß Battefiori auch bei großen Transaktionen nicht mit der Wimper zuckte. So hatte Don Domenico vor einigen Monaten die Mitgift seiner Töchter dem Unternehmen entzogen, um sie an sicherster Stelle vor allen Schwankungen zu schützen. Battefiori erklärte sich damals sofort einverstanden damit, ohne daß er wußte, zu welchem Zwecke das entnommene Kapital verwendet werde. Ebensowenig wußten übrigens die Mädchen, daß Papa für ihre Zukunft wirke und sorge. Was ging es sie auch an? Seiner Auffassung nach hatten junge reine Mädchen von Geld noch mindere Kenntnis zu haben als von Liebe. Don Domenico bevorzugte die verhüllte und unangesagte Tat. Es lag in seiner Natur, niemanden einzuweihen und diejenigen, die von ihm abhingen, am allerwenigsten. Auch Battefiori erfuhr seine Pläne erst im letzten Augenblick.
Einmal freilich hatte sich der kleine Mann gerächt. Das war die Geschichte im Vorjahr, als Domenico Pascarella eines Tages in die Azienda kam und die Tafel mit der dicken Aufschrift vorfand: »Cambio Valute – Geldwechsel«. Ein schweres Vergehen Battefioris, und er mußte es auch wochenlang büßen. In langen dramatischen Dialogen erschöpfte er händeringend aber vergeblich die kräftigsten und stichhaltigsten Argumente: Die Fremdensaison! Zehntausend Ausländer! Die gute Örtlichkeit! Die bereits erworbene Konzession! All dies zerschellte an des Gegners starrem: »Ich bin kein Wechsler!« oder: »Hängen Sie sich einen Korb um und klappern Sie in der Galleria mit Münzen, wenn Sie wollen!«
Doch auch diese Komödie fand eine des Protagonisten würdige Lösung. Als Battefiori an einem Herbstmorgen ins Geschäft kam, sah er nun seinerseits die verfemte und lang schon abmontierte Tafel wieder an der Azienda prangen. Was war geschehen? Hatte ihm Don Domenico vergeben? Nein! Er hatte nach längerer Überlegung seinen Willen gesetzt. Damit aber war der Geldwechsel zum vornehmen Gewerbe erhoben, was er ja auch unbedingt ist, wenn man an die verschiedenartigen Geschäfte der Großen, der Fürstlichkeiten und Politiker, denkt.
Domenico Pascarella beugte sich über seine Arbeit. Sie bestand darin, daß er mit roter, blauer, grüner Tinte und den dazu gehörigen Federn, sorgfältig liniierend und rastrierend, gewöhnliche weiße Kanzleibogen in kompliziertes Buchhaltungspapier verwandelte. Dies aber war beileibe keine Marotte des Geizes, der an Schreibutensilien Ersparnisse machen will. Wie ein empfindlicher Mann keine fertigen Schuhe kauft, so konnte er, dem die Buchführung oblag, keine fertigen Rubriken brauchen. Wie man sieht, mußten sich demnach auch die toten Dinge vor diesem Charakter beugen.
Die Stimme von drüben eiferte noch immer:
»Alato discorso! – Elevata dichiarazione! – Parole vibranti! – Pensiere eterni! – Un urlo frenetico della immensa folla! – Die unermeßliche Menge ein einziger frenetischer Aufschrei! O Gott, was noch?!«
Don Domenico liniierte ruhig weiter:
»Wie oft ermahne ich Sie schon, von all diesen unreinen Zeitungen abzulassen?!«
Battefiori stieß melancholisch zischend den Atem aus seiner allzu schmalen Nase:
»Sie haben leicht reden, mein hochverehrter Don Domenico. Sie sind ein Mann, wie es keinen zweiten mehr gibt. Sie besitzen Ihre eigene Welt. Sie sind glücklich. Aber ich? Versetzen Sie sich bitte einmal in solch einen Unglückswurm, wie ich es bin! Alt, einsam, verloren und, wenn ich auch mein tägliches Brot habe, schiffbrüchig. Was bleibt mir? Zum Ersatz für ein verspieltes Leben will man wenigstens erfahren, was vorgeht ...«
»Durch diese Blätter erfahren Sie ganz gewiß, was nicht vorgeht.«
In einem Anfall von entschlossener Ordnungsliebe faltete daraufhin Signor Battefiori seine Zeitungen zusammen, als sei er nunmehr durch Pascarellas schlagende Antwort für Zeit und Ewigkeit bekehrt:
»Das haben Sie brillant gesagt. Wie immer! Es ist alles Lug und Trug.«
Er neigte sein demütig lauschendes Runzelgesicht vor:
»Manches würde Sie vielleicht doch interessieren, Don Domenico ... Wissen Sie, was die Herrschaften da vorhaben? Sie wollen die moderne Unmoral abschaffen. Sie wollen zur römischen Familie zurückkehren. Alle Macht den Familienvätern! Denn die Familie ist der Kern des Staates und der Staat ist der liebe Gott. Interessant, was?!«
Don Domenico rastrierte und antwortete nicht. Battefiori aber gab es nicht auf, ihm die Ideen des neuen Regimes auseinanderzusetzen:
»Zweck des Ganzen ist es – man liest es hundertmal –, es soll wieder eine Autorität errichtet werden.«
Domenico Pascarella legte nachdrücklich die Feder hin:
»Autorität hat man, aber man errichtet sie nicht.«
Ein Schein wehmütiger Begeisterung erleuchtete Battefioris Gesichtchen:
»Mit Ihnen werden auch jene Helden nicht fertig, Don Domenico.«
Und nach einer Pause setzte er seine Klage leise fort:
»Ich trage mein Schicksal zu Ende. Aber wissen Sie, daß Sie der einzige Mensch auf der Welt sind, den ich beneide?«
Signor Pascarella brauchte trotz seinem Alter noch keine Brille. Ernst prüfte er ein neues Blatt. Battefioris Klage erklang immer inniger:
»Ah, Sie sollten meinen Neid begreifen! Es wird Mittag zum Beispiel. Was tun? Die Arbeit ist fertig. Man muß essen. Also auf zu Targiani! Und am Abend die gleiche Geschichte. Also auf zu Esposito! Manchmal auch umgekehrt. Das ist die ganze Abwechslung. Ich will gar nicht davon reden, daß der Magen schwach, das Essen miserabel und die Speisekarte immer die gleiche ist. Aber alleinsitzen, mein sehr verehrter Herr, einsam tafeln?! Reden Sie jetzt nur nichts von Freunden! Wenn ich mir erlauben darf, aufrichtig zu sein, der einzige Mensch, den ich mir als Freund gewünscht habe, ... doch das wissen Sie ja selbst.«
Don Domenico machte eine ebenso knappe wie inhaltsreiche Bewegung. Sie drückte etwa aus, daß er nicht die Schuld trage, wenn Battefiori es nicht zum Familieneigentümer gebracht habe, daß ferner das minderwertige Los von Junggesellen weitverbreitet und allgemein bekannt sei und daß endlich ihm selbst nichts peinlicher wider den Geschmack gehe als sentimentale Grenzübertretungen in einem sachlichen Verhältnis. Des ungeachtet aber verwandelte sich die Elegie des Schreibtischgefährten jetzt nach und nach in einen Dithyrambus:
»Und Sie, Don Domenico? Jawohl, mein Neid malt sich es gierig aus, wie Sie sich nach Geschäftsschluß Ihrem Hause nähern. Ihr Herz schlägt zufrieden und ruhig. Sie wissen, das junge Volk wartet Ihrer. Es ist eine ganze Welt, die auf Sie wartet, und eine wohlgeratene dazu. Ahnen Sie denn, was Sie besitzen?«
Hier mußte der Entbehrende mit dem Taschentuch unters Augenglas fahren:
»Ihre Kinder, Don Domenico, sind die reinsten Engel ...«
Während dieses Lobgesanges hatten die Augen Pascarellas immer nervöser, immer sprungbereiter dreingesehen. Als Battefiori zur näheren Charakteristik der Geschwister übergehen wollte, wurde er heftig unterbrochen:
»Ich bitte höflich, sich um andere Dinge zu kümmern!«
Des Vaters Abwehr mußte dabei ihr Bewenden haben, da aus dem kleinen Laden unten, wo die Straßenkundschaft empfangen wurde, der Stimmenklang einer Meinungsverschiedenheit empordrang. Der Kassier arbeitete in einem anderen Raum und zwei ältere Beamte befanden sich auf Geschäftswegen, so daß im Laden nur ein junger Praktikant dem Publikum zu Diensten war. Um deshalb nach dem Rechten zu sehen, verließ Don Domenico den sehr betrübten Lobredner und betrat die schwanke Wendeltreppe, die unmittelbar vom Studio abwärts führte.
An einem Pulttisch stand ein großer schlanker Engländer, der Hut, Handschuhe und ein Bündel mit Fünf-Pfund-Banknoten vor sich hingelegt hatte. Der Praktikant suchte ihm durch Gesten und einige englische Brocken klar zu machen, daß er, laut einer neuen gesetzlichen Verordnung, seinen Paß vorweisen müsse, wenn er Geld zu wechseln wünsche. Der Engländer andrerseits deutete ebenfalls durch Gesten und englische Brocken an (erfahrungsgemäß meint mancher im fremden Lande sich besser verständlich machen zu können, wenn er die eigene Sprache gebrochen stammelt), kurz, der Engländer deutete auf gleiche Art an, daß er nicht daran denke, seinen Paß vorzuzeigen.
Don Domenico verhielt sich vorerst neutral und betrachtete eingehend den Kunden. Ein ausgesprochenes Interesse für dieses Britengesicht fesselte seinen Blick. Es war kein sehr junges Gesicht mehr, wohl über die Vierzig, denn das volle weiche Haar hatte schon jene Färbung, von der man nicht weiß, ob sie aschblond oder aschgrau ist. Die Wangen hingegen strahlten von einem gesunden Rot, einem knabenhaften, windaufgerauhten Rot. In den ruhigblauen Augen aber stand das humorvolle Vergnügen zu lesen, das ihnen der kleine Kampf bereitete, der eben ausgefochten wurde.
Nachdem dieser mit Zeichen- und Brockensprache noch eine Weile hin und her gegangen war, fragte Domenico Pascarella endlich seinen Angestellten nicht ohne Hoheit:
»Was will er?«
Der junge Mann versicherte mit einem dichten Schwarm von Worten, daß es zum Verzweifeln sei, daß der Herr ihn schon eine halbe Stunde aufhalte, weil er die Erlässe der Regierung nicht anerkennen wolle und, obgleich er das diesbezügliche Verordnungsblatt mit eigenen Augen gesehen habe, die Vorweisung seines Passes verweigere. Don Domenico zeigte durchaus kein Entsetzen über die Widerspenstigkeit der Kundschaft. Er selbst verurteilte die Übergriffe des Staates, die sich von Tag zu Tag mehrten, die Schikanen der verschiedenen Ämter, die Dreistigkeit der Steuerkommissionen, den Druck des politischen Lebens. Und weil er hier in seiner Azienda Herr sein wollte und nicht ein Schalterbeamter der Post oder Eisenbahn, rief er dem Kommis zu:
»Sag ihm, er soll seine Adresse aufschreiben und Schluß!«
Diese Entscheidung hatte einen unerwarteten Effekt. Der Engländer öffnete den Mund zu einem herzlichen Lachen, zog aus der Brieftasche seinen Paß, zeigte ihn mit freundlicher Verbeugung Herrn Pascarella und schrieb dann steil und großzügig auf ein Blatt Papier:
»Mr. Arthur Campbell, Hotel Bertolini.«
Indessen hatte der Praktikant seine Umrechnung beendet und reichte sie dem Fremden. Da alles nun in guter Ordnung seinen Lauf nahm, wollte Don Domenico den Raum schon verlassen, als ihn neue Unzufriedenheit des Engländers wieder zurückhielt. Der offizielle Kurs des Pfund Sterling, den der Quälgeist mit dem Fingernagel hartnäckig unterstrich, lautete auf fünfundvierzig Lire und etliche Centesimi. Der junge Mann hatte dreiundvierzig, fünfzig eingesetzt und schwor in voller Erregung, daß weder die Banca Commerciale noch der Credito Italiano einen anderen Tageskurs auszahlten. Nur die Gegenwart seines Chefs hinderte ihn daran, unverschämt zu werden. In diesem aber stieg wieder der alte Unwille über die Wechselstubenidee Battefioris auf, die er zuerst so streng bekämpft und dann selbst verwirklicht hatte. Der Handel mit diesem ausländischen Querulanten bewies ihm ihre innerste Unwürdigkeit. Er schob den Kommis beiseite, rechnete die Summe nach dem gedruckten Kurs um und zählte dem Engländer viertausendfünfhundert und etliche Lire wie mit Peitschenhieben auf den Tisch hin. Da hatte er aber die Rechnung ohne seinen Kunden gemacht. Dieser schüttelte den Kopf, nahm nun selbst den Bleistift zur Hand und zog von der Summe jenen Prozentsatz ab, den er nach seinen heimischen Erfahrungen der Wechselbank zu entrichten hatte. Lächerlicherweise unterschied sich der Betrag nicht viel von dem, den der Praktikant vorhin ausgesetzt hatte. Dann steckte Mr. Campbell, aufs höchste befriedigt, die ihm gebührenden Banknoten ein und ließ den Rest auf dem Pulttisch liegen. Don Domenico aber nahm weder von diesem Vorgang noch von dem zurückerstatteten Gelde die leiseste Notiz. Er stand abgesperrt und unbeteiligt da, als hänge er fernen, stolzen Gedanken nach, in denen der schmutzige Valutenverkehr dieser Gegenwart keine Rolle spielen durfte. Das hinderte den Fremden aber nicht, mit schönen Zähnen fröhlich zu lachen und Herrn Pascarella voll ins Gesicht zu sehen wie einem sympathischen Mann, dem zu begegnen eine erfreuliche Sache war. Zum Schluß reichte er ihm auch noch die Hand. Und so unglaublich es klingen mag, Don Domenico faßte die Hand des ungeladenen Gastes und vergaß sogar, ein recht liebenswürdiges Lächeln zu unterdrücken, wie sehr er sich auch nachher darüber ärgerte.
Der Abschluß dieses ungewöhnlichen und folgenreichen Geschäftes hatte einige Zeit gekostet. Es war zwölf Uhr und der Praktikant machte schon Anstalten, den Laden zu sperren. Für Don Domenico war die Stunde seines alltäglich pedantisch durchgeführten Mittagsspazierganges gekommen. Als er seinen Kompagnon Renato Battefiori davon in Kenntnis setzte, daß die Freizeit angebrochen sei, entgegnete dieser, für ihn gebe es keine solche Einteilung, er sei immer frei, er könne speisen oder fasten wie es ihm beliebe und fühle jetzt gerade das Bedürfnis, alle Rückstände aufzuarbeiten und neue Schlingen voraus zu werfen. Diese Antwort bewies klar, daß Battefiori ein unverbesserlicher Geist der Unordnung war und daß er in kindischer Bosheit dem Senior die Lebensleere vorwarf, die ihn plagte. Dieser ließ ihn in seinem Rauchnebel und in der Korrespondenzwüste zurück, in der er fahrig zu hantieren begann.