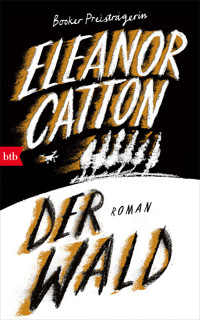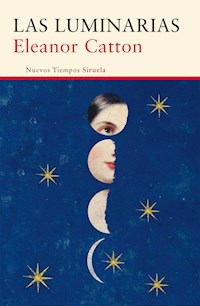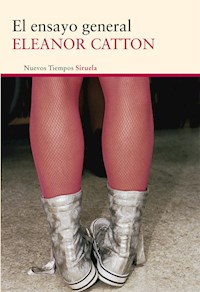9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einer Hafenstadt an der wilden Westküste Neuseelands gibt es ein Geheimnis. Und zwei Liebende, die einander umkreisen wie Sonne und Mond.
Als der Schotte Walter Moody im Jahr 1866 nach schwerer Überfahrt nachts in der Hafenstadt Hokitika anlandet, trifft er im Rauchzimmer des örtlichen Hotels auf eine Versammlung von zwölf Männern, die eine Serie ungelöster Verbrechen verhandeln. Und schon bald wird Moody hineingezogen in die rätselhaften Verstrickungen der kleinen Goldgräbergemeinde, in das schicksalhafte Netz, das so mysteriös ist wie der Nachthimmel selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1342
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
»Nennen Sie Eleanor Catton einWunderkind. Mit 28 Jahren hat sieals jüngste Autorin allerZeiten den Booker-Preis gewonnen.Er ist jede Seite ihres eindrucksvollenfast 1000-seitigen und dennocherstaunlich luftigen Romans wert!«
Entertainment Weekly
Auslieferung: 9. November 2015Die Gestirne | ca. 1000 Seiten. | Geb. mit SchutzumschlagISBN: 978-3-442-75479-3eISBN: 978-3-641-15896-5Das Hörbuch erscheint zeitgleich im Hörverlag.
www.btb-verlag.de
»Das Buch ist mitGoldstaub bestreutund inOpium getränkt.
Ein viktorianischesEpos fehlte derneuseeländischen Literaturbislang.
Catton hat gewagt,diese Lücke zu füllen.«
The Guardian
INHALT
Wenn der Goldstaub sich legtBooker-Preis für »Die Gestirne« von Eleanor Catton
Das große InterviewEleanor Catton über Liebe, die Deutung der Sterne und Ruhm
Aus der ÜbersetzerwerkstattMelanie Walz über die spannende Arbeit am Text
Exklusive Leseprobe
WENN DER GOLDSTAUB SICH LEGT
Booker-Preis für »Die Gestirne« von Eleanor Catton, Bill Roorbach, The New York Times, 16.10.2013
»Die Gestirne«, dieser beeindruckende zweite Roman Eleanor Cattons, für den sie 2013 mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet wurde, besitzt viele Facetten – sehr viele Facetten –, aber neben allem anderen ist er letzten Endes eine Liebesgeschichte, die gut 1000 Seiten braucht, um sich zu erfüllen. Und er ist auch kein Roman im herkömmlichen Sinn, sondern ein erzählerisches Gespinst, das sich vor unseren Augen in Luft auflöst, eine astrologische Voraussage, die schwindet wie der abnehmende Mond, mit einem ersten Teil von knapp 500 Seiten Länge und einem letzten von wenigen Zeilen. Aber diese Zeilen haben es in sich.
In dem Maß, in dem die Struktur des Romans sich entzieht, enthüllt die wachsende Finsternis ein Firmament, das seinen eigenen Gesetzen folgt, von der Autorin mit astrologischen Karten angereichert, die ich zwar nicht deuten konnte, aber trotzdem fasziniert betrachtet habe. Ein Dutzend Hauptfiguren wechselt sich darin ab, die Geschehnisse aus jeweils eigener Sicht zu berichten. Sie präsentieren und arrangieren ausgedehnte Szenen, erleiden Schusswunden und Vergiftungen, werden aus Kalkül Huren, überleben Seestürme, entdecken in Kleider eingenähte Schätze, verlieren den Fund und finden ihn wieder. Wir begegnen einander entfremdeten Brüdern, unternehmungslustigen Geistlichen, unehrlichen Magnaten, investigativen Journalisten, Maori-Weisen, Trickbetrügern und chinesischen Goldsuchern. Zuletzt gilt unsere Anteilnahme den eingangs erwähnten Liebenden, die durch Schicksal und menschliche Machenschaften getrennt wurden und denen wir bei allen Wirrnissen ein gutes Ende wünschen.
Die Lektüre ist sehr vergnüglich, fast so, als würde man ein Kreuzworträtsel zum Thema Charlotte Brontë lösen – was manche Leser zur Verzweiflung treiben, in anderen aber sportlichen Ehrgeiz wecken dürfte. Ich habe beide Wirkungen am eigenen Leib erfahren: In neidloser Bewunderung des unerschöpflichen Wissens und der hohen erzählerischen Kunst dieser jungen Neuseeländerin verlor ich manchmal den Faden, wünschte mir hin und wieder weniger kühle Distanz, genoss die gewollt altmodisch ausführlichen Kapitelüberschriften, staunte über das astrologische Fachwissen, recherchierte dauernd im Internet, kratzte mich ratlos am Kopf, lachte vor Begeisterung und seufzte vor Befriedigung, blätterte zurück und las mit neugieriger Erwartung gebannt weiter.
BOOKER-PREIS 2013 für Eleanor Catton
Zeit der Handlung sind die späten sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts, Schauplatz ist die Goldrausch-Stadt Hokitika im wilden Südwesten Neuseelands, wo die Maori seit Jahrhunderten Pounamu – eine Art Jade – förderten, einen von ihnen verehrten heiligen Stein. Dass in dieser Gegend auch unheiliges Gold gefunden werden kann, interessiert die Ureinwohner nicht, wohl aber die europäischen Einwanderer. Hokitika ist erst wenige Jahre alt, aber es gibt bereits stattliche Herrenhäuser, ein Gefängnis, das einen Neubau erhalten soll, ein Gericht, eine eigene Zeitung, Bars in Hotels, Bordelle und Banken und einen lebhaften Schiffsverkehr in dem Hafen mit seiner gefährlichen Einfahrt. Die Geschichte beginnt – wie könnte es anders sein? – in einer dunklen und stürmischen Nacht mit der Ankunft eines bis auf die Knochen durchnässten jungen schottischen Anwalts namens Walter Moody, der auf der Flucht vor dem Unglück zu Hause sein Glück als Goldsucher in Neuseeland machen will.
Im Crown Hotel begibt Moody sich in das Rauchzimmer, um sich aufzuwärmen, und trifft dort auf eine Versammlung von zwölf Männern, die sich verdächtig unverdächtig benehmen. Schnell ahnt Moody, dass sie sich nicht zufällig eingefunden haben. Nachdem die zwölf den jungen Schotten kritisch beäugt und ausgefragt haben, ziehen sie ihn ins Vertrauen: Jeder von ihnen sieht sich unwillentlich in ein mysteriöses Netz von Verbrechen verwickelt, und sie wollen gemeinsam Aufklärung schaffen. Obwohl Moody auf dem Schiff etwas Grauenhaftes erlebt hat, tritt er so kühl und gelassen auf, dass er sich das Vertrauen der zwölf Männer erwirbt.
Einer nach dem anderen berichten die Anwesenden nun ihre Sicht der Dinge, und der Leser versucht genau wie Moody, aus den vielen Facetten, die sie präsentieren, ein einheitliches Bild zu gewinnen.
Ein einsiedlerischer Goldgräber ist in einer Hütte in den Bergen ums Leben gekommen. Ein Vermögen ist verschwunden. Verwickelt in diese Vorgänge sind offenbar ein ehrgeiziger Politiker, ein dubioser Schiffskapitän, eine misshandelte Prostituierte, ein versklavter chinesischer Arbeiter und ein stoischer Maori-Jadesammler. Hinzu kommt das unerklärliche Verschwinden eines allseits beliebten jungen Goldgräbers, des reichsten Manns von Hokitika, und das plötzliche Auftauchen der vorgeblichen Witwe des verstorbenen Einsiedlers. Allgemeines Erstaunen, dass dieser eigenbrötlerische alte Einzelgänger verheiratet gewesen sein soll. Und die neu auf der Bildfläche erschienene Ehefrau ist eine vormalige Puffmutter, die sich nun ein respektables Ansehen verschaffen will, indem sie Seancen veranstaltet. Goldgräber glauben an Zeichen und Voraussagen.
Je weiter die Geschichte sich entfaltet und je mehr Einzelheiten offenbart werden, desto mehr verdichtet sich das Geheimnis und spornt die Neugier des Lesers an.
© Robert Catto
»Neulich stellteich fest, dass ich amselben TagGeburtstag habe wieF. Scott Fitzgerald.«
Ein Gespräch mitEleanor Cattonüber Liebe, die Deutungder Sterne und Ruhm
Das Interview führte Joan Flemingfür die Website »The Lumière Reader«, lumiere.net.nz
J. F. Seit der Verleihung des Booker-Preises haben Sie zahllose Interviews gegeben. Wozu würden Sie sich inzwischen am liebsten nicht mehr äußern?
E. C. Zu meinem Alter und zum Umfang des Buchs. Einmal wurde ich gefragt, ob ich die Absicht gehabt hätte, die bisher jüngste Booker-Preis-Gewinnerin zu werden. Ich sah die Dame etwas befremdet an, und sie beeilte sich, ihre Frage zu präzisieren: Nun ja, ob ich beabsichtigt hätte, das umfangreichste Buch zu schreiben, das je mit dem Booker-Preis ausgezeichnet wurde. Ich weiß nicht, was man auf solche Fragen antworten soll. Leider wurden sie oft gestellt. Offenbar verwechseln die Leute das Schreiben mit der Jagd nach Rekorden. Ich hatte nicht vor, einen Rekord aufzustellen.
Sie haben einmal gesagt, in »Die Gestirne« sei mehr von Ihnen eingegangen als in Ihren ersten Roman »Anatomie des Erwachens«. Wie ist das zu verstehen?
Als ich »Die Gestirne« schrieb, musste ich in gewisser Weise mein Inneres entblößen. Ich musste mehr riskieren, und damit gibt man viel von sich preis: Ich musste mich der eigenen Feigheit und den Grenzen meines Könnens stellen, bevor ich meine Hemmungen überwinden konnte. Vielleicht könnte man sagen, dass das, was von mir in das Buch eingegangen ist, eng mit dem allwissenden Erzähler verwoben ist, aber auch mit dem Umstand, dass es in dem Buch so viele männliche Protagonisten gibt; weil es für mich keinen eigenen Platz gab, musste ich überall sein, wenn Sie mich verstehen. Auf den ersten Blick könnte man denken, mit den Figuren in »Die Anatomie des Erwachens« hätte ich mehr Gemeinsamkeiten, aber als denkender und fühlender Mensch finde ich mich in »Die Gestirne« viel stärker wieder. Dieses Buch glaubt an das, woran ich glaube, es sucht, was ich suche, irrt sich, wie ich mich irre, und liebt, was ich liebe.
Darf ich das fragen? Was lieben Sie?
Ich liebe unbedachte Formen der Liebe – Enthusiasmus, Leidenschaft, abgöttische Liebe. Emery Staines, in dem Roman zuerst die Sonne und später der Mond, ist für mich das liebende Herz des Buchs. Er ist fürchterlich naiv. Aber seine Naivität ist eine Art hoffnungsvoller Projektion, eine eigenwillige Freude an allem, was merkwürdig ist, und an allem, was gut ist. Menschen wie ihn liebe ich, Menschen, die sich lieber bezaubern und täuschen lassen, als zynisch und ehrbar zu sein.
»Dieses Buch glaubtan das, woran ichglaube, es sucht,was ich suche, irrt sich,wie ich mich irre,und liebt, was ich liebe.«
Ich wüsste gern, in wieweit die Psyche der Figuren astrologischen Lehrsätzen entspricht. Die völlige Ichbezogenheit des Bankiers Charlie Frost, seine Unfähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen oder sie auch nur wahrzunehmen, ist das typisch für einen Stier? Oder nur typisch für Charlie Frost?
Die Astrologie ist geschlechtsorientiert. Die gleichen Voraussetzungen manifestieren sich unterschiedlich bei Männern und Frauen, weil Männer und Frauen in unserer Zivilisation ganz verschieden behandelt werden – abhängig vom Geschlecht werden manche Persönlichkeitseigenschaften befürwortet und andere bemängelt. Harald Nilssen, der Kaufmann, hat als Waage zum Beispiel einiges von mir, aber auf gebrochene Weise; als männliche Waage teilt er das Geschlecht mit seinem Tierkreiszeichen (als Luftzeichen ist die Waage männlich), und deshalb verkörpert er das Wesen der Waage. Als weibliche Waage, als Frau, die unter einem männlichen Tierkreiszeichen geboren wurde, stelle ich es dar. Ein männlicher Stier könnte sich mit Frost identifizieren – die Subjektivität ist der Schlüssel des Empfindens des Stiers, von Männern dargestellt, von Frauen verkörpert –, aber man kann sich nur mit jemandem identifizieren, wenn man dazu bereit ist. Mir gefällt die Unterscheidung zischen Verkörpern und Darstellen, sie hat vielleicht etwas mit C. G. Jungs Unterscheidung zwischen Introversion und Extraversion gemeinsam, indem sie sich auf eine unterschiedliche Richtung oder Bewegung bezieht. Virginia Woolf und James Joyce sind ein gutes Beispiel; beide waren Wassermann, was sie darstellte und er verkörperte. Neulich stellte ich fest, dass ich am selben Tag Geburtstag habe wie F. Scott Fitzgerald, und mir gefällt die Vorstellung, ich könnte darstellen, was er als Person verkörperte. Doch dann stellte ich fest, dass David Cameron am selben Tag Geburtstag hat wie P. J. Harvey – na, danke.
Wie schätzen Sie die weltweite Aufnahme der neuseeländischen Literatur ein? Gibt es eine stereotype Reaktion, wenn Leute erfahren, dass Sie Neuseeländerin sind?
Im Allgemeinen scheint man sich darüber zu wundern, dass ich hier lebe, als wäre Neuseeland ein Ort, den man verlässt, nicht einer, wo man bleibt. Man fragt mich, ob ich bald nach New York oder nach London ziehen will. Aber ich habe eigentlich nie den Eindruck, dass mein Schreiben mit dem Schreiben anderer neuseeländischer Autoren verglichen wird oder dass man mich in eine neuseeländische literarische Tradition einzuordnen versucht. Ich glaube, dass es außerhalb unseres Landes keinen ausgeprägten Begriff von neuseeländischer Literatur gibt.
»Ich kann garnicht sagen,wie oft ich michbeim Lesen derHarry-Potter-Bücherschier totgelachthabe …«
Der Schauplatz Ihres Romans »Die Gestirne« ist aber unübersehbar Neuseeland. Finden Sie Ihr Buch auch auf andere Weise mit einem »neuseeländischen Schreiben« verbunden – wie man es auch definieren mag?
E. C. Eine der Merkwürdigkeiten des Neuseeland-Goldfiebers bestand darin, wie wenige der Goldsucher im Land blieben; ein Goldfund galt als Weg nach Hause. Ich habe den Eindruck, dass in Neuseeland noch immer die Vorstellung gilt, wenn man es zu Geld bringt, sollte man dieses Geld am besten anderswo ausgeben – als wäre ein Leben in London oder New York lebenswerter, lebendiger oder interessanter als ein Leben in Wellington oder Christchurch. Te Rau Tauwhare und Charlie Frost sind die zwei Figuren meines Romans, die in Neuseeland geboren sind, und als Widder und Stier versinnbildlichen sie Objektives und Subjektives, Adam und Eva der zwölfteiligen Geschichte des Tierkreises. Ich stelle mir gern die Geschichte Neuseelands als Mischung aus beiden vor: stolz wie Tauwhare und gleichzeitig gehemmt wie Frost. Ich weiß, dass ich mich davor gedrückt habe, Ihre Frage zu beantworten; wahrscheinlich liegt es daran, dass es mir leichter fällt, Geisteshaltungen in der neuseeländischen Literatur auszumachen als Traditionen. Auch das könnte eine Art Tradition sein: dass gefühlsmäßige Verbindungen unsere Literatur stärker geprägt haben als formale Verbindungen, wenn man es so nennen will.
Sie sagten, »Die Gestirne« seien eine Reaktion auf angestrengt intellektuelle Romane ohne jeden Humor. Und tatsächlich sind »Die Gestirne« nicht nur eine dicke Ladung Handlung, Psychologie und Philosophie, sondern darüber hinaus unvergleichlich unterhaltsam und witzig. Beim Lesen habe ich mich immer wieder dabei überrascht, dass ich laut auflachen musste. Gibt es eine literarische Tradition dieser ernsten Unernsthaftigkeit, der Sie sich verbunden fühlen?
Selbstverständlich: Kinderbücher. Kinderbücher haben immer eine ethische und moralische Botschaft, sie sind fast immer sehr lustig und sind ausnahmslos Zaubergeschichten. Die in ein System gebrachte Zauberei in Kinderbüchern kann man mit den Grenzen des philosophischen Gedankenexperiments vergleichen – ein Kinderbuch ist sinnlos, wenn es nicht witzig und lustig ist. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich mich beim Lesen der Harry-Potter-Bücher schier totgelacht habe, aber ich könnte auch nicht sagen, wie viel Zeit ich damit zugebracht habe, über die Liebe, über Opfer und Mut nachzudenken, wie sie in diesen Büchern ergründet werden.
Die astrologische Struktur des Romans bewirkt einen Dialog zwischen Schicksal und Zufall, zwischen Natur und Erziehung, zwischen Umständen und Glück. Aus astrologischer Sicht könnte man sagen, dass jede Entscheidung der Figuren vorherbestimmt ist – ihre Schritte sind vorherbestimmt in Einklang mit der Sternenkonstellation zu ihrer Geburtsstunde. Der Plot wird durch verblüffende »Zufälle« vorangetrieben, und die Protagonisten sind miteinander verwoben und verbunden. Diese labyrinthischen Beziehungsgeflechte haben als Hintergrund eine Stadt des Goldrauschs in unbeständigen Zeiten, in einer Zeit, in der das Geschick eines Mannes oder einer Frau sich über Nacht unversehens wandeln konnte. Glauben Sie an das Glück oder an das Schicksal, an die Vorherrschaft der Natur über die Erziehung?
Als ich astrologische Karten zu Rate zog, um das Muster meines Plots zu entwerfen, bestimmte ich in gewisser Weise die Form meiner Geschichte, aber der Begriff der Vorherbestimmung hat letztlich keinen Sinn für das Entstehen eines Romans, der sich im Lauf der Zeit von selbst ergibt.
»Können Siesich einenRoman ohneZufällevorstellen?«
Ich habe jedes Tierkreiszeichen bewusst ausgesucht und habe mir trotzdem erforderlichenfalls alle Freiheiten gelassen. Oft genug fand ich mich an die Wand gefahren und war wochenlang ratlos, mit dem Muster konfrontiert, ohne herauszufinden, wie ich damit umgehen sollte, wie die einzelnen Tierkreiszeichen untereinander kommunizieren. Mein Plot enthält viele Zufälle, und manche sind alberner als andere. Aber können Sie sich einen Roman ohne Zufälle vorstellen? Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Geschichten brauchen Verbindungen, und das sind die Zufälle.
Glück und Schicksal oder der Konflikt zwischen Natur und Erziehung sind für meine Begriffe Interpretationsmöglichkeiten; ihr Nutzen hängt für mich davon ab, welche Bedeutung sie generieren. Was mir gar nicht gefällt, ist die Art und Weise, in der im letzten Jahrhundert die wohlhabenden und konservativen Kreisen sie vereinnahmt haben, aber ich glaube, sie können alle drei nützlich sein, wenn man nach einem Sinn sucht. Manchmal kann es immens sinnstiftend und deshalb immens notwendig sein, an das Glück, das Schicksal oder die Natur zu glauben. Gegen Ende des Romans stellt sich heraus, dass Emery Staines’ Glückssträhne genauso übertrieben worden war wie Annas Glücklosigkeit; letztlich haben die anderen in beide das hineinprojiziert, was ihnen selbst entspricht, ihren Wertvorstellungen, ihren Wünschen.
Der Booker-Preis verändert vieles – für Sie, für Ihre Schriftstellerlaufbahn und auch für Ihr Bankkonto. Was planen Sie mit dem Geld?
Ich glaube, ich werde etwas Vernünftiges tun und mir ein Haus kaufen – eine aufregende Vorstellung für jemanden, der nichts lieber tut, als Möbel umzustellen (zum Entsetzen meines Freundes und zum Entzücken unserer Katzen). Die Dankesschuld, die ich beim Schreiben der »Gestirne« angesammelt habe, kann ich nicht mit Geld abtragen. Ich will unbedingt weiter am Manukau Institute of Technology unterrichten, die Freundschaften lebendig erhalten, die mir wichtig sind, und die Beziehung zu meiner Familie.
______________________
INTERVIEW mit Eleanor Catton, von Joan Fleming am 4.11.2013.
Eleanor Catton kommtnach Deutschland!
Lesungen im LiterarischenColloquium Berlin undin den LiteraturhäusernHamburg, Köln undMünchen, vom16. bis 20. November 2015.
»Ich könnte jetzt als Goldschürferarbeiten –oder als Medium in einemWahrsagerbetrieb.«
Literaturübersetzerin Melanie Walz über ihre spannende Arbeit am Text
Eleanor Catton hat in ihrem Roman ein historisches Panorama entworfen, das nicht nur ein Bild des Goldrauschs im Neuseeland der Mitte des 19. Jahrhunderts entfaltet, sondern auch die sozialen und kulturellen Gegebenheiten der Herkunftsländer der nicht neuseeländischen Protagonisten der Geschichte beleuchtet. Dieses anspruchsvolle Unterfangen hat sie mit einer formalen Besonderheit unterfüttert: Das Buch besteht aus zwölf Teilen, entsprechend den zwölf „Häusern“, den Abschnitten oder Zeichen des Tierkreises; den ersten Teil bilden zehn Unterabteilungen, die den astrologischen Konstellationen von zehn Protagonisten zugeordnet sind, den zweiten Teil elf Abteilungen, von denen zehn wiederum zehn Protagonisten gelten, und im Verlauf der Erzählung werden die Teile und Unterabteilungen immer kürzer, während die erläuternden Überschriften im gleichen Verhältnis immer ausführlicher werden, bis zuletzt die Überschriften länger sind als der eigentliche Text des entsprechenden Kapitels, und all das ist in Anlehnung an astrologische Konventionen angelegt.
Bei der Lektüre des Romans war mein erster Eindruck ein doppelter; zum einen der Eindruck der beinahe schlafwandlerischen Sicherheit der Verfasserin im Verfügen über ihr sprachliches Repertoire, ihr Stilbewusstsein, das sie eine gratwandlerische Balance wahren lässt, die sie vor dem Absturz in platte historisierende Klischees ebenso bewahrt wie vor einem allzu hochgestochenen »feinen« Ton oder – schlimmer noch – dem Verfallen in das ermüdende Aufzählen all der interessanten Fakten, die man im Lauf seiner Recherchen ausgegraben hat. Und zum anderen war es der Eindruck der Raffinesse, mit der sie die Geschichte, die sie erzählt, gewissermaßen vom Ende her aufrollt, indem sie jeden Protagonisten seine Sicht der Dinge darstellen lässt, woraus sich erst nach und nach ein Gesamtbild ergibt, das bis zum Ende lückenhaft bleibt und erst auf den letzten Seiten vollendet wird. Es ging mir beim Lesen dieses Romans fast ein bisschen wie bei Quentin Tarantinos Film »Pulp Fiction« – nach der ersten Lektüre will man das Buch sofort noch einmal lesen, um endlich zu wissen, wo es wirklich anfängt und aufhört. Kann man über einen Roman etwas Besseres sagen?
Als ich das Manuskript gelesen hatte, wusste ich sofort, dass ich dieses Buch gerne übersetzen würde. Das ständige Austarieren, wie man die sehr überlegte und gekonnte Sprache Eleanor Cattons in eine passende deutsche Form gießen soll oder kann – nicht übertrieben modern, nicht altertümelnd, ist ein Vergnügen. Und oft muss man einfach beherzt auf die eigene Inspiration vertrauen, um eine gute Lösung zu finden.
Nach Abschluss der Übersetzung werde ich – darauf darf ich vertrauen – in der Lage sein, jederzeit in einem neuen Goldfundgebiet als Goldschürferlehrjunge zu arbeiten, notfalls auch in einem Wahrsagerbetrieb als Pseudomedium oder schlimmstenfalls als Schankkraft in einem mittelklassigen Bordell. Und all das werde ich Eleanor Cattons Roman verdanken.
MELANIE WALZ, 1953 in Essen geboren, übersetzte u. a. A. S. Byatt, Charles Dickens, John Cowper Powys, Lawrence Norfolk, Annie Proulx und R. L. Stevenson. 1999 wurde sie mit dem Zuger Übersetzer-Stipendium, 2001 mit dem Heinrich-Maria-Ledig-Rowohlt-Preis ausgezeichnet.
ELEANOR CATTONDIE GESTIRNE
Aus dem Englischen von Melanie Walz | Romanca. 1000 Seiten | Gebunden mit SchutzumschlagFormat: 13,5 × 21,5 cmISBN 978-3-442-75479-3eISBN: 978-3-641-15896-5
09. NOVEMBER 2015
HÖRBUCH
Gelesen von Sascha Rotermund4 mp3-CDs | ca. 40 Std.ISBN 978-3-8445-1908-2Der Hörverlag
ERSCHEINT ZEITGLEICH
ELEANOR CATTON DIE GESTIRNE
ROMAN
Aus dem Englischen vonMelanie Walz
EXKLUSIVE LESEPROBE
Für Pop, der die Sterne sieht, und für Jude, der ihre Klänge hört
AN DEN LESER
Die Sternbilder und Planetenstellungen in diesem Buch wurden auf astronomischer Grundlage berechnet. Das bedeutet, dass wir das Himmelsphänomen der sogenannten Präzession anerkennen, also der Verschiebung des Frühlingspunktes – der astrologischen Entsprechung des Greenwich-Meridians – aufgrund der Kreiselbewegung der Erde. In früheren Zeiten fand die Tagundnachtgleiche im Frühling (in südlichen Breiten die Herbst-Tagundnachtgleiche) statt, als sich die Sonne im ersten Tierkreiszeichen Widder befand.
Inzwischen befindet sich die Sonne zu diesem Zeitpunkt im zwölften Zeichen, dem der Fische. Folglich verschiebt sich, wie die Leser dieses Buches bemerken werden, jedes Tierkreiszeichen um ungefähr einen Monat nach hinten – anders als in der allgemein bekannten Astrologie. Mit dieser Korrektur wollen wir der herkömmlichen Astrologie keineswegs zu nahe treten; wir erlauben uns allerdings die Feststellung, dass das Festhalten an obigem Irrtum in Widerspruch zu dem unstreitigen Wissen unseres 19. Jahrhunderts über das Firmament erfolgt. Und wir wagen darüber hinaus die Vermutung, dass diese Haltung ihrem Wesen nach dem Zeichen Fische entspricht – eine Haltung, die in der Tat bezeichnend ist für Menschen, die im Fische-Zeitalter geboren wurden, einer Zeit der Spiegel, der Hartnäckigkeit, des Instinktes, der Zweiheit und der Heimlichkeiten. Dies mag uns genügen. Es festigt abermals unser Vertrauen in den unendlichen und wissenden Einfluss des
endlosen Himmels.
VERZEICHNIS DER HANDELNDEN PERSONEN
STERNE:
VERWANDTE HÄUSER:
Te Rau Tauwhare, Jadesucher
Die Wells-Hütte (Arahura Valley)
Charlie Frost, Bankier
Die Reservebank (Revell Street)
Benjamin Löwenthal,Zeitungsherausgeber
Das Büro der West Coast Times(Weld Street)
Edgar Clinch, Hotelier
Das Gridiron-Hotel (Revell Street)
Dick Mannering, Goldfeldmagnat
Die Aurora-Goldmine (Kaniere)
Quee Long, Goldschmied
»Chinatown Forge« (Kaniere)
Harald Nilssen, Handelsagent
Nilssen & Co. (Gibson Quai)
Joseph Pritchard, Apotheker
Die Opiumhöhle (Kaniere)
Thomas Balfour, Spediteur
Godspeed (eine Bark, in Port Chalmers registriert)
Aubert Gascoigne, Gerichtsschreiber
Gerichtsgebäude von Hokitika (Sitz des Polizeirichters)
Sook Yongshen, Hutmacher
Das Wayfarer’s Fortune (Revell Street)
Das Gefängnis von Hokitika (Seaview)
Cowell Devlin, Geistlicher
PLANETEN:
VERWANDTE EINFLÜSSE:
Walter Moody
Lydia (Wells) Carver,
Vernunft
geborene Greenway
Begehren
Francis Carver
Kraft
Alistair Lauderback
Herrschaft
George Shepard
Beschränkung
Anna Wethereil
Äußerstes (vormals Innerstes)
Emery Staines
Innerstes (vormals Äußerstes)
TERRA FIRMA:
Crosbie Wells
(verstorben)
Merkur im Haus des Schützen
In welchem Kapitel ein Fremder nachHokitika kommt, eine geheime Versammlunggestört wird, Walter Moody seine neuestenErinnerungen verbirgt und Thomas Balfoureine Geschichte zu erzählen beginnt.
Die im Rauchzimmer des Crown Hotel versammelten zwölf Männer wirkten, als hätten sie sich dort zufällig eingefunden. Aus ihrem Betragen und ihrer Kleidung zu folgern – Gehrock, Frack, Seemannsjacken mit Gürtel und Beinknöpfen, gelber Moleskin, Kammertuch und Serge –, hätten sie zwölf Fremde in einem Eisenbahnwaggon sein können, jeder von ihnen auf dem Weg zu einem anderen Viertel einer Stadt mit genug Nebel und Wasserläufen, um sie voneinander zu trennen; und wahrhaftig bewirkte die absichtsvolle Absonderung jedes Einzelnen, wie er über seiner Zeitung brütete, sich vorbeugte, um seine Tabakasche in den Kamin zu schnipsen, oder die gespreizte Hand auf den grünen Flanell legte, um den nächsten Billardstoß abzuwägen, ebenjene Art geradezu greifbarer Stille, wie sie spätabends in der Eisenbahn eintritt – doch hier nicht vom Schnaufen und Rattern der Wagen übertönt, sondern vom lauten Prasseln des Regens.
Diesen Eindruck gewann Mr. Walter Moody, als er in der Tür stand, die Hand am Türrahmen. Er hatte keinerlei private Besprechung gestört, denn die Sprechenden waren verstummt, sobald sie seine Schritte im Flur gehört hatten, und als er die Tür öffnete, widmete sich jeder der zwölf Männer wieder seiner Beschäftigung (seitens der Billardspieler nicht allzu überzeugend, denn sie hatten ihre Positionen vergessen) mit so bemühter Konzentration, dass keiner von ihnen den Blick hob, als er das Zimmer betrat.
Die ungeteilte Unmissverständlichkeit, mit der die Männer ihn ignorierten, hätte vielleicht Mr. Moodys Interesse geweckt, wenn er körperlich und seelisch er selbst gewesen wäre. Doch in seiner gegenwärtigen Lage war ihm unwohl und unsicher zumute. Er hatte gewusst, dass die Fahrt nach West Canterbury schlimmstenfalls tödlich enden konnte in dem grenzenlosen wogenden Wellental aus weißschäumenden Wassern und Gischt, das am sturmverwüsteten Friedhof von Hokitika endete, doch auf die besonderen Schrecknisse dieser Reise war er nicht vorbereitet gewesen, und auch nun konnte er nicht darüber sprechen, nicht einmal im Selbstgespräch. Moody bezeigte von Natur aus wenig Nachsicht mit den eigenen Schwächen – bei Ängsten und Krankheiten kehrte er sich nach innen –, und deshalb unterlief ihm das höchst untypische Versäumnis, die Stimmung in dem Raum, den er soeben betreten hatte, zu beurteilen.
Von Natur aus machte Moody den Eindruck eines offenen und aufmerksamen Menschen. Seine grauen Augen waren groß und stetig im Ausdruck, und sein beweglicher knabenhafter Mund trug für gewöhnlich den Ausdruck höflichen Interesses. Seine Haare neigten zu dichtem Lockenwuchs; in früheren Tagen waren sie ihm bis auf die Schultern gefallen, doch nun war sein Haar dicht am Schädel geschnitten, seitlich gescheitelt und mit einer süßlich duftenden Pomade glattgekämmt, die die goldene Tönung der Haare zu einem öligen Braun herabstimmte. Stirn und Wangen waren ebenmäßig geformt, die Nase war gerade, der Teint makellos. Er war noch keine achtundzwanzig Jahre alt, bewegte sich schnell und gewandt und besaß die lebhafte, unschuldige Energie, die weder von Gutgläubigkeit noch von Bosheit gefärbt ist. Er trat auf wie ein diskreter und intelligenter Butler, und deshalb zogen ihn oft gerade die Verschlossensten in ihr Vertrauen, oder man bat ihn, zwischen Leuten zu verhandeln, die er erst seit Kurzem kannte. Sein Äußeres verriet wie gesagt sehr wenig über sein Wesen, und es war dazu angetan, anderen sofort Vertrauen, einzuflößen.
Moody war sich der Vorteile seines unergründlichen Zaubers sehr wohl bewusst. Wie die meisten ausnehmend schönen Menschen hatte er das eigene Spiegelbild eingehend studiert und kannte sich in gewisser Weise am besten von außen; er sah sich immer in einer Kammer seines Geistes von außen. Er hatte viele Stunden in seinem Ankleidezimmer verbracht, wo der Spiegel sein Bild in die Ansicht aus Profil, Halbprofil und Gegenüber zerteilte: van Dycks Porträt von Charles I., allerdings wesentlich beeindruckender. Dies war eine heimliche Übung, die er vermutlich nicht gern zugegeben hätte – denn wie unumschränkt verdammen die Moralapostel unserer Tage die Selbstbeobachtung! Als gäbe es keine Beziehung zwischen dem Ich und dem Ich, als sähe man nur in den Spiegel, um die eigene Arroganz zu bestätigen, als wäre der Vorgang der Selbstbetrachtung nicht ebenso subtil, gefahrvoll und unbeständig wie jede Verbindung zwischen gleichgestimmten Seelen. Moodys Faszination hielt ihn weniger dazu an, die eigene Schönheit zu bewundern, als sie zu beherrschen. Zweifellos verspürte er einen angenehmen Kitzel der Befriedigung, wenn er das eigene Spiegelbild in einem Schaufenster erblickte oder des Nachts in einer Fensterscheibe, doch es war eine Empfindung, wie ein Ingenieur sie haben könnte, der zufällig eine Maschine erblickt, die er selbst konstruiert hat, und sieht, dass sie alle Erwartungen erfüllt, blinkt und blitzt, gut geölt ist und so funktioniert, wie er es vorgesehen hatte.
Moody sah sich nun vor seinem inneren Auge, im Türrahmen zu dem Rauchzimmer, und er wusste, dass er einen völlig gelassenen Eindruck machte. Er zitterte fast vor Erschöpfung; in seinem Inneren lastete ein Bleigewicht des Grauens; er fühlte sich geschmälert, ja eingeschüchtert; und er fürchtete sich.
Mit höflichem Desinteresse und entsprechender Freundlichkeit ließ er seinen Blick durch das Zimmer wandern. Es sah aus wie ein Ort, den man nach langer Zeit aus dem Gedächtnis wiedererrichtet hatte, nachdem vieles vergessen worden war (Kaminböcke, Draperien, eine vernünftige Kamineinfassung), in dem aber kleine Details erhalten geblieben waren: zum Beispiel ein Bild des verstorbenen Prinzgemahls, aus einer Zeitschrift ausgeschnitten und mit Schuhnägeln an die Wand geheftet, die dem Innenhof gegenüberlag, die Naht im Tuch des Billardtischs, der auf den Docks von Sydney zersägt worden war, um die Überfahrt besser zu überstehen, der Stapel alter Flugschriften auf dem Sekretär, deren Seiten vom Befingern durch viele Hände dünn und verschmiert waren. Die Aussicht aus den zwei kleinen Fenstern links und rechts des Kamins ging auf den Hinterhof des Hotels, ein schlammiges Stück Land voller Kisten und verrostender Fässer, von den Nachbargrundstücken nur durch Gestrüpp und Farnbüschel getrennt und im Norden durch eine Reihe niedriger Hütten, deren Türen gegen Diebe gesichert waren. Hinter diesem verschwommenen Horizont sah man durchhängende Wäscheleinen, die hinter den Häusern einen Block weiter östlich im Zickzack verliefen, längs auf quer geschichtete Holzstapel, Schweinekoben, Abfallhaufen, Ansammlungen von Eisenblech und Kerzenresten sowie Kloaken, und alles war verlottert oder einigermaßen vernachlässigt. Die Uhr hatte die späte Stunde der Dämmerung geschlagen, wenn alle Farben auf einmal zu verblassen scheinen, und es regnete unaufhörlich; durch das geriffelte Glas nahm der Hof sich ausgebleicht und farblos aus. Im Haus hatten die Spirituslampen noch nicht das meerfarbene Licht des ersterbenden Tages abgelöst, und mit ihrem blassen Schimmer schienen sie die allgemeine Trostlosigkeit der Ausstattung des Zimmers noch zu unterstreichen.
Für jemanden, der seinen Club in Edinburgh gewohnt war, wo alles rot und golden glänzte und die gepolsterten Sofas eine fette Behaglichkeit ausstrahlten, die dem Leibesumfang der Gentlemen entsprach, die auf ihnen saßen, wo einem beim Eintreten eine weiche Jacke gereicht wurde, die angenehm nach Anis oder Pfefferminz duftete, und wo danach die kleinste Regung des Fingers zur Klingelschnur hin genügte, um eine Flasche Bordeaux auf silbernem Tablett herzubeordern, war dieser Anblick bedrückend. Aber Moody gehörte nicht zu denen, die sich über abstoßende Umstände grämten; die ungeschliffene Schlichtheit seiner Umgebung ließ ihn nur innerlich zurückweichen, so wie ein reicher Mann schnell beiseitetritt und zu Stein wird, wenn er auf der Straße einem Bettler begegnet. Sein freundlicher Gesichtsausdruck wich nicht, als sein Blick durch den Raum glitt, doch geistig ließ ihn jede Einzelheit – der Haufen schmutzigen Wachses am Fuß einer Kerze oder der Staubrand an einem Glas – sich noch weiter in sich selbst zurückziehen und seinen Körper noch mehr gegen seine Umgebung stählen.
Diese Abwehr, wenn auch unwillkürlich, hing weniger mit den üblichen Vorurteilen von Menschen höheren Standes zusammen – und tatsächlich war Moody nur bescheiden vermögend und gab oft den Armen Geld, wenn auch (das müssen wir eingestehen) nie ohne ein leises Vergnügen an der eigenen Großzügigkeit – als mit dem persönlichen Desequilibrium, das zu bewältigen er sich im Augenblick und unmerklich bemühte. Schließlich war das hier eine Stadt des Goldrauschs, neu erbaut zwischen Wildnis und Meer am südlichsten Ende der zivilisierten Welt, und er hatte keinen Luxus erwartet.
Tatsächlich verhielt es sich so, dass Moody auf der Bark, die ihn von Port Chalmers an diesen wilden Küstenabschnitt gebracht hatte, etwas miterlebt hatte, was so außergewöhnlich und aufwühlend war, dass es alle anderen Gewissheiten infrage stellte. Die Szene stand ihm noch immer vor Augen – als wäre im Hintergrund seines Geistes eine Tür aufgeklinkt worden, die ihm einen grauen Lichtschein zeigte, und als könnte er sich die Dunkelheit nicht zurückwünschen. Es kostete ihn nicht wenig Mühe, zu verhindern, dass die Tür sich noch weiter öffnete. In dieser prekären Befindlichkeit nahm sich alles Ungewohnte und alles Unerquickliche wie eine persönliche Kränkung aus. Ihm war, als wäre die ganze trostlose Szenerie vor seinen Augen ein gesammeltes Echo der Prüfungen, die er vor so kurzer Zeit durchgemacht hatte, und er scheute vor ihr zurück, um seinen Geist davor zu bewahren, dieser Verbindung nachzugehen und zur Vergangenheit zurückzukehren. Geringschätzung war nützlich. Sie gab ihm ein verlässliches Gefühl für Verhältnisse und Rechtmäßigkeit, auf das er sich verlassen konnte und das ihn beruhigte.
Der Raum war für seine Begriffe trostlos, schäbig und bedrückend – und innerlich so gegen die Ausstattung gewappnet, wendete er sich den zwölf Anwesenden zu. Ein umgekehrtes Pantheon, dachte er, und wieder fühlte er sich etwas sicherer, weil er sich diese dünkelhafte Vorstellung erlaubt hatte.
Die Männer waren gebräunt und wettergegerbt wie alle Pioniere; ihre Lippen waren weiß und schuppig, und ihre Haltung sprach von Entbehrungen und Verlusten. Zwei von ihnen waren Chinesen, gleich gekleidet mit Stoffschlappen und grauen Baumwolltuniken. Die Herkunft der anderen konnte Moody nicht erraten. Er wusste noch nicht, dass das Goldschürfen einen Mann in wenigen Monaten altern ließ; als er den Blick durch das Zimmer wandern ließ, hielt er sich für den Jüngsten unter den Anwesenden, obwohl mehrere der anderen jünger waren als er oder gleichaltrig mit ihm. Der Schimmer der Jugend war von ihnen gewichen. Sie würden für alle Zeit gebückt bleiben, ruhelos, gierig, vorzeitig gealtert, und Staub auf die braunen Linien ihrer Handflächen spucken. Moody erschienen sie grobschlächtig, ja kurios; er hielt sie für Männer von wenig Einfluss; er wunderte sich nicht über ihre Schweigsamkeit. Er hatte nur den Wunsch nach einem Glas Brandy und nach einem Platz, wo er sitzen und die Augen schließen konnte.
Er blieb in der Tür stehen, nachdem er eingetreten war, und wartete darauf, dass man ihn willkommen hieß, doch nachdem niemand eine einladende oder abweisende Geste machte, trat er einen weiteren Schritt vor und schloss die Tür leise hinter sich. Er verbeugte sich leicht in Richtung des Fensters und ein weiteres Mal in Richtung des Kamins als allgemeine Begrüßung und ging dann zu dem Tisch mit den Getränken und mischte sich einen Drink aus den Karaffen, die dort standen. Er wählte eine Zigarre und schnitt sie an, nahm sie in den Mund, drehte sich wieder zu dem Zimmer um und betrachtete ein weiteres Mal die Gesichter der Anwesenden. Niemand schien seine Gegenwart auch nur entfernt zur Kenntnis zu nehmen. Das war ihm recht. Er setzte sich in den einzigen freien Sessel, zündete seine Zigarre an und lehnte sich zurück mit dem leisen Seufzen eines Mannes, der den Eindruck hatte, sein täglicher Komfort sei ausnahmsweise wahrhaftig verdient.
Seine Zufriedenheit sollte nicht lange währen. Kaum hatte er die Beine ausgestreckt und die Knöchel gekreuzt (das Salz auf seinen Hosenbeinen war getrocknet, und dies höchst unerfreulich in Form weißer Streifen), beugte der Mann unmittelbar zu seiner Rechten sich in seinem Sessel vor, fuhrwerkte mit seinem Zigarrenstumpen in der Luft herum und sagte: „Junger Mann – haben Sie hier im Crown Hotel ein bestimmtes Anliegen?“
Das war recht unverblümt ausgedrückt, aber Moody ließ sich seine Verblüffung nicht anmerken. Er beugte höflich den Kopf und erklärte, er habe in der Tat ein Zimmer im Obergeschoss erhalten, nachdem er an diesem Abend in der Stadt angekommen sei.
„Gerade erst gelandet, wollen Sie sagen?“
Moody neigte wieder den Kopf und bestätigte, dass er genau dies habe sagen wollen. Damit der andere ihn nicht für wortkarg hielt, fügte er hinzu, er komme von Port Chalmers und beabsichtige, sich als Goldgräber zu versuchen.
„Sehr gut“, sagte der andere. „Sehr gut. Neue Goldfunde oben am Ufer – da wimmelt es von Gold. Schwarzer Sand: das rufen alle, schwarzer Sand in Richtung Charleston; das ist nördlich von hier, ja, natürlich, Charleston. Aber in der Mine könnte man immer noch sein Auskommen finden. Haben Sie einen Kameraden, oder sind Sie solo gekommen?“
„Nur ich allein“, sagte Moody.
„Ohne Verbindungen!“, sagte der andere.
„Nun ja“, sagte Moody, der sich wieder über die Wortwahl des Mannes wunderte, „ich habe die Absicht, allein mein Glück zu machen.“
„Ohne Verbindungen“, wiederholte der andere. „Und ohne Anliegen. Oder sind Sie mit einem bestimmten Anliegen in das Crown Hotel gekommen?“
Das war unverschämt – zweimal das Gleiche zu fragen –, aber der Mann wirkte ganz jovial und ein wenig nervös, wie seine unruhigen Finger verrieten, mit denen er an den Aufschlägen seiner Weste zupfte. Vielleicht, dachte Moody, hatte er sich nur nicht klar genug ausgedrückt. Er sagte: „Mein Anliegen in diesem Hotel beschränkt sich darauf, dass ich mich ausruhen will. In den kommenden Tagen werde ich mich über das Goldsuchen erkundigen – welche Flüsse besonders ergiebig sind, welche Flusstäler nichts mehr erbringen – und mich mit dem Leben des Goldsuchers vertraut machen, so gut es geht. Ich beabsichtige, eine Woche lang in diesem Hotel zu logieren und mich dann in das Landesinnere aufzumachen.“
„Sie haben also noch nie geschürft.“
„Nein, Sir.“
„Noch nie Gold gesehen?“
„Nur beim Juwelier, an Uhren oder Gürtelschnallen; aber noch nie im Rohzustand.“
„Aber geträumt haben Sie davon! Sie haben geträumt, wie Sie im Wasser knien und das Gold aus dem Sand waschen.“
„Nun, vielleicht … nein, das habe ich eigentlich nicht“, sagte Moody. Die ausufernde Gesprächigkeit des Mannes erschien ihm einigermaßen befremdlich; trotz aller ersichtlichen Nervosität redete der Fremde schnell und mit einer Intensität, die fast etwas Aufdringliches hatte. Moody ließ den Blick durch den Raum schweifen in der Hoffnung, mit einem der anderen einen Blick des Einverständnisses wechseln zu können, doch alle Augen wichen ihm aus. Er hüstelte und sagte: „Ich nehme an, dass ich von dem geträumt habe, was danach kommt – ich meine, was das Gold ermöglichen könnte, wozu es einem verhelfen könnte.“
Diese Antwort schien dem Mann zu gefallen. „Umgekehrte Alchemie nenne ich das immer“, sagte er, „die ganze Sache, das Goldschürfen. Umgekehrte Alchemie. Verstehen Sie – die Verwandlung, nicht von etwas in Gold, sondern von Gold in etwas anderes …„
„Ein hübscher Gedanke, Sir …“, und erst sehr viel später fiel ihm ein, dass dieser Gedanke seiner eigenen Vorstellung von einem umgekehrten Pantheon recht verwandt war.
„Und Ihre Erkundigungen“, sagte der Mann und nickte nachdrücklich, „Ihre Erkundigungen – ich nehme an, Sie werden Auskünfte einholen, über Schaufeln und Schwingtröge, Landkarten und dergleichen mehr.“
„Ganz genau. Ich will es von Anfang an richtig angehen.“
Der Mann lehnte sich in seinem Sessel zurück, mit einer Miene, als hätte man ihm einen guten Witz erzählt. „Eine Woche im Crown Hotel, um Ihre Erkundigungen einzuziehen!“ Er lachte kurz und laut. „Und dann knien Sie zwei Wochen im Schlamm, um das Geld wieder hereinzubekommen!“
Moody kreuzte die Beine andersherum. Seine Verfassung erlaubte ihm nicht, auf den munteren Ton des Gegenübers einzugehen, doch er war zu gut erzogen, um sich unhöflich zu betragen. Er hätte um Nachsicht für sein Unbehagen bitten können, sich auf irgendein generelles Unwohlsein berufen können – schließlich wirkte der Mann mit seinen nervösen Fingern und seinem unterdrückten Gelächter keineswegs unsympathisch –, aber Moody war es nicht gewohnt, offen mit Fremden zu sprechen, und noch weniger, einem anderen Schwäche zu offenbaren. Er riss sich zusammen und sagte in etwas aufgeräumterem Ton: „Und Sie, Sir? Sie haben hier wohl ein gutes Auskommen, nehme ich an?“
„O ja“, erwiderte der andere. „Seespedition Balfour. Sie haben unsere Firma sicher gesehen, gleich hinter dem Viehhof, beste Lage, Wharf Street, Sie wissen schon. Balfour, das bin ich. Thomas mit Vornamen. Beim Goldschürfen werden Sie Ihren brauchen; in den Minen heißt keiner Mister.“
„Dann muss ich üben, meinen zu benutzen“, sagte Moody. „Ich heiße Walter. Walter Moody.“
„Tja, und Walter wird man Sie auch nicht nennen“, sagte Balfour und schlug sich aufs Knie. „Vielleicht ’Schotten-Walt’ oder auch ‚Goldhand-Walt’. ‚Wally Nugget’. Ha!“
„Diesen Namen muss ich mir erst noch verdienen.“
Balfour lachte. „Von Verdienen kann keine Rede sein“, sagte er. „Manche von denen, die ich gesehen habe, waren so groß wie eine Damenpistole. So groß wie ein Damen…, aber, das dürfen Sie mir glauben, wesentlich einfacher zu befingern.“
Thomas Balfour war um die fünfzig, stämmig und untersetzt. Sein Haar war fast ganz ergraut, zurückgekämmt und lang an den Seiten. Er trug einen eckig geschnittenen Knebelbart und hatte die Angewohnheit, ihn mit der Handfläche zu streicheln, wenn er sich amüsierte, und in diesem Augenblick amüsierte er sich über den eigenen Witz. Moody hatte den Eindruck, dass er seinen Wohlstand gelassen genoss, und meinte, an ihm jenes entspannte Gefühl der Berechtigung zu sehen, das sich einstellt, wenn lebenslanger Optimismus mit Erfolg belohnt wird. Balfour war in Hemdsärmeln; seine feingewebte seidene Krawatte war mit Bratensauce bespritzt und hing ihm lose um den Hals. Moody stufte ihn als Indeterministen ein: harmlos, geistig unkonventionell und von heiterer Mitteilsamkeit.
„Ich bin Ihnen verpflichtet“, sagte Moody. „Das ist einer der ersten Gebräuche, von denen ich nicht das Geringste weiß, wie ich sehe. Ich hätte sicherlich den Fauxpas begangen, in der Mine meinen Nachnamen zu benutzen.“
Zweifellos war sein geistiges Bild von den Goldminen in Neuseeland ausnehmend ungenau und beruhte hauptsächlich auf Bildern von den kalifornischen Goldfundgebieten – Blockhütten, flache Täler, Karren im Staub – und auf einem undeutlichen Eindruck (woher, war ihm nicht klar), die Kolonie sei in gewisser Weise ein Abklatsch der Britischen Inseln, das unausgeformte, wilde Kehrbild von Sitz und Herz des Empires. Als er die Spitzen der Otago-Halbinsel vor zwei Wochen umrundete, hatte es ihn überrascht, Herrenhäuser auf der Anhöhe zu sehen, Kais, Straßen und gepflegte Gärten, und nun überraschte es ihn zu sehen, wie ein gut gekleideter Herr seine Streichhölzer einem Chinesen reichte und sich dann an ihm vorbeibeugte, um sein Glas zu ergreifen.
Moody hatte in Cambridge studiert; er war in Edinburgh geboren, mit bescheidenen Vermögensaussichten und in einem Haushalt mit drei Bediensteten. Die gesellschaftlichen Kreise, in denen er sich vorrangig bewegt hatte – zuerst am Trinity College und später am Inner Temple –, waren nicht von den rigiden Anforderungen des Adelsstands geprägt gewesen, in dem sich die eigene Geschichte und Familie lediglich im Rang von den anderen unterschieden; dennoch hatte seine Bildung ihn vereinzelt, denn sie hatte ihm beigebracht, der richtige Weg, ein soziales System zu sehen, sei der, es von oben zu betrachten. In Gesellschaft seiner Kommilitonen (im College-Cape und trunken vom Rheinwein) trat er mit aller Heftigkeit und Kraft eines jungen Menschen für die Vermischung der Klassen ein, doch mit der Wirklichkeit konfrontiert, war er immer entsetzt. Er wusste noch nicht, dass ein Goldgräberfeld ein Ort des Unrats und der Zufälle war, wo jedermann dem Nachbarn und dem Boden fremd war, wo der Karren eines Krämers von Gold überquellen konnte, während der Karren eines Anwalts leer blieb – wo es keine Klassenunterschiede gab. Moody war um die zwanzig Jahre jünger als Balfour, und deshalb bemühte er sich um eine ehrerbietige Sprache, aber er war sich dessen bewusst, dass Balfour gesellschaftlich unter ihm stand, und er war sich auch der sonderbaren Mischung von Leuten um ihn herum bewusst, deren Stand und Herkunft er nicht im Geringsten erraten konnte. Deshalb hatte seine Höflichkeit etwas hölzern Gezwungenes, wie bei einem Mann, der es nicht gewohnt ist, mit Kindern zu sprechen, und der nicht weiß, wie er sich verhalten soll und sich stumm absondert, hatte er noch so freundlich sein wollen.
Thomas Balfour spürte diese Herablassung, und es entzückte ihn. Er hatte eine scherzhafte Abneigung gegen Leute, die, wie er es ausdrückte, „durch die Nase“ sprachen, und es gefiel ihm, sie zu provozieren – nicht um sie zu ärgern (das interessierte ihn nicht), sondern um sie dazu zu bringen, sich unter ihr Niveau zu begeben. Moodys Steifheit war für ihn nichts anderes als ein modischer Kragen, nach aristokratischem Muster gefertigt und unerträglich beengend für den Träger, denn so betrachtete er alle Konventionen der feinen Gesellschaft, als nutzlose Ornamente, und es belustigte ihn, dass diesem Mann seine eigene Eleganz so großes Unbehagen bereitete.
Wie Moody erraten hatte, war Balfour in der Tat ein Mann von bescheidener Herkunft. Sein Vater hatte in einer Sattlerei in Kent gearbeitet, und er hätte vielleicht dieses Gewerbe ergriffen, wenn nicht in seinem elften Lebensjahr Vater und Gewerbe einem Feuer zum Opfer gefallen wären, doch er war ein ungebärdiger Junge mit zerschlissenen Manschetten und einem Ungestüm, das dem verträumten, unkonzentrierten Ausdruck widersprach, den er meistens zur Schau trug, und die eintönige Arbeit hätte ihm nicht zugesagt. Ein Pferd konnte jedenfalls mit einem Eisenbahnwaggon nicht mithalten, wie er gern sagte, und das Sattlergewerbe hatte der schnellen Veränderung der neuen Zeiten nicht standgehalten. Balfour gefiel die Vorstellung, zur Vorhut einer neuen Zeit zu gehören. Wenn er von der Vergangenheit sprach, tat er es so, als wäre jede der vorausgegangenen Dekaden eine schlecht gegossene Kerze gewesen, abgebrannt und erloschen. Er dachte nicht mit Wehmut an das Gewerbe seiner Jugendzeit zurück – die dunkle Lauge in den Küpen, das Gestell mit den Häuten, die Tasche aus Kalbsleder, in der sein Vater Nadeln und Ahlen aufbewahrte – und erinnerte sich nur daran, wenn es um einen Vergleich mit neueren Gewerbezweigen ging. Erz, das war die Goldgrube. Kohlebergwerke, Erzgießereien, Goldminen.
Er begann in der Glasherstellung. Nach einigen Lehrjahren gründete er eine eigene Glashütte, eine bescheidene Fabrik, die er später gegen einen Anteil an einem Kohlebergwerk eintauschte, den er wiederum nach und nach zu einem Netz von Schächten ausbaute und zuletzt für einen ansehnlichen Batzen an Londoner Investoren verkaufte. Er heiratete nicht. An seinem dreißigsten Geburtstag kaufte er eine Karte für die Fahrt auf einem Klipper, der nach Veracruz segelte; das war der erste Abschnitt einer Reise von neun Monaten Dauer zu den kalifornischen Goldfeldern. Der Glanz des Goldgräberlebens verblich schnell, aber der nie versiegende Ansturm auf die Goldfelder und die unerschütterliche Hoffnung der Goldgräber faszinierten ihn; mit seinem ersten Goldstaub kaufte er sich in eine Bank ein; innerhalb von vier Jahren errichtete er drei Hotels und wurde vermögend. Als Kaliforniens Gold versiegte, verkaufte er alles und segelte nach Victoria – neue Goldfunde, ein neues jungfräuliches Land – und von dort, als er abermals den Ruf vernahm, den der Wind des Zufalls wie eine Zauberflöte über den Ozean trug, nach Neuseeland.
Im Lauf seiner sechzehn Jahre auf den rauen Goldfeldern hatte Thomas Balfour viele Männer vom Schlag Walter Moodys erlebt, und es sprach für ihn, dass er sich in all diesen Jahren eine tiefe Zuneigung und Achtung für die Ahnungslosigkeit jener bewahrt hatte, die noch unberührt von Erfahrung und Prüfungen waren. Balfour hatte Verständnis für Ehrgeiz, und für einen Selfmademan war er von ungewöhnlich großzügiger Gesinnung. Unternehmergeist gefiel ihm; Wünsche gefielen ihm. Er war bereit, Moody zu mögen, weil dieser gewagt hatte, etwas zu unternehmen, wovon er offenkundig wenig verstand und wovon er sich offenbar viel erwartete.
An diesem Abend jedoch hatte Balfour seine Pläne. Moodys Erscheinen hatte die zwölf Anwesenden überrascht, denn sie hatten beträchtliche Vorkehrungen getroffen, um sicherzugehen, dass sie nicht gestört werden würden. Das Gesellschaftszimmer des Crown Hotel war für eine Privatveranstaltung reserviert worden, und unter der Markise vor dem Eingang hatte man einen Jungen postiert, der die Straße überwachen sollte für den Fall, dass es irgendjemandem in den Sinn kommen könnte, im Crown einen Drink zu nehmen – was nicht allzu wahrscheinlich war, denn das Rauchzimmer des Hotels war weder für seine Besucher noch für sonstige Reize berühmt und war meistens leer, selbst an den Abenden am Wochenende, wenn die Goldgräber in Scharen von den Bergen kamen, um ihren Goldstaub in den Spelunken der Stadt für Schnaps auszugeben. Der diensthabende Junge arbeitete für Mannering und hielt ein dickes Bündel Stehkarten zum Verschenken in der Hand. Die Aufführung – Sensationen aus dem Orient! – war eine neue Produktion, die sicher keine Wünsche offen lassen würde, und im Foyer der Oper wartete kistenweise Champagner auf die Besucher, gestiftet von Mannering persönlich zu Ehren des Premierenabends.
Nach diesen Vorkehrungen und in der Überzeugung, dass an dem düsteren Abend eines so unfreundlichen Tages kein Boot die Landung wagen würde (die in den entsprechenden Kolumnen der West Coast Times angekündigten Landungen hatten alle bereits stattgefunden), hatten die Anwesenden jedoch keine Vorkehrungen getroffen für den Fall eines zufällig hereingeschneiten Fremden, der schon vor Einbruch der Dämmerung das Hotel aufgesucht hatte und sich folglich bereits im Inneren des Hauses befand, als Mannerings Junge unter dem tropfenden Eingang an der Straße Aufstellung bezog.
Trotz seines beruhigenden Aussehens und der höflichen Distanz, die er wahrte, war Walter Moody ein Eindringling. Die anderen waren ratlos angesichts der Frage, wie man ihn dazu bewegen könne, den Raum zu verlassen, ohne durchblicken zu lassen, dass er als Eindringling betrachtet wurde, und damit den Verschwörungscharakter ihrer Anwesenheit zu verraten. Thomas Balfour hatte es auf sich genommen, ihn auszufragen, weil er zufällig neben ihm nahe am Feuer saß – ein glücklicher Zufall, denn Balfour war hartnäckig, ungeachtet seiner Großspurigkeit und Überschwänglichkeit, und er verstand sich darauf, Situationen zu nutzen.
„Ja, ja“, sagte er nun, „man lernt die Gepflogenheiten schnell, und jeder muss da anfangen, wo Sie sich jetzt befinden – ich meine, als Lehrjunge, der keine Ahnung hat. Wie wurde die Saat denn gesät, wenn ich das fragen darf? Das interessiert mich nämlich persönlich: was jemanden hierherbringt, verstehen Sie, ans Ende der Welt, was einen Mann anfeuert.“
Moody tat einen Zug an seiner Zigarre, bevor er antwortete. „Das ist eine komplizierte Geschichte“, sagte er. „Es hängt mit einem Streit in der Familie zusammen, einem schmerzlichen Thema, weshalb ich die Reise allein zurückgelegt habe.“
„Oh, in dieser Hinsicht sind Sie nicht allein“, sagte Balfour aufmunternd. „Jedermann hier ist vor irgendetwas weggelaufen, darauf können Sie sich verlassen!“
„Tatsächlich?“, sagte Moody, dem dies als eher beunruhigende Aussicht erschien.
„Jeder kommt von anderswo“, sprach Balfour weiter. „Ja, so verhält es sich und nicht anders. Wir kommen alle von anderswo. Und was die Familie betrifft: In der Mine werden Sie Brüder und Väter genug finden.“
„Es ist freundlich von Ihnen, mir Trost zu spenden.“
Mittlerweile grinste Balfour ganz ungeniert. „Ha, was für ein Wort“, sagte er und wedelte so heftig mit seiner Zigarre, dass er Aschesprenkel auf seiner Weste verteilte. „Trost …! Wenn Sie das als Trost sehen, dann sind Sie ein echter Puritaner, junger Mann.“
Moody stand keine passende Antwort auf diese Bemerkung zur Verfügung; deshalb deutete er erneut eine Verbeugung an, und danach nahm er einen großen Schluck aus seinem Glas, als wollte er jeden Anschein des Puritanertums von sich weisen. Draußen unterbrach ein Windstoß das stetige Platschen des Regens und warf einen Wasserschwall gegen die Fenster zum Westen. Balfour betrachtete das Ende seiner Zigarre und kicherte noch immer in sich hinein. Moody steckte sich seine Zigarre in den Mund, wendete sich ab und zog leicht.
In diesem Augenblick stand einer der elf schweigenden Männer auf, faltete dabei seine Zeitung zwei Mal und ging zu dem Sekretär, um sich eine andere Zeitung zu holen. Er trug einen kragenlosen schwarzen Überrock und eine weiße Halsbinde, die Kleidung eines Geistlichen, wie Moody überrascht bemerkte. Das war sonderbar. Warum sollte ein Geistlicher sich dafür entscheiden, spät an einem Samstagabend seine Zeitungslektüre im Rauchzimmer eines gewöhnlichen Hotels zu suchen? Und warum sollte er dabei so schweigsam sein? Moody sah zu, wie der Geistliche in dem Stapel von Drucksachen blätterte, mehrere Ausgaben des Colonist verwarf und sich für einen Grey River Argus entschied, den er mit zufriedenem Murmeln herauszog, von sich weghielt und beifällig ins Licht hielt. Doch dann, dachte Moody, der sich zur Räson rief, war das vielleicht nicht gar so außergewöhnlich; es war ein sehr regnerischer Abend, und in den Versammlungsräumen und Lokalen der Stadt war es wahrscheinlich ziemlich voll. Vielleicht hatte der Geistliche sich aus irgendeinem Grund genötigt gefunden, kurzfristig Zuflucht vor dem Regen zu suchen.
„Sie hatten also einen Streit“, sagte Balfour plötzlich, als hätte Moody ihm eine spannende Geschichte versprochen und vergessen, sie zu erzählen.
„Ich war in einen Streit verwickelt“, verbesserte ihn Moody. „Das heißt, ich habe den Streit nicht angefangen.“
„Streit mit Ihrem Vater, nehme ich an.“
„Es ist schmerzlich, darüber zu sprechen, Sir.“ Moody sah den anderen an im Bestreben, ihn mit einem strengen Blick zum Schweigen zu bringen, aber Balfour reagierte darauf, indem er sich weiter vorlehnte. Durch Moodys ernsten Gesichtsausdruck ermuntert, hielt er die Geschichte für noch hörenswerter.
„Kommen Sie!“, sagte er. „Reden Sie es sich von der Seele.“
„Das ist kaum möglich, Mr. Balfour.“
„Junger Freund, das kann ich nicht glauben.“
„Erlauben Sie mir, das Thema zu wechseln –“
„Aber Sie haben meine Neugier geweckt! Ich bin jetzt ganz Ohr!“ Balfour grinste ihn an.
„Ich muss Sie bitten, mich zu entschuldigen“, sagte Moody. Er bemühte sich, unaufgeregt zu sprechen, ihr Gespräch vor den Ohren der anderen geheim zu halten. „Ich muss Sie bitten, meine Privatsphäre zu respektieren. Es geht mir um nichts anderes als darum, keinen schlechten Eindruck auf Sie zu machen.“
„Aber Sie sind derjenige, dem Unrecht getan wurde, das sagten Sie. Den Streit hätten nicht Sie vom Zaun gebrochen.“
„So ist es.“
„Nun, dann! So etwas muss man nicht für sich behalten!“, rief Balfour. „Habe ich nicht recht? Anderer Leute Verfehlungen muss man nicht für sich behalten! Man muss sich nicht für anderer Leute, nun ja – Taten schämen, oder?“
„Sie sprechen von persönlichen Verfehlungen“, sagte Moody leise. „Ich spreche von der Schande, die einer Familie angetan wird. Ich will den Namen meines Vaters nicht besudeln; es ist auch mein Name.“
„Ihr Vater! Aber was sagte ich Ihnen vorhin? Sie werden unten in der Mine genug Väter finden, das sagte ich doch! Das ist keine leere Redewendung – so ist es hier üblich und notwendig, so handelt man hier! Lassen Sie sich von mir sagen, was beim Goldsuchen als Schande gilt. Ein falsches Goldfeld deklarieren – das ist eine Schande. Einem anderen den Claim streitig machen – das ist eine Schande. Einen anderen bestehlen, betrügen, umbringen – das ist eine Schande. Aber eine Familienschande! Sagen Sie das den Ausrufern, damit sie es auf der Straße von Hokitika unter die Leute bringen – vielleicht halten die das für eine Nachricht! Was ist Familienschande ohne Familie?“ Diese Philippika beendete Balfour, indem er mit dem leeren Glas auf die Armlehne seines Sessels klopfte. Er sah Moody freudig an und kehrte die Handfläche nach oben, als wolle er damit sagen, er habe seine Sicht der Dinge so überzeugend dargelegt, dass es nichts hinzuzufügen gebe, Zustimmung aber dennoch willkommen sei. Moody nickte wieder automatisch und erwiderte in einem Ton, der zum ersten Mal seine nervliche Erschöpfung verriet: „Sie sprechen sehr überzeugend, Sir.“
Balfour, der noch immer strahlte, tat das Kompliment ab. „Überzeugen setzt Tricks und Schliche voraus. Ich spreche offen und ehrlich.“
„Ich danke Ihnen.“
„Ja, ja“, sagte Balfour umgänglich. Er schien bester Laune zu sein. „Aber jetzt müssen Sie mir von Ihrem Familienstreit erzählen, Mr. Moody, damit ich selbst beurteilen kann, ob Ihr Name wirklich besudelt ist.“
„Verzeihen Sie“, murmelte Moody. Er warf einen Blick um sich und sah, dass der Geistliche zu seinem Sitzplatz zurückgekehrt war und sich der Lektüre seiner Zeitung widmete. Der Mann an seiner anderen Seite – eine rotgesichtige Erscheinung mit gewaltigem Schnauzer und ingwerfarbenem Haar – schien eingeschlafen zu sein.
Thomas Balfour war nicht zu bremsen. „Freiheit und Sicherheit!“, rief er und schwenkte wieder den Arm. „Geht es nicht darum? Sie sehen, ich weiß schon, worum es geht! Ich weiß, wie so etwas abläuft! Freiheit statt Sicherheit, Sicherheit statt Freiheit … Vorsorge des Vaters, Freiheit für den Sohn. Natürlich kann der Vater zu viel Kontrolle ausüben – das kommt vor –, und der Sohn kann ein Verschwender sein … ein verlorener Sohn … aber es ist letzten Endes immer der gleiche Streit. Auch unter Liebesleuten“, fügte er hinzu, als Moody schwieg. „Für Liebesleute gilt das genauso: Im Grunde ist es immer der gleiche Streit.“
Aber Moody hörte nicht hin. Für einen Augenblick hatte er die wachsende Asche an seiner Zigarrenspitze und den Rest warmen Brandys in seinem Glas vergessen. Er hatte vergessen, wo er war, im Rauchzimmer eines Hotels in einer Stadt, die vor kaum fünf Jahren erbaut worden war, am Ende der Welt. Sein Geist war entschlüpft und dorthin zurückgekehrt, zu der blutigen Krawatte, der silbernen Hand, die sich festkrallte, zu dem Namen, der aus der Dunkelheit gekeucht worden war, wieder und wieder, Magdalena, Magdalena, Magdalena. Die Szene kam wie ein Blitz über ihn, ungefragt, wie ein Schatten, der kalt über die Sonne zieht.
Moody war von Port Chalmers auf der Bark Godspeed gekommen, einem kraftvollen kleinen Schiff mit kess gebogenem Bug und einer Galionsfigur aus bemaltem Eichenholz, einem Adler, der an den heiligen Johannes erinnern sollte. Auf der Landkarte hätte die Fahrt der Form einer Haarnadel geglichen: Die Bark fuhr zuerst nach Norden, querte die Meerenge zwischen zwei Meeren und richtete ihre Fahrt dann nach Süden, zu den Goldfeldern. Moodys Fahrkarte wies ihm einen spärlichen Raum unter Deck zu, doch unten war es so eng und es roch so scheußlich, dass er sich genötigt sah, die Reise größtenteils an Deck zu verbringen, unter dem Schanzdeck kauernd und seine nasse lederne Aktentasche an sich drückend, den Kragen hochgeschlagen, um sich vor der Gischt zu schützen. Da er mit dem Rücken zur Aussicht kauerte, sah er nicht viel von der Küste – von den gelben Ebenen des Ostens, die nach und nach in grünere Höhenzüge übergingen und schließlich in Berge, die sich in der Ferne blau ausnahmen; von den begrünten Fjorden weiter nördlich, von ruhigem Wasser befriedet, und von den gesäumten Strömen im Westen, die sich schmutzig verfärbten, wenn sie an die Strände trafen und Risse in den Sand gruben.
Als die Godspeed die nördliche Spitze der Insel umrundete und nach Süden weiterfuhr, sank das Barometer. Wäre Moody nicht so krank und elend zumute gewesen, hätte er sich fürchten und sich Gott anvertrauen können, denn das Ertrinken war die Krankheit der West Coast, wie die Schiffsjungen am Hafen ihm gesagt hatten, und ob er ein Überlebender sein würde, war eine Frage, die entschieden wäre, lange bevor er die Goldfelder erreichen und zum ersten Mal niederknien konnte, um mit seinem Sieb den Kies zu berühren. Die Zahl der Ertrunkenen war so groß wie die der Überlebenden. Der Kapitän seines Schiffs – Kapitän Carver – hatte von seiner Position auf dem Achterdeck so viele gesehen, die in den Tod gespült wurden, dass das Schiff mit Fug und Recht ein Friedhof genannt werden konnte - was man aber nur mit geflüsterter Ehrfurcht und weit aufgerissenen Augen äußerte.
Der Sturm war von grünlichen Winden hergetragen worden. Er begann als kupfriger Geschmack in der Mundhöhle, als ein metallischer Schmerz, der zunahm, als die Wolken dräuten und sich verdichteten, und als er hereinbrach, tat er es wie die flache Hand besinnungslosen Zorns. Das triefende Deck, die absonderlichen Blitze aus Licht und Schatten, die von den klatschenden und geblähten Segeln geworfen wurden, die spürbare Angst der Seeleute, die sich mit aller Kraft bemühten, das Schiff auf seinem Kurs zu halten – all das war Stoff für einen Alptraum, und als das Schiff sich den Goldfeldern immer mehr näherte, hatte Moody den alptraumhaften Eindruck, das Schiff hätte den teuflischen Sturm aus eigenem Willen heraufbeschworen.
Walter Moody war nicht abergläubisch, obwohl ihm der Aberglaube anderer Leute großes Vergnügen bereitete, und erste Eindrücke täuschten ihn selten, obwohl er große Mühe darauf verwendete, seinen eigenen ersten Eindruck auf andere vorzubereiten. Dies verdankte sich weniger seiner Intelligenz als vielmehr seiner Erfahrung, die allerdings vor seiner Abreise nach Neuseeland weder als breit gefächert noch als umfassend gegolten haben dürfte. In seinem bisherigen Leben hatte er Zweifel nur als etwas kennengelernt, was berechenbar und vorhersehbar ist. Er hatte es nur mit Misstrauen, Pessimismus oder Wahrscheinlichkeiten zu tun gehabt, aber noch nie mit der angsterfüllten Erkenntnis, die sich einstellt, wenn man nicht mehr an die eigene Zuversicht glauben kann, nie mit dem abscheulichen Entsetzen, das auf diese Erkenntnis folgt, und erst recht nie mit der tödlichen Leere, die sich danach ergibt. All diese letzten Formen der Ungewissheit waren ihm bis vor Kurzem glücklicherweise unbekannt geblieben. Sein Vorstellungsvermögen neigte nicht zum Phantastischen, und in Vorstellungen erging er sich nur, wenn es um konkrete Vorhaben ging. Die eigene Sterblichkeit besaß für ihn nur eine intellektuelle Faszination, eine Art düsteren Glanz; und da er nicht religiös war, glaubte er nicht an Gespenster.
Der ganze Bericht dessen, was auf diesem letzten Abschnitt der Reise zutage trat, ist Moodys Bericht, und das muss er bleiben. Wir halten es an dieser Stelle für ausreichend zu sagen, dass es an Bord der Godspeed acht Passagiere gab, als sie den Hafen von Dunedin verließ, und dass es neun waren, als sie an der Küste landete. Der neunte Passagier war kein Säugling, der unterwegs zur Welt gekommen wäre, er war auch kein blinder Passagier und kein Schiffbrüchiger, den der Mann im Ausguck im Wasser treibend erblickt hätte, an ein Stück Treibholz geklammert, und den zu retten er laut ausgerufen hätte. Aber dies zu erzählen hieße, Walter Moody dessen zu berauben, was er zu erzählen hat – und das wäre unfair, denn er war noch immer außerstande, sich die Erscheinung in allen Einzelheiten zu vergegenwärtigen, ganz davon zu schweigen, eine Geschichte zur Unterhaltung Unbeteiligter daraus zu bilden.
In Hokitika hatte es seit zwei Wochen ununterbrochen geregnet. Moodys erster Blick auf die Stadt zeigte ihm ein unstetes Gewölk, das sich vor und zurück bewegte, wenn der Nebel seine Richtung änderte. Zwischen der Küste und den abrupt aufragenden Bergen gab es nur einen schmalen Streifen Land, von der ständigen Brandung flach geklopft, die auf dem Sand wie Rauch aussah; der Strand wirkte noch flacher und enger durch die Wolke, die die Berge tief unten zerteilte und eine graue Decke über den eng gedrängten Dächern der Stadt bildete. Der Hafen lag im Süden der Ortschaft, in die gekrümmte Mündung eines goldreichen Flusses geschmiegt, der schäumte, wo er sich mit dem salzigen Meerwasser mischte. Hier an der Küste war er braun und trist, doch weiter flussaufwärts war sein Wasser kühl und klar, und es hieß, es schimmere. Die Flussmündung war ruhiges Wasser, ein kleiner See voll Masten und dicker Schornsteine von Dampfern, die auf besseres Wetter warteten, weil sie wussten, wie gefährlich es wäre, zu riskieren, auf die Sandbank aufzulaufen, die unter dem Wasser lauerte und bei jeder Strömung ihre Lage änderte. Die unermessliche Menge der Schiffe, die an dieser Sandbank gestrandet waren, lag als trauriges Zeugnis der Gefahr unter Wasser verstreut. Es waren insgesamt mehr als dreißig Wracks, darunter einige neueren Datums. Ihre zersplitterten Schiffskörper formten eine sonderbare Barriere, die einen bedrückenden Schutzwall der Stadt gegen das offene Meer zu bilden schien.