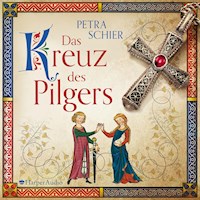7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kreuz-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Von der Eifel an den Rhein: ein Frauenschicksal im Mittelalter Luzia verbringt mit ihrer Herrschaft die Wintermonate in Koblenz. Die Bauerntochter ist überwältigt: Das Leben in der Stadt ist so aufregend! Ihr Glück scheint vollkommen, als der Gewürzhändler Martin Wied sie um ihre Mitarbeit bittet: Ingwerwurzeln, Safranfäden, Paradieskörner, Zitronenöl, Muskatnuss – Luzia entdeckt ihre Passion. Ihr Verkaufstalent, ebenso wie ihr hübsches Äußeres, bleibt auch anderen nicht verborgen. Ausgerechnet Siegfried Thal, der Sohn von Martins größtem Konkurrenten, will Luzia zur Frau. Noch bevor Martin ihr seine eigenen Gefühle offenbaren kann, wird er des Mordes angeklagt. Überzeugt von seiner Unschuld, beginnt Luzia nach dem wahren Täter zu suchen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 687
Ähnliche
Petra Schier
Die Gewürzhändlerin
Historischer Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Von der Eifel an den Rhein: ein Frauenschicksal im Mittelalter
Luzia verbringt mit ihrer Herrschaft die Wintermonate in Koblenz. Die Bauerntochter ist überwältigt: Das Leben in der Stadt ist so aufregend! Ihr Glück scheint vollkommen, als der Gewürzhändler Martin Wied sie um ihre Mitarbeit bittet: Ingwerwurzeln, Safranfäden, Paradieskörner, Zitronenöl, Muskatnuss – Luzia entdeckt ihre Passion.
Ihr Verkaufstalent, ebenso wie ihr hübsches Äußeres, bleibt auch anderen nicht verborgen. Ausgerechnet Siegfried Thal, der Sohn von Martins größtem Konkurrenten, will Luzia zur Frau. Noch bevor Martin ihr seine eigenen Gefühle offenbaren kann, wird er des Mordes angeklagt. Überzeugt von seiner Unschuld, beginnt Luzia nach dem wahren Täter zu suchen …
Über Petra Schier
Petra Schier, Jahrgang 1978, lebt mit ihrem Mann und einem Schäferhund in einer kleinen Gemeinde in der Eifel. Sie studierte Geschichte und Literatur und arbeitet mittlerweile freiberuflich als Lektorin und Schriftstellerin.
Mehr Informationen zur Autorin unter www.petra-schier.de.
Weitere Veröffentlichungen:
(die historischen Romane um die Apothekerstochter Adelina)
Tod im Beginenhaus
Mord im Dirnenhaus
Verrat im Zunfthaus
Frevel im Beinhaus
(aus der Romanreihe um die Reliquienhändlerin Marisa)
Die Stadt der Heiligen
Der gläserne Schrein
Das silberne Zeichen
(aus der Romanreihe um die Bauerntochter Luzia)
Die Eifelgräfin
Inhaltsübersicht
Du hättest keine Macht über mich,
wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre.
Darum: der mich dir überantwortet hat,
der hat größere Sünde.
(Johannes 19, 11)
Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann,
der gute Perlen suchte,
und als er eine kostbare Perle fand,
ging er hin und verkaufte alles, was er hatte,
und kaufte sie.
(Matthäus 13, 45–46)
Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen:
Bei einem Sünder ist er eingekehrt.
Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach:
Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe,
so gebe ich es vierfach zurück.
(Lukas 19, 7–8)
Prolog
Konstantinopel, Frühjahr, Anno Domini 1199
Wehmütig, doch zugleich auch mit Vorfreude im Herzen blickte Matthäus Ibn Maternus Ibn Radulf auf die Mauern und Türme der Metropole zurück. Die Sonne brannte heiß und unbarmherzig auf die Reisewagen hinab, deren Nachhut er zusammen mit zweien seiner Knechte bildete. Der Sommer war noch fern, dennoch glühte die Erde bereits in der ersten Trockenperiode dieses Jahres. Matthäus hatte sein Reittier gezügelt und sich einen letzten Blick auf Konstantinopel erlaubt, jene Stadt, die seinem Vater und zuvor schon seinem Großvater zu Reichtum verholfen hatte. Die Zeiten für Kaufleute waren gut, insbesondere nachdem König Amalrich II. von Jerusalem im vergangenen Jahr einen Waffenstillstand mit den Muslimen hatte aushandeln können. Der Fernhandel mit Italien, dem Frankenreich und sogar den Ländern noch weiter nördlich wuchs und gedieh.
Dies war einer der Gründe, weshalb Matthäus sich auf den Weg dorthin begeben hatte. Sein Ziel war das Heilige Römische Reich – vor allem die großen Handelsstädte am Rhein, von denen sein Großvater ihm so viel erzählt hatte, als Matthäus noch ein Junge gewesen war. Seit jener Zeit trug er dieses Fernweh in seinem Herzen, den Wunsch, die Orte zu sehen, die mit den Wurzeln seiner Familie eng verknüpft waren. Sein Großvater Radulf war als Kreuzritter im Zweiten Kreuzzug unter König Konrad III. nach Jerusalem gezogen und nach der Niederlage des Kreuzfahrerheeres dort geblieben. Er hatte Maria geheiratet, die Tochter eines angesehenen christlichen Handelsherrn aus der Grafschaft Edessa, und nach dem Tod des Schwiegervaters dessen gutgehendes Handelskontor zu einem der bedeutendsten Fernhandelsgeschäfte ausgebaut. Er selbst, später sein Sohn und auch Matthäus waren regelmäßig zwischen Edessa und Konstantinopel hin- und hergereist, hatten Karawanen mit Gewürzen und anderen Handelswaren auf den Weg zu ihren fernen Bestimmungsorten gebracht.
Matthäus hatte nun beschlossen, sein Geschäft an eine dieser fernen Stätten am Rhein zu verlegen, nicht zuletzt weil er seinem Großvater einst versprochen hatte, eines Tages in jene Heimat, das Heilige Römische Reich, zurückzukehren: Er wolle die grünen Wiesen und Hänge, die von Wild bevölkerten Wälder, die vielen im Sonnenlicht glitzernden Bäche und Flüsse sehen – und die kühle, klare Luft nach einem ergiebigen Regenguss selbst einatmen und auf der Haut spüren.
Radulf hatte gelacht und ihm für dieses Vorhaben Glück gewünscht; vermutlich hatte er den Flausen seines Enkels nicht allzu viel Beachtung geschenkt. Dennoch hatte er ihm einige Jahre später, kurz vor seinem Tod, ein Geschenk gemacht und ihn gebeten, er möge es mit sich nehmen, wenn er tatsächlich das Land am Rhein aufsuchen würde.
Matthäus zog die mit roten und blauen Edelsteinen besetzte Kette unter seinem Hemd hervor, betrachtete sie sinnend und schloss die rechte Hand fest darum. Lag es an seiner eigenen Körperwärme, dass die Kette sich so seltsam lebendig anfühlte? Fast hatte er den Eindruck, ein sanftes Prickeln oder Pulsieren zu spüren.
Eine Reliquie sei dies, hatte der Großvater ihm erklärt, einer von drei Teilen einer Reliquie, die er während des Kreuzzuges mit zwei seiner besten Freunde geteilt hatte.
«Niemals», hatte er gesagt, «darfst du diese Kette verkaufen. Behalte sie in Ehren, sie ist das Unterpfand unseres Glücks und Erfolgs. Solltest du dereinst einem der Nachfahren jener beiden Männer begegnen, so erinnere dich an die alte Freundschaft unserer Familien und an das Gelöbnis, welches wir einander damals gaben, niemals Krieg oder Händel gegeneinander zu führen, sondern einander beizustehen.»
Matthäus hatte versprochen, dieses Erbe zu hüten und an seine Kinder weiterzugeben. Gleichwohl bezweifelte er, dass er jemals einem Nachkommen jener Freunde seines Großvaters begegnen würde. Gewiss, er würde sich nach den Grafen von Wied erkundigen und möglicherweise sogar jemanden finden, der den Bauern Jost Bongert gekannt hatte, der einst für seinen Herrn dem Aufruf zum Kreuzzug gefolgt war. Doch niemand konnte wissen, ob es überhaupt noch Nachfahren jener beiden Familien gab.
Das Wichtigste war zunächst, die weite, anstrengende Reise zu bewältigen und sich nach einem Ort umzusehen, der sich sowohl zum Leben als auch für sein Geschäft eignete. Fernhandel betrieb man am besten direkt von einer der Städte am Rhein aus. Köln vielleicht, obgleich dort die Konkurrenz sicherlich am größten sein und es ihm schwermachen würde, als Fremder Fuß zu fassen.
Vielleicht sollte er sich lieber eine kleinere Stadt suchen – für den Anfang. Und noch etwas musste er tun. Matthäus Ibn Maternus Ibn Radulf war sowohl in Edessa als auch in Konstantinopel und allen Städten dazwischen ein angesehener Name. In jenen Landen am Rhein, so fürchtete Matthäus, wäre der arabische Klang jedoch vermutlich nicht gerade förderlich. Deshalb hatte er beschlossen, seinen Namen zu ändern und sich nach jenem Geschlecht zu nennen, dem sein Großvater – wenn auch nur als unehelicher Sohn – entstammte.
Matthäus Wied. Der ungewöhnliche Klang beschäftigte seine Gedanken, sodass er zunächst gar nicht bemerkte, dass einer seiner Männer kehrtgemacht hatte und auf ihn zugeritten kam.
«Herr?» Der kleine, drahtige Knecht zog sich das Tuch vom Gesicht, mit dem er sich vor dem feinen Sandstaub schützte, den der Wind seit dem Morgen vor sich hertrieb. «Warum habt Ihr angehalten? Gibt es ein Problem?»
Matthäus riss sich vom Anblick der Stadt los und schüttelte den Kopf. «Nein, Ahmet, es ist alles in Ordnung. Ein bisschen Wehmut hat mich wohl gerade überkommen. Ich weiß nicht, ob ich Konstantinopel oder die Stätten meiner Kindheit und Jugend jemals wiedersehen werde.»
Ahmet nickte verständnisvoll. «Ihr habt einen langen Weg vor Euch, Herr. Ich würde Euch ja begleiten, wenn …»
«Nein, Ahmet. Du und die anderen Männer bleiben hier. Ich kehre zurück in das Land meiner Väter, es reicht, wenn einer von uns seine Heimat verlassen muss.» Matthäus warf noch einen letzten Blick auf Konstantinopel, dann schnalzte er und wendete sein Pferd. Die Kette, die er noch immer umfasst hielt, schob er sorgsam unter sein Hemd zurück. «Komm, Ahmet, wir sollten uns beeilen, damit wir die Karawane noch rechtzeitig erreichen.»
1. Kapitel
Koblenz, 1. September, Anno Domini 1351
Ach du liebe Zeit, Luzia, sieh dir das an!» Elisabeth von Manten deutete missbilligend auf die lange Schlange, die sich vor dem Stand des Pastetenbäckers gebildet hatte. Die beiden Frauen hatten gemeinsam die wichtigsten Einkäufe auf dem Koblenzer Wochenmarkt getätigt und den Knecht Wilbert bereits mit zwei vollen Körben nach Hause geschickt. Nun folgte ihnen noch Luzias Bruder Anton, der ebenfalls bereits einiges an Lebensmitteln in einem Korb vor sich hertrug. «Da warten wir ja ewig», beschwerte Elisabeth sich weiter, steuerte aber dennoch auf das Ende der Schlange zu. Als sie bemerkte, dass ihre Magd ihr nicht folgte, drehte sie sich zu ihr um. «Luzia? Hast du mich gehört?»
«Hm?» Zögernd wandte sich Luzia ihrer Herrin zu und kam mit abwesendem Blick ein paar Schritte näher.
Elisabeth blickte sie aufmerksam an. «Stimmt etwas nicht?»
Entschlossen riss sich Luzia zusammen und bemühte sich, die merkwürdige Empfindung zu ignorieren, die sie gerade überkommen hatte. «Verzeihung, Herrin, ich war nur gerade …»
«In Gedanken, das habe ich gesehen», ergänzte Elisabeth und lächelte.
«Nein», entgegnete Luzia verlegen. «Ja, das heißt … Ich dachte gerade …» Unwillkürlich fasste sie an die Stelle, an der unter ihrem Umhang das silberne Kruzifix verborgen war, das sie schon seit zwei Jahren an einer Kette um den Hals trug. Das Kreuz bestand aus zwei Teilen, einem mit roten und blauen Edelsteinen besetzten Rahmen und dem schlichten Kruzifix selbst. Vor drei Jahren, als Luzia in Elisabeths Dienst getreten war, hatten sie festgestellt, dass sie beide im Besitz jener beiden Teile der Reliquie waren, die ihre Ahnväter auf dem Kreuzzug erbeutet hatten: Vermutlich ein Teil des legendären Gralsschatzes, wie sie mittlerweile von Elisabeths Beichtvater Georg erfahren hatten. Selbstverständlich wusste außer ihnen niemand davon – auch nicht, dass das Kruzifix seltsame Fähigkeiten besaß.
Seit sie die beiden Teile wieder zusammengefügt hatten, war Luzia hin und wieder in der Lage, in Träumen kurze Einblicke in zukünftige Geschehnisse zu erhalten. Auch leuchtete das Kruzifix gelegentlich, summte und vibrierte, wenn es auf eine bevorstehende Gefahr aufmerksam machen wollte. Sie hatte inzwischen gelernt, diese Fähigkeiten zu nutzen. Seit sie jedoch vor zwei Wochen in Koblenz eingetroffen waren, glaubte Luzia manchmal, ein leichtes Vibrieren unter der stets ungewöhnlich warmen Oberfläche des Kreuzes zu spüren. Eben war es wieder da gewesen – dieses leichte Pulsieren, das sich fast wie ein Herzschlag anfühlte.
Elisabeth hatte Luzias unwillkürliche Geste natürlich bemerkt, und sofort wurde ihre Miene besorgt. «Was ist, Luzia?», fragte sie mit gesenkter Stimme. «Hast du etwas gespürt? Hat das Kreuz …»
«Nein, nein, Herrin.» Rasch schüttelte Luzia den Kopf. «Ich hatte nur das Gefühl … Aber jetzt ist es schon vorbei.»
«Was für ein Gefühl?»
Luzia seufzte. «Ich dachte, es vibriert wieder. Aber ich habe mich bestimmt getäuscht.»
«Hoffentlich.» Elisabeth runzelte die Stirn. «Du weißt, dass es meistens nichts Gutes bedeutet, wenn das Kruzifix sich regt. Manchmal denke ich, es wäre besser gewesen, wir hätten es Bruder Georg zur Verwahrung gegeben oder ihn gebeten, es einem Gelehrten vorzulegen, damit er es untersucht.»
«Aber das können wir nicht!», widersprach Luzia im Flüsterton. «Der Schwur, der damals geleistet wurde, besagt, dass es in der Familie bleiben muss. Wir müssen uns an dieses Versprechen halten.»
«Ja, sicher.» Elisabeth zögerte und blickte sich vorsichtig um, doch in dem bunten Treiben um sie herum achtete niemand auf ihr Gespräch. Dennoch schüttelte sie den Kopf. «Lass uns zu Hause darüber sprechen. Ich hoffe bloß, wir müssen hier nicht noch viel länger warten, sonst gibt es womöglich in der Garküche keine schönen Kapaune mehr zu kaufen. Hoffentlich taugt die Köchin, die Johann von diesem Ratsherrn Hole empfohlen wurde. Ich bin es leid, das Essen ständig von außerhalb holen zu müssen.»
«Wann soll die Frau bei uns anfangen?»
Elisabeth seufzte hoffnungsvoll. «Morgen.»
Die beiden Frauen lächelten einander an und warteten dann geduldig, bis sie an der Reihe waren. Eine knappe halbe Stunde später machten sie sich auf den Heimweg zum Stadthaus der Mantens. Im Winter war es unangenehm kalt in der Burg an der Mosel, daher hatte Elisabeths Mann, Graf Johann von Manten, ein geräumiges Haus mitten in Koblenz gekauft, in das man sich in der kalten Jahreszeit zurückziehen konnte. Beide Frauen waren froh darüber.
Anton schleppte nun nicht nur die Pasteten und sorgsam verpackten gegarten Kapaune in seinem Korb, sondern obendrein noch zwei große Brote, die Elisabeth bei Meister Feit in der Mehlgasse erstanden hatte. Zwar verdrehte er ob seiner schweren Last die Augen, schnüffelte gleichzeitig jedoch genießerisch, denn das gebratene Fleisch verströmte einen geradezu sündhaften Duft.
Luzia warf ihm über die Schulter einen prüfenden Blick zu und lachte. «Was ist, Tünn, läuft dir das Wasser jetzt schon im Mund zusammen? Lass bloß die Finger von dem Geflügel. Das ist nur für die Herrschaft bestimmt.»
Anton grinste und zuckte mit den Achseln. «Träumen wird wohl erlaubt sein», brummelte er mit seiner inzwischen deutlich dunkleren Stimme, an die sich Luzia noch immer nicht gewöhnt hatte. Er machte nie viele Worte, deshalb warf ihm Luzia ein weiteres, diesmal herausforderndes Lächeln zu. «Du wirst schon nicht verhungern, kleiner Bruder.»
«Hey, nenn mich nicht klein! Ich bin inzwischen viel größer als du.»
Zufrieden, ihrem Bruder noch ein paar weitere Worte entlockt zu haben, zwinkerte sie ihm zu und zupfte spielerisch an einer seiner roten Locken, die ihren eigenen so sehr ähnelten. «An Körpergröße vielleicht, aber an Jahren wirst du immer fünf hinter mir zurückbleiben.»
«Da wären wir», unterbrach Elisabeth das Geplänkel der beiden und öffnete die Tür zu dem stattlichen dreigeschossigen Steinhaus, dessen Fenster im Erdgeschoss mit teurem Glas verschlossen waren. In den beiden oberen Geschossen füllten mit Schweinehaut bespannte Holzrahmen die Fensteröffnungen, sodass auch hier die Bewohner gegen die Zugluft geschützt waren.
Luzia schritt hinter ihrer Herrin hinein, gefolgt von Anton, der sich zielstrebig auf den Weg in die Küche machte, um seine Last endlich loszuwerden.
Elisabeth blickte sich prüfend um. Sie standen in einem großen Raum, der gleichzeitig Eingangshalle und gute Stube war. Von ihr selbst geknüpfte Wandteppiche schmückten die frisch geweißten Wände dort, wo es keine Regale mit Geschirr und Truhen mit Tischwäsche gab. Beherrscht wurde der Raum von einem langen, schweren Eichentisch, an dem zwölf Personen mit Leichtigkeit Platz fanden. Am oberen Ende der Tafel gab es sechs sehr wertvolle und aufwendig mit Schnitzereien gestaltete Stühle, am unteren Ende standen zu beiden Seiten des Tisches Bänke für das Gesinde. Johann hatte darauf bestanden, die Dienstbotenschaft klein zu halten, da der Unterhalt eines Stadthauses an sich schon sehr teuer war. Die Mahlzeiten durften die Knechte und Mägde deshalb ebenfalls hier einnehmen, es sei denn, Johann und Elisabeth hatten Gäste geladen. Dann wurden die Bänke entfernt und weitere Stühle aufgestellt.
Im Kamin, der sich den Rauchabzug mit der im angrenzenden Raum befindlichen Küche teilte, stapelte sich ordentlich aufgeschichtetes Holz und wartete darauf, für ein heimeliges Feuer entzündet zu werden. Noch war der Spätsommer jedoch so angenehm warm, dass nur selten – und wenn, dann meist bloß abends – geheizt wurde.
Elisabeth wandte sich an Luzia. «Geh und schau nach, wo Hilla steckt. Sie soll den Tisch decken, damit wir essen können. Ich sehe derweil nach, wo Johann steckt.»
Luzia nickte und machte sich umgehend auf die Suche nach der kleinen schwarzhaarigen Magd, die sie von der Mantenburg mitgebracht hatten. Sie fand Hilla im Hof hinter dem Haus, wo sie die Hühner fütterte und dabei ungehalten vor sich hin murmelte und sich den Rücken rieb.
«Hilla, Frau Elisabeth möchte, dass du den Tisch deckst.»
Die Magd drehte sich um und musterte Luzia ungnädig. «Ich komm schon gleich. Verfluchte Stalltür! Ist mir doch glatt ins Kreuz geflogen, als ich die Eier holen wollte.» Wieder rieb sie sich den Rücken. «Der Godewin soll sich das mal anschauen. Da stimmt was mit den Scharnieren nicht. Immerzu fliegt die Tür zu. So schnell kann man keinen Klotz finden, um sie aufzuhalten.» Sie verteilte seelenruhig weiter Futter zwischen den Hühnern.
Luzia sah ihr einen Augenblick dabei zu, dann räusperte sie sich. «Hilla, die Herrin meinte sofort.»
Verärgert hob Hilla erneut den Kopf. «Hab’s vernommen. Kann aber nicht zaubern. Soll die Arbeit hier draußen liegenbleiben? Ich bräucht dringend noch eine zweite Magd zur Hilfe. Aber fragt mich wer? Warum gehst du nicht und deckst den Tisch? Bist dir wohl zu fein dafür.»
Luzia runzelte die Stirn. «Ich muss mich um die Einkäufe kümmern, die Wilbert und Anton in die Küche gestellt haben. Sie müssen ordentlich in der Speisekammer verstaut werden, damit sie nicht verderben. Frau Elisabeth hat bestimmt, dass ich dafür verantwortlich bin, solange die neue Köchin noch nicht hier ist.»
«Na klar, wer sonst. Das brave Jungferchen hat ja Sonderrechte. So gut möcht ich’s auch mal haben», murmelte Hilla verdrießlich, stellte aber schließlich doch den Eimer mit dem Hühnerfutter beiseite und ging ins Haus.
Luzia sah ihr mit einem leichten Kopfschütteln nach und griff dann selbst nach dem Eimer. Rasch streute sie das restliche Futter zwischen die gackernden Hühner, bevor sie sich in die Küche begab, um die Lebensmittel zu verstauen.
Da Elisabeth für den Nachmittag von einer Nachbarin, der Adligen Christine von der Arken, eingeladen worden war, nutzte Luzia die freien Stunden für einen weiteren Gang in die Stadt. Sie nahm ihren Bruder mit, da Elisabeth ihr eingeschärft hatte, niemals ohne Begleitung, vorzugsweise männliche, auszugehen. Zum einen schickte es sich für eine ehrbare Jungfer nicht, alleine durch Koblenz zu streifen, zum anderen war es zu gefährlich: Auch wenn Koblenz eine wohlhabende und durch ein Aufgebot an Stadtsoldaten wohlbehütete Stadt war, trieb sich doch eine Menge unehrliches Gelichter in den Straßen und Gassen herum.
Luzia genoss das geschäftige Treiben um sich herum. Sie beobachtete im Gehen einen Zimmermann, der an einem Haus in der Judengasse eine neue Tür einsetzte. Einen Moment musste sie stehen bleiben, weil ein Ochsenfuhrwerk ihren Weg kreuzte, das hoch mit Mehlsäcken beladen war. Inzwischen kannte sie sich gut genug in der Stadt aus, um zu wissen, dass dies sicher die Lieferung für einen der zahlreichen Bäcker in der Mehlgasse war. Hinter dem Fuhrwerk liefen zwei ältliche, ausgemergelte Mägde, die große Eimer mit Wasser schleppten, und aus der Schildergasse kam gerade eine Horde von sechs oder sieben Gassenjungen gerannt, die jauchzend und schreiend mit Stöcken einen Stein vor sich hertrieben und versuchten, ihn sich gegenseitig abzuluchsen. Von irgendwoher schallte eine keifende Frauenstimme, die sich über den Lärm beschwerte, den die Buben veranstalteten.
Da sie zur Liebfrauenkirche wollte, hielt Luzia sich rechts und ging am Friedhof vorbei auf das große Portal des Gotteshauses zu.
Anton zupfte sie am Ärmel. «Willst du schon wieder beten? Du warst doch erst gestern. Muss ich da mit rein?»
Luzia blieb stehen. «Heute ist der Tag des heiligen Ägidius, des Nothelfers. Wie oft habe ich ihn in der Vergangenheit um Beistand angefleht! Da ist es nur recht, dass ich ihm an seinem Gedenktag eine Kerze anzünde und ein Dankgebet spreche.»
Anton verdrehte kurz die Augen, blickte dann jedoch betreten auf seine Fußspitzen, die in neuen Lederstiefeln steckten. Er erinnerte sich selbst nur allzu gut an die schlimme Zeit während der großen Pest vor drei Jahren. Sie hatten damals ihre Eltern, die kleine Schwester und die Großmutter verloren und standen seither allein auf der Welt. Zwar besaßen sie noch den Hof in Blasweiler und das dazugehörige Land, doch wenn sie in Elisabeth und Johann nicht solche fürsorglichen Freunde gehabt hätten, die Luzia dabei halfen, das Erbe zu verwalten und zu erhalten, wäre es ihnen sicherlich schwergefallen, sich durchzuschlagen.
Anton fühlte sich wohl im Dienst des Grafen von Manten. Selbst ein Edelknecht hätte es bei manch anderem Herrn nicht so gut gehabt. Luzia, die Elisabeths Leibmagd war, verdiente obendrein noch einen erklecklichen Lohn, der es ihr ermöglichte, ihren Bruder und sich selbst stets ordentlich zu kleiden und dafür zu sorgen, dass es ihnen an nichts fehlte. Sie waren vor Jahren übereingekommen, niemandem zu verraten, dass sie die Nachkommen von einfachen Bauern waren. Elisabeth hatte sie darin ermutigt, um den Geschwistern, deren Schicksal zuletzt so hart gewesen war, einen Vorteil zu verschaffen. Tatsächlich wurden sowohl Luzia als auch Anton überall mit Respekt behandelt, glaubten die Leute doch, sie seien die Waisen einer angesehenen bürgerlichen Familie.
Anton hatte sich längst mit dieser Maskerade abgefunden und konnte sich inzwischen kaum noch vorstellen, den elterlichen Hof tatsächlich einmal als Bauer zu übernehmen. Zu weit fort schien ihm das Eifeldorf Blasweiler und die leibeigenen Nachbarn, unter denen er aufgewachsen war. Leider waren mehr als zwei Drittel von ihnen ebenfalls der Pestilenz zum Opfer gefallen. Er würde sich in seinem Heimatdorf ganz sicher nicht mehr heimisch fühlen, müsste er heute oder morgen dorthin zurückkehren. Derzeit war der Hof an einen anderen Bauern verpachtet und warf sogar so gute Erträge ab, dass der Pachtzins regelmäßig floss. Eine weitere Einnahmequelle, über die Luzia sorgfältig Buch führte.
Luzia hatte von Elisabeth Lesen und Schreiben gelernt und beides mittlerweile auch Anton gelehrt. Vor anderen verschwieg er sein Können meistens, denn er wollte nicht als Sonderling unter seinesgleichen dastehen. Selbst viele Bürgerliche waren des Lesens und Schreibens nicht mächtig, geschweige denn Knechte. Aber es gab Anton ein gutes Gefühl, über Kenntnisse zu verfügen, die so vielen anderen Menschen auf ewig verschlossen blieben.
Während er mit sich selbst im Reinen war und sich im Allgemeinen wohlfühlte, wusste er, dass Luzia unter den Ereignissen der Vergangenheit weit stärker gelitten hatte als er. Mehr, als sie selbst vor Elisabeth zugab. Anton vermutete, dass sie ein schlechtes Gewissen hatte, weil sie nicht da gewesen war, als ihre Familie von dieser heimtückischen Krankheit befallen und dahingerafft worden war. Er, Anton, hatte mit ansehen müssen, wie ein geliebter Mensch nach dem anderen gestorben war, ohne dass er etwas hätte tun können. Doch er gab sich nicht die Schuld daran. Auch dass er sich als Einziger wie durch ein Wunder nicht angesteckt hatte, nahm er im Nachhinein als einen Wink Gottes hin, dass dieser offenbar noch Größeres mit ihm vorhatte.
Seine Schwester hingegen war in letzter Zeit häufig sehr still gewesen, hatte sich zunehmend dem Gebet gewidmet und immer häufiger die Kirche besucht. Sie hatte bereits ein kleines Vermögen für Talglichter und Kerzen ausgegeben, die sie an den Gedenktagen der heiligen Nothelfer, der Gottesmutter Maria und an den Namenstagen ihrer Eltern sowie der Schwester in der Kirche entzündete. Oft sah er sie in unbeobachteten Momenten wehmütig in die Ferne blicken und fragte sich, woran sie in solchen Augenblicken wohl denken mochte. Zu fragen hatte er bisher noch nicht gewagt. Er hoffte nur, sie würde nicht schwermütig werden, denn das sähe Luzia so gar nicht ähnlich. Sie war immer zupackend und von fröhlichem Gemüt gewesen. Anton grinste kurz vor sich hin. Ihr loses Mundwerk war seinerzeit weithin bekannt gewesen. Sie hielt mit ihrer Meinung selten hinterm Berg, selbst ihrer Herrin gegenüber konnte sie ihre spitze Zunge manchmal nicht im Zaum halten. Nach außen hin schien sie auch noch immer dieselbe Luzia zu sein. Lediglich in diesen kurzen Momenten, in denen sie glaubte, niemand merke es, schien sie plötzlich wie verwandelt.
«Soll ich nun mit reingehen?», fragte Anton und versuchte, in der gleichmütigen Miene seiner Schwester Anzeichen von Trauer oder Schwermut zu finden.
Luzia lächelte und zwinkerte ihm zu. «Weißt du was – warte einfach hier draußen auf mich. Es wird nicht so lange dauern. Aber lauf ja nicht weg. Du weißt, dass ich nicht allein durch die Stadt gehen soll.»
«Schon klar.» Anton atmete auf und ließ sich auf einem Mauervorsprung neben dem Portal nieder. «Sag dem heiligen Ägidius einen schönen Gruß von mir.»
Luzia kicherte und hob drohend den Zeigefinger, dann betrat sie das Gotteshaus. Leises Gemurmel wehte ihr entgegen und steigerte sich zu einem Stimmengewirr, als sie das große Kirchenschiff durchquerte. Am Altar standen Vater Lambert, einer der Kapläne, und mehrere Kanoniker des St. Florinstiftes beieinander und waren offenbar in irgendeinen gelehrten lateinischen Disput verwickelt. Zwei Laienbrüder waren damit beschäftigt, mit großen Reisigbesen den Fußboden zu kehren. Auch sie unterhielten sich lautstark auf Latein und lachten immer wieder. Sie kehrten um mehrere reichgewandete Männer herum, die sich offenbar hier getroffen hatten, um irgendwelche Geschäfte abzuwickeln. Zwei von ihnen hatte Luzia bereits gesehen: den Ratsherrn Hole, der ihnen die Köchin empfohlen hatte, und den Fleischermeister Richolf Barfuse, der ebenfalls einen Sitz im Stadtrat besaß.
Vor dem Marienaltar knieten zwei Frauen in den strengen grauen Trachten der Beginen und waren in ein Gebet vertieft. Wenige Schritte weiter saßen zwei Geistliche an einem länglichen Tisch, vor sich Papier, Federkiele und Tinte, und warteten darauf, dass jemand bei ihnen die Niederschrift eines Briefes in Auftrag gab. Luzia ging rasch an ihnen vorbei auf einen weiteren Seitenaltar zu, vor dem sich, ähnlich wie vor dem Marienaltar, unzählige brennende Kerzen und Talglichter aneinanderdrängten. Ihre hellen Flammen flackerten im Luftzug, als Luzia sich über sie beugte und das Lichtermeer nach einer noch nicht brennenden Kerze absuchte. Schließlich fand sie eine, nahm sie und entzündete sie an einem anderen Licht. Fast gleichzeitig hörte sie neben sich ein aufforderndes Räuspern. Ein alter Geistlicher mit verkniffenem Mund und derart faltigem Gesicht, dass es aussah, als habe man die Haut wie ein Stück Papier zerknüllt und dann ohne Sorgfalt wieder glatt gestrichen, deutete mit strengem Blick auf den Opferstock.
Luzia lächelte ihm freundlich zu, öffnete die Geldkatze an ihrem Gürtel und entnahm ihr eine Münze. Sie hielt sie dem Geistlichen vor die Nase, der jedoch keine Miene verzog, und warf sie dann in den quadratischen Silberkasten, der als Opferstock diente. Als sie sich erneut nach dem Geistlichen umsah, war er verschwunden. Sie schmunzelte. Offenbar hatte er sich in irgendeine Nische zurückgezogen, um weiterhin die Besucher des Gotteshauses im Auge zu behalten und dafür zu sorgen, dass ein jeder seine ordnungsgemäße Spende für die Kerzen hergab.
Luzia bekreuzigte sich und hatte sich gerade auf die hölzerne Kniebank vor dem Seitenaltar gekniet, als neben ihr die üppigen Röcke einer älteren Frau raschelten.
«Wie es aussieht, ist Bruder Fulrad heute guter Stimmung», flüsterte die Frau Luzia zu und kniete sich neben sie. Als sie Luzias überraschte Miene sah, lächelte sie. «Er bewacht die Opferstöcke von Liebfrauen nun schon seit über dreißig Jahren. Muss langweilig sein, meint Ihr nicht auch? Interessant wird es doch nur, wenn jemand eine richtig große Spende für einen Ablass tätigt. Ist aber schon ein Weilchen nicht mehr geschehen, weil sich die meisten in solchen Fällen ans St. Kastorstift wenden. Oder ans St. Florinstift.» Sie kicherte verhalten. «Oder gleich an den Erzbischof persönlich.» Nun wurde sie wieder ernst. «Verzeiht, ich möchte Euch nicht in Eurer Andacht stören.»
Luzia neigte nur kurz den Kopf und versenkte sich in ihr Gebet. Die Frau neben ihr tat es ihr gleich.
Aus den Augenwinkeln musterte Luzia sie. Es handelte sich offenbar um eine bürgerliche Matrone. Ihre leicht füllige Statur sowie der reiche dunkle Brokatstoff ihres Kleides verrieten ihren Wohlstand. Die braunen Haare hatte sie zu zwei dicken Schnecken geflochten und links und rechts an ihrem Kopf festgesteckt. Eine zarte braune Leinenhaube mit Haarnetzen hielt die kunstvolle Frisur zusammen. An den Fingern, welche die Frau andächtig vor der Brust gefaltet hielt, trug sie gleich vier wertvolle Silberringe; einer davon ähnelte dem Siegelring, den Johann von Manten trug. Vielleicht war dies ihr Ehering, oder sie war verwitwet und besaß nun das Siegelrecht ihres verstorbenen Mannes. Elisabeth hatte ihr so einiges über die Gepflogenheiten von Adligen, Patriziern und Bürgern erklärt.
Als sich Luzia erhob, tat die Frau es ihr gleich und seufzte aus tiefstem Herzen. «So, genug für heute.» Sie wandte sich Luzia wieder zu. «Ich hoffe, Ihr habt einen erfreulicheren Grund für Eure Andacht und die gespendete Kerze als ich. Eine Geste des Dankes, ja?» Sie lächelte wehmütig. «Wisst Ihr, ich komme jeden Tag hierher zum Beten. Mein Sohn ist nun schon seit zwei Jahren in der Fremde, und ich hoffe auf seine baldige Heimkehr. Der letzte Brief, den wir von ihm erhalten haben, ist vor über vier Monaten gekommen. Darin hat er versprochen, zum Jahrmarkt wieder hier zu sein. Er ist Kaufmann, wisst Ihr, und musste in ferne Länder reisen, um seinem Onkel beizustehen, der inzwischen leider verstorben ist; Gott sei seiner Seele gnädig.» Die Frau bekreuzigte sich. «Mein ältester Sohn wird das Fernhandelsgeschäft in Italien übernehmen, aber er hat damals einen Brief mit der Bitte um Hilfe geschickt … Aber ach, was erzähle ich Euch davon! Ihr kennt mich ja nicht einmal und ich Euch auch nicht.» Sie legte den Kopf auf die Seite. «Euer Gesicht kommt mir so gar nicht bekannt vor. Seid Ihr zu Besuch hier in Koblenz?»
Luzia lächelte über die offenkundige Neugier und Redseligkeit ihres Gegenübers, und da sie die Frau nicht unsympathisch fand, antwortete sie freundlich: «Nein, nicht zu Besuch. Wir – das heißt meine Herrschaft – sind gerade in ein Stadthaus am Graben gezogen, und ich …»
«Ach, dann seid Ihr bestimmt die Edelmagd der Gräfin Elisabeth, nicht wahr? Ich habe schon von Euch gehört oder vielmehr von der Gräfin. Sie soll eine außergewöhnlich schöne und zugleich ehrfurchtgebietende Frau sein, sagt man. Ich habe sie ja bisher noch nicht kennengelernt. So ein Zufall, dass ich gerade Euch hier begegne. Wisst Ihr, mein Sohn, der, von dem ich eben erzählt habe, ist ein guter Freund des Grafen Johann.» Sie lachte vergnügt. «Ich habe mir schon überlegt, dass Martin sich gewiss freuen wird, wenn er von seiner Reise zurückkehrt und erfährt, dass Herr Johann sich um die Bürgerschaft in Koblenz bemüht.»
Während die Frau eifrig auf Luzia einredete, spürte diese plötzlich wieder das leichte Pulsieren des Kruzifixes. Unwillkürlich griff sie danach, zwang sich dann jedoch, die Hand wieder sinken zu lassen, um keinen Argwohn zu erwecken. Etwas unbehaglich verschränkte sie die Hände ineinander. «Martin? Meint Ihr Martin Wied, den Weinhändler? Das ist Euer Sohn?»
«Aber ja, sagte ich das nicht eben? O verzeiht, ich habe mich ja noch immer nicht vorgestellt. Was müsst Ihr nur von mir denken? Mein Name ist Augusta Wied. Und Ihr seid … Wartet, es fällt mir gleich wieder ein! Louisa?»
«Luzia. Luzia Bongert.»
«Ja, richtig. Luzia.» Augusta blickte sich suchend um. «Wo steckt denn meine Magd? Ich fürchte, ich muss mich nun verabschieden. Meine Pflichten rufen. Bitte richtet Eurer Herrin und Graf Johann einen Gruß von mir aus. Vielleicht ergibt es sich ja bald einmal, dass wir gemeinsam speisen. Herr Johann kam früher häufig zu uns zu Besuch. Sobald Martin heimgekehrt ist, werde ich ihn bitten, eine Einladung auszusprechen.» Augusta wollte sich abwenden, hielt jedoch mitten in der Bewegung inne und lauschte. «Was ist das?»
«Was meint Ihr?» Luzia tat, als höre sie nichts, obgleich sie genau wusste, was Augusta meinte. Das Kruzifix vibrierte stärker.
«Da ist doch was … ein Summen. Hört Ihr das nicht?» Augusta lauschte noch angestrengter.
Rasch drehte sich Luzia zur Seite und tat, als schaue sie sich um. «Nein», antwortete sie, doch ihre Stimme klang nicht so sicher, wie sie gehofft hatte. «Ich weiß nicht, was Ihr meint. Eine Fliege vielleicht? Oder eine Biene?»
«Hier in der Kirche?» Augusta schüttelte den Kopf, hob dann jedoch die Schultern. «Das muss es wohl sein. Aber ich sehe keine Fliege weit und breit. Merkwürdig. Es klingt auch gar nicht wie eine Fliege, sondern irgendwie … Ich weiß auch nicht. Merkwürdig.»
Luzia wurde blass und legte unwillkürlich erneut ihre Hand auf die Stelle an ihrer Brust, an der sich unter ihrem Umhang das Kruzifix befand. Sofort verstummte das Summen.
Augustas Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. «Das ist ja seltsam. Jetzt hat es aufgehört. Seid Ihr sicher, dass Ihr nichts gehört habt, Jungfer Luzia?»
Ehe Luzia darauf antworten konnte, trat Augusta einen Schritt zurück und nickte ihr – nun deutlich distanzierter als zuvor – noch einmal kurz zu. «Entschuldigt mich, ich muss nun gehen. Gehabt Euch wohl!»
«Beruhige dich, Luzia, so schlimm ist die Sache doch gar nicht», versuchte Elisabeth ihre Freundin am Abend zu beschwichtigen. Luzia hatte ihr gleich bei ihrer Rückkehr von dem Zusammentreffen mit Martin Wieds Mutter berichtet. Natürlich hatte sie bemerkt, wie rasch die leutselige Art der Frau in Misstrauen umgeschlagen war. Augusta Wied hatte ganz sicher mitbekommen, dass Luzia nicht die Wahrheit gesagt hatte. Aber wie hätte sie dieser Fremden erklären sollen, dass sie ein Kruzifix bei sich trug, das über magische oder göttliche Fähigkeiten verfügte und vor Unheil warnte?
Elisabeth hatte Luzia eine Hand auf den Arm gelegt und drückte ihn nun leicht. «Du hast es schon ganz richtig gemacht. Was hättest du der guten Frau auch sagen sollen? Vielleicht wäre es besser, du trügest das Kruzifix eine Weile nicht um den Hals. Wenigstens so lange nicht, bis wir wissen, warum es wieder mit dem Summen angefangen hat.»
«Ich möchte es ungern ablegen», widersprach Luzia. «Wo ich es nun schon so lange trage.»
Elisabeth nickte. «Wenn es aber weiterhin summt …»
«Ich weiß, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als es abzulegen.» Luzia senkte den Kopf.
Noch einmal drückte Elisabeth ihren Arm. «Bist du sicher, dass du in letzter Zeit keine ungewöhnlichen Träume hattest?»
Luzia hob den Kopf wieder. «Ganz sicher. Ich hätte Euch doch gleich davon erzählt. Es summt auch anders als früher, Herrin.»
«Wie anders?»
Luzia zuckte etwas ratlos mit den Achseln. «Anders eben. Nicht so zornig wie damals, als es uns vor der Pest warnen wollte. Es vibriert auch nicht richtig, sondern fühlt sich eher an, als habe es plötzlich eine Art Herzschlag.»
«Herzschlag? Ein Silberkreuz?»
Luzia zog das Kruzifix unter ihrem Kleid hervor. Sie hatte es vorsichtshalber daruntergeschoben, um den unheimlichen Summton zu dämpfen. «Hier, fühlt selbst. Es ist nicht heiß geworden wie damals, aber es pocht irgendwie.»
Elisabeth nahm das silberne Kreuz vorsichtig in die Hand. Nach einer Weile nickte sie. «Du hast recht, Luzia. Es fühlt sich an, als sei es lebendig.»
«Und das Summen klingt nicht wütend», hob Luzia hervor. «Eher aufgeregt oder ungeduldig, findet Ihr nicht?»
Nachdem das Geräusch nun deutlicher zu hören war, lauschte Elisabeth eine Weile und stimmte ihrer Freundin dann zu. «Was es uns wohl diesmal mitteilen will? Wenn es nicht zornig summt, will es uns womöglich dieses Mal etwas Gutes verkünden.» Sie ließ das Kreuz wieder los. «Ich werde eine Nachricht zur Küneburg schicken und Vater bitten, uns Bruder Georg zu schicken. Vielleicht weiß er einen Rat.»
2. Kapitel
Greif zu!», forderte Martin Wied seinen treuen Knecht Alban auf, der ihm gegenüber an einem der langen Tische des Gasthauses saß. Zwischen ihnen stand eine große Schüssel mit geschmortem Gemüse, daneben eine Platte mit knusprig gebratenem Geflügel. «Auch wenn wir erst in Lahnstein sind und der Regen uns frühzeitig zur Rast gezwungen hat, wollen wir doch heute schon unsere glückliche Heimkehr feiern, meinst du nicht?»
«Danke, Herr.» Alban strich sich über den fast kahlen Schädel. «Ganz schön heftig, der Regenguss», sagte er und griff nach einem Stück Fleisch. «Hätte nicht gedacht, dass es heute schon anfängt. Heute hätten wir gut noch das letzte Stück bis Koblenz schaffen können.» Genussvoll biss er in den saftigen Schenkel und kaute mit genießerisch verzogenen Lippen.
Martin sah ihm einen Moment lang lächelnd zu, bevor er sich selbst ebenfalls Fleisch und Gemüse auf seinen Teller häufte. Alban war seit vielen Jahren sein treuer Diener; mittlerweile mochte er auf die fünfzig zugehen. Die Jahre schienen ihm allmählich mehr zuzusetzen. Während der zweijährigen Reise nach Italien hatte ihn trotz des wärmeren Klimas so manches Zipperlein geplagt, nach und nach waren ihm dann auch noch fast alle Haare ausgegangen. Doch kräftig zupacken konnte der Knecht nach wie vor. Martin schätzte ihn sehr, deshalb hatte er ihn heute zu einem besonders guten Essen eingeladen.
«Du hast recht», antwortete Martin, nachdem er ebenfalls ein paar Bissen gegessen hatte. «Es wäre schön gewesen, heute schon nach Hause zu kommen, aber auf einen halben Tag mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an. Zum Jahrmarkt sind wir jedenfalls noch rechtzeitig zurück.»
Alban hob den Kopf und ließ die Hand mit dem Fleisch sinken. «Ich gehe gleich noch mal raus und sehe nach unseren Wagen, Herr. Will sichergehen, dass damit alles in Ordnung ist. Ihr habt so viele wertvolle Waren dabei – nicht dass jemand auf die Idee kommt, Euch zu bestehlen!» Schon wollte der Knecht aufspringen, doch Martin hob nur lachend die Hand und hielt ihn zurück.
«Keine Sorge! Setz dich ruhig wieder, Alban. Meine Wachleute sind schon fähig, unsere Wagen zu bewachen. Iss erst einmal.» Martin sah sich in der gutgefüllten Gaststube um. Kaufleute, Pilger und Einheimische bevölkerten die Tische. Ein buntes Gewirr von Stimmen und Gelächter erfüllte die Luft. Über allem hing der Geruch von nasser Wolle und Gebratenem. Sein Blick blieb an einer kleinen Gruppe Frauen hängen, die an einem der hinteren Tische beieinandersaßen. Die bunten Bänder an ihren Kleidern und die auffälligen gelben Kopftücher wiesen sie als Hübschlerinnen aus. Bei gutgefüllten Bierbechern schienen sie es sich wohlergehen zu lassen. Gleichzeitig ließen die Weiber – wie Martin nicht entging – ein ums andere Mal ihre prüfenden Blicke durch die große Gaststube schweifen: Ständig waren sie auf der Suche nach potenzieller Kundschaft.
Martin räusperte sich und wies mit dem Kinn in ihre Richtung. «Vielleicht hast du ja Lust auf ein wenig Gesellschaft heute Nacht, Alban. Zur Feier des Tages, sozusagen.»
«Äh, ja, Herr … vielleicht, Herr.» Albans Gesicht lief rot an. Er schien Martins Angebot nicht abgeneigt und äugte nun, noch immer eifrig kauend, in die Richtung, die Martin ihm wies.
Eine der Hübschlerinnen hatte die Blicke der beiden Männer bemerkt. Wie zufällig stand sie auf und schob sich durch die Tischreihen auf sie zu.
Mit hinter dem Kopf verschränkten Händen lag Martin auf der schmalen Pritsche in dem Zimmerchen, das er sich für die Nacht gemietet hatte. Die Herberge lag gleich neben dem Gasthof, und man konnte den Lärm aus der Gaststube deutlich hören. Kurz hatte er daran gedacht, sich ebenfalls eine der Hübschlerinnen mit ins Bett zu nehmen, doch bei näherer Betrachtung hatte keine von ihnen ihm besonders gefallen. Zwar schienen sie einigermaßen sauber zu sein, nach seinem Geschmack war jedoch keine gewesen. Eines der Weiber hatte eine derart unnatürliche Körperfülle gehabt, dass es aussah, als würde ihr Kleid jeden Moment auseinanderplatzen. Die anderen wirkten alle eher knochig und unterernährt. Doch selbst wenn er darüber hinweggesehen hätte – die erschrockenen Blicke der Hübschlerinnen waren ihm nachdrücklich aufgefallen, als sie seine Entstellung bemerkt hatten. Er kannte diese Reaktion, diesen Anflug von Abscheu in den Augen der Frauen, nur zu genüge. Wohin er auch kam, musste er sie ertragen. Er war im Alter von vierzehn Jahren bei einem Brand im Haus seines Vaters schwer verletzt worden. Die Verbrennungen an seinem Körper waren so schlimm gewesen, dass er wochenlang mit dem Tode gerungen hatte.
Zwar hatte das Leben schlussendlich gesiegt, die Narben jedoch würde er zeitlebens als sichtbaren Beweis seines Todeskampfes mit sich herumtragen.
Die Brandnarben überzogen fast seinen gesamten Rücken, seinen rechten Arm und – besonders schlimm – seine rechte Hand. Der Handrücken war von rotbraunem und weißlichem Narbengewebe überzogen, der kleine Finger verharrte vollkommen unbeweglich in einer leichten Krümmung, und der Ringfinger war in seiner Beweglichkeit ebenfalls stark beeinträchtigt.
Auch an der linken Hand hatte er einige kleinere Narben davongetragen, ebenso an der rechten Hüfte und an den Beinen. Von der rechten Schulter über den Hals bis in den Nacken zog sich weitere hässlich vernarbte Haut; lediglich sein Gesicht hatte das Feuer gänzlich verschont. Eine Laune des Allmächtigen möglicherweise, vielleicht aber auch eine große Gnade. Martin wusste, dass sein Gesicht im Allgemeinen als besonders ansehnlich bezeichnet wurde. Ihn selbst kümmerte dies wenig, wusste er doch, dass selbst die ansprechendste Physiognomie den meisten Frauen nicht ausreichte, wenn sie gewahr wurden, wie verunstaltet der Rest seines Körpers war. Die Käuflichen ließen sich zumeist nichts anmerken, wenn er sie gut genug bezahlte, doch war ihm keine der Frauen heute Abend angenehm genug gewesen, um eine derartige Geldausgabe zu rechtfertigen.
Also hatte er sich in sein Kämmerchen zurückgezogen und Alban mit den Weibern allein gelassen.
Nachdenklich betrachtete Martin den steifen kleinen Finger an seiner rechten Hand. Es hatte Jahre gedauert, bis er wieder gelernt hatte, mit dieser Hand einen Griffel oder eine Feder zu halten. Lange Zeit hatte er nur mit der linken Hand geschrieben, sein Fleisch geschnitten oder auch, wenn es nötig gewesen war, die Faust geschwungen. Noch heute war seine Linke weitaus effektiver und kraftvoller als seine Rechte.
Er gähnte. Zwar war es noch nicht spät, aber das beständige Trommeln des Regens vor dem Fenster wirkte einschläfernd. In der Gaststube begann jemand, auf einer Fidel zu spielen. Ziemlich schräger Gesang der bereits Betrunkenen setzte ein. Grinsend richtete Martin sich auf und streifte sein Wams ab, dann zog er sich das Hemd über den Kopf; die Hose behielt er an.
Die dünne Wolldecke, unter die er schlüpfte, roch ein wenig rauchig – weiß der Himmel, wo der Herbergswirt sie lagerte. Doch lieber Rauch als Schweiß, überlegte er und spielte gedankenverloren mit der silbernen Kette, die er um den Hals trug. Sie war mit roten und blauen Edelsteinen besetzt: ein Erbstück, das ihn stets daran erinnerte, dass er vor zwei Jahren einen Plan gefasst hatte, den er nicht hatte ausführen können.
«Frau Jutta weigert sich, die Mantenburg für den Winter zu verlassen», knurrte Johann und drückte Elisabeth den Brief in die Hand, den ein Bote soeben überbracht hatte. Er hatte das Schriftstück in seine kleine Schreibstube mitgenommen, und Elisabeth war ihm auf dem Fuße gefolgt, um die Neuigkeiten ebenfalls zu erfahren. «Sie will zum Jahrmarkt herkommen und danach umgehend wieder nach Hause zurückkehren.»
Elisabeth nickte, warf aber nur einen kurzen Blick auf den Brief. «Wird sie den kleinen Notker mitbringen? Und kommt Adele auch mit?»
Ungehalten starrte Johann seine Gemahlin an. «Hast du mir überhaupt zugehört? Ich sagte, Jutta will nicht für den Winter in unser Haus ziehen.»
Elisabeth lächelte. «Ich habe dir sehr wohl zugehört. Deshalb frage ich ja, ob wir Notker und Adele vor dem Winter noch einmal wiedersehen werden.» Bevor Johann etwas erwidern konnte, ergriff sie seine Hand. «Ich weiß ja, dass du dich um deine Stiefmutter sorgst. Aber es geht ihr doch gut, oder nicht? Seit dein Vater gestorben ist, kümmert sie sich hervorragend um die Ländereien. Damit nimmt sie dir eine Menge Arbeit ab. Es ist doch nur natürlich, dass sie auch im Winter auf der Mantenburg bleiben möchte, um nötigenfalls erreichbar zu sein. Sie kümmert sich eben gern selbst um alles.»
«Hier in Koblenz hätte sie es angenehmer», brummelte Johann. «Der letzte Winter war hart, und wenn es dieses Jahr wieder genauso viel Schnee gibt …»
«Dann ist sie auf der Mantenburg trotzdem bestens versorgt», unterbrach Elisabeth ihn. «Sie legt eben keinen so großen Wert auf die Annehmlichkeiten eines Stadthauses. Also was ist nun, bringt sie deine Geschwister mit, oder muss ich den ganzen Brief selbst lesen, um das herauszufinden?» Auffordernd legte Elisabeth den Kopf auf die Seite und veranlasste ihren Gemahl so zu einem ergebenen Seufzen.
«Sie bringt sie beide mit. Im Oktober wird Adele dann für einige Wochen nach Kempenich reisen und danach zusammen mit der Edeljungfer Gertrud zu deren Eltern gebracht werden.»
«Wie lange wird sie dort bleiben?»
Johann hob die Schultern. «Ein Jahr, vielleicht auch zwei. Sie soll sich dort möglichst heimisch fühlen, wenn Gertruds Bruder Harro von seinem Knappendienst beim Herzog von Jülich zurückkehrt. Das wird die angestrebte Eheschließung hoffentlich erleichtern und für beide Seiten angenehmer machen.»
Elisabeth nickte zustimmend. «Adele kennt Harro aber doch schon, nicht wahr? Sind sie einander nicht bereits vorgestellt worden?»
Nun lächelte Johann zum ersten Mal. «Sie haben als Kinder einmal einen Sommer zusammen auf der Mantenburg verbracht. Harro war damals gerade acht Jahre alt und sollte im darauffolgenden Herbst seinen Pagendienst bei den Jülichern antreten. Adele, die fünf Jahre alt war, hing ihm an den Fersen, wo er ging und stand. Er fand das furchtbar. Ein Junge will sich schließlich mit seinen Kameraden in Spiel und Kampf messen und nicht ständig ein kleines Mädchen mitschleppen, auch wenn es ihn anhimmelt.»
Elisabeth schmunzelte.
«Später haben sie sich hin und wieder bei Festlichkeiten getroffen und schienen recht gut miteinander auszukommen. Deshalb habe ich dem Vorschlag von Harros Vater, die beiden miteinander zu verheiraten, bedenkenlos zugestimmt. Adele scheint auch nicht abgeneigt zu sein, also …»
«Wird sich alles zum Guten wenden», vollendete Elisabeth den Satz.
«Ja. Wenn ich mir damit nicht ausgerechnet Einhard von Maifeld in die Verwandtschaft holen würde.» Johanns Miene verdüsterte sich schlagartig wieder.
«Rockzipfelverwandtschaft.» Elisabeth winkte ab. «Er ist zwar Harros Onkel, aber er lebt auf einer anderen Burg und hat, soweit ich weiß, nicht viel mit den anderen Maifeldern zu tun.»
«Dennoch. Er ist eine Schlange, mit deren Gift ich ungern noch einmal in Berührung kommen will.»
Verständnisvoll nickte Elisabeth und legte den Brief auf das Schreibpult. «Ich weiß, mir geht es ebenso.» Kurz flackerten vor ihrem inneren Auge Bilder eines längst vergangenen Osterfestes auf Burg Kempenich auf. Damals hatte Einhard von Maifeld mit Gewalt versucht, Elisabeth zu einem Eheversprechen zu zwingen. Unwillkürlich spürte sie eine Gänsehaut auf Rücken und Armen. Noch immer meinte sie, das Echo von zerreißendem Stoff zu hören und seine Hände zu spüren, die sich rücksichtslos nehmen wollten, wonach sie begehrten. Nur der Allmächtige allein wusste, was geschehen wäre, hätte nicht Johann in jenem Moment sie bemerkt. Er hatte Einhard von ihr fortgerissen und ihm eine Tracht Prügel verabreicht, bevor er ihn verjagt hatte.
Johann, der ihr leichtes Schaudern bemerkt hatte, zog sie rasch an sich. «Verzeih, Elisabeth, ich wollte dich nicht aufregen. Ich weiß, wie schlimm es für dich war …»
«Nein, schon gut, Johann.» Elisabeth lehnte sich an ihn und schlang die Arme um seinen Hals. «Das ist alles lange vorbei. Die Verbindung mit den Maifeldern wird gut für uns sein, das allein zählt. Mit Einhard brauchen wir uns doch nicht weiter abzugeben.»
«Aber zu allen Familienfeierlichkeiten müssen wir ihn dann einladen.»
«Und wenn schon.» Elisabeth blickte zu Johann auf und drückte sich noch ein wenig fester an ihn. «Solange du in meiner Nähe bist, kann mir doch nichts geschehen. Außerdem wacht Einhards Gemahlin Maria mit Argusaugen und eiserner Hand über ihn. Ich glaube nicht, dass er sich trauen würde, mir zu nahe zu treten.»
Johann schmunzelte. «Damit könntest du recht haben. Habe ich dir schon erzählt, was man über die beiden munkelt? Es heißt, Maria soll ihm schon mehr als einmal mit einer gusseisernen Bratpfanne aufgelauert haben, wenn er sich wieder einmal irgendwo herumgetrieben hat.»
«Im Dirnenhaus herumgetrieben, meinst du.» Elisabeth lachte leise. «Das ist mir in der Tat schon zu Ohren gekommen. Du solltest dich glücklich schätzen.»
«Warum?» Johanns Lippen näherten sich den ihren.
Elisabeth zwinkerte ihm zu. «Wenn er dir die Maria nicht vor der Nase weggeschnappt hätte, wärest du jetzt mit ihr verheiratet.»
«Niemals!», widersprach Johann entrüstet.
«Ach nein?» Wieder lachte Elisabeth leise. «Wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, warst du damals aber fest entschlossen, die Ehe mit ihr einzugehen.»
Schmerzlich verzog Johann das Gesicht. «Mag sein, ich hatte mich da in etwas verrannt. Aber du musst mir glauben, ich hätte sie nicht geheiratet. Das … hätte ich nicht über mich gebracht. Ich wusste einfach nicht … Ich konnte nicht …»
«Ich weiß, mein Lieber.» Elisabeth hob den Kopf ein wenig und gab ihm einen sanften Kuss, den er sofort erwiderte. Unvermittelt schienen kleine Flammen zwischen ihnen hochzuzüngeln; der Kuss wurde rasch leidenschaftlicher. Johanns Hände glitten verlangend über Elisabeths Körper.
Etwas atemlos löste sie sich von ihm und lächelte. «Na, na, ich glaube, das hier brechen wir lieber ab. Wie du weißt, erwarten wir heute Abend Gäste, also sollte ich mich allmählich um die Vorbereitungen für das Essen kümmern.»
Enttäuscht lockerte Johann ein wenig seinen Griff. «Ich dachte, dafür hätten wir die neue Köchin eingestellt.»
«Haben wir», bestätigte Elisabeth. «Aber du sagst es ganz richtig: Sie ist noch neu im Haus. Ich will sichergehen, dass sie alles richtig macht. Und eine gute Hausherrin kümmert sich, wie du weißt, gerne selbst um alles.» Sie gab Johann noch einen schnellen Kuss und verließ dann rasch die kleine Schreibstube, bevor sie es sich noch einmal anders überlegen konnte. Sie stieg die Stufen ins Erdgeschoss hinab und hörte die erregten Stimmen bereits, noch bevor sie die Küche betrat.
«So geht das nicht, Hilla. Du kannst nicht einfach die toten Hühner hier mitten auf dem Tisch ablegen. Und was ist mit dem Sack Hirse? Soll ein jeder, der in die Küche kommt, gleich darüberfallen? Bring ihn in die Speisekammer und dann nimm die Hühner wieder mit hinaus. Ich will sie erst wieder hier drinnen sehen, wenn sie ordentlich gerupft sind.»
«Was bildest du dir eigentlich ein, du hochmütige Schnepfe? Glaubst du, ich hätte meine Zeit gestohlen? Ich habe auch noch etwas anderes zu tun. Rupf dir doch deine Hühner selbst. Ich kann nicht … Oh, Herrin!» Hilla verstummte erschrocken, als Elisabeth mit strenger, fragender Miene in die Küche trat.
«Was geht hier vor?», wollte sie wissen. Sie wandte sich an die neue Köchin, eine kleine, rundliche Frau, deren weizenblondes Haar unter einem adretten Kopftuch steckte und deren Wangen vor Empörung leicht gerötet waren. «Nun, Josefa? Kannst du mir sagen, weshalb es an deinem ersten Arbeitstag in meinem Haus bereits solch heftigen Streit gibt?»
«Verzeiht, Herrin, wir wollten Euch nicht stören.» Josefas entschlossene Miene strafte ihre Worte Lügen. Es sah nicht so aus, als bedauere sie den Zusammenstoß mit Hilla. «Es ist nur so, dass ich meine Arbeit hier nicht ordentlich verrichten kann, wenn ein Trampel wie die da …», sie wies mit dem Kinn auf Hilla, «… nicht einsieht, dass in einer Küche Ordnung zu herrschen hat.»
«Trampel? Also das ist ja wohl …» Hilla schnappte empört nach Luft. «Muss ich mir das bieten lassen?»
«Schweig, Hilla!» Elisabeth warf ihr einen kurzen Blick zu. «Und du, Josefa, nimm bitte zur Kenntnis, dass ich solche Zankereien nicht dulde.» Prüfend blickte Elisabeth sich in der geräumigen Küche um. Über der großen Feuerstelle brodelte bereits etwas, das wie Eintopf roch. Die Regale waren aufgeräumt und ihr Inhalt offenbar neu angeordnet worden. Mitten auf dem großen Arbeitstisch lagen zwischen mehreren großen Tonkrügen vier frischgeschlachtete Hühner. Das Blut, das aus ihren Hälsen sickerte, hatte auf der polierten Tischplatte eine hässliche Pfütze gebildet. Mit der Fußspitze berührte Elisabeth den kleinen Sack Hirse, der mitten im Weg lag. Sie verschränkte die Arme vor der Brust. «Dies ist von nun an dein Reich, Josefa. Ich gebe dir recht, dass die Unordnung hier beseitigt werden muss.» Sie wandte sich wieder Hilla zu. «Trag die Hühner hinaus und rupfe sie ordentlich, dann wird Josefa sicherlich bereit sein, die Hirse in die Speisekammer zu tragen.»
Hilla zog den Kopf ein und griff nach den toten Vögeln. «Ja, Herrin, ich geh schon. Aber ich schaff die ganze Arbeit nicht allein. Das bisschen, was die Luzia macht, ist doch nicht der Rede wert. Eine zweite Magd muss her, Herrin.»
Elisabeth neigte den Kopf ein wenig. «Luzia hat andere Aufgaben in diesem Haushalt, Hilla. Das weißt du. Aber wenn es dich beruhigt, werde ich mit Herrn Johann darüber sprechen, wie wir dir am besten eine Hilfe zur Seite stellen können.»
Elisabeth wartete, bis Hilla die Küche verlassen hatte, dann besprach sie mit Josefa noch einmal die Speisenfolge für das geplante Abendessen, zu dem nicht nur der Ratsherr Hole geladen war, sondern auch dessen betagter Vater, Hermann Hole von Weis, der das Amt des Koblenzer Schultheißen bekleidete.
Luzia schloss die Tür ihrer Kammer und lehnte sich aufatmend dagegen. Das gemeinsame Abendessen mit den anderen Knechten und Mägden war laut und anstrengend gewesen. Während Wilbert und Godewin einander schlüpfrige Witze erzählt hatten, waren Hilla und die neue Köchin in einen Streit geraten, der offenbar schon am Nachmittag wegen nicht gerupfter Hühner und eines Hirsesacks seinen Anfang genommen hatte. Luzia hatte zu schlichten versucht, doch den beiden Frauen schien dies nur ein Grund zu sein, ihren Ärger gegen sie zu richten, deshalb hatte sie sich schließlich herausgehalten. Anton war wie so oft eher schweigsam gewesen und hatte vor sich hin geträumt.
Seufzend ließ sich Luzia auf die Kante ihres Bettes sinken und begann, die Verschnürung ihrer Schuhe zu lösen. Sie würde heute früh zu Bett gehen. Elisabeth benötigte ihre Gesellschaft nicht, war doch die Familie Hole zu Besuch sowie der Ratsherr von Ders mit seiner Gemahlin Carissima. Johann von Manten legte Wert darauf, mit den Ratsmitgliedern freundschaftliche Bande zu knüpfen, denn er wollte so bald wie möglich als Neubürger in Koblenz aufgenommen werden.
In dieser hochwohlgeborenen Runde hatte eine Leibmagd selbstverständlich nichts verloren. Luzia war nicht böse darüber. Sie hatte beim Auftragen der Speisen geholfen und sich dann in die Küche zurückgezogen. Die Ratsherren wirkten hochfahrend und einschüchternd. Der alte Mann jedoch, der Schultheiß, war Luzia ganz besonders unheimlich. Sein von Falten durchzogenes Gesicht wirkte ernst und ein wenig grimmig. Seine stechend grauen Augen hatten jede Person im Raum – Luzia eingeschlossen – scharf gemustert und, da war sie sich sicher, einer genauen Beurteilung unterzogen. Ihm schien nichts zu entgehen.
Furchteinflößend, das war er – musste er vermutlich sein, wenn man bedachte, welch hohes und wichtiges Amt er bekleidete. Selbst das Kruzifix war in seiner Gegenwart vollkommen verstummt.
Luzia zog den gepolsterten Hocker unter dem kleinen Tisch neben dem Bett hervor und setzte sich darauf. Die Kette mit dem Kruzifix zog sie über den Kopf und betrachtete das Schmuckstück dann eine Weile nachdenklich. Nach wie vor spürte sie ein leichtes Pulsieren. Was es wohl zu bedeuten hatte? Die einzige ihr bekannte Möglichkeit, das herauszufinden, bestand darin, das silberne Kreuz nachts unter ihr Kopfkissen zu legen und abzuwarten, ob sie einen seherischen Traum haben würde. Ein bisschen mulmig war ihr jedes Mal, wenn sie das tat, aber geschadet hatte es ihr bisher noch nie.
Plötzlich fasste sie den Entschluss, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Sie beugte sich vor, hob ihr Kissen an und verbarg das Schmuckstück sorgsam darunter. Anschließend griff sie nach der Verschnürung ihres Kleides und nestelte daran herum, hielt dann aber inne. Sie war zwar erschöpft, fühlte sich jedoch noch zu unruhig, um sich jetzt schon schlafen zu legen. Womit sollte sie sich ablenken? Sollte sie eine der Handarbeiten aus Elisabeths Kammer holen? Sie warf einen Blick aus dem Fenster. Es hatte fast den gesamten Tag über geregnet, noch immer war der Himmel wolkenverhangen. Viel Tageslicht fiel nicht mehr in ihre Kammer, der klägliche Rest würde in spätestens einer halben Stunde der nächtlichen Dunkelheit weichen. Keine guten Voraussetzungen für feine Näharbeiten oder Stickereien. Das Licht ihrer Öllampe war nicht hell genug. Sie stand auf und ging zu der Kleidertruhe am Fußende ihres Bettes. Zum Lesen würde das Licht ausreichen, überlegte sie. Schon lange hatte sie nicht mehr in ihre Schätze hineingeschaut. Sie klappte den Deckel der Truhe hoch, schob die ordentlich gefalteten Kleider beiseite und zog die beiden Bücher hervor, die sie einst auf dem Jahrmarkt in Ahrweiler gekauft hatte, obgleich sowohl Elisabeth als auch Bruder Georg ihr davon abgeraten hatten.
Das größere, in einfaches Leder gebundene Buch enthielt eine in die deutsche Sprache übersetzte Zusammenfassung verschiedener Schriften über Mathematik, wie die Arithmetik nach Boëthius, ein Werk Euklids über die Geometrie und Auszüge aus den Werken Bradwardines und Ockhams.
Das dünnere Büchlein hieß Liber Abbaci und befasste sich ebenfalls mit der Kunst des Rechnens. Inzwischen besaß Luzia sogar einen Abakus, ein Rechenbrett, wie es in dem gelehrten Büchlein beschrieben stand. Bruder Georg hatte ihr den Abakus von einem Händler in Trier mitgebracht; seitdem hütete sie ihn wie einen Schatz zusammen mit den Büchern.
Luzia nahm Bücher und Rechenbrett mit zu ihrem Tisch und setzte sich wieder. Sie hatte schon seit Monaten weder gelesen noch versucht, die teilweise komplizierten Rechenoperationen mit Hilfe der Rechensteine des Abakus nachzuvollziehen. Bruder Georg war sehr erstaunt gewesen, als er bemerkt hatte, dass Luzia die gelehrten Schriften mit Freude las und noch dazu verstand. Sie wäre eine Laune der Natur, hatte er behauptet und dabei den Kopf geschüttelt. Dennoch hatte er ihr das Rechenbrett mitgebracht, denn, so hatte er gesagt, Gelehrsamkeit sei stets zu begrüßen, auch wenn sie in Luzias Fall offensichtlich verschwendet sei. Wozu brauchte eine Leibmagd, noch dazu eine so niedrig geborene wie sie, Wissen über Mathematik? Den meisten Menschen reichte es, wenn sie die Finger an ihren Händen zu zählen wussten und darüber hinaus den Wert der Münzen kannten, die sie in ihrer Börse mit sich trugen.
Lächelnd strich Luzia über den Buchdeckel des Liber Abbaci, zog dann jedoch die mit Klammern zusammengehaltene Kladde zu sich heran, die stets auf ihrem Tisch lag. Darin hielt sie gewissenhaft all ihre Einnahmen fest, also den Lohn, den Elisabeth ihr zahlte, sowie die Pachteinnahmen aus Blasweiler. Auch ihre Ausgaben schrieb sie in einer gesonderten Spalte nieder, wie sie es einst in einem Rechnungsbuch des Weinhändlers Martin Wied gesehen hatte. Vermutlich würde er sich darüber lustig machen, denn wie wichtig waren schon die Aufzeichnungen über Haarbänder und -spangen, Stoff für Unterhemden oder süße Krapfen vom Marktbäcker?
Luzia war jedoch stolz darauf, dass sie stets genau wusste, wie viele Silber- und Kupfermünzen sich in der kleinen Geldkassette in ihrer Truhe befanden. Über die Jahre hatte sie eine stattliche Summe angespart. Genug, um … ja, um was? Sie stützte den Kopf in ihre Hände und betrachtete nachdenklich die Zahlen vor sich. Was sollte sie mit all dem Geld jemals anfangen? In Elisabeths Haushalt fehlte es ihr an nichts, auch Anton war wohlversorgt. Zwar hatte sie regelmäßige Ausgaben für neue Kleider – ihr Bruder wuchs in letzter Zeit allzu rasch aus seinen Sachen heraus –, dennoch blieb ein ordentlicher Betrag übrig.
Vielleicht, so überlegte sie, sollte sie beim Stadtrat eine verzinsliche Rente hinterlegen, auf die sie später einmal zurückgreifen konnte, falls es die Umstände erforderten. Sie hatte Elisabeth und Johann über solche Renten sprechen hören, wusste jedoch nicht, ob es auch Frauen gestattet war, so etwas zu tun.
Eine andere Möglichkeit wäre, mit dem Geld eine Lehrstelle für Anton zu bezahlen. Sie wusste nicht genau, wie viel die Lehre bei einem angesehenen Handwerker kostete, wollte aber, dass ihr Bruder etwas aus sich machte. Sie ahnte schon länger, dass er kein Verlangen mehr verspürte, den elterlichen Hof irgendwann zu übernehmen. Die Arbeit als Knecht gefiel ihm besser. Aber sollte er sein Leben lang ein Dienstbote bleiben? Vielleicht wäre es gut, einmal mit ihm darüber zu sprechen und auch zu versuchen herauszufinden, welche Möglichkeiten es für einen Jungen wie ihn gab.
Seufzend schob sie die Kladde von sich und zog stattdessen das dünnere der beiden Bücher zu sich heran. Im Grunde wusste sie, dass Anton für einen Lehrjungen schon einige Jahre zu alt war, doch etwas musste sie für ihn tun. Sie wollte dafür sorgen, dass er einmal auf eigenen Füßen stehen würde, vielleicht bei einem angesehenen Handwerker als Geselle arbeiten und leben konnte. Der Hof in Blasweiler war zwar sein Erbe und eine Rückversicherung, aber weder sie noch er wollte dorthin zurückkehren. Wenn sie ehrlich zu sich war, musste sie zugeben, dass es die Erinnerungen waren, die sie und auch Anton zurückhielten. Zu viel Leid war geschehen. Aus der Ferne war es leichter, nur die schönen Erinnerungen am Leben zu erhalten.
Luzia klappte den Buchdeckel auf und begann zu lesen. Sie kannte die Worte sehr genau, hatte sie in diesem Buch doch schon unzählige Male geblättert und die gelehrten Ausführungen studiert. Ihren Reiz verloren sie deshalb nicht. Schon bald zog sie den Abakus näher und begann, ein paar der beschriebenen Rechenoperationen durchzuführen. Dann dachte sie sich selbst Rechenaufgaben mit neuen Zahlen aus und versuchte sich an der Lösung. Sie war so vertieft in ihre Studien, dass sie zunächst gar nicht merkte, dass die Flamme ihrer Öllampe kleiner wurde. Erst als es leise zischte und die Flamme zu flackern begann, hob sie den Kopf. Das Öl war fast aufgebraucht. Wenn sie nicht gleich im Dunkeln sitzen wollte, musste sie hinab in die Vorratskammer steigen und die Lampe auffüllen.
Rasch nahm sie das Lämpchen und verließ damit die Kammer. Schon auf der Treppe hörte sie die Stimmen aus der Stube und verhaltenes Gelächter. Elisabeth und Johann schienen einen angenehmen Abend mit ihren Gästen zu verbringen. Ohne weiter darüber nachzudenken, ging sie die letzten Stufen so vorsichtig hinab, dass das Holz nicht zu laut knarrte, und trat dann an die geschlossene Tür heran. Sie wusste, dass es sich nicht schickte zu lauschen, doch ihre Neugier war größer.
«… immer sehr guten Wein geliefert», hörte sie einen der