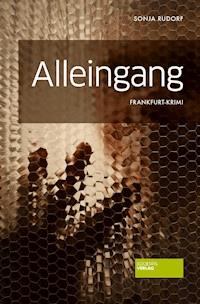4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Eva Stetter erfährt kurz nach der Beerdigung ihrer Mutter ein lang gehütetes Geheimnis: Ihr vor fast dreißig Jahren verstorbener Vater hatte in Prag zur Zeit des Kalten Krieges heimlich eine zweite Familie gegründet. Im Nachlass der Mutter findet Eva Hinweise darauf, dass diese mit Ludmila, der Geliebten ihres Mannes, Kontakt aufgenommen hatte. Eva wird schlagartig die Bedeutung der Blumensamen bewusst, die sie in einem Röhrchen zwischen dem geerbten Familienschmuck gefunden hat. Ein furchtbarer Verdacht keimt in ihr auf. Ohne ihren Mann Ben einzuweihen, dessen auffälliges Verhalten seit einiger Zeit ihren Argwohn erregt, fliegt sie nach Prag, um Ludmila aufzuspüren. Was sie von dieser erfährt, stellt ihr bisheriges Leben völlig in Frage. Nach ihrer Rückkehr ist Eva nicht mehr in der Lage, Realität von Fiktion zu unterscheiden. Als Ben durch einen verhängnisvollen Fehler ihr Misstrauen schürt, scheint die Tragödie unaufhaltsam ihren Lauf zu nehmen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Ähnliche
Sonja Rudorf
Die Gift- sammlerin
Roman
LangenMüller
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.langen-müller-verlag.de
© für das eBook: 2016 LangenMüller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
© für die Originalausgabe: 2005 nymphenburger in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten.
Schutzumschlag: Wolfgang Heinzel
Schutzumschlagmotiv: photonica, Hamburg
eBook-Produktion: F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
ISBN 978-3-7844-8313-9
Lügen. Als ob dieser Begriff für Aufklärung sorgen könnte. Niemand wird im Ernst behaupten wollen, mit der Wahrheit ließe sich ohne kleinere Korrekturen auch nur die kürzeste Zeit unmissverstanden leben.
I
Eva senkte den Blick. Ihre durchweichten Mokassins hatten sich dunkel verfärbt, die nasse Flanellhose schmiegte sich an ihre Oberschenkel. Nur Jacke und Hut trotzten der herabstürzenden Sintflut, die die Trauergemeinde in ein Heer schwarzer Regenschirme verwandelte. Auf dem Weg zum Grab hatte Ben immer wieder versucht, sie behutsam unter seinen Schirm zu ziehen, doch Eva war ihm ausgewichen. Schutzlos, verletzbar, so fühlte es sich eben an, wenn man von der eigenen Mutter Abschied nahm. Für einen Moment verfluchte sie die Menschen um sich. Abschied war still. Hatte nichts mit den sorgsam ausgefeilten Formulierungen zu tun, die man der Mutter ins Grab mitgab. Sie schnappte das Wort »Frieden« auf, suchte den Blick des Geistlichen und runzelte die Stirn. Ein letztes Mal erhob er seine Stimme gegen den prasselnden Regen, dann schloss er seine Predigt mit einem Gebet und nickte Eva zu. Der Weg bis zum Grab erschien ihr endlos. Eine Blume nehmen, sie auf den Sarg fallen lassen, einen letzten Gruß hinterherschicken. Besser noch hinauf, zu dem undurchdringlichen Wolkenband, hinter dem ihre Mutter möglicherweise saß und diesen kräftigen Guss eigenhändig auf die ungeliebte Verwandtschaft niedergehen ließ. Noch vor kurzem hatte ihr die Mutter am Krankenbett zugeflüstert, sie hoffe, vom Anblick scheinheiliger Erbschleicher verschont zu bleiben. Ein Lachen stieg Evas Kehle hinauf, blieb stecken und setzte sich dort als Klumpen fest.
Sie zwang sich, den Blick vom Sarg zu lösen und zur Seite zu treten. Langsam zogen die Trauernden an ihr vorüber. Ein Händedruck, eine Beileidsbezeugung und der Nächste stand vor ihr. Nur Elsie Gruber, die älteste Freundin der Mutter, sah Eva unter ihrem Regenschirm durchbohrend an, während sie kondolierte. Wenig später zog der Tross der Hinterbliebenen Richtung Friedhofsausgang. Eva blieb allein zurück. Der intensive Geruch nach Blumen, Erde und Vergänglichkeit stieg ihr in die Nase. Sie betrachtete die geöffnete Grabstelle, das schmale Holzkreuz, dahinter die Friedhofsmauer, die Backsteine, aus denen loser Mörtel brach, Ginsterbüsche zu beiden Seiten, schließlich die mächtige, herbstlich verfärbte Eiche, die ihre schützenden Arme über den Ort hielt, den man der Mutter für ihren langen Schlaf zugeteilt hatte. Ein guter Platz, dachte Eva, ruhig und abgelegen, ein Platz wie geschaffen für die nahtlose Fortführung des Rückzuges, den ihre Mutter bereits zu Lebzeiten angetreten hatte. Lange stand Eva am Grab und verlor sich in Gedanken an die Frau, die sie geboren hatte. Die Zeit schien still zu stehen. Erinnerungen zogen vor ihrem inneren Auge vorüber. Erst als ein Kälteschauer sie durchschüttelte, folgte sie den anderen ins Café.
Das Waldcafé war eine Wirtsstube mit speckigen Holztischen. Geblümte Sitzpolster und Stofflampen, die an einem verregneten Tag wie diesem ihren gelben Schein aufs Holz legten, trugen die Spuren jahrelangen Zigarettenrauches. Hier und dort saßen Gäste vereinzelt bei Kaffee, Himbeertorte oder Schnaps und lasen Zeitung. Im hinteren Teil schloss sich ein Raum an den Tresen an, der durch eine Schiebetür abgetrennt war. Nur schemenhaft ließ sich die Trauergemeinde jenseits der milchigen Scheibe erkennen. Lachen tönte heraus.
Als Eva die Tür aufzog, erstickte es. Für einen Moment verstummten die Gespräche an dem lang gezogenen Tisch. Eva suchte die schmale Gestalt ihres Mannes und entdeckte sie zwischen zwei ihrer Kusinen. Die zänkische Beate und Isabelle, ihr dickes Ebenbild, dachte sie, während sie Bens hilflosen Blick mit einem Schulterzucken beantwortete. Natürlich hatte es kein Entrinnen vor diesen beiden gegeben, niemand wusste das besser als Eva. Isabelle vereinnahmte jeden Menschen sofort mit ihrem Redestrom und Beate positionierte sich stets in ihrer unmittelbaren Nähe, um korrigierende Kommentare einzuwerfen. Die beiden waren ein eingespieltes Team. Ihre Mutter, Tante Hilde, hatte wohlweislich am anderen Ende der Tafel Platz genommen.
»Eva, setz dich zu mir.« Die heisere Stimme Elsie Grubers holte sie aus ihren Gedanken. Stühle wurden gerückt, jemand räusperte sich. Als sie saß, spürte Eva eine Hand auf ihrem Unterarm und wechselte zum zweiten Mal an diesem Tag einen intensiven Blick mit der Frau, die einmal die beste Freundin ihrer Mutter gewesen war.
»Ursel geht es jetzt gut.« Beim Lächeln legte sich Frau Grubers Gesicht in Falten, selbst den Wangen war ein feines Muster eingeritzt. Das kurz geschnittene, glatte Haar, ihr Hals und die beringten Finger, die an den Gelenken verdickt waren, zeugten von ihrem Alter – sie musste um die siebzig sein –, aber aus ihren Augen sprach dieselbe Lebendigkeit wie eh und je.
»Wenigstens muss sie diese Verwandtschaft nicht länger ertragen«, flüsterte Eva, »ihre Katzen haben wahrscheinlich einen höheren I.Q.«
Sie lehnte sich zurück und registrierte, dass die ältere Dame es ihr gleichtat, wobei sie ihren Stuhl ein Stück näher an den ihren rückte. Eine merkwürdige Spannung ging von ihr aus. So etwas wie eine stete Aufforderung, Kontakt zu halten. Eva suchte nach Worten. Ihr Kopf schien wie leer gefegt. Unmerklich versank sie in jene Lethargie, die sie seit dem Tod der Mutter immer wieder befiel. Nur mit halbem Ohr erfasste sie Fetzen des Tischgespräches, das um den Gnadenhof kreiste, jenes Waisenhaus für alte, verstoßene und kranke Tiere, das ihre Mutter vor Jahren gegründet hatte. Tatjana, eine der Mitarbeiterinnen, suchte Blickkontakt zu ihr, doch Eva tat so, als bemerke sie es nicht. Niemand würde heute geschäftliche Dinge mit ihr regeln können, niemand auch nur die kleinste, verbindliche Aussage zu irgendetwas erhalten, das mit dem Nachlass zu tun hatte. Sie schloss die Augen und versuchte die ölige Stimme ihres Onkels auszublenden. Keine fünf Sekunden später spürte sie, wie jemand an ihrem Ärmel zupfte.
»Hat Ursel mit dir gesprochen?«, raunte Frau Gruber.
»Über was?«
Erstaunen glomm in den Augen der alten Dame auf, dann schob sich ein undurchdringlicher Schleier davor.
»Über den Hof. Wie es weitergehen soll.«
Eva schüttelte den Kopf. Eine innere Stimme riet ihr nachzuhaken, aber sie war zu erschöpft. Jemand stellte eine Tasse Kaffee vor sie. Sie trank das heiße, bittere Getränk, das ihren Gaumen betäubte, in kleinen Schlucken. Wie aus weiter Ferne hörte sie die Trauergäste miteinander reden, ein Stimmenteppich, der an der Peripherie ihres Bewusstseins blieb. Ihre Augen streiften ziellos über die muntere Gesellschaft, bis sie Bens tröstenden Blick auffingen. Er würde nach einer angemessenen Zeit die Verwandten verabschieden, die Rechnung begleichen und sie nach Hause bringen. Auf Ben war Verlass.
Auf Ben war immer Verlass gewesen. Seit Eva ihn vor sechs Jahren kennen gelernt hatte, verging keine Woche, in der er sie nicht vor einer kleinen Katastrophe bewahrte. Ihre erste Begegnung hatte bereits den Weg vorgezeichnet. Es war bei einer Vernissage gewesen, die sie, damals im letzten Semester ihres Kunststudiums, mit Kommilitonen besucht hatte. Am Ausstellungstisch lehnend, hatte sie der Laudatio des Galeristen gelauscht, als ihr plötzlich auffiel, dass ihr Rotweinglas auf einem der Tuscheexponate stand. Im gleichen Augenblick hatte der Mann zu ihrer Linken ohne viel Aufhebens das Glas vom Kunstwerk gehoben, den kreisrunden Abdruck mit dem Handballen fortgewischt und es ihr mit einem Lächeln gereicht. Nach der Rede hatte er sich vorgestellt. Ben. Drei solide Buchstaben, die für Klarheit und Ruhe standen. Vermutlich hatte sie sich wegen seines Namens in ein Gespräch verwickeln lassen, das in verschiedenen Bars bis in die Morgenstunden seinen Fortgang fand. Wegen des Namens und der langen, geschwungenen Wimpern, die seinen Augen einen sanften Ausdruck verliehen. Ben war einen Kopf kleiner als sie. Sein Kleiderschrank bestand aus Jeans, dunklen Hemden und sandfarbenen Rollkragenpullovern, die Bartstoppeln auf seinen Wangen besaßen exakt die in aktuellen Modejournalen empfohlene Rasur.
Eva hatte sich sofort in ihn verliebt. Sie mochte seine leise Art zu reden und das Leuchten in seinen Augen, wenn er von einem Bauprojekt erzählte. Während sie mit Mitte dreißig noch immer an ihrem Lebenskonzept bastelte, saß er in seinem kleinen Architekturbüro und entwarf ein Gebäude nach dem anderen. Er war der erste Mann, der sich ohne Murren unter dem diffusen Licht ihrer antiken Badlampe rasierte. Der einzige, der sie nicht überreden wollte, das Rauchen aufzugeben. Und als er sie an ihrem vierzigsten Geburtstag damit überraschte, dass er die Gartenlaube seines kleinen Grundstückes in ein Atelier für sie umgebaut hatte, beschloss sie, ihn zu heiraten.
Mit den Jahren war die Verliebtheit einem steten Wohlgefühl gewichen. Natürlich gab es Gemütsverfassungen, die Ben nicht verstand. Die er nicht einmal wahrnahm. Aber nach Evas Ansicht entsprach niemand den Idealvorstellungen, die der Geist unaufhörlich produzierte. Sie war sich sicher, auch ihre Eltern hatten sich unter einem Kind namens Eva kein Mädchen vorgestellt, das im Alter von sieben Jahren einen Terpentinkanister im Garten der Nachbarin hochgehen ließ. Umso befremdeter registrierte Eva den Argwohn, den ihre Mutter Ben gegenüber hegte. Noch zwei Tage vor ihrem Tod hatte sie sich mit einem misstrauischen Unterton in der Stimme erkundigt, warum er an so vielen Wochenenden arbeiten müsse. Auf Evas Antwort, dass seine Projekte für ihn intensiver seien als jede Geliebte, hatte sie nur nachdenklich den Kopf gewiegt. Aber diese Geste war typisch für ihre Mutter. Seit sie ihr Leben den Tieren gewidmet hatte, waren Menschen für sie suspekte, unberechenbare Wesen geworden.
Drei Tage nach der Beerdigung fuhr Eva zu ihrem Elternhaus. Das Wohnviertel am Rande der Stadt hatte sich seit ihrer Kindheit merklich verändert. Wo früher Gärten bis zum Waldrand geführt hatten, streckten heute breite, stromlinienförmige Gehwege ihre Finger nach ihm aus. Wohlstand präsentierte sich in rundum verglasten Eigentumswohnungen, in mehrstöckigen Gebäudeblöcken, die keine zehn Meter Rasen zwischen sich aufwiesen. Vor jedem Wohnblock waren Wippe, Rutsche und Sandkasten aufgereiht. Autos parkten dicht am Gehsteigrand. Zum Leidwesen der Zugezogenen legten Bauarbeiter bereits die nächste Großbaustelle an. Nur in den schmalen Seitengassen entlang dem Hügel strahlten die Häuser jenen diskreten Reichtum aus, der Evas Weltbild geprägt hatte.
Das kleine Anwesen ihrer Mutter hob sich deutlich von den gepflegten Nachbargrundstücken ab. Es war ein kleines, zweistöckiges Familienhaus mit verwildertem Vorgärtchen. Früher wuchsen dort Heckenrosen, Sonnenblumen und Hortensien, Efeu wucherte über die Häuserfassade. Nun kletterten einzelne, verloren wirkende Ranken die Frontseite hinauf. An manchen Stellen bröckelte der Putz. Nicht nur daran hatte die Nachbarschaft jahrelang Anstoß genommen, an dem Zerfall von Wert, der ihr unmoralisch erschien. Es war vielmehr die unorthodoxe Lebensweise der allein lebenden älteren Frau gewesen, die sich mit der der anderen nicht vertrug. Und natürlich das stete Gebell und Maunzen, das ihr Grundstück umgab.
Einen Moment lang erschien es Eva, als ob einzig der Eigensinn der Mutter das Haus zusammengehalten hätte und sich mit ihrem Tod zugleich ihr Refugium aufzulösen begänne. Sie zögerte, die Haustür zu öffnen, und betrachtete das Emailleschild neben der Klingel. ›Hier wohnen Kurt, Ursel und Eva Stetter‹ war mit Schnörkelbuchstaben hineingelötet. Es war jahrzehntealt, schließlich lebte der Vater seit beinah dreißig Jahren nicht mehr. Und Eva war im Alter von achtzehn Jahren ausgezogen. Merkwürdig, dass ihre Namen noch immer eine Familie bildeten.
Als Eva Stimmen vom Nachbargrundstück vernahm, gab sie sich einen Ruck und betrat das Haus. Ein Geruch nach Katzenfutter, kaltem Rauch und Reinigungsmitteln schlug ihr ins Gesicht. Normalerweise wären ihr gleich in der Diele diverse Vierbeiner entgegengesprungen. Ihre Mutter hatte die ärmsten Geschöpfe vom Gnadenhof mit nach Hause genommen, sodass das einstige Wohnhaus sich nach und nach in eine Tierpension verwandelt hatte. Jetzt herrschte Stille. Kein Tapsen unsicherer Schritte von der Wendeltreppe, kein Miauen, kein Tschilpen kranker Vögel. Bei dem Gedanken an die große, füllige Gestalt ihrer Mutter, die für gewöhnlich im Türrahmen des Wohnzimmers erschien, sobald Eva das Haus betrat, begann ihr Herz schneller zu schlagen. In der Klinik hatte die Mutter wie ein Fremdkörper gewirkt. Täglich war sie zwischen den weißen Kissen ein wenig mehr geschrumpft, um am Ende eine stark abgemagerte Hülle zurückzulassen. Hier in diesen Räumen lebte sie noch.
Eva atmete tief durch. Die Wohnzimmertür am Ende der Diele war nur angelehnt. Vorsichtig schob sie sie auf. Ihr Blick glitt über die Einrichtung. Rechts befand sich die Essecke mit vier Stühlen, einer davon mit Kissen überhäuft, daneben die Stehlampe, die Glasvitrine, der alte Sekretär ihres Vaters, dunkles Kirschbaum, sein Arbeitsstuhl, darüber die Wolljacke der Mutter. Auf der anderen Seite des Zimmers stand das geräumige Sofa, auf dem sie jeden Abend gesessen hatte, die Hände ins Fell der neben ihr liegenden Hunde versenkt. Der Glastisch war mit Zeitschriften und Papieren übersät, an seinem Rand stand eine Teetasse und Gebäck. Zögernd trat Eva in das Zimmer ein. Erst jetzt bemerkte sie, wie kühl es im Haus war. Sie drehte die Heizung am Fenster auf und blickte in den schmucklosen Garten, der von der Straße nicht einsehbar war.
Es war alles so schnell gegangen an jenem Tag. Das Martinshorn, die eilenden Sanitäter, ein Weißkittel, der knappe Anweisungen erteilte, bellende Hunde, dazwischen die Trage, ein hilfloser Blick der Mutter. Ihre heiße, schweißige Hand. Eva sank auf die Couch. Die Stille drückte sie mit aller Gewalt nieder. Sie hatte gewusst, dass all das zurückkommen und ein Turm von Erinnerungen sich vor ihr aufbauen würde. Dazu die Sehnsucht der letzten Wochen: Noch einmal dem Menschen, der ihr das Leben geschenkt hatte, nahe kommen. Die Liebe, den Dank in Worte fassen. Es war Eva nicht gelungen, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
Genauso wenig Erleichterung schien ihrer Mutter beschieden zu sein. Am Tag vor ihrem Tode hatte Eva das Gefühl, als wollte sie ihr etwas mitteilen. In die Augen der Kranken war jenes nervöse Flackern getreten, das Eva von früheren Unterredungen her kannte. Doch dann hatte eine Welle der Müdigkeit diesen Funken zum Erlöschen gebracht. Die Mutter war vor Erschöpfung eingeschlafen, das Gespräch damit auf den nächsten Besuch vertagt worden. Als in der Nacht darauf das Telefon klingelte, war es zu spät für klärende Worte. Eva wusste sofort, was geschehen war. Der Tod der Mutter verhinderte jedes weitere Nachdenken über das geplante Gespräch. Eva wurde in einen Strudel von Aktivitäten gezogen. Sie organisierte die Beerdigung, erledigte Formalitäten. Was blieb, war der Wunsch, das Andenken der Mutter in Würde zu bewahren. Aber wie? Sie musste ja die privaten Sachen durchsehen, um den Haushalt aufzulösen. War nicht schon allein dies eine Verletzung der Würde? Als sie ein Kribbeln auf ihrer Kopfhaut fühlte, zwang sie sich aufzustehen und die schmale Wendeltreppe hinaufzugehen.
Im oberen Stock empfing sie düsteres Licht. Eine Akazie verschattete das Flurfenster. Draußen flatterten gelbe Blätter unter einer Sturmböe auf, ein Zweig schlug gegen die Scheibe, dann beruhigte sich der Herbstwind wieder und Eva nahm das Geräusch ihres eigenen Atems wahr. Der Boden ihres ehemaligen Kinderzimmers, seit Jahren ein Abstellraum für Wäsche und Gerümpel, war mit Zeitschriften und Büchern übersät. In Stapeln aufgeschichtet, zeugten sie von der Lesewut der Mutter und ihrem sukzessiven Rückzug in ihre eigene Welt. Sie hatte beinahe alle sozialen Kontakte gelöst. Geschichten aus zweiter Hand hatten ihr den Bezug zur Wirklichkeit erhalten. Die letzten Jahre war ihr Einsiedlerleben nur durch die Korrespondenz mit den Angestellten des Gnadenhofs und Evas gelegentliche Besuche unterbrochen worden.
Eva schloss die Tür des Zimmers, ohne etwas berührt zu haben. Im Bad herrschte Chaos. Das Medizinschränkchen stand offen. Im Waschbecken lagen Fläschchen, Tablettenbriefe und geöffnete Schachteln. Bis zuletzt hatte ihr die Mutter die Metastasen in der Lunge verschwiegen. Eva setzte sich auf den Wannenrand, zog das Handtuch vom Halter und drückte ihre Nase hinein. Es roch vertraut. Nach dem Weichspüler, den die Mutter benutzt hatte. Ein Leben lang die gleiche Marke. Eva fasste ihr kastanienbraunes Haar im Nacken zusammen und betrachtete ihr bleiches Gesicht im Spiegel über dem Waschbecken. Sie hatte keine Lampe angeknipst. Das spärliche Tageslicht legte ihr Schatten unter die Augen. Sie musste weg hier, bevor der Himmel sich und das Haus vollends verdunkelte.
Am Absatz der Wendeltreppe fiel ihr der Schmuck ein. Ihr gesamter Familienschmuck sei im Bettkasten, hatte die Mutter ihr vor ein paar Tagen gestanden und den Finger auf die Lippen gelegt, als Eva über diesen Leichtsinn schimpfen wollte. Eilig rannte Eva ins Schlafzimmer. Sie musste nicht lange suchen. Die schwarze Lederkassette steckte, in zwei Laken eingewickelt, im hinteren Teil der Bettlade. Eva wollte sie gerade öffnen, als das Telefon in der Diele läutete. Eine unheimliche Stille folgte. Dann wieder das Signal, schrill, durchdringend. Mit einem Knacken sprang der Anrufbeantworter an. Bevor Eva die Wendeltreppe hinuntereilen und dem Spuk ein Ende bereiten konnte, tönte die tiefe, etwas nasale Stimme ihrer toten Mutter durch den Flur.
Hals über Kopf rannte Eva aus dem Haus. Sie durchquerte den Vorgarten und schlug das Gartentor hinter sich zu. Erst im Wagen gewann sie ihre Fassung wieder. Sie starrte auf den Stoffpapagei, den Ben als Maskottchen aufs Armaturenbrett geklebt hatte und fragte sich, was er zu ihrer kindischen Flucht sagen würde. Ben kannte sie schrill und launisch, herzlich, kompliziert, chaotisch und liebenswert. Ängstlich hatte er sie jedoch noch nie erlebt. Angst war etwas, das sie bisher in der hintersten Kammer ihres Herzens verschlossen hatte.
Sie fand ihn im Arbeitszimmer, das er sich im ersten Stock ihres Hauses eingerichtet hatte. Als er vom Laptop aufsah, wirkte er wie aus einer anderen Welt.
»Wo warst du denn? Ich habe bei dir angerufen.«
»Wo hast du angerufen?«
»Bei deiner Mutter. Also in ihrem Haus, meine ich.«
Ben sprang auf und nahm sie in die Arme.
»Tut mir Leid«, fügte er hinzu.
»Schon gut. Hast du noch Arbeit?«
»Kann warten.«
Sie spürte, wie ein Ruck durch seinen Körper ging und sich die Hände von ihrer Taille lösten.
»Gehen wir runter«, sagte er, während er an den Schreibtisch trat und den Laptop zusammenklappte, bis nur noch ein bläulicher Lichtspalt zu sehen war, »dann kannst du mir beim Essen in Ruhe erzählen, wie es war.«
Eva folgte ihm die asymmetrische Marmortreppe hinunter, auf die er beim Bau des Hauses besonders stolz gewesen war. In der Küche, die durch einen offenen Rundbogen direkt in das Wohnzimmer überging, knipste sie die Deckenlampe an. Sie schnitt Brot in Scheiben, bereitete einen Schnittlauchquark zu, legte Käse und Gurken auf ein Holzbrett und entkorkte eine Flasche Rotwein. Während des Essens erzählte sie von ihren Eindrücken und der überstürzten Flucht aus ihrem Elternhaus. Ben hörte schweigend zu. In regelmäßigen Abständen nickte er oder lächelte aufmunternd und nach einer Weile spürte sie, wie sich seine Ruhe auf sie übertrug. Erst bei der Schilderung ihrer von Ängsten begleiteten Heimfahrt beschlich sie das Gefühl, ins Leere zu reden.
»Ben?«
»Ja?« Ein verlegener Blick traf sie. »Entschuldige. Ich bin einfach überarbeitet.«
»Du solltest mal ein paar Tage zu Hause bleiben. Oder gibt das Ärger mit HM?«
Eva verkniff sich den nächsten Satz. Schon der vorhergehende hatte ein wenig zu bissig geklungen. Wann hatte sie Herta Miro, die junge Architektin, die Ben vor zwei Jahren eingestellt hatte, das letzte Mal nur mit ihren Initialen genannt?
»Im Ernst. Ich frage mich, warum du gerade abends und am Wochenende so viel arbeitest.«
Sie stockte über ihre eigenen Worte, die denen ihrer Mutter in Wortlaut und Tonfall glichen, als hätte sie mit der abgestandenen Luft ihres Elternhauses auch das Misstrauen der alten Frau eingeatmet. Ben sah sie verwundert an. Seine kräftigen Augenbrauen, die dem fein geschnittenen Gesicht Ausdruck verliehen, hatten sich unmerklich nach oben gezogen. Stumm betrachtete Eva das vertraute Antlitz, die zierliche Nase mit der kaum noch erkennbaren, zum Mund verlaufenden Scharte, Relikt einer Prügelei, wie er sie zu Schulzeiten, als der Spott über mangelnde Körpergröße noch durch Faustschläge auszugleichen war, zu Dutzenden geführt hatte. Unter ihren liebevollen Blicken entspannten sich seine Gesichtszüge.
»Du hast Recht, ich mache Schluss für heute.«
»Musst du nicht«, hörte sie sich zu ihrer eigenen Überraschung erwidern und murmelte, sie wolle ein Bad nehmen. Schneller als ihr Verstand schien ihr Unterbewusstsein begriffen zu haben, dass sie alleine sein wollte.
Einige Minuten später lag sie bis zu den Schultern im heißen Wasser, atmete den Melissenduft des Ölbades ein und versuchte, an nichts zu denken. Dann fiel ihr der Schmuckkoffer ein, den sie bei ihrer kopflosen Flucht aus dem Elternhaus schnell noch unter den Arm geklemmt und zu Hause achtlos auf die Flurkommode gestellt hatte. Sie schlüpfte aus der Wanne, huschte, nackt wie sie war, die Treppe hinunter, schnappte sich das schwarze Kästchen und stellte es auf den Wannenrand, bevor sie ins warme Wasser zurücksank. Vorsichtig lösten ihre Finger den Druckknopf der Lederschnalle und hoben den Deckel an. In den Falten des Samtkissens lagen goldene Halsketten, Armbänder, Ohrringe, eine zweireihige, blütenweiße Perlenkette und Glasbroschen jeglicher Art. Eva zog einen Turmalinring heraus und streifte ihn zögernd über ihren Finger. An diesen Ring konnte sie sich erinnern. Er stammte, wie die meisten Schmuckstücke, aus der Zeit, in der ihr Vater es mit seinen Glasgeschäften zu einigem Wohlstand gebracht hatte. Sie betrachtete den Ring eine Weile, bevor sie ihn zurücklegte. Erst auf den zweiten Blick entdeckte sie, dass sich die Einlage mit dem roten Samtfutteral herausnehmen ließ. Was darunter zum Vorschein kam, erinnerte an ein Plastikröhrchen, wie man es für Stuhlproben benutzte. Neugierig hielt sie es gegen das Licht der Deckenlampe. Erkennen ließ sich nichts. Sie schraubte den Verschluss ab, leerte den Inhalt vorsichtig in ihre Handmulde, roch an den Körnern, die herausgerieselt waren, nahm zwei und rieb sie zwischen Daumen und Zeigefinger. Aus dem Flur drangen Geräusche, dann wurde die Klinke gedrückt und Bens Gesicht erschien im Türspalt.
»Komm rein und sieh dir das an«, flüsterte Eva, »jede Menge teurer Schmuck.« Sie hielt ihm die geöffnete Hand entgegen, an deren feuchter Innenfläche die Samen klebten. »Und das hier.«
»Pflanzensamen!«, rief Ben erstaunt.
»Woher weißt du das?«
»Na hör mal, wer kümmert sich denn um den Garten?«
Er betrachtete das milchige Röhrchen, das sie ihm reichte. »Die müssen schon eine Ewigkeit alt sein. Ich glaube nicht, dass die noch angehen. Sie sind bestimmt ein Andenken an deinen Vater. Oder hatte deine Mutter nach ihm noch einen Freund?«
Seine Hand tauchte in den Schmuckkasten und beförderte eine Kette mit goldenem Anhänger zutage. »Sie war doch noch gar nicht alt, als dein Vater starb. So alt etwa wie du jetzt, oder?« Ein spitzbübisches Lächeln huschte über sein Gesicht. »So jung, meine ich. Schließ mal die Augen.« Gleich darauf spürte Eva, wie zwei warme Hände ihr die Kette anlegten. Während die stumme Rechnung in ihrem Kopf ergab, dass ihre Mutter damals tatsächlich genau in ihrem Alter gewesen war, hatte Ben sich seiner Kleidung entledigt und war zu ihr in die Wanne gestiegen.
II
Adonis aestivalis. Eva lehnte an der Küchenspüle und betrachtete das Tütchen Blumensamen, das sie vor wenigen Minuten im Pflanzencenter erstanden hatte. Ein wenig enttäuscht war sie den Ausführungen des Fachverkäufers über die Gruppe der Hahnenfußgewächse gefolgt. Das geheimnisvolle Erbe, jene Körner, die Ben als Pflanzensamen identifiziert hatte, entpuppte sich als ein harmloses Ziergewächs, eine Sommerblume mit zinnoberrotem Kelch und schwarzviolettem Staubbeutel, soweit sich das auf der Abbildung erkennen ließ. Das Tütchen Samen zu neunzig Cent. Was hatte sie erwartet? Eine eigene Züchtung der Mutter, den Hinweis auf ein geheimes Versteck, das sich unter dieser Pflanze im Erdreich finden würde? Sie konnte sich nicht erinnern, jemals im Garten ihrer Mutter ein solches Gewächs gesehen zu haben. Ohnehin gedieh dort seit Jahren nichts außer Unkraut und wilden Hecken.
»Sag mal, Dr. Alfons, frisst du eigentlich Blumensamen?« Sie schob eine Ecke der Verpackung in den Vogelkäfig, der auf dem Fensterbrett der Küche stand und zog sie, als der Beo mit dem Schnabel danach hackte, eilig zurück. Es war seine freche Art, den Kopf schief zu legen und die wildesten Sachen von sich zu geben, die sie dazu bewogen hatte, ein Tier aus dem Gnadenhof der Mutter aufzunehmen. Der Vogel hatte im Laufe seines zwölfjährigen Lebens mehrmals den Besitzer gewechselt und war so zu einem reichhaltigen, pikanten Repertoire gekommen. Sie steckte ihren Finger durch die Stäbe und streichelte sein Gefieder. Als sie eine halbe Stunde später in einem alten Wollpullover und Jeans ihr Atelier betrat, saß Dr. Alfons, mit einer Schnur am Bein befestigt, auf ihrer Schulter. Er liebte es, ihr beim Arbeiten zuzusehen. Wenn er nicht gerade durch die Gartenlaube flatterte, beobachtete er vom höchsten Zweig einer Birkenfeige aus ihr Tun. Hin und wieder hustete er mit einer fremden Stimme, um Aufmerksamkeit zu erregen, oder er stieß ein albernes Glucksen aus, das er, Eva war sich sicher, von ihrem überspannten Galeristen übernommen hatte.
Heute saß er still auf ihrer Schulter. Draußen tanzten die Bäume. Die alte Walnuss, auf die Eva von ihrem Arbeitsplatz aus sah, hatte bisher kaum Blätter verloren. Flink huschten Eichhörnchen über ihre Äste, knabberten eine Frucht vom Stängel und verschwanden im Blätterdickicht. Dahinter leuchtete die gelb gefärbte Krone einer Birke, als säße die Sonne darin. Eva sah von ihrem Stuhl aus in den Garten, die Hände vor ihren Knien verschränkt. Wie jeden Tag spürte sie dem Pulsschlag der Natur draußen nach, bevor sie sich auf die Atmosphäre in ihrem Atelier konzentrierte. Trotz der herbstlichen Unruhe war es still. Blechschere und Winkelschleifer lagen auf dem Tisch, ein großer Werkzeugkasten stand neben alten, angerosteten Blechtonnen in der Ecke. Reststücke aus Aluminium und Stahlblech lagerten in Plastikkörben und Glasbehältern, aufgereiht wie in einer alten Apotheke. Sie musste in der Stimmung aufgehen, mit den Eindrücken verschmelzen, erst dann kamen Bilder. Einfälle.
Die Idee zu ihrem neuen Projekt verdankte sie dem Tod der Mutter. Eva betrachtete die an der Wand lehnenden Metallplatten, deren quadratische Flächen mit Farbe besprüht waren. In loser Anordnung hatte sie Dutzende von Blechteilen darauf geklebt. Mit jeder Platte würde sich ihre Anzahl ausdünnen, wie die Verästelungen im Gehirn älterer Menschen, wie Haar, Knochendichte, wie das Leben selbst, das sich mit dem Fortschreiten der Jahre zurückzog, das in eine bedenkliche Schieflage geriet, wenn man nicht immer wieder den Reichtum an Erfahrung und Ruhe dagegensetzte, den das Altern ebenfalls mit sich bringen konnte. Das letzte Quadrat der Serie würde eine leere, weiß besprühte Fläche darstellen. Aber bis dahin war es noch ein weiter Weg. Den ganzen Vormittag arbeitete Eva konzentriert. Es gab keine Zeit, keine Welt außerhalb der ihren, nur die aus leeren Getränkedosen geschnittenen Teile, die sie mit einer Zange in Form drehte.
Das Pochen an der Tür drang erst nach einer Weile in ihr Bewusstsein. Eva öffnete. Vor ihr stand Annedore, eine Basttasche um die Schulter. Wie immer trug sie knallenge Jeans und einen Pullover in der Farbe ihrer Haare, ein dunkles Kastanienbraun, über dem Pulli eine hellbraune, ärmellose Daunenweste. Die Locken, die ihr bis zu den Schultern reichten, kringelten sich in der feuchten Herbstluft noch stärker als sonst, was ihr ein engelhaftes Aussehen verlieh. Sie drückte Eva kurz an sich und trat in die Laube.
»Was wird denn das?«, fragte sie und ließ ihre Blicke zwischen dem Berg zerschnittener Dosen und den Blechteilchen auf der Metallplatte hin- und herwandern.
Eva sah sie herausfordernd an. »Der Titel ist ›Sterben‹.«
»Aha.« Annedore lachte auf, dann schien sie sich der Bedeutung von Evas Worten bewusst zu werden. Betreten blickte sie zu Boden.
»Hast du ein paar Minuten? Ich würde die Platte gerne zu Ende bringen.«
Annedore nickte. Während Eva erneut die Heißklebepistole ansetzte, zog sie ein Modejournal aus ihrer Basttasche und blätterte darin.
Es dauerte eine halbe Stunde, bis Eva das Blech fertig gestellt hatte. Als die beiden Frauen das Atelier verließen, sahen sie Ben über die Wiese laufen. Der Wind hatte sein Gesicht belebt. Seine Augen glänzten, der rote Schal um den Rollkragen seines Pullovers gab ihm das Aussehen eines Studenten.
»Ich dachte, ihr zwei seid auf dem Büchermarkt«, rief er ihnen entgegen.
»Sind schon auf dem Weg«, erwiderte Annedore.
Ben trat auf sie zu und umfasste zur Begrüßung kurz ihre Schultern.
»Wie geht’s Carsten?«
»Gut.«
Endlich wandte er sich zu Eva und gab ihr einen Kuss.
»Alles klar?«, fragte er fröhlich.
Eva nickte langsam, während sie in dem Gesicht ihres Mannes nach einer Erklärung suchte. Etwas an seinem Verhalten war anders. Etwas, das sich auch in der schwungvollen Bewegung widerspiegelte, mit der er den Schal über seine Schulter warf. Die Lebhaftigkeit, die sich sonst nur in seinen Augen zeigte, schien sich auf seinen Körper übertragen zu haben. Beschwingt streckte er die Hand nach Dr. Alfons aus. Doch der Beo blieb reglos auf Evas Schulter sitzen. Ja, er fixierte Ben in derselben Art, wie Annedore es tat. Mehrere Sekunden verharrte Bens Arm unnütz in der Luft – Eva hatte die Vision eines Standbildes –, dann ließ er ihn sinken und steckte die Hände in die Hosentaschen.
»Ich muss noch in die Stadt, Zeichenpapier besorgen. Soll ich euch mitnehmen?«
»Nicht nötig«, hörte sich Eva antworten und bemerkte im gleichen Moment, wie albern ihre Sachlichkeit war. Bevor sie Ben fragen konnte, was ihn mitten am Tag nach Hause führte, spürte sie einen flüchtigen Kuss und sah ihn federnd in Richtung Garage laufen. Annedore löste sich als Erste aus der Starre.
»Was ist los mit ihm? Er war scheißfreundlich zu mir.«
»Ist das schlimm?«
»Ach komm, Eva. Ich weiß, dass ich ihm auf die Nerven falle.«
Eva zuckte mit den Schultern. »Das bildest du dir ein.«
Sie fuhren in die Altstadt, auf deren Marktplatz Buden aufgebaut waren. Einmal im Jahr sortierten die städtischen Büchereien ihre Bestände aus. Im Laufe der Zeit hatten sich private Buchhändler und Antiquare dazugesellt und so war ein Markt für Liebhaber entstanden, auf dem es inzwischen auch kulinarische Spezialitäten gab. Als die beiden den Büchermarkt erreichten, empfing sie der Duft nach frisch gebackenen Waffeln und Glühwein, erste Vorboten der kalten Jahreszeit.
Annedore stöberte nach alten Lehrbüchern und guten, nicht zu abgegriffenen Romanen, während Eva ihr gedankenversunken folgte. Hier und da zog sie ein Kunstbuch aus dem Stoß vergilbter Exemplare, um es, kaum dass sie den Geruch des Papiers eingeatmet hatte, wieder an seinen Platz zu legen. Verwelktes Herbstlaub raschelte unter ihren Füßen, ein loser Blätterteppich, dazwischen sah nass glänzendes Kopfsteinpflaster hervor. Eva überredete ihre Freundin zu einem Becher Glühwein, dann zu einem zweiten. Sie genoss die Atmosphäre jener Stunde, in der sich der Tag zurückzog und die Menschheit im Schwebezustand zurückließ, in einem irritierenden, undefinierbaren Nichtsein, bis mit einem Mal, von einer Sekunde zur nächsten, der Abend hereinbrach. Es war die Stimmung, in der sie sich hoffnungslos allein und der ganzen Welt zugleich verbunden fühlte. Auch Annedore wirkte in sich gekehrt. Stumm beobachteten sie Passanten, bis ihre Gläser leer waren. Dann trennten sie sich.
Eva hatte Bens seltsames Verhalten einige Stunden zuvor bereits vergessen, als sie gegen Abend nach Hause kam. Das Erste, was ihr auffiel, war ein riesiger Strauß Sonnenblumen im Flur. Im Wohnzimmer brannten Kerzen auf dem Tisch und gleich darauf trat Ben mit zwei Gläsern Champagner aus dem Türbogen. Es war ihr Hochzeitstag, erklärte er ihr in seiner ruhigen, unprätentiösen Art, als sie noch immer nicht begriff. Noch Tage danach wusste sie, worauf sich sein spitzbübisches Lächeln in den Mundwinkeln bezog, wenn er sie beim Fernsehen von der Seite betrachtete. Er hatte ihr Misstrauen registriert. Und Eifersucht war etwas, das er seiner Frau nur selten entlocken konnte.
Zwei Wochen später begann Eva, den Haushalt ihrer Mutter aufzulösen. Sie hatte sich vorgestellt, dass der Abschied mit jedem entsorgten Gegenstand ein wenig realer werden würde. Doch ihre Trauer folgte eigenen Gesetzen. Je länger sie in dem Nachlass stöberte, desto mehr Rätsel gab ihr das Wesen der Mutter auf. Sie zog altmodische Kleidungsstücke aus den Schränken, Stoffservietten und Tischtücher, die sie noch aus ihrer Kindheit kannte. Alte Spiele, Bücher, Zeitschriften, Videokassetten, Geschirr und eine Sammlung getragener Handtaschen lagen nach der ersten Sichtung auf verschiedenen Stapeln in den Ecken der zahlreichen Zimmer. Die meisten Räume glichen einem Museum, das ein Leben dokumentierte, mit dem ihre Mutter bereits vor langer Zeit abgeschlossen hatte. Was fehlte, waren persönliche Dinge, Briefe, Fotos, Zettel, ein Adressbuch und dergleichen. Ihre Mutter schien das Haus in Vergangenheit und Gegenwart aufgeteilt zu haben. Die linke Seite des Stockwerks wirkte unbenutzt. Durch die Räume, die rechts der Wendeltreppe abzweigten, Bad und Schlafzimmer, war Leben geflossen. Das ebenerdige Wohnzimmer fand sie so vor, wie es ihre Mutter vor Wochen für immer verlassen hatte. Eva hatte es bisher nicht übers Herz gebracht, etwas zu verändern. Sie betrachtete den Berg prall gefüllter Plastiksäcke, der ein Drittel der Diele einnahm und am Nachmittag von einem Wohltätigkeitsverein abgeholt werden würde, während sie die Nummer Elsie Grubers wählte. Es kam Eva wie eine Ewigkeit vor, bis sich die heisere Stimme am anderen Ende der Leitung meldete.