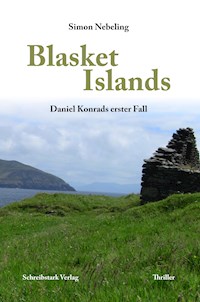8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schreibstark-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Müde und erschöpft kommen Daniel Konrad und seine Freundin erst in den frühen Morgenstunden nach Hause. Marie wähnt ihre Tochter schlafend im Bett, doch das Zimmer ist leer und ihr Bettzeug unberührt. Ein Brief auf dem Kissen offenbart die schreckliche Wahrheit. Sarah ist fort. Jemand hat sie entführt und wird auch nicht davor zurückschrecken, ihr etwas anzutun. Als Daniel die sorgfältig geschriebenen Zeilen liest, kommen ihm sofort verchiedene Namen und Personen in den Sinn, die dafür verantwortlich sein könnten. Darunter auch solche, die er eigentlich für tot hält. Ein Wettlauf auf Leben und Tod beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Epilog
Danksagungen und Anmerkungen
Über den Autor
Die gottlose Insel
Simon Nebeling
Die gottlose Insel
Daniel Konrads dritter Fall
Thriller
Schreibstark Verlag
Simon Nebeling, »Die gottlose Insel«
© 2024 der vorliegenden Ausgabe
Schreibstark Verlag
Saalburgstr. 30, 61267 Neu-Anspach
© 2024 Simon Nebeling
Alle Rechte vorbehalten.
Satz, Umschlagsfoto und -gestaltung: Simon Nebeling
Druck und Einband: Schreibstark Verlag
Für Andrea, Miriam und Manuel.
Prolog
Die grell leuchtende Lampe, die der Entführer neben der Tür abgelegt hatte, warf bedrohliche Schatten an die Wände der Holzhütte. Das Mädchen kniff die Augen zusammen, die sich während ihrer Gefangenschaft an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Regungslos ertrug sie, wie der Mann ihr die Arme auf den Rücken drehte. Er schlang ein Seil um ihre Handgelenke und verknotete es so fest, dass sie vor Schmerzen aufstöhnte.
»Mach den Mund auf«, befahl er.
Sie gehorchte. Es brachte nur weiteres Leid, sich gegen ihn aufzulehnen, das hatte sie gelernt. Langsam öffnete sie ihre Lippen und warf dabei einen ängstlichen Blick über die Schulter. Der Mann zog einen Lappen aus seiner Hosentasche und stopfte ihn ihr in den Mund, bis sie würgen musste. Dann knebelte er sie mit einem zweiten Stofffetzen. Sie rang nach Luft, bis sie sich daran gewöhnt hatte, durch die Nase zu atmen. Einen Moment lang stand sie dort und wartete darauf, was als Nächstes passieren würde. Plötzlich stieß er sie brutal vorwärts, in Richtung der geöffneten Tür.
Als sie hinaustrat, wehte ihr ein eisiger Wind entgegen. Bloß mit dem T-Shirt und einer dünnen Leggins bekleidet, streifte die Kälte ihre nackten Arme. Das Mädchen zögerte weiterzugehen, spürte dann aber die Schusswaffe an ihrem Hinterkopf. Erbarmungslos schob er sie voran. Das grelle Licht folgte ihr, erzeugte noch mehr unheimliche Schatten, die um sie herumtanzten. So geführt, stolperte sie aus der Blockhütte heraus in den Wald. Die Dämmerung war schon weit fortgeschritten und die Luft war unangenehm feucht und kalt. Unnachgiebig trieb der Mann sein Opfer auf das Dickicht zu. Steine und heruntergefallene Äste bohrten sich in ihre Füße, dennoch schob er sie weiter voran, bis sie schließlich eine Lichtung erreichten. Sofort erkannte das Mädchen, was hier geschehen sollte. Sie wich vor dem ausgehobenen Erdloch zurück. Doch es gab kein Entkommen.
»Hinknien!«, befahl er.
Das Kind stand wie gelähmt da und starrte auf die schmutzige Schaufel, die in dem gewaltigen Erdhaufen steckte.
»Na los, mach schon.«
Sie unternahm einen verzweifelten Versuch, trotz des Knebels zu sprechen.
»Bitte nicht!«, bettelte sie, doch der Stoff erstickte ihre Worte.
Tränen liefen über ihre Wangen und Urin an ihren Beinen herunter.
»Sofort!«, brüllte er.
Der Körper des Mädchens bebte, als sie endlich die Knie beugte und sich wimmernd vor ihr Grab hockte. Seine Hände zitterten, während er die Mündung seiner Waffe erneut an ihren Hinterkopf setzte. Die Zeit schien stillzustehen und die Welt um sie herum auf dieses kalte, trostlose Loch im Boden zu schrumpfen. Sie wagte nicht zu atmen, starrte bloß wie gebannt in die Dunkelheit und wartete auf das Unvermeidliche. Ein ohrenbetäubender Knall zerfetzte die Stille. Der Körper des Kindes wurde nach vorne gerissen und fiel reglos in das ausgehobene Loch.
Kapitel 1
Samstag, 4. Dezember, 02:24 Uhr
Daniel
Am Ende meiner Kräfte schleppte ich mich durch die Eingangshalle des Krankenhauses. Ich hatte den Arm um Maries Schulter gelegt, die mir auf diese Weise halt gab. Kurz zuvor war die Wunde an meinem Kopf rasiert, genäht und neu verbunden worden. Die Schnittverletzung am Fuß hatte zum Glück nicht weiter behandelt werden müssen. Trotzdem schmerzte sie bei jedem Schritt. Zuletzt hatte ich eine Tetanus-Auffrischung erhalten und war von einem jungen Arzt auf Anzeichen einer Gehirnerschütterung untersucht worden. Er hatte zwar keine gefunden, hätte mich aber dennoch gern zur Beobachtung über Nacht stationär aufgenommen. Ich hatte dankend abgelehnt und nach einer kurzen Diskussion ein Papier unterschreiben müssen, dass ich mich entgegen dem ärztlichen Rat selbst entlassen wollte. Vermutlich sicherte sich das Krankenhaus auf diese Weise gegen nachträgliche Schadensersatzforderungen ab. Diese Information hatte ich Marie aber lieber verschwiegen, denn ich hatte keine Lust auf einen Vortrag über meine Dickköpfigkeit.
Wenige Schritte vor der Drehtür ins Freie kam uns eine junge Frau entgegen. Ihre Kleidung verriet, dass es sich um eine Krankenschwester handelte. Sie musterte uns kurz und warf mir dann ein mildes, verständnisvolles Lächeln zu. Es war jener Gesichtsausdruck, mit dem ich auf ältere Menschen an der Kasse des Supermarkts reagiere, wenn es ihretwegen ein bisschen länger dauert. Ihr mitleidiger Blick traf mich wie ein Schlag ins Gesicht. Ich kam mir vor wie ein gebrechlicher Greis und dieses Gefühl war unerträglich. Trotzig schaute ich sie an und zwang mich dazu, aufrechter und sicherer zu laufen. Dabei ignorierte ich die Schmerzen und das Schwindelgefühl, so gut es eben ging. Erst in letzter Sekunde bemerkte ich den Flügel der Drehtür und konnte gerade noch verhindern, von diesem am Kopf getroffen zu werden. In Schwarzweiß gefilmt und mit Klaviermusik unterlegt, wäre diese Szene bestimmt ein großer Lacher gewesen. Ich warf einen verlegenen Blick über meine Schulter, ob die Krankenschwester diesen Beinah-Zusammenstoß gesehen hatte. Erst danach bemerkte ich das breite Grinsen im Gesicht meiner Freundin.
»Was?«, stieß ich genervt aus.
»Es tut mir leid«, antwortete sie amüsiert. »Ich fürchte, die süße Schwester hat deinen heldenhaften Kampf gegen die Windmühle verpasst.«
Ich spürte, wie mir das Blut ins Gesicht schoss. Gerne hätte ich etwas Schlagfertiges erwidert, doch leider fiel mir nichts Passendes ein.
»K-können wir dann jetzt weitergehen?«, stammelte ich stattdessen sinnlos.
»Gott mag es so fügen«, antwortete Marie.
Obwohl ich das Buch niemals gelesen hatte, war ich mir sicher, dass dies ein Zitat aus Don Quijote war. Sie genoss diesen Moment der Überlegenheit sichtlich.
Ich beschloss, meinen Ärger herunterzuschlucken. Marie hatte in dieser Nacht viel für mich getan und ich hatte kein Recht, ärgerlich zu sein. Sie war mir nicht von der Seite gewichen, seit wir uns nach dem Vorfall auf der Eisenbahnbrücke wiedergetroffen hatten. Dafür war ich ihr unendlich dankbar, denn es handelte sich keineswegs um eine Selbstverständlichkeit. Mir war die ganze Zeit über bewusst, dass sie als Mutter eines 13-jährigen Kindes eigentlich woanders sein sollte. Einmal hatte ich sogar den Versuch unternommen, sie zur Heimfahrt zu bewegen. Direkt bei unserer Ankunft am Krankenhaus hatte ich ihr angeboten, mir für die Rückfahrt ein Taxi zu nehmen, damit sie vorausfahren und nach ihrer Tochter schauen konnte.
»Red keinen Unsinn!«, hatte Marie nur geantwortet. »Sarah schläft sicher schon seit Stunden. Außerdem ist sie schon groß, sie hätte längst angerufen, wenn irgendwas vorgefallen wäre.«
Wir verließen das Krankenhaus und liefen den langen, von Büschen gesäumten Weg zum Parkplatz entlang. Ein eisiger Wind wehte und jeder Schritt durch die Kälte war mir einer zu viel. Endlich erreichten wir die erste Reihe parkender Autos. Ich versuchte, mich zu erinnern, wo wir den Wagen abgestellt hatten. Bevor es mir einfiel, ertönte bereits der durchdringende Signalton der Zentralverriegelung und grell aufleuchtende Scheinwerfer beantworteten die Frage. Marie hob meinen Arm von ihrer Schulter. Sie schien zu prüfen, ob ich ohne sie stehen konnte. Ihre Fürsorge bohrte in der Wunde, die die Krankenschwester kurz zuvor aufgerissen hatte.
»Ab hier schaffe ich es allein, Sancho«, sagte ich und konnte mir ein gehässiges Grinsen nicht verkneifen. Maries Blick machte deutlich, dass ihr der Vergleich mit Don Quijotes kleinem, übergewichtigen Knappen nicht passte. Insgeheim ärgerte ich mich, dass mir diese Erwiderung nicht schon früher eingefallen war.
Meine Freundin öffnete die Wagentür und ich ließ mich auf den Beifahrersitz plumpsen. Dann unternahm ich einen ungelenken Versuch, die Seitentür zu schließen. Marie war bereits um das Auto herumgelaufen und eingestiegen, als es mir endlich gelang. Sofort kondensierte unsere Atemluft an der kalten Frontscheibe. Daher beugte ich mich nach vorn und schaltete die Lüftung des Autos ein. Mein Kopf beantwortete diese schnelle Bewegung mit heftigem Schwindel. Es dauerte einen Moment, bis ich den Gurt greifen und ihn anlegen konnte.
Marie drehte den Zündschlüssel und der Motor sprang an. Sie setzte den Wagen rückwärts aus der Parklücke. Die Beschilderung führte uns zur Ausfahrt des Parkplatzes. Dort bogen wir auf die Straße. Ich schaute aus dem Fenster. Die Straßenlaternen sorgten mit ihrem orangegelben Schein für einen beständigen Wechsel von Licht und Schatten. In Verbindung mit dem monotonen Rauschen der Lüftungsanlage wirkte das geradezu betäubend. Meine Augenlider schienen schwer wie Blei zu werden. Keinesfalls wollte ich im Auto einschlafen, also richtete ich mich etwas auf. Nach wenigen Minuten erreichten wir die große Kreuzung und bogen in die Frankfurter Straße ein. Unwillkürlich drehte ich dabei den Kopf, um in Fahrtrichtung zu schauen. Mich durchzog ein dumpfer Schmerz, die Wirkung der Betäubungsspritze ließ offenbar bereits nach. Vorsichtig betastete ich den Verband. Die Stelle tat zwar nicht weh, doch da, wo mich der Mistkerl erwischt hatte, verspürte ich wieder ein leichtes Druckgefühl. Ich ahnte, dass sich dieser Druck innerhalb der nächsten Stunden in einen pochenden Schmerz verwandeln würde. Meine Freundin schien diese Bewegung mitbekommen zu haben.
»Wie geht’s dir?«, fragte sie besorgt.
»Ich werde schon wieder. Ich will bloß ins Bett und schlafen«, brummte ich und überprüfte dabei, ob sich die Schmerztabletten noch in meiner Hosentasche befanden. Es wurde höchste Zeit, endlich nach Hause zu kommen.
Endlich nach Hause kommen. Es schien mir, als wäre diese Sehnsucht mein ständiger Begleiter geblieben, seit ich vor Wochen zu einer unheilvollen Reise nach Irland aufgebrochen war. Unsagbare Schrecken hatte ich dort durchlebt. Marc, ein Freund aus Kindertagen, war in den Fluten des Atlantiks ertrunken und seine Freundin Alexandra hatte ebenfalls einen grausamen Tod sterben müssen. Doch waren die beiden nicht die einzigen, die ich auf Great Blasket Island zurückgelassen hatte. Diese Reise hatte mein ganzes Leben ins Chaos gestürzt und obwohl ich inzwischen seit sechs Wochen wieder in Deutschland war, konnte ich nicht behaupten, bereits im Hier und Jetzt angekommen zu sein. Stattdessen hatte ich versucht, mich in die Arbeit zu stürzen. Die Beratung von Schülerinnen und Schülern mit auffälligem Verhalten hatte mich in der Vergangenheit stets ausgefüllt, doch auch dadurch war ich dem Gefühlschaos nicht entkommen. Im Gegenteil. Mit einer Einbruchserie in der Stadt und dem spurlosen Verschwinden eines Mädchens hatten weitere Ereignisse ihren Lauf genommen, die schließlich zur Ermordung eines ehemaligen Schülers geführt und mein Leben noch mehr durcheinandergebracht hatten. Erst vor wenigen Stunden hatte ich eine Verbindung zwischen diesen Geschehnissen und der Reise zu den Blasket Islands entdeckt. Alles hing letztlich zusammen, als hätte ich diese verfluchte Insel nie wirklich verlassen.
»Es ist schon verrückt, oder?«, sagte ich nachdenklich.
»Was denn?«, fragte meine Freundin. Ich realisierte erst durch ihre Rückfrage, dass ich den letzten Gedanken laut ausgesprochen hatte.
»Die ganze Sache«, antwortete ich nun zögernd, denn ich brauchte einen Moment, um meine Überlegungen zu sortieren. Es war nicht leicht, all diese Zusammenhänge auf einen Punkt zu bringen.
»Wenn Alexandra nicht auf Great Blasket Island gestorben wäre«, erklärte ich nun, »hätte sie die Kette einfach wieder zurückgegeben und all das wäre nie passiert.«
Aus dem Augenwinkel nahm ich wahr, wie meine Freundin nickte.
»Diese Insel hat noch mehr Menschen den Tod gebracht«, antwortete sie. So merkwürdig ihr Satz auch klang, ich kam zu demselben Schluss.
Samstag, 4. Dezember, 02:37 Uhr
Ricky
Vollkommen erschöpft lag Ricky in seinem Bett. Er hatte die Arme hinter dem Kopf verschränkt und starrte auf den seltsamen Schatten neben der ausgeschalteten Deckenlampe. Es waren die Äste des Baums vor dem Fenster, die jene sonderbaren Muster an die Zimmerdecke zeichneten. Als Kind hatte er sich davor gefürchtet. Damals hatten sie für ihn wie Arme des Monsters ausgesehen, das immer wieder in seinen Träumen aufgetaucht war.
Er war hundemüde. Ab und an fielen ihm sogar die Augen zu, doch sofort hielten ihn böse Geister der vergangenen Stunden vom Einschlafen ab. Erneut übermannte ihn der Sekundenschlaf. Prompt durchzuckten wieder blitzlichtartige Erinnerungen seinen Kopf. Die Scheinwerfer des heranrasenden Autos, die Waffe in seiner Hand, der zerplatzende Schädel. Ricky schreckte hoch, das Herz hämmerte in seiner Brust.
»Fuck, ey«, seufzte er, nachdem er hochgeschreckt war und begriffen hatte, dass keine akute Gefahr bestand. Nicht mehr.
»Du bist hier vollkommen sicher«, bestätigte er sich wieder und wieder. Dann ließ er sich auf das Kissen sinken, konzentrierte sich aber weiter darauf, wachzubleiben. Er winkelte sogar die Beine an, um noch ein bisschen unbequemer zu liegen. Es waren die aufgerissenen Augen des Mannes, die ihn jetzt verfolgten und aus der Dunkelheit anzustarren schienen. Sein entsetzter Blick, als sich der Schuss löste. »Der Kerl hatte es verdient«, sagte Ricky sich selbst. Er zweifelte keine Sekunde daran, dass dies der Wahrheit entsprach. Der Mann, den er erschossen hatte, war für den Tod unzähliger Menschen verantwortlich. Er hatte seinen Freund Benny getötet. Und den Sportlehrer – auch wenn der selbst kein netter Kerl gewesen war. Er hatte sogar versucht, Ricky mit dem Auto zu überfahren. All das änderte jedoch nichts an der Tatsache, dass Ricky schuld am Tod dieses Mannes war. Er hatte sich selbst zum Richter und zum Henker erklärt. Die Worte von Mister Kay kamen ihm in den Sinn.
»Du wirfst dein ganzes Leben weg, wenn du abdrückst.«
Hatte er das getan? Hatte er sein ganzes Leben weggeworfen? Angst, dass der Erziehungsberater Recht behalten würde, stieg in ihm auf. Die Wahrheit war, Mister Kay behielt letztlich immer Recht. Und plötzlich fand Ricky sich auf der Eisenbahnbrücke wieder. Er stand jenseits des Geländers und starrte auf die Bahnschienen hinunter. Hinter sich spürte er die Anwesenheit eines anderen Menschen. Er wusste, wer es war, noch bevor dieser sprach.
»Es war Notwehr!«, rief Mister Kay, doch Ricky wusste, dass das nicht stimmte.
»War es nicht«, antwortete er und nahm seine eigene Stimme wie aus weiter Entfernung wahr. »Ich wollte den Scheißkerl umbringen! Ich wollte es! Aber ich gehe nicht dafür in den Knast.«
Entschlossen wandte er sich dem Abgrund zu. Es wollte springen. Er wollte es wirklich, doch er fürchtete sich vor dem Aufprall. Wieder erschien das Bild des zerplatzenden Kopfes vor seinem inneren Auge. All das Blut erschreckte ihn zu Tode. Er wollte dieser Erinnerung bloß noch entkommen. Ohne weiter nachzudenken, ließ er das Geländer los und sprang. Für einen Augenblick fühlte es sich an, als könne er fliegen. Wie bei der blöden Zeichentrickkatze im Fernsehen, wenn sie mal wieder den Vogel verfehlt hatte und über dem Rand des Abgrunds stand. Doch dann sah Ricky, wie das Gleisbett auf ihn zu raste. Er riss die Hände schützend vor sein Gesicht und schrie, so laut er konnte. Ehe er aufschlug, schoss er abermals hoch. Nun saß er wieder kerzengerade in seinem Bett, noch immer schreiend vor Angst. Das T-Shirt klebte an seinem Körper.
»Verfluchte Scheiße!«, entfuhr es ihm. »Ganz übler Horrorfilm!«
Dieser Film war fortan sein Leben. Er wollte nicht riskieren, erneut einzuschlafen, also schwang er seine Beine aus dem Bett. Einen Moment saß er auf der Bettkante und hatte das Gefühl, als würde das Zimmer um ihn herum schwanken.
»Du musst dich ablenken«, befahl er sich selbst. »Einfach an was anderes denken und so.«
Doch das war leichter gesagt als getan. Immer wieder kehrten seine Gedanken nach kurzen Ausflügen zu dem Ort zurück, an dem er den Mann erschossen hatte. Verzweifelt suchte er etwas in seinem abgedunkelten Zimmer, das ihn ablenken konnte. Sein Blick fiel auf das Paar, das sich eng umschlungen vor einer orangegelben Wand küsste. Die Farben konnte er in der Dunkelheit nicht erkennen, doch er wusste genau, wie das Plakat einer amerikanischen Rockband aussah. Eigentlich stand Ricky ja auf richtigen Punkrock. Seinen Irokesenschnitt verdankte er dem CD-Cover einer Underground-Punkband, deren Namen er nicht mal mehr wusste. Doch die Art, wie das Mädchen auf dem Plakat in den Kuss versunken war, hatte ihn damals gepackt. Heute weckte das Bild Erinnerungen an Nancy. Sie hatte sich genauso an ihn geschmiegt, als sie das erste Mal nackt zusammenlagen. Die Lava-Lampe hatte ihr Zimmer sogar in fast dasselbe Licht getaucht. Und sie hatten sich ebenfalls geküsst. Ricky erinnerte sich daran, wie er zärtlich ihren Rücken gestreichelt und sie dabei ganz nah an sich herangezogen hatte. Allein beim Gedanken an diesen Moment spürte er, wie seine Unterhose anfing zu spannen. Nie zuvor war ihm ein Mädchen so nah gewesen. Doch auch über dieser Erinnerung lag ein dunkler Schatten. Der Nachmittag in Nancys Zimmer war nicht ohne Folgen geblieben. Als seine Freundin kapiert hatte, dass ihre morgendliche Übelkeit keine Nebenwirkung vom Kiffen sein konnte, war sie regelrecht durchgedreht. Sie hatte ihre Siebensachen zusammengepackt und war in den Wald geflüchtet. Diese Dummheit hätte sie nicht nur um ein Haar mit dem Leben bezahlt. Ihre Familie war daran zerbrochen und selbst der Tod ihres Bruders stand irgendwie damit in Zusammenhang. Ricky seufzte. Er brachte allen Menschen nur Unglück. Und den Tod. Und jetzt sollte er auch noch Vater eines Babys werden? Bestimmt würde er das Leben des Kindes ebenfalls ruinieren. Wenn es überhaupt zur Welt kam und nicht vorher weggemacht wurde. Ricky fühlte sich unendlich schuldig. Und sofort war das Bild vom zerplatzenden Kopf wieder da. Es gab scheinbar kein Entkommen aus dem Karussell seiner Gedanken. Erst in diesem Augenblick bemerkte er die Stimmen. Er konnte nicht hören, was gesagt wurde, oder von wem, doch er ahnte, was dort unten vor sich ging. Es passierte immer, wenn er etwas Schlimmes angestellt hatte. Und nie zuvor hatte er so eine Menge Unheil angerichtet wie in den letzten Tagen. Er fand es unvorstellbar, dass sie bis jetzt stritten. Der Polizist hatte ihn schon vor Stunden hierhergebracht und, wie er es nannte, der Obhut der Eltern übergeben. Ricky hielt kurz die Luft an, um besser in die Dunkelheit lauschen zu können. Doch sein Zimmer war zu gut gedämmt. Eilig zog er die Hausschuhe unter seinem Bett hervor und schlüpfte hinein. Dann schlich er zur Tür hinüber.
Marie
Die Parklücke war groß genug und Marie hatte fahrschulmäßig neben dem vorderen Fahrzeug gehalten. Eigentlich war das Einparken eine reine Formsache. Lenkrad einschlagen, rückwärtsfahren und im richtigen Augenblick gegenlenken. Ein simpler Automatismus, den sie seit ihrer Fahrschulzeit beherrschte. Normalerweise schaffte sie es problemlos, selbst in kleinste Parklücken einzuparken. Diesmal nicht. Diesmal brauchte sie einen zweiten Anlauf und auch der gelang ihr nur mäßig. Es war einfach vollkommen anders, wenn ihr Freund daneben saß und jede Handbewegung verfolgte. Endlich stand das Fahrzeug halbwegs gerade neben dem Bordstein. Marie atmete erleichtert auf und zog den Wagenschlüssel ab. Dann stieg sie zügig aus und umrundete das Auto. Daniel hatte die Fahrzeugtür bereits geöffnet und kämpfte damit, sich an der Tür hochzuziehen. Schnell reichte sie ihm eine Hand und hakte ihn schließlich unter. Der gemeinsame Weg zur Haustür kam ihr quälend langsam vor. War sie sich im Krankenhaus noch sicher gewesen, dass mit Sarah alles in Ordnung war, so hatte sie spätestens beim Einsteigen in das Auto ein schlechtes Gewissen bekommen. Und obwohl es nach all den Stunden, die sie nun fort war, vollkommen unlogisch erschien, hatte sie es plötzlich sehr eilig. Endlich erreichten sie die Haustür und Marie schloss auf.
»Kommst du klar?«, fragte sie ihren Freund.
Der nickte knapp. »Ich schaffe es schon.«
»Dann schaue ich mal schnell nach Sarah.«
Obwohl Daniel alles andere als sicher auf den Beinen stand, ließ sie ihn los und machte sich auf den Weg zum dunklen Treppenhaus. Auf Zehenspitzen schlich sie die Treppenstufen hinauf und hoffte, keinen allzu großen Lärm zu machen. Es gelang ihr, bis sie die Treppe etwa zur Hälfte erklommen hatte. Dort trat sie versehentlich auf jene Stufe, die jedes Mal gequält stöhnte, wenn man sie betrat. Marie stieß einen lautlosen Fluch aus und wählte ihre Schritte noch sorgfältiger. Sie hatte das Licht nicht eingeschaltet, um das Mädchen nicht zu wecken. Dennoch erkannte sie schon vom Flur aus, dass Sarahs Schlafzimmertür nur angelehnt war. Das kam ihr seltsam vor, denn ihre pubertierende Tochter legte normalerweise größten Wert auf ihre Privatsphäre.
»Kein Problem«, versuchte sie sich zu beruhigen, »sie wollte bestimmt nur mitkriegen, wenn ich nach Hause komme.«
Sie erreichte das Zimmer und öffnete die Tür einen Spalt, gerade genug, um hineinzuschauen. Ihre Tochter lag nicht im Bett.
»Sarah?«, fragte Marie voller Sorge. Sie tastete im Dunkeln nach dem Lichtschalter. Eine nackte Glühbirne flackerte auf und erleuchtete das spärlich möblierte Zimmer des Mädchens. Niemand war dort. Im Bett hatte keiner gelegen, das Bettzeug lag noch genauso da, wie Marie es an diesem Vormittag hergerichtet hatte. Sarahs Lieblingsteddy saß auf dem Kissen und glotzte sie mit großen Augen an. Sein Bein berührte die Ecke eines Briefes. Darauf stand, sorgsam von Hand geschrieben:
»Das Kind ist in meiner Gewalt. Keine Polizei! Du allein trägst die Schuld an allem, was nun geschieht. Du hast mein Leben zerstört, hast mir alles genommen und mich dann einfach vergessen. Diese gottlose Insel war mein Gefängnis. Verängstigt. Gebrochen. Allein. Doch nun wirst du für deine Taten bezahlen. Ich nehme dir weg, was du liebst, und beende dein Leben, wie du meines beendet hast.«
Panik schnürte Maries Hals zu.
»Daniel!«, rief sie. »Daniel, komm schnell her!«
Es polterte auf der Treppe und kurz darauf erschien ihr Freund in der Zimmertür.
»Was ist passiert?«, fragte er keuchend.
Marie hatte das Schreiben vom Bett genommen und hielt es ihm wortlos entgegen. Atemlos versuchte Daniel, danach zu greifen, während er sich am Türrahmen abstützte. Ihr schienen Stunden zu vergehen, bis er die wenigen Zeilen gelesen hatte.
»Diese gottlose Insel war mein Gefängnis«, las er schließlich laut vor und schaute Marie fragend an. »Ist hier Great Blasket Island gemeint?«
Ihr war nicht nach Ratespielen zumute.
»Ist doch scheißegal!«, rief sie empört. »Sarah ist weg! Was machen wir denn jetzt?«
»Wir müssen die Polizei verständigen«, antwortete er, nachdem er endlich von den Zeilen des Briefes aufgeschaut hatte. »Die wissen bestimmt, was zu tun ist.«
»Nein«, erwiderte Marie energisch. »Das steht doch ganz klar hier drin: Keine Polizei. Wir werden Sarah nicht in Gefahr bringen.«
»Aber was sollen wir denn sonst machen? Wie sollen wir sie finden?«
Marie zuckte mit den Schultern.
»Ich weiß es nicht«, brachte sie kleinlaut hervor.
»Die Polizei hat Erfahrung mit solchen Fällen, die wissen bestimmt auch, wie man ihre Beteiligung geheim halten kann.«
»Wir werden Sarah nicht in Gefahr bringen!« Marie betonte jedes einzelne Wort. Sie schaute ihren Freund dabei durchdringend an. Wut glomm in ihren Augen. »Du bist doch hier das große Genie. Jetzt kannst du mal zeigen, was du draufhast. Wie finden wir mein Kind?«
Daniel antwortete nicht, sondern hinkte bloß einen Schritt auf Marie zu. Er nahm sie in den Arm, obwohl sie sich anfangs dagegen wehrte. Schließlich gab sie ihren Widerstand auf und ließ es geschehen. Er hielt sie fest in seinem Arm, sehr fest sogar. Seine Stärke gab ihr Halt und ihre Wut verschwand genauso schnell, wie sie gekommen war. Verzweifelt klammerte sie sich an ihren Freund.
»Wie finden wir mein Kind?«, wimmerte sie.
Eine Weile standen sie so da.
»Das Einzige, was wir tun können …«
Irgendwo im Haus war ein Klingeln zu hören.
»Das Telefon«, rief Marie. »Im Wohnzimmer.«
Mit diesen Worten rannte sie aus dem Zimmer, durch den Flur, die Treppe hinunter und quer durch den Eingangsbereich. Daniel folgte ihr mit einigem Abstand. Sie erreichten das Wohnzimmer. Marie griff nach dem Mobilteil der Telefonanlage und warf einen kurzen Blick auf das Display.
»Unbekannt«, sagte sie.
»Geh ran«, empfahl Daniel. »Versuch, ganz ruhig zu bleiben, was immer er verlangt, stimm erstmal zu. Ach ja, und falls möglich, erwähne so oft es geht Sarahs Namen.«
Marie verstand nicht, weshalb er all das von ihr wollte, aber sie vertraute ihm. Mit zittrigen Fingern drückte sie die Taste mit dem grünen Hörer und gleich darauf jene mit dem Lautsprecher.
»H-hallo?«
Es rauschte am anderen Ende der Leitung, als telefoniere sie mit einer Freisprechanlage. Mehrmals knackte es in der Verbindung. Niemand sagte etwas, aber Marie konnte deutlich das Atmen des Anrufers hören.
»Hallo?«, wiederholte sie. »Wer ist da?«
Eine Ewigkeit schien zu vergehen, ehe die dunkle Stimme eines Mannes etwas antwortete. Seine Worte klangen dumpf. Vermutlich hatte er das Telefon abgedeckt, um nicht erkannt zu werden.
»Das Kind ist in meiner Gewalt«, sagte er trocken.
»Wer sind Sie?«, fragte Marie mit zitternder Stimme. Dann erinnerte sie sich an Daniels Anweisungen. »Und was wollen Sie von Sarah?«
»Ich will gar nichts von dem Mädchen.«
Es klang regelrecht abfällig, wie er das Wort Mädchen aussprach. Jetzt erahnte Marie, worum es ihrem Freund mit der Erwähnung ihres Namens ging. Ihre Tochter war für den Entführer bloß ein namenloses Opfer, mit dem er tun konnte, was er wollte. Daniel beabsichtigte offenbar, dies zu verändern, soweit es irgendwie möglich war.
»Sie ist nur ein Mittel zum Zweck«, sagte der Mann jetzt, als habe er Maries Gedanken erahnt und wollte ihn dadurch bestätigen. »Tut, was ich euch sage und sie wird nicht leiden müssen.«
Nicht leiden müssen. Der Satz hatte wohl beruhigend wirken sollen, erreichte aber genau das Gegenteil. Marie wechselte einen verzweifelten Blick mit Daniel. Der schaute ebenso ratlos drein, wie sie sich in diesem Augenblick fühlte.
»W-was meinen Sie damit? Was wollen Sie von uns?«
»Alles zu seiner Zeit«, sagte der Mann langsam. In der Ruhe seiner Worte lag etwas Bedrohliches. »Ihr werdet schon sehen. Bis dahin gibt es nur eine Regel. Keine Polizei! Wenn ihr sie brecht, stirbt das Mädchen und ihr werdet ihre Leiche niemals finden.«
Marie spürte, wie ihr Herz schneller schlug. Es war nackte Angst, die in ihr aufstieg.
»Geht es Sarah gut?«, fragte sie panisch. »Ich verlange einen Beweis, dass es meiner Tochter gut geht!«
Wieder schwieg der Mann am anderen Ende der Leitung. Schritte waren zu hören, dann ein mechanisches Quietschen, wie von einer Tür. Marie hörte das Wimmern eines Kindes. Selbst ohne Worte erkannte sie ihre Tochter sofort.
»Sarah? Sarah? Geht es dir gut?«
»I-ich …«
Ein dumpfer Schlag unterbrach das Kind, ehe es weitersprechen konnte. Es folgte ein Schmerzensschrei, der Marie in die Glieder fuhr. Die Brutalität des Entführers war erbarmungslos.
»Warum tun Sie das?«, brüllte sie ins Telefon. »Lassen Sie sie in Ruhe!«
Es folgte keine Antwort, sondern bloß ein weiterer dumpfer Schlag. Wieder war das verzweifelte Jammern des Mädchens zu hören.
Maries Körper bebte. Sie traute sich nicht mehr, auch nur ein einziges Wort zu sagen. Keinesfalls wollte sie den Entführer dazu bringen, Sarah noch einmal zu schlagen. Doch was konnte sie stattdessen tun? Hilfesuchend schaute sie Daniel an. Der zeigte eine Geste mit den Händen, die beruhigend wirken sollte.
Marie versuchte, tief durchzuatmen. Es gelang ihr nicht wirklich.
»Es tut mir leid«, brachte sie schließlich hervor. »Wir tun alles, was Sie wollen, nur lassen Sie Sarah in Ruhe!«
Ein Knirschen in der Leitung ließ Marie vermuten, dass der Entführer das Telefon zur Seite gelegt hatte. Abermals hörte sie ihr kleines Mädchen wimmern. Die darauffolgende Pause war unerträglich. Gebannt lauschte sie, was als Nächstes geschah. Es folgte eine ganze Reihe dumpfer Schläge. Die anfänglichen Schmerzensschreie des Kindes verebbten, bis bloß noch ein leises Stöhnen zu hören war.
»Aufhören!«, flehte Marie. »Aufhören, bitte!« Ihre Stimme versagte. Als sie ein weiteres Aufhören hervorbringen wollte, war es bloß noch ein Flüstern. Stille kehrte ein. Für ihr Mutterherz zog sich das Warten endlos in die Länge, bis irgendwann wieder das Knirschen in der Leitung ertönte. Der Entführer atmete schwer. Das Quälen des Kindes hatte ihn hörbar angestrengt. Sarahs Schluchzen wurde lauter. Offenbar befand sich das Telefon nun ganz in ihrer Nähe.
»Ist ja gut. Wein doch nicht. Alles wird gut. Ich denke, es ist vorbei.« Es klang beinah, als versuchte ein anderes Kind, Sarah zu trösten. Marie war jedoch vollkommen sicher, dass der Mann bloß seine Stimme verstellte. Was war das für ein sonderbares Spiel? Wollte er sie damit demütigen? »Deine Mama hat jetzt verstanden, dass sie sich benehmen muss. Nicht wahr?«
Marie war wie gelähmt. Die Brutalität des gefühllosen Mannes überforderte sie. Daniel trat einen Schritt an sie heran und nickte. Mit seinen Lippen formte er das Wort: Ja.
»Ja … ja, ich habe verstanden«, brachte sie hervor. Was sie sagte, war kaum zu verstehen, weil ihre Stimme abermals den Dienst quittierte. Sie wollte tief durchatmen, doch ihre Lunge schien keinen Sauerstoff mehr aufnehmen zu können.
»Ich habe verstanden«, versuchte sie es noch einmal. Sie hatte erwartet, dass der Entführer etwas antworten würde. Doch stattdessen ertönte bloß ein Knacken und das Telefonat war beendet. Das Gefühl der Hilflosigkeit riss Marie den Boden unter den Füßen weg. Sie wollte schreien, brachte aber keinen einzigen Ton hervor. Schweiß trat auf ihre Stirn und alles um sie herum drehte sich. Sie suchte im Chaos nach Daniel, doch konnte sie nicht erkennen, wo er sich befand. Sie wollte ihn rufen, doch ihre Welt versank schon im Dunkeln, bevor das gelang.
Daniel
Es war mir gelungen, Marie in letzter Sekunde aufzufangen, als sie das Bewusstsein verlor. Vorsichtig hob ich sie hoch und trug sie zum Sofa hinüber. Dort nutzte ich einige Kissen und eine herumliegende Decke, um ihre Beine hochzulegen.
»Marie? Marie, kannst du mich hören?«, fragte ich und berührte sanft ihr Gesicht. Sie öffnete ihre Augen, blinzelte ein paar Mal und murmelte etwas Unverständliches. Sie war nur wenige Augenblicke weg gewesen.
»Bitte was?«, fragte ich.
»Wo bin ich? Was ist passiert?« Ihre Worte waren nur unwesentlich deutlicher. Sofort schien es ihr jedoch selbst einzufallen. Sie richtete sich auf, während ihr Blick suchend die Wohnung durchstreifte.
»D-das Telefon! Sarah!«, rief sie voller Panik. Das Zittern und ihr blasses Gesicht verrieten mir, dass sie noch nicht aufstehen sollte. Vermutlich stand sie unter Schock.
»Du musst dich erstmal beruhigen«, sagte ich und drückte ihre Schultern sanft nach unten. Sie versuchte augenblicklich, sich zu befreien.
»Ich will mich nicht beruhigen«, rief sie empört. »Wir müssen Sarah helfen.«
»Das werden wir auch«, versprach ich. »Aber du kannst ihr nicht helfen, wenn du dich nicht mal auf den Beinen halten kannst. Also gib dir ein oder zwei Minuten, um wieder zu dir zu kommen.« Mir war zwar bewusst, dass dies erheblich länger dauern würde, aber ich wollte sie nicht weiter aufregen.
Trotzdem bäumte sie sich abermals auf. Es war jener Kampfgeist, den ich stets an ihr bewundert hatte.
»Sarah hat vielleicht keine zwei Minuten mehr.«
»Doch, die hat sie!«, sagte ich entschieden, während mein Gehirn verzweifelt versuchte, eine vernünftige Begründung für diese These zu finden. »Alles zu seiner Zeit. Das hat der Entführer gesagt. Das heißt, er wird sich noch einmal melden. Und bis es so weit ist, können wir gar nichts tun. Das Telefonat ist beendet, eine Rufnummer hast du nicht und die Polizei können wir auch nicht rufen!«
»Trotzdem muss ich …«
»Du musst dich beruhigen!«, befahl ich nun eindringlicher. »Für Sarah!«
Mit den letzten Worten gelang es mir, ihren Widerstand zu brechen.
»Okay«, sagte Marie und ließ sich auf das Sofa zurücksinken. »Kannst du mir ein Glas Wasser holen?«
»Klar, kein Problem«, bestätigte ich und machte mich auf den Weg zur Küche. Dort holte ich ein Glas aus dem Schrank und füllte es am Wasserhahn. Auf dem Weg zurück ins Wohnzimmer kam ich am Bad vorbei. Die Tür stand einen Spalt breit offen und mein Blick fiel auf den weißen Medizinschrank. Zunächst zögerte ich, doch dann trat ich ins Bad. Ich schaltete das Licht ein und öffnete die Schranktür. Dahinter türmten sich unzählige Pappschachteln jedweder Form und Größe. Kopfschmerztabletten, Durchfallmedikamente und Vitaminpräparate. Im obersten Fach fand ich eine kleine Schachtel mit der Aufschrift Diazepam. Ich nahm eine Tablette des Beruhigungsmittels aus der Verpackung, obwohl ich mir sicher war, dass meine Freundin diese niemals freiwillig schlucken würde. Zurück im Wohnzimmer erwartete mich eine Überraschung. Marie war offenbar eingedöst. Immer wieder zuckte sie und wimmerte im Schlaf. Leise stellte ich das Glas auf den Couchtisch und legte die Tablette daneben.
Trotz der frühen Uhrzeit fuhr draußen ein Auto vorbei, was ungewöhnlich laut zu hören war. In diesem Moment schreckte meine Freundin hoch.
»W-was ist?«, rief sie und schaute mich vollkommen desorientiert an.
»Das Wasser und die Tablette, die du wolltest«, log ich.
»Ah ja, danke.« Sie griff nach der kleinen weißen Pille und schob sie sich in den Mund. Ich half ihr beim Trinken. Sofort sank sie wieder auf das Sofakissen zurück und schloss ihre Augen. Sicherheitshalber wartete ich einen Moment, ob sie nochmal aufwachte, aber nichts passierte. Dann schleppte ich mich zu dem großen Sessel und ließ mich darauf sinken. Ich wollte auf keinen Fall einschlafen, bloß eine Sekunde lang ausruhen.
Dabei kamen mir die Worte aus dem Brief des Entführers in den Sinn. Diese gottlose Insel war mein Gefängnis. Was hatte er damit gemeint? Natürlich hatte ich bei dieser Formulierung sofort an Great Blasket Island gedacht. Aber war es überhaupt möglich, dass jemand außer Marie und mir diese Reise überlebt hatte und nun auf Rache sann? Wer sollte das sein? Draußen fuhr ein weiteres Auto vorbei. Das Geräusch der Reifen war deutlich zu hören. Es erinnerte mich an das Rauschen des Meeres. Diese gottlose Insel.
Montag, 18. Oktober, 14.22 Uhr (7 Wochen früher)
Die Wellen des Meeres rollten beständig auf den Sandstrand der Insel zu. Ihr gleichmäßiges Rauschen wirkte beruhigend. Ich atmete die salzige Meeresluft ein und blickte über das Wasser – hinüber nach Irland. Das Wetter hatte aufgeklart und ich erkannte jetzt sogar einzelne Häuser auf dem Festland. Nichts erinnerte mehr an den Sturm der vergangenen Tage.
»Kommen Sie klar?«, fragte die junge Frau, deren Namen ich schon wieder vergessen hatte. Sie war mir eine große Hilfe gewesen. Niemals hätte ich den Polizisten mit meinen bescheidenen Englischkenntnissen klarmachen können, was auf Great Blasket Island geschehen war. Zum Glück hatte sich an Bord der ersten Fähre zur Insel eine deutsche Touristin befunden. Sie war die ganze Zeit an meiner Seite geblieben und hatte mir als persönliche Übersetzerin geholfen.
Ich drehte kurz den Kopf zu ihr und nickte.
»Ich denke schon«, antwortete ich und wandte mich wieder dem Wasser zu.
»Die Polizei sagt, Sie können die Insel jetzt verlassen, wenn Sie möchten. Es steht ein Boot bereit, das Sie auf das Festland zurückbringt. Sie sollen sich aber morgen früh wieder auf dem Polizeirevier einfinden.« Mit diesen Worten kam sie ein paar Schritte näher. Sie stand nun direkt neben mir. »Das ist die Adresse«, sagte sie und reichte mir ein Stück Papier.
Ich nahm es entgegen und steckte es achtlos in meine Hosentasche.
»Vielen Dank«, sagte ich. »Für alles, äh …«
Mit einer Handbewegung deutete ich an, dass mir ihr Name entfallen war.
»Sylvia«, antwortete sie. »Nichts zu danken.« Sie lächelte kurz und wandte sich dann zum Gehen, merkte aber, dass ich nicht mitkam. Irritiert schaute sie mich an. »Ich habe gedacht, Sie wollen diese Insel so schnell wie möglich verlassen.«
Doch ich war noch nicht bereit aufzubrechen. Ich wartete auf die Rückkehr des Schlauchboots. Vor etwa einer halben Stunde waren zwei Mitarbeiter der Polizei in Taucheranzügen damit aufgebrochen, um das Wasser nach Leichen abzusuchen. Ich hatte ihren Start beobachtet und stand immer noch an der gleichen Stelle.
»Sie wollen wissen, ob Ihre Freunde gefunden werden, nicht wahr?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Es waren nicht meine Freunde«, erwiderte ich, einem Impuls folgend, obwohl mir bewusst war, dass diese Aussage nicht stimmte. Zögerlich setzte ich zu einer Erklärung an. »Ich meine … sie waren schon meine Freunde, aber … sie haben …«
»Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen«, sagte Sylvia verständnisvoll. »Ich kenne Ihre Geschichte ja bereits. Sie haben genug erlebt, um ein ganzes Buch darüber zu schreiben. Und die Verarbeitung des Erlebten könnte vermutlich zwei weitere Bücher füllen.«
»Wer würde sowas lesen wollen?«, fragte ich sarkastisch. »Ich muss einfach wissen, ob …«
»Ob es wirklich vorbei ist?«
Ich nickte. Das Einfühlungsvermögen der jungen Frau war beeindruckend.
»Psychologie-Studentin?«, fragte ich.
»Sowas in der Art. Eigentlich bin ich …«
In diesem Augenblick war in weiter Ferne das Dröhnen des Außenbordmotors zu hören und kurz darauf erschien das Schlauchboot im Blickfeld. Es hielt direkt auf den Strandabschnitt zu. Hinter mir brach Hektik aus. Polizisten kamen herübergelaufen, setzten Funksprüche ab und breiteten dann zwei Plastikplanen nahe dem Wasser aus.
Sylvia beendete ihren Satz nicht mehr. »Sieht aus, als hätten die Taucher etwas gefunden«, sagte sie stattdessen. Wir gingen ebenfalls einige Schritte auf das Wasser zu, bis wir von einem der Polizisten zurückgehalten wurden.
Das Boot erreichte den Sandstrand. Einer der Froschmänner stieg aus und zog es an Land. Dann begannen die Männer, einen Körper aus dem Inneren zu heben und legten ihn auf der ersten Plane ab.
»Erkennen Sie, wer es ist?«, fragte Sylvia.
Ich schüttelte den Kopf. »Die Polizisten stehen im Weg.«
Kurz darauf wurde eine zweite Leiche aus dem Boot gehoben und auf die andere Folie gelegt. Ich merkte, wie mich die Situation innerlich anspannte. Bis zuletzt hatte ich gehofft, dass die Taucher alle drei Körper gefunden hatten. Doch es waren nur zwei Planen vorbereitet worden. Die Männer schlugen die Plastikfolien über den Toten zusammen und begannen, sie mit Reißverschlüssen zu schließen. Einer der Polizisten kam zu uns herüber und sprach mit Sylvia.
»Er sagt, Sie müssen die Leichen identifizieren und fragt, ob Sie dazu bereit sind.«
Ich antwortete nicht, sondern machte mich direkt auf den Weg zu den Planen. Beide waren etwa zur Hälfte geschlossen. Sylvia und der Polizist folgten mir. Mehr als einmal hatte ich dem Tod ins Auge geblickt, seit wir diese gottlose Insel betreten hatten. Und doch hatte dieser nichts von seinem Schrecken eingebüßt. Ich zwang mich, die auf dem Boden liegenden Körper anzuschauen. Das Gesicht der ersten Leiche war blass und ausdruckslos. Ihre Augen waren zu. Und dennoch sah es aus, als könne sie sie jeden Moment wieder öffnen. So wirkte der andere Tote nicht. Seine sterblichen Überreste waren von den Ereignissen der vergangenen Tage gezeichnet. Eine klaffende Wunde verlief quer über das Gesicht. An seinem Pullover war die Austrittswunde einer Kugel erkennbar. Wieder sprach der Polizist und Sylvia übersetzte.
»Er sagt, Sie sollen die Namen der Toten nennen.«
»Die Frau hieß Annika Weiß und der Mann hieß Sven ...« Ich hielt inne und musste ernsthaft nachdenken, um mich an den Nachnamen von Annikas Freund zu erinnern. Ich hatte ihn nur einmal gehört, als er sich damals vorgestellt hatte. »Daub«, ergänzte ich schließlich. »Sven Daub.«
Der Polizist schien eine Rückfrage zu stellen.
»Also fehlt jetzt noch eine Person, richtig?«, übersetzte Sylvia.
Ich nickte. »Ja, es fehlt noch Marc Schulz.« Mein Blick wanderte dabei auf das Meer hinaus. Was mochte bloß mit ihm geschehen sein?
Samstag, 04. Dezember, 03:05 Uhr
Langsam öffnete ich meine Augen. Mir wurde klar, dass ich auf diese Frage bis heute keine Antwort erhalten hatte. Der Grund dafür war simpel und ein bisschen beschämend. Ich hatte bis jetzt nicht mehr danach gefragt. Marc Schulz war seit frühester Kindheit mein bester Freund gewesen. Ich hatte ihn stets für einen verpeilten, aber im Grunde seines Herzens gutmütigen Chaoten gehalten. Doch unsere Zeit auf Great Blasket Island hatte alles infrage gestellt.
»Marc war dein bester Freund«, sagte ich zu mir selbst in dem verzweifelten Versuch, mich zu beruhigen. »Nie im Leben würde er so etwas Schreckliches tun. Dazu wäre er gar nicht in der Lage.«
Es klang alles absolut logisch, aber meine Zweifel wurden dennoch stärker. Marc hatte Schreckliches getan. Mit Alexandra. Mit Annika. Und auch zu diesen Taten war er fähig gewesen. Dies war vermutlich der Grund dafür, weshalb ich seit der Rückkehr die Suche nach ihm nicht weiter fortgesetzt hatte. Ich hatte mich auf meine neue Freundschaft mit Marie konzentriert und ihn praktisch vergessen.
Das bereute ich jetzt. Diese gottlose Insel war mein Gefängnis. Bestand wirklich eine Chance, dass Marc noch lebte? Steckte er hinter der Entführung von Maries Tochter? Wäre er imstande, so etwas zu tun? Die Müdigkeit zwang mich, abermals meine Augen zu schließen. Die Umstände seines Todes kamen mir in den Sinn. Ich hatte versucht, ihn zu retten, und war dabei selbst in Lebensgefahr geraten. Den mächtigen Fluten des Atlantiks war ich bloß lebend entkommen, weil Sven mich gerettet und Alexandra mich reanimiert hatte. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie Marc all dies ohne Hilfe überlebt haben sollte. Und selbst wenn, welchen Grund könnte er haben, sich derart an Marie und mir zu rächen? All das ergab keinen Sinn. Das Nachdenken wurde schwerer und schwerer. Es schien mir vollkommen unvorstellbar, dass mich jemand so abgrundtief hasste. Doch genau das stand unumstößlich fest. Irgendwer war auf Rache aus und dabei offenbar wild entschlossen, zum Äußersten zu gehen. Ich fragte mich nach dem Grund, versuchte, mir auf all das einen Reim zu machen. Doch meine Gedanken schweiften immer wieder ab. Unzusammenhängende Bilder tauchten in meinem Kopf auf. Der Anblick meines ertrinkenden Freundes in den Fluten des Atlantiks. Das gespannte Tau mit dem Körper einer weiteren Leiche daran. Die Explosion der Hütte auf Great Blasket Island. Der Blick von Sven, der von blindem Hass getrieben auf den zerklüfteten Einschnitt der Insel zusteuerte. Immer neue Bilder erschienen – wie ein Karussell, das sich unaufhörlich drehte.
Kapitel 2
Ricky
Obwohl er angespannt war, gelang es ihm, die Türklinke lautlos herunterzudrücken. Er öffnete die Tür nur einen Spalt breit und schlich auf den Flur hinaus. Die Stimmen seiner Eltern wurden lauter, blieben aber dennoch unverständlich. Erinnerungen überrollten ihn, Bilder vom ersten Mal, als er einen Streit der beiden belauscht hatte. Das war inzwischen viele Jahre her. Ricky vermutete, dass er damals fünf oder sechs gewesen war. Weinend hatte er auf der Treppe gesessen, bis seine Mutter ihn entdeckt und ins Bett zurückgebracht hatte. Ihr Versprechen, dass sowas nie wieder vorkommt, hatte sie seither unzählige Male gebrochen. Er folgte dem hölzernen Geländer bis zur Treppe. Hier setzte er sich auf die oberste Stufe und lauschte.
»Das kann nicht dein Ernst sein«, sagte seine Mutter.
Ricky konnte ihre Worte nur deshalb verstehen, weil sie sie laut genug gesagt hatte. Die Antwort seines Vaters dagegen hörte er nicht. Seufzend zog er sich am Geländer hoch und schlich einige Stufen hinunter, bis er endlich alles mitbekam.
»Irgendwas muss mit dem Jungen passieren. Hast du vielleicht eine bessere Idee?«
»Eine bessere Idee als das?«, erwiderte seine Mutter jetzt. »Das dürfte nicht so schwer sein.«
»Besser das als den Knast!«
Bei dem Wort Knast setzte Rickys Herz einen Schlag aus. Was zur Hölle plante sein Vater da? Was hatte er mit ihm vor? Ricky zweifelte schon immer daran, dass er seinem Erzeuger wirklich wichtig war, aber die Härte in seiner Stimme erschütterte ihn.
»Es geht um unseren Sohn, Herrgott. Wir müssen bloß für ihn da sein«, argumentierte seine Mutter. Die Rollen in diesem Gespräch waren für Ricky klar verteilt. Sein Vater war der finstere Bösewicht. Er stellte ihn sich in einer schwarzen Weltraumrüstung vor. Seine Mutter war die Kämpferin für das Gute, die in einem weißen Gewand antrat. Ricky malte sich vor seinem inneren Auge eine Schlacht mit leuchtenden Schwertern aus.
»Ich will ihm doch auch helfen!«, donnerte der dunkle Lord und schwang sein Lichtschwert durch die Luft.
»Das ist nicht die Hilfe, die er braucht«, rief die Heldin voller Überzeugung und schleuderte ihm eine Welle der Macht entgegen. Doch er parierte den Angriff.
»Und welche Hilfe soll das sein?«, dröhnte die blecherne Stimme des finsteren Herrschers. Ihre Schwerter sausten durch die Luft, trafen sich in der Mitte. Ein gewaltiges Kräftemessen begann.
»Er braucht die Liebe und Aufmerksamkeit seiner Eltern. Beider Eltern!«
»Du hörst dich schon an wie seine Psychotante!«
»Du weißt, dass sie damit vollkommen Recht hat. Wir sind zu wenig für ihn da gewesen und er füllt die Lücke mit … mit diesem Scheiß.«
Zu gerne wäre Ricky auf der Treppe noch ein Stück nach unten gerutscht, um seine Mutter sehen zu können. Doch er saß schon auf der letzten Stufe, die nicht vom Küchenlicht beschienen wurde. Bestimmt würden seine Eltern ihn entdecken, falls er sich weiter vorwagte. Er stellte sich vor, wie ihr Gesicht von Schmerzen gezeichnet war. Sie litt immer so furchtbar, wenn er in Schwierigkeiten geriet. Und Ricky bereute es jedes Mal. Und er nahm sich auch jedes Mal vor, es nie mehr zu tun, obwohl er natürlich wusste, dass es trotzdem wieder passieren würde.
»Der Junge ist inzwischen alt genug, um für seinen eigenen Mist geradezustehen. Du hast den Polizisten doch gehört. Er hat einen Menschen erschossen.«
»Einen Mörder … in Notwehr.«
»Und denkst du, er hat auch die Wohnungen in Notwehr ausgeräumt? Oder die Kleine von den Wagners in Notwehr geschwängert? Er ist ein notgeiler Krimineller!«
Der Kampf war vorüber. Der finstere Lord hatte der guten Ritterin das Schwert aus der Hand geschlagen und triumphierte jetzt ob seines Sieges. Ricky konnte bloß noch das Schluchzen seiner Mutter hören.
»Du bist grausam«, brachte sie weinend hervor. Zu gerne wäre er in die Küche gelaufen, um sie zu trösten. Doch er war sich nicht mal sicher, ob seine Anwesenheit überhaupt tröstlich sein konnte. Er spürte einen gewaltigen Kloß in seinem Hals. Diesmal hatte er es echt verbockt.
»Und du bist naiv! Du glaubst ernsthaft, dass wir das in den Griff kriegen können, aber erstens ist der Junge nicht mehr in den Griff zu kriegen und zweitens gibt es schon lange kein Wir mehr.«
Ricky konnte hören, wie der Stuhl nach hinten über den Boden schabte, als seine Mutter aufsprang.
»Dann geh doch zu deiner Schlampe zurück!«, schrie sie und ihre Stimme überschlug sich dabei.
»Das mache ich auch, aber vorher besorge ich dem Jungen die Hilfe, die er braucht!«, giftete er zurück.
Urplötzlich war Ricky wieder das kleine Kind, das vor zehn Jahren auf der obersten Treppenstufe gesessen und seinen Teddy nassgeheult hatte. Tränen liefen über sein Gesicht. Er hatte immer geahnt, dass seine Eltern Eheprobleme hatten. Doch erst in diesem Augenblick begriff er, dass diese Ehe längst Geschichte war. Bloß eine Show, die sie seinetwegen aufrechterhielten. Ricky hatte genug gehört. Er stand leise auf und kehrte in sein Zimmer zurück. Wie ferngesteuert hielt er auf das CD-Regal zu. Auf das, was er mit anhören musste, gab es nur eine Antwort. Er griff hinter die CDs in das mittlere Fach und zog eine kleine metallene Box hervor. Im Dunkeln tastete er die Gegenstände in ihrem Inneren ab. Die Papers, die Büchse mit dem Zeug, den Tabakbeutel. Darin befand sich noch eine Selbstgedrehte vom Vortag. Zuletzt suchte er alle Ecken der Kiste nach dem Feuerzeug ab. Als er es gefunden hatte, stellte er sie wieder sorgfältig zurück und schlich zur Verandatür hinüber. Leise öffnete er die Tür und trat auf den Balkon. Eisige Kälte schlug ihm entgegen. Ricky fröstelte. Er klemmte sich den Joint zwischen die Lippen und zündete ihn an. Allein das Einatmen des Rauchs beruhigte ihn schon ein wenig, obwohl er wusste, dass die eigentliche Wirkung noch ein oder zwei Minuten brauchte. Selbst die Kälte trat in den Hintergrund. Mit dem Fuß zog er sich einen der Plastikstühle heran und ließ sich darauf fallen. Die Beine legte er auf dem Balkongeländer ab. Erneut zog er an der Zigarette. Die Glut glomm auf und sein Mund füllte sich mit Rauch. Er sog ihn gierig ein. Es dauerte nicht lange, bis alle Anspannung von ihm abfiel. Ricky starrte in den Himmel und strich sich dabei gedankenverloren durch den schmalen Streifen seiner roten Haare auf dem ansonsten kahlrasierten Schädel. Es war verflixt dunkel in dieser Nacht. Ricky suchte nach dem Mond, der normalerweise da oben strahlte. Er fand bloß eine dunkle blassblaue Scheibe mit einer winzigen Sichel am Rand. Erneut füllte er seine Lunge mit Rauch und allmählich begann die Welt um ihn herum, in einem angenehmen Nebel aus Gleichgültigkeit zu versinken. Scheißegal-Stimmung, so nannte Ricky diesen Moment, wenn das Gras zu wirken begann. Alles war ihm auf einmal scheißegal. Der Stress mit der Polizei, seine streitenden Eltern, selbst der tote Wichser. Als Test schloss er kurz seine Augen. Kein Schuss. Kein zerplatzender Kopf. Bloß die Scheißegal-Stimmung. Erst jetzt bemerkte er, dass er lächelte. Er öffnete seine Augen wieder und schaute gedankenverloren auf das rotglühende Wunder in seiner Hand. Es war wie ein Schalter, mit dem er die grausame Wirklichkeit ausknipsen konnte. Und in diesem Augenblick begriff er es. All die Termine, all die Besprechungen, all die Geschäftsreisen. Das waren die Schalter, die seine Eltern benutzten, um vor ihren Problemen zu fliehen. Es tröstete ihn, dass sie im Grunde gar nicht so verschieden waren. Vermutlich hatte er diese Art, allem zu entfliehen, sogar von seinen sogenannten Vorbildern übernommen. Er malte sich aus, wie er jetzt in die Küche ging, um diese Erkenntnis mit seinen Eltern zu besprechen. Er schloss abermals die Augen und die Szene lief wie ein Film in seinem Kopf ab. Wie er die Treppe hinunter spazierte und in die Küche platzte. Wie er sich direkt vor seinen Erzeugern aufbaute.
»Mum, Dad«, begann er die Ansprache an die Eltern seiner Filmszene und legte dann eine dramatische Pause ein. Er stellte sich vor, wie sie ihn dabei erwartungsvoll anschauten. »Fickt euch!«
Deutlich sah er den bescheuert fassungslosen Gesichtsausdruck des Film-Vaters vor seinem inneren Auge und dabei musste Ricky so sehr lachen, dass er beinah vom Stuhl fiel.
Samstag, 04. Dezember, 06:49 Uhr
Daniel
Es dauerte eine Weile, ehe ich begriff, wo ich mich befand. Ich hatte meine Augen nur kurz ausruhen wollen und war dann offenbar tief und fest eingeschlafen. Marie lag noch immer zusammengekauert auf der Couch. Unangenehme Träume schienen sie im Schlaf zu verfolgen. Sie verzog das Gesicht und wirkte dabei furchtbar angespannt. Hin und wieder gab sie einen stöhnenden Laut von sich. Ihre Verzweiflung war schwer zu ertragen. Daher beschloss ich, zu ihr zu gehen, um sie zu trösten. Es bedeutete jedoch eine gewaltige Kraftanstrengung, auf die Beine zu kommen. Die Wunde an meinem Hinterkopf begann augenblicklich zu pochen und mir war entsetzlich schwindelig. Als ich meine Freundin endlich erreichte, strich ich ihr behutsam über das Haar. Das schien sie tatsächlich zu beruhigen.
Nur allzu gern hätte ich ebenfalls weitergeschlafen, doch ich hatte mir schon vor Stunden vorgenommen, Sarahs Zimmer zu durchsuchen. Ich hielt es für unverantwortlich, dieses Vorhaben erneut aufzuschieben. Also kramte ich rasch meine Schmerzmittel aus der Hosentasche und nahm eine mit dem Wasser, das noch immer auf dem Tisch stand. Dann schlich ich so leise wie möglich in Richtung des Treppenhauses. Auf dem Weg dorthin trat ich beinah auf das Telefon, das Marie heute Nacht fallengelassen hatte. Mein Kreislauf schlug Kapriolen, während ich es vom Boden aufhob. Einen kurzen Augenblick lang musste ich mich sogar an dem Beistelltisch festhalten, auf dem die Basisstation der Telefonanlage stand. Unfähig zu handeln, wartete ich, bis das Zimmer sich nicht mehr drehte.
»Du kannst ihr nicht helfen, wenn du dich nicht mal selbst auf den Beinen halten kannst«, mahnte meine innere Stimme mit denselben Worten, die ich heute Nacht zu Marie gesagt hatte.
»Keine Zeit, auszuruhen!«, erwiderte ich. Zu meiner Überraschung gehorchte mein Körper. Der Schwindel ließ nach und ermöglichte es mir, das Telefon auf den Couchtisch zu bringen und den Weg zum ersten Stock anzugehen. Trotzdem kam mir jede Stufe der Treppe wie eine unüberwindliche Hürde vor. Eine davon, etwa auf halber Höhe, gab ein lautes Knarzen von sich. Ich hielt inne und lauschte in der Hoffnung, dass ich Marie nicht geweckt hatte. Gott sei Dank blieb alles still, also stieg ich weiter hinauf. Schließlich erreichte ich Sarahs Zimmer. Viele Spuren gab es hier nicht zu entdecken. Das Mädchen war erst wenige Tage zuvor bei ihrer Mutter eingezogen und das sah man diesem Raum deutlich an. Die Wände waren frisch gestrichen und strahlten in langweiligem Weiß. Statt einer Deckenlampe hing bloß eine notdürftig angeschraubte Fassung in der Mitte des Zimmers, die eine nackte Glühbirne hielt. Das Bett schien frisch bezogen, ein überdimensionierter Smiley mit einem Kopfhörer zierte den Kissenbezug. Ein Schriftzug sagte Music is my life. Auf dem Nachttisch am Kopfende lag eine umgefallene Lampe. Einige Umzugskartons standen in der Ecke. Der oberste war geöffnet, einzelne Wäschestücke hingen heraus. Andere Kartons stapelten sich leer oder bereits zusammengefaltet dahinter. Deren Inhalt hatte Maries Tochter, wie es aussah, achtlos in den Wandschrank an der gegenüberliegenden Seite des Zimmers gestopft. Neben der Tür stand ein kleiner Schreibtisch mit einem Computer darauf. Das Gerät wirkte überdimensioniert für das winzige Kinderzimmer oder die Bedürfnisse einer Jugendlichen. Ich vermutete, dass es sich um einen ausrangierten Rechner von Maries Arbeitsstelle handelte.
Ich ließ meinen Blick auf der Suche nach etwas Ungewöhnlichem ein weiteres Mal durch den Raum schweifen. Dabei bemerkte ich eine dunkle Stelle an der Zimmerdecke über Sarahs Bett. Was ich anfangs für einen Fleck hielt, entpuppte sich bei näherem Hinsehen als eine Collage. Maries Tochter hatte eine Ansammlung von Fotos an die Decke geklebt, sodass sie diese vor dem Einschlafen sehen konnte. Bei dem Versuch, mir die Bildersammlung genauer anzusehen, wurde mir derart schwindlig, dass ich mich sicherheitshalber auf die Bettkante setzte. So konnte ich nach oben schauen, ohne umzukippen. Im Zentrum der Anordnung klebte ein Foto, das Sarah und ein großes dunkelbraunes Pferd mit pechschwarzer Mähne zeigte. Das Mädchen stand in der Mitte des Bildes – ein schlanker, blonder Lockenkopf mit breitem Grinsen und auffälligen Sommersprossen. Sie wirkte neben dem gewaltigen Kopf des Tieres beinahe winzig. Eine Hand lag auf dem Nasenrücken des Pferdes, während sie ihm mit der anderen etwas zu fressen hinhielt. Seine volle Aufmerksamkeit gehörte dem Futter. Weitere Fotografien waren um das zentrale Bild herum angeordnet und zeigten, wie Sarah auf dem Pferd ritt, es am Zügel führte oder mit einer Bürste striegelte. Das Tier hieß Matteo, wie ein Schild am Eingang zu seiner Pferdebox verriet. Mädchen in diesem Alter verändern sich im Laufe eines Jahres sehr stark, sodass ich die Aufnahmen mühelos auf die letzten Wochen eingrenzen konnte. Meine Vermutung wurde durch das unterste Foto der Anordnung bestätigt. Es war an der gleichen Stelle aufgenommen worden wie das Bild in der Mitte. Was fehlte, war jedoch Sarahs Lächeln. Ihre Mimik wirkte traurig und ihre Augen schienen zu sagen: »Ich will dich nicht verlassen.«
Sie war aufgrund einer Erkrankung ihrer Oma zu Marie gezogen. Vermutlich zeigte das Bild ihren Abschied von dem Pferd.
Meine Sitzposition wurde allmählich unbequem und die Wunde begann aufs Neue zu pochen. Also setzte ich mich wieder aufrecht und schaute dabei direkt auf Sarahs Computer. Ein Gewirr schwarzer Kabel schlängelte sich über den Schreibtisch. Sie verbanden den Rechner mit der Tastatur und der Maus. In der Hoffnung, dort irgendeinen Hinweis zu finden, erhob ich mich und wankte zu dem Tisch hinüber. Das Gerät war nicht abgeschaltet worden, was ein blinkendes Lämpchen am Tower signalisierte. Ich drückte auf die Leertaste und sofort erschien der Sperrbildschirm und verlangte von mir die Eingabe eines Passwortes. Ich seufzte und war schon im Begriff, mich von dem Gerät abwenden, als mir eine Idee kam. Durch einen der langweiligsten Vorträge aller Zeiten, auf einer Fortbildung zum Thema Sicherheit im Internet, war ich bestens auf diese Aufgabe vorbereitet. Also beugte ich mich über die Tastatur, um mit beiden Händen zu tippen, und probierte es mit den häufigsten Passwörtern von Teenagern. Sie hatten auf einer Folie gestanden, die der Referent uns zum Einstieg in die Veranstaltung gezeigt hatte. Mein erster Versuch waren die Zahlen 12345, doch es erschien bloß in weißen Buchstaben der Hinweis: »Bitte versuchen Sie es erneut.« Ich ergänzte nach und nach weitere Ziffern der Zahlenreihe. Ohne Erfolg. Auch die Worte Passwort, iloveyou und qwertz führten mich nicht zum gewünschten Ziel. An dieser Stelle hielt ich kurz inne und überlegte.
»Na los«, befahl ich mir selbst. »Tu, was du am besten kannst!«
Das Fresko an Sarahs Decke kam mir in den Sinn und da wusste ich, was ich tun musste. Triumphierend tippte ich die Zeichenfolge in den Computer: M a t t e o. Doch wieder erschien nur die Aufforderung zur erneuten Eingabe. Trotz meiner Ernüchterung war ich noch nicht bereit, mich geschlagen zu geben. Sarahs Blick auf dem letzten Bild kam mir in den Sinn. Wie würde ein Mädchen dieses Alters ihre Trauer über die Trennung von dem Tier ausdrücken? Nach kurzem Überlegen ergänzte ich das eingegebene Passwort um die Abkürzung IMY für I miss you und bestätigte abermals mit Return. Diesmal erschien eine kleine Sanduhr und Sekunden später wurde der Desktop freigegeben. Ein Browserfenster öffnete sich und zeigte die letzte Seite, die Sarah besucht hatte. Es handelte sich um ein bekanntes soziales Netzwerk aus Deutschland, das sich aktuell großer Beliebtheit bei Schülerinnen und Schülern erfreute. Die Zugangsdaten waren im Browser gespeichert, sodass ich ohne Schwierigkeiten auf die Profilseite von Maries Tochter kam. Es gefiel mir gar nicht, im Profil einer Elfjährigen herumzuschnüffeln, doch ich hoffte auf einen greifbaren Hinweis auf ihren Entführer. Offenbar hatte Sarah gestern Abend noch spät mit einer Freundin namens Annabella gechattet. Wie für Mädchen dieses Alters typisch, hatte sich die Unterhaltung bis in die Nacht hingezogen. Ich holte mir den Schreibtischstuhl heran und setzte mich, obwohl er für meine Statur deutlich zu klein geraten war. Sein Gestell ächzte bedrohlich. Ich scrollte den Dialog bis zu seinem Anfang und überflog die Nachrichten. Die Erste war kurz nach halb elf verschickt worden.
»Habe deinen Brief gelesen«, schrieb Sarah. »Hdagdvl.«
Es folgten wechselseitige Freundschaftsbekundungen.
»Und? Wie ist es so bei deiner Mum?«, fragte Annabella schließlich.
»Ganz toll. Habe endlich ein normales Zimmer.«
»Schick mal Fotos.«
Der Computer gab ein Bing von sich und ein Pop-up-Fenster erschien. Irgendjemand namens WKWgangster hatte Sarah geschrieben. Seine Nachricht lautete:
»Du bist ja on.«
Ich drückte die Mitteilung weg, ohne darauf zu antworten, und las weiter in dem Chat der Mädchen. Es folgte eine Reihe von Bildern dieses Zimmers. Jedes war von Sarahs Freundin mit einem Smiley oder einem Herzchen versehen worden. Ich klickte sie nacheinander an, bis schließlich ein Foto erschien, das die Pausenhalle meiner Schule zeigte.
»Alles in meiner neuen Schule ist einfach irre groß. Jeder Flur hat unzählige Abzweigungen und irgendwie führen alle in die Pausenhalle«, hatte Sarah dazu geschrieben. Es war eine überaus treffende Beschreibung.
Wieder ertönte ein Bing und abermals öffnete sich ein kleines Fenster. »Hallo?«, fragte der Junge darin.
»Ja, ja, hallo!«, brummte ich, während ich seine Nachricht schloss.
»Schicke Schule«, hatte Annabella geantwortet. »Und der Freund deiner Mutter ist da echt ein Lehrer?«
»Kein Lehrer. Eher sowas wie ein Berater. Die Schüler nennen ihn nur Mister Kay.«
»Und? Wie ist er so?«
»Ich glaube, er ist voll in Ordnung.«
Verlegen unterbrach ich das Lesen des Textes. Nun kam ich mir endgültig vor wie ein Stalker. Ich beeilte mich, die folgenden Bilder durchzuklicken. Sie zeigten Schülerinnen der fünften Klasse. Die Mädchen hatten sich gegenseitig vor dem Seebach fotografiert, einem zugewachsenen Rinnsal zwischen dem Schulgelände und dem Parkplatz. Sarah hatte jeweils die passenden Namen dazugeschrieben.
Bing. »Warum antwortest du nicht?«
Wer immer dieser Junge war, seine Nachrichten waren wirklich penetrant. Schnell drückte ich auf das X in der oberen rechten Ecke des kleinen Fensters, denn ich wollte möglichst rasch zu dem letzten Bild der Mädchen zurückkehren. Irgendetwas hatte meine Aufmerksamkeit erregt. Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, was ich unbewusst wahrgenommen hatte. Unscharf im Hintergrund erkannte ich den Parkplatz der Schule. Dort stand ein Mann. Er hatte die Arme verschränkt, sein Gesicht war unter einer dunklen Kapuze verborgen und es sah beinah so aus, als beobachte er die Mädchen. Ich bewegte das Mausrad, um das Bild zu vergrößern. Doch meine Hoffnung, den Unbekannten dadurch zu erkennen, erfüllte sich nicht. Stattdessen erhielt ich nur riesige Pixel ohne jede Kontur.
Ich seufzte und verkleinerte das Bild wieder. Wer war dieser Kerl? Handelte es sich um Sarahs Entführer? Oder war er nur zufällig auf das Foto geraten, während er auf dem Parkplatz gewartet hatte? Schnell klickte ich auf das nächste Bild der Reihe, doch es war aus einer völlig anderen Perspektive aufgenommen worden und zeigte den Unbekannten gar nicht.
Abermals verkündete der schrille Ton den Eingang einer Chatnachricht und erneut unterbrach ein Pop-up-Fenster meine Konzentration auf das, was mir wichtiger war. Ich wollte die Nachricht schon wegdrücken, als ich ihren Inhalt realisierte.
»WENN DU MIR NICHT ANTWORTEST, DREHE ICH DER KLEINEN SCHEISS-GÖRE DEN HALS UM!«
Nach einer kurzen Schrecksekunde zog ich mit feuchten Fingern die Tastatur zu mir heran und tippte eine Antwort ein.
»Wer bist du?«
Die Reaktion des Unbekannten ließ nicht lange auf sich warten.
»Das weißt du nicht? Was ist los mit dir? Tappt der große Daniel Konrad etwa vollkommen im Dunkeln?«
Bei den Worten bekam ich eine Gänsehaut. Woher wusste er, wer vor dem Rechner saß? Während ich über diese Frage nachdachte, entdeckte ich das grüne Lämpchen neben der Webcam, die im Monitor des Computers fest verbaut war. Ich erinnerte mich nicht daran, dass es kurz zuvor geleuchtet hatte. Offenbar war diese Funktion per Fernzugriff gesteuert worden. Möglicherweise hatte der Entführer Sarah auf diese Weise schon tagelang beobachtet.
Eine weitere Nachricht erschien.
»Es ist nicht wichtig, wer ich bin«, schrieb der Unbekannte. »Wichtig ist, wer du bist. Und vor allem, was du getan hast.«