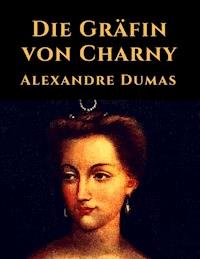
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Andrea de Taverney, die Gräfin von Charny, war mitten in dem bunten Treiben der Festlichkeiten des Schlosses Versailles und trotz der Gunst Marie Antoinette stets allein und unglücklich. Nun findet sie im Leben die Dinge, nach denen sie Zeit ihres Lebens suchte: Zum einen ihren verlorenen Sohn Sebastian, der in Villers Cotterêts aufwuchs und dann von seinem Vater Gilbert auf ein College in Paris gesandt worden war, wo ihn immer stärkere Halluzinationen heimsuchen. Zum anderen die Zuneigung und Liebe des Grafen von Charny, der, während sich seine Leidenschaft für die eifersüchtige Marie Antoinette abkühlt, in der Ehefrau, mit der ihn bis dahin nicht mehr verband als ein Ring und ein erzwungenes Versprechen vor Gott und den Menschen, seine wahre Liebe entdeckt. Die Romanreihe »Memoiren eines Arztes«, in der »Die Gräfin von Charny« als vierter und letzter Roman erschien, hat Alexandre Dumas zwischen 1846 und 1855 veröffentlicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Gräfin von Charny
TitelseiteErstes KapitelZweites KapitelDrittes KapitelViertes KapitelFünftes KapitelSechstes KapitelSiebentes KapitelAchtes KapitelNeuntes KapitelZehntes KapitelElftes KapitelZwölftes KapitelDreizehntes KapitelVierzehntes KapitelFünfzehntes KapitelSechzehntes KapitelSiebzehntes KapitelAchtzehntes KapitelNeunzehntes KapitelZwanzigstes KapitelEinundzwanzigstes KapitelZweiundzwanzigstes KapitelDreiundzwanzigstes KapitelVierundzwanzigstes KapitelFünfundzwanzigstes KapitelSechsundzwanzigstes KapitelSiebenundzwanzigstes KapitelAchtundzwanzigstes KapitelNeunundzwanzigstes KapitelDreißigstes KapitelEinunddreißigstes KapitelZweiunddreißigstes KapitelDreiunddreißigstes KapitelVierunddreißigstes KapitelFünfunddreißigstes KapitelSechsunddreißigstes KapitelSiebenunddreißigstes KapitelAchtunddreißigstes KapitelNeununddreißigstes KapitelVierzigstes KapitelEinundvierzigstes KapitelZweiundvierzigstes KapitelDreiundvierzigstes KapitelVierundvierzigstes KapitelFünfundvierzigstes KapitelSechsundvierzigstes KapitelSiebenundvierzigstes KapitelAchtundvierzigstes KapitelNeunundvierzigstes KapitelFünfzigstes KapitelEinundfünfzigstes KapitelZweiundfünfzigstes KapitelDreiundfünfzigstes KapitelVierundfünfzigstes KapitelFünfundfünfzigstes KapitelSechsundfünfzigstes KapitelSiebenundfünfzigstes KapitelAchtundfünfzigstes KapitelImpressumAlexandre Dumas
Die Gräfin von Charny
Roman
Erstes Kapitel
Auf dem Wege von Versailles nach Paris machte vor dem Gasthause an der Brücke zu Sèvres ein etwa fünfundvierzig- bis achtundvierzigjähriger Mann halt, der wie ein Schmied oder Schlosser gekleidet war. Ohne groß zu sein, war er ungemein schön gewachsen; er hatte einen kleinen Fuß; und auch seine Hand hätte für schön und zart gelten können, wenn sie nicht die Bronzefarbe der Eisenarbeiter gehabt hätte. Aber wenn man seinen Arm bis zu dem aufgerollten Hemdärmel betrachtet hätte, so würde man gesehen haben, dass die starken Muskeln mit einer feinen, fast aristokratischen Haut bedeckt waren.
Dieser Mann trug ein reich mit Gold eingelegtes Doppelgewehr, auf dessen Lauf der Name des Büchsenmachers Leclerc zu lesen war.
Der Mann war von Versailles gekommen und über alle Ereignisse genau unterrichtet; dem Wirt erzählte er, die Königin komme mit dem König und dem Dauphin; sie habe sich endlich entschlossen, dem Drängen des Volles nachzugeben und in die Tuilerien überzusiedeln.
Während er dies sagte, schaute er mehrfach und aufmerksam in die Richtung nach Paris, aus der jetzt ein Wanderer kam, der ebenfalls dem Handwerkerstande anzugehören schien.
»He, Kamerad!« sagte der wartende Gast, »das Wetter ist kalt und der Weg lang; nehmen wir nicht ein Glas Wein zur Stärkung und Erwärmung?«
Der Wanderer sah sich um.
»Meinet Ihr mich?« fragte er.
»Wen denn sonst? Ihr seid ja allein.«
»Und Ihr bietet mir ein Glas Wein an?«
»Warum denn nicht? Wir sind ja von dem gleichen Geschäft ...«
»Meinetwegen«, sagte der Handwerker, in das Wirtshaus eintretend.
Der Unbekannte deutete auf den Tisch und reichte ihm das Glas ...
»Die Nation soll leben!«
Die grauen Augen des Arbeiters hefteten sich einen Augenblick auf den andern. Dann sagte er:
»Das war wohl gesprochen: Die Nation soll leben! Was macht Ihr denn hier?«
»Wie Ihr seht, ich komme von Versailles, ich erwarte den Zug, um ihn nach Paris zu begleiten.«
»Was für einen Zug?«
»Wisst Ihr denn nicht, dass der König mit der Königin und dem Dauphin in Begleitung der Marktweiber und mit zweihundert Mitgliedern der Nationalversammlung, unter dem Schutze der Nationalgarde und Lafayettes, nach Paris zurückkehren?«
»Ich dachte es wohl, als ich mich heute früh um drei Uhr auf den Weg nach Paris machte.«
»So! Ihr habt heute früh um drei Uhr Versailles verlassen? Wart Ihr denn nicht neugierig, was dort vorgehen wird?«
»Jawohl, ich hätte gern gewusst, was aus dem Bourgeois wird, zumal da er, ohne mich zu rühmen, ein alter Bekannter ist; aber Ihr wisst ja, die Arbeit geht vor; man hat Weib und Kind, und die wollen leben, und das ist jetzt nicht so leicht, da die königliche Schlosserwerkstätte eingeht.«
Der Unbekannte ließ die beiden letzten Anspielungen unbeachtet. »Ihr habt also dringende Arbeit in Paris gehabt?«
»Ja, und die Arbeit ist gut bezahlt worden«, erwiderte der Handwerker.
»Die Arbeit war vermutlich schwer ...«
»Eine unsichtbare Tür!«
»Wo habt Ihr das gemacht?«
»Ja, das kann ich ...«
»Aha! Ihr wollt's nicht sagen.«
»Ich kann's nicht sagen, weil ich's nicht weiß.«
»Man hat Euch also die Augen verbunden?«
»Ja, so ist's; ich wurde an der Barriere mit einem Wagen erwartet. Man verband mir die Augen und brachte mich nach der Arbeit wieder mit verbundenen Augen an die gleiche Stelle.«
»Und gar nichts habt Ihr gesehen?«
»Nun ja. Als ich draußen an der Treppe stolperte, benutzte ich die Gelegenheit und verschob die Binde. Da sah ich links eine Baumreihe; das brachte mich auf die Vermutung, das Haus müsse am Boulevard stehen; aber das ist alles.«
»Ihr würdet das Haus nicht wiedererkennen?«
Der Schlosser sann einen Augenblick nach.
»Wahrhaftig nein,« sagte er, »das könnte ich nicht.«
Diese Versicherung schien der Unbekannte mit Befriedigung aufzunehmen.
»Es ist sonderbar,« sagte er, »dass man Schlosser von Versailles kommen lässt, um geheime Türen machen zu lassen ...«
»Jawohl,« sagte der Schlosser, »es gibt auch Schlosser in Paris ... und sogar Meister gibt's ... aber zwischen Meister und Meister ist ein Unterschied.«
»Aha!« sagte der Unbekannte lächelnd, »ich sehe, nicht nur Meister, sondern Meister über Meister.«
»Und Meister über alle ... Seid Ihr vom Geschäft?«
»Nun ja, so ziemlich.«
»Was seid Ihr?«
»Ich bin Büchsenmacher.«
»Ist das etwas von Eurer Arbeit?«
Der Schlosser nahm dem Unbekannten das Gewehr aus der Hand, betrachtete es aufmerksam, probierte das Schloss, nickte beifällig, und las den Namen, der auf dem Laufe stand.
»Leclerc«, sagte er. »Unmöglich, Freund. Leclerc ist höchstens achtundzwanzig, und wir beide gehen auf die Fünfzig los. Doch nichts für ungut, es ist nicht böse gemeint.«
»Es ist wahr,« erwiderte der andere, »ich bin nicht Leclerc, aber es ist ganz dasselbe.«
»Wie, es ist ganz dasselbe?«
»Allerdings, ich bin ja sein Meister.«
»Das wäre nicht übel«, sagte der Schlosser lachend. »Das ist gerade, als wenn ich sagte: Ich bin nicht der König, aber es ist ganz dasselbe.«
»Wie! Es ist ganz dasselbe?« wiederholte der Unbekannte.
»Jedenfalls, denn ich bin ja sein Meister«, sagte der Schlosser.
»Oho!« rief der Unbekannte, indem er aufstand und salutierte, wie ein Soldat. »Habe ich die Ehre, Monsieur Gamain vor mir zu sehen?«
»Jawohl, den leibhaftigen Gamain, ergebenst aufzuwarten,« erwiderte der Schlosser, hocherfreut über den Effekt, den sein Name gemacht hatte.
»Teufel!« sagte der Unbekannte, »ich wusste nicht, dass ich einen so bedeutenden Mann vor mir hatte ... Aber ich denke mir's nicht schön, der Meister eines Königs zu sein, wenn man sagen muss: Ew. Majestät, geruhen Sie diesen Schlüssel in die linke Hand zu nehmen; – Sire, nehmen Sie diese Feile in die rechts Hand.«
»Ei! Eben das war so schön bei ihm. Sobald wir in der Werkstätte waren, nannte ich ihn ›Bourgeois‹, und er nannte mich Gamain; nur sagte er Du zu mir, und das tat ich nicht. Ihr müßt wissen, im Grunde fühlte er sich nur wohl in der Werkstätte oder zwischen seinen Landkarten; es ist jammerschade, daß er als König auf die Welt gekommen ist und sich mit so vielen Nebendingen beschäftigen muß, anstatt in seiner Kunst Fortschritte zu machen. Er wird nie ein rechter König sein, aber ein tüchtiger Schlosser wäre er geworden. Man machte ja auch mit ihm, was man wollte. Der Minister Necker stahl ihm die Zeit; was er von seinem Gelde nicht den Armen gab, sogen ihm die Coigny, Vaudreuil und Polignac aus der Tasche; stellt Euch vor, einmal verwandte die Königin fünfhunderttausend Francs für ein Kindbettgeschenk an Frau von Polignac ...
Die Polignacs waren vor zehn Jahren so arm, und nun schleppen sie Millionen davon! Wenn die Sippschaft noch etwas könnte! Den Leuten ein X für ein U zu machen, das verstehen sie, und sie haben den König in die Tinte gebracht; er kann nun zusehen, wie er mit Vailly, Lafayette und Mirabeau wieder herauskommt ... Und ich sitze nun da mit dem versprochenen Jahresgehalt von fünfzehnhundert Livres, das ich aber nicht bekomme. Ich würde ihn wahrhaftig besser beraten haben als die Polignacs; ich war ja sein Meister, sein Freund!«
Jetzt erschienen zwei Männer aus der untersten Volksklasse und ein Fischweib in der Gaststube, und setzten sich an denselben Tisch, wo der Unbekannte mit dem Meister Gamain eben die zweite Flasche leerte.
Der eine der beiden Männer hatte eine zwergartige Gestalt, er war kaum fünf Fuß hoch. Sein Gesicht schien diese Mißgestalt noch auffallender zu machen; seine fettigen Haare lagen platt auf der eingedrückten Stirn; dieser Mensch schien kein Blut, sondern Galle in den Adern zu haben.
Der andere war das Gegenstück zu dem ersten, er glich einem auf zwei Stelzen stehenden Reiher.
Der dritte oder die dritte, wie man will, war ein Amphibium, dessen Spezies wohl zu erkennen, aber dessen Geschlecht schwer zu unterscheiden war. Es war ein männliches oder weibliches Geschöpf von dreißig bis vierunddreißig Jahren, im eleganten Fischweiberkostüm, mit goldener Kette und Ohrringen, Kopftuch und Spitzenkragen. Man erwartete mit Ungeduld, daß ihr oder sein Mund sich auftue und einige Worte spreche, denn man hoffte, der Ton der Stimme werde der ganzen zweifelhaften Person einen bestimmten Charakter geben; aber auch darin täuschte man sich, denn die einem Sopran ähnliche Stimme erregte in dem Beobachter noch mehr Zweifel als die äußere Erscheinung.
Die Schuhe der drei neuen Gäste trugen unverkennbare Spuren einer langen Wanderung.
»Es ist merkwürdig,« sagte Gamain, »das Frauenzimmer glaube ich zu kennen.«
»Wohl möglich, lieber Meister Gamain,« sagte der Unbekannte, »aber wenn diese drei Personen beisammen sind, haben sie gewiß etwas vor, und wenn sie etwas vorhaben, muß man sie gewähren lassen.«
»Kennt Ihr sie denn?« fragte Gamain.
»Ja, von Ansehen«, antwortete der Unbekannte. –
»Wenn Ihr sie kennt, so nennt mir doch die beiden Männer, ich werde dann ganz gewiß auch das Frauenzimmer erkennen.«
»Der Krummbeinige ist Jean Paul Marat ... und der Langbeinige Prosper Verrières. Nun, bringen Euch die Namen auf die Spur des Fischweibes?«
»Nein, ich entsinne mich nicht.«
»Dann will ich ihn nennen, das Fischweib ist der Herzog von Aiguillon.
Als dieser Name genannt wurde, stutzten die drei neuen Gäste und sahen sich um.
Der Unbekannte legte den Finger auf den Mund und verließ das Gastzimmer. Gamain, der zu träumen glaubte, folgte ihm. An der Tür stieß er gegen einen Mann, der vor einer ihn verfolgenden Schar zu fliehen schien. »Der Friseur der Königin! Der Friseur der Königin!« rief der heranstürmende Haufe.
Unter den Schreiern waren zwei Männer, die jeder einen bluttriefenden Kopf auf einer Pike trugen.
Es waren die Köpfe der beiden unglücklichen Leibgardisten Varicourt und Deshuttes.
»Siehe da, Monsieur Léonard!« sagte Gamain, der den Verfolgten sogleich erkannte.
»Er soll wohl diesen armen Teufeln die Köpfe frisieren. In Zeiten der Revolution haben die Menschen gar sonderbare Ideen«, sagte der Unbekannte, dann mischte er sich unter die Menge und ließ den Meister Gamain, dem er wahrscheinlich alles entlockt hatte, was er wissen wollte, wieder nach Versailles in seine Werkstätte zurückkehren.
Der Unbekannte konnte sich leicht unter den Volkshaufen mischen, da dieser sehr groß war. Es war der Vortrab des Zuges, der den König, die Königin und den Dauphin begleitete.
Die Abreise von Versailles hatte, wie der König angeordnet, gegen ein Uhr mittags stattgefunden.
Die Königin, der Dauphin,Madame Royale,der Graf von Provence,Madame Elisabeth und Andreahatten im Wagen des Königs Platz genommen.
Hundert Kutschen hatten die Mitglieder der Nationalversammlung, die den König nicht verlassen wollten, aufgenommen.
Der Graf von Charny und Billotwaren in Versailles geblieben, um dem Baron Georges von Charny, der in jener Schreckensnacht vom 5. zum 6. Oktober gefallen war, die letzte Ehre zu erweisen, und um zu verhindern, daß sein Leichnam verstümmelt werde, wie man die Leichname der Leibgardisten Varicourt und Deshuttes verstümmelt hatte.
Der oben erwähnte Vortrab hatte sich um die beiden Gardistenköpfe wie um eine Fahne geschart.
Er bestand aus zerlumptem, halbnacktem Gesindel. Plötzlich entstand ein großer Tumult unter der Volksmenge. Man bemerkte die Nationalgarde und Lafayette. Dieser bewaffneten Schar folgte der Wagen des Königs.
Lafayette war der Abgott des Pariser Volkes und unumschränkter Gebieter.
Der Vortrab war weit vorausgeeilt: er wollte dem Kommandanten seine blutige Trophäe verbergen, und mochte sich von dieser doch nicht trennen. Die »Standartenträger«, durch das im Wirtshause wartende Triumvirat verstärkt, beschlossen, den König zu erwarten, um sich dem Zuge anzuschließen, denn Seine Majestät habe erklärt, sich von seinen »Getreuen« nicht trennen zu wollen.
Der Vortrab setzte sich daher, nachdem er sich durch einige Zuzüge verstärkt, wieder in Bewegung.
Diese Volksmenge, die sich, einer durch einen Platzregen angeschwellten Gosse ähnlich, auf der Landstraße von Versailles gegen Paris hin fortwälzte, zog aus den nahen Dörfern eine Menge Neugieriger herbei. Die meisten blieben ruhig auf beiden Seiten des Weges stehen, ohne für den König und die Königin große Sympathie an den Tag zu legen; dagegen rief die Menge aus Leibeskräften: »Es lebe Lafayette!« Auch Mirabeau ließ man hochleben; so hörte denn der unglückliche König Ludwig XVI., dessen Name gar nicht genannt wurde, wie man die Volkstümlichkeit, die er verloren hatte, und das Genie, das er nie besessen, jubelnd begrüßte.
Gilbertging an der rechten Seite des königlichen Wagens, wo die Königin saß. Marie Antoinette bewunderte Gilbert, der, ohne Liebe und Zuneigung für seine Regentin, nur das tat, was er für seine Pflicht hielt, und bereit war, für sie sein Leben zu opfern.
Außer den Fußgängern, welche den königlichen Wagen begleiteten, wateten zu beiden Seiten der Landstraße im tiefen Kot die Marktweiber, Gemüsehändler und andere, dem niedrigsten Volke angehörende Leute, die einige mit singenden und schreienden Weibern beladene Kanonen und Munitionskarren mit sich führten.
Sie sangen und schrien: »Jetzt wird uns das Brot nicht fehlen: wir führen ja den Bäcker, die Bäckerin und den kleinen Bäckerjungen heim!«
Die Königin schien das Geschrei nicht zu verstehen; sie hielt den kleinen Dauphin auf den Knien; der König sah dem Getümmel mit gleichgültigen Blicken zu; er hatte in der letzten Nacht fast nicht geschlafen, denn er war nicht für schwierige Lebensverhältnisse geschaffen.
Den Grafen von Provence erkannte man an seinem immer lauernden, tückischen Blick; er war in jenem Augenblick ein Liebling des Volkes, weil er in Frankreich geblieben, während sein Bruder, der Graf von Artois, geflohen war.
Andrea schien von Marmor zu sein. Sie glich einer überirdischen Erscheinung, die sich unter die Lebenden verirrt hat. Nur ihr Blick gab zu erkennen, daß sie lebte: ihr Auge flammte unwillkürlich auf, so oft es dem Auge Gilberts begegnete.
Etwa hundert Schritte vor dem obenerwähnten kleinen Wirtshause machte der Zug halt. Das Schreien und Toben wurde noch stärker.
Die Königin neigte sich aus dem Wagen, und diese Bewegung, die man für einen Gruß nehmen konnte, erregte ein Gemurmel unter der Menge.
»Herr Gilbert«, sagte sie.
Gilbert trat an den Wagen. Da er von Versailles her den Hut in der Hand hielt, hatte er nicht nötig, ihn abzunehmen, um der Königin seine Ehrerbietung zu bezeigen.
»Majestät.«
»Herr Gilbert, was singt und schreit das Volk?«
Herr Gilbert wollte antworten, aber ein Schrei des Entsetzens, gefolgt von barbarischem Gelächter, drang aus der Volksmenge.
Die beiden Pikenträger kamen heran. Die Köpfe, die sie gleichsam als Feldzeichen der Rotte vorantrugen, hatten sie von dem unglücklichen Leonhard pudern und frisieren lassen; sie wollten sie der Königin zeigen.
»Um des Himmels willen, gnädigste Frau,« sagte Gilbert, »sehen Sie nicht nach rechts!« Aber die Königin hatte nichts Eiligeres zu tun, als ihren Blick nach der bezeichneten Richtung hin zu wenden. Das Entsetzen entlockte ihr einen lauten Schrei. Aber plötzlich wendeten sich ihre Augen von dem furchtbaren Schauspiel ab und starrten ein Medusenhaupt an, von dem sie sich nicht abwenden konnten. Es gehörte jenem Unbekannten, den wir im Wirtshause zu Sèvres mit dem Meister Gamain zusammen gesehen haben, und der jetzt mit verschränkten Armen an einem Baume stand.
Die Hand der Königin fiel auf Gilberts Schulter und zuckte krampfhaft.
Gilbert sah sich um. Dann riefen beide zugleich:
»Cagliostro! ...«
Der Fremde sah Gilbert und winkte ihm zu.
In diesem Augenblick setzte sich der Wagenzug wieder in Bewegung.
Gilbert ließ die Kutschen und die Volksmenge vorüberziehen und folgte dem angeblichen Büchsenmacher, der sich von Zeit zu Zeit nach ihm umsah, in eine Seitengasse.
Zweites Kapitel
Vor einem großen und schönen Hause machten Cagliostro und sein Begleiter halt. Sie traten ungesehen durch eine kleine Seitenpforte und Gilbert zog die Tür hinter sich zu; man hörte nicht das leiseste Knarren der Angeln, nicht das mindeste Schnappen des Schlosses. Der Boden war mit einem weichen Teppich belegt. Links fand Gilbert eine Tür offen, durch die er in ein prachtvolles Gemach gelangte. Hier hing ein einziges Gemälde, es war eine Madonna von Raphael.
Gilbert bewunderte dieses Meisterwerk, als er eine Tür hinter sich aufgehen hörte. Er sah sich um und erkannte Cagliostro, der sich in einem Nebenzimmer umgekleidet hatte.
Er war jetzt nicht mehr der Handwerker mit den geschwärzten Händen, den mit Kot bedeckten Schuhen und dem groben, schmutzigen Hemd. Mit freundlichem, offenem Blick trat er näher und breitete die Arme aus.
Gilbert eilte auf ihn zu und drückte ihn innig an seine Brust.
»Teurer Meister!« sagte er.
»Oh! lieber Gilbert,« erwiderte Cagliostro lachend, »Sie haben seit unserer Trennung so gute Fortschritte gemacht, zumal in der Philosophie, daß Sie jetzt der Meister sind, und ich kaum würdig bin, Ihr Schüler zu sein.«
»Ich danke für das Kompliment,« sagte Gilbert, »aber angenommen, ich hätte solche Fortschritte gemacht, wie können Sie es wissen? Es sind acht Jahre her, daß wir uns nicht mehr gesehen haben.«
»Sie zweifeln also noch immer an meiner Seherkraft? Dann will ich Sie eines besseren belehren. Sie kamen gewisser Familienangelegenheiten wegen zum ersten Male wieder nach Frankreich. Es handelte sich um die Erziehung Ihres Sohnes Sebastian: Sie brachten ihn in eine kleine Stadt und besuchten zugleich Ihren Pächter, einen braven Mann mit Namen Billot, den Sie gegen seinen Willen in Paris zurückhalten. Sie kamen zum zweiten Male nach Frankreich zurück, weil Sie, gleich vielen andern, an den politischen Angelegenheiten teilnehmen wollten. Unglücklicherweise hatten Sie eine gewisse alte Geschichte ganz vergessen. Diese Geschichte betraf Mademoiselle Andrea de Favernay, nachmalige Gräfin von Charny. Da die Königin der Dame, die den Grafen von Charny geheiratet hatte, nichts abschlagen konnte,so verlangte und erhielt sie einen Verhaftsbefehl, infolgedessen Sie in die Bastille gebracht wurden. Dort würden Sie noch heute sitzen, lieber Doktor, wenn das Volk Sie nicht befreit hätte. Als guter Royalist begaben Sie sich sogleich zum König, dessen Leibarzt Sie geworden sind. Gestern oder vielmehr heute früh haben Sie zur Rettung der königlichen Familie sehr viel beigetragen; Sie weckten den braven Lafayette, der den Schlaf des Gerechten schlief, und vorhin, als Sie mich sahen, schickten Sie sich an, Ihre Souveränin – die, beiläufig gesagt, Ihre Todfeindin ist, gegen jede Gefahr zu schützen. Ist es nicht so?«
»Ja, es ist so,« sagte er, »und Sie sind immer der Zauberer Cagliostro.«
Cagliostro lächelte. »Ich habe es gemacht wie Sie«, erwiderte er; »ich habe Könige, viele Könige gesehen, aber in anderer Absicht; Sie nähern sich ihnen, um ihnen beizustehen, ich nähere mich ihnen, um sie zu stürzen. Sie versuchen, einen konstitutionellen König an die Spitze der Nation zu stellen, und es wird Ihnen nicht gelingen, ich mache Kaiser, Könige, Fürsten zu Philosophen, und das gelingt mir.«
»Wirklich?« sagte Gilbert zweifelnd.
»Jawohl. Der liebe König Friedrich, den wir leider verloren haben, war mit einem guten Beispiel vorangegangen. Da ist vor allen der König Joseph II., der Bruder unserer vielgeliebten Königin, der drei Viertel der Klöster aufhebt, die Kirchengüter einzieht, sogar die Karmeliternonnen aus ihren Zellen austreibt. Da ist der König von Dänemark, der Henker seines Leibarztes Struensee. Da ist die Kaiserin Katharina, die so große Fortschritte in der Philosophie macht, was sie jedoch nicht hinderte, Polen auseinanderzureißen. Da ist die Königin von Schweden und ... ganz Deutschland.«
»Sie haben nur noch den Papst zu bekehren,« sagte Gilbert, »und da Ihnen nichts unmöglich ist, so glaube ich, daß es Ihnen gelingen wird.«
»Oh! das wird schwer sein, ich komme soeben erst aus seinen Krallen; vor sechs Monaten saß ich in der Engelsburg, so wie Sie vor drei Monaten in der Bastille saßen.«
»Nicht möglich! Und wie sind Sie befreit worden?«
»Ich hatte Unglück, ich hatte einen unbestechlichen Kerkermeister, aber zum Glück war er nicht unsterblich; der Zufall wollte es, daß er am Tage nach der dritten Zurückweisung meines Antrags starb. Man mußte ihm einen Nachfolger geben.
Der Nachfolger war nicht unbestechlich.
Der neue Kerkermeister sagte am ersten Abend, als er mir das Nachtessen brachte: ›Laßt's Euch wohlschmecken und sammelt neue Kräfte, denn wir haben diese Nacht einen weiten Weg zu machen.‹ – Wahrhaftig, der brave Mann log nicht; in derselben Nacht ritten wir jeder drei Pferde zu Tode und legten hundert Meilen zurück.«
»Und was sagte der Gouverneur, als er Ihre Flucht bemerkte?«
»Er zog dem noch nicht beerdigten Leichnam des andern Kerkermeisters die von mir zurückgelassenen Kleider an, schoß ihm mit einem Pistol mitten durch das Gesicht, ließ das Pistol neben ihm liegen und erklärte, ich hätte mich erschossen.«
»Und darf man ohne Indiskretion fragen, wie Sie jetzt heißen?«
»Ich bin der Baron Zannoné, Bankier aus Genua; ich bin Geldgeber Monsieurs, des königlichen Prinzen ... Gutes Papier, nicht wahr? ...«
»Und warum sind Sie nach Paris gekommen?«
»Wer weiß, vielleicht gelingt es mir, in Frankreich zu gründen, was sie in Amerika gegründet haben: eine Republik.«
Gilbert schüttelte den Kopf. »Der Geist der Franzosen ist keineswegs republikanisch. Der König wird bleiben.«
»Dann machen wir keine Republik, sondern eine Revolution.«
Gilbert ließ den Kopf sinken.
»Wissen Sie, wer die Bastille zerstört hat, Gilbert?«
»Das Volk.«
»Sie verstehen mich nicht: Fünfhundert Jahre lang hat man Grafen, Fürsten und andere große Herren in die Bastille eingesperrt; da kam eines Tages ein König auf den unsinnigen Einfall, den Gedanken in eine Zelle zu sperren. Der Gedanke hat die Bastille in die Luft gesprengt, und das Volk ist durch die Bresche eingedrungen.«
»Das ist wahr«, sagte Gilbert.
»Warten Sie nur, Gilbert, das ist erst der Anfang. Hören Sie, ich war vor drei Tagen bei einem sehr verdienstvollen, menschenfreundlichen Arzt. Wissen Sie, womit er sich in diesem Augenblick beschäftigt? Er erfindet eine wirklich höchst sinnreiche Maschine, die er der Nation verehren will, und mit der man in einer Stunde fünfzig, sechzig, achtzig Menschen aus der Welt schaffen kann. Wenn sich nun ein so ausgezeichneter Arzt, ein so wohlmeinender Philanthrop, wie der Doktor Guillotin, mit einer solchen Maschine beschäftigt, ist das nicht ein Beweis, daß eine solche Maschine wirklich Bedürfnis ist? Wenn Sie die Maschine sehen wollen, lieber Gilbert, so werden Sie nächstens Gelegenheit dazu haben, man wird eine Probe damit machen. Ich werde es Ihnen sagen lassen, und wenn Sie nicht blind sind, werden Sie den Finger der Vorsehung erkennen, die wohl weiß, daß ein Augenblick kommen müsse, wo der Henker zuviel zu tun haben wird, um mit den gewöhnlichen Mitteln auszureichen.«
»Graf, Graf! in Amerika hatten Sie tröstlichere Lebensansichten.«
»Das glaube ich wohl, ich war mitten unter einem Volke, das sich erhebt, und hier befinde ich mich in einer Gesellschaft, mit der es bald zu Ende geht. In unserer veralteten Welt geht alles zu Grabe, Adel und Königtum, und dieses Grab ist ein bodenloser Abgrund.«
»Aber retten wir das Königtum, es ist das Palladium der Nation.«
»Das sind große Worte, Gilbert. Glauben Sie denn, es sei so leicht, das Königtum mit einem solchen König zu retten?«
»Aber er ist doch der Sprößling eines gewaltigen Geschlechts ...«
»Jawohl, eines Adelsgeschlechts, das mit Papageien endet! Hören Sie, Gilbert, Sie wissen, daß ich imstande bin, tausend Leiden zu ertragen, um Ihnen einen Schmerz zu ersparen. Ich will Ihnen daher einen Rat geben.«
»Reden Sie.«
»Der König muß fliehen. Der König muß Frankreich verlassen, solange es noch Zeit ist. In drei Monaten, in einem halben Jahr vielleicht wird es zu spät sein.«
»Graf,« erwiderte Gilbert, »würden Sie einem Soldaten den Rat geben, seinen Posten zu verlassen, weil das Bleiben auf demselben mit Gefahr verbunden ist?«
»Wenn der Soldat so wehrlos, umzingelt und in die Enge getrieben wäre, daß er sich nicht verteidigen könnte, wenn zumal sein Tod das Leben von Hunderttausenden in Gefahr brächte, ja, dann würde ich ihm raten, zu fliehen.«
»Graf, Sie wissen, daß ich ein Fatalist bin. Es geschehe, was da wolle; solange ich bei dem König etwas vermag, bleibt er in Frankreich, und ich bleibe bei ihm.«
»Hören Sie, es klopft jemand.«
»Wohlan, Graf, sagen Sie mir das Geschick dessen, der an diese Tür klopft, sagen Sie mir, wann und welchen Todes er sterben wird.«
»Gut,« sagte Cagliostro, »wir wollen selbst öffnen.«
Der Marquis von Favras trat ein.
Die Herren verneigten sich.
»Belieben Sie in den Salon zu gehen, Marquis«, sagte Cagliostro. »In fünf Minuten stehe ich zu Diensten.«
Der Marquis grüßte noch einmal, als er an den beiden Männern vorüberging, und verschwand.
»Nun?« fragte Gilbert.
»Sie wollen wissen, welchen Todes der Marquis sterben wird.«
»Sie haben mir ja versprochen, es zu sagen.«
Cagliostro lächelte und sah sich, um. Da niemand in der Nähe war, sagte er leise:
»Haben Sie schon einen Edelmann hängen sehen?«
»Nein.«
»Nun, da es ein seltenes, merkwürdiges Schauspiel ist, so finden Sie sich an dem Tage, wo der Marquis von Favras gehängt wird, auf dem Grèveplatz ein.«
Drittes Kapitel
Unterdessen setzten der König und die königliche Familie ihren Weg nach Paris fort.
Unterwegs hatte der kleine Prinz Hunger bekommen und zu essen verlangt. Wäre Gilbert dagewesen, so würde die Königin kein Bedenken getragen haben, ihn um ein Stück Brot für den Dauphin zu ersuchen. Aber einen Volkswehrmann mochte sie nicht anreden. Sie drückte den Dauphin an ihre Brust und sagte weinend zu ihm:
»Mein Kind, wir haben kein Brot, in Paris ist seit drei Tagen keines.«
Der arme Dauphin! Er sollte mehr als einmal, ehe er starb, vergebens um Brot bitten. Nachdem der Zug etwa eine halbe Stunde gesungen, geschrien, getanzt hatte, ertönte ein ungeheures Hurra. Wer ein geladenes Gewehr hatte, feuerte es ab; die Kinder weinten und fürchteten sich so sehr, daß ihnen der Hunger verging.
Dann ging's weiter, an den Kais hin, zum Stadthause.
Ganz in ihrer Nähe bemerkte die Königin ihren Kammerdiener Weber.
Sie rief ihn zu sich.
»Warum versuchst du mit Gewalt in das Stadthaus zu dringen?« fragte ihn die Königin.
»Um Ew. Majestät näher zu sein.«
»Im Stadthause bist du mir unnütz, Weber«, sagte die Königin; »aber anderswo kannst du mir sehr nützlich sein. In den Tuilerien, lieber Weber, in den Tuilerien! Dort erwartet uns niemand, und wenn du uns nicht vorauseilst, finden wir weder ein Bett, noch ein Zimmer, noch ein Stück Brot.«
»Das ist eine vortreffliche Idee, Madame«, sagte der König.
Marie Antoinette hatte deutsch gesprochen; der König, der wohl deutsch verstand, aber nicht sprach, antwortete in englischer Sprache.
Das Volk hörte wohl die instinktmäßig verabscheute Sprache, aber verstand sie nicht. Am den Wagen entstand ein lautes Murren, das in Gebrüll auszuarten drohte, als sich das Truppenkarree vor dem Wagen der Königin öffnete und hinter demselben wieder schloß.
Bailly erwartete den König und die Königin am Fuße eines in der Eile errichteten Throns. Er richtete einige Worte an sie, und der König antwortete ihm mit den Worten: »Ich kehre immer mit Freude und Vertrauen zu den Bewohnern meiner guten Stadt Paris zurück.«
Dann nahm das Königspaar auf dem in Eile hergerichteten Thron Platz, um die Anreden der Stadtverordneten zu hören.
Weber besichtigte unterdessen die Gemächer in den Tuilerien und wählte die von der Gräfin von Lamark bewohnten Appartements.
Gegen zehn hörte man den Wagen Ihrer Majestäten vorfahren.
Alles war zum Empfange bereit, und Weber eilte dem hohen Herrscherpaare entgegen.
Der König, die Königin, Madame Royale, der Dauphin, Madame Elisabeth und Andrea traten ein.
Der König sah sich unruhig nach allen Seiten um, als er aber in den Salon trat, bemerkte er durch eine halb offene Tür das in der Galerie aufgetragene Souper.
»Ah! Weber weiß immer Rat zu schaffen«, sagte er freudig überrascht. »Madame, sagen Sie ihm, daß ich sehr zufrieden mit ihm bin.«
Sobald die Kinder gegessen hatten, bat Marie Antoinette den König, sich in ihr Zimmer begeben zu dürfen.
»Sehr gern, Madame,« sagte der König, »denn Sie müssen ermüdet sein ...«
Die Königin verließ, ohne zu antworten, mit ihren beiden Kindern den Speisesaal. Als sie in ihrem Zimmer war, atmete sie befreit auf. Keine ihrer Frauen war ihr gefolgt; sie sah sich nach einem Sofa oder einem großen Armsessel um, denn sie wollte die beiden Kinder in ihr Bett legen. Der kleine Dauphin schlief schon. Kaum hatte der arme Knabe seinen Hunger gestillt, war er eingeschlafen.
Madame Royale war noch wach, und wenn es hätte sein müssen, würde sie die ganze Nacht nicht geschlafen haben.
Die Königin trat an eine Tür; sie wollte öffnen, aber ein leises Geräusch im Nebenzimmer hielt sie zurück; sie horchte und hörte einen Seufzer; sie sah durch das Schlüsselloch die Gräfin von Charny, die auf einer Fußbank kniete und betete.
Dieser Tür gegenüber war eine andere. Die Königin öffnete sie, und befand sich in einem behaglich warmen und von einer Nachtlampe beleuchteten Zimmer. Zu ihrer freudigen Überraschung bemerkte sie zwei schneeweiße, frisch überzogene Betten; hier legte sie ihre beiden Kinder schlafen und ging in ihr Zimmer zurück.
Vier Wachskerzen brannten auf dem Tische, der mit einem roten Teppich belegt war.
Die Königin starrte vor sich nieder und ihr Blick faßte nichts als den roten Teppich zu ihren Füßen.
Zwei- oder dreimal schüttelte sie gedankenlos den Kopf. Der blutige Widerschein der Lichter machte einen seltsamen Eindruck auf sie; es war ihr, als ob sich ihre Augen mit Blut füllten; ihre Schläfe pochten fieberisch.
Alle Ereignisse ihres Lebens zogen wie Nebelbilder vor ihrem geistigen Auge vorüber.
Sie erinnerte sich plötzlich, daß sie einmal das Haus des Barons von Faverney besucht und daselbst den berüchtigten Cagliostro, der einen so furchtbaren Einfluß auf ihr Geschick gehabt, zum ersten Male gesehen hatte. Der Unhold hatte ihr auf ihr Bitten etwas Ungeheuerliches in einer Flasche gezeigt, eine Todesmaschine, die man noch nie gesehen hatte, und am Fuße dieser Maschine ein vom Rumpfe getrenntes Haupt, das kein anderes war, als das ihrige ... Vor ihren Augen sah sie einen roten Nebel aufsteigen.
Erstaunt bemerkte die Königin, daß es in dem Zimmer dunkler zu werden begann, sie blickte zu dem vierarmigen Kandelaber auf. Eine der vier Wachskerzen war ohne eine äußere Veranlassung erloschen.
Sie erschrak. Die Kerze rauchte noch, und dieses Erlöschen ließ sich durch nichts erklären.
Während sie den Kandelaber anstarrte, schien es ihr, als ob die der erloschenen zunächst befindliche Kerze nach und nach matter brannte; bald wurde die bisher weiße Flamme rot, und dann bläulich, flackerte plötzlich auf, wie durch einen unsichtbaren Hauch angeblasen, und erlosch endlich.
Die Königin hatte dem Erlöschen des Lichtes mit Entsetzen zugesehen, ihr Atem stockte, ihre ausgestreckten Hände näherten sich dem Kandelaber, je matter das Licht wurde; und als es endlich erlosch, sank sie in ihren Sessel zurück. So saß sie etwa zehn Minuten mit geschlossenen Augen, und als sie sie wieder aufschlug, bemerkte sie zu ihrem Schrecken, daß auch die dritte Kerze matter zu brennen begann, wie es mit den beiden ersten der Fall gewesen war.
Marie Antoinette glaubte anfangs, es sei ein Traumgesicht, sie versuchte aufzustehen, aber es war ihr, als ob sie an den Sessel festgebannt wäre; sie machte einen Versuch, die Prinzessin zu rufen, aber die Stimme erstarb ihr im Munde. Sie suchte den Kopf zu drehen, aber ihr Kopf blieb starr und unbeweglich, als ob das dritte erlöschende Licht ihren Blick und ihren Atem in sich gesogen hätte. Endlich veränderte auch das dritte, wie zuvor das zweite, mehrmals die Farbe, flackerte auf, schwankte hin und her und erlosch.
»Das Erlöschen der drei Kerzen«, sagte die Königin laut, »soll mich nicht kümmern, aber wehe mir, wenn auch die vierte erlischt, wie die andern!«
Kaum hatte sie diese Worte gesprochen, so erlosch das vierte Licht, ohne daß es die Farbe wechselte, ohne daß es aufflackerte und schwankte, als ob der Tod die Kerze mit seinem Flügel berührt hätte.
Die Königin schrie vor Entsetzen laut auf; sie sprang auf, drehte sich zweimal im Kreise, streckte die Arme aus und sank ohnmächtig nieder.
In dem Augenblicke, als sie zu Boden fiel, ging die Tür des Nebenzimmers auf, und Andrea im weiten weißen Nachtgewande erschien auf der Schwelle.
Sie bettete den Kopf der Königin in ihren Schoß, und nach vielen Mühen gelang es ihr, diese aus ihrer tiefen Ohnmacht zu befreien.
»Die Gräfin von Charny!« rief Marie Antoinette und ließ Andrea schnell los; es war fast, als ob sie sie zurückstieße.
Weder diese Bewegung, noch das Gefühl, das sie hervorgerufen, entging der Gräfin. Aber im ersten Augenblicke blieb sie unbeweglich. Dann trat sie einen Schritt zurück.
»Befehlen Eure Majestät, daß ich Ihnen beim Auskleiden helfe?« fragte sie.
»Nein, Gräfin, ich danke«, antwortete die Königin mit bewegter Stimme. »Ich werde mich allein auskleiden, gehen Sie in Ihr Zimmer, Sie werden müde sein.«
»Ich will in mein Zimmer gehen,« antwortete Andrea, »aber nicht, um zu schlafen, sondern um über den Schlaf Euer Majestät zu wachen.«
Sie verneigte sich ehrerbietig vor der Königin und entfernte sich mit langsamen, feierlichen Schritten.
Viertes Kapitel
An demselben Abend, wo sich dies zutrug, war die Lehranstalt des Abbé Fortier durch ein nicht minder bedeutendes Ereignis in Schrecken gesetzt worden.
Sebastian, der Sohn des Grafen Gilbert, war gegen sechs Uhr abends verschwunden, und trotz der sorgfältigsten Nachforschungen hatte man ihn bis Mitternacht nicht wiederfinden können.
Er hatte sich nach Haramont aufgemacht, um seinen Freund Pitou aufzusuchen, der mit ihm zusammen bei dem Abbé Fortier erzogen worden war.
Wir erinnern uns,daß Ange Pitou nach dem Gelage, das die Nationalgarde von Haramont sich selbst zu Ehren veranstaltet hatte, seiner Freundin Katharina nachgeeilt war; diese war nach dem Abschied von ihrem Geliebten, Isidor von Charny, auf dem Wege von Villers-Cotterets nach Pisseleux ohnmächtig zusammengebrochen.
Sebastian Gilbert, der davon nichts wußte, begab sich geradeswegs zu Pitous Hütte; da er aber seinen Freund nicht antraf, schrieb er ihm folgende Zeilen:
»Mein lieber Pitou!
Wie ich höre, ist das Volk nach Versailles gezogen und hat viele Menschen getötet, unter andern Georges von Charny. Ich habe große Angst um meinen Vater, der ein Feind der Aristokraten ist. Nun bin ich hier, um dich zu bitten, mich nach Paris zu begleiten. Ich zweifle durchaus nicht an deiner Bereitwilligkeit, gehe aber schon vor, da ich dich nicht antraf.
Beruhige den Abbé Fortier über mein Verschwinden, aber erst morgen, damit er mich nicht verfolgen kann.
Dein Sebastian.
Wir würden die Unwahrheit sagen, wenn wir behaupten wollten, Sebastian Gilbert sei ganz ruhig und unbefangen gewesen, als er in der Nacht eine so lange Reise unternahm; aber er hatte sein fünfzehntes Jahr beinahe vollendet, und ein Knabe von Sebastians Temperament, der Sohn Gilberts und Andreas, ist fast zum Manne gereift.
Sebastian nahm also, fest entschlossen, seinen Plan auszuführen, den Weg nach Largny. Bald aber teilte sich der Weg; nach welcher Richtung sollte er sich wenden? Er setzte sich auf die Böschung des Chausseegrabens nieder, um zu überlegen. Nach einer Weile glaubte er aus der Richtung von Villers-Cotterets ferne Hufschläge zu hören.
Er trat auf die Heerstraße, um die Reiter anzuhalten und zu befragen. Bald sah er die dunklen Umrisse der letzteren und die Funken, die die Hufeisen der Pferde aus den Steinen schlugen. Es waren zwei Reiter, von denen der eine etwa vier Schritte vor dem andern hergaloppierte. Gilbert vermutete mit Recht, daß der erste der Herr und der zweite der Diener sei.
Aber wie groß war sein Erstaunen, als er in dem Herrn Isidor von Charny erkannte, dem er von seinen Besuchen mit Pitou bei Katharina nicht unbekannt sein konnte.
Der Vicomte nahm Sebastian auf sein Pferd, dann ging's im Galopp weiter, und die beiden Pferde mit den drei Reitern verschwanden bald jenseits der Anhöhe von Goudreville.
Der Ritt ging bis Dammartin, dann wurde die Reise mit einer Postkutsche fortgesetzt. Erst am Nachmittag um fünf Uhr kamen sie vor den Tuilerien an.
Am Schloßtore mußten sie sich zu erkennen geben, denn Lafayette hielt alle Posten besetzt; als sich indes Isidor von Charny zu erkennen gab, wurden sie sogleich ins Haus geführt, wo sie in einem Vorzimmer Platz nehmen mußten.
Der Türsteher sollte sich zugleich nach dem Grafen von Charny und nach dem Doktor Gilbert erkundigen.
Der Knabe setzte sich auf ein Sofa. Isidor ging auf und ab. Nach zehn Minuten kam der Türsteher zurück. Der Graf von Charny war bei der Königin. Dem Doktor Gilbert war kein Unglück begegnet; man vermutete sogar, er befinde sich beim Könige; der König habe sich mit seinem Leibarzt eingeschlossen.
In diesem Augenblicke ging die Tür auf:
»Herr Vicomte von Charny! Man erwartet den Herrn Vicomte in den Zimmern der Königin.«
Isidor folgte dem Türsteher, Sebastian setzte sich wieder auf das Sofa. Seine Gedanken schweiften zu dem Abbé Fortier, zu Pitou, und er dachte an die Unruhe, die dem einen seine Flucht, dem andern sein Brief verursachen würde. Die Erinnerung an Pitou rief ihm den heimatlichen Wald ins Gedächtnis, und er dachte an die weibliche Gestalt, die er so oft im Traume, und nur einmal, wie er wenigstens glaubte, in Wirklichkeit gesehen hatte; jener Spaziergang im Walde von Sartory fiel ihm ein, wo die schöne Frau an ihm vorüberging, und dann in einer prächtigen, mit zwei feurigen Rossen bespannten Kutsche hinter den Bäumen verschwand.
Er erinnerte sich an den tiefen Eindruck, den diese Erscheinung auf ihn gemacht, und in diesen Traum versunken flüsterte er:
»Mutter! Mutter!«
Plötzlich ging die Tür, die sich hinter Isidor von Charny geschlossen hatte, wieder auf, und dieses Mal erschien eine Dame. Die Erscheinung stimmte mit dem, was in seiner Seele vorging, so vollkommen überein, daß er seinen Traum verwirklicht glaubte. Sebastian war in der lebhaftesten Spannung.
Aber seine Aufregung stieg aufs höchste, als er in der Eintretenden zugleich das Traumgesicht und die Wirklichkeit sah. – Es war das Ideal seiner Träume, es war die Dame, die er im Walde von Sartory gesehen hatte.
Er sprang auf, als ob er durch eine Feder emporgeschnellt würde. Seine Lippen taten sich auf, seine Augen erweiterten sich; er versuchte umsonst, einen Laut hervorzubringen.
Die Dame ging mit stolzer, majestätischer Haltung vorüber, ohne ihn zu beachten.
Wie ruhig und kalt auch ihre Haltung war, so ließ sie doch an ihren zusammengezogenen Augenbrauen, an ihrer blassen Gesichtsfarbe, an ihren heftigen Atemzügen erkennen, daß sie sich in einer großen Aufregung befand.
Sie ging durch den ganzen Saal, öffnete die Tür am entgegengesetzten Ende desselben, und verschwand im Korridor.
Sebastian eilte so schnell nach, als er konnte, und kaum hatte sie den unteren Stock erreicht, so erschien Sebastian ebenfalls und rief: »Madame, Madame!«
Die junge Dame eilte in den Hof. Dort erwartete sie ein Wagen, sie stieg schnell ein und setzte sich, aber noch ehe die Wagentür geschlossen wurde, schlüpfte Sebastian an dem Bedienten vorüber und küßte der Flüchtigen den Saum des Gewandes.
»O Madame, Madame!« rief er mit dem Ausdrucke des tiefsten Gefühls.
Die junge Dame sah den schönen Knaben, der sie anfangs erschreckt hatte, verwundert an, und sagte mit ungewöhnlich sanfter Stimme:
»Warum laufen Sie mir denn nach, lieber Kleiner? Was wollen Sie von mir?«
»Ich will Sie sehen«, erwiderte der Knabe. »Ich will Sie recht oft sehen und Sie küssen.« Dann setzte er leise hinzu: »Ich will Sie Mutter nennen!«
Die junge Dame schrie laut auf, nahm den Kopf des Knaben in beide Hände, zog ihn an sich und drückte einen langen Kuß auf seine Stirn.
Dann lehnte sie sich zurück, und als ob sie gefürchtet hätte, daß ihr jemand den Knaben rauben werde, zog sie ihn ganz in den Wagen, schob ihn auf die andere Seite und zog selbst die Wagentür zu.
»Nach meiner Wohnung!« sagte sie, das Fenster niederlassend und sogleich wieder aufziehend: »Rue Coq-Héron Nr. 9, das erste Haustor von der Rue de la Plâtrière.«
Dann sagte sie zu dem Knaben:
»Dein Name?«
»Sebastian.«
»O komm, Sebastian, an mein Herz!«
Der Weg war nur ein einziger langer Kuß zwischen Mutter und Sohn. Diesen Knaben, denn ihr Herz hatte keinen Augenblick gezweifelt, daß er es sei, diesen Knaben, der ihr in einer entsetzlichen, angstvollen Nacht geraubt worden war, sie hatte ihn wiedergefunden; er erkennt sie wunderbarerweise, eilt ihr nach, verfolgt sie, nennt sie Mutter; ohne sie jemals gesehen zu haben, liebt er sie zärtlich, so wie sie ihm ihr Mutterherz öffnet, und ihr Mund, den nie fremde Lippen berührt haben, findet alle Freuden ihres verlorenen Lebens wieder in dem ersten Kusse, den sie ihrem Kinde gibt!
Es schlug sechs, als sich das Haustor auf den Ruf des Kutschers auftat, und der Wagen vor der Tür des Pavillons anhielt.
Andrea wartete nicht einmal, bis der Kutscher vom Bocke stieg, sie öffnete die Wagentür, sprang zuerst auf die erste Stufe der Außentreppe und zog Sebastian mit sich fort. Nachdem sie die Tür des Vorzimmers sorgfältig hinter sich abgeschlossen hatte, eilte sie in ihren Salon, wo sie Sebastian auf ein Sofa zog.
»O mein Kind, mein liebes Kind!« sagte sie in überschwenglicher Freude, in der noch ein leiser Zweifel bebte, »bist du es denn wirklich?«
»Mutter!« antwortete Gilbert mit einer Gefühlsinnigkeit, die wie erfrischender Tau das ungestüm pochende Herz Andreas durchdrang.
»Und hier! hier!« rief sie, indem sie sich umsah, in demselben Salon, wo sie Sebastian geboren hatte, und mit Entsetzen nach dem Zimmer hinblickte, wo er ihr entrissen worden war.
»Hier?« wiederholte Sebastian. »Was meinen Sie damit, Mutter?«
»Ich meine damit, mein Kind, daß es bald fünfzehn Jahre sind, als du in diesem Zimmer geboren wurdest, und daß ich der Gnade des Allmächtigen danke, der uns nach fünfzehn Jahren so wunderbar wieder zusammengeführt hat.«
»Wir haben uns nun wiedergefunden,« sagte der Knabe, »und du freust dich so darüber. Wir werden uns doch nicht mehr verlassen, nicht wahr?« Andrea war betroffen. »Mein armes Kind,« seufzte sie, »wie glücklich würdest du mich machen, wenn du das fertig brächtest.«
»Höre,« sagte Sebastian, »ich werde es schon machen. Die Gründe, die dich von meinem Vater getrennt haben, kenne ich nicht ...«
Andrea erblaßte.
»Aber wie wichtig diese auch sein mögen, so werden sie doch vor meinen Bitten, und wenn es sein muß, vor meinen Tränen verschwinden.«
»Nein ... nie!« sagte Andrea.
»Höre,« erwiderte Sebastian, »mein Vater ist mir von Herzen gut ...«
Andrea ließ die Hände des Knaben los, er schien es nicht zu beachten, und vielleicht bemerkte er es gar nicht. Er fuhr fort:
»Ich will ihn auf ein Zusammentreffen mit dir vorbereiten, ich will ihm sagen: Da ist sie; sieh nur, Vater, wie schön sie ist!«
Andrea stieß den Knaben von sich und stand auf.
Sebastian sah sie an; sie war so blaß, daß er sich vor ihr fürchtete.
»Nein, nie!« wiederholte sie.
»Und warum«, stammelte er, »willst du meinen Vater nicht sehen?«
»Ich will es dir sagen«, antwortete Andrea, die ihren Groll nicht länger zurückzuhalten vermochte; »weil dein Vater ein elender, schändlicher Mensch ist!«
Sebastian sprang vom Sofa auf und trat vor die Gräfin hin.
»Von meinem Vater sagen Sie das, Madame?« rief er, »von meinem Vater? Von dem Doktor Gilbert, der mich erzogen hat! Das sagen Sie von dem Manne, dem ich alles verdanke, den ich liebe und verehre! Ich habe mich geirrt, Madame, Sie sind meine Mutter nicht.« In diesem Augenblicke wurde das Haustor geöffnet, und ein Wagen rollte in den Hof.
Andrea war so erschrocken, daß dem Knaben ebenfalls ganz bange wurde. Der Graf von Charny war gemeldet worden.
»Geschwind in jenes Zimmer, Sebastian!« sagte Andrea in der größten Hast; »er darf dich nicht sehen, er darf nicht wissen, daß du auf der Welt bist.«
Sie schob den ganz bestürzten Knaben in das Nebenzimmer.
Dann schloß sie die Tür hinter ihm.
»Ich lasse den Herrn Grafen von Charny bitten, hereinzukommen«, sagte sie mit möglichster Fassung.
Der Graf von Charny war schwarz gekleidet, er trauerte um seinen vor zwei Tagen gefallenen Bruder.
Zum ersten Male nach ihrer Vermählung waren der Graf und die Gräfin allein.
»Verzeihen Sie,« sagte der Graf, »wenn meine unerwartete Gegenwart Ihnen lästig ist. Der Wagen hält vor der Tür, und ich werde mich entfernen, wenn ...«
»Nein, Graf,« fiel ihm Andrea ins Wort, »im Gegenteil, nach den schrecklichen Ereignissen freut es mich sehr, Sie zu sehen.«
»Sie waren also so gütig, sich nach mir zu erkundigen, Gräfin?« fragte Charny.
»Allerdings, man antwortete mir, Sie wären bei der Königin.«
Waren diese letzten Worte ganz harmlos, oder enthielten sie einen Vorwurf?
Andrea konnte ihre Eifersucht auf die Königin nicht verbergen. Charny, der sich wegen seines unangemeldeten Besuches entschuldigen zu müssen glaubte, sagte:
»Ich komme auf Befehl des Königs, der mir aufgetragen hat, nach Ihnen zu sehen. Erst durch die teilnehmenden Fragen des Königs habe ich erfahren, daß Sie vor kurzem die Tuilerien verlassen haben, wie man annimmt, nach einem Zwischenfall zwischen Ihnen und der Königin. Ich kannte Ihre frühere Wohnung hier in der Rue Coq-Héron, und so suchte ich Sie hier.« Bei diesen Worten schaute er Andrea mit großen Augen an: »Bin ich Ihnen willkommen?« »Können Sie daran zweifeln, Graf?« sagte Andrea, die schnell aufstand und ihrem Gemahl beide Hände reichte. Charny faßte beide Hände und zog sie an seine Lippen. Andrea schrak zusammen, als ob glühendes Eisen sie berührt hätte, und sank auf das Sofa zurück. Aber da ihre krampfhaft zusammengezogenen Hände den Grafen festhielten, so zog sie ihn im Zurücksinken mit sich, und Charny saß an ihrer Seite. In diesem Augenblicke hörte Andrea ein Geräusch im Nebenzimmer und entfernte sich so hastig, daß der Graf ebenfalls aufstand und sie verwundert ansah. Charny stand, auf die Rücklehne des Sofas gestützt, der Gräfin gegenüber und seufzte. Andrea drückte beide Hände vor das Gesicht. Was in diesem Augenblicke in ihrem Herzen vorging, ist unmöglich zu beschreiben. Sie war seit vier Jahren mit einem Manne vermählt, den sie unendlich liebte, ohne daß dieser Mann, dessen Neigung der Königin zugewandt war, die mindeste Ahnung gehabt hatte von dem großen Opfer, das sie durch diese Vermählung gebracht hatte. Sie hatte unter Verleugnung ihrer doppelten Pflicht als Gattin und Untertanin alles gesehen, alles ertragen, über alles das tiefste Schweigen beobachtet. Endlich hatte sie aus einigen zärtlichen Blicken ihres Gemahls, aus einigen härteren Worten der Königin geschlossen, daß ihre Aufopferung nicht ganz fruchtlos war. In den letzten schrecklichen, angstvollen Tagen war Andrea unter den bestürzten Hofleuten vielleicht die einzige gewesen, die ein freudiges Gefühl aufbrachte; es war, wenn ein Blick Charnys seine Besorgnis um sie an den Tag zu legen schien, wenn er sie mit Sehnsucht aufsuchte. Ein leiser Händedruck ließ ein bisher ungeahntes Gefühl in ihnen aufsteigen und rief einen gemeinsamen Gedanken in ihnen hervor.
Als nun das arme verlassene Wesen eben das ihr so lange entrissene Kind wiedergefunden hatte, ging an ihrem so düsteren Horizont plötzlich eine Morgenröte der Liebe auf; doch das Glück schien nicht für sie geschaffen, denn das eine glückliche Ereignis mußte das andere ertöten.
Charny seufzte und nahm das Gespräch wieder auf.
»Was soll ich dem Könige sagen, Gräfin?« fragte er.
Andrea erschrak, als sie seine Stimme hörte, und erwiderte:
»Ich habe so viel bei Hofe gelitten, daß ich den mir von der Königin bewilligten Abschied mit Dank annehme; ich habe in der Einsamkeit immer die Ruhe, wenn auch nicht das Glück gefunden. Mit Ihrer Erlaubnis, Graf, werde ich diesen Pavillon bewohnen, an den sich für mich wohl schmerzliche, aber auch süße Erinnerungen knüpfen.«
Diese Erlaubnis erteilte Charny mit einer artigen Verbeugung:
»Es ist also Ihr fester Entschluß, Gräfin?« sagte er.
»Ja, Graf«, antwortete Andrea sanft, aber entschieden.
»Jetzt habe ich nur noch eine Frage zu stellen,« sagte Charny, »darf ich Sie hier besuchen?«
Andrea sah ihn an; ihr sonst so ruhiges, leidenschaftloses Auge nahm einen lebhafteren Ausdruck an.
»Allerdings, Graf«, erwiderte sie; »ich werde ganz zurückgezogen leben, und ich werde Ihnen jederzeit dankbar sein, wenn Sie mir Ihre freien Augenblicke widmen.«
»Haben Sie wenigstens alles, was Sie brauchen?«
»Ich werde hier alles finden, was ich vormals hatte.«
»Lassen Sie doch sehen«, sagte Charny, der sich einen Begriff von der künftigen Wohnung seiner Gemahlin machen wollte.
»Was wollen Sie sehen, Graf?« fragte Andrea, die hastig aufstand und einen Blick auf das Schlafzimmer warf.
»Aber wenn Sie nicht gar zu bescheiden in Ihren Wünschen sind, Gräfin, so ist dieser Pavillon eigentlich keine Wohnung. Ich bin durch ein Vorzimmer gekommen, hier bin ich im Salon. Diese Tür«, und er öffnete eine Seitentür, »führt in einen Speisesaal, und diese?«
Andrea trat schnell zwischen den Grafen und die Tür, auf die er zuging, und hinter der sie in Gedanken Sebastian stehen sah.
»Graf,« sagte sie, »ich bitte Sie, keinen Schritt weiter!«
»Ja, ich verstehe,« sagte Charny, »diese Tür führt in Ihr Schlafzimmer.«
»Ja, Graf«, stammelte Andrea kaum vernehmbar.
Charny sah die Gräfin an, sie war blaß und zitterte; der Schrecken sprach deutlich aus ihren Gesichtszügen.
»Oh! Ich wußte wohl, daß Sie mich nicht lieben«, sagte er tief bewegt; »aber ich wußte nicht, daß Sie mich hassen.«
Er schien nicht imstande zu sein, länger bei Andrea zu bleiben, ohne seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen; er wankte wie ein Betrunkener, und alle seine Kräfte sammelnd, stürzte er mit einem Schmerzensruf, der tief in Andreas Herz drang, zum Zimmer hinaus.
Andrea folgte ihm mit den Augen, bis er verschwunden war; sie lauschte, der Wagen rollte davon; sie war in einem unbeschreiblichen Gemütszustände; sie fühlte, daß sie ihrer ganzen Mutterliebe bedurfte, um die andere Liebe zu bekämpfen. Noch einen Augenblick lauschte sie, es war alles ruhig, dann riß sie die Tür des Schlafzimmers auf und rief:
»Sebastian! Sebastian!«
Aber niemand antwortete ihr, und vergebens erwartete sie ein tröstendes Echo auf diesen Angstruf.
»Sebastian, Sebastian!« Keine Antwort.
Erst jetzt bemerkte sie, daß das Fenster offen war, und daß der Wind das Nachtlicht hin und her trieb.
Es war dasselbe Fenster, das man bereits vor fünfzehn Jahren offen gefunden hatte, als das Kind zum ersten Male verschwunden war.
»Oh! Ich hätte es mir denken können«, stammelte sie; »er sagte ja, daß ich seine Mutter nicht sei!«
So hatte sie denn alles verloren, ihr Kind und ihren Gatten, und in dem Augenblicke, als sie alles wiederzufinden glaubte! Erschöpft und halb bewußtlos warf sie sich auf das Bett. Sie hatte keine Willenskraft, sie hatte keine Gebete mehr, sie konnte nur klagen und weinen und schluchzen.
Plötzlich schien es ihr, als ob sich noch etwas Schrecklicheres zwischen diesen ihren Schmerz und ihre Tränen drängte; sie richtete sich langsam auf; ihr ganzer Körper bog sich, wie unter dem Einfluß einer unsichtbaren Gewalt, ihre Augen glaubten durch den feuchten Nebel ihrer Tränen hindurch zu bemerken, daß sie nicht mehr allein war. Gilbert, der durch das Fenster gekommen zu sein schien, stand vor ihr.
Fünftes Kapitel
Es war wirklich der Doktor Gilbert, der in dem Augenblicke, als sich der Lakai auf Isidors Geheiß erkundigt hatte, bei dem Könige war.
Als er von der Audienz zurückkam, traf er mit dem Vicomte von Charny zusammen, der ihn zu dem Vorzimmer führte, in dem Sebastian gewartet hatte. Aber Sebastian war nicht mehr da. In großer Sorge eilten Doktor Gilbert und der Vicomte durch die Gänge nach dem Ausgang, wo sie erfuhren, daß Sebastian mit einer Dame nach der Rue Coq-Héron Nr. 9 gefahren sei. Nun wußte Gilbert, daß sein Sohn seine Mutter gefunden hatte. Er verabschiedete den Vicomte und eilte nach dem Hause Andreas.
Mit den Verhältnissen noch genau vertraut, näherte er sich ihrem Schlafzimmerfenster und sah auf dem Bette eine regungslose weibliche Gestalt liegen, aus deren Munde leise Klagetöne kamen, die von Zeit zu Zeit durch einen lauten Angstruf unterbrochen wurden.
Gilbert näherte sich langsam, als er nahe genug stand, zweifelte er nicht mehr, es war Andrea, und sie war allein. – Aber wie kam es, daß sie allein war, und warum weinte sie? Das konnte Gilbert nur durch eine Unterredung mit ihr erfahren.
Er stieg leise und vorsichtig durchs Fenster, und stand hinter ihr in dem Augenblicke, wo die magnetische Anziehungskraft, für die sie so empfindlich war, sie zwang, sich umzudrehen.
Die beiden Feinde trafen also wieder zusammen.
Das erste Gefühl der Gräfin war eine unüberwindliche Abneigung.
Gilbert hingegen fühlte für Andrea nicht mehr jene glühende Liebe, die den Jüngling einst zu seiner verbrecherischen Tat getrieben,wohl aber jene zarte, innige Teilnahme, die den Mann bewogen haben würde, ihr selbst unter Lebensgefahr einen Dienst zu erweisen.
»Was wollen Sie von mir?« sagte Andrea.
»Was ich will? Ich will, daß Sie mir sagen, wo mein Sohn ist, den Sie in Ihrem Wagen hierhergebracht haben.«
»Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, er ist vor mir geflohen, Sie haben ihn ja daran gewöhnt, seine Mutter zu hassen.« »Seine Mutter, Gräfin! ... Sind Sie wirklich seine Mutter?«
»O mein Gott!« rief Andrea, »er ist Zeuge meiner Verzweiflung gewesen, und fragt mich, ob ich seine Mutter bin!«
»Sie wissen also nicht, wo er ist?«
»Ich sage Ihnen ja, daß er entflohen ist, daß er in diesem Zimmer war, daß ich ihn hier wiederzufinden glaubte, und daß ich dieses Fenster offen und das Zimmer leer fand.«
»O mein Gott!« rief Gilbert. »Wohin kann er sich gewandt haben? Der arme Knabe kennt Paris nicht, und Mitternacht ist vorüber!«
»Glauben Sie,« sagte Andrea, die diesen Gedanken aufgriff, »daß ihm ein Unglück begegnet ist?«
»Das will ich eben wissen,« erwiderte Gilbert, »und das sollen Sie mir sagen.«
Und damit streckte er Andrea die Hand hin.
Diese murmelte den Namen Sebastians und sank mit einem leisen Klagelaut auf einen Sessel.
»Schlafen Sie«, sagte Eilbert; »aber im Schlafe sehen Sie mit dem Herzen.«
»Ich schlafe«, sagte Andrea.
»Wohin haben Sie Sebastian geführt?«
»In den Salon hier neben diesem Zimmer.«
»Warum hat er Sie verlassen?«
»Weil ein Wagen vorfuhr.«
»Wer war in dem Wagen?«
Andrea zögerte.
»Wer war in dem Wagen?« wiederholte Gilbert mit festerem Ton und stärkerem Willen.
»Der Graf von Charny.«
»Wo haben Sie den Knaben versteckt?« »Ich schob ihn in dieses Zimmer.«
»Was sagte er, als er hier eintrat?« »Ich sei nicht mehr seine Mutter.«
»Warum hat er das gesagt?«
»Weil ich zu ihm sagte,« wiederholte Andrea mit großer Selbstüberwindung, »daß Sie ein elender, schändlicher Mensch sind.«
»Hat der Graf von Charny geahnt, daß der Knabe hier war?«
»Nein.«
»Warum ist er denn nicht geblieben?«
»Weil der Graf nie bei mir bleibt.«
»Was wollte er denn hier?«
»O mein Gott! mein Gott! Olivier, lieber Olivier!«
Gilbert sah sie erstaunt an.
»Oh, ich Unglückliche!« klagte Andrea. »Er fing an, sich mir zuzuwenden, er liebt mich, er liebt mich! ...«
Gilbert tat zum ersten Male einen Blick in dieses furchtbare Familiendrama.
»Und Sie,« fragte er, »lieben Sie ihn?«
»Seit dem Augenblick, wo ich ihn zum ersten Male sah.«
»Sie wissen also, was Liebe ist, Andrea?« fragte Gilbert traurig.
»Ich weiß,« antwortete die junge Gräfin, »daß die Liebe dem Menschen gegeben ist, damit er wisse, wieviel er leiden kann.«
»Kehren wir wieder zu Sebastian zurück.«
»Gattin, vergiß deinen Gatten; Mutter, denke nur an dein Kind!«
»Wo war Sebastian, während Sie mit dem Grafen von Charny sprachen?«
»Er lauschte ... da, da, an der Tür.«
»In welchem Augenblick hat er dieses Zimmer verlassen?«
»In dem Augenblick, als der Graf mir die Hand küßte und ich erschrocken aufschrie.«
»Sehen Sie ihn?«
»Ich sehe ihn«, sagte Andrea. »Er sieht sich nach einer Tür um, und da er keine findet, springt er aus dem Fenster und verschwindet.«
»Folgen Sie ihm in der Dunkelheit.«
»Er eilt der Rue Plâtrière zu ...; er spricht mit einer Frau, die ihm begegnet.«
»Wonach fragt er sie?«
»Er fragt nach der Rue Saint-Honoré.«
»Ja; dort wohne ich. Er wird mich erwarten ...«
»Nein,« sagte Andrea unruhig, »nein, er ist nicht da, er wartet nicht.«
»Wo ist er denn?«
»Er findet die Rue Saint-Honoré ... ei läuft über den Platz des Palais Royal ... er eilt weiter ... in der Rue des Frondeurs ... Halt, armes Kind! Sebastian! Sebastian! siehst du denn den Wagen nicht, der aus der Rue de la Sourdière kommt? Ich sehe ihn ... die Pferde ... Ach! ...«
Andrea schrie laut auf. »Gott sei gelobt!« rief sie nach einer Pause. »Das Pferd hat ihn auf die Seite geworfen ... da liegt er bewußtlos auf der Straße, aber er ist nicht tot ... er ist nur ohnmächtig ... Hilfe! Hilfe! ... Es ist mein Kind!«
Andrea sank, selbst fast ohnmächtig, in den Armsessel zurück.
»Weiter«, sagte Gilbert.
»Warten Sie!« erwiderte Andrea. »Es ist mein Sohn, es ist mein Sebastian! ... Oh, mein Gott! Die Menge macht Platz,– es ist gewiß der Mann, den man gerufen.«
»Was ist denn?« fragte Gilbert.
»Ich will nicht, daß der Mann mein Kind anrühre!« rief Andrea.
»Was macht der fremde Mann?«
»Er trägt ihn fort ... er wendet sich links in das Seitengäßchen, geht auf eine angelehnte Tür zu, geht eine Treppe hinunter und legt ihn auf den Tisch. Er zieht ihm den Rock aus, öffnet ein Besteck und nimmt eine Lanzette heraus; er will ihm eine Ader öffnen ... Nein, ich will es nicht sehen, ich will das Blut meines Sohnes nicht sehen!«
»Sehen Sie die Tür genau an und sagen Sie mir, ob etwas Auffallendes daran ist.«
»Ja, ein kleines viereckiges Fenster, mit kreuzweise zusammengefügten Eisenstäben.«
»Gut, mehr brauche ich nicht zu wissen.«
»Eilen Sie, laufen Sie! ... Sie werden ihn finden, wo ich gesagt habe.«
»Wollen Sie sogleich erwachen und sich an alles erinnern?«
»Wecken Sie mich sogleich; ich will alles im Gedächtnis behalten.«
Gilbert strich mit beiden Daumen über die Augenbrauen der Gräfin, hauchte ihr auf die Stirn und sprach die beiden Worte:
»Erwachen Sie!«
Dann eilte er in der vorgezeichneten Richtung davon und fand Sebastian in einer Kellerwohnung, wo er in einem dunklen Winkel auf einem armseligen Ruhebett lag.
Als sich Vater und Sohn mit einer langen, zärtlichen Umarmung begrüßt hatten, wandte sich Gilbert zu dem Gastfreunde Sebastians.
»Sieh, Albertine,« sagte dieser, »und danke mit mir dem Zufall, der mir erlaubt hat, einem meiner Brüder diesen Dienst zu erweisen.«
Während der Chirurg diese Worte mit einigem Pathos sprach, sah sich Gilbert um; er schrak unwillkürlich zurück; es war ihm, als ob er diesen Menschen bereits in einem furchtbaren Traum, wie durch einen blutigen Schleier, gesehen hätte.
»Mein lieber Herr,« sagte er, »empfangen Sie den aufrichtigsten, herzlichsten Dank eines Vaters, dem Sie den Sohn gerettet haben. Darf ich fragen, mit welchem Menschenfreunde ich die Ehre habe zu sprechen?«
»Sie kennen mich nicht, Kollege«, sagte der Chirurg mit einer lächerlichen Fratze, die seiner Absicht nach freilich ein wohlwollendes Lächeln sein sollte; »aber ich kenne Sie: Sie sind der Doktor Gilbert, der Freund Washingtons und Lafayettes.«
»Wenn Sie mich aber kennen, so habe ich um so mehr Ursache, meine Frage zu wiederholen, und um die Ehre Ihrer Bekanntschaft zu bitten.«
»O! wir haben schon vor langer Zeit Ihre Bekanntschaft gemacht«, erwiderte der Chirurg; »vor zwanzig Jahren, in der Nacht des 30. Mai 1770, wurden Sie verwundet, bewußtlos, dem Tode nahe, zu mir gebracht .... Mein Meister Rousseau brachte Sie, und ich öffnete Ihnen damals eine Ader.«
»Dann sind Sie Jean Paul Marat!« rief Gilbert, der unwillkürlich einen Schritt zurücktrat.
»Du siehst, Albertine,« sagte Marat, »mein Name macht Effekt.«
Er brach in ein unheimliches Gelächter aus.
»Aber warum muß ich Sie hier in diesem Keller wiederfinden?« fuhr Gilbert fort. »Ich glaubte, Sie wären Leibarzt des Grafen Artois? ...«
»Ich habe meinen Abschied genommen, ich will den Tyrannen nicht dienen.«
»Aber warum,« sagte Gilbert, »wohnen Sie denn in diesem dunklen, feuchten Keller?«
»Warum, Herr Philosoph? Weil ich ein Patriot bin, weil Bailly mich fürchtet, weil Necker mich verabscheut, weil Lafayette mir seine Nationalgarde auf den Hals hetzt, weil er einen Preis auf meinen Kopf gesetzt hat .... Aber ich lache ihn aus, diesen Lafayette, der mit der Königin konspiriert. Die Sache ist wahr, ich weiß es von der Bertin, der Putzmacherin der Königin. Und all dies bringe ich in dem vor kurzem gegründeten Journal »Der Volksfreund« an die Öffentlichkeit. Unter Aufbietung aller Energie schreibe ich den ganzen Volksfreund selbst, oft bis zu sechzehn Seiten; ich schreibe Tag und Nacht; die Polizei Lafayettes zwingt mich, verborgen zu leben, sie treibt mich zur Arbeit; es gefällt mir, die erbärmliche Welt durch das kleine düstere Fenster meines Kellers zu sehen. Von meinem unterirdischen Reiche aus beherrsche ich die Welt der Lebenden; ich bin der oberste Schiedsrichter über Wissenschaft und Politik; mit einer Hand werfe ich Newton, Franklin, Laplace, Monge, Lavoisier zu Boden; mit der andern rüttle ich an Bailly, Necker, Lafayette; ich werde alles niederreißen ... ja, wie Samson den Tempel niedergerissen hat, und unter den Trümmern, die mich selbst vielleicht zermalmen, werde ich das Königtum begraben.«
Gilbert schauderte unwillkürlich; dieser Mann sagte in einem elenden Kellerloche etwa dasselbe, was Cagliostro in einem Palast gesagt hatte.
»Nehmen Sie sich in acht!« sagte er; »für das, was Sie vorhaben, wird in Frankreich nicht genug Hanf wachsen, und die Stricke werden nicht mehr zu bezahlen sein.«
»Ich hoffe auch,« erwiderte Marat, »daß man neue und schnellere Mittel erfinden wird. Wissen Sie, wer in zehn Minuten an diese Tür klopfen wird? Ich erwarte Guillotin. Er hat eine wundervolle Maschine erfunden, eine Maschine, die tötet, ohne Schmerz zu verursachen; in diesen Tagen werden wir sie ausprobieren.«
Gilbert schauderte; es war das zweite Mal, daß dieser Mann ihn an Cagliostro erinnerte. Er nahm seinen Sohn und trug ihn auf den Armen nach Hause, wo er von dem Pächter seines Gutes in Haramont, Billot, und von Pitou erwartet wurde. Nach den Erzählungen Pitous war Billot um seine Tochter und um den Stand seiner Äcker in Sorge geraten; er war gekommen, um von Dr. Gilbert die Erlaubnis zur Heimreise zu erwirken, die ihm auch erteilt wurde. Pitou ging mit ihm in die Heimat und nahm Geld mit zur Ausrüstung der dort von ihm begründeten Nationalgarde.
Sechstes Kapitel
Nach jenem furchtbaren Zuge vom 6. Oktober warf die aufgehende Sonne ihr mattes Licht auf eine vor den Tuilerien versammelte Volksmenge, die ihren König sehen wollte.
Den ganzen Tag hindurch empfing Ludwig XVI. Abordnungen. Hin und wieder mußte er sich auf dem Balkon zeigen und wurde mit allgemeinem Jubel empfangen.
Madame Elisabeth zeigte ihrem Bruder die sich herandrängende Volksmenge und sagte zu ihm:
»Es scheint mir doch, solche Menschen müssen nicht schwer zu regieren sein.«
Jedermann erklärte die Revolution für beendet; war doch der König von seinem Versailles, von seinen Höflingen und Ratgebern befreit; der Zauber war gebrochen, der das Königtum so lange festgehalten hatte; Gott sei Dank! Die beiden populärsten Männer Frankreichs, Lafayette und Mirabeau, kamen als Royalisten nach Paris zurück.
Der Herzog von Orleans reiste auf Wunsch Lafayettes ab und kam erst zurück, als er gerufen wurde.
Der König und Elisabeth schauten mit Rührung auf das Volk, während sich in Marie Antoinette Haß und Ärger immer mehr festsetzten. Die Marktfrauen, die sie empfangen mußte, behandelte sie kalt, fast mit Verachtung.
Die Königin war innerlich zerrissen, sie litt unsäglich darunter, daß sie Charny sich entgleiten sah. – –
Gilbert, der mehrere Tage nicht beim König gewesen war, erinnerte sich, daß er Dienst habe. Er fand Ludwig XVI. vor dem Bilde Karls I., das van Dyck gemalt hatte, in Gedanken versunken; er machte eine Bewegung, Ludwig XVI. stutzte und sah sich um.
»Ach! sind Sie es, Doktor?« sagte der König, der so in Gedanken versunken war, daß er Gilbert nicht hatte eintreten hören. Dann führte er Gilbert vor das Meisterwerk und sagte:
»Kennen Sie dieses Porträt, Doktor?«
»Meinen Eure Majestät die Geschichte des Königs, den es darstellt oder die Geschichte des Bildes selbst?«
»Ich meine die Geschichte des Bildes.«
»Nein, Sire; ich weiß nur, daß es 1645 oder 1646 zu London gemalt morden ist, das ist alles, was ich sagen kann; aber ich weiß nicht, wie es nach Frankreich gekommen ist und wie es zugeht, daß es jetzt in dem Zimmer Eurer Majestät ist.«
»Es gehörte der Madame Dubarry, der Geliebten Ludwigs XV. Nachdem wir diese in die Verbannung geschickt hatten, blieb es in einer Dachstube zu Versailles hängen. Wie kommt es nun, daß ich es hier finde? Warum verfolgt es mich?«
»Doktor,« fuhr er fort, »es ist ein Zufall, und kein Verhängnis.«
»Es ist ein Verhängnis, Sire, wenn dieses Bild nichts zu Ihnen sagt, aber es ist der Finger der Vorsehung, wenn es zu Ihnen spricht.«
»Wie können Sie denken, Doktor, daß ein solches Bild zu einem König in meiner Lage nicht spreche?«
»Eure Majestät haben mir erlaubt, die Wahrheit zu sagen; darf ich mich erkühnen, zu fragen?«
Ludwig XVI. schien einen Augenblick unschlüssig.
»Fragen Sie nur, Doktor«, sagte er.
»Was sagt dieses Porträt zu Eurer Majestät?«
»Es sagt mir, daß Karl I. seinen Kopf verloren hat, weil er gegen sein Volk Krieg führte, und daß Jakob II. den Thron verloren hat, weil er sein Volk verließ.«
»Da mir Eure Majestät erlaubt haben, zu fragen, so frage ich, was Sie dem so aufrichtig sprechenden Bilde antworten?«
»Herr Gilbert,« sagte der König, »ich gebe Ihnen mein Wort, daß ich noch nichts beschlossen habe; ich werde mich nach den Umständen richten.«
»Man fürchtet, Eure Majestät beabsichtigen einen Krieg gegen Ihr Volk.«
Ludwig XVI. schüttelte den Kopf.
»Nein, Herr Gilbert,« sagte er, »ich kann nur mit Hilfe des Auslandes gegen mein Volk Krieg führen, und ich kenne die Lage von Europa zu gut, als daß ich den fremden Mächten trauen könnte. Der König von Preußen ist erbötig, mit hunderttausend Mann in Frankreich einzurücken, aber ich kenne den ehrsüchtigen Geist dieser kleinen Monarchie, die ein großes Königreich zu werden trachtet. Österreich stellt ebenfalls hunderttausend Mann zu meiner Verfügung, aber ich kann meinen Schwager Leopold nicht leiden; seine Mutter, Maria Theresia, hat meinen Vater vergiften lassen. Mein Bruder d'Artois schlägt die Hilfe Sardiniens und Spaniens vor, aber diesen beiden Mächten traue ich nicht. Die große Katharina beschränkt sich auf das Ratgeben. Sie können sich leicht denken, daß sie mit Polen genug zu tun hat. Sie gibt mir einen Rat, der lächerlich ist, zumal nach den Vorgängen dieser letzten Tage. ›Die Könige‹, sagt sie, ›müssen unbekümmert um das Geschrei des Volkes ihre Bahn wandeln, gleichwie der Mond unbekümmert um das Gebell der Hunde seine Bahn wandelt.‹«
»Das Volk fürchtet, Eure Majestät wollten fliehen, Frankreich verlassen.«
Der König legte die Hand auf Gilberts Schulter.





























