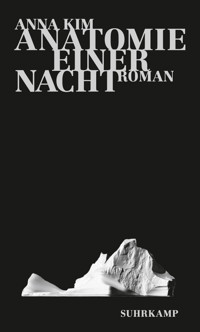11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Spionagegeschichte, politischer und historischer Roman in einem, handelt Die große Heimkehr von Freundschaft, Loyalität und Verrat, vom unmöglichen Leben in einer Diktatur. Das Buch erzählt von den Folgen der Teilung der koreanischen Halbinsel und den Anfängen des heutigen Nordkorea, als die Gewaltherrschaft Kim Il Sungs noch in den Kinderschuhen steckte. Und es stellt sich der Frage: Wem gehört Geschichte? Den Siegern, die Archive verschließen und Dokumente schwärzen? Oder dem Einzelnen, der seine Erfahrungen von Verlust und Verlorenheit an andere weitergibt, Verlierer wie er selbst?
Seoul, im April 1960. Johnny Kim, seine Geliebte Eve Moon und sein bester Freund aus Kindertagen Yunho Kang sind auf der Flucht vor der berüchtigten Nordwest-Jugend, einer antikommunistischen, paramilitärischen Schlägertruppe im Dienst der Regierung Südkoreas. Diese steht kurz vor dem Zusammenbruch, seit Wochen geht die Bevölkerung gegen den autokratischen Präsidenten Rhee auf die Straße. Gemeinsam wagen Johnny, Eve und Yunho die illegale Überfahrt nach Japan und finden Unterschlupf und Arbeit im koreanischen Viertel Osakas. Doch schon bald werden sie von ihrer Vergangenheit eingeholt: Ein Mädchen ist verschwunden, und der Verdacht fällt auf Johnny …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Seoul, im April 1960. Johnny Kim, seine Geliebte Eve Moon und sein bester Freund aus Kindertagen Yunho Kang sind auf der Flucht vor der berüchtigten Nord-West-Jugend, einer antikommunistischen, paramilitärischen Schlägertruppe im Dienst der Regierung Südkoreas. Diese steht kurz vor dem Zusammenbruch, seit Wochen geht die Bevölkerung gegen den autokratischen Präsidenten Rhee auf die Straße. Gemeinsam wagen Johnny, Eve und Yunho die illegale Überfahrt nach Japan und finden Unterschlupf und Arbeit im koreanischen Viertel Osakas. Doch schon bald werden sie von ihrer Vergangenheit eingeholt: Ein Mädchen ist verschwunden, und der Verdacht fällt auf Johnny …
Spionagegeschichte, politischer und historischer Roman in einem, handelt DIE GROSSE HEIMKEHR von Freundschaft, Loyalität und Verrat, vom unmöglichen Leben in einer Diktatur. Das Buch erzählt von den Folgen der Teilung der koreanischen Halbinsel und von den Anfängen des heutigen Nordkorea, als die Gewaltherrschaft Kim Il Sungs noch in den Kinderschuhen steckte. Und es stellt sich der Frage: Wem gehört Geschichte? Den Siegern, die Archive verschließen und Dokumente schwärzen? Oder dem Einzelnen, der seine Erfahrungen von Verlust und Verlorenheit an andere weitergibt, Verlierer wie er selbst?
Anna Kim wurde 1977 in Südkorea geboren. 1979 zog die Familie nach Deutschland und schließlich weiter nach Wien, wo die Autorin seit 1984 lebt. 2004 erschien ihr erstes Buch, DIE BILDERSPUR, im Literaturverlag Droschl. Seither veröffentlicht sie Romane und Essays, zuletzt ANATOMIE EINER NACHT (2012) im Suhrkamp Verlag. Für ihr Werk erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien, unter anderem den Literaturpreis der Europäischen Union 2012.
ANNA KIM
DIE GROSSE HEIMKEHR
Roman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4888
Erste Auflage 2017
© Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagabbildung: plainpicture/Rolau; abzee/Getty Images
eISBN 978-3-518-74853-4
www.suhrkamp.de
Die große Heimkehr
Oh, how the ghost of you clings
These foolish things they remind me of you
Holt Marvell, Harry Link, Jack Strachey,
These Foolish Things
Autrui détient un secret: le secret de ce que je suis.
Jean-Paul Sartre, L’Etre et le Néant
Meinem Vater
1
Das Licht des späten Nachmittags, noch immer durstig, ließ die Kiefern grüner, saftiger erscheinen und zog ein Schattenspiel zwischen den Mauern auf. Es war dieses Licht, an das ich mich erinnerte, ich hatte es vor vielen Jahren das erste Mal gesehen, als es die düsteren Fassaden der Altstadt zum Schimmern gebracht hatte; später hatte der Monsunregen alle Farben überdeckt und die Stadt in ein dampfendes Becken verwandelt, der Himmel war eine bleigraue Fläche, die vielen Gerüche aber, gekocht von der Hitze des Sommers und von der Nässe, waren intensiver gewesen, als ich es bisher von einem Ort gewohnt war. Doch heute und hier, im ehemaligen Viertel der amerikanischen Missionare, vor dem einzigen ebenerdigen Haus der Straße, das wie alle anderen Häuser auch von einer Mauer umgeben war, die den Blick zensierte und Teil eines Labyrinths war, das nur in Bruchstücken im alten Seoul erhalten ist, roch es modrig, weder nach Gewürzen noch nach Früchten, auf dem Gehsteig vor der braunen Hausmauer stand ein verrostetes Trockengestell mit schrumpeliger Wäsche und aus dem Hausinneren tröpfelte Musik, die maunzende Trompete, das trippelnde Klavier, der tapsende Bass und schließlich, lauter als die Begleitung, die Stimme Billie Holidays. Sie sang:
In my solitude
You taunt me
With memories
That never die
Ich hatte mir vorgenommen, auf das Ende des Liedes zu warten, die Stille zwischen den Nummern zu nutzen und an die Tür zu klopfen, als die Stimme eines Mannes aus dem Fensterspalt drang.
»Worauf warten Sie? Oder spionieren Sie mich aus? Wenn ja, sind Sie ein verdammt schlechter Spion, allerdings hoffe ich, dass Sie die Übersetzerin sind. Kommen Sie herein, wenn Sie schon da sind!«
Die letzten Sätze, gemurmelt, verstand ich nicht. Ich überlegte, ob ich nachfragen sollte, als es aus dem Inneren bellte: »So kommen Sie doch endlich, worauf warten Sie?«
Sobald ich das Haus betreten hatte, befand ich mich an einem Ort, der ausschließlich aus Musik bestand, in einer Höhle aus Geräuschen und Klängen. Erst nach geraumer Zeit wuchs ein Bild, die Umgebung füllte sich mit Farben und Details, ich erkannte Pflanzen in Töpfen, Kissen auf der Couch, Bilder an den Wänden, Figuren und Bücher in den dunklen Regalen, die das wenige Licht schluckten, ich hatte gedacht, es wären nur ein paar, tatsächlich waren es viele, sie stapelten sich sogar auf dem Boden – ich befand mich in einer Bibliothek.
Erst jetzt sah ich den Mann, der am Boden kauerte; von meinen Kollegen wurde er derArchivar genannt.
»Sie sehen aus wie eine Koreanerin«, sagte er und blickte mich aus unversiegelten Augen an. »Nicht ein bisschen wie eine Deutsche.«
Yunho Kang musterte mich im Schutz des Zwielichts, ich stand im Scheinwerfer des Fensters. »Ich bin beides«, antwortete ich.
»Habe ich das richtig verstanden, Sie wurden von einem deutschen Ehepaar adoptiert?«
»Ja.«
»Wie alt waren Sie?«
»Ich war vier Jahre alt.«
»Können Sie sich noch an Korea erinnern?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Wie sollten Sie auch. Ist dies Ihr erster Besuch hier?«
»Nein, mein zweiter.«
»Was wissen Sie über Ihre Heimat?«
Ich sah ihn ratlos an, er verbesserte sich: »Ich meine: Haben Sie die Geschichte Koreas studiert? Oder die Sprache?«
»Beides«, antwortete ich.
»Und Sie sprechen Englisch?«
»Ich habe eine Zeitlang in London gelebt.«
Er klopfte eine Zigarette aus der runzligen Packung und zündete sie an.
»Haben Sie sich über meine Anfrage gewundert?«
Ich zögerte mit meiner Antwort; ich weiß nicht, warum.
Man habe mich schon ein paar Mal gebeten zu übersetzen, sagte ich schließlich, offenbar gebe es Bedarf. Er musterte mich, dann nickte er langsam. »Sie sind sehr groß«, sagte er, »ebenso Ihre Ohren. So groß wie Mandarinen.«
Er lächelte.
»Wie lange arbeiten Sie schon für den Maryknoll-Orden?«
»Seit zwei Wochen.«
»Was sind Ihre Aufgaben?«
»Ich liefere Essen aus.«
»An Alte und Kranke?«
»Hauptsächlich an Alte und Kranke. Manchmal helfe ich auch im Büro aus.«
»Warum tun Sie das? Haben Sie keine andere Arbeit gefunden?«
»Ich habe noch gar nicht wirklich angefangen zu suchen.«
Er nickte wieder. Ob ich ihn gut verstehe oder ob er zu schnell spreche?
»Es geht«, antwortete ich.
»Es geht. Wo haben Sie Koreanisch gelernt?«
»An der Universität.«
»An der Universität.«
Yunho wiederholte meine Sätze, als müsse er sich vergewissern, dass er mich richtig verstanden hatte.
Später sagte er: »Sie haben einen japanischen Akzent.« »Ich habe einen japanischen Akzent?«, fragte ich; auch ich war sein Echo. Es sei meine Intonation, erklärte er. »Ich singe nicht, ich spreche«, sagte er, »ich schiebe die Wörter vor mir her. Wenn Sie sprechen, wirbeln Sie sie auf, Sie werfen sie.«
Er nahm einen tiefen Zug.
»Keine Angst«, sagte er und atmete den Rauch langsam aus, »es klingt niedlich.«
Als ich antwortete, bemühte ich mich, weder zu werfen noch zu wirbeln. Er habe ebenfalls einen Singsang in der Stimme, sagte ich und zwang meine zur Notlandung. Er sah mich nachdenklich an, das habe er noch nie gehört, da lache ja sein Nabel, und wie um sich zu vergewissern, dass diesem kein Lachen entfuhr, legte er die Hand auf seinen Bauch.
Yunho war achtundsiebzig Jahre alt, sprach neben Koreanisch fließend Japanisch und etwas Chinesisch. Sein Haar war silbrig, wellig und schulterlang. Da er meinte, dass seine Glatze größer werde, beäugte er jedes ausgefallene Haar sorgfältig, untersuchte die Wurzel, ehe er es in den Mülleimer legte; er warf es nicht, er legte es, ebenso wenig ging er, er schlenderte, dann schlenkerte die dunkle Nadelstreifenhose um seine Beine, und die Konturen seines Unterhemds schimmerten durch das weiße Oberhemd. Die Hose, die vom vielen Waschen dünn geworden war, reichte weit über seine Körpermitte und wurde von grauen Hosenträgern zusätzlich hochgezogen. Yunho ging nie ohne Gehstock, Handschuhe, Hut und Brille aus, letztere stammte von seinem Vater, und er sah nicht wirklich besser mit ihr, obwohl er es sich einredete.
Er siezte mich, das war ich nicht gewöhnt, ich kannte gesprochenes Koreanisch nur von meiner Kinderfrau, Yŏnghee Maria, die ich stets Jung-Maria genannt hatte, obwohl ich mich wunderte, dass sie, eine ältere Frau, in meinen Augen damals eine Greisin, sich als jung bezeichnete, es aber nicht mehr war; ich dachte, sie nenne sich jung, weil sie es nie gewesen war.
Sie nahm mich als Kind unter ihre Fittiche, fütterte mich mit koreanischen Sätzen und Speisen, während sie kleine Arbeiten im Haus verrichtete. Abends holte sie ihr Bügelbrett hervor, einen alten Kissenbezug, der mit Zeitungen gefüllt war, und hockte sich auf den Boden, einen Stapel sauberer Wäsche neben sich. Sie ließ das Bügeleisen nicht über die Kleidungsstücke gleiten, sondern drückte nur; sie fürchtete sich vor dem Dampf, beteuerte, das Gerät schnaube vor Wut. Wir bügelten abends, wenn Monika und Wolfgang, die ich nicht Mutter und Vater nennen wollte, ausgegangen waren, und ich war glücklich, dass ich im gelben Küchenlicht neben Jung-Maria auf dem Linoleumboden liegen konnte, der sich seltsam weich anfühlte, während sie Wäsche drückte und mir Geschichten erzählte, von einer Zeit in Korea, als die feinen Fräulein, gehüllt in bodenlange Seidenmäntel, die Gesichter unter einer Kapuze verborgen, im dämmrigen Schein der Gaslaternen ausgehen durften. Männer hatten ab diesem Zeitpunkt nichts mehr auf der Straße verloren, lediglich Blinden und königlichen Kurieren war es gestattet, sich unter die Damen zu mischen, dann holten die blinden Masseure ihre Flöten hervor und begannen auf ihnen zu spielen, und in der Stadt verbreiteten sich ihre traurigen Melodien; manchmal öffnete sich ein Fenster, und sie wurden ins Innere gebeten. Die Hunde, verführt von den Flötentönen, stimmten ihrerseits einen Gesang an, der vom rhythmischen Klopfen der Arbeiterfrauen untermalt wurde, die mit Holzkeulen auf die Wäsche einschlugen, um sie zu glätten.
Sie seufzte, tätschelte meine Hand und sagte, das Weinen der Vögel sei aber viel schöner, und ich rief: »Jung-Maria, Vögel können doch nicht heulen!«
Wenn ich an Jung-Maria denke, fällt mir die Puppe ein, die ich überallhin mitnahm, in die Schule, zum Klavierunterricht. Sie schlief im vorderen Fach meines Rucksacks, manchmal auch neben mir auf der Couch; in die Hosentasche passte sie nicht, und meine Röcke hatten keine Taschen, ein großes Manko, das deren Verbannung ins Sibirien des Kleiderschranks rechtfertigte. Als sie eines Tages wieder einmal neben mir auf dem Boden lag, nahm Jung-Maria ihr Halstuch ab und band mir die Puppe auf den Rücken. Nun trüge ich sie wie eine koreanische Mutter ihr Baby, sagte sie, in Korea gebe es keine Kinderautos, die Frauen hätten ihre Säuglinge stets auf den Buckel gebunden, das sei praktischer, als sie in einem Häuschen vor sich herzuschieben.
Während ich mit meinem neuen Rückenschmuck durch das Wohnzimmer galoppierte, kam mir plötzlich ein Gedanke. Ob auch ich von meiner Mutter auf dem Rücken getragen worden war, fragte ich. »Von deiner Mutter?«, fragte Jung-Maria. »Ja«, antwortete ich und bettelte, sie solle es vormachen.
Sie sah mich lange an; trotz ihrer braunen Augen hatte sie einen hellen Blick, ich würde sogar sagen, einen kühlen Blick, wach und hart, an dem Tag aber war er dunkel und weich, eingerahmt von kurzen Locken. Sie hatte sich eine Dauerwelle beim Friseur gegönnt, normalerweise machte sie sie selbst, und ich durfte zusehen, wie sie die Lockenwickler anlegte, den weißen Fixierschaum aufsprühte und dabei die wunderlichsten Schimpfwörter ausstieß.
Ich erinnere mich, dass sie laut seufzte und schließlich antwortete: »Nein, Hannaja, nein. Deine Mutter hat dich nicht mehr kennengelernt, sie trennte sich sofort nach der Geburt von dir. Sie ließ dich bei dem Pfarrer zurück, der dich deinen deutschen Eltern vorstellte.«
Sie ließ mich bei dem Pfarrer zurück, der mich meinen deutschen Eltern vorstellte.
Es war dieser Satz, der mich zur Kündigung meiner Arbeit und meiner Wohnung veranlasste; der mich in ein Flugzeug steigen ließ und mich in ein Land brachte, in dem ich bloß eine Menschenseele kannte. Ich vergaß, leichte Kleidung mitzunehmen, so war ich stets auf der Suche nach Klimaanlagen, offenen Fenstern und Türen. Die ersten Tage nach der Ankunft verschlief ich, mich verwirrte der Zeitunterschied, ich glaubte, es sei abends, wenn es morgens war, das Licht irritierte mich zusätzlich, es verhielt sich anders, als ich es gewohnt war: wie das helle Licht des Frühlings im Spätsommer.
Gleich nach meiner Ankunft in Seoul unternahm ich einen Versuch, Jung-Maria zu finden. Ihr Name, Yŏnghee Jang, machte es mir unmöglich, zu normal ist er, zu gewöhnlich, zu viele tragen diesen Namen.
Schließlich brach ich zum Ordenshaus der Maryknoll-Brüder auf, im Rucksack einen Stadtplan und ein Wörterbuch, in der Hoffnung, eine Arbeit zu bekommen, mit der ich mich fürs Erste über Wasser halten konnte.
Blue moon, sang Billie Holiday; tatsächlich befanden wir uns auf einem blauen Mond, zwischen uns eine Stehlampe, deren Schein die niedrigen Tische und Kissen, die über dem Holzboden verstreut waren, sowie den gläsernen Aschenbecher mit einem bläulichen Schimmer überzog, sogar den Qualm blau einfärbte, der der Zigarette entwich – und Yunhos Profil, das ich in Ruhe studieren konnte, da er stets meinem Blick auswich. Mit der Zeit meinte ich keinen Menschen vor mir zu haben, sondern eine Fotografie, ein Bild aus Licht und Schatten, in dem eine Stimme lebte, und etwas Rauch; es passte in diese Welt, in der ich die Tage durchträumte und die Nächte durchwachte.
»Hanna«, sagte er, und aus seinem Mund klang es wie hana, eins auf Koreanisch, und in meinem Kopf zählte ich weiter, dul, zwei, ßeht, drei, neht, vier, »werden Sie nach Ihren Eltern suchen?«
Ich hatte auf diese Frage gewartet; ich hatte gehofft, vergeblich zu warten.
»Wahrscheinlich. Das habe ich noch nicht entschieden.«
Er nickte. Ich müsse mir das gut überlegen, wer weiß, wen ich finden würde. Selbst die Menschen, die man gut kenne, überraschen einen mit ihrem geheimen Leben.
»Mit ihrem geheimen Leben?«
»Ja. Jeder besitzt Geheimnisse. Sie doch auch.«
»Und Sie?«
Er hielt meinem Blick stand, wechselte aber das Thema.
»Habe ich das richtig verstanden, Sie sind Übersetzerin?«
Ich hatte mir vorgenommen, vorsichtig zu sein, also sagte ich: »Gelegentlich.«
»Und aus welchen Sprachen übersetzen Sie? Aus dem Englischen, aus dem Koreanischen?«
»Aus dem Englischen ins Deutsche.«
»Und aus dem Koreanischen?«
»Seltener.«
Ich griff nach einer Zigarette. Die letzte hatte ich vor einem Jahr geraucht. »Warum fragen Sie?«
»Ich möchte, dass Sie diesen Brief für mich übersetzen.«
»Einen Brief?«
Er habe ihn vor ein paar Tagen erhalten, einen Brief aus Amerika, aber er könne ihn nicht lesen. Yunho legte ihn auf den Tisch, der Umschlag war schneeweiß, die Adresse in Druckbuchstaben geschrieben, die Handschrift ungelenk. Er räusperte sich und murmelte, als wollte er die Worte vor mir verstecken, er glaube, dass er wichtige Wörter enthalte, ich müsse ihm sagen, welche.
Er gab mir das Kuvert, ich öffnete es und entfaltete das Blatt. Der Absender war ein Altersheim in Richmond, Virginia. Mrs Linda Miller schrieb, dass Mrs Eve Lewis in der Nacht vom vierzehnten auf den fünfzehnten des letzten Monats friedlich von uns gegangen sei. Da Mr Lewis bereits tot sei und Mrs Lewis keine Kinder habe, auch keine anderen Verwandten in den USA, habe sich die Heimverwaltung dazu entschlossen, die Benachrichtigung an die einzige Adresse zu senden, die man in Mrs Lewis’ Unterlagen gefunden habe. Vielleicht könne der Adressat Mrs Lewis’ Verwandte in Südkorea von ihrem Dahinscheiden informieren?
Mit aufrichtigem Dank und Beileid
Linda Miller
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, als ich bemerkte, dass Yunho weinte. Ich drückte die Zigarette aus, setzte mich neben ihn auf den Boden und reichte ihm mein Taschentuch; es war zerknüllt. Er nahm es, wischte die Tränen vom Brief und sagte, Eve sei also tot.
»Eve.«
Er wiederholte, diesmal mit dem Anflug eines Lächelns: »Eve Moon.«
Er habe ihren Namen nie richtig aussprechen können, im Koreanischen gebe es kein W oder V, nur B. Er sah mich nachdenklich an. Wieso habe sie sich bloß solch einen schwierigen Namen ausgesucht?
Er wühlte in seiner Hosentasche, zog eine Packung Zigaretten hervor. Ich sagte, ohne viel nachzudenken, vielleicht habe sie nur von Amerikanern angesprochen werden wollen. Er nahm einen tiefen Zug und nickte bedächtig, das könne schon sein. Sein Schweigen und das Rauschen der Platte zwangen mich zu sprechen, und ich hörte mich fragen: »Wer war Eve Moon?«
Er sah mich an, mit klaren, stillen Augen. Das sei eine Frage, auf die es keine einfache Antwort gebe.
»Möchten Sie wirklich wissen, wer Eve war?«
Er klopfte die letzte Zigarette aus der Packung und zündete sie an.
»Die einfache Antwort lautet: Sie war Mrs Henry Lewis, Eve Lewis. Sie war allerdings auch Eve Moon, Yunmee Moon und Mizuki Takahashi. Sie hatte viele Namen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wo und wann ich sie zum ersten Mal gesehen habe: in Johnnys kleinem Zimmer in Seoul, vor mehr als fünfzig Jahren …«
Von diesem Nachmittag an trafen wir uns täglich in diesem Raum, in dem alle Uhren anders gingen, die Kuckucksuhr an der Wand schneller war als der Wecker auf der Anrichte und dieser flinker als die Standuhr mit dem tiefen Gong, und Yunho erzählte, seine Stimme unterlegt von jenem mehrstimmigen Ticken, einem Rhythmus, dem er sich nie entzog, von den Ereignissen in Seoul und Osaka, in den Jahren 1959 und 1960.
Seoul, 1959
2
Ich erinnere mich an das Lied, das durch die Tür drang, an das leise Jaulen der Gitarre und an das Schlagzeug, das dem Rhythmus scheinbar zögerlich, eigentlich sicher, schlafwandlerisch sicher folgte; doch es waren nicht die Töne, die den Raum füllten, es war die aufgeheizte, dicke Spätsommerluft, der heiße Nachmittag, und obwohl ich einen fensterlosen Flur entlangging, sickerte die Sonne durch die Türspalten ins Innere und teilte den Korridor in Abschnitte, ein fast schwarzer gefolgt von einem goldbraunen, meine kurze Reise untermalt von ferner Musik, unterbrochen von den Geräuschen im Haus, dem Scheppern des Blechgeschirrs, dem Klappern der Messerschneide auf dem Holzbrett, dem Murmeln der Wirtin, die mich missmutig gemustert hatte.
Seine Tür war angelehnt, ich drückte sie auf. Johnny und Eve tanzten eng umschlungen, Kopf an Kopf, die Augen geschlossen, aus dem Grammophon tönte Sleep Walk, der Song der Gebrüder Santo und Johnny; Letzterer war der Namenspatron meines Freundes. Damals war ich überzeugt, nichts könnte sie trennen, Johnny und Eve, Eve und Johnny, sie bewegten sich auf dem Fleck zwischen Bett und Schreibtisch in einem vollkommenen Moment.
Ich beobachtete sie viel zu lang. Ich setzte mich auf den Boden, vor Johnnys Tür. Ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte, ich kannte niemanden in Seoul außer ihn. Während ich wartete, strömte der Duft von frisch gekochtem Reis aus der Küche im unteren Stock, der Geruch von zerstampftem Knoblauch, gehackten Chilischoten und gebratenem Fisch. Geschirrklirren, dann huschte die Wirtin mit einem Tablett ins Wohnzimmer. Warum sie so lange auf sich habe warten lassen, hörte ich die Stimme ihres Mannes. Sie antwortete nicht. Ob der Student bezahlt habe, fragte er, sie habe ihn noch nicht sprechen können, sagte sie, er habe Besuch. »Besuch«, hörte ich, »von wem?« »Von einem Fräulein«, sagte sie, »oder auch nicht.« »Was soll das denn heißen?«, fragte er. »Sprich nicht in Rätseln!«
Es handle sich um Eve Moon, antwortete sie. »Eve Moon«, fragte er, und seine Stimme wurde lauter, »Eve Moon?« »Ja«, wisperte sie. Unglaublich, donnerte er, das sei doch kein Bordell, was falle ihm ein, diese Hure mit auf sein Zimmer zu nehmen! »Sei still«, unterbrach ihn seine Frau, »das ganze Haus kann dich hören«, und schloss die Tür.
Erst in diesem Moment nahm ich sie wahr, Eve, die neben mir in den Gang getreten war. Ich wusste nicht, wie lange sie schon zugehört hatte, sie ließ sich nichts anmerken. Ihr Gesicht war starr, eine Maske, Yunmee Moon oder, wie sie sich nannte, Eve Moon, die Haare gelockt, die Sommersprossen übertüncht, die Lippen rot angemalt; mir war ihre Schönheit zu kalkuliert. Später lernte ich zwischen der echten und der unechten Eve zu unterscheiden, viel später, als Johnny bereits auf dem Weg nach Nordkorea war …
Sie schlenderte zum Treppenabsatz und blieb für ein paar Sekunden stehen, als wollte sie sich vergewissern, dass ihr Abgang unbemerkt bliebe; mich ignorierte sie. Sie schlüpfte aus den Schuhen, klemmte sie unter den Arm und lief die Treppe hinunter ins Erdgeschoss; zog die Haustür einen Spaltbreit auf, sie brauchte nicht viel Platz, um ins Freie zu schlüpfen.
Ich klopfte. Johnny öffnete, eine Zigarette im Mundwinkel, ein Béret auf dem Kopf, die Haare glänzten von der Pomade; er wirkte verschlafen. Als er mich erkannte, lachte er und umarmte mich, lachte und umarmte mich wieder und wieder. »Yunho«, rief er, »Yunho, was für eine Überraschung, was machst du hier? Komm rein, komm schnell herein!«
Johnny und ich wuchsen im Westen Südkoreas auf, in Nonsan, damals eine kleine Siedlung, zu klein, um auf einer Landkarte verzeichnet zu sein. Wir wurden Freunde wegen der Enge des Dorfes, ihr zum Trotz blieben wir befreundet, Johnny, der stets auf der Suche nach Möglichkeiten war, die ihn aus dem Nichts ins Alles befördern würden, und ich, der so sehr daran glauben wollte, dass in Nonsan die Zeit stehengeblieben war, dass ich mich bis zu meinem ersten Schultag weigerte, die Namen der Wochentage zu lernen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, nur Samstag und Sonntag kannte ich. Reisfelder und Berge, Non und San, und zwischen den Feldern endlos lange Pfade auf Deichen, die breit genug für ein Fahrrad waren oder für zwei Fußgänger, Wanderskinder: Wir wanderten jeden Tag zur Schule in den Nachbarort, zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück, wir gingen im hellen Licht des Winters, das das wellige Tal in ein weißes Meer verwandelte, und im gelben Licht des Sommers, das den vielen Schatten, die von den Sträuchern, Gräsern und Strohdächern auf die rissige Erde geworfen wurden, weitere, bizarre hinzufügte, abstrakte Formationen aus einer anderen Welt. An diesen Tagen meinte ich, ich könnte an keinem Ort leben als an diesem, und lange, nachdem ich aus Nonsan weggegangen war, schien mir, ich hätte nichts als Kummer und Sorgen verdient, denn ich hatte das Paradies verlassen.
Johnny war der einzige Sohn, das jüngste von fünf Kindern, ich der jüngere von zwei Söhnen. Meine Mutter arbeitete als Haushälterin im Haus seines Vaters, des Schuldirektors, mein Vater bewirtschaftete dessen Äcker, und ich verbrachte meine Nachmittage in dessen Höfen und Gärten. Das Haus meiner Familie befand sich an der Grundstücksmauer, direkt neben dem Haustor, es war das Pförtnerhaus, und eine Aufgabe meines Vaters war es, unangemeldete oder unerwünschte Besucher abzuweisen und jene einzulassen, die erwartet wurden. Unser Haus war ein Häuschen, es bestand aus einer Küche, zwei Zimmern und dem Flurraum, Maru, der als Wohnzimmer genutzt und deswegen von Mutter täglich nass gewischt wurde, während ich im Klassenzimmer saß und Japanisch, Mathematik und Geschichte lernte; aus Japanisch wurde drei Jahre später Koreanisch. Johnnys Wohnzimmer wurde von Yuri, dem Hausmädchen, geputzt, wie auch alle anderen Räume des Direktors, und sie beklagte sich, dass sie den ganzen Tag nichts anderes tue, als zu kehren und zu schrubben, denn dieses Haus war groß, spähte man von der Eingangstür ins Innere, passte die Einrichtung zwischen Zeigefinger und Daumen.
»Weißt du, dass es hier spukt?«, fragte sie mich eines Nachmittags, als ich vom Unterricht nach Hause kam. »Deswegen hat Herr Kim das Grundstück so billig bekommen.«
Die ersten Monate nach dem Einzug habe das ganze Dorf darauf gewartet, dass der Geist die Kinder des Direktors fressen würde, doch nichts sei geschehen, vergeblich habe man die Familie belauert und durch die Ritzen des Zaunes ins Innere gespäht. Schließlich habe man das Spionieren aufgegeben, aber Vorsicht, sie fixierte mich mit ihren dunklen Augen, die Gefahr sei noch nicht gebannt, wenn ich in der Dämmerung an der Hausmauer entlangginge, könne ich sie sehen, die Leute, die einen Blick auf das verfluchte Haus und den bösen Geist werfen wollen, von überall her kämen sie, von überall her.
Sie eilte kichernd in die Küche. Ich blieb zurück und dachte an den knorrigen Ahorn, der am äußersten Rand Nonsans stand, dort, wo sich dem Blick eine Weite öffnete, die selbst der alles verkleinernde Himmel nicht dominieren konnte. Ich fragte mich, ob dieser uralte Laubbaum, an dessen unterste Äste weiße Stoffstreifen geknüpft waren, die bei der kleinsten Brise aufflatterten, Blätter in Gefangenschaft, für diesen Geist dekoriert worden war oder für einen anderen und ob die Speisen in den Blechschüsseln, die in regelmäßigen Abständen von unsichtbarer Hand auf seinen Wurzeln serviert wurden, dazu gedacht waren, ihn zu besänftigen: ihn, der es noch immer auf meinen besten Freund abgesehen hatte.
Es ließ mir keine Ruhe, ich wollte ihn sehen, ich musste ihn sehen, so suchten wir nach Yuris bösem Geist, Johnny und ich. Wir fanden ihn nicht, auch keine anderen Geister, dafür Gespenster, Gestalten in Grau und Braun, deren Kleidung in Fetzen vom Körper hing, oder war es Haut und kein Stoff? Wir konnten dies nicht erkennen, sosehr wir es versuchten, ihre Gesichter und Hände waren dermaßen verdreckt, dass sie sich von der Farbe der Erde kaum unterschieden, sie wandelten auf den Straßen wie verlorene Schatten auf der Suche nach ihrem Körper. Sie sprachen nicht, sie gurgelten, röchelten und starrten uns an, dann klammerte sich ihr Blick an uns, und wir sahen in ein zerronnenes Antlitz, dem die Nase fehlte, dessen Mund verformt war, ebenso die Augen, und schreiend rannten wir davon. Nicht in die Gerstenfelder, auf keinen Fall in die Gerstenfelder, Yuri hatte uns gewarnt, in den Gerstenfeldern, zwischen den Halmen würden sie leben, die Kolonien von Leprakranken, sie würden sich, exiliert von den Gesunden, im dichten Gerstenfell verstecken und nur zum Vorschein kommen, wenn sich Kinder näherten. Wenn man es am allerwenigsten erwartete, würde sich der grüne Vorhang teilen, blitzschnell würden sie hervorspringen, nach unseren Armen greifen und uns ins Innere des Feldes ziehen; dort würden sie uns kitzeln.
»Wenn ihr euch hilflos vor Lachen windet, holen sie ein Messer hervor und schlitzen eure Leiber auf.«
»Mit einem Messer?«
»Es gelüstet sie nach Kinderdärmen. Davon ernähren sie sich.«
Sie grinste, als ich hinter Johnnys Rücken verschwand. »Keine Angst, Yunho«, sagte sie, »ihr müsst sie mit Sand bewerfen, dann laufen sie davon, denn er juckt und sticht in ihren offenen Wunden, bewerft ihr sie aber mit Erde, werden sie euch folgen, denn die tut ihrer geschundenen Haut gut.« Sie hockte sich auf den Boden, füllte zwei Stoffbeutel mit Sand und drückte sie uns in die Hand.
Solcherart bewaffnet, wagten Johnny und ich uns an den Rand des Gerstenfeldes, das Getreide war noch jung, erbsengrün, der Himmel tiefblau, durchzogen von weißen Adern, die Wolken zogen schnell vorüber: als würde der Tag vorgespult. Das Getreidemeer schillerte im Spiel von Licht und Schatten. Wir starrten ins dichte Grün. Plötzlich begannen die Gerstenhalme wenige Meter vor uns verdächtig zu zucken …
Kreischend rannten wir davon, griffen in unsere Beutel und warfen mit Sand um uns. Herr Im, der Eierhändler, der eine große, hölzerne Kiste auf dem Rücken trug, in der sich lebende Hühner- und Entenküken sowie sein gesamtes Eiersortiment befanden, bekam ihn in die Augen. Er schrie, verlor das Gleichgewicht, und langsam, ganz langsam kippte er mit dem Käfig voran auf den Boden, ruderte mit seinen Armen und Beinen in der Luft wie ein unglücklicher Käfer. Doch ehe wir uns verziehen konnten, war er wieder auf den Beinen, schnappte uns am Kragen, und wir mussten einen ganzen Monat für ihn durch Nonsan laufen und rufen: »Kaufen Sie Eier, Hühner- und Enteneier, von Im Junbing, dem Eierking!«
Hinter den Gerstenfeldern lagen die Reisfelder, bei der Reissaat, wenn die Setzlinge in die gefluteten Beete umgepflanzt wurden, half die Familie des Direktors mit, dann holten die Mädchen die Nylonstrümpfe aus dem Schrank, steckten ihre Arme in den hautfarbenen Schlauch und ließen die Hände mit gespreizten Fingern wieder hinausgleiten, auf diese Weise fanden sie die Löcher, durch die die Blutegel sie angriffen. Erst wenn sie sich vergewissert hatten, dass die Strümpfe löcherlos waren, zogen sie sie sich über. Trotz aller Sorgfalt kam es zu Egelattacken, die Mädchen kreischten, und wir Jungen, die wir ohne Nylonrüstung auskommen mussten, lachten sie aus.
Ich verliebte mich in Miya Sŏng, das Nachbarsmädchen, als ich acht Jahre alt war, ein Jahr vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Damals hieß Johnny noch Mino und ahnte nichts von meinen Gefühlen für die vier Jahre ältere Miya, ahnte nicht, wie sehr ich um ihre Zuneigung kämpfte, und auch sie vermutete nichts, wusste sie überhaupt, dass ich existierte?
Vielleicht; an einem Sommernachmittag, den wir damit verbrachten, die Hündin und ihre sechs Welpen zu beobachten, die in einem der Höfe im Kreis um die Wette rannten – wir saßen im Schatten einer Kiefer und feuerten ihn an, den kleinen Dicken, der so versessen darauf war, seine Mutter einzuholen (wir schrien ihm zu, weiter so, mach schon, Kleiner, weiter, weiter, weiter!) –, beachtete sie mich mehr als die Hunde und lächelte; deswegen glaubte ich, sie liebe mich (deswegen glaubte ich, ich liebe sie).
Im selben Jahr verlor auch Johnny sein Herz.
Wir hatten vom Film gehört, aber noch keinen gesehen; wir hatten gehört, dass Filme lebende Fotos seien, Wackelbilder, dachten wir und wackelten vor den Schwarzweißfotos des Direktors mit unseren Köpfen, bis uns schwindlig wurde. In unserem Geheimversteck, auf dem breiten Ast eines Ginkgobaumes, fragte Johnny, ob im Kino die Zuschauer vor riesengroßen Fotografien säßen und ihre Schädel schüttelten. Er könne sich das nicht wirklich vorstellen. Ich sagte, ich könne mir das genauso wenig vorstellen, viel Spaß mache das nicht. Vielleicht wäre es anders, wenn die Bilder groß seien, meinte Johnny und schlug vor, es auszuprobieren, also hielten wir uns am Stamm fest und begannen, unsere Häupter hin und her zu schwenken, zuerst langsam, dann immer schneller.
Heute denke ich, es muss Zufall gewesen sein … Die Welt hielt still, nur für uns, kein Wind, nicht einmal eine Brise, und zugleich mit ihrem Atem hielt sie auch alle anderen Geräusche an. Ich sehe uns vor mir, wie wir auf dem Astwerk hocken und unsere Köpfe von links nach rechts und von rechts nach links bewegen, wir lachen, weil wir meinen dem Geheimnis auf die Spur gekommen zu sein, wir lachen hämisch, weil wir wissen, dass einzig wir dem Geheimnis auf die Spur gekommen sind, alle anderen bezahlen ein Vermögen wegen ihrer Dummheit; dieses Wissen macht Spaß. Als der Wind die Stille stört, die Stille einer Postkarte, machen wir eine Pause, und plötzlich lebt alles wieder, wir hören Vogelstimmen, das Plätschern des Flusses, das Zirpen der Grillen, das Summen der Bienen und Fliegen; in weiter Ferne die Stimme meiner Mutter.
In jenem Sommer im August, nachdem der Monsun den ganzen Juli hindurch die Erde und die Grasdächer aufgeweicht, die Luft in Dampf verwandelt und das helle Frühsommerlicht geschluckt hatte, sodass uns der plötzlich aufgeklarte Himmel blendete, rollte ein Auto, ein kleiner Schrank, durch das Dorf. Aus den heruntergekurbelten Fenstern riefen die Fahrer, sie seien ein Wanderkino, sie hätten Filme mitgebracht und jeder sei willkommen, sie anzusehen, jeder. »Hat er Film gesagt?«, fragte mich Johnny und sprang auf. Ich nickte. »Komm schon!«, rief er und begann, hinter dem Wagen herzulaufen, »wir müssen herausfinden, wo sie das Kino hinfahren!«
Wir mussten nicht lange suchen, die Holzstangen, die aus dem Fahrzeug geragt waren, ragten nun aus einer Ebene, die bisher unentdeckt gewesen war; Terra incognita. Bis zu diesem Tag hatte niemand von ihrer Existenz gewusst außer uns, und wir hatten den Ort geheim gehalten, er war unser unerforschtes Tal. Hier schlugen sie die Stangen in die Erde und bauten eine schwarze Maschine auf, den Filmprojektor. Johnny und ich blieben in der Nähe, wir gaben vor, uns nicht für sie zu interessieren, weder für den Projektor, den wir für einen Ofen hielten, noch für den Aufbau des Kinos, der in vollem Gang war. »Kommt her und helft uns!«, riefen sie und winkten uns herbei. Wir trotteten langsam zu den Männern, ganz geheuer waren sie uns nicht. Sie baten uns, ihnen den Vorhang aus der Tasche zu reichen, sie wollten ihn an den Pfählen befestigen.
Langsam verwandelten sich die Stangen vor unseren Augen in ein Holzgerüst und dieses in ein weißes Stoffhaus mit einem Vorhang als Eingang. Es stand an diesem Platz, breitbeinig, als gehörte es hierher, als hätte es schon immer hierher gehört. »Heute Abend«, lächelte einer der Männer und gab uns zwei Papierstücke, »kommt ins Kino und nehmt eure Eltern, Geschwister und Freunde mit.«
Sie kamen, sie kamen alle. Das ganze Dorf wollte wissen, was es mit dem Zauberhaus auf sich hatte, allerdings mussten sie Eintrittskarten kaufen, Johnny und ich schlüpften neben ihnen hinein.
Auf dem Boden waren Decken zum Sitzen ausgebreitet, wir streiften die Schuhe von den Füßen und setzten uns auf den weichen Stoff, durch den die Feuchte der vergangenen Wochen drang. Es war noch nicht vollkommen finster, stellenweise leuchtete der Himmel dunkelblau, bald würde das stille Glühen vom Schwarz der Nacht verschluckt werden. Niemand wagte, zu sprechen, wir saßen stumm auf der Erde und spürten die leichte Brise, die die Stoffwände zum Rascheln brachte; dann ein Windstoß, der Stoff bauschte sich, eine Kerze erlosch.
Ein erschrockener Ausruf.
Wispern? Weinen?
Sachtes Murmeln.
Das Zischen eines Streichholzes.
Die Laternen sind wieder vollzählig, sie verbreiten ein schummriges Licht. Der Abendwind beruhigt sich, weicht nächtlicher Ruhe, und langsam treten die Sterne aus der Finsternis hervor, einer nach dem anderen, bis der ganze Himmel mit einem Glitzern überzogen ist.
Der Mond!
Alle drehen ihre Köpfe, inzwischen liegen wir, wir sitzen nicht mehr, wir liegen auf dem Rücken, einer neben dem anderen, einer auf dem anderen, und starren zum Firmament, wir suchen den Mond und finden ihn, und sobald wir wissen, wo er am Himmel steht und wie groß er ist, sehen wir sein Licht, sein silbrig schwelendes Licht … Und ich vergesse, dass ich kam, um einen Film zu sehen, stattdessen erinnere ich mich an einen Spruch meines Vaters: Auch wenn der Himmel einstürzt, es gibt ein Loch, durch das man entkommt. An diesem Abend denke ich, ich habe sie vor mir, die Himmelslöcher, durch die man entkommt, und sie sind strahlend gelb. Aber vielleicht ist es umgekehrt, denn Vater sagte auch: Der Himmel ist so groß wie eine kleine Münze. Diesen Spruch habe ich nie verstanden, nun meine ich ihn zu verstehen, er scheint zu bedeuten, die Sterne in ihrer Kompaktheit seien der eigentliche Himmel, nicht der Raum zwischen ihnen. Während ich neben Johnny auf der Decke liege und mich an Vaters Stimme zu erinnern versuche, werde ich traurig, denn ich stelle fest, dass ich sie vergessen habe, obwohl sein Tod nur ein paar Monate zurückliegt …
Plötzlich heißt es, nun seien sie so weit. Die Maschine setzt sich mit einem lauten Knacksen in Bewegung. Jemand fordert uns auf, die Kerzen auszupusten. Mit einem Mal erscheint auf der Leinwand ein lebendes Bild: Wann immer es atmet, ruckelt es, und seine Schärfe geht im Zittern verloren. Als es verschwindet, wird es schwarz vor unseren Augen, und manche schreien entsetzt auf, da sie glauben, sie seien erblindet; als der Schatten eines Kopfes durch den Film hüpft – er ist wie eine Verletzung, die Verletzung einer Haut –, rufen wir, man solle sich setzen, und zwar sofort!
Ich war wie gebannt von den Erscheinungen des Lichts, niemals hätte ich gedacht, dass Leben diese Form annehmen, ein Gewebe aus Hell und Dunkel sein kann, Schwarz und Weiß, eine flüchtige, zugleich ewige Welt, deren Zeit gezählt ist; vielleicht war es das Wissen um diese Vergänglichkeit, das mich dazu zwang, meine Gedanken, mein Wissen, meine Erinnerungen und Gefühle aufzugeben – und mich zwei Stunden lang von Hunger und Armut befreite.
Schließlich konnte ich den Lichtblitzen auf der Leinwand nicht mehr folgen, ich lehnte mich zurück und beobachtete das Flirren der Sterne.
»Yunho, schlaf nicht ein«, zischte Johnny und kniff mich in den Arm. Ich hatte meine Augen geschlossen, doch ich schlief nicht; ich dachte an Vater, wie er, wann immer er frei gehabt hatte, seine braune Ledertasche unter den Arm geklemmt hatte und ins Zentrum von Nonsan gewandert war; wie er sich an den Straßenrand vor das Gerichtsgebäude gesetzt und auf einer alten Zeitung zwischen Straßenhändlern und Schuhputzern auf Menschen gewartet hatte, die einen Prozess führen wollten, ihre Beschwerde jedoch nicht selbst aufschreiben konnten – auf Analphabeten, Schwarzaugen. Er war ihr Übersetzer gewesen, die Verbindung zwischen Kopf und Papier, und er hatte sich Mühe gegeben, dasselbe Dokument ein zweites und drittes Mal aufgesetzt, zu Hause im Schein einer Kerze, während wir schliefen. Die Miete einer der vielen Schreibstuben, Holzhütten, die sich auf dem Platz vor dem Gericht drängelten, winzige Räume, möbliert mit einem Tisch und zwei Stühlen, die dritte Person musste im Hintergrund stehen, hatte er sich nicht leisten wollen, er könne dieser Beschäftigung ohnehin nicht regelmäßig nachgehen, hatte er gesagt, sie sei Liebhaberei, nicht Arbeit. Jene Kunden, die ihre Anklageschrift noch am selben Tag abgeben wollten, hatte er abgelehnt, er hatte die Stillen und Leisen bevorzugt, die Trödler und Dichter, die nie lesen und schreiben gelernt hatten. »Eine volle Flasche Wasser macht keinen Laut«, hatte er gesagt, ihnen gelauscht und sich Gedichte diktieren lassen. Am Ende hatte er ihnen die eingefangenen Worte geschenkt, und sie hatten die Blätter entgegengenommen wie eine Kostbarkeit. Manche Verse hatte er für sich selbst notiert; er hatte sie mit sich herumgetragen wie andere Geld.
»Aber sie riechen viel besser, nicht wahr, Yunho?«
Ich versuchte mich an den Geruch zu erinnern, an den Geruch des Papiers und an die raue Oberfläche der getrockneten Tusche, über die ich so gerne mit dem Finger gefahren war, als der Projektor mit einem lauten Rattern ankündigte, dass die Vorstellung zu Ende war. Alle standen auf, suchten im schwachen Schein der Petroleumlampen und Kerzen nach ihren Schuhen. Viele waren eingeschlafen, sie mussten geweckt oder nach Hause getragen werden, doch Johnny war hellwach, seine Augen funkelten, er zog mich zu dem Mann, der den Filmprojektor bedient hatte, und fragte ihn, ob er die Bilder gemalt habe. Dieser lachte, strich Johnny über die Wange und sagte, nein, er zeige sie bloß her, er und seine Freunde. Er war Anfang zwanzig und studierte Literaturwissenschaft, ein kleiner schlanker Mann, dessen schwarzes Haar mit ausreichend Öl zu einem glänzenden Seitenscheitel gekämmt war. Sein Körper war in westliche Kleidung gehüllt, und er trug eine Mütze, heute weiß ich, es war ein Béret, damals wunderte ich mich über dieses runde Häuflein, das über die rechte Seite seiner Stirn hing.
Er und seine Freunde blieben eine Woche in Nonsan, Direktor Kim nahm sie bei sich auf, sie durften im Gästehaus schlafen, zum Dank zeigten sie uns jede Nacht einen anderen Film. Am Ende der Woche erklärte Johnny, er werde in Seoul Filme drehen, wenn er groß sei, dabei trug er die Wollschüssel verkehrt auf dem Kopf.
Johnny konnte nicht stillsitzen, immer wieder sprang er auf, um mir ein Getränk zu bringen (»Bist du durstig? Willst du Wasser oder Tee?«), und immer wieder fiel er sich selbst ins Wort (»Ach nein, das ist nicht feierlich genug, und haben wir nicht einen Grund zum Feiern! Wahrscheinlich bist du hungrig, ich werde für dich etwas zu essen besorgen, eine Schüssel Reis und ein paar kleine Speisen, gebratenes Gemüse, gedünstete Wurzeln, Kimchi, vielleicht bist du ein Glückspilz, und es sind noch Mandu* übrig!«), dazwischen spielte er mit einer Zigarette aus der halbleeren Schachtel, ließ sie zwischen seinen Fingern hin- und herwandern und bombardierte mich mit Fragen (»Wie lange haben wir uns nicht gesehen, fünf, sechs Jahre? Was machst du in Seoul? Bleibst du länger hier? Wirst du hier studieren? Wie ist es dir in den letzten Jahren ergangen?«). Ich versuchte vergeblich, alle zu beantworten, viele verstand ich nicht, denn wir sprachen gleichzeitig, der eine lauter als der andere, unser Gespräch unterbrochen von Fragen auf Antworten, die ich gar nicht gegeben hatte, sodass ich schließlich erschöpft ausrief: »Nun ist aber Schluss, ich kann dich nicht hören!«
Wir lachten und ließen uns auf sein Bett fallen. Er habe es weit gebracht, krächzte ich, zu einem Eisenbett mit quietschender Matratze. Und nicht zu vergessen, Johnny grinste von einem Ohr zum anderen, schrecklich staubig und doch herrlich weich.
»Jede Nacht liege ich auf meiner Wolke.«
»Und was ist mit den Federn, die mir den Rücken zerstechen?«
»Zerstechen? Jetzt übertreibst du aber!«
»Nein, im Ernst, ich glaube, ich blute.«
»Das kann gar nicht sein. Die Rippen meiner Wolke sind weich –«
»Die Rippen deiner Wolke?«
Er hatte sich nicht verändert, er war noch immer Mino, vorwitzig, frech, viel zu selbstbewusst dafür, dass er schrecklich talentlos war, er konnte weder gut zeichnen noch singen, nur träumen konnte er und den Tiger ins Dorf lügen. Dem Béret hatte er die Treue gehalten, er hatte es auf dem Kopf, während er rauchte. Auch sonst sah er dem Filmstudenten von damals erstaunlich ähnlich, vielleicht weil er die Haare mit zu viel Öl nach hinten gekämmt hatte und eine weite schwarze Hose trug.
»Sie sind zu groß, ich weiß«, sagte er, als sich unsere Blicke kreuzten, »aber ich mag sie, sie sehen aus, als gehörten sie Humphrey Bogart, findest du nicht? Nur die Hosenträger fehlen.«
Er drehte sich für mich im Kreis. Wo er die denn herhabe, fragte ich und lachte, er habe sie wohl geklaut. Er lächelte geheimnisvoll, drückte die Zigarette am Fenstersims aus und schnippte sie auf den Zimmerboden. Nachdem er von der Militärakademie geflogen sei, habe ihm eine Freundin die Hose geschenkt, als Wiedergutmachung.
»Du bist von der Militärakademie geflogen?«
»Nein. Von der Brutstätte der politischen Elite.«
Sein Schicksal besiegelt habe eine Prügelei auf dem Campus der Akademie, aus der er klar als Sieger hervorgegangen sei, jedoch als Verlierer des Studienplatzes. Würdeloses Verhalten habe man ihm vorgeworfen, einem Studenten der Akademie nicht angemessen, er beschmutze das Ansehen dieser traditionsreichen Institution. Traditionsreich, habe er eingeworfen und in diesem Moment sei ihm alles egal gewesen, verkatert und verletzt vom Kampf, mit einem blauen Auge und einer blutigen Nase sei er vor dem Komitee der Idioten gestanden und habe gezetert, traditionsreich? Die Amerikaner hätten sie mitgebracht, wie auch die Autos, in denen die hochverehrten Lehrer herumkutschieren, die Uniformen, in denen sie defilieren, die Geldscheine, mit denen sie in Bars um sich werfen! An dieser Stelle sei er von zwei Kadetten gepackt und aus dem Raum gezerrt worden. Seit Herbst studiere er an der Korea-Universität, dort sei das Leben angenehmer …
Er lächelte verschmitzt.
Übrigens, er heiße schon seit zwei Jahren nicht mehr Mino, sondern Johnny. Warum er sich diesen Namen zugelegt habe, fragte ich erstaunt. Er langte nach dem Feuerzeug und zündete sich eine neue Zigarette an.
»Hat deine Freundin ihn dir gegeben? Die große Hübsche im gelben Kleid? Ich habe sie vorhin im Treppenhaus gesehen.«
»Eve?«
Ich nickte.
Er grinste. Es sei nicht klar, ob sie seine Freundin sei, ihr Verhältnis sei nicht eindeutig.
»Nicht eindeutig?«
»Man hat keine Beziehung mit Eve, Yunho, man trifft sich nur mit ihr.«
Das erste Mal, sagte Johnny, sei er Eve auf der Hochzeit seiner Schwester Haesun begegnet. Sie sei in Begleitung eines Amerikaners gekommen, eines Bekannten seines Vaters, angeblich, habe man sich erzählt, habe sich dieser ihr Geleit erkauft.
An dem Tag zerbröselte der Himmel, doch die Schneeflocken waren weder kalt noch schwer, sondern trocken und leicht, körperlos fast … Der Schnee kam ungelegen. Es war Ende Oktober, und es hätte eine Herbsthochzeit werden sollen. Das Festessen verlagerte man ins Innere, von der Weite des Gartens in die enge Eingangshalle einer neugotischen Dorfkirche an den Rändern Seouls; hier wartete man auf das Ende des Schneefalls. Es war eigenartig still im Raum, die Hochzeitsgesellschaft hatte sich am Fenster versammelt, ihre Blicke folgten den Kindern, die nicht ins Innere geflohen waren, sondern draußen nach den Flocken schnappten und im Schnee tanzten. Johnny war mit ihnen im Freien geblieben und beobachtete sie; er war im Begriff, jedes Gefühl für Zeit zu verlieren, als unversehens Eve vor ihm stand. Sie legte eine Orange in seine Hand, ohne etwas zu sagen, diese Kostbarkeit, die lediglich auf dem Schwarzmarkt erhältlich war. Die Schale war klebrig, warm, die Frucht größer als seine Handfläche, und er musste die Finger spreizen, um sie zu halten.
»Danke«, sagte er, »haben Sie vielen Dank.« Sie nickte und wandte ihm den Rücken zu. Er hielt sie zurück. Ob sie das Fest schon verlassen wolle? Es gebe jede Menge zu essen. Wieder nickte sie und deutete auf die Straße, ihr Begleiter sei bereits fort. Mit einem Lächeln und einer angedeuteten Verbeugung verabschiedete sie sich, doch Johnny konnte sie nicht einfach so gehen lassen. Er folgte ihr durch die Vororte, von den Rändern Seouls bis ins dicht bebaute Zentrum, und je länger die Verfolgung andauerte, desto schmäler wurden die Straßen, die breiten Boulevards der Außenbezirke verwandelten sich in Gassen, und im labyrinthischen Stadtkern verlor er sie aus den Augen und fand sie nur wieder, weil sie auf ihn wartete. Sie sah nicht auf, sondern blickte in einen Taschenspiegel. Als sie ihn erspähte, schlenderte sie zur Haustür, drehte sich um und sah ihm ins Gesicht.
Und er?
Floh panisch in eine Sackgasse.
Johnny fand heraus, dass sie in einer Dancing School arbeitete, in einer der vielen Tanzschulen, die während des Koreakriegs entstanden waren und in denen die westliche Art zu tanzen gelehrt wurde sowie jene des Kleidens, Frisierens und Sprechens, das Kauderwelsch aus Koreanisch und Englisch wurde, wie der andere amerikanische Import, die Sonnenbrille, aufgesetzt und abgelegt, sobald man diesen Ort verließ. Dann schlüpfte man in die koreanische Tracht, die weite Hose, den langen Rock, das ungeschminkte Gesicht. Eve war eine Ausnahme, sie dachte nicht daran, die Verkleidung aufzugeben, sie behielt ihren amerikanischen Namen und die amerikanische Kleidung, das Koreanische warf sie, wie das Japanische zuvor, weg, und auch zu besonderen Anlässen holte sie es nicht heraus. Sie identifizierte sich mühelos, zu mühelos, wie ich fand, mit jenen, die durch unsere Heimat marschierten, als hätten sie sie erbeutet und mit ihr ihre Einwohner, die sie nach Gutdünken bestraften, indem sie ihnen mit dickflüssiger, roter Farbe das Gesicht beschmierten und Goddamn Koreans auf ihren Rücken schrieben – und all das wegen einer Dose Bohnen oder eines Beutels Reis. Als sich eine Gruppe junger Burschen Eve auf die Fersen heftete und ihr »Ami-Hure!« nachrief, fand ich es gerechtfertigt.
Am Eingang der Tanzschule blinkten zwei Neonschilder, die Wörter Dancing und Girls. Daneben saß auf einem Plastikstuhl der Betreiber des Etablissements und Ticketverkäufer, ein schmächtiger Mann um die dreißig mit dem Gesicht eines Luchses, der immer eine Sonnenbrille trug, egal, ob es sonnig war oder nicht, und sein Haar mit Pomade an den Schädel geklebt hatte. Eine Strähne ließ sich jedoch nicht zähmen, sie schnellte stets nach dem Frisieren in die Höhe und fächerte sich auf, ihretwegen wurde er Kakimo genannt. Einen fixen Eintrittspreis gab es nicht, Kakimo verlangte, was und wie viel er wollte, gutaussehenden Männern berechnete er weniger, Frauen gar nichts, und hässlichen Menschen verwehrte er den Einlass. Wenn er seine Hand hob, tauchte sein Partner auf, der einen Namen hatte, aber nie angesprochen wurde, ein gewaltiger Schwarzer, der nie einen Finger rühren musste, einzig aufstehen und einen Schritt ins Licht tun, schon verzogen sich alle, selbst die, die sich ungerecht behandelt fühlten.
Die Halle befand sich im Souterrain, sie war größer als jedes Zimmer, das Johnny bis zu diesem Zeitpunkt gesehen hatte. Kurz vor fünf Uhr nachmittags, ehe Kakimo sie öffnete und die Neonreklame anknipste, legte er eine Platte auf und stellte den Hebel auf endlos, dann spielte die Musik für einen leeren Raum, beschallte aus zwei Trichtern eine hölzerne Ebene im Zwielicht; der Ton war blechern, die Streicher von den Posaunen kaum zu unterscheiden, und doch, vielleicht weil es weiche, langsame Melodien waren, die Sehnsucht wecken sollten, vielleicht weil sich der Raum schnell mit Frauen füllte, die wie Eve lange Abendkleider trugen und ihre Schultern entblößten, bereitwillig romantisch nannte Kakimo sie, war dieser Ort mit der aufgemalten Meereslandschaft, Wasser, Sand, Sonne und Fußstapfen am Strand, eine Art Refugium – übersah man die Aufpasser, die zwischen den tanzenden Menschen patrouillierten, und das Hinterzimmer, in das Paare für eine halbe oder ganze Stunde verschwanden, eine Kammer, die von einer geschwärzten Glühbirne beleuchtet und mit einer Couch aus dunklem Leder möbliert war, die Wände beklebt mit Tapetenresten, ein japanisches Papierfenster in der Mitte der Mauer und ein Kassettenrekorder auf dem gewellten Linoleumboden, der bei jedem Schritt quietschte.
»Die Kondome musst du selbst mitbringen, dafür kannst du dir das Mädchen und die Musik aussuchen«, pflegte Kakimo zu sagen, »aber vorher bezahlen!«
Als Johnny Eve das zweite Mal begegnete, lag sie in den Armen eines amerikanischen Soldaten, dem der Stehblues nicht reichte, er drängte in Richtung Hinterzimmer. Ihre Lippen waren genauso rot wie ihr Kleid, ihre Haare waren hellbraun gebleicht und eingedreht, und durch das weiße Gesichtspuder schimmerte ihre natürliche, bräunliche Hautfarbe hindurch.
In dem Moment verlor Johnny jede Scheu vor ihr. »Was für ein Klischee du bist«, sagte er, »du bist das koreanische Klischee einer Amerikanerin, und, bist du stolz darauf?«
Der GI, der einzig verstand, dass ihm ein Typ seine Zeit stahl, wollte sich einmischen und war im Begriff, seine Fäuste auszupacken, als er von einer anderen Tänzerin abgelenkt wurde, die Kakimo herbeigescheucht hatte.
Eve legte ihre Hände auf Johnnys Schultern, drückte ihn an sich und hauchte in sein Ohr: »Es ist schwieriger, als es aussieht, versuch du es mal.« Dann stieß sie ihn weg. Er wurde von zwei Händen gepackt und mit einem Fußtritt auf die Straße befördert.
Er blieb zunächst sitzen, so verdutzt war er – nicht vom Rausschmiss, sondern von ihrer Schlagfertigkeit. Schließlich stand er auf, klopfte sich den Straßenstaub von der Kleidung und fuhr sich mit einem Kamm durch die Haare. In einer dunklen Ecke zündete er sich eine Zigarette an. Obwohl er es nicht geplant hatte, wartete er auf sie. Einem Kind kaufte er eine Zeitung ab, einem anderen eine Packung Kaugummi, er ließ sich die Schuhe putzen und von einem lästigen Greis die Zukunft vorhersagen (der Straßenprophet erblickte in seiner Hand ein kurzes Leben). Er musste lange ausharren, erst kurz vor Mitternacht tauchte sie auf. Als er sie rief, sah sie sich um, hielt im Umdrehen ein Taxi an und sagte, ehe sie einstieg, sie werde nicht mit ihm ausgehen, nicht mit dem Klischee eines Koreaners.
In den nächsten Wochen ignorierte sie ihn an jeder Ecke in Jongno, auch die Postkarten, die er ihr schickte, die Briefe und Zeichnungen. Die Tanzschule durfte er nicht mehr betreten, Kakimos Riese blockierte die Tür. Jede Nacht wartete Johnny, zusammengekauert auf dem Asphalt, vor der blinkenden Leuchtreklame Dancing und Girls, während betrunkene Soldaten an ihm vorbeizogen und ihn nicht in Ruhe ließen, alle wollten zumindest einen Blick in sein Skizzenbuch werfen, das er stets bei sich hatte, manche von ihm porträtiert werden, und nicht wenige fingen einen Streit mit ihm an. Einen Monat lang fror er sich an dieser Ecke den Hintern ab, dafür füllten sich die leeren Seiten seines Buches, und er musste seine Skizzen kleiner und kleiner werden lassen, bis auch die letzten weißen Flecken des Papiers mit seinen Zeichnungen bedeckt waren.
Eines Nachts hörte er eine ihm vage bekannte Stimme, die Stimme einer Frau. Ob er Maler werden wolle, Künstler? Er sah auf und Eve ins Gesicht. Nein, antwortete er, eigentlich nicht, eigentlich wolle er Filme drehen, doch er habe kein Geld, deswegen gebe er sich damit zufrieden, seine Filme aufzuzeichnen, und er hielt ihr sein Büchlein hin. Sie nahm es, öffnete es und blätterte es langsam durch, Seite für Seite, manchmal lächelte sie, manchmal seufzte sie, schließlich klappte sie es zu und sagte, er zeichne schlecht, trotzdem gefielen ihr seine Filme. Sie nahm eine Zigarette aus der Manteltasche. Ob er Feuer für sie habe? Er nickte, versuchte das Streichholz anzureißen, es sprang ihm aus den Fingern, ebenso das zweite, erst beim dritten klappte es. Seine Finger waren klamm, klamm und steif, und er war sich nicht sicher, ob Eve tatsächlich vor ihm stand oder ob er es sich bloß einbildete, er hatte den ganzen Tag nichts gegessen.
Noch während er sie anstarrte wie der Kranich den Frosch im Sumpf, hakte sie sich bei ihm unter und sagte: »Lass uns von hier verschwinden, Johnny.«
Er fragte sie, weshalb sie ihn Johnny nannte, sie verriet es ihm nicht, obwohl er ihretwegen von der Akademie geworfen wurde. Sie sagte, sie könne ihn nur lieben, wenn er ihr nahe sei, also wich er nicht mehr von ihrer Seite. Sie sagte, er dürfe sich vor ihr nicht verstecken, er müsse sein wahres Ich offenbaren, also beichtete er ihr seine Geheimnisse und stellte sie allen seinen Freunden vor. Sie selbst zeigte sich ihm ausschließlich geschminkt; sogar wenn er bei ihr übernachtete, schlief sie mit einem weißen Gazetuch über ihrem Gesicht, unbeweglich wie eine Statue. Als er ihr erklärte, das Wissen um ihr tatsächliches Aussehen werde das Bild nicht verderben, das er von ihr habe, selbst etwas so Vollkommenes wie Jade habe Makel, gab sie sich verständig, unterließ es aber trotzdem, ihm ihr ursprüngliches Ich zu zeigen. Stattdessen erzählte sie ihm folgendes Märchen:
Als die Tiger lange Pfeifen rauchten, litt das Mädchen Yunmee an gebrochenem Herzen. Sie war unglücklich in einen Amerikaner verliebt, den sie in einer Bar bei den Militärbaracken nördlich von Seoul, in Uijeongbu, kennengelernt hatte.
Yunmee kam aus einer angesehenen Familie. Die Eltern waren tot, ihre fast zehn Jahre ältere Schwester, eine Schuldirektorin, war ihr strenger Vormund. Yunmee las gerne und viel, doch noch lieber waren ihr Filme, die Technicolor-Streifen aus Hollywood wie Du sollst mein Glücksstern sein oder Der Zauberer von Oz, allerdings waren es weniger die Geschichten, die sie faszinierten, sondern die blauen Augen und goldenen Haare der Filmstars – sie konnte sich an den Filmen nicht sattsehen, bald reichte es ihr nicht mehr, diese exotischen Menschen auf der Leinwand zu bestaunen, sie wollte vor ihnen stehen und sie anfassen. Mit diesem Vorsatz schlich sie zur Busstation, weder wusste sie, was sie in Uijeongbu erwartete, noch, ob sie, konfrontiert mit einem Blauauge, den Mut aufbringen würde, mit ihm zu sprechen.
Rund um die Militärbasis waren viele Geschäfte, Bars, Restaurants und Cafés zu finden, alle mit englischen Namen, und Bordelle, damit die GIs für weibliche Unterhaltung nicht mehr nach Japan gebracht werden mussten, wie das während des Koreakriegs der Fall gewesen war. In dieser Gegend durften sich Frauen aus gutem Hause nicht blicken lassen, wenn sie mit Männern aus gutem Hause verheiratet werden wollten, trotzdem (oder gerade deswegen) übte die Militärbasis eine starke Anziehungskraft auf sie aus, Yunmee war bei weitem nicht die Einzige, die die Straßen auf der Suche nach Blauaugen durchstreifte. Von einer Freundin hatte sie gehört, es gebe eine Bar, die ausschließlich von GIs frequentiert würde, sie hatte sich den Namen notiert, den Zettel allerdings zu Hause vergessen.
Sie betrat die erstbeste Bar. Diese war verraucht und dunkel, die Fenster waren klein und mit Vorhängen verhüllt. In einer Ecke stand ein stummes Grammophon, hinter der Bar rauchten der Barmann und seine zwei Helfer, und an der langen Theke lehnten ein paar Männer, nach denen sie nicht gesucht hatte. Sie waren weißhäutig, das ja, doch weder blond noch blauäugig, die Farbe ihrer Haare glich Kiefernrinde und die ihrer Augen Teer, mit dem Seoul gerade überzogen wurde.
Yunmee hatte keine gute Zeit gewählt, es war drei Uhr nachmittags, das Lokal würde sich erst in drei Stunden füllen. Als sie den Ort verängstigt und enttäuscht wieder verlassen wollte, spürte sie eine Hand auf ihrer Schulter; sie wagte nicht, sich umzudrehen, so blieb sie stehen wie ein Kerzenleuchter im Pfandhaus, und der Amerikaner musste um sie herumgehen, um sie anzusehen. Seine Augen waren blau, blau wie das Ostmeer im Sonnenlicht, und seine Haare unter der verdreckten Mütze gelb, dunkelgelb wie die Weizenfelder im Südosten Koreas. Der Amerikaner hieß Jeff und war Soldat, er erbarmte sich Yunmees und brachte sie zur Busstation, nachdem sie auf keine seiner Fragen in einer Sprache geantwortet hatte, die er verstand. Sie merkte nicht, dass sie Französisch mit ihm sprach, erst als der Bus angefahren kam, entdeckte sie ihren Irrtum und bedankte sich auf Englisch bei ihrem Retter, der das verwirrte Fräulein noch durch das kleine Busfenster um seine Adresse bat. Sie gab sie ihm, weniger, weil sie ihn wiedersehen, sondern weil sie ihm beweisen wollte, dass sie nicht der Hohlkopf war, für den er sie nach all dem Kauderwelsch halten musste.
Er kam sie tatsächlich besuchen, und es gelang ihnen, sich noch zwei Mal zu treffen, ehe er an die Direktorin geriet, die von der Haushälterin auf Yunmees Notiz, »Uijeongbu, Bar Acapulco«, aufmerksam gemacht worden war und daraufhin die jüngere Schwester vom Chauffeur hatte beschatten lassen. Private Jeff wurde durch einen Dolmetscher jeder weitere Kontakt mit Yunmee untersagt, und er hielt sich an das Verbot bis auf einen Tag im Mai ein halbes Jahr später, als er ihr durch einen Freund ein Briefchen zustecken ließ, in dem er ihr mitteilte, er werde morgen in die Vereinigten Staaten zurückkehren und wolle sie gerne noch ein letztes Mal sehen; er werde nach Sonnenuntergang beim Reishändler in ihrer Straße warten. Das Treffen kam zustande, Jeff ließ sich durch die misstrauischen Blicke des Reisverkäufers nicht einschüchtern, am Ende der Nacht kehrte der Amerikaner auf seine Basis zurück, um im Morgengrauen ein Flugzeug zu besteigen, und Yunmee in das Zuhause ihrer Schwester, um einen Monat später festzustellen, dass sie schwanger war.
Sie beschloss, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Sie wollte den Schein wahren, trotz der Gerüchte, die von den Nachbarn in Umlauf gebracht worden waren. Eine Greisin, die dabei helfen sollte, ihn aufrechtzuerhalten, trug dazu bei, dass die bröckelnde Fassade vollends kollabierte: Sie verlangte für den Eingriff eine dermaßen hohe Summe, dass Yunmee keine andere Wahl blieb, als ihrer Schwester alles zu beichten; daraufhin wurde sie aus dem Haus geworfen. Noch am selben Tag verwandelte sich Yunmee in Eve – Eve wie Eve Harrington in Alles über Eva. Es war Henry Lewis, der amerikanische Ehrengast auf Haesuns Hochzeit, der ihr den Namen gab. Als er sie das erste Mal sah, im beigefarbenen Trenchcoat, einen schlabbrigen Regenhut auf dem Kopf, unter dem ihre Locken hervorlugten, habe sie ausgesehen wie Anne Baxter zu Beginn des Films, wenn sie Bette Davis um ein Autogramm bittet. Yunmee gefiel nicht nur der Name, sondern auch die Figur der Eve Harrington, ihr berechnendes Verhalten, ihr Kalkül, und sie begann sich wie sie zu kleiden, ihr Haar genauso hochzustecken und die Stirnfransen einzudrehen.
Das Geld für die neue Garderobe, die Dauerwelle und die Arztrechnung lieh sie sich von Kakimo, einem Bekannten Henrys, dafür musste sie sieben Mal die Woche, von sieben Uhr abends bis Mitternacht, mit jedem tanzen, der mit ihr tanzen wollte. Sie plante, dies so lange zu tun, bis sie ihre Schuld beglichen hatte, dann aber stellte sie fest, dass sie als Tänzerin an einem Abend mehr Geld verdiente als eine Fabrikarbeiterin in einem Monat, und sie blieb Kakimos Dancing School treu.
Ob sie seither viele Herzen gebrochen habe, fragte Johnny. Sie lachte laut auf. Ein Verehrer sei ihretwegen in die Irrenanstalt gekommen. In die Irrenanstalt? Johnny war beeindruckt. Eve nickte. Er sei der Sohn eines hohen Regierungsbeamten gewesen, die Familie habe im vornehmen Angukdong gewohnt, einen Chauffeur, eine Köchin, mehrere Dienstboten und Privatlehrer beschäftigt und regelmäßig Ausflüge nach Tokio unternommen. Der Sohn habe sehr gut Englisch gesprochen, weil er als Kind in New York von einer Nanny betreut worden war. Dieser frühe westliche Einfluss habe sich jedoch als verhängnisvoll erwiesen: Er habe sich für koreanische Frauen nicht erwärmen können, schon gar nicht für die, die ihm seine Mutter als potentielle Ehefrauen vorführte. Wie in einer Modenschau trabten die reichen Erbinnen durch die endlos langen Flure der Villa und drehten ihm dabei jede ihrer Seiten zu, dennoch gefielen sie ihm nicht. Auf einer seiner nächtlichen Streifzüge schließlich sei sie ihm begegnet, und während sie zu Glenn Millers Serenade in Blue