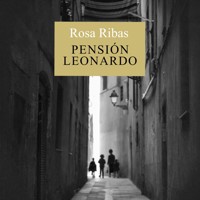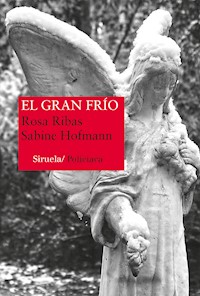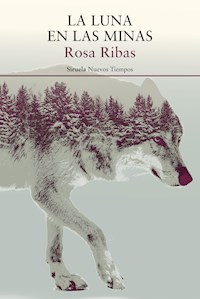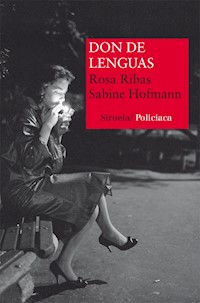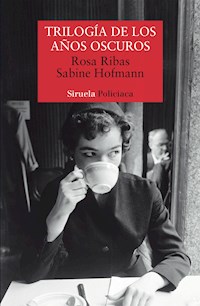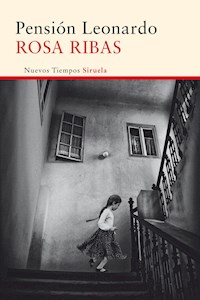7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ana Martí ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Dunkel wie der Winter. Kalt wie der Schnee. Barcelona, 1956: Ausgerechnet im kältesten Winter seit Jahrzehnten wird die junge Journalistin Ana Martí in ein entlegenes Bergdorf in Aragonien geschickt, um über ein Mädchen mit Stigmata an Händen und Füßen zu berichten. Von den Dorfbewohnern wird die kleine Isabel wie eine Heilige verehrt, Ana hingegen ist skeptisch. Aber noch ehe sie dem Geheimnis der Wundmale auf die Spur kommt, wird auf dem schneebedeckten Waldboden die Leiche eines Mädchens gefunden. Offenbar nicht das erste Kind, das in Las Torres unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen ist. Der neue Fall für die Journalistin Ana Martí, die im Spanien der Franco-Zeit ermittelt: ein spannender Kriminalroman voller Atmosphäre und von archaischer Kraft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Ähnliche
Rosa Ribas • Sabine Hofmann
Die große Kälte
Kriminalroman
Über dieses Buch
Dunkel wie der Winter. Kalt wie der Schnee.
Barcelona, 1956: Ausgerechnet im kältesten Winter seit Jahrzehnten wird die junge Journalistin Ana Martí in ein entlegenes Bergdorf in Aragonien geschickt, um über ein Mädchen mit Stigmata an Händen und Füßen zu berichten. Von den Dorfbewohnern wird die kleine Isabel wie eine Heilige verehrt, Ana hingegen ist skeptisch. Aber noch ehe sie dem Geheimnis der Wundmale auf die Spur kommt, wird auf dem schneebedeckten Waldboden die Leiche eines Mädchens gefunden. Offenbar nicht das erste Kind, das in Las Torres unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen ist.
Der neue Fall für die Journalistin Ana Martí, die im Spanien der Franco-Zeit ermittelt: ein spannender Kriminalroman voller Atmosphäre und von archaischer Kraft.
Vita
Rosa Ribas, geboren 1963 in El Prat de Llobregat, studierte Hispanistik in Barcelona und lebt seit 1991 in Frankfurt am Main. Bisher hat sie neun Romane veröffentlicht.
Sabine Hofmann wurde 1964 in Bochum geboren. Sie studierte Romanistik und Germanistik und arbeitete als Dozentin an der Universität Frankfurt, wo sie auch Rosa Ribas kennenlernte.
2014 erschien «Das Flüstern der Stadt», ihr erster gemeinsamer Roman und der erste Fall für die Journalistin Ana Martí, die im Spanien der Franco-Zeit ermittelt. Über ihre Erfahrungen beim Schreiben haben die Autorinnen ein Arbeitsjournal verfasst, nachzulesen unter: www.rowohlt.de/ribas-hofmann
Impressum
Die spanische Ausgabe erschien 2015 unter dem Titel «El gran frío» bei Siruela, Spanien.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«El gran frío» Copyright © 2015 by Rosa Ribas & Sabine Hofmann
Redaktion Johanna Schwering
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Umschlagabbildungen Getty Images; OSORIOartist/iStockphoto.com
ISBN 978-3-644-31561-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Dieses Spiel mag ich nicht.
Ich verstehe es nicht. Muss man vielleicht ganz still sein?
Verstecken! Ist es Verstecken?
Aber wo sind dann die anderen? Ich mag keine Spiele, die ich nicht verstehe.
«Pili, dieses Spiel mag ich nicht. Steh endlich auf.»
Warum steht sie nicht auf?
Wie lustig! Sie hat die Schuhe falsch rum an. Den rechten links und den linken rechts. Früher hat mir Mutter manchmal die Schuhe falsch rum angezogen, wenn sie es eilig hatte, aber jetzt ziehe ich sie mir selbst an, und ich mache es immer richtig. Fast immer. Neulich hat Vater mich angeschrien und mich durcheinandergebracht. Weil er geschrien hat und gesagt hat, dass ich nicht nur dumm bin, sondern auch langsam. Und da habe ich mir die Schuhe falsch rum angezogen. Ich habe aber nichts gesagt. Damit er mich nicht schlägt. Aber hinterher hat es weh getan, und außerdem bin ich hingefallen.
«Pili, bist du hingefallen? Hast du dir weh getan? Warum bewegst du dich nicht?»
Vielleicht weint sie ja. Mädchen legen sich hin, wenn sie weinen. Jungen nicht. Jungen weinen nicht. Weil Jungen Männer sind und Männer nicht weinen.
«Bist du traurig, Pili? Nicht weinen.»
Ich kitzele sie mal. Das hält sie nicht lange aus, sie muss immer lachen, wenn ich sie kitzele.
«Pili! Los, lach schon.»
Sie rührt sich nicht.
Kalt ist sie auch.
«Pili!»
Das war das Monster. Aber das Monster bringt die Mädchen nicht um. Es tut ihnen weh, aber es bringt sie nicht um. Es tut ihnen weh, deshalb haben sie alle Angst vor ihm, aber es bringt sie nicht um.
Und wenn es noch hier ist?
Ich habe keine Angst. Wenn das Monster kommt, bringe ich es um. Ich lasse nicht zu, dass es Pili auffrisst.
«Monster, komm her, wenn du dich traust.»
1
Und falls sich der Chef doch geirrt hatte?
Sie stieg an der Plaza de España aus der Straßenbahn und war sicher, dass Señor Rubio zum ersten Mal in den drei Jahren, die sie nun für ihn arbeitete, falschlag. Ana blickte zu den öffentlichen Toiletten an der Ecke zur Calle Cruz Cubierta hinüber. Gerade strebte ein Mann auf das Häuschen zu, schon im Gehen streifte er sich die Handschuhe ab.
Es war eindeutig ein Fehler gewesen, sie zum Ort des Geschehens zu schicken. Keiner der Beteiligten würde ihr etwas erzählen. Nicht nur weil sie eine Frau war. Auch mit einem Mann würde niemand gerne darüber sprechen, weder die Arbeiterinnen der Glühbirnenfabrik noch die Männer, an die die verhaftete Kupplerin sie vermittelt hatte.
Wenn es einen Toten gab, war es einfacher. Der Tod machte die Menschen gesprächig, vor allem, wenn er nicht in ihrer Nähe zuschlug, sondern nur einen entfernten Verwandten, einen Nachbarn oder eine Zufallsbekanntschaft erwischte. So wie sich nach Beerdigungen zwangsläufig heftiger Hunger einstellte, löste ein Toter bei den Leuten nervöse Wortkaskaden aus, selbst wenn sie gerade einmal die Schuhspitze der Leiche gesehen hatten.
Aber bei einem Fall wie dem der Kupplerin, die offiziell als Losverkäuferin unterwegs war, wollte niemand etwas gewusst haben. Glaubte ihr Chef etwa, dass die Mädchen aus der Fabrik, die sich mit den arrangierten Rendezvous etwas dazuverdienten, mit Ana darüber reden würden? Wie stellte er sich derartige Gespräche vor?
«Hallo, bist du eine von den … na, du weißt schon …»
Er würde wohl auch nicht von ihr erwarten, dass sie um die Männertoiletten herumstrich und mögliche Kunden der Zwergin ansprach, wenn diese sich mit kaum verhohlener Eile näherten. Oder, noch besser, wenn sie weitaus langsamer wieder herauskamen, der eine oder andere noch mit seinem Hosenschlitz beschäftigt, und sie den Moment männlicher Erleichterung nutzte, um sie mit der Frage zu überfallen: «Verzeihung, mein Herr, gehörten Sie auch zu den Kunden von Paulina Sánchez?»
Da würden doch alle Männer sofort die Flucht ergreifen. Die einen, weil es ihnen peinlich war, just in diesem Moment auf einen unbekannten Namen angesprochen zu werden, die anderen, weil sie wussten, was es mit Paulina Sánchez auf sich hatte, auch wenn diese als «Losverkäuferin» oder «Lottozwergin» bekannt war, und sie würden Ana für einen Polizeispitzel halten.
Die Frau war vor drei Tagen aufgrund der anonymen Anzeige einer Arbeiterin aus der Glühbirnenfabrik «Z» in der nahegelegenen Calle de México verhaftet worden. Jeden Morgen hatte sie mit ihren Losen von der Blindenlotterie an der Wand des Toilettenhäuschens gesessen. Den Namen «Lottozwergin» hatte sie bekommen, weil sie nicht größer als einen Meter dreißig war. Ihre Wirbelsäule knickte nach vorn ab, sodass ihr Rumpf nicht wesentlich länger wirkte als ihr riesiger Kopf. Ihre Beine waren so kurz, dass die Füße den Boden vor ihrem Stuhl nicht berührten.
Ana hatte sie auf dem Polizeifoto erkannt, das Rubio ihr gezeigt hatte. Sie hatte die Zwergin oft hier gesehen, die Los-Coupons an die Brust geheftet und immer inmitten einer Traube von Männern. Jetzt wusste Ana, dass die Männer keine Lose gekauft hatten.
Lange hatte Paulina Sánchez als Kupplerin gearbeitet, und alles schien gut zu laufen: Die Männer kamen zu ihr, damit sie ihnen eines der Mädchen aus der Fabrik vermittelte. Sie nannten ihre Vorlieben hinsichtlich Alter, Körperbau oder Haarfarbe, so wie andere Kunden sie um Lose mit ungeraden Nummern, einer Acht am Ende oder ohne Fünf in der Ziffernfolge baten. Die Losverkäuferin vereinbarte mit ihnen Tag und Uhrzeit und gab ihnen die Adresse des Etablissements. Dieses Verfahren hatte reibungslos funktioniert, bis irgendein Rädchen aus der Spur geraten war und es zerstört hatte. Eine der Frauen konnte es nicht gewesen sein, sie hatten kein Interesse daran, ihre Tätigkeit öffentlich zu machen. Ana glaubte nicht an die offizielle Version, der zufolge eine der neuen Arbeiterinnen die Zwergin angezeigt hatte, aus moralischer Empörung darüber, dass diese es gewagt hatte, ihr ihre Dienste anzubieten.
Obgleich sie nicht erwartete, weitere Informationen für ihren Artikel zu bekommen, schlenderte sie einen Moment lang zwischen dem Toilettenhäuschen und der Bar La Pansa auf und ab. Hin und wieder warf sie einen Blick auf ihre Uhr, damit es so aussah, als wartete sie auf jemanden. Irgendetwas – vielleicht ihr journalistischer Instinkt, vielleicht ihre Sturheit, vielleicht die Erfahrung aus vier Berufsjahren – hinderte sie daran, den Platz zu verlassen und Rubio mitzuteilen, dass es dieses Mal nichts genutzt hatte, vor Ort zu sein und, wie ihr Chef zu sagen pflegte, sich die Füße im Schlamm der Straße schmutzig zu machen.
Schmutzig waren ihre Füße genau genommen zwar nicht, dafür aber eiskalt. In den Zeitungen hieß es, die Temperaturen seien in diesem Winter so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Die Kollegen, die am meisten zu Übertreibungen neigten, sprachen schon von einer «neuen Eiszeit im Jahre 1956».
Der feuchte und schneidende Januarwind hatte es jetzt geschafft, unter ihren Mantel zu kriechen. «Noch fünf Minuten, und dann gehe ich», hatte sie sich schon mehrmals gesagt, während sie auf dem Bürgersteig auf und ab marschierte, den Mantel fest um sich gezogen und die Arme vor der Brust verschränkt.
Während sie überlegte, ob sie sich in einem Café in der Nähe aufwärmen oder besser direkt nach Hause zurückkehren sollte, sah sie den Losverkäufer, der aus der Calle Cruz Cubierta kam. Er stützte sich mit der Rechten auf die Schulter eines Mädchens, dessen Zöpfe dicker als ihre Arme schienen. Das Mädchen führte ihn, und die beiden kamen zügig voran. Die Leute wichen ihnen aus, sobald sie sie bemerkten, und das Mädchen umging geschickt alle Hindernisse.
Der Blinde war ungefähr fünfzig Jahre alt. Wenn er nicht der Vater des Mädchens war, so musste er zumindest mit ihr verwandt sein. Seine Arme und Beine waren ebenfalls extrem mager, an dem windigen Tag klebte der Stoff seiner dünnen Hosen geradezu an den fleischlosen Waden. Seine wettergegerbte Haut war so dunkel, dass die Augäpfel hell hervortraten, als wären sie von innen beleuchtet.
Sie kamen an Ana vorbei. Der Mann hatte sich die Los-Coupons mit Stecknadeln an die Mantelaufschläge geheftet. Das Mädchen führte ihn bis zu einer sonnigen Stelle vor der Wand, an denselben Platz, an dem auch die Zwergin gesessen hatte. Dann kontrollierte sie, ob alle seine Mantelknöpfe geschlossen waren, und verabschiedete sich. Der Blinde tätschelte ihr die Wange.
Bevor das Mädchen in die Straßenbahn in Richtung Paralelo stieg, drehte es sich immer wieder um, als ob es sich vergewissern wollte, dass es den Mann auf den richtigen Platz gesetzt hatte.
Vielleicht hatten sie eine Vorahnung, weil sie so oft vor Ort auf der Straße gewesen waren, vielleicht lag es auch einfach nur daran, dass sie eiskalt waren – jedenfalls waren es Anas Füße, die die Initiative ergriffen. Ihr Kopf fing erst an, einen Plan zu entwerfen, als sie schon bei dem Blinden angelangt war.
«Das Glück! Das Glück!», rief der Mann aus, als er spürte, dass jemand vor ihm stand.
«Etwas Glück kann ich wirklich brauchen», sagte Ana.
«Das lässt sich machen.» Der Blinde ließ grinsend seine Finger über die Lose gleiten. «Hiermit.»
Ana verspürte leichte Gewissensbisse, weil sie die Tatsache ausnutzte, dass der Mann sie nicht sehen konnte. Ihre Kleidung hätte ihm sofort gesagt, dass sie keine Fabrikarbeiterin war. Sie trat noch etwas näher heran und murmelte: «Ich bräuchte etwas Zuverlässigeres. Einen kleinen Nebenverdienst.»
«Arbeitest du in der Fabrik?»
Die Frage verriet ihn. Wenn er von nichts gewusst hätte, hätte er erstaunt sein müssen.
«Ja.»
«Ledig oder verheiratet?»
«Verheiratet», log Ana.
«Also hast du die Premiere schon hinter dir. Kanntest du die Zwergin?»
«Ja. Sie hat mir manchmal geholfen.»
«Und weißt du, was ihr passiert ist?»
«Ja. Deshalb habe ich gedacht, dass Sie vielleicht …»
«Komm ein bisschen näher, Süße.»
Sie machte einen Schritt auf ihn zu, als ob sie die Losnummern an seinem Mantel lesen wollte. Eine widersprüchliche Geruchsmischung schlug ihr entgegen: Waschmittel und säuerlicher Schweiß. Aber er ließ ihr keine Zeit zu spekulieren, ob er saubere Kleidung trug, weil das Mädchen sie ihm wusch. Eine knochige Hand fuhr über ihren Körper, den Arm hinauf, zu ihrer linken Brust, hinab zur Taille und suchte unter dem Mantel den Weg zwischen ihre Beine.
Ana sprang zurück. «Was machen Sie da?»
«Ich kann die Qualität der Ware nicht sehen wie die Zwergin. Mit der Figur verdienst du bestimmt ganz gut, oder?»
Sie unterdrückte den Impuls wegzulaufen. Wenn sie die demütigende Situation schon über sich ergehen ließ, sollte zumindest etwas dabei herausspringen.
Sie schloss den Mantelknopf, den der Blinde mit seinen dürren Fingern blitzschnell geöffnet hatte. «Also, können Sie mir weiterhelfen oder nicht?»
Der Blinde fing an zu lachen. «Ich? Nein, meine Süße. Ich wollte bloß mal etwas frischeres Fleisch in der Hand haben als das meiner Frau.»
«Sie sind ein Schwein!»
«Du hast doch wohl nicht geglaubt, dass wir Blinden von Natur aus bessere Menschen sind?»
Ana verschlug es für einen Moment die Sprache.
«Aber ich will mal nicht so sein. Ich habe was für dich.»
Er hob die Hand, mit der er sie betatscht hatte, und fuhr in der Luft den Weg über Anas Körper nach. Sie wich einen weiteren Schritt zurück.
«Geh in die Boquería. Da verkauft ein Krüppel Lose, er hilft manchmal den Marktfrauen, sich ein paar Peseten extra zu verdienen.»
«Ein Krüppel?»
«Ja, du kannst ihn nicht verfehlen. Er hat keine Beine mehr und sitzt auf einem kleinen Holzkarren. Um sich abzustoßen, steckt er die Hände in alte Schuhe. Aber sei vorsichtig, er knutscht gerne», fügte er mit einem schmutzigen Lachen hinzu.
Ana beherrschte sich, um ihn nicht zu ohrfeigen. Blinde schlägt man nicht.
«Und der Krüppel ist nicht verhaftet worden?»
«Nein. Weil niemand ihn angezeigt hat. Er mag verkrüppelt sein, doch er betrügt weder die Mädchen noch die Kunden bei der Abrechnung.»
«Aber die Zwergin hat das getan?»
«So ist es, Süße. Habsucht macht blind.»
War das ein Witz, oder hatte der Losverkäufer einfach nur eine Redewendung gebraucht?
«Keine Sorge, bei ihm bist du in guten Händen.» Er lachte wieder.
Langsam hatte Ana von diesem Blinden und seinem Lachen genug, aber eine Frage musste sie noch klären.
«Wissen Sie, wer die Zwergin angezeigt hat?»
«Du bist ganz schön neugierig, Süße.»
«Ich will nicht, dass mir etwas passiert. Ich habe Familie.»
«Dir wird nichts passieren. Die Zwergin hatte Ärger. Sie hat den Polizisten, den sie bestochen hat, übers Ohr gehauen. Habsucht hat schon so manchen ins Verderben gestürzt. Gegen die Habsucht die Großzügigkeit. Jetzt willst du bestimmt ein paar Lose kaufen, oder?»
Ana holte ihr Portemonnaie aus der Tasche, öffnete und schüttelte es, sodass das Kleingeld klirrend aneinanderschlug. Dann ließ sie den metallenen Verschluss laut zuschnappen. Der Blinde streckte in Erwartung der Münzen die Hand aus.
«So etwas Dummes», sagte Ana. «Ich habe gar kein Geld dabei.»
«Macht nichts», erwiderte der Blinde lächelnd. «Wie man in den Wald hineinruft … Beschwer dich aber hinterher nicht, wenn eins von meinen gewinnt. Und wenn du nichts kaufen willst, gehst du jetzt besser. Ich muss auf meinen Ruf achten.»
Dieses Mal klang sein Lachen teuflisch.
Die Stimme des Blinden verfolgte Ana bis zur Straßenbahnhaltestelle. Er leierte: «Das Glück, das Glück. Gegen die Trägheit den Fleiß. Gegen den Zorn die Geduld. Das Glück, das Glück. Gegen die Wollust die Keuschheit, gegen den Neid die Nächstenliebe.»
Als sie an der Haltestelle ankam, fuhr gerade eine Straßenbahn ein. Sie stieg ein, ohne nachzuschauen, ob es die richtige war. Hauptsache, sie brachte sie fort von dem Blinden und seinem Singsang.
«Das Glück, das Glück. Gegen den Hochmut …»
Die Tür der Bahn schloss sich hinter ihr.
«Die Demut», murmelte Ana.
«Wie bitte?», fragte der Schaffner.
«Nichts.»
Sie legte das Geld auf die Theke und nahm den Fahrschein entgegen. Es war die richtige Straßenbahn. Sie fand einen freien Sitzplatz. Auf der Straße liefen die Leute vornübergebeugt, starr vor Kälte trotz der schwächlichen Sonne.
Obwohl die Polizei die Presse über die Verhaftung der Kupplerin informiert hatte, würde es nicht leicht sein, den Artikel zu verfassen. Sie würde viele Umschreibungen finden müssen, um die Schere der Moralwächter zu umgehen, die unbarmherzig alles zensierten, was, wie sie es nannten, mit dem sechsten Gebot zu tun hatte.
Auch über den geschmierten Polizisten würde sie kein Wort schreiben dürfen. Dass ein Repräsentant der Staatsmacht korrupt war, durfte man nicht einmal andeuten, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Streifenpolizisten handelte. Nicht nur das aufgezwungene Schweigen dämpfte den Stolz über ihre Entdeckung, sondern auch der Preis, den die Auskunft sie gekostet hatte. Unwillkürlich lehnte sie sich im Sitz nach rechts, als wollte sie der Hand des Blinden abermals ausweichen.
Aber auch wenn die Zensur sie fesselte und knebelte, ihre Neugier hatte sie behalten. Sie beschloss, den Krüppel zu suchen, um den Dingen auf den Grund zu gehen.
Sie erreichte die Ramblas. Schon vor dem Schirmgeschäft am Pla de la Boquería hörte sie eine Stimme mit metallischem Timbre singen: «Das Glück, das Glück. Es sind nur noch ein paar übrig. Bringt Glück, jedes Stück. Kaufen Sie, schöne Frau.»
Der Blinde hatte recht, der Krüppel war tatsächlich leicht zu erkennen. Seine Beine endeten ein Stück über dem Knie, er saß auf einer Holzkiste, die darunter montierten Räder schienen von Rollschuhen zu stammen. Daneben lagen die Schuhe, mit denen er sich abstieß.
Ihre Füße waren immer noch kalt und geschwollen, die Fahrt in der Straßenbahn hatte sie nicht aufgewärmt. Trotzdem suchte Ana nun einen geeigneten Platz auf der Straße, um den Mann zu beobachten. Sie bezog auf dem Bürgersteig gegenüber Stellung, in der Nähe eines Kiosks, und begann wieder zu warten.
Der Krüppel nannte singend die Zahlen, sprach Passanten an und summte immer wieder ein Liedchen. Nach einer halben Stunde hatte er einige Losstreifen verkauft: an eine ältere Frau, die mit einem Korb aus der Markthalle kam, an einen Mann in einer Verkäuferschürze, an eine Frau mit einem widerspenstigen Kind. Dann trat ein Mann mittleren Alters auf ihn zu und bot ihm eine Zigarette an. Der Mann zündete ihm die Zigarette an, der Krüppel nickte. Kurze Fragen, knappe Antworten, wie bei einer Verabredung. Wann? Wo? Einverstanden? Ja. Nein. Gut. Auf Wiedersehen. Der Mann entfernte sich. Lose hatte er nicht gekauft.
Der Krüppel rauchte die Zigarette zu Ende, drückte sie auf dem Pflaster aus und legte den Stummel in eine Schachtel neben seinem linken Oberschenkel, danach zog er sich die Schuhe über die Hände und rollte in die Markthalle. Das Quietschen der Räder drang bis zu Ana hinüber, die sich sofort in Bewegung setzte. Sie überquerte die Ramblas und betrat ebenfalls die Markthalle.
Um diese Zeit war in der Boquería viel Betrieb. Der Kopf des Krüppels erschien und verschwand zwischen den Bäuchen und Taillen der Menschenmenge in den Gängen. Um sich seinen Weg zu bahnen, drückte er immer wieder auf eine birnenförmige Gummihupe an seinem Wägelchen. Wie die von Harpo Marx, dachte Ana.
Vor einem Metzgereistand hielt der Krüppel an. «Mädchen, ich bring dir die Nummer, die du reserviert hast», rief er einer der beiden Verkäuferinnen zu.
«Einen Moment, ich komme sofort», erwiderte die Frau.
Sie war Mitte dreißig, ihre Hände waren rot von dem kalten Fleisch, das sie mit riesigen Messern zerlegte. Sie hatte gerade ein paar Rippchen zerteilt und wickelte sie nun ein, um sie der Kundin zu reichen. Der Krüppel wartete mitten im Gang auf sie. Er brauchte keine Hupe, damit die Leute ihm auswichen. Nachdem sie das Wechselgeld in eine Holzschachtel gelegt hatte, wischte die Verkäuferin sich die Hände an einer Schürze ab, die am Morgen weiß gewesen sein musste, klappte einen Teil der Marmortheke hoch und kam heraus. Sie trat auf den Krüppel zu und beugte sich hinunter, um die Lose in Empfang zu nehmen. Der Mann flüsterte ihr etwas ins Ohr, während um sie herum die anderen Verkäufer schreiend ihre Ware anpriesen, Fleischstücke wogen, kassierten und Wechselgeld herausgaben. Wie viel der Mann mit den Zigaretten wohl für seine Ware bezahlte?
Eine Stunde später, auf dem Heimweg, korrigierte Ana sich. Der Chef hatte sich nicht geirrt.
2
Nach dem Essen ging Ana ihre Notizen durch und schrieb einen Entwurf für den Artikel, der in der kommenden Woche in der nächsten Ausgabe von El Caso erscheinen sollte. Dann zog sie sich um, denn am Abend würde sie an einem Galaempfang teilnehmen, über den sie berichten sollte, und nach ihrem Besuch bei Enrique Rubio würde ihr keine Zeit bleiben, noch einmal nach Hause zurückzukehren. Glücklicherweise hatten ihre reichen Cousinen immer noch Freude daran, der in ihren Augen etwas exzentrischen Verwandten abgelegte Kleidungsstücke zu schenken, sodass Anas Kleiderschrank mit Abendkleidern bester Qualität gut bestückt war. Sie änderte sie mit der Nähmaschine ab, die sich den hellsten Fleck in der Wohnung mit ihrer Olivetti teilte. Allerdings würde sie ihrer Cousine Claudina, die sich nach ihrer Hochzeit von einer grazilen und modebewussten jungen Frau in eine rundliche Matrone verwandelt hatte, niemals sagen, dass sie sich aus dem übriggebliebenen Stoff ihres türkisfarbenen Samtkleides noch zwei Sofakissen hatte nähen können.
Trotz der Kälte stieg sie die vier Stockwerke auf Strümpfen hinab, ihre Pumps in der Hand: Sie wollte eine Begegnung mit der Hausmeisterin vermeiden. Teresina Sauret verwickelte sie jedes Mal in ein Gespräch, wenn sie mitbekam, dass Ana gut gekleidet das Haus verließ, um herauszufinden, was sie am Abend vorhatte. Seit Ana für Mujer actual schrieb, zählte Teresina Sauret zu ihren ergebensten Bewunderinnen, auch wenn sie es nach wie vor missbilligte, dass Ana als junge Frau allein lebte. Diesmal gelang es ihr, unbemerkt zum Hauseingang zu schleichen. Aus der Wohnung der Hausmeisterin tönten aufgeregte Stimmen und dramatische Musik. Die Radioserie schien gerade an einem Punkt angelangt zu sein, der die gesamte Aufmerksamkeit der Zuhörerin forderte. Trotzdem öffnete Ana sicherheitshalber die Haustür, bevor sie sich die Schuhe anzog, damit sie gegebenenfalls schnell aus dem Haus schlüpfen konnte.
Es war noch kälter geworden. Sie schlug den Mantelkragen hoch und machte sich auf den Weg zur Ronda de San Antonio.
«El ’ciero, La Vanguardia! El ’ciero!» Der Zeitungsjunge stand neben der Straßenbahnhaltestelle und schwenkte ein Exemplar des Noticiero Universal. Die lange Jacke, die er mit einem alten Hosengürtel zugebunden hatte, reichte ihm bis zu den Waden. Da Ana ihr Tempo verringerte, blickte der Junge sie fragend an: «El Noticiero? La Vanguardia? Welche wollen Sie?»
Sie schüttelte den Kopf, bevor sie in die Straßenbahn stieg, die gerade einfuhr. Keine von beiden.
Die Vanguardia hatte sie verlassen. Beim Noticiero Universal hatte man sie nicht gewollt. Im Grunde genommen hatte sie La Vanguardia verlassen, weil man sie dort ebenfalls nicht mehr gewollt hatte. Die Tür zur Redaktion der Vanguardia hatte ihr Mateo Sanvisens geöffnet, der Chefredakteur der Tageszeitung und ein alter Freund ihres Vaters. Ihr Vater galt, wie viele Journalisten nach dem Bürgerkrieg, als politisch belastet und hatte Berufsverbot. Einigen in der Redaktion hatte es nicht gepasst, mit einer Frau zusammenzuarbeiten, aber solange ihre Tätigkeit sich darauf beschränkte, Berichte für die Gesellschaftsnachrichten zu schreiben und Texte zu verfassen, die unter dem Namen anderer Kollegen veröffentlicht wurden, hatte man ihre Anwesenheit hingenommen. Doch der Erfolg, den Ana ihre Berichte über den Fall Sobrerroca bescherte, hatte Eifersucht und vor allem Neid geweckt.
«Eine unserer vornehmsten nationalen Eigenheiten, seit Jahrhunderten kultiviert», hatte ihre Cousine Beatriz kommentiert, als Ana sich beklagte.
Dann hatte Beatriz in ihrer Bibliothek ein Exemplar von Miguel de Unamunos Abel Sánchez gesucht und es ihr geliehen, damit sie sah, dass sie Opfer eines weit verbreiteten Übels war. Aber das hatte wenig geholfen, wenn sie die Sticheleien der Kollegen hörte, die sich wie giftige Dornen unter ihrem Lob verbargen: «Gute Arbeit! Wer hätte das erwartet!»
Darauf folgten die kleinen Feindseligkeiten: nicht erwiderte Grüße, verächtliche Blicke, Getuschel, das gerade laut genug war, damit sie es hören konnte: «Wofür hält sie sich eigentlich?»
«Na, das wissen wir doch, sie ist die Tochter von Andrés Martí. Sonst würde sie nicht hier arbeiten.»
Eine Zeitlang schützten sie drei Dinge: Mateo Sanvisens, die unzweifelhafte Qualität ihrer Arbeit und ihr Erfolg. Letzterer aber verkehrte sich ins Gegenteil, als Luis de Galinsoga davon erfuhr. Galinsoga, von Franco persönlich ausgewähltes Mitglied der Cortes, des einflusslosen, aber prestigeträchtigen Parlaments, wurde nach dem Bürgerkrieg vom Regime als Herausgeber der Zeitung eingesetzt, die ab diesem Zeitpunkt das Adjektiv «spanisch» in ihrem Namen tragen musste. Galinsoga verachtete die Stadt, in der die von ihm geleitete Zeitung erschien, und sorgte mit eiserner Hand dafür, dass die Redakteure sich strikt an die vorgegebene politische Linie hielten.
Anas Erfolg wirkte wie der Lichtkegel eines Scheinwerfers, und Galinsoga fragte sich plötzlich: Was macht eine Frau hier, bei meiner Zeitung? Und dazu noch die Tochter eines Roten?
Sanvisens bemühte sich, sie wieder unsichtbar zu machen. Erst schickte er sie zu den Gesellschaftsnachrichten zurück. Dann ließ er sie Texte schreiben, die ohne Verfasser oder unter fremdem Namen publiziert wurden. Irgendwann durfte sie nur noch Korrektur lesen. Sie hielt durch, bis sie begriff, dass ihre bloße Anwesenheit Sanvisens die Stelle kosten konnte, da er sich trotz des Drucks weigerte, sie zu entlassen.
Also ging sie. Besser gesagt, sie hörte eines Tages auf, in die Redaktion zu kommen. Es gab keine Verabschiedung, keine freundlichen Worte der Kollegen, auch nicht von denen, die Ana, so nahm sie zumindest an, schätzten. Nur einen großen Strauß Margeriten, den Sanvisens ihr zwei Tage später von einem Büroboten nach Hause bringen ließ. Weiße Margeriten, Zeichen der Unschuld und Schutz vor übler Nachrede. Er hatte ihre Entscheidung akzeptiert.
All das war jetzt vier Jahre her. Sie hatte sich vorgenommen, nicht mehr daran zu denken, und gewöhnlich hatte sie Enttäuschung und Groll unter Kontrolle, selbst beim Einschlafen, wenn die Verbitterung nur darauf lauerte hervorzutreten, sobald die Betriebsamkeit des Alltags sie nicht mehr in Schach hielt. Aber manchmal überfiel die Erinnerung Ana wieder, in der Straßenbahn, im Auto oder in einem Taxi, wenn ihr Blick ziellos aus dem Fenster wanderte und das Schaukeln des Fahrzeugs sie schläfrig und geistesabwesend machte. Dann pirschte sich die Erinnerung heran, versteckte sich hinter halbwachen Gedanken, um sie aus dem Hinterhalt anzuspringen: mit dem schmerzhaften Anblick ihres geräumten Tisches in der Redaktion, der verletzenden Bemerkung eines Kollegen oder einer Mutmaßung, was man hinter ihrem Rücken über sie gesagt haben mochte.
Sie stieg aus und nahm sich vor, die bitteren Erinnerungen in der Straßenbahn zurückzulassen.
Wenig später erreichte sie Señor Rubios Haus in der Calle Viladomat, wo sie bereits erwartet wurde.
Enrique Rubio war einer der Gründer des Boulevardblatts El Caso, und er war «die Redaktion in Barcelona». Obgleich nicht viel älter als sie selbst, war er für Ana Señor Rubio, ihr Chef, der ihr seit drei Jahren Aufträge gab, auch wenn kaum jemand davon wusste, da ihre Artikel unter einem Pseudonym erschienen.
Offiziell arbeitete sie für das Magazin Mujer actual, wo sie über das Treiben der höheren Gesellschaft von Barcelona berichtete, über Empfänge, Wohltätigkeitsveranstaltungen und Debütantinnenbälle, über Hochzeiten und Taufen. Auch Interviews mit Stars und Sternchen gehörten zu ihrer Arbeit. Ihr Lieblingsinterview war eines mit Amparo Rivelles, nachdem diese einen Film mit Orson Welles gedreht hatte. Doch war es ein Gespräch mit Mario Cabré, Schauspieler, Extorero und zeitweiliger Liebhaber von Ava Gardner, das ihr im Viertel unerwarteten und zuweilen etwas lästigen Ruhm verschafft hatte. Zu verdanken hatte sie ihn ihrer Hausmeisterin. Teresina Sauret hatte die Neuigkeit in allen Läden von San Antonio verbreitet, sowohl in denen, wo sie Stammkundin war, als auch in jenen, die sie ausschließlich zu besagtem Zweck aufgesucht hatte.
Wahrscheinlich betrachteten einige ihrer ehemaligen Kollegen von der Vanguardia ihren Weg als Rückkehr zu einer naturgegebenen Ordnung, vielleicht auch als verdiente Strafe für Hochmut. Wie hieß es noch? Gegen den Hochmut die Demut.
Doch was ihre Kollegen über ihre Arbeit für die Frauenzeitschrift dachten, war ihr nicht halb so wichtig wie die Meinung ihres Vaters. Als sie ihm erzählte, dass sie möglicherweise für El Caso arbeiten würde, hatte er durchblicken lassen, dass es ihm nicht gefiel, den Namen Martí unter den Artikeln eines Boulevardblatts zu sehen. Deshalb hatte Ana Enrique Rubio gebeten, ein Pseudonym verwenden zu dürfen.
«Wie Sie möchten.» Am Anfang hatten sie sich noch gesiezt. «Ihr Vater ist Andrés Martí, von der Vanguardia, nicht wahr?»
Sie wusste nicht, ob es Rubios Absicht war, aber die Bemerkung des Chefredakteurs verriet ihr, dass er ihre Beweggründe für einen falschen Namen verstand.
«Ja.»
«Ihr Großvater war ebenfalls ein bedeutender Journalist. Ein Meister seines Fachs. Ein großer Verlust für unsere Zunft.»
Ihr Großvater war vor zwei Jahren gestorben. Aus der Welt der Zeitung hatte er sich jedoch lange zuvor verabschiedet, und auch die Familie hatte er in gewisser Weise schon vor seinem Tod verlassen, da sein Verstand in den letzten Jahren immer trüber geworden war.
Rubio hatte also nichts gegen ein Pseudonym. Er selbst verwendete mehrere, um den Eindruck zu erwecken, dass eine Vielzahl von Redakteuren und Reportern für El Caso schrieb. Ana hatte zwei. Meistens benutzte sie den Namen «Sabino Rivas», manchmal, vor allem bei Berichten über seltsame Ereignisse, verwendete sie auch «Periquito Martínez», eine kleine Hommage an ihren Bruder Ángel, der in einer Familie von Barça-Anhängern unbeirrt zum Fußballclub Español Barcelona gestanden hatte, ein aufrechter «Periquito», wie die Fans von Español genannt wurden.
Sie hatte Enrique Rubio über Mateo Sanvisens kennengelernt, und als sie sich bei Rubio vorstellte, merkte sie, dass ihr ehemaliger Chefredakteur ihr den Weg geebnet hatte, denn Rubio war bestens über sie informiert.
«Ihre Arbeit im Fall Sobrerroca zeigt, wenngleich meines Wissens nicht alles veröffentlicht werden konnte, dass Sie genau die Art Journalistin sind, die wir brauchen. Jemand, der die Nachricht draußen, vor Ort, aufspürt und sich nicht scheut, sich die Füße im Schlamm der Straße schmutzig zu machen.»
So hörte Ana schon bei ihrem ersten Gespräch einen seiner wichtigsten Glaubenssätze. In den darauffolgenden Monaten hatte sie viel von ihm gelernt: geduldig zu beobachten, Schweigen hinzunehmen und den richtigen Moment für die richtige Frage abzuwarten. Rubio wiederum schätzte ihre Fähigkeit, genau hinzuhören und Nichtgesagtes zu erahnen.
Sie erinnerte sich gern daran, wie begeistert er war, als sie seine Frage, ob sie mit einer Kamera umgehen könne, bejaht hatte.
Weitere Punkte konnte sie verbuchen, als sie ihm von ihrer guten Beziehung zu Isidro Castro, dem Chefinspektor der Brigada de Investigación Criminal, erzählte, der neben dem Fall Sobrerroca, welcher ihm die Beförderung eingebracht hatte, noch weitere spektakuläre Fälle gelöst hatte.
«Es ist sicher nicht leicht, mit ihm auszukommen. Er gilt ja nicht gerade als Muster an Liebenswürdigkeit.» Aus Rubios Worten klang Bewunderung. «Aber er ist erstklassig. Erst kürzlich haben wir wieder über ihn berichtet.»
Er zeigte ihr eine der letzten Ausgaben von El Caso.
«Hier, leider ohne Bild, weil er sich partout nicht fotografieren lässt. Er hat den Fall mit diesen Betrügern gelöst, die Maschinen verkauft haben, mit denen man angeblich Geldscheine drucken kann.»
Und so hörte Ana an jenem ersten Tag einen weiteren von Rubios Glaubenssätzen: «Bei Betrügereien ist das Opfer meistens viel schlimmer als der Täter.»
Danach erklärte ihr Rubio ohne Umschweife die Arbeitsbedingungen bei der Zeitung. «Die Zensur hat uns besonders im Auge, weil wir sehr populär geworden sind. Glücklicherweise ist unser Herausgeber, Eugenio Suárez, nicht nur ein Falangist, sondern auch klug. Er präsentiert unsere Berichte als vorbeugende Maßnahme gegen das Verbrechen und natürlich auch als Schilderung der guten Polizeiarbeit.» Zufrieden nahm Rubio Anas verständnisvolles Lächeln zur Kenntnis. «Aber da wir in einem Land leben, in dem Friede und Ordnung herrschen, wurde uns eine Beschränkung auferlegt, was die Berichterstattung über inländische Mordfälle angeht: nur einen Mord pro Ausgabe.»
«Nur einen pro Woche?»
«Nur einen. Und den wählen wir gut aus.»
Und so wurde es gehandhabt, seit Ana für El Caso arbeitete. Außerdem fand Enrique Rubio Betrugsfälle ohnehin weitaus attraktiver als Schwerverbrechen. Daher interessierte ihn lebhaft, was Ana über die Geschäfte der Zwergin und des Krüppels herausgefunden hatte. Dennoch verzichtete Ana darauf, ihm alle Einzelheiten des Gesprächs mit dem Blinden zu berichten.
«Sehr gute Arbeit, Ana. Wir veröffentlichen es, ohne den Namen der Glühbirnenfabrik und natürlich ohne den bestochenen Streifenpolizisten zu erwähnen.»
Ana war einverstanden. Der leiseste Hinweis auf die mögliche Beteiligung eines Polizisten konnte dazu führen, dass die gesamte Ausgabe beschlagnahmt wurde. Was den Namen der Fabrik betraf, würde dieser den Lesern außerhalb der Stadt gleichgültig sein, und die Barceloneser würden ohnehin wissen, wer gemeint war. Journalisten schrieben zwischen den Zeilen, und ihre Leser konnten zwischen den Zeilen lesen.
«Was ist mit dem Krüppel?», fragte Ana.
«Auch das erwähnen wir besser nicht.»
«Aber …»
«Das ist Angelegenheit der Polizei.»
«Sagen wir ihnen Bescheid?»
«Ich nicht.»
Ana würde es auch nicht tun. Sie war schließlich kein Spitzel. Rubio war mit den Gedanken schon woanders. Er griff nach einem Notizblatt auf seinem Schreibtisch.
«Wenn du mit dem Artikel fertig bist, habe ich etwas Neues für dich.»
«Was denn?»
«Der Pfarrer eines Dorfes bei Teruel hat in der Redaktion der Zeitung angerufen. Ein gewisser», er las den Namen ab, «Don Benito Tena aus Las Torres. Wegen eines Mädchens, das offenbar Stigmata hat. Madrid hat den Fall an uns weitergereicht, weil Aragonien zu unserem Gebiet gehört.»
«Vielleicht eher weil die Geschichte wenig hergibt? Wenn eine Geschichte gut ist, gilt doch: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.»
Rubio warf ihr einen verständnisvollen Blick zu. Wenige Monate nachdem Ana begonnen hatte, für ihn zu arbeiten, hatte sie ihm ihre Ansichten über die Berichte mitgeteilt, die das Blatt im Jahr seiner Gründung, 1952, über die interplanetarische Kommunikation mit den Bewohnern des Planeten Gemide veröffentlicht hatte.
«Ich habe mich für die Zeitung geschämt», hatte sie in einem Anfall geradezu selbstmörderischer Aufrichtigkeit bekannt, «als ich die Seiten mit den Zeichnungen vom Inneren der Raumschiffe gesehen habe, die dieser angebliche ungarische Wissenschaftler persönlich besichtigt haben will.»
Die Gemiden brauchen unsere Mineralien hatte die Schlagzeile verkündet. Die Beiträge waren mit Zeichnungen von metallischen Gestalten illustriert, deren Köpfe aussahen wie zahnbewehrte Taucherhelme. Ihre Hände waren geisterhaft durchscheinend und saßen am Ende überlanger Arme. Einer von ihnen hatte der Zeitung ein Interview gewährt, er nannte sich D9.
«D9. Als ob sie Schiffeversenken spielten. Aber er war nichts weniger als Präsident der Atlantarischen Vereinigung und oberster Befehlshaber der intelligenzgenerierenden Gravitationsdienste!»
Rubio hatte sie reden lassen, er hatte nicht versucht, die Artikel zu verteidigen. Schließlich hatte er nur gesagt: «Gut. Jetzt kenne ich Sie schon etwas besser.»
Wenig später hatten sie angefangen, sich zu duzen.
Wenn Rubio also wusste, wie sehr Ana Aberglauben, unerklärliche Naturphänomene, Übernatürliches, kurz: alles Irrationale verabscheute, verstand sie nicht, warum er ihr jetzt den Auftrag gab, über angebliche Wundmale zu berichten.
«Was hat der Priester denn gesagt?»
«Dass das Mädchen Wunden an Händen und Füßen hat.»
«Bei dieser Kälte sind Frostbeulen nichts Ungewöhnliches.»
«Ana, deine Skepsis mag gesund sein, aber sie versperrt dir den Zugang zum Wunderbaren.»
«Das ist mir lieber so. Wir Journalisten sind schon von Berufs wegen Skeptiker.»
«Sicher», gab ihr Chef zu. «Aber Don Benito Tena hat versichert, dass die Wunden des Mädchens unzweifelhaft denen Jesu am Kreuz entsprechen. Ob es stimmt, wirst du überprüfen. Das Thema könnte für unsere Leser interessant sein. Außerdem berichten wir exklusiv.»
«Tatsächlich?»
«Ja. Der Pfarrer sagt, dass er nur uns benachrichtigt hat.»
«Ein schlauer Pfarrer.»
Die Auflage von El Caso war hoch, sehr hoch. Über 100000 Exemplare, keine andere spanische Zeitung konnte da mithalten. Das Blatt wurde in den Großstädten ebenso wie in den abgelegensten Dörfern gelesen.
«Wenn es wahr ist, was der Pfarrer sagt, und wir die Ersten sind, wird es ein Knüller.»
«Und wenn es nicht wahr ist, wovon ich ausgehe?»
«Na, nichts weiter. Eine Reise ins Maestrazgo, ein paar Notizblätter und eine Handvoll Fotos umsonst.»
«Und meine Zeit.»
«Das darfst du so nicht sehen, meine Liebe! Jede Erfahrung ist für einen Journalisten wertvoll. Wenn er die Augen offen hält. Und das musst du. Weit offen. Ich will nicht, dass man uns nachsagt, wir hätten uns ein Schwein für eine Kuh verkaufen lassen. Nicht nur weil wir uns damit zum Gespött machen würden. Für unsere Feinde wäre es ein gefundenes Fressen, wenn wir derartige Nachrichten publizieren und sich hinterher herausstellt, dass sie falsch sind.»
Da er merkte, dass er ihre Zweifel nicht zerstreuen konnte, appellierte er an ihre Neugier: «Überleg mal: Es ist sicherlich interessant herauszufinden, ob es ein echtes oder ein vorgetäuschtes Wunder ist.»
Ana musste lächeln. Rubios Leidenschaft für Täuschung und Betrug, für Verbrechen und Verbrecher hatten ihn zu einem guten Menschenkenner gemacht.
«Du hast recht, Chef.»
«Und noch interessanter ist, was hinter diesem sogenannten Wunder stecken könnte.»
«Du glaubst also selbst nicht an die Geschichte.»
«Vielleicht ja, vielleicht nein. Das musst du herausfinden.»
«Und an die Marsmenschen, hast du an die geglaubt?»
«Du lässt einfach nicht locker, Ana. Das mit den Außerirdischen – dass sie vom Mars kamen, haben wir nie geschrieben – ist harmlose Unterhaltung. Wie sprechende Hunde oder Kälber mit zwei Köpfen. Wunder sind weitaus heikler, weil sie einen Eigentümer haben.»
«Die Kirche.»
Rubio nickte und wartete, dass sie weitersprach.
«Die Kirche entscheidet, ob es ein Wunder ist. Warum warten wir nicht ab? Wahrscheinlich hat der Pfarrer seine Vorgesetzten informiert und …»
Rubio gestikulierte wild, er sah aus wie eine Ausgabe von Orson Welles in Citizen Kane in karierten Samtpantoffeln.
«Exklusiv, Ana, exklusiv.»
Der Beruf als Berufung, dachte sie, obwohl sie nicht die Art von Journalismus machte, von der sie geträumt hatte: seriöse Berichterstattung für ein angesehenes Blatt. Und frei, ohne Zwang und Zensur, konnte sie erst recht nicht schreiben. Trotzdem wollte sie nichts anderes tun.
«Einverstanden?»
«Was bleibt mir denn anderes übrig?»
«Übermorgen kannst du fahren. Es gibt einen Bus, der dreimal in der Woche von Castellón aus nach Las Torres hochfährt, dienstags, donnerstags und samstags.»
Er hielt ihr einen Zettel entgegen, auf dem er die Zeiten notiert hatte. Bevor sie ihn nahm, fragte Ana: «Kannst du mir nicht das Auto geben?»
«Leider nein. Ich brauche es für eine andere Story.»
Ana griff nach dem Papier, ohne ihre Enttäuschung zu verbergen. Sie hatte bei ihren Recherchen häufiger den Wagen benutzt, einen Fiat-Kleintransporter, auf dessen Türen «El Caso» gepinselt war. So wie es Leute gab, die lesen lernten, um El Caso zu lesen, hatte sie fahren gelernt, um das Auto der Zeitschrift zu benutzen.
Sie blieb nicht mehr lange. Rubio gab ihr noch Anweisungen für ihre Reise: «Nimm die Kamera mit. Hier sind auch die Filme. Pack lieber ein paar mehr ein, ich glaube nicht, dass du dort welche kaufen kannst.»
Dann hatte er es eilig, sich wieder mit seinen eigenen Artikeln zu beschäftigen. Er brachte sie zur Tür. Bevor er sie schloss, sagte er mit einem Blick auf Anas Abendkleid: «Und zieh dich warm an.»
3
Für den Artikel über die kupplerische Losverkäuferin musste Ana tief in die Kiste der Euphemismen greifen, um aus allerlei bigotten Formulierungen ein Kostüm für eine Geschichte zu basteln, die den Zensoren selbst mit aller Diskretion erzählt zu unanständig scheinen könnte.
Am Sonntagnachmittag zog sie das Blatt mit dem Entwurf aus der Schreibmaschine, steckte es in die Tasche und machte sich auf den Weg zu ihrer Cousine Beatriz.
Beatriz war im Hinblick auf sprachlichen Stil und die richtige Wortwahl zu ihrem Gewissen geworden. Nicht nur wenn sie sie in ihrer riesigen Wohnung an der Rambla de Cataluña besuchte, um ihr geliehene Bücher zurückzubringen und andere mitzunehmen, die Ana eifrig und zugleich leise rebellierend las, wie es sich für eine gute Schülerin gehört.
Bei Beatriz angekommen, zog sie zwei Bücher aus der Tasche und hielt El Jarama von Rafael Sánchez Ferlosio in die Höhe. «Das hat mir gefallen. Ich habe noch nie so etwas gelesen, es ist ja nahezu hyperrealistisch. Man hat den Eindruck, dass man unsichtbar direkt neben den Personen steht oder einem Aufnahmegerät zuhört. Der Autor hat ein wirklich gutes Ohr für Gespräche.»
Beatriz lächelte. Das zufriedene und überlegene Lächeln einer Professorin, dachte Ana. Offenbar hatte sie gerade eine Art Examen bestanden.
Sie freute sich, gleichzeitig ärgerte sie sich darüber, dass Beatriz’ Anerkennung ihr so wichtig war. Mit dem zweiten Buch würde sie sie allerdings enttäuschen, obwohl Beatriz es ihr wie einen Schatz anvertraut hatte. Es war aus Mexiko ins Land geschmuggelt worden, in einem falschen Einband und zwischen trockenen wissenschaftlichen Aufsätzen, die jeden Zollbeamten abschrecken würden, der das Päckchen von der Universidad de México öffnen sollte.
Aber Beatriz’ Blick sagte ihr, dass ihre Cousine verstand, warum sie ihr das Exemplar von Ramón J. Senders Mosén Millán schweigend auf den Tisch legte. Sie verstand, dass Ana den Tod des Protagonisten, das Erschießungskommando vor einer Friedhofsmauer, nicht ertragen hatte, nie ertragen würde, weil ihr Bruder Ángel auf diese Weise gestorben war.
Beatriz nahm das Buch an sich, um es in ihrer Bibliothek verschwinden zu lassen, und versuchte die Geister zu vertreiben.
«Komm», sagte sie. «Lass mich deinen Artikel lesen, und dann zeige ich dir meine Trophäen.»
Zu ihren wöchentlichen Treffen erwartete Beatriz sie stets mit Kaffee, Gebäck und einer neuen Sammlung von Fehlern und Sprachschnitzern aus der Presse. Ana hoffte jedes Mal zuversichtlich, dass ihre Texte nicht dabei waren.
«Ich will gar nicht daran denken, was manche unserer Schreiberlinge anstellen würden, wenn sie so viele Präpositionen benutzen müssten wie die Deutschen», hatte Beatriz einmal gesagt.
Die Bibliothek roch nach Kaffee, Papier und Tabak. Die Regale waren wieder gefüllt. Ihre Cousine musste keines ihrer wertvollen Bücher mehr verkaufen, um überleben zu können. Im Moment schien Beatriz zufrieden mit dem ruhigen Leben einer Wissenschaftlerin, der ihre Vergangenheit zwar die Türen spanischer Universitäten verschlossen hatte, die jedoch im Ausland immer mehr Ansehen gewann.
Beatriz las die Blätter mit Anas Bericht für El Caso und reichte sie ihr zurück.
«Ich bin mir nicht sicher, ob ihr hiermit durch die Zensur kommt.» Sie zeigte auf einen Satz: ‹Die Angeklagte wies die Beschuldigung zurück, amouröse Treffen organisiert zu haben.› Das Wort ‹amourös› ist zu eindeutig, fürchte ich.»
«Warten wir ab, was Rubio sagt.»
«Wollen wir wetten?»
«Worum?»
«Wenn es nicht durch die Zensur kommt, lernst du das Sonett I von Garcilaso auswendig.»
«Ist es sehr kitschig?»
Beatriz warf ihr einen empörten Blick zu. «Garcilaso ist niemals kitschig!»
«Schon gut. Und was musst du tun, wenn du verlierst? Ich kann dich schlecht bitten, dass du irgendetwas aus deinem immensen Gedächtnis tilgst.»
Plötzlich hatte sie eine Idee. Ihre Cousine hasste sinnleere Formelhaftigkeit. Ana, die selbst ein gutes Gedächtnis hatte, erinnerte sich an ein flammendes Plädoyer, das Beatriz gegen metrische Spielereien gehalten hatte, ihrer Ansicht nach «etwas fürs Kuriositätenkabinett, keine Literatur».
«Wenn es durch die Zensur geht, lernst du eine Sestine auswendig, eine von Fernando de Herrera.»
Beatriz lachte. «Da werde ich wohl den Zensor anrufen müssen und ihm einen kleinen Wink geben. Eine Sestine von Herrera! Du bist wirklich gnadenlos!»
Ana hatte den Verdacht, dass sie in Wirklichkeit schon eine auswendig konnte.
Auf einem Tisch sah sie einen Stapel Ausgaben von El Caso liegen. Ana freute sich, sie nahm an, dass Beatriz sie ihretwegen aufbewahrte. Sie konnte der Versuchung nicht widerstehen, ihre Cousine dazu zu bringen, ihr diese schmeichelhafte Vermutung zu bestätigen.
«Hebst du meine Artikel auf?»
«Nein. Ich mache eine kleine Untersuchung zur Rhetorik der Sensationsberichte.»
Beatriz war nie besonders sensibel in Hinblick auf die Empfindlichkeiten ihrer Mitmenschen gewesen, aber etwas hatte sie dazugelernt, denn sie fügte hinzu, wenngleich reichlich spät: «Natürlich hebe ich deine Artikel auf. Dadurch bin ich erst auf die Idee gekommen.»
«Ehrlich?»
«Ich habe angefangen, El Caso zu kaufen, weil ich deine Texte gedruckt sehen wollte.»
Sie stand auf und griff nach einem der Hefte. Ein Stück Papier markierte die Seite mit Anas Text.
«Schau, das hier ist witzig. Du schreibst über eine Betrügerin in der Pelzhandlung La Siberia, und gleich daneben findet sich die Annonce eines Kurses für angehende Tierpräparatoren.»
Beatriz’ Anstrengungen, liebenswürdig zu sein, waren nicht immer von Erfolg gekrönt. Ana hatte die unfreiwillige Komik dieser Kombination nicht bemerkt, und nun war sie ihr peinlich. Doch Beatriz nahm keine Notiz davon und machte sich ungerührt daran, Ana ihre These zu erläutern: «Wusstest du, dass manche der rhetorischen Formeln aus den Sensationsberichten auf Bänkelsängerlieder zurückgehen?»
Aufrecht vor dem Kaffeetisch stehend und mit einem Exemplar von El Caso in der Hand sah Beatriz selbst aus wie ein Bänkelsänger, der von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt zog und seine blutrünstigen Geschichten von Räubern, Rache und Mord zum Besten gab.
«All diese Einzelheiten, die ihr benutzt, um den Wahrheitsgehalt der Erzählung glaubhaft zu machen, die Adjektive, mit denen ihr klarmacht, wer die Guten sind – die Polizisten, die Tugendhaften, die Ehrlichen – und wer die Bösen. Und wie ihr mit der alten Faszination für das Morbide spielt. Kein Wunder, dass die Leser euch aus der Hand fressen.»
Beatriz’ Enthusiasmus war echt und zugleich verletzend. Ana wusste nicht, ob sie die Begeisterung ihrer Cousine teilen oder sich über sie ärgern sollte. Sie entschied sich für Ersteres, als sie Beatriz sagen hörte: «Ich bin mir sicher, dass einige eurer Geschichten mündlich überliefert und die Kinder davon singen werden.»
In Madrid war tatsächlich schon ein Lied über die Marquise von Villasente im Umlauf, die Schlüsselfigur im «Fall der abgeschnittenen Hand». Die Hand hatte der Tochter der Marquise gehört, die mit sechsunddreißig an einem Lungenödem gestorben war. Die Mutter hatte in ihrer Trauer versucht, Körperteile ihrer Tochter in Formalin zu konservieren. Die besagte Hand war vor zwei Jahren, 1954, in einer Plastikmilchkanne aufgetaucht, und schon bald sangen in Madrid die Kinder ein Lied: «In der Calle de la Princesa / lebt ’ne olle, bekloppte Marquesa / schnitt der Tochter ’s Händchen ab / folgt ihr bald ins kalte Grab.» Nach kurzer Zeit war die Geschichte der Frau, die über den Tod ihrer Tochter den Verstand verloren hatte, zu einem Schauermärchen geworden, mit dem die Kinder einander beim Spielen erschreckten. Eine Legende, deren wahrer Kern immer noch