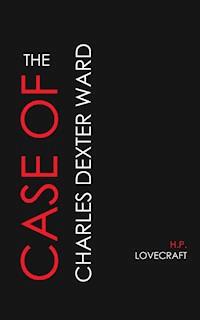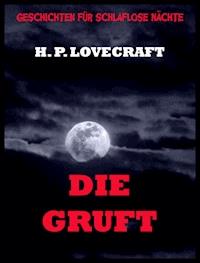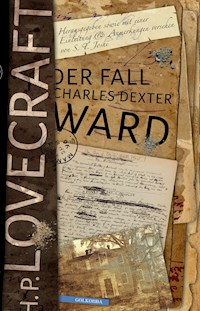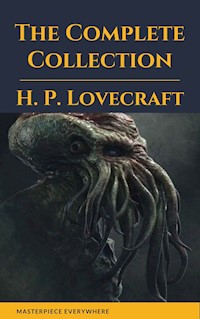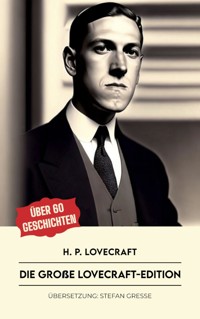
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Willkommen in einer Welt, in der das Unvorstellbare hinter dem Schleier der Wirklichkeit lauert – eine Welt, geboren aus dem Geist eines der einflussreichsten Autoren der phantastischen Literatur: Howard Phillips Lovecraft. Diese E-Book-Edition beinhaltet über 60 Kurzgeschichten aus allen Schaffensphasen Lovecrafts – von seinen frühen Werken, die vom klassischen Gothic-Horror beeinflusst sind, bis hin zu den späteren Erzählungen des sogenannten "Cthulhu-Mythos", in denen kosmische Schrecken, uralte Götter und der Wahnsinn selbst allgegenwärtig sind. Lovecrafts Universum ist eines voller dunkler Wunder, fremdartiger Geometrien und verborgener Wahrheiten, die jenseits des menschlichen Verständnisses liegen. Seine Geschichten führen uns an die Grenzen der Realität – in modrige Bibliotheken voller verbotener Bücher, untergegangene Städte im Ozean, verlassene Dörfer in Neuengland und zu Sternen, die niemals leuchten sollten. Ob Sie Lovecraft zum ersten Mal lesen oder als Kenner zurückkehren: Diese Sammlung lädt dazu ein, sich dem Grauen in all seinen Facetten zu stellen. Doch seien Sie gewarnt: Wer einmal hinter den Vorhang blickt, wird nie wieder mit denselben Augen sehen. Treten Sie ein – in eine Welt jenseits des Verstandes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1573
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis:
Der Tempel
Polaris
Die Farbe aus dem All
Die Aussage von Randolph Carter
Das Weihnachtsfest
Das Unsagbare
Der Nachkomme
Kühle Luft
Das Unheil, das nach Sarnath kam
Das Biest in der Höhle
Dagon
Hinter den Mauern des Schlafes
Die anderen Götter
Die namenlose Stadt
Die Geschichte des Necronomicons
Celephaïs
Der Außenseiter
Der Hund
I.
II.
Das Grabmal
Herbert West – Der Wiedererwecker
I. Aus dem Dunkel
II. Der Dämon der Pest
III. Sechs Schüsse um Mitternacht
IV. Der Schrei des Toten
V. Das Grauen der Schatten
VI. Die Legion aus dem Grab
Der Ruf von Cthulhu
I. Der Schrecken aus Ton
II. Die Geschichte von Inspektor Legrasse
III. Der Irrsinn vom Ozean
Das Bild im Haus
Ex Oblivione
Die Katzen von Ulthar
Die Straße
Die Musik von Erich Zann
Die Verwandlung von Juan Romero
Aus dem Jenseits
Das weiße Schiff
Pickmans Modell
Gefangen bei den Pharaonen
Teil I.
Teil II.
Der Alchemist
Der schreckliche alte Mann
Der Baum
Das schleichende Chaos
Das Grauen am Martin’s Beach
Der silberne Schlüssel
In der Gruft
Die Träume im Hexenhaus
Iranons Suche
Das gemiedene Haus
I.
II.
III.
IV.
V.
Hypnos
Nyarlathotep
Die Ratten in den Mauern
Das Ding auf der Türschwelle
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Fakten über den verstorbenen Arthur Jermyn und seine Familie
I
II
Das seltsame hohe Haus im Nebel
Der Verfolger aus der Finsternis
Old Bugs
Der Mondsumpf
Hinter den Toren des silbernen Schlüssels
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Das Grauen in Red Hook
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Das sehr alte Volk
Er
Das Buch
Eine Erinnerung an Dr. Samuel Johnson
Der bösartige Priester
Was der Mond bringt
Ibid
Azatoth
Die Traumreise zum unbekannten Kadath
Teil I – Die verlorene Stadt des Sonnenuntergangs
Teil II – Die Suche nach dem Berg Ngranek und dem Abbild der Götter
Teil III – Im Reich der Ghule
Teil IV – Die Reise nach Celephais
Teil V – Die Überfahrt nach Inganok
Teil VI – Das Zusammentreffen mit dem Hohepriester von Leng
Teil VII – Die Rettungstat in den Ruinen von Samarkand
Teil VIII – Der Berg Kadath und das Schloss der Großen
Teil IX – Der Flug nach Kadath
Der Tempel
The Temple (1920)
(ein Manuskript, aufgefunden an der Küste von Yucatan)
von H. P. Lovecraft
Übersetzung:Stefan Gresse (2023)
Am 20. August 1917 deponierte ich, Karl Heinrich Graf von Altberg-Ehrenstein, Leutnant der Kaiserlichen Deutschen Marine und Kommandant des Unterseebootes U-29, diese Flaschenpost an einer mir unbekannten Stelle im Atlantischen Ozean, wahrscheinlich bei etwa 20° nördlicher Breite und 35° westliche Länge, wo mein Schiff funktionsuntüchtig auf dem Meeresboden liegt. Ich tue das, weil ich gewisse ungewöhnliche Fakten öffentlich klarstellen möchte. Ich kann dies nicht persönlich tun, da ich selbst sehr wahrscheinlich nicht überleben werde, denn die Umstände, in denen ich mich befinde, sind so bedrohlich wie außerordentlich, da die U-29 hoffnungslos außer Gefecht gesetzt wurde, aber auch weil mein eiserner Wille auf die verheerendste Weise beeinträchtigt ist.
Wie wir U-61, das auf dem Weg nach Kiel war, über Funk berichteten, hatten wir am Nachmittag des 18. Juni den britischen Frachter Victory auf seinem Weg von New York nach Liverpool bei 45° 16‘ nördlicher Breite und 28°34‘ westlicher Länge torpediert. Wir erlaubten der Mannschaft, in ihre Rettungsboote zu steigen, um gute Filmaufnahmen für die Admiralität zu machen. Das Schiff sank recht spektakulär mit dem Bug zuerst, wobei es das Heck hoch aus dem Wasser hob, während die Hülle senkrecht auf den Meeresboden sank. Unsere Filmkamera nahm alles perfekt auf und ich bedaure zutiefst, dass diese großartige Rolle Film Berlin wohl nie erreichen wird. Danach haben wir die Rettungsboote mit unseren Kanonen versenkt und sind wieder abgetaucht.
Als wir bei Sonnenuntergang zur Oberfläche aufstiegen, wurde auf unserem Deck die Leiche eines Seemannes gefunden, dessen Hände auf merkwürdige Weise die Reling umklammerten. Der arme Kerl war noch jung, dunkelhaarig und gut aussehend; wahrscheinlich ein Italiener oder Grieche, und gehörte zweifellos zur Mannschaft der Victory. Er hatte sich wohl genau auf das Schiff flüchten wollen, das sich gezwungen sah, sein eigenes zu zerstören – ein weiteres Opfer des ungerechten Angriffskrieges, den die englischen Schweinehunde gegen unser Vaterland führen. Unsere Leute durchsuchten ihn nach Souvenirs und fanden in einer seiner Jackentaschen ein ganz besonderes Stück geschnitztes Elfenbein, das den Kopf eines jungen Mannes mit einem Lorbeerkranz darstellte. Mein Offizierskollege Leutnant Klenze meinte, es sei sehr alt und habe großen künstlerischen Wert, also nahm er es an sich. Weder er noch ich konnten uns vorstellen, wie es in den Besitz dieses einfachen Seemannes gelangen konnte.
Als der Tote dann über Bord geworfen wurde, geschahen zwei Dinge, die bei der Mannschaft für große Unruhe sorgten. Die Augen des Mannes waren zunächst geschlossen gewesen, aber als wir seinen Körper über die Reling zerrten, riss er sie auf und viele Besatzungsmitglieder schienen den seltsamen Eindruck zu haben, dass sie ständig und geradezu spöttisch Schmidt und Zimmer anstarrten, die sich über die Leiche gebeugt hatten. Der Bootsmann Müller, ein älterer Mann, der es eigentlich besser wissen sollte, wäre er nicht so ein abergläubisches Schwein aus dem Elsass, regte sich bei diesem Eindruck dermaßen auf, dass er die Leiche im Wasser genauestens beobachtete und danach schwor, dass sie die Arme ausstreckte, nachdem sie etwas herabgesunken war und unterhalb der Wellen schnell nach Süden zu schwimmen begann. Klenze und mir gefiel diese Zurschaustellung bäuerlicher Ignoranz gar nicht, und wir rügten die Männer ernsthaft, besonders Müller.
Am nächsten Tag entstand eine sehr problematische Situation durch das Unwohlsein einiger Mannschaftsmitglieder. Sie litten offensichtlich wegen unserer langen Reise unter starker nervlicher Belastung und hatten böse Träume. Einige der Männer schienen benommen und gefühllos zu sein und nachdem ich mich davon überzeugt hatte, dass sie ihre Schwäche nicht nur vortäuschten, befreite ich sie von ihren Pflichten. Die See war ziemlich rau, daher gingen wir auf eine Tiefe, in der die Wellen weniger lästig waren. Hier lag das Boot verhältnismäßig ruhig – trotz einer eigenartigen, nach Süden gerichteten Strömung, die wir auf unseren Seekarten nicht identifizieren konnten. Das Stöhnen der kranken Männer war äußerst lästig; aber da sie den Rest der Mannschaft nicht weiter demoralisierten, brauchten wir keine besonderen Maßnahmen zu ergreifen. Unser Plan war, dazubleiben, wo wir waren und den Liniendampfer Dacia anzugreifen, der in den Informationen unserer Agenten in New York erwähnt wurde.
Am frühen Abend tauchten wir zur Oberfläche auf und fanden die See weniger bewegt vor. Man sah den Rauch eines Schlachtschiffes am nördlichen Horizont, aber wegen der großen Entfernung und unserer Fähigkeit abzutauchen, fühlten wir uns sicher. Was uns mehr beunruhigte, waren die Geschichten des Bootsmannes Müller, die immer wilder wurden, während die Nacht heranbrach. Er war verachtenswert kindisch und faselte über die Wahnvorstellung von Leichen, die unter Wasser vor den Bullaugen vorbeitrieben. Angeblich starrten ihn diese Leichen eindringlich an. Sie waren schon aufgequollen, aber er erkannte in ihnen die Toten, die wir bei einer unserer siegreichen deutschen Heldentaten hinterlassen hatten. Er sagte, der Mann, den wir gefunden und über Bord geworfen hatten, sei ihr Anführer gewesen. Das war grauenhaft albern und nicht mehr normal, also ließen wir Müller Handschellen anlegen und kräftig auspeitschen. Die Mannschaft war über diese Bestrafung gar nicht erfreut, aber Disziplin war unbedingt notwendig. Wir lehnten auch den Antrag einer Delegation unter der Führung von Seemann Zimmer ab, dass der so eigenartig geschnitzte Elfenbeinkopf ins Meer geworfen werden müsse.
Am 20. Juni 1920 wurden die Seeleute Böhm und Schmidt, die am Tag zuvor krank gewesen waren, geistesgestört und gewalttätig. Ich bedauerte, dass kein Arzt unter den Offizieren an Bord war, denn deutsche Leben sind kostbar, aber die ständigen Fantasien der beiden über einen schrecklichen Fluch untergruben die Disziplin. Wir mussten daher drastische Maßnahmen ergreifen. Die Mannschaft akzeptierte das mürrisch, aber Müller schien es zu beruhigen, der uns danach keinen Ärger mehr machte. Am Abend ließen wir ihn frei und er tat schweigend seine Pflicht.
In der Woche danach waren alle sehr nervös und hielten Ausschau nach dem Schiff Dacia. Die Spannung steigerte sich noch durch das Verschwinden von Müller und Zimmer, die ohne Zweifel Selbstmord begangen hatten, wahrscheinlich wegen der Ängste, die sie anscheinend befallen hatten, auch wenn niemand beobachtet hatte, wie sie über Bord gesprungen waren. Ich war ziemlich froh, Müller los zu sein, denn selbst sein Schweigen hatte sich ungünstig auf die Mannschaft ausgewirkt. Alle schienen nun eher dazu zu neigen, Ruhe zu bewahren, wenn sie sich auch insgeheim fürchteten. Viele von ihnen waren krank, aber niemand wurde unruhig.
Leutnant Klenze litt unter der Anspannung und regte sich wegen jeder Kleinigkeit auf – zum Beispiel über eine Gruppe von Delfinen, die sich in immer größerer Zahl um die U-29 versammelt hatten und auch die immer stärker werdende Strömung in südlicher Richtung, die auf unseren Karten nicht verzeichnet war.
Es wurde langsam klar, dass wir die Dacia inzwischen völlig verpasst hatten. Solche Pannen sind nicht ungewöhnlich und wir waren eher erfreut als verärgert, denn unserer Rückkehr nach Wilhelmshaven stand nun nichts mehr im Weg. Am Mittag des 28. Juni nahmen wir Kurs in nordöstlicher Richtung und trotz der eher komischen Verwicklungen mit der ungewöhnlichen Anzahl von Delphinen waren wir schon auf dem Weg nach Hause.
Die Explosion im Maschinenraum um zwei Uhr nachts kam dann auch vollkommen überraschend. Wir hatten keinen Defekt an der Maschine bemerkt und es hatte auch keine Unachtsamkeit seitens der Mannschaft gegeben, als das Schiff plötzlich von einem Ende zum anderen von einem gewaltigen Schlag durchfahren wurde. Leutnant Klenze eilte in den Maschinenraum und stellte fest, dass der Treibstofftank und ein Großteil der Maschine zerschmettert worden waren, wobei die Ingenieure Raabe und Schneider ums Leben kamen. Unsere Situation war urplötzlich lebensgefährlich geworden, denn auch wenn die chemischen Lufterneuerer noch intakt waren und wir die Anlagen zum Auf- und Abtauchen noch benutzen konnten und es daher noch möglich war, die Luken zu öffnen, solange noch Druckluft vorhanden war und die Batterien hielten, so waren wir doch ohne Antrieb, um das U-Boot anzutreiben und auf Kurs zu halten. Der Versuch, in die Rettungsboote umzusteigen, hätte uns dem Feind ausgeliefert, der erbittert gegen das große Deutsche Reich kämpfte, denn unsere Funkanlage funktionierte seit der Geschichte mit der Victory auch nicht mehr und wir konnten uns daher auch nicht mit einem anderen U-Boot der Kaiserlichen Marine in Verbindung setzen.
Seit dem Augenblick des Unfalls bis zum 2. Juli trieben wir fortwährend nach Süden – planlos und ohne irgendein anderes Schiff zu sichten. Die Delfine umkreisten die U-29 noch immer; eigentlich bemerkenswert bei der Entfernung, die wir inzwischen zurückgelegt hatten. Am Morgen des 2. Juli sichteten wir ein Kriegsschiff unter amerikanischer Flagge und die Männer wurden unruhig und wollten sich ergeben. Am Ende sah Leutnant Klenze sich gezwungen, einen Seemann namens Traube zu erschießen, der besonders heftig auf dieser undeutschen Handlungsweise bestanden hatte. Das beruhigte die Mannschaft eine Weile und wir konnten unbemerkt abtauchen.
Am nächsten Nachmittag tauchte von Süden her ein großer Schwarm Seevögel auf und der Ozean begann bedrohlich zu rollen. Wir schlossen die Luken und warteten ab, bis wir einsahen, dass wir abtauchen mussten, wenn wir nicht von den immer größeren Wellen überflutet werden wollten. Unsere Druckluft und Elektrizität verringerten sich zusehends und wir wollten den unnötigen Einsatz unserer geringen mechanischen Hilfsmittel vermeiden, aber in diesem Fall hatten wir keine Wahl. Wir tauchten nicht tief ab und als sich die See einige Stunden später beruhigte, entschlossen wir uns, an die Oberfläche zurückzukehren. Hier gab es dann allerdings erneut Ärger, denn trotz aller Anstrengungen der Mechaniker ließ sich das Schiff nicht mehr steuern. Die Männer wurden angesichts dieser unterseeischen Gefangenschaft noch ängstlicher und einige von ihnen begannen wieder, wegen Leutnant Klenzes Elfenbeinschnitzerei zu murren, aber der Anblick einer Maschinenpistole beruhigte sie sofort. Wir beschäftigten die armen Teufel so gut es ging und bastelten an der Maschine herum, obwohl wir wussten, dass das nutzlos war.
Klenze und ich schliefen normalerweise zu unterschiedlichen Zeiten und während ich schlief – es war etwa fünf Uhr morgens am 4. Juli – brach überraschend eine allgemeine Meuterei los. Die sechs übrig gebliebenen Seemannsschweine dachten, wir seien nun verloren und gerieten wegen unserer Weigerung, uns dem Schlachtschiff der Yankees zu ergeben, plötzlich irrsinnig in Rage und schlugen fluchend alles kurz und klein. Sie brüllten wie Tiere, die sie waren, und zerschlugen unterschiedslos Instrumente und Mobiliar. Sie schrien und erzählten solchen Unsinn wie den Fluch des Elfenbeinkopfes des dunkelhaarigen, jungen Toten, der sie ansah und dann wegschwamm. Leutnant Klenze schien gelähmt und überfordert zu sein, wie es von einem weichen, weibischen Rheinländer nicht anders zu erwarten war. Ich erschoss alle sechs Männer, weil es nötig war, und stellte sicher, dass niemand mehr am Leben war.
Wir stießen die Leichen durch die doppelten Luken ins Wasser hinaus und waren dann allein in der U-29. Klenze schien überaus nervös zu sein und begann heftig zu trinken. Ich war entschlossen, solange wie möglich am Leben zu bleiben und die großen Vorräte an Verpflegung und die chemische Sauerstoffversorgung zu nutzten, die von den Schweinehunden der Seeleute nicht angerührt worden waren. Unser Kompass, Tiefenmesser und die anderen empfindlichen Messgeräte waren ruiniert, daher konnten wir von nun anstatt zu berechnen nur noch raten. Dabei mussten wir uns auf unsere Armbanduhren, den Kalender und auf die scheinbare Strömung verlassen. Die Strömung konnten wir nur an Objekten abschätzen, die wir von den Bullaugen der Kommandobrücke aus vorbeitreiben sahen. Glücklicherweise waren die Batterien geladen und wir konnten sie noch lange nutzen – sowohl für die Innenbeleuchtung als auch für den Suchscheinwerfer. Wir beleuchteten damit oft die Umgebung des Schiffes, sahen aber nur die Delphine, die neben uns her schwammen, während wir dahintrieben. Ich war an diesen Delphinen wissenschaftlich interessiert, denn der gewöhnliche Delphinus delphis ist ein ähnliches Säugetier, wie der Wal, dass ohne Atemluft nicht überleben kann. Trotzdem beobachtete ich einen der großartigen Schwimmer annähernd zwei Stunden lang, ohne dass dieser irgendwann auftauchen musste.
Während die Zeit verging, entschlossen Klenze und ich uns, weiter nach Süden zu treiben, während wir tiefer und tiefer sanken. Wir beobachteten die Meeresfauna und Flora und sahen zu diesem Thema in den Büchern nach, die ich für meine Freizeit mitgenommen hatte. Ich kam dabei nicht umhin festzustellen, dass die wissenschaftlichen Kenntnisse meines Begleiters doch recht mangelhaft waren. Ihm fehlte der preußische Geist und er hatte sich wertlosen Vorstellungen und Spekulationen gewidmet. Die Tatsache, dass wir sterben würden, berührte ihn seltsamerweise stark. Er betete oft voller Reue wegen der Männer, Frauen und Kinder, die wir auf den Meeresgrund geschickt hatten, und vergaß dabei völlig, dass alles, was dem deutschen Staat diente, ehrenhaft war. Nach einiger Zeit wurde er spürbar unausgewogen, starrte stundenlang auf seinen Elfenbeinkopf und erfand fantasievolle Geschichten über verlorene und vergessene Dinge auf dem Meeresgrund. Manchmal begleitete ich ihn auf diesen Wanderungen und hörte mir seine endlosen poetischen Zitate und Erzählungen über versunkene Schiffe an. Er tat mir wirklich leid, denn ich sehe einen Deutschen nicht gerne leiden, aber er war kein guter Mann, um mit ihm zu sterben. Ich war jedenfalls stolz darauf zu wissen, dass mein Vaterland mein Andenken ehren würde und meinen Söhnen beigebracht werden würde, richtige Männer so wie ich zu werden.
Am 8. August untersuchten wir den Meeresgrund und beleuchteten ihn mit unserem starken Suchscheinwerfer. Es war eine riesige, wellenförmige Ebene, zumeist von Seegras bedeckt und voller Gehäuse kleiner Mollusken. Hier und da sah man schlammige Objekte mit verwirrenden Umrissen, mit Algen bewachsen und verkrustet, bedeckt von Seepocken und Entenmuscheln. Klenze erklärte, dass müssten versunkene Schiffe sein, die in ihren Gräbern ruhten. Er war irritiert von einer soliden herausragenden Felsspitze, die knapp einen Meter emporragte, mit glatten Seiten, die in einem stumpfen Winkel zuliefen. Ich sagte, es sei eine herausragende Felsspitze, aber Klenze meinte, er könne darauf Schnitzereien erkennen. Nach einer Weile begann er zu erschaudern und wandte sich ab, als hätte er es plötzlich mit der Angst bekommen. Er konnte sich das nicht erklären; er war nur überwältigt von der Unermesslichkeit, Dunkelheit, Entfernung, dem Alter und dem Mysterium der ozeanischen Abgründe. Sein Geist war müde, aber als Deutscher verstand er zwei Dinge sehr bald: Dass die U-29 dem Wasserdruck ausgezeichnet standhielt und dass die eigenartigen Delfine immer noch bei uns waren, sogar noch in einer Tiefe, wo Naturforscher die Existenz höheren Lebens für unmöglich gehalten hätten. Ich war mir sicher, dass ich die Tiefe, in der wir waren, überschätzt hatte, aber wir mussten uns doch schon in einer Tiefe befinden, in der diese Phänomene bemerkenswert waren. Die Geschwindigkeit, mit der wir nach Süden trieben, war etwa so groß wie ich vorher angesichts der in geringerer Tiefe treibenden Organismen geschätzt hatte.
Um Viertel nach 3 Uhr morgens wurde der arme Klenze dann vollkommen verrückt. Er war auf der Kommandobrücke und hatte den Suchscheinwerfer benutzt. Ich sah ihn dann in die Bücherabteilung kommen, wo ich gerade saß und las. Sein verzerrtes Gesicht verriet ihn sofort. Ich werde hier nur wiederholen, was er sagte und die Worte unterstreichen, die er besonders betonte: „Er ruft! Er ruft! Ich kann ihn hören! Wir müssen zu ihm gehen!“ Während er das sagte, nahm er das Elfenbein-Ding vom Tisch, steckte es sich in die Tasche, packte mich am Arm und zog mich durch den Gang aufs Deck. Einen Moment später wurde mir klar, dass er die Luke öffnen und draußen mit mir ins Wasser springen wollte; ein Anfall von mörderischer und selbstmörderischer Raserei, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Als ich versuchte, ihn zu beruhigen, wurde er noch gewalttätiger und sagte: „Kommen Sie schon, warten Sie nicht noch länger. Es ist besser zu bereuen, damit einem vergeben wird, als sich zu widersetzen und verflucht zu werden.“ Da gab ich es auf, ihn zu beruhigen und sagte ihm, er sei ja verrückt – bedauernswert wahnsinnig. Aber er ließ sich nicht beeindrucken und schrie: „Wenn ich verrückt bin, dann ist das eine Gnade. Mögen die Götter Mitleid mit einem Mann haben, der in seiner Gefühllosigkeit bis zum bitteren Ende geistig gesund bleibt! Kommen Sie und seien Sie verrückt, solange er uns noch gnädig ruft!“
Dieser Gefühlsausbruch schien den Druck in seinem Gehirn zu verringern, denn als er das gesagt hatte, wurde er sanfter und bat mich, ihn doch alleine gehen zu lassen, wenn ich ihn schon nicht begleiten wollte. Mir wurde nun klar, was ich tun musste. Er war zwar Deutscher, aber eben nur ein Rheinländer, ein Bürgerlicher, der inzwischen schon ein möglicherweise gefährlicher Wahnsinniger war. Als ich mich scheinbar mit seinem Selbstmordversuch einverstanden zeigte, konnte ich mich sofort von ihm befreien, denn er war jetzt kein Gefährte mehr, sondern nur noch eine Bedrohung. Ich bat ihn, mir die Elfenbeinschnitzerei zu geben, bevor er hinausging, aber diese Bitte brachte ihn so unheimlich zum Lachen, dass ich es vorzog, nichts mehr zu sagen. Dann fragte ich ihn, ob er ein Andenken oder eine Haarlocke für seine Familie in Deutschland zurücklassen wolle, für den Fall, dass ich gerettet würde, aber darauf lachte er erneut wieder nur so unheimlich. Während er die Leiter hinaufstieg, bediente ich die Hebel, die die Maschinerie in den richtigen Zeitabständen in Gang setzte, die ihn in den Tod schicken würde. Nachdem ich festgestellt hatte, dass er nicht mehr an Bord war, leuchtete ich mit dem Suchscheinwerfer nach ihm, um ihn ein letztes Mal zu sehen, denn ich wollte wissen, ob der Wasserdruck ihn zusammengepresst hatte, was theoretisch zu erwarten war oder ob der Körper unverändert blieb wie bei diesen außergewöhnlichen Delfinen. Ich konnte ihn jedoch nicht erkennen, denn die Delphine hatten sich dort in großen Mengen versammelt und verdeckten die Kommandobrücke.
An diesem Abend bedauerte ich, dass ich das Elfenbeinbild nicht heimlich aus der Tasche des armen Klenze gezogen hatte, bevor er hinausging, denn es war faszinierend. Ich konnte den jugendlichen, wunderschönen Kopf mit seinem Lorbeerkranz nicht vergessen, auch wenn ich eigentlich keine Künstlernatur bin. Es tat mir auch leid, dass ich jetzt niemanden mehr hatte, mit dem ich mich unterhalten konnte. Klenze war, auch wenn er mir nicht ebenbürtig gewesen war, doch immer noch viel besser als überhaupt niemand. Ich konnte diese Nacht nicht gut schlafen und fragte mich, wann das Ende wohl kommen würde. Ich hatte sicherlich nur eine sehr geringe Chance, gerettet zu werden.
Am nächsten Morgen stieg ich auf die Kommandobrücke und startete mit den üblichen Untersuchungen mit dem Suchscheinwerfer. Nach Norden war der Anblick der gleiche wie nun schon seit den ganzen vier Tagen, die ich den Meeresgrund absuchte, aber ich bemerkte, dass die U-29 jetzt langsamer dahintrieb. Als ich den Scheinwerfer nach Süden richtete, bemerkte ich, dass der Meeresboden dort vor mir stärker abfiel und es lagen da an manchen Stellen merkwürdig regelmäßige Steinblöcke herum, die definitiv ein Muster bildeten. Das Boot tauchte nicht sofort tiefer, um sich der größeren Tiefe anzupassen, also musste ich den Suchscheinwerfer bald nachjustieren, damit er senkrecht nach unter leuchtete. Bei dieser plötzlichen Bewegung wurde die Kabelverbindung unterbrochen, was ich erst wieder instand setzen musste, aber nach einer Weile ging das Licht wieder an und beleuchtete das unterseeische Tal, das unter mir lag.
Ich gab mich keinerlei Emotionen hin, aber ich war wirklich erstaunt, als ich erblickte, was da plötzlich im Licht des Scheinwerfers auftauchte. Und da ich in der besten preußischen Kultur erzogen worden war, hätte ich nicht erstaunt sein dürfen, denn sowohl die Geologie als auch die Tradition lehren uns von Verschiebungen bei den ozeanischen und kontinentale Platten. Was ich da sah, war eine große Fläche bedeckt von verfallenen Gebäuden; alle von großartiger, wenn auch ungeordneter Architektur und unterschiedlich gut erhalten. Die meisten schienen aus Marmor zu bestehen, der im Licht des Scheinwerfers weißlich funkelte und man hatte den allgemeinen Eindruck einer großen Stadt auf dem Grund eines engen Tales mit vielen einzelnen Tempeln und an steilen Abhängen angelegten Landhäusern unterhalb dieser Tempel. Die Dächer waren eingefallen und die Säulen zerbrochen, aber sie bewahrten immer noch den uralten Glanz, den nichts hatte auslöschen können.
Ich stand nun endlich dem Atlantis gegenüber, das ich vorher für einen Mythos gehalten hatte und ich hatte große Lust, es zu erforschen. Auf dem Grund dieses Tales war einst ein Bach geflossen, denn bei genauerer Untersuchung entdeckte ich die Überreste von Brücken aus Stein und Marmor, Ufermauern, Terrassen und Deichen, die einst schön begrünt gewesen waren. In meiner Begeisterung wurde ich fast so verrückt und sentimental wie der arme Klenze und bemerkte recht spät, dass die nach Süden gerichtet Strömung endlich aufgehört hatte, was der U-29 erlaubte, langsam über der versunkenen Stadt anzuhalten wie ein Flugzeug, das oben auf der Erde über einer Stadt schwebte. Nach einer Weile bemerkte ich auch, dass die Gruppe ungewöhnlicher Delfine inzwischen verschwunden war.
Nach etwa zwei Stunden setzte ich das Boot auf einem gepflasterten Platz in der Nähe der felsigen Wand des Tales aufgrund. Auf einer Seite sah ich die ganze Stadt, die sich den Abhang hinab von dem Platz bis zu den Ufern eines Baches erstreckte und auf der anderen Seite sah ich ganz in der Nähe die reich geschmückte und vollständig erhaltenen Fassade eines großartigen Bauwerks – offenbar ein Tempel, der aus dem Felsen herausgehauen worden war. Über den Bau dieses riesigen Gebäudes kann ich nur Vermutungen anstellen. Die Fassade von enormer Größe bedeckte anscheinend eine durchgehend ausgehöhlte Vertiefung, die viele und weiträumig verteilte Fenster hatte. Im Zentrum befand sich eine große offene Tür, die man über eine eindrucksvolle Freitreppe erreichte und die von vorzüglichen Schnitzereien umgeben war, wie die erhaben ausgearbeiteten Figuren des Bacchanals.
Vor all dem standen großartige Säulen und Friese, die mit Skulpturen von unbeschreiblicher Schönheit dekoriert waren, die offenbar Hirtenszenen und Prozessionen von Priestern und Priesterinnen darstellten, die fremdartige zeremonielle Geräte zur Anbetung eines strahlenden Gottes mit sich führten. Die Kunst war von phänomenaler Vollkommenheit, größtenteils in Hellenischem Stil, jedoch fremdartig und einzigartig. Sie machte den Eindruck, enorm alt zu sein, als sei sie der antike Vorgänger der altgriechischen Kunst. Zweifellos war jede Einzelheit dieses gewaltigen Konstrukts aus dem jungfräulichen Felsen gefertigt worden. Alles war spürbar ein Teil der Felswand des Tales, obwohl ich mir kaum vorstellen kann, wie das gewaltige Innere jemals ausgehoben werden konnte. Vielleicht befanden sich im Inneren vorher schon eine oder mehrere Höhlen. Weder ihr Alter noch das umgebene Wasser hatten die makellose Erhabenheit dieses schaurigen Tempels zerstört, denn ein Tempel musste es wohl sein, der heute auch nach tausenden von Jahren noch makellos und unberührt in der endlosen Nacht und Stille einer Schlucht im Ozean ruhte.
Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich damit zubrachte, die versunkene Stadt mit ihren Gebäuden, Bögen, Statuen und Brücken und dem gewaltigen Tempel mit seiner Schönheit und seinem Mysterium zu betrachten. Obwohl ich wusste, dass ich dem Tode nahe war, verzehrte mich meine Neugier und ich leuchtete mit meinem Suchscheinwerfer eifrig überallhin. Der Lichtstrahl erlaubte mir, alle Einzelheiten zu erkennen, aber ich konnte nicht durch die weit offen stehende Tür ins Innere des in den Felsen gehauenen Tempels blicken und nach einiger Zeit stellte ich den Strom ab, denn ich war mir bewusst, dass ich elektrischen Strom sparen musste. Die Leuchtkraft hatte sich während der Wochen, die ich dahingetrieben war, bereits merklich abgeschwächt. Aber mein Wunsch, die Geheimnisse dieser Unterwasserwelt zu erforschen, wurde durch den sich ankündigenden Mangel an Beleuchtung nur noch stärker. Ich, ein Deutscher, sollte der Erste sein, der diese seit Jahrhunderten vergessenen Wege betrat!
Ich konstruierte und überprüfte einen Tiefsee-Tauchanzug aus zusammengesetzten Metallplatten und experimentierte mit dem tragbaren elektrischen Licht und dem Lufterneuerer. Auch wenn es schwierig werden würde, die doppelte Luke allein zu bedienen, glaubte ich, alle Schwierigkeiten mit meiner wissenschaftlichen Geschicklichkeit überwinden und tatsächlich selbst in der toten Stadt umherwandern zu können.
Am 16. August stieg ich aus der U-29 und bahnte mir mühevoll den Weg durch die verfallenen und schlammigen Straßen zu dem antiken Bach. Ich fand keine Skelette oder andere menschliche Überreste, sammelte jedoch massenweise archäologische Überreste in Form von Skulpturen und Münzen. Darüber darf ich aber noch nicht sprechen, außer von meiner Hochachtung vor einer Kultur auf dem Höhepunkt ihres größten Glanzes zu einer Zeit, als die Menschen in Europa noch in Höhlen lebten und der Nil noch unbesehen ins Meer floss. Geleitet von diesem Manuskript, falls es jemals gefunden wird, müssen dann andere Leute die Geheimnisse lüften, die ich nur andeuten kann. Ich kehrte zum Boot zurück, als meine Batterien immer schwächer wurden und war entschlossen, den Felsentempel am nächsten Tag weiter zu erforschen.
Am 17. August, als mein Drang, das Geheimnis des Tempels zu erforschen, immer eindringlicher wurde, erlebte ich ein großes Ärgernis, denn ich stellte fest, dass das Material, das nötig war, um die tragbare Lampe wieder aufzuladen, während der Meuterei dieser Schweinehunde im Juli zerstört worden war. Ich war von unbändiger Wut erfüllt, meine deutsche Vernunft verbot es mir jedoch, mich unvorbereitet in das finstere Innere zu wagen, in dem sich ein unbeschreibliches Meeresungeheuer aufhalten könnte, oder vielleicht bestand es im Innern aus einem Labyrinth von Gängen, aus dem ich mich niemals wieder hätte befreien können. Alles, was ich tun konnte, war, den immer schwächer werdenden Suchscheinwerfer der U-29 einzuschalten und mit seiner Hilfe die Stufen zum Tempel hinaufzusteigen und die äußeren Gravuren zu studieren. Der Lichtstrahl trat von oben durch die Tür ein und ich blickte hinein, um im Inneren etwas zu erkennen, aber es war vergebens. Nicht einmal das Dach war zu sehen und obwohl ich ein paar Schritte hineinging, nachdem ich die Haltbarkeit des Bodens mit einem Stab geprüft hatte, traute ich mich nicht weiter. Außerdem empfand ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Gefühl des Grauens. Ich begann zu erkennen, dass einige der Gefühle des armen Klenze auf mich abgefärbt hatten, denn während der Tempel mich immer stärker anzog, fürchtete ich mich mit blindem und zunehmendem Schrecken vor seinen unter Wasser liegende Abgründen. Ich kehrte zum U-Boot zurück, schaltete die Lichter aus und saß dann lange nachdenklich im Dunkeln. Die Elektrizität musste ich fortan für Notfälle aufsparen.
Samstag, den 18., verbrachte ich in vollständiger Dunkelheit, gequält von Gedanken und Erinnerungen, die meinen deutschen Willen zu überwältigen drohten. Klenze war verrückt geworden und umgekommen, bevor er diese finsteren Überreste einer weit zurückliegenden Kultur erreichen konnte und er hatte mir geraten, mit ihm zu gehen. War es denn tatsächlich mein Schicksal, meinen klaren Verstand zu behalten, nur um zu einem schrecklicheren und unvorstellbaren Ende zu gelangen, als sich je ein Mensch hätte träumen lassen? Es war klar, dass meine Nerven schmerzhaft angespannt waren und ich diese Eindrücke schwächerer Menschen von mir halten musste.
Samstags Nacht konnte ich nicht schlafen und ich schaltete ohne Rücksicht auf zukünftige Ereignisse das Licht ein. Es war ärgerlich, dass die Elektrizität nicht wenigstens so lange hielt wie die Atemluft und die Lebensmittelvorräte. Ich ließ meine Gedanken an Selbstmord wieder aufleben und überprüfte meine Maschinenpistole. Am Morgen muss ich dann bei eingeschaltetem Licht eingeschlafen sein, denn ich erwachte am nächsten Nachmittag in völliger Dunkelheit und stellte fest, dass die Batterien mittlerweile vollkommen leer waren. Ich entzündete in schneller Folge einige Streichhölzer und bedauerte meine Unachtsamkeit, die schon vor längerer Zeit dazu geführt hatte, die wenigen Kerzen zu verbrauchen, die wir dabeigehabt hatten.
Nachdem ich die Streichhölzer fast alle verbraucht hatte, saß ich sehr ruhig und ohne jegliche Beleuchtung da. Während ich über mein unvermeidliches Ende nachdachte, erinnerte ich mich an die vorausgegangenen Ereignisse und hatte einen vorher nicht bewussten Gedanken, der einen schwächeren und abergläubischen Menschen hätte erschaudern lassen. Der Kopf des strahlenden Gottes an den Skulpturen auf dem Felsentempel ist der gleiche wie in diesem Elfenbeinbild, den der tote Seemann aus dem Meer mitgebracht und den der arme Klenze dann wieder mit ins Meer zurückgenommen hatte!
Ich war von diesem Zusammentreffen leicht verwirrt, aber das erfüllte mich nicht mit Schrecken. Nur ein geistig minderbemittelter Mensch ist schnell bereit, das Einzigartige und Komplizierte mit einem einfachen Kurzschluss von Übernatürlichkeit zu erklären. Die zufällige Übereinstimmung war schon merkwürdig, aber ich war vernünftig genug, die Umstände, die logischerweise nichts miteinander zu tun haben konnten, nicht miteinander in Verbindung zu bringen, oder anders gesagt: Die katastrophalen Ereignisse der Geschichte der Victory hatten nichts mit meiner gegenwärtigen Notlage zu tun. Ich musste mich dringend etwas ausruhen, also nahm ich eine Schlaftablette und bekam so etwas mehr Schlaf. Meine Nervosität spiegelte sich in meinen Träumen wider, denn ich hörte die Schreie der Ertrinkenden und sah die Gesichter der Toten, die sich von außen gegen die Bullaugen des Bootes pressten. Und unter diesen toten Gesichtern war auch das lebendige höhnische Gesicht des jungen Mannes, der den Kopf aus Elfenbein bei sich gehabt hatte.
Ich muss vorsichtig sein, wie ich mein heutiges Erwachen erinnere, denn ich bin völlig entnervt, und in diesem Zustand vermischt sich die Wirklichkeit oft mit Halluzinationen. Mein Fall ist psychologisch hochinteressant und ich bedauere, dass er nicht von einer kompetenten deutschen Autorität wissenschaftlich untersucht werden kann. Nach meinem Erwachen war mein erstes Gefühl ein überwältigender Drang, den Felsentempel zu besuchen. Dieser Drang nahm ständig zu, allerdings versuchte ich ihm zu widerstehen – besonders wegen gewisser Befürchtungen, die mich von einem weiteren Besuch abhielten. Als Nächstes hatte ich den Eindruck von Lichtschein inmitten der Dunkelheit und ich nahm durch das Bullauge, durch das man auf den Tempel blickte, eine Art phosphoreszierendes Glühen im Wasser wahr. Das weckte meine Neugier, denn ich kannte keine Organismen der Tiefsee, die fähig waren, ein solches Licht zu erzeugen. Aber bevor ich der Sache nachgehen konnte, kam noch ein weiterer Eindruck hinzu, der mich wegen seiner Irrationalität an der Objektivität meiner Wahrnehmungen zweifeln ließ. Ich glaubte nämlich, einen rhythmischen, melodischen Klang zu hören, einen wilden und trotzdem schönen Gesang oder eine Choralhymne, die von außen durch die schalldichte Hülle des U-Bootes zu dringen schien. Überzeugt von meinem abnormalen Geisteszustand entzündete ich einige Streichhölzer und sprühte mir eine kräftige Dosis einer Natriumbromid-Lösung in den Mund, was mich etwas beruhigte und dafür sorgte, dass die Illusion des melodischen Klangs nachließ. Aber das phosphoreszierende Licht blieb und ich konnte nur schwer den kindlichen Drang unterdrücken, zu dem Bullauge zu gehen und nach der Quelle des Lichtes Ausschau zu halten. Aber das Licht war furchtbar realistisch und bald konnte ich mit seiner Hilfe die vertrauten Dinge um mich herum erkennen. Auch das leere Natriumbromidglas, das ich vorher nicht hatte sehen können. Dieser Umstand machte mich nachdenklich, also stand ich auf und berührte das Glas. Und es war tatsächlich an demselben Ort, an dem ich es gesehen hatte. Jetzt wusste ich, dass das Licht entweder real war oder ein Teil einer Halluzination, die so stark und beständig war, dass ich nicht darauf hoffen konnte, sie zu vertreiben. Also gab ich meinen Widerstand auf und stieg zur Kommandobrücke auf, um die Lichtquelle zu lokalisieren. Könnte es vielleicht ein anderes U-Boot sein, das mich möglicherweise retten könnte?
Ich hätte Verständnis dafür, wenn der Leser nichts von dem Folgenden als objektive Wahrheit akzeptiert, denn da die Geschehnisse die Naturgesetze übersteigen, sind sie notwendigerweise subjektive und unrealistische Erfindungen meines überforderten Geistes. Als ich die Kommandobrücke erreicht hatte, fand ich das Meer viel weniger beleuchtet, als ich erwartet hatte. Es war keine tierische oder pflanzliche Phosphoreszenz zu sehen und die Stadt, die bis zum Bach hinab reichte, war in der Schwärze nicht zu erkennen. Was ich sah, war weder spektakulär noch grotesk oder erschreckend, trotzdem beseitigte es den letzten Rest von Vertrauen in mein klares Bewusstsein. Denn die Tür und die Fenster des unterseeischen, in den felsigen Hügel gehauenen Tempels leuchteten und flackerten lebhaft, so als würde sich in seinem Inneren ein mächtiger brennender Altar befinden.
Was danach geschah, war chaotisch. Während ich die unheimlich erleuchtete Tür und die Fenster anstarrte, wurde ich das Opfer extremer Visionen – Visionen, die so extravagant waren, dass ich sie nicht einmal schildern kann. Ich bildete mir ein, dass ich in dem Tempel Objekte erkennen konnte – sowohl ruhende als auch sich bewegende Objekte, und es war wieder dieser unwirkliche Gesang zu hören, den ich schon wahrgenommen hatte, als ich zum ersten Mal aufgewacht war. Und über allem erhoben sich Gedanken und Ängste, die sich auf den jungen Mann aus dem Meer und auf das Elfenbeinbild bezogen, dessen Schnitzereien sich in gleicher Form auf dem Fries und den Säulen des Tempels vor mir widerfanden. Ich dachte an den armen Klenze und fragte mich, wo wohl seine Leiche mit dem Elfenbeinbildnis sein könnte, das er wieder mit ins Meer genommen hatte. Er hatte mich vor etwas Unbekanntem gewarnt und ich hatte seine Warnung nicht beachtet, aber er war ein weichherziger Rheinländer, der bei jeder Schwierigkeit gleich verrückt wurde – Schwierigkeiten, die ein Preuße mit Leichtigkeit bewältigen konnte.
Der Rest ist sehr einfach. Mein Drang, den Tempel zu besuchen und hineinzugehen, ist inzwischen zu einem unerklärlichen und gebieterischen Befehl geworden, der keinen Widerspruch duldet. Mein eigener deutscher Wille kontrolliert jetzt nicht mehr meine Handlungen, und meine Willenskraft entscheidet von jetzt an nur noch in unbedeutenden Angelegenheiten. Es war genau derselbe Wahnsinn, der Klenze in den Tod trieb – ohne Helm und ungeschützt im Ozean. Ich aber bin ein Preuße, ein Mensch von gesundem Menschenverstand und werde auch den letzten Rest meines schwachen Willens nutzen, den ich noch habe. Als ich erkannte, dass ich gehen musste, bereitete ich meinen Tauchanzug, meinen Helm und den Lufterneuerer vor, um ihn sofort anziehen zu können, und begann, diesen überstürzten Bericht zu schreiben – in der Hoffnung, dass er eines Tages die Welt erreichen würde. Ich werde das Manuskript in einer Flasche einschließen und sie dem Meer anvertrauen, wenn ich die U-29 endgültig verlasse.
Ich habe keine Angst, nicht einmal vor den Vorhersagen des verrückten Klenze. Was ich gesehen habe, kann unmöglich wahr sein, und ich weiß, dass dieser eigenwillige Irrsinn höchstens zu meinem Ertrinken führen wird, wenn meine Luft aufgebraucht ist. Das Licht in dem Tempel ist nur eine Wahnvorstellung, und ich werde in aller Ruhe wie ein Deutscher in den schwarzen und vergessenen Tiefen sterben. Dieses dämonische Gelächter, das ich höre, während ich schreibe, kommt nur aus meinem aufgeweichten Hirn. Also werde ich sorgfältig meinen Tauchanzug anziehen und mutig die Stufen zu diesem uranfänglichen Heiligtum hinaufgehen – zu diesem lautlosen Geheimnis unergründlicher Gewässer und unzähliger Jahre.
Polaris
Polaris (1918)
von H. P. Lovecraft
Übersetzung: Stefan Gresse (2023)
In das nördliche Fenster meines Zimmers scheint der Polarstern mit seinem unheimlichen Licht. Während der langen höllischen Stunden der Dunkelheit scheint er dort. Und im Herbst, wenn die Winde aus dem Norden fluchen und heulen und die rot belaubten Bäume des Sumpfes in den frühen Morgenstunden unter dem abnehmenden Mond einander seltsame Dinge zuflüstern, sitze ich am Fenster und beobachte diesen Stern. Zu fortgeschrittener Stunde glitzert das Sternbild Kassiopeia von den Höhen herab, während sich der Große Wagen hinter den dunstigen Sumpfbäumen abzeichnet, die im Nachtwind wanken. Kurz vor dem Morgengrauen zwinkert Arkturus rötlich von oberhalb des niedrigen Friedhofshügels, und Coma Berenices schimmert eigentümlich in der Ferne im geheimnisvollen Osten; aber immer noch lacht der Polarstern hell und klar herab von derselben Stelle am schwarzen Himmelsgewölbe, grinsend wie ein wahnsinniges Auge, das versucht, eine seltsame Botschaft zu übermitteln, sich aber nicht daran erinnern kann, was eigentlich genau ihr Inhalt sein soll. Nur manchmal, wenn es bewölkt ist, kann ich schlafen.
Ich erinnere mich gut an die Nacht der großen Aurora, als über dem Sumpf die schockierenden Leuchterscheinungen des dämonischen Lichts aufflackerten. Auf die Strahlen folgten Wolken und dann war ich schließlich eingeschlafen.
Unter einem abnehmenden Mond erblickte ich die Stadt zum ersten Mal. Still und schläfrig lag sie da, auf einer seltsamen Hochebene in einer Senke zwischen bizarren Gipfeln. Aus gespenstischem Marmor waren ihre Wände und Türme, ihre Säulen, Kuppeln und Gehwege. In den marmornen Straßen befanden sich marmorne Stehlen, in deren obere Hälften die Figuren von ernsthaften, bärtigen Männern gemeißelt waren.
Die Luft war warm und regte sich nicht. Und hoch oben, kaum zehn Grad vom Zenit entfernt, leuchtete der wachsame Polarstern. Lange betrachtete ich die Stadt, aber der Tag brach nicht heran. Als der rote Aldebaran, der tief am Himmel funkelte, aber niemals unterging, ein Viertel des Weges am Horizont entlanggekrochen war, erblickte ich Licht und Bewegung in den Häusern und auf den Straßen. Seltsam gekleidete Gestalten, edel und vertraut zugleich, gingen umher, und unter dem abnehmenden Mond sprachen Männer weise Worte in einer Sprache, die ich verstand, obwohl sie keiner Sprache glich, die ich je gekannt hatte. Und als der rote Aldebaran mehr als die Hälfte des Weges am Horizont zurückgelegt hatte, kehrten Dunkelheit und Stille wieder ein.
Als ich erwachte, war ich nicht mehr derselbe. Die Vision der Stadt hatte sich in mein Gedächtnis eingebrannt, und in meiner Seele war eine weitere und vage Erinnerung aufgestiegen, über deren Natur ich mir damals nicht sicher war. Seitdem sah ich die Stadt häufig in den wolkenverhangenen Nächten, in denen ich schlafen konnte; manchmal unter jenem abnehmenden Mond und manchmal unter den heißen gelben Strahlen einer Sonne, die nicht unterging, sondern tief am Horizont umherwanderte. Und in den klaren Nächten grinste der Polarstern anzüglich wie nie zuvor.
Allmählich begann ich mich zu fragen, welchen Platz ich in jener Stadt auf der seltsamen Hochebene zwischen den seltsamen Gipfeln einnehmen könnte. Anfangs zufrieden damit, die Szenerie als allwissendes, unkörperliches Wesen zu betrachten, sehnte ich mich nun danach, meine Beziehung zu ihr zu definieren und meine Meinung unter den ernsten Männern kundzutun, die täglich auf den öffentlichen Plätzen diskutierten. Ich sagte mir: „Dies ist kein Traum, aber auf welche Weise ließe sich die größere Realität des anderen Lebens im Haus aus Stein und Ziegeln südlich des unheilvollen Sumpfes und des Friedhofs beweisen, wo der Polarstern jede Nacht grell durch mein Nordfenster späht?“
In der Nacht, als ich auf dem großen Platz mit seinen vielen Statuen einer Diskussion lauschte, fühlte ich eine Veränderung und spürte, dass ich endlich eine körperliche Gestalt erlangt hatte. Und ich war auch kein Fremder mehr in den Straßen von Olathoë, das auf dem Plateau von Sarkis liegt, zwischen den Gipfeln Noton und Kadiphonek. Es war mein Freund Alos, der sprach, und seine Rede erfreute meine Seele, denn es war die Rede eines wahren Mannes und Patrioten. An diesem Abend erreichte uns die Nachricht von Daikos’ Niederlage und dem Vormarsch der Inutos; gedrungene, teuflische, gelbe Ungeheuer, die vor fünf Jahren aus dem unbekannten Westen aufgetaucht waren, um die Grenzen unseres Königreichs zu verwüsten und schließlich unsere Städte zu belagern. Nachdem sie die befestigten Orte am Fuße der Berge eingenommen hatten, war ihr Weg auf die Ebene nun frei, es sei denn, jeder Bürger könnte sich ihnen mit der Kraft von zehn Männern widersetzen. Denn die gedrungenen Kreaturen waren äußerst bewandert in den Künsten des Krieges und kannten nicht die Skrupel der Ehre, die unsere großen, grauäugigen Männer von Lomar von rücksichtsloser Eroberung abhielten.
Alos, mein Freund, war der Oberbefehlshaber aller Streitkräfte auf der Ebene, und auf ihm ruhten die letzten Hoffnungen unseres Landes. An diesem Abend sprach er von den Gefahren, die es zu bewältigen galt, und ermahnte die Männer von Olathoë, den Tapfersten der Lomarier, die Traditionen ihrer Vorfahren aufrechtzuerhalten, die, als sie gezwungen waren, sich vor dem Vorrücken des großen Eispanzers von Zobna nach Süden aufzumachen (genau wie unsere Nachkommen eines Tages aus dem Land Lomar werden fliehen müssen), dabei tapfer und siegreich die haarigen, langarmigen, kannibalischen Gnophkehs beiseite fegten, die ihnen im Weg standen. Mir verweigerte Alos einen Kriegseinsatz, denn ich war schwach und neigte zu seltsamen Ohnmachtsanfällen bei Stress und Entbehrungen. Aber meine Augen waren die schärfsten in der Stadt, trotz der langen Stunden, die ich täglich dem Studium der Pnakotischen Manuskripte und der Weisheit der Zobnarianischen Väter widmete; daher belohnte mich mein Freund, der mich nicht untätig wissen wollte, mit einer Aufgabe, die zweifellos von großer Bedeutung war. Er schickte mich auf den Wachturm von Thapnen, um dort als wachsames Augen unserer Armee zu dienen. Sollten die Inutos versuchen, die Zitadelle über den schmalen Pass hinter dem Gipfel Noton zu erreichen und auf diesem Wege die Garnison überraschen, sollte ich das Feuersignal geben, das die kampfbereiten Soldaten warnen und die Stadt vor der unmittelbaren Katastrophe bewahren würde.
Ich stieg allein auf den Turm, denn jeder kräftige Mann wurde auf den Pässen gebraucht. Mein Gehirn war von Aufregung und Erschöpfung schmerzhaft verwirrt, denn ich hatte seit vielen Tagen nicht geschlafen; dennoch war mein Entschluss unumstößlich, denn ich liebte mein Heimatland Lomar und die marmorne Stadt Olathoë, die zwischen den Gipfeln von Noton und Kadiphonek liegt.
Aber als ich mich in der obersten Kammer des Turms befand, sah ich den abnehmenden Mond, rot und unheilvoll durch die Dämpfe flackern, die über dem fernen Tal von Banof schwebten. Und durch eine Öffnung im Dach funkelte der blasse Polarstern, flatternd, gerade so, als ob er lebendig wäre, und lachte wie ein Dämon und Verführer. Mir schien es, dass sein Geist mir böse Ratschläge zu flüsterte, um mich mit einer äußerst rhythmischen Hymne zu ermüden, die er fortwährend wiederholte:
„Schlummere, Wächter, bis die Sphären Sechsundzwanzig tausend Jahre vergangen sind, Und ich kehre zurück An den Ort, an dem ich jetzt brenne.Andere Sterne werden dann aufsteigen, Zur Achse des Himmels.Sterne, die beruhigen und segnen Mit einer süßen Vergessenheit:Erst, wenn mein Lauf vorüber ist, Wird die Vergangenheit an deine Tür klopfen.“
Vergeblich kämpfte ich gegen meine Müdigkeit an und versuchte, diese seltsamen Worte mit meinem Wissen über die Gestirne zu verbinden, dass ich in den Pnakotischen Manuskripten entnommen hatte. Mein Kopf, schwer und durcheinander, senkte sich auf meine Brust, und als ich das nächste Mal aufblickte, war ich in einen Traum versunken; mit dem Polarstern oberhalb der schrecklich, wankenden Bäume eines Traumsumpfes, der mich durch ein Fenster angrinste. Und ich träume noch immer.
In meiner Scham und Niedergeschlagenheit schreie ich manchmal voller Verzweiflung, flehe die Traumwesen um mich herum an, mich aufzuwecken, bevor die Inutos heimlich durch den Pass hinter dem Gipfel Noton hinaufsteigen und die Zitadelle überraschen; aber diese Kreaturen sind Dämonen; sie lachen mich aus und sagen mir, dass ich nicht träume. Sie verspotten mich, während ich schlafe, und während sich vielleicht der gedrungene gelbe Feind lautlos auf uns zubewegt. Ich habe meine Pflicht versäumt und die marmorne Stadt Olathoë verraten; ich bin Alos, meinem Freund und Befehlshaber, untreu geworden. Aber diese Schatten meines Traums verhöhnen mich immer noch. Sie sagen, dass es kein Land Lomar gibt, außer in meinen nächtlichen Fantasien; dass es in jenen Gefilden, wo der Polarstern hoch scheint und der rote Aldebaran niedrig um den Horizont schleicht, seit Tausenden Jahren nichts als Eis und Schnee gibt und keine Lebewesen außer den gelben, von der Kälte verderbten Wesen, die sie ‚Esquimaux‘ nennen.
Und während ich mich in meiner Schuld geplagten Agonie winde und mich bemühe, die Stadt zu retten, deren Gefahr mit jeder Minute wächst, und vergeblich versuche, diesen unnatürlichen Traum von einem Haus aus Stein und Ziegeln südlich eines unheilvollen Sumpfes und eines Friedhofs auf einem niedrigen Hügel abzuschütteln; lacht der Polarstern, böse und monströs, aus dem schwarzen Himmelsgewölbe herab, grinsend wie ein wahnsinniges Auge, das versucht, eine seltsame Botschaft zu übermitteln, sich aber nicht daran erinnern kann, was eigentlich genau Inhalt dieser Botschaft sein sollte.
Die Farbe aus dem All
The Colour Out of Space (1927)
von H. P. Lovecraft
Übersetzung: Stefan Gresse (2023)
Westlich von Arkham präsentiert sich die Hügellandschaft wild und ungestüm. Es gibt Täler mit derartig tiefen Wäldern, dass die Bäume dort noch nie von der Axt eines Holzfällers berührt wurden. In den dunklen und engen Schluchten, an denen sich die Bäume fantastisch emporschlängeln, plätschern kleine Rinnsale, die noch nie den Glanz des Sonnenlichts eingefangen haben. An den flacheren Hängen liegen alte Bauernhöfe, deren gedrungene, moosbedeckte Hütten, seit Ewigkeiten im Windschatten großer Felsvorsprünge über den alten Geheimnissen von Neuengland brüten. Aber mittlerweile sind sie alle verlassen, ihre mächtigen Kamine bröckeln, und ihre mit Schindeln verkleideten Seitenwände wölben sich gefährlich unter den niedrigen Mansardendächern.
Die alten Leute sind fortgezogen und Fremden ist diese Gegend unbehaglich. Franko-Kanadier haben es versucht, Italiener haben es versucht, und die Polen kamen und gingen. Es liegt nicht an etwas Konkretem, das man hören, sehen oder berühren könnte, sondern an Fantasien und Gedanken. Der Ort beeinflusst die Vorstellungskraft und bringt des Nachts unruhige Träume. Das muss es sein, was die Ausländer fernhält, denn der alte Ammi Pierce hat ihnen nie etwas von seinen Erinnerungen an die seltsamen Tage erzählt. Ammi, dessen Kopf seit Jahren ein wenig seltsam tickt, ist der Einzige, der noch geblieben ist und der jemals von den seltsamen Tagen spricht; und er wagt es auch nur deshalb, weil sein Haus so nah an den offenen Feldern und den viel befahrenen Straßen nach Arkham liegt.
Einstmals verlief eine Straße über die Hügel und durch die Täler, genau dort, wo jetzt die verwüstete Heide liegt; aber die Leute hörten auf, sie zu benutzen, und so wurde eine neue Straße angelegt, die in einem weiten Borgen nach Süden verläuft. Spuren der alten Straße finden sich noch immer inmitten des Wildwuchses der zurückkehrenden Wildnis, und einige Überreste werden vermutlich selbst dann noch überdauern, wenn die Hälfte der Senken für den neuen Stausee überschwemmt worden sind. Dann werden die dunklen Wälder abgeholzt und die verwüstete Heide wird tief unter den blauen Wassern schlummern, deren Oberfläche den Himmel spiegeln und in der Sonne glitzern wird. Und die Geheimnisse der seltsamen Tage werden eins sein mit den Geheimnissen der Tiefe; eins, mit dem verborgenen Wissen des alten Ozeans und all den Mysterien der urzeitlichen Erde.
Als ich mich in die Hügellandschaft begab, um das neue Reservoir zu vermessen, sagte man mir, dass der Ort böse sei. Dies sagte man mir in Arkham, und weil Arkham eine sehr alte Stadt voller Hexenlegenden ist, dachte ich, dass das Böse etwas sein müsste, das Großmütter ihren Enkelkindern über Jahrhunderte hinweg leise zugeflüstert hätten. Der Begriff »verfluchte Heide« kam mir äußerst seltsam und theatralisch vor, und ich fragte mich, auf welche Weise er Einzug in die Folklore einer puritanischen Bevölkerung gefunden hatte. Dann sah ich mir dieses düstere Gewirr von Schluchten und Abhängen in westlicher Richtung selbst an und hörte auf, mich über irgendetwas zu wundern – stattdessen war ich vollends eingenommen von der erhabenen Rätselhaftigkeit des Ortes. Ich hatte mich dort zwar eines Morgens umgesehen, aber die Schatten schienen hier fortwährend zu lauern. Die Bäume wuchsen zu dicht nebeneinander, und ihre Stämme fielen für einen gesunden Wald in Neuengland definitiv zu mächtig aus. Auch war es in den dunklen Alleen zwischen ihnen viel zu leise, und der Boden war zu aufgeweicht von dem feuchten Moos und den Verwesungsrückständen unendlich vieler Jahre.
Auf den Feldern entlang des alten Straßenverlaufs befanden sich kleine Bauerngehöfte; manchmal standen noch alle Gebäude, manchmal nur ein oder zwei, und manchmal nur noch ein einsamer Schornstein oder ein verschütteter Keller. Gestrüpp und Unkraut beherrschten die Szenerie, während wildes Getier verstohlen im Unterholz raschelte. Über allem lag ein dunstiger Schleier von Unruhe und Bedrückung; ein Hauch von Unwirklichkeit und Groteske, als ob ein vitales Element der Perspektive oder der Hell-Dunkel-Kontrast nicht stimmen würde. Ich wunderte mich nicht, dass die Fremden diese Gegend mieden, denn dies war kein Ort für einen gesunden Schlaf. Alles ähnelte zu sehr einer Landschaft von Salvator Rosa; zu sehr einer verbotenen Holzschnittzeichnung in einer Schreckensgeschichte.
Aber dies war noch nichts im Vergleich mit der »verfluchte Heide«. Dies wurde mir sofort klar, als ich am Ende eines weitläufigen Tals auf ebendiese Heide stieß; keine andere Bezeichnung könnte etwas Derartiges präziser beschreiben oder irgendetwas anderes besser zu einem solchen Namen passen. Es schien, als ob der Dichter die Bezeichnung just in dem Moment geprägt hatte, als er dieser besonderen Gegend ansichtig wurde. Es musste sich, so dachte ich, als ich mich umschaute, um das Ergebnis eines Brandes handeln; aber warum nur ist auf diesen fünf Morgen Ödland, die sich wie ein großer Säurefleck in die umliegenden Wälder und Felder fraßen, nie wieder etwas Neues gewachsen?
Der Großteil davon lag nördlich des alten Straßenverlaufs. Nur an wenigen Stellen griff die Ödnis auf die andere Seite der alten Straße über. Ich verspürte eine merkwürdige Abneigung dagegen, mich der Gegend weiter zu nähern, und tat es schließlich nur, weil mich mein Auftrag dazu zwang, diese Region zu passieren. Hier gab es keinerlei Vegetation irgendeiner Art, sondern überall nur einen feinen, grauen Staub – oder vielleicht war es auch Asche -, die aber erstaunlicherweise zu keinem Zeitpunkt vom Wind aufgewirbelt wurde. Die Bäume in der näheren Umgebung wirkten kränklich und verkümmert, und viele abgestorbene Baumstämme standen oder lagen verrottend an den Rändern der Heide. Als ich hastig daran vorüber Schritt, bemerkte ich zu meiner Rechten die verschütteten Ziegel und Steine eines alten Schornsteins und Kellers sowie den gähnenden schwarzen Schlund eines Brunnens, dessen elende Ausdünstungen ein seltsames Spiel mit den Farben des Sonnenlichts trieben. Verglichen damit, schien mir der lange, dunkle Aufstieg durch den Wald eine willkommene Abwechslung zu sein, und mittlerweile wunderte ich mich auch nicht mehr über die ängstlichen Flüstergeschichten der Bewohner Arkhams. In der näheren Umgebung waren keine Häuser oder Ruinen von Bauernhöfen zu sehen. Schon in den ältesten Tagen muss dieser Ort sehr einsam und abgelegen gewesen sein. Für meinen Rückweg wählte ich die weiter südlich verlaufende Straße und ging auf recht verschlungenen Wegen zurück in die Stadt, da ich mich davor fürchtete diesen ominösen Ort in Dämmerung erneut passieren zu müssen. Vage hoffte ich darauf, dass ein paar Wolken aufziehen würden, denn ein seltsames Angstgefühl hatte sich angesichts der himmelblauen Leere über mir in meiner Seele eingenistet.
Am Abend befragte ich die alten Bewohner von Arkham nach der verfluchten Heide und was mit dem Ausdruck »seltsame Tage« gemeint war, den so viele von ihnen beiläufig erwähnt hatten. Ich erhielt jedoch kaum aussagekräftige Informationen, außer dass das ganze Mysterium weitaus aktueller war, als ich es mir ausgemalt hatte. Es handelte sich dabei keineswegs um uralte Legenden, sondern um etwas, das sich zu Lebzeiten derer ereignet hatte, mit denen ich gesprochen hatte. Das Ganze war in den Achtzigerjahren geschehen, und eine Familie war dabei entweder verschwunden oder getötet worden. Die Ausführungen meiner Gesprächspartner waren äußerst unpräzise und teilweise widersprüchlich, und weil sie alle der Auffassung waren, dass ich den verrückten Geschichten von Ammi Pierce auf keinen Fall Beachtung schenken solle, suchte ich genau diesen am nächsten Morgen auf, nachdem ich gehört hatte, dass er allein in der alten baufälligen Hütte lebte. In einer Gegend, in der der Baumbewuchs bereits zunehmend dichter wurde. Es war ein furchterregend archaischer Ort und das Gebäude hatte bereits begonnen, einen schwachen Gestank zu verströmen, der an allen Häusern haftet, die schon zu lange stehen. Nur durch hartnäckiges Klopfen konnte ich den alten Mann aufwecken, und als er ängstlich zur Tür schlurfte, bemerkte ich, dass er nicht sonderlich erfreut war, mich zu sehen. Er war nicht so schwächlich, wie ich erwartet hatte, aber seine Augen hingen auf eine seltsame Weise herab, und seine liederliche Kleidung und sein weißer Bart ließen ihn sehr ungepflegt und trostlos erscheinen. Ohne genau zu wissen, wie ich ihm am besten seine Geschichten entlocken konnte, heuchelte ich eine Angelegenheit von Wichtigkeit vor; erzählte ihm von meiner Vermessungstätigkeit und stellte ihm dabei vage Fragen zur näheren Umgebung. Er war viel intelligenter und gebildeter als ich gedacht hatte, und bevor ich mich versah, hatte er bereits genauso viel vom eigentlichen Thema erfasst wie auch jede andere Person, mit der ich zuvor in Arkham gesprochen hatte. Er war anders als die vielen anderen Landbewohner, die ich in der Region der geplanten Stauseen kennengelernt hatte. Von ihm gab es keine Proteste dagegen, dass kilometerlange alte Wälder und Ackerflächen ausgelöscht werden sollten, obwohl dies eventuell der Fall gewesen wäre, wenn seine Behausung nicht außerhalb der Grenzen des zukünftigen Sees gelegen hätte. Erleichterung war das einzige Gefühl, das er offenbarte; Erleichterung über den Untergang der düsteren, uralten Täler, durch die er sein ganzes Leben lang gewandert war. Unter Wasser waren sie jetzt besser aufgehoben. Seit den „seltsamen Tagen“ wären sie unter Wasser besser aufgehoben gewesen. Nach diesen einleitenden Worten dämpfe er seine heisere Stimme, beugte seinen Körper nach vorn und begann mit seinem rechten Zeigefinger zitternd, aber eindrucksvoll zu gestikulieren.
Zu diesem Zeitpunkt hörte ich die Geschichte zum ersten Mal, und während die krächzende und flüsternde Stimme ihre Erzählung vortrug, schauderte es mich immer wieder trotz des wohligen Sommerwetters. An den Stellen, wo der Sinn für Logik und Kontinuität seiner Geschichte versagte, musste ich den Erzähler entweder von seinen Ausschweifungen zurückrufen, wissenschaftliche Fakten geraderücken oder seine Gedächtnislücken füllen. Als er mit seinem Vortrag fertig war, erstaunte es mich nicht mehr, dass sein Verstand ein wenig verrückt geworden war oder die Leute von Arkham nicht viel über die verfluchte Heide sprechen wollten. Noch vor Sonnenuntergang eilte ich zurück in mein Hotel, da ich es vermeiden wollte, dass die Sterne über mir am Himmel erschienen, während ich noch im Freien war. Am folgenden Tag kehrte ich nach Boston zurück, um meine Stellung aufzugeben. Ich konnte nicht noch einmal in das trübe Chaos des alten Waldes und der Berghänge zurückkehren. Auch sträubte sich alles in mir, ein weiteres Mal diese verfluchte, graue Heide zu betreten, wo sich der tiefe Schlund des schwarzen Brunnens neben den Ziegel- und Steinhaufen auftat. Der Stausee wird demnächst angelegt, und dann werden all die alten Geheimnisse für immer in seinen wässrigen Tiefen begraben sein. Aber selbst dann würde ich diese Gegend nicht des Nachts besuchen wollen – zumindest nicht, solange die unheilvollen Sterne am Himmel scheinen; und nichts könnte mich in Arkham dazu bringen, Wasser aus dieser neuen Quelle zu trinken.
Es begann alles, so sagte der alte Ammi, mit dem Meteoriten. Davor hatte es seit den Hexenprozessen keine wilden Geschichten mehr gegeben und auch zu jener Zeit fürchtete man diese westlichen Wälder nur halb so sehr wie eine kleine Insel im Miskatonic, wo der Teufel an einem seltsamen steinernen Altar Hof hielt, der schon vor den Indianern dort gewesen war. Die Wälder waren damals noch nicht verflucht, und ihr Anblick im fantastischen Dämmerlicht war bis zu den seltsamen Tagen nie wirklich furchterregend gewesen. Dann erschien eines Mittags eine weiße Wolke, es folgten mehrere Explosionen und dann stieg aus dem Wald tief im Tal eine Rauchsäule empor. Bereits in der Nacht hatte ganz Arkham von dem großen Gesteinsbrocken gehört, der vom Himmel gefallen war und sich auf dem Grundstück von Nahum Gardner neben dem Brunnen in das Erdreich gebohrt hatte. Auf dem Grundstück, auf dem später die verfluchte Heide entstehen sollte, hatte das Haus gestanden – das hübsche, weiße Haus von Nahum Gardner umgeben von fruchtbaren Gärten und Obstbäumen.
Nahum hatte sich dann auf den Weg in die Stadt gemacht, um den Leuten von dem Gesteinsbrocken zu erzählen, und unterwegs bei Ammi Pierce Halt gemacht. Ammi war damals vierzig Jahre alt, und all die seltsamen Geschehnisse hatten sich unauslöschlich in sein Gedächtnis eingebrannt. Er und seine Frau waren am nächsten Morgen mit den drei Professoren von der Miskatonic University hinausgeeilt, um den merkwürdigen Besucher aus den Weiten des Weltraums zu bestaunen, und hatten sich dann sehr darüber gewundert, dass Nahum ihn am Tag zuvor als „so groß“ bezeichnet hatte. Als Nahum auf die große bräunliche Erhebung auf dem aufgewühlten Erdreich und dem verbrannten Gras in seinem Vorgarten wies, meinte er, dass der Stein wohl etwas geschrumpft sein müsse. Aber die Professoren erwiderten darauf, dass Steine nicht schrumpften. Der Meteor strahlte hartnäckig Hitze aus, und Nahum behauptete, dass er in der Nacht sogar schwach geglüht hatte. Die Professoren untersuchten ihn mit einem Geologenhammer und stellten fest, dass er eigentümlich weich war. Tatsächlich war er so nachgiebig, dass er beinahe formbar war. Das Stück, das sie für weitere Analysen mit an die Universität nahmen, mussten sie dann auch eher herausmeißeln, als dass sie es abschlagen konnten. Sie transportierten die Gesteinsprobe in einem alten Eimer, den sie sich aus Nahums Küche ausliehen, denn selbst dieser kleiner Gesteinsbrocken sonderte noch ein erhebliches Maß an Hitze ab. Auf dem Rückweg hielten sie bei Ammi an, um sich auszuruhen, und machten einen sehr nachdenklichen Eindruck, als Mrs. Pierce bemerkte, dass das Gesteinsfragment immer kleiner wurde und dabei den Boden des Eimers durchfraß. Die Gesteinsprobe war wahrhaftig nicht sehr groß gewesen, aber vielleicht hatten sie auch weniger mitgenommen, als sie gedacht hatten.
Schon am Tag danach – all dies geschah im Juni ‚82 - kehrten die Professoren in heller Aufregung wieder zurück. Als sie an Ammi‘s Hause vorbeizogen, berichteten sie ihm von den wundersamen Eigenschaften der Gesteinsprobe und wie vollständig sich der Stein aufgelöst hatte, nachdem sie ihn in ein Becherglas gelegt hatten. Der Becher war ebenfalls verschwunden, und die Professoren sprachen von einer seltsamen Verwandtschaft des Gesteins mit Silizium. Im wohl sortierten Labor der Universität hatte er sich äußerst ungewöhnlich verhalten. Als er auf Kohle erhitzt wurde, reagierte er überhaupt nicht und offenbarte keinerlei eingeschlossene Gase. Der Borax-Perlenversuch lieferte ausschließlich negative Ergebnisse und zudem erwies sich das Gesteinsmaterial unabhängig von der erzeugten Temperatur als absolut nicht flüchtig. Auf einem Amboss schien er sehr gut formbar zu sein, und in der Dunkelheit wurde seine Leuchtkraft deutlich sichtbar. Dass er sich unter keinen Umständen abkühlen ließ, versetzte bald die gesamte Universität in kollektive Aufregung. Als die Gesteinsprobe beim Erhitzen vor einem Spektroskop Farbtöne offenbarte, die sich von allen bekannten Farben des normalen Spektrums unterschieden, wurde viel von neuen Elementen, bizarren optischen Eigenschaften und anderen Dingen geredet, über die perplexe Wissenschaftler normalerweise sprechen, wenn sie mit dem Unbekannten konfrontiert werden.