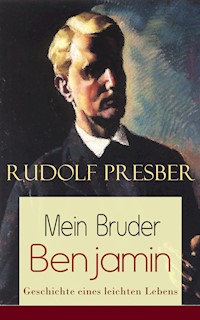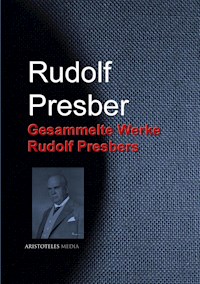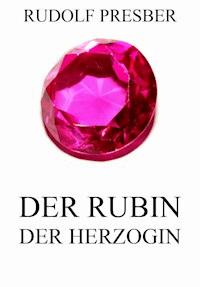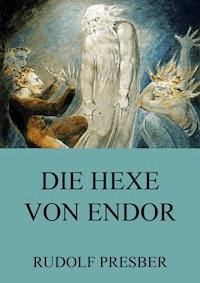0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Die Hexe von Endor" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "Siegmund Kern stand mit nacktem, wasserbeperltem Oberkörper vor dem kleinen Waschtisch. Gewohnt, die meiste Zeit seines Lebens hinter dem Pult zu sitzen, hatte er auf gute Körperhaltung nie sonderlich acht gegeben. Seine knochigen Schultern näherten sich einander in einem Bogen, während unter der reichlich behaarten Brust der schwabbelnde Ansatz eines Bäuchleins sich in den allzu straff sitzenden Bund des Unterbeinkleides verlor. Wie er eigentlich zu dieser seltsamen, weder schönen noch bequemen Fettablagerung gekommen, wußte er selbst nicht. Von der Reichlichkeit fetter Mahlzeiten, die ihm Melusine vorsetzte, kaum." Rudolf Presber (1868-1935) war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Drehbuchautor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Die Hexe von Endor
Inhaltsverzeichnis
I
Erstens war die Feder so schlecht, wie sie auf kleinen Postämtern zu sein pflegt, wo jeder seine Wut darüber, daß er telegraphieren muß, an dem Schreibmaterial ausläßt. Zweitens hatte er kalte Finger, die noch niemals mit einer verdorbenen Feder besonderes geleistet haben. Drittens beherrschte ihn das deutliche Gefühl, daß die junge Dame, die da neben ihm, nur durch die halbhohe matte Glaswand von ihm getrennt, ohne von ihrer Umgebung irgendwelche Notiz zu nehmen, sich schreibend auf das Papier beugte, sehr hübsch sei.
Drei Gründe dafür, daß er die Hand auf dem Telegraphenformular ruhen ließ, auf dem bis jetzt nur in kritzligen Buchstaben zu lesen stand: »Wenn Wetter gut, morgen Wannsee-Bahnhof . . .« Das Weitere, auch die Adresse, die er aus gewissem Argwohn gegen etwa über die Schulter schauende Vorübergehende immer zuletzt schrieb, sollte folgen. Aber da hatte ein ganz feiner sympathischer Duft – er schätzte: Veilchen plus junger Frauenkörper – ihn gestreift; und er warf die schlechte Feder auf das Telegrammformular und beschloß zu warten. Zu warten, bis die Schreiberin neben ihm sich von ihrer, wie es schien, mühevollen Arbeit endlich aufrichten würde.
Ihr einfacher mit Pelz besetzter dunkelblauer Wintermantel verriet eine hübsche Figur. Das Haar war tief schwarz, kein Bubikopf, ein Knoten. Es muß schwer für sie sein, dachte Veit, bei ihrem reichen Haar und der unmodernen Frisur den passenden Hut zu finden. Das Gesicht konnte er nicht sehen. Aber seine Ahnung sagte ihm: es paßte zu der Erscheinung, soweit sie für den diskreten Nachbar nachprüfbar war; paßte zu der schlichten, aber guten Aufmachung, paßte zu dem ganz feinen aus Frau und Veilchen gemischten Duft, der ihn beunruhigte.
Jetzt hörte Veit nebenan die Hand, die er nicht sehen konnte, ein Stück Papier zerknüllen und weglegen. Ein leiser Seufzer begleitete diese Bewegung. Der Brief oder was es ist, scheint stilistisch ihren Anforderungen nicht genügt zu haben, dachte Veit. Er dachte es ohne Ungeduld, die ihn sonst wohl auf Postämtern beherrschte, wenn ein anderer den einzig brauchbaren Federhalter nicht losließ oder in der Telephonzelle die angenagelte Mahnung, sich kurz zu fassen, schnöde mißachtete.
Veit sah sich in dem wenig großstädtischen Postamt um. An jedem Schalter warteten etliche vom Novemberregen befeuchtete Menschen. Es roch nach Leim, Schweiß, billiger Pomade und nassen Kleidern. Am Schalter für postlagernde Briefe standen ein paar wenig reizvolle Damen, deren Korrespondenz gewiß mit gutem Recht anonym geführt wurde. Dazwischen ein stumpf brütender alter Mann, der vermutlich bessere Tage gesehen hatte und sich – wie sich das Veit aus einer jüngst gelesenen Annonce erinnerte – »an einem ähnlichen Unternehmen wieder zu beteiligen« wünschte.
Ganz am Ende der betreffenden Schlange wartete ein eleganter Herr im Gehpelz. Mitte der Dreißiger vielleicht, ein bißchen blaß und abgelebt. Das randlose Monokel schien von der spitzen, schmalen, etwas schiefsitzenden Nase an das rechte Auge gepreßt zu werden. Der Herr trug die zu dem Bisampelzkragen passende Mütze als Kopfbedeckung und schien der einzige der Wartenden zu sein, der sich nicht schmählich ärgerte über die nicht zu erschütternde Ruhe des amtierenden kahlköpfigen Postbeamten, der die gerade neu eingelaufenen postlagernden Briefe hinter der geschlossenen Glasscheibe ohne Eile sortierte und dabei, als müsse er es unbedingt memorieren, vor sich hinmurmelte: »Fräulein Hulda S. A.« . . . »Herrn Wolfgang Krispin aus Danzig« . . . »Figaro 100« . . . »Amor 7« . . .
Der Herr mit dem Monokel schien Zeit zu haben. Zeit und Interesse. Er sah – der Spiegel des Einglases verriet die Richtung – unverwandt zu dem kleinen Abteil des für das Publikum um die Säule herumgebauten Schreibtisches, an dem eben mit einem neuen Seufzer der Ungeduld oder Enttäuschung die junge Dame mit dem schwarzen Haarknoten ein zweites Papierchen zerknüllte.
Draußen vor der von den Spritzern des Herbstregens betupften Scheibe sah Veit in gewissen Abständen immer denselben schmalen Schatten schildwachartig vorüberwandeln. Addo, der treue Freund, wartete da auf ihn und machte sich gewiß schon Gedanken über die Länge und Ausführlichkeit der Depesche, die nach seiner Erkenntnis den nicht ungewöhnlichen Zweck hatte, die kleine quecksilbrige, sommersprossige Annemarie, erste Plätterin im »Herrschaftlichen Wäsche- und Plättgeschäft« der Frau Emmerich in Nowawes zu gemeinsamer Sonntagsunternehmung an den Wannseebahnhof zu bestellen.
Schade, Addo hat keinen Schirm, dachte Veit, während er auf das Rascheln des Papiers dicht neben sich lauschte, und sein neuer Hut – das hat er mir gerade vorhin erzählt – hat auf der Potsdamer Straße sechzehn Mark fünfzig gekostet.
In diesem Augenblick richtete sich die junge Dame neben ihm – entweder fertig mit ihrer Schreibarbeit oder daran verzweifelnd – aus ihrer gebückten Stellung auf. Veit sah für einen Augenblick in ein etwas blasses aber bildhübsches Gesicht. Edelgeschnitten, ein wenig an Feuerbachs Römerinnen erinnernd, aber, wie ihm vorkam, hellblaue Augen, die groß und ein bißchen traurig an ihm vorbeisahen.
Die junge Dame, die eben noch so viel Zeit gehabt, schien es jetzt sehr eilig zu haben. Sie raffte eine Zeitung, ein Taschenbuch und ein Täschchen zusammen und verließ rasch, sich durch das Publikum drängend, das Postamt.
Ohne den Blick von der Enteilenden zu wenden, war Veit an das freigewordene benachbarte Abteil herangetreten, von dem er den besseren Federhalter erhoffte. Als er ihn ergriff, war er noch warm von ihrer Hand.
Dieses Gefühl der Wärme gab seinen Gedanken eine Richtung, die nicht nach Nowawes führte und nichts zu tun hatte mit dem Plättgeschäft der Frau Emmerich und ihrer ersten Plätterin. Die Fortsetzung seines Telegramms lag ihm plötzlich nicht mehr allzusehr am Herzen; und er bemerkte gar nicht, daß er mit der tatsächlich besseren Feder sinnlose Schnörkel durch die schon geleistete Arbeit: »Wenn Wetter gut, morgen Wannsee-Bahnhof« zu ziehen bemüht war.
Da fiel sein Auge auf die beiden zerknüllten Zettelchen an dem Tintenfaß. Rasch griff er das eine glättete es und las in einer feinen, zierlichen Handschrift:
»Welcher Edeldenkende wäre geneigt, einer jungen, strebsamen Künstlerin aus guter Familie – schauspielerisch bereits geprüft – – –«, die folgenden Worte, deren Fassung offenbar Schwierigkeiten verursacht, waren durchgestrichen bis zur Unkenntlichkeit.
Dreimal überflog Veit die wenigen Worte, verblüfft und eigenartig aufgewühlt, als ob er den Aufschluß zu einem bedauerlichen Geheimnis erfahren hätte. Dann raffte er plötzlich das Papier auf, ließ die für den Draht bestimmte Mitteilung an die kleine Annemarie, erste Plätterin im »Herrschaftlichen Wäsche- und Plättgeschäft« der Frau Emmerich in Nowawes, auf der Tischplatte liegen und eilte hinaus auf die Straße zu Addo, dessen schmaler Schatten gerade eben wieder am trüben Fenster vorbeigeglitten war.
»Addo!«
»Endlich! Du hast wohl an die Kleine in Versen telegraphiert?«
»Unsinn! . . . Ich habe überhaupt noch nicht telegraphiert . . . ich . . . das heißt, du – ich meine, hast du hier eine junge Dame herauskommen sehen?«
»Du, hör' mal, Veit – in der Viertelstunde, in der du mich hier im Regen patrouillieren ließest, sind natürlich eine ganze Anzahl junger Damen – auch ältere, die sogar in der Mehrzahl – hier herausgekommen und die Marburger Straße entlang . . .«
»Ganz kürzlich erst – vor einer Minute oder zwei – im dunkelblauen Mantel mit schmalem Pelzbesatz – schlank, gute Figur – ausgezeichnete Figur!«
»Ja, wart' mal – schwarzes Haar, kein Bubikopf?«
»Richtig, richtig, die!« Veit triumphierte, als ob sein Freund ein besonders schwieriges Rätsel der Prinzessin Turandot soeben für ihn geraten hätte. »Wo ging sie lang? Hier nach der Augsburger zu – oder dort nach der Tauentzienstraße?«
»Willst du ihr nach –?«
»Mein Gott, das ist doch egal – zunächst mal, wohin ist sie . . .?«
»Entschuldige mal, das ist gar nicht egal«, sagte, von dem Ton Veits leicht verletzt, der in der Pedanterie, die einem Bankbeamten eigen sein muß, zu Weitläufigkeiten geneigte Addo – »es ist gar nicht egal, insofern, als die junge Dame, wie ich beobachtete, von einem andern . . .«
»Wie denn – wo denn –? Ein anderer ist ihr nachgestiegen?« Veit war ehrlich entrüstet. »Wer denn? Bitte, wer war es?«
»Ja, vorgestellt hat er sich mir nicht«, lachte Addo. »Ein peinlich eleganter Herr. Mittelalter, Gehpelz –«
»Mit Monokel –? Dann weiß ich schon! Daß ich den Fatzke nicht im Auge behielt!«
»Ein Fatzke war es eigentlich nicht – er sah bloß gut aus.«
»Es war ein Fatzke! – Lehr' mich die Menschen kennen, die da auf Postämtern – – und nachher gleich hinter einer hübschen Frau, die sie nicht kennen –«
»Ja, Veit, ich weiß nicht recht . . . Mir scheint, du bist kein Fatzke – – und du wolltest doch, scheint mir, eigentlich auch . . .«
»Das ist etwas ganz anderes. Hier, bitte, hier!« Und wie zu seiner Rechtfertigung hielt Veit dem Freunde, während er selbst noch einmal nach links und rechts aufs schärfste die Straße nach der Verschwundenen absuchte, das Blatt hin.
Addo nahm umständlich seine Lesebrille aus der Brusttasche, setzte sie auf, neigte den Kopf seitlich und las. Wahrend der Novemberregen mehr und mehr die hübschen Buchstaben betupfte und verwischte, sprach er, als ob er sie memorieren wolle, die Worte vor sich hin: »Welcher Edeldenkende wäre geneigt, einer jungen, strebsamen Künstlerin aus guter Familie . . .«
Er sah verdutzt auf. »Was denn – das talentvolle Mädchen aus guter Familie . . .?«
Veit runzelte die Stirn. Ein ehrlicher Groll untermalte seine Worte, als er ergänzte: »– hast du mir eben durch die Latten gehen lassen!«
»Wieso ich? Ich hatte doch keine Ahnung –«
»Ach, was! Wenn man wirklich gut Freund ist, so wie wir zwei – wir kennen uns doch seit dem ersten Spielen auf dem Sandhaufen in der Kaiser-Allee . . . da hat eben einer schon eine Ahnung, wenn es sich um die Interessen des anderen handelt!«
»Entschuldige schon«, Addo war wirklich leicht gekränkt. Außerdem hatte er keinen Schirm, und es regnete immer stärker. »Entschuldige schon – aber ich bin auch jetzt noch nicht restlos im Bilde –, was hast du denn für Beziehungen zu dieser jungen Dame mit dem angeblichen Talent und dem schwarzen Haarknoten?«
»Aber du hast's doch gelesen!« sagte Veit, indem er ärgerlich dem Freunde das mittlerweile bis zur Unkenntlichkeit verwischte Blättchen aus der Hand nahm. »Ich – ich bin doch der von ihr Gemeinte, der Gesuchte.«
»Du bist –?«
»Ja, der Edeldenkende, der bin ich. Ich muß sie nur erst haben.«
II
Ilia sah von dem Marmortischchen, auf dem sie mit den geschickten Fingern die Kartenspiele aufbaute, über den kleinen goldenen Buddha hinüber nach Klara.
Noch die Nässe des häßlichen Novemberregens im reichen schwarzen Haar, die schlanken Hände von der Kälte ein wenig gerötet, erhitzt vom raschen Gang, stand das schöne Mädchen vor dem ein wenig blinden Spiegel, den die pausbäckigen vergoldeten Putten in neckischem Spiel mehr zu streicheln als zu halten schienen, und steckte die kleine Brosche mit dem Türkisen am Ausschnitt fest.
»Du hast ein Abenteuer gehabt«, sagte Ilia. Sie konstatierte, sie fragte nicht. »Ein Abenteuer, mehr belustigend als unangenehm.«
»Geht eine nicht gerade verwachsene und blatternarbige Frau vor ihrem siebzigsten Geburtstag jemals durch dies gräßliche Berlin, ohne ein Abenteuer zu erleben? Oder doch ohne die Gelegenheit eines Abenteuers zu haben?« klang es vom Spiegel zurück.
»Das mag selten vorkommen. Es sei denn – eine Würde, eine Höhe entfernte die Vertraulichkeit. Aber das war nur bei dem Schillerschen Mädchen so, von dem er selber zugeben muß: ›Sie war nicht in dem Tal geboren – man wußte nicht, woher sie kam.‹«
Klara lächelte. Diese Ilia, die nicht oft lachte, hatte Humor. Freilich bei ihrer Lebenserfahrung und ihrem ungewöhnlichen Beruf durfte sie von dieser Gottesgabe nur selten etwas merken lassen. Denn ihre das Nichtalltägliche erwartende und honorisierende Kundschaft verlangte den feierlichen Ernst. Verlangte, wo er nicht echt war, die verhüllende Maske. Diesem Verlangen trug die Halbmaske Rechnung, die dort, aus mattem Silberblech hübsch geformt, mit einem geschliffenen Topas mitten auf der Stirn, wie das Auge des Buddha, bei den alten in Schweinsleder gebundenen Folianten und den Spielkarten auf der dunkelroten Plüschdecke lag.
»Mein Abenteuer hätte auch das Mädchen in der Fremde haben können. Ich kam von der Post in der Marburger Straße und wollte in die Augsburger einbiegen –«
Sie stockte und fühlte, wie sie rot wurde. Warum hatte sie ihren Weg genannt? Ilias dunkles Auge ruhte auf ihr, fremd, forschend und doch mit einer peinlichen Sicherheit. So, wie sie ihre Klienten ansah, ehe sie die Karten mischte oder Unverständliches murmelnd den mystischen Kristall mit dem Lederchen rieb. Dies seltsame unbewegliche Auge fragte, was hat das Mädel auf der Post in der Marburger Straße zu tun gehabt?
Rasch, ein wenig überstürzt, fuhr Klara fort und fühlte selbst das Unechte der Munterkeit, die sie ihrer Erzählung zu geben versuchte: »Ich hätte ein wunderschönes Spitzentaschentuch plus machen können bei diesem – na ›Abenteuer‹ ist eigentlich ein zu kühner Ausdruck – sagen wir also: bei dieser Begegnung.«
»Mit einem Herrn –?«
»Ja, natürlich. Damen sprechen einen selten an – sie hätten denn einem etwas Unangenehmes zu sagen. Etwa, daß der Unterrock vorguckt, daß man ein Loch im Strumpf hat oder was ähnlich Schönes. Ein hocheleganter Herr im Gehpelz – Kavalier durchaus – ist plötzlich neben mir und sagt grüßend – sagt höflich mit einer sehr angenehmen Stimme, ein bißchen singend: ›Verzeihung, meine Gnädige, Sie haben gerade dies Tüchlein verloren, darf ich's Ihnen zurückgeben?‹ . . . Ich sehe hin – denke schon, es ist eines, das ich von der Mutter geerbt habe . . .«
»Wie hübsch und schlicht du das ›geerbt‹ aussprichst – und dabei hat dir doch die andere, die üble Person, nichts gelassen als die paar armseligen Leinensachen. Und dein armer, geduckter Papa muß –«
»Laß das, bitte, Ilia«, Klaras Stimme bebte ein wenig. Die Röte wich aus ihrem Gesicht. »Vor allem laß den Vater aus dem Spiel. Wenn dich mein Geschichtchen nicht interessiert, hättest du nicht fragen sollen.«
»Doch, doch, es interessiert mich. Der singende Kavalier hielt dir also ein Tüchlein hin –«
»Ja, mit wunderschönem breiten Spitzenrand – ein Tuch, das sauber, hübsch und kostbar war, bloß leider nicht mir gehörte. Ich sage ihm das; er scheint betroffen, ungläubig. ›Ich ging zufällig hinter Ihnen‹, er sprach die Worte langsam abwägend, als ob er sich den Vorgang gewissenhaft ins Gedächtnis zurückriefe. ›Ich glaubte doch gesehen zu haben, wie etwas fiel – wie ein kleiner weißer Vogel – dann lag jedenfalls das Tüchlein in Ihrer Fußspur. Ich hob es auf und . . . Sie müssen schon entschuldigen, meine Gnädige, ich konnte nur annehmen‹ . . . Und ein wenig komisch verzweifelt balanciert er es auf den Fingerspitzen. ›Was mach' ich jetzt damit?‹ – Das weiß ich nicht, sagte ich. Jedenfalls ich darf's nicht annehmen. Geben Sie's einfach auf dem Fundbüro ab. – ›Oh‹, wehrte er lachend ab, ›Sie sagen einfach – bei Behörden, bei unseren deutschen Behörden ist nichts einfach. Da hat man bei den simpelsten Dingen schreckliche Schwierigkeiten mit Fragen und Recherchen und eidlichen Versicherungen und beglaubigten Unterschriften. Etwas finden – das ist schlimmer, als wenn man's gestohlen hat in Deutschland‹ – Wir lächeln uns unwillkürlich an. Da steckt er das Tüchlein resigniert in die Seitentasche seines Gehpelzes, greift militärisch an die Pelzmütze: ›Gestatten‹ – und stellt sich, korrekt, ein bißchen wie ein Militär alter Schule, mir vor.«
»Bravo! Wie hieß er?«
»Ich habe leider nur den Vornamen verstanden. Viktor – und dann allerdings noch das ›von‹ –«
»Ein Adeliger.« Ilia nickte befriedigt.
»Vielleicht früherer Offizier.«
»Kein Eisernes Kreuz-Bändchen?«
»Im Gehpelz –?«
»Hast du ihm auch deinen Namen gesagt?«
»Nein. Ich habe gesagt, ich bin nur auf der Durchreise in Berlin. Ich bin, glaub' ich, rot geworden bei der Lüge und da –« Klara zögerte, als ob sie ärgerlich über sich selbst sei, daß sie die Erzählung überhaupt begonnen habe.
»Und da –?« fragte Ilia liebenswürdig.
»Da – sagte er etwas Seltsames. Er sei abergläubisch, lächelte er. Er sei gewissermaßen auch bloß auf der Durchreise, sei des Trubels von Berlin bereits recht müde. Und gerade als er das Tüchlein fallen oder liegen sah, habe er bei sich überlegt: fort von hier – aber wohin? Und er habe beschlossen, sich – wie er das gern und oft mit Glück mache – vom Zufall die Richtung seiner nächsten Fahrt in die Welt geben zu lassen.«
»Hm. Der Mann muß Geld und Zeit haben.«
»So sieht er allerdings aus.«
»Ein Globetrotter?«
»Vielleicht – mir kam vor, ein leiser Anklang ans Wienerische.«
»Und dann – dann hat er dir wohl vorgeschlagen, ihm zu erzählen, wo du als Durchreisende nach absolviertem Berlin dich hinzubegeben gedenkst?«
»Also, Ilia« – Klara sah sich betroffen um, »manchmal könnt' man glauben, du bist wirklich hellseherisch.«
»Du weißt, Kind, daß es Stunden gibt –« ein seltsamer Ernst lag über den Zügen der in ihrem Alter unbestimmbaren Frau, als sie dieses ruhig und langsam hinsprach – »daß es Stunden gibt, in denen ich selbst sogar fest davon überzeugt bin. Wie übrigens – beiläufig bemerkt – bei allen Medien, selbst bei denen, die später mehr oder minder überzeugend entlarvt werden, eine sie über das Dutzend ihrer nüchternen Gegner erhebende mediumistische Begabung vorhanden ist. Eine Gabe, der sie, nur von eigener Geldgier getrieben oder vom sogenannten ›Impresario‹ ausgenützt und vom blinden Vertrauen der Gläubigen gefördert, Gewalt antun. Gewalt bis zur Täuschung – bis zur Kollision mit dem Betrugsparagraphen und dem Triumph der Wissenschaftler. In deinem Fall aber, liebes Kind, gehört keine Sehergabe, nur ein bißchen gesunder Menschenverstand dazu, über den ich – nach meiner viel besser begründeten Überzeugung – zu allen Stunden verfüge. Du bist hübsch, der Kavalier im Pelz – übrigens für einen Gehpelz eigentlich noch ein bißchen früh – aber die alte Geschichte: für die Besitzer schöner Pelze fängt der Winter halt früh an. Wie für die Mädchen mit hübschen Armen der Sommer zeitig einsetzt . . . Ich wollte sagen: er hat dich vermutlich auf der Post schon beobachtet.«
»Das glaube ich eigentlich nicht – ich hätte ihn doch gesehen.«
»Ach – wenn sie gerade wichtig beschäftigt ist, passiert's sogar einer hübschen Frau mal, daß sie eine schmeichelhafte Huldigung übersieht.«
Klara spürte den Angelhaken einer Frage in dieser scheinbar beiläufig hingeworfenen Weisheit. Sie wollte los von dem Thema und sagte: »Es ist windig geworden. Vielleicht klärt sich's doch noch auf.«
Ilia ließ sich nicht beirren. »Er hat den richtigen Instinkt des Weltmanns und Frauenfreundes gehabt, daß du lose in der Welt hängst. Er hat das Abenteuer, das er mit dem zufällig gefundenen Taschentuch anknüpfte, auf seine Weise weiterzuspinnen gedacht. Wirst du ihn wiedersehen?«
»Aber nein, was denkst du!«
»Was ich denke, will ich dir sagen, Klara.« Sie zündete sich eine Zigarette an und hielt ihr anbietend das silberne Zigarettendöschen hin.
Klara dankte.
»Ach so, du rauchst ungern. Selten bei Frauen mit hübschen Händen. – Also was ich denke? Ich denke eigentlich nichts, sondern ich weiß –«
»Als Hellseherin?«
»Nein, als vernünftige Frau, die das Leben kennt und die Welt und die Menschen und die jungen Mädchen und – na ja, unser Blut. Denn vergiß nicht, unsere Mütter, so verschieden sie im Alter waren, sind Schwestern, unsere Väter sind Vettern gewesen. Das ist viel, da kennt eines oft – ohne viel Worte – die Gedanken des anderen, weil er den Rhythmus des Pulses mit ihm teilt – oder im selben Alter einmal geteilt hat. Du bist unglücklich. Ich wär's an deiner Stelle und in deinen Jahren auch. Du zeigst es mir nicht oder wenig, weil du, wie die Endlers alle, stolz bist – und immer stolzer wirst, je mehr du dir das Wasser der Not – die du dir vielleicht nur einbildest, aber das ist im Effekt dasselbe – je mehr du dir das Wasser der Not an die Kehle steigen fühlst. Du weißt dich hier bei mir, die ich deine wesentlich ältere Base bin, gut geborgen. Du magst mich vielleicht sogar –«
»Ilia, ich bin dir so dankbar!«
»Dankbarkeit in dem Ton ist schon eine Einschränkung der Liebe. Ist ein Anstand des Herzens, dem der Affekt fehlt. Das ist gleichgültig. Denn ich weiß: hätte ich einen Modesalon und redete den Damen vom Kurfürstendamm verrückte Hüte auf, die sie noch scheußlicher machen, oder hätte ich eine Wiener Feinbäckerei und mogelte ein bißchen beim Wiegen der Mohntörtchen und des Teegebäcks, so würdest du dich – trotz kleiner menschlicher Bedenken – mit mir und meiner Art schließlich abfinden. Der Pulsschlag ist mehr – und dann, du fühlst, daß ich's gut mit dir meine – daß ich vielleicht augenblicklich eine von den wenigen bin, die dir so etwas wie einen Halt geben können, denn –«
»Ich weiß das alles, Ilia, und du mußt nicht glauben –«
Ilia ließ sich nicht unterbrechen. Sie stieß, als ob sie damit Wichtiges vollbringe, den polierten spitzen Nagel ihres Zeigefingers in das kreisrunde Wölkchen, das sie geblasen hatte und fuhr fort: »– denn man darf das nicht mißverstehen mit dem Gutmeinen. Gewiß, der Kavalier mit dem Spitzentüchlein wäre bereit, dich heute abend schon in Länder mitzunehmen, wo er in der südlichen Sonne seinen schönen Gehpelz und vielleicht noch manches andere abzulegen geneigt wäre. Aber eines Morgens bei den Ruinen von Syrakus oder vor den Pyramiden von Giseh sähe er eine andere – diesmal vielleicht eine blonde junge Dame, der er das Taschentüchlein aufhöbe – und drei Tage später säßest du – mit oder ohne Geld – verheult und verzweifelt allein im Hotel . . . Zu mir kannst du jederzeit kommen – und es hat mich gefreut und – ich bin offen – hat mir ein wenig geschmeichelt, daß du vor Wochen, als der Krach kam, der kommen mußte, und die tüchtige Melusine, die große Komödiantin, die dich glücklich so weit hatte –«
»Du ahnst ja gar nicht, wie das alles war, Ilia –« es war, als ob Klara in dem warmen Zimmer fröstelte. Sie zog den niedrigen Stuhl ganz dicht an die in ein unechtes Kamin eingebaute Zentralheizung und stierte auf das dunkelrote Muster des stark abgenutzten Kassak.
»Es ist vielleicht ein bißchen unfreundlich –« ein kleines Lächeln umspielte die ein wenig angetuschten Lippen Ilias und ließ viel Gold in gut gereihten Vorderzähnen sehen – »ist vielleicht ein bißchen unfreundlich, gerade einer der in den besten Kreisen bekanntesten Hellseherin von Berlin zu sagen, daß sie von etwas keine Ahnung habe – – – Aber ich verzeihe dir's, denn ich habe natürlich wirklich keine Ahnung. Etwas steckt noch hinter deinen Erzählungen von deiner Flucht aus deines Vaters Haus – die ich dir sonst aufs Wort glaube. Man lügt schließlich nicht, wenn man nicht alles erzählt. Aber vieles kann ich mir genauer und deutlicher denken, da ich deinen Vater kenne. Immer war er ein guter Kerl. Nur hat ihm meistens der Mut zur eigenen Courage gefehlt. Kommt noch hinzu, daß er vielleicht . . .«
»Was meinst du, Ilia?« Klara sah fragend zu der plötzlich Stockenden auf. »Du hast neulich schon mal ganz plötzlich so deine Rede unterbrochen wie jetzt, als du von meinem Vater sprachst . . . Nein, ich möchte das hören, was du da zu wissen glaubst oder was du dir ausdenkst!«
Ilia löschte umständlich das Stümpfchen ihrer Zigarette im Aschbecher. Ganz ruhig und langsam, als ob sie es jemand diktiere, sagte sie: »Ich habe die Überzeugung – daß deine zweite Mutter – verzeihe den unpassenden Ausdruck – also, daß deines Vaters zweite Frau, die üble und talentarme Komödiantin, auf die der Ärmste, weiß der Himmel wieso, so lange nach dem Tode deiner prächtigen Mutter hereingefallen ist, irgend etwas von ihm weiß. Ein Verbrechen natürlich, das begeht er nicht, dein guter alter Herr. Aber irgendetwas hat sie als erlebtes oder erlauschtes oder erpreßtes Geheimnis mit ihm gemeinsam. Irgendeine peinliche Sache, deren Bekanntwerden ihm schädlich oder vielleicht nur in seiner Einbildung gefährlich wäre. An eine geschlechtliche Hörigkeit deines Vaters der fetten, unschönen Person gegenüber glaube ich nicht. Dazu ist er zu unsinnlich, zu gradlinig, zu bedürfnislos in seinem Gefühlsleben. Ich weiß nicht, sei mir nicht bös, aber deinen Vater und den ›Eros‹ zusammen zu nennen, scheint mir schon ein bißchen ein Unding. Das Mächtige dieser Person liegt nicht auf erotischem Gebiet. Wenn ich sie einmal sehen oder sprechen könnte –«
»Wie soll das geschehen? Sie hat ja keine Ahnung, daß du . . . wo du . . . Und deshalb bin ich ja gerade hier auch so sicher bei dir. Einmal hat sie deinen Namen im Telephonbuch gesucht –«
»Da stehe ich seit Jahren nicht mehr drin. Ich habe eine Geheimnummer.«
»Ich weiß doch. Aber damals vor zwei Jahren, denk' ich, kurz, nachdem sie Papa geheiratet, hatte sie durchgesetzt, daß Papa ein Telephon anschaffte. Es gehört dazu, hat sie gemeint.«
»Vermutlich hat sie geglaubt, die Agenten werden den ganzen Tag immer nur an der Strippe hängen, werden Schlange stehen vor der Telephonzelle im ›Adlon‹ und ›Bristol‹, um der Frau Melusine Möller, ja nunmehr: Kern-Möller, Anträge zu machen für Gastspiele am Wiener Burgtheater und am Deutschen Theater in Milwaukee . . . Großer Gott, es könnte deinem Vater, glaube ich, nichts Lieberes geschehen. Den kleinen rachitischen Jungen, den sie ihm gleich fertig mitgebracht hat in die Ehe, würde sie ihm natürlich auf dem Hals lassen.«
»Sag' nichts gegen das Hugochen –« Klara sprach den Namen des Kindes mit zitternder Zärtlichkeit aus, und in ihren Augen glänzte ein feuchter Schimmer, den sie, den Kopf drehend, zu verbergen suchte.
»Ich begreife dich nicht, Klara. Was kann unter dem Herzen dieser Frau, die ich für eine hundeschnäuzige kalte Egoistin halte –«
»Das mag sie sein.«
»Nun also – was kann sich unter solchem Herzen entwickelt haben?!«
»Vielleicht«, zögernd kam das heraus, »vielleicht war Hugos Vater –«
»– ein ungarischer Graf, ein römischer Kardinal – ein indischer Rajah – ein Wohltäter der Menschheit – so viel ich gehört habe, hütet sie sich wohlweislich, von diesem Vater zu sprechen.«
»Ich glaube ja allerdings, Papa weiß es selbst nicht, wer der Vater von Hugo gewesen ist.«
»Der Mack, der Börsianer, mit dem sie zuletzt liiert war, ist es jedenfalls nicht. Der ist schwarz und feist und haarig wie ein Affe. Und das Hugochen soll blond und zart sein.«
»Ganz blond und ganz zart. Wie ein kleiner Engel, sag' ich dir. Manchmal, wenn ich abends ihm sein Nachtmahl gebe – wenn Melusine im Grabbe-Theater spielt – und dann mit ihm bete – du glaubst nicht, was es für ein kluges Kind ist. Und was er mich da alles gefragt hat über den Himmel und die Sterne und den lieben Gott, und er hatte dabei einen ganz überirdischen Glanz in den Augen. Aber sobald sie kommt – die Mutter – wird er still und verstockt. Ich kann mir denken, daß es Leute gibt, die ihn dann boshaft und heimtückisch nennen. Aber sie hat auch zu närrische Erziehungsmethoden, die seltsame Frau. Wenn sie gerade nichts zu spielen hat, keine Proben und keine Rollen zu lernen, o Gott, eine schreckliche Zeit für die zu Hause – es ist dann nicht auszuhalten mit ihren hysterischen Anfällen. Dann liest sie Erziehungsbücher, alte und hypermoderne durcheinander. Pestalozzi und Ellen Key, Rousseau und Psychoanalytiker. Und dann schwört sie bald auf Prügel, bald auf Rohkost. Bald phantasiert sie von dem Segen der individuellen Privaterziehung, bald schwärmt sie für die Waldschule und macht rote Ausrufezeichen an den Rand der Prospekte. Heute spricht sie kaum mit dem Kind und sucht es, wie sie sagt, ›bloß durch Blicke zu lenken‹. Morgen fragte sie dem Bürschlein, das von nichts weiß, die Seele aus dem Leib nach seinen Träumen und seinen Heimlichkeiten und ›Erinnerungen an schlechte Dinge‹ . . . Davon ist es scheu geworden, das arme Kerlchen. Und dann hat sie – die Mutter – mit einem schrecklich unechten Ton in der Stimme, immer wieder die Hand erhebend, wie um auszudrücken, daß sie mit dem Himmel hadere, ausgerufen: ›Der Junge kann nicht lieben – der Junge hat ein totes Herz in der Brust!‹ – Ach, und Ilia glaube mir, diese Klagen, die sie mit einem Wolter-Schrei einleitet, sind nicht wahr. Das Bübchen hat in seinem schwachen, kranken Körperchen – dem bald bloß mit Milch, bald bloß mit Obst und dann wieder mit Fleisch, Fleisch und wieder Fleisch geholfen werden soll, – hat das Bübchen – wie ein kleines Tier, denk' ich oft – eine Sehnsucht nach Liebe. Nach einem Sichanschmiegen an einen warmen Körper, der ihm Schutz bietet, an ein Herz, das es schlagen hört.«
»Du vermißt den Kleinen wohl sehr?«
»Ja, weil ich weiß, daß er mich vermißt. Daß er mich braucht, nicht mich gerade persönlich, mißverstehe mich nicht – aber irgend jemanden wie mich. Papa ist ja auch gut zu ihm; aber sobald sie das sieht, die Melusine, faucht sie den armen Mann an: ›Das könnte dir so passen, du Heimlicher, mir die Zuneigung und das Vertrauen meines ahnungslosen Kindes zu stehlen!‹ Oder: ›Das sieht dir ähnlich, dich so einzuweinberln‹– sie liebt solche wienerischen Ausdrücke, obschon sie, glaub' ich, aus Preußisch-Stargardt stammt.«
»Bühne, Kind, Bühne!«
»Ja, ja, einzuweinberln, sagt sie, ›bei dem Kind mit deinen armseligen Groschenpräsenten aus den verdreckten Automaten!‹ . . . Du lieber Gott, sie führt doch selbst die Kasse . . . Sie läßt für Vater kaum das Geld für die Elektrische, wenn es regnet, um zum Theater in den Dienst zu fahren.«
»Er –« Ilia sah forschend hinüber – »er steht doch noch gut mit seinem Direktor, dem pfiffigen, kleinen Böck?«
Klara, die all das von dem Kind frei und offen und mit einer heißen Hast erzählt hatte, schwieg jetzt einen Augenblick, dann sagte sie langsam: »Ich glaube nicht mehr ganz so gut wie früher.«
»Denkst du, daß da auch Melusine die Schuld trägt?«
»Ich weiß nicht«, kam es zögernd heraus, »aber das glaub' ich eigentlich nicht.«
In diesem Augenblick hatte Ilia, die scharf zu ihr hinsah, das Gefühl: hier sitzt der Schlüssel zu einem großen Leid.
Aber Klara sprach, ohne sie anzusehen, als ob sie sich selbst Rechenschaft gäbe, vor sich hin: »Ich habe den Eindruck, der Direktor Böck mag sie nicht, die Melusine. Schätzt sie weder als Mensch noch als Darstellerin. Aber – du erwähntest vorhin den Mack, den Sensal, den Börsianer. Der machte öfter Geschäfte für den Direktor Böck, hat ihn in schwieriger Lage – als im Vorjahr die drei ersten Premieren völlig versagten und sein Star, die Therese Kaden, ganz plötzlich heiratete – den Bankier . . . wie heißt er doch gleich?«
»Mücke«, half Jim aus. »Ich bin im Bilde, sie, die Therese Mücke, ist meine beste Freundin, wenn's auch ihr Mann nicht gern sieht, daß sie mich besucht.«
»Damals hat der Mack dem Böck, der schon immer drohte: ›I wer' zusperr'n‹ – er wienert auch, wenn er gereizt wird – hat ihm wohl Geld besorgt – vielleicht auch selbst etwas hineingesteckt, das er bestimmt noch nicht wiederhat, wenn er's überhaupt je –«
»Und du glaubst, daß Mack und – deines Vaters Frau heute noch . . .?«
»Nein, nein!« Klara wehrte rasch ab. Es war klar, daß sie schützend nicht vor die Frau, die ihr nur Böses getan, aber vor den Vater trat, indem sie leidenschaftlich sagte: »So schlecht ist sie nun nicht, daß sie hinter Vaters Rücken noch mit – oder vielleicht war sie ihn überhaupt müde, den Mack. Der soll ja jetzt – – – aber das ist gleichgültig. Jedenfalls macht er seinen Einfluß– vielleicht noch aus Dankbarkeit – für sie geltend. Daß sie zum Beispiel in der französischen Komödie im letzten Herbst – wie hieß sie doch – die Rolle der Kupplerin spielen durfte –«
»War ein Erfolg für sie, wie ich las. Die Rolle lag ihr.«
Klara überhörte das und vollendete ihren Satz. »Das war – bei Tisch sagte es der arme Papa mal so beiläufig ohne böse Absichten, und schon fauchte sie ihn wie eine Katze an – das war damals bloß der Fürsprache zu danken. Das wußte das ganze Theater.«
In diesem Augenblick kam, ohne anzuklopfen, lautlos die Tür öffnend und auf dicksohligen Filzpantoffeln mehr herangleitend als gehend, Berta Babusch ins Zimmer. Auf einem silbernen Teller reichte sie Ilia eine Depesche hin: »Eben gekommen!«
Die korrekte Art dieser kleinen Zeremonie stand in einem wunderlichen Gegensatz zu der ungewöhnlichen Erscheinung der Bedienerin. Indem Klara zu ihr hinsah, hatte das schöne Mädchen wieder, wie immer, wenn Berta plötzlich geräuschlos auftauchte, das Gefühl des Bedrückenden. Die groteske Häßlichkeit dieser vielleicht Dreißigjährigen wurde noch verstärkt durch ihre Vorliebe, sich zwar billig, aber auffällig zu kleiden. Auch jetzt trug Berta Babusch wieder eine grellrote seidene Bluse zu einem grünlichen Rock. Das Rot der Bluse betont den hohen Rücken, über dem ein viel zu kurzer Hals saß; und der grüne Rock war so knapp, daß er mehr, als es modern oder nötig war, die krumme Linie der viel zu dicken, in prallen Seidenstrümpfen steckenden Beine betonte. Klein von Figur, wulstig in den Hüften, ohne Busen, mit einem knochigen Kopf, der chronische Gelbsucht zu verraten schien und aus dem ein paar geschlitzte schwarze Chinesenaugen die Nasenspitze beschielten, hätte sie vielleicht zu anderer Zeit mit kleinen Nachhilfen bei Barnum als Abnormität sich sehen lassen können. Jedesmal, wenn Klara durch eine plötzliche Begegnung mit diesem meist grinsenden, die schlechten Vorderzähne zeigenden weiblichen Gnom erschreckt wurde, kam ihr, die in der Theateratmosphäre groß geworden war und selbst glühend gern zum Theater gegangen wäre, der zwingende Gedanke, dieser im Geschmack und Gehaben die Mißgestalt seiner Figur betonende garstige Gnom könne nur eine Tochter des Kaliban in Shakespeares »Sturm« sein.
Vor drei Monaten, als Klara im plötzlichen Entschluß fluchtartig die Wohnung des Vaters in der Uhlandstraße verlassen hatte und nach einem gräßlichen dreitägigen Aufenthalt in einer Pension des Südwestens, die sich als glattes Absteigequartier erwies, sich zu der ihr nur aus Kindheitserinnerungen bekannten Kusine in der Ansbacher Straße geflüchtet hatte, war es die groteske Erscheinung dieses dienstbaren Geistes, die sie – in Verbindung mit dem leisen Abscheu vor dem wunderlichen Beruf Ilias – beinahe wieder hätte heimlich ins Ungewisse entweichen lassen, Und je mehr sie in den ersten Tagen des Zusammenlebens mit der sie freundlich und taktvoll aufnehmenden Ilia ihre Vorurteile gegen die von reichen und vornehmen Kunden viel besuchte Kartenlegerin und Zukunftsdeuterin zurücksteckte, um so seltsamer, ja rätselhafter schien's ihr, wie eine im Grunde sein empfindende, hochgebildete und ästhetisch begabte Frau wie Ilia sich so eine unglaubliche Vogelscheuche von schier übernatürlicher Häßlichkeit zur täglichen Bedienung hatte auswählen können. Und diese Berta Babusch war nun schon sechs oder sieben Jahre – neben einer auch durchaus anmutlosen taubstummen Aufwartefrau, die am frühen Morgen kam und, unartikulierte Töne ausstoßend, das Gröbste des Haushalts besorgte – die hier allein schaltende und waltende Hilfe. Dabei mußte man's ihr lassen, daß diese menschliche Mißbildung mit dem hölzernen Gang nicht unflink war. Und noch eins: peinlich sauber war sie, sowohl an ihrem Körper als bei jeglicher häuslicher Verrichtung. Sobald die Arbeit in Küche, Diele und Zimmer getan war, wechselte sie, als gelte es, sich gesellschaftsfähig zu machen, umständlich die Wäsche, nahm Fußbäder mit Kiefernadelzusatz und wusch sich den stumpf-schwarzen Bubikopf, dessen Negerhaare sich sofort in unwahrscheinlicher Scheußlichkeit kräuselten. Dann manikürte sie sich, über einen Schmöker aus der Leihbibliothek gebeugt, stundenlang die breiten aber blitzsauberen Nägel.
Erst eine Aussprache mit Ilia, die diese selbst nach lächelnder Beobachtung des geheimen Abscheus Klaras vor dieser Kaliban-Tochter herbeiführte, klärte Klara ein wenig über die seltsame Vorliebe Ilias für diese Haushaltsstütze auf.
Ilia hatte damals, als sie vom Theater in Hamburg abgehen mußte, zunächst allzu sorglos das für den schmerzhaften Fall über ein Versatzstück auf verdunkelter Bühne im Rechtsstreit erstrittene Schmerzensgeld aufgezehrt. Dann, als sie den letzten Hundertmarkschein wechselte, hatte sie nicht recht gewußt, wie sie, alleinstehend in der Welt und bis jetzt nur für die Bühne vorgebildet, ihr Leben fristen sollte. Der steifgebliebene linke Fuß hinderte sie wohl nicht auffällig am Gehen, aber er machte sie doch auf der Bühne unmöglich. Ein Talent, zu verzagen und sich unterkriegen zu lassen, hatte Ilia nicht. In Hamburg, wo sie künstlerisch gewirkt und von einem Aufstieg des Ruhms und der Gage geträumt, wollte sie keinen neuen Brotberuf ergreifen. So verkaufte sie ein paar Schmuckstücke. Ein indischer Verehrer, ein Fürst, der über eine Million Seelen in braunen nackten Körpern hinter dem Ganges herrschte, hatte auf der Fahrt nach London zum »Kaiser von Indien«, in Hamburg Rast machend, nicht üble Lust gezeigt, die damals wirklich hübsche Schauspielerin zu seiner Lieblingsfrau zu erheben. Als er mit seinem in schlechtem Englisch gestammelten ehrenvollen Antrag kein Glück hatte, war er großzügig genug, der Angebeteten zur Erinnerung an ein paar kleine Soupers im »Atlantic« und einen Ausflug nach Helgoland ein paar herrliche Steine – protzig gefaßt – zu hinterlassen, eh' er sich nach England einschiffte. In Berlin hatte Ilia zunächst in einer kleinen Familienpension in der Kurfürstenstraße gewohnt, in der im wesentlichen Damen abgestiegen waren. Damen, die gerade geschieden waren oder diese Auseinandersetzung vor Gericht noch vorhatten, untermischt mit jungen Fräuleins, die sich malten, Zigaretten rauchten, Konfekt naschten und sich von den Heldinnen der gesprengten Ehefesseln freihalten ließen. Die etwas schwüle Atmosphäre dieser von zärtlichen Blicken und scheuen Händedrücken gewürzten, sonst aber für teures Geld nicht allzu üppigen Mahlzeiten schien Ilia, die noch die mit englischen Vokabeln verbrämten indischen Schwüre des Rajah im Ohr hatte, nicht das für sie Geeignete. Auch die Berufe, denen einige der in dieser Pension wohnenden Damen nachgingen, entsprachen nicht ihren Neigungen und Anlagen. Die eine war oder nannte sich »Meisterin der Schönheitspflege, diplomierte Schülerin von Madame d'Outre-le-pont in Paris« und suchte die Opfer ihrer Behandlungsmethode in den großen Hotels. Eine zweite hatte eine Vertretung holländischer Liköre, die sie hauptsächlich an ältere Damen absetzte. Eine dritte, die angeblich von den Kanarischen Inseln kam und selber aussah wie ein Kanarienvogel in der Mauser, gab spanischen Unterricht. Aber in der Pension war man der Ansicht, daß sie eigentlich mit Rauschgift handle. Ilia hatte die Erzählungen aller dieser Berufstätigen mitangehört, einiges davon auch geglaubt. Sie war aber in keiner Weise begeistert worden, irgendeiner dieser geschminkten und verlebten Puppen Konkurrenz zu machen. Sie las eifrig den Annoncenteil der großen Berliner Blätter, besonders die Sonntagsnummern, die sie sich auf ihrem Morgenspaziergang zum Zoo kaufte. So hatte sie sich bald eine Übersicht verschafft über das, was die mit der Not der Zeit kämpfenden Frauen, auch besserer Kreise, an Wissen, Talent und gutem Willen hier anzubieten hatten. Mit Stenographie und Schreibmaschineschreiben konnte sie nicht aufwarten. An der Vorführung klassischer Tänze in Familien und Privatzirkeln hinderte sie ihr steifer Fuß. Deutschen Sprachunterricht an russische Emigranten vermochte sie nicht zu erteilen, da sie zwar gut Deutsch aber kein Russisch sprach. Zur Säuglingsschwester oder »Hortnerin« mangelte ihr die Vorbildung, zur Erteilung von Bridgeunterricht an Damen und Herren die nötige Geduld, und zur Ausübung »strenger Massage« fehlte der sadistische Einschlag in ihrem Liebesleben. In einigen Blättern aber war ihrer Aufmerksamkeit eine besondere Rubrik nicht entgangen, die zu denken gab. Da priesen Damen – manchmal war betont: »Damen der Gesellschaft« – teils unter Chiffre, teils von wohlklingenden Namen gedeckt, die ihnen sicherlich nicht bereits in der Taufe verliehen waren – ihre Kunstfertigkeit an, aus der Hand und aus den Karten zu lesen. Andere wieder waren bereit, Interessenten das Horoskop zu stellen und auf Grund eines mystischen Systems, gestützt auf ausgezeichnete Zeugnisse, die von Interessenten eingesehen werden könnten, Ratschläge in schwierigen Lebensfragen zu erteilen . . . Da kam es nun Ilia zum Bewußtsein, daß sie sich – eigentlich schon seit der Zeit ihrer Einsegnung, als sie, allem Außerirdischen zugekehrt, durch ein tragisches Schicksal Vater und Mutter kurz nacheinander verloren hatte – immer für mystische Dinge stark interessiert hatte. Von einer Kollegin an der Bühne, die aus einer durch ihr perlendes Lachen berühmten Naiven rasch eine derb-brummige komische Alte geworden war, hatte sie allerlei Arten von Patiencen und Kartenlegen erlernt. War auch eifrig zu Wahrsagerinnen gegangen, meist schmuddeligen alten Weibern, die in unsauberen Zimmern, nach Kohl, Käse und billigem Parfüm riechend, ihre geheimnisvolle Kunst übten. Dort hatte sie das Übliche erfahren: daß eine falsche Freundin ihr heimlich nicht wohlwolle; daß ein entflammter blonder Kavalier sich ihr nähern werde; daß ein Brief mit äußerst wichtigen Nachrichten demnächst zu erwarten sei, und was dergleichen aufregende Neuigkeiten mehr waren. Eine bemerkenswerte Erscheinung aber hatte sie doch bei diesen Besuchen kennengelernt. Eine Seherin, die nicht annoncierte, kein Geld für ihre Dienste forderte – man legte ihr nur außer einem Hühnerei, das verlangt wurde, einfach eine beliebige Summe auf den Tisch unter die immer sauberen Karten. Diese so ein bißchen auf eine Marquise des Rokoko zurechtgemachte, in ihrer Haltung untadelige alte Dame, die immer von ein paar wunderschönen weißen Katzen umschnurrt und umspielt war, stellte keinerlei Fragen. Statuenhaft aufgebaut, las sie aus Augen und Händen manches Vergangene und viel Zukünftiges. Sie hatte Ilia beim ersten Besuch gesagt, daß sie Waise und Künstlerin sei und daß sie im Beruf einen Unfall haben werde, der ihr Leben neu gestalte. Auch sah sie angeblich in der Pupille ihrer Besucherin einen Turban, den sie sich selbst nicht zu erklären wußte. Über den Turban hatte Ilia damals auf der Treppe noch gelacht. Zwei Monate später aber, als der Rajah sie mit heißen Augen beschwor, ihm als Lieblingsfrau nach dem Ganges zu folgen, zeigte er, der in Hamburg durchaus als Europäer gekleidet war, ein Bild von sich, das ihn in der Tracht seines Landes darstellte; und hier trug er auf dem fürstlichen Haupt einen mit steinbesetzter Agraffe geschmückten Turban. Genau, wie ihn die alte Dame in Ilias Pupille gesehen und, scheinbar unwillig, einem Zwange folgend, beschrieben hatte. Ohne durch dieses höchst seltsame Erlebnis überzeugt zu sein, war Ilia doch stark beeindruckt; und wenn sie alles das, was die offenbar kluge und gebildete Seherin aus den Linien der Hände und aus den Pupillen der Augen an Dagewesenem und Zukünftigem gelesen haben wollte, für gescheite Kombinationen hielt, hier waltete ein fast unglaublicher Zufall oder . . . Das »Oder« konnte und wollte Ilia nicht formulieren. Auch nicht, als sie schon selbst hin und wieder, halb im Scherz, halb im Ernst, Proben ihrer Handlesekunst und prophetischen Gaben ablegte. Aber diese merkwürdige Mystikerin in der Hamburger Altstadt fiel ihr wieder – beispielsmäßig, vorbildlich – ein, als sie in Berlin zunächst schüchtern in sonst wenig von ihr geschätzten Skandalblättchen annoncierte, den ersten Kunden die Karten legte und aus den Linien gepflegter und verwilderter Hände allerlei Schlüsse auf künftige Gefahren, Glücksfälle und Erfolge zog. Damals hatte sie ihrer Freundin Therese, die mit ihr in Hamburg engagiert gewesen war und die später in Berlin am »Grabbe-Theater« spielte, was gut und teuer war, vorausgesagt, daß der Bankier, den sie in die Freundin verliebt wußte, sie trotz unklarer Verhältnisse in den Zeiten der Theaterschule und des Aufstiegs bestimmt heiraten werde, wenn sie sich ihm bis dahin versage. Diese Prophezeiung war nun weniger einem wirklichen Einblick in zukünftige Dinge entsprungen als vielmehr der Kenntnis der hier in Betracht kommenden Menschen und ihrer Charaktere. Durch ihre Prophezeiung, die sie mit einem geschliffenen Kristall in Verbindung brachte, hatte sie auf der einen Seite der zur Mystik geneigten Therese den Willen bis zur sieghaften Sündhaftigkeit gestärkt, auf der anderen Seite mit dem Naturell eines nach arbeitsreicher, frauenarmer Jugend blindverliebten Mannes, der in seiner Position nach niemandem zu fragen hatte, richtig gerechnet. Als nun das Vorhergesagte wirklich eintraf, hatte die dankbare Therese, die nun, dem Theater den Rücken kehrend, viel Geld zur Verfügung hatte, Kinder nicht wünschte und eine gutmütige Person war, der Wegweiserin ihres Glückes eine schöne Wohnungseinrichtung für vier Zimmer geschenkt. Ilia zog nun in die Ansbacher Straße und hatte bald aus den Kreisen, in denen Therese und ihr Mann verkehrten, viel Anlauf. Sie kaufte durch Vermittlung des Althändlers Friedländer aus dem Nachlaß eines verstorbenen Sammlers eine kleine Kollektion von Buddhas, Kwanons und angemalten Götzen aus Mexiko und Afrika, die gut zu dem mystischen Beruf einer Seherin paßten und stimmungsvoll ihren Nimbus erhöhten. Gerade als diese wunderliche Sammlung von ihr in Empfang genommen und über die sonst durchaus schönen und gediegenen Räume verteilt wurde, meldete sich, von einer Vermieterin geschickt, die Berta Babusch bei ihr als Stütze oder Mädchen für alles.
Ilia fand, daß diese unerhört garstige und doch wieder durch einen gewissen Reiz der Häßlichkeit aparte Person famos zu den Götterfratzen aus der Inkazeit und zu den rohgeschnitzten Fetischen der afrikanischen Kaffern paßte. Und ihr, die sich anschickte, vom Aberglauben der anderen zu leben und ihn ein wenig auf sich selbst abfärben zu lassen, schien es wie ein Schicksalswink. Auch der Gedanke, daß eine so außergewöhnliche Karikatur auf menschliche Gottähnlichkeit bei Öffnen der Türe die schon mit klopfendem Herzen nahenden Kunden noch konfuser, noch empfänglicher für außergewöhnliche Mitteilungen mystischer Herkunft mache, sprach bei Ilias Erwägung mit. Sie engagierte nach kurzer Unterredung Berta Babusch, die, nachdem sie einen krebskranken Onkel und Vormund in einer Kellerwohnung des Nordens brav zu Tode gepflegt, seit Wochen im Berliner Westen umherlief und vergeblich ihre offenbar wenig geschätzten Dienste anbot. Sie hatte bis heute diese Wahl, von der ein Dutzend Hausfrauen des Westens im Anblick der Berta zurückgeschreckt waren, nicht zu bereuen gehabt. Berta Babusch fügte sich, ohne Verwunderung zu zeigen oder Fragen zu stellen, schlicht und als müsse das alles so sein, dem wunderlichen Betrieb in dieser Vierzimmerwohnung ein. Sie blieb unerschüttert von dem Schreck neuer Ankömmlinge, denen sie die Tür öffnete, und empfing alle Kunden mit einem rätselvoll diskreten Lächeln. Sie ordnete die Kartenspiele und Bücher, staubte die Götzen und Fratzen ab und putzte behutsam die silberne Maske, ohne durch Wort oder Miene zu verraten, was sie sich bei dieser Arbeit denke. Ohne die Unterwürfigkeit zu übertreiben, widersprach sie nie; fügte sich in alle Anordnungen Ilias und antwortete nur, wenn sie gefragt wurde. Dann aber zeigte sich's oft, daß sie über Menschen und Dinge, die hier eine Rolle spielten, besser orientiert war, als man vermuten konnte. Von den kleinen Douceurs, die sie manchmal von wohlberatenen, beglückt heimkehrenden Kunden an der Korridortür erhielt, kaufte sie sich Seidenhemden, durchbrochene Strümpfe, wohlriechende Mundwasser und Nagelcreme, als ob sie sich jeden Abend für die Liebesnacht mit einem Sultan herzurichten hätte.
Auch jetzt wieder, als sie das Telegramm überbrachte, stand die Berta blitzsauber und geschmückt, nach Orchideen duftend, in all ihrer Häßlichkeit im Zimmer und wartete, ohne Neugier zu verraten, den stumpfen Blick der schiefgestellten Augen auf den kleinen Onyx im Nabel eines Buddha gerichtet, auf Ilias Befehle.
»Es ist gut, Berta«, nickte Ilia nur.
Da verschwand Berta Babusch mit ihrem silbernen Serviertellerchen lautlos wie eine Elfe.
»Von der Durchlaucht«, Ilia reichte Klara mit einem leichten Lächeln des Triumphs die Depesche hin.
Klara las: »Im Auftrag Seiner Durchlaucht des Herzogs Johann bitte ich um möglichst baldigen Besuch – zwei Tage wenn möglich – am Krankenlager Seiner Durchlaucht. Im Auftrag von Finkenkroog.«
»Wer ist Finkenkroog?«
»Der Hofmarschall –«, und da sie Klaras fragenden Blick sah, fuhr Ilia fort: »Mein vornehmster Klient, der Herzog, den die Revolution aus seinem Ländchen vertrieben, lebt seitdem auf seinen Gütern in Pommern. Dort hält er – wenn er nicht gerade als Graf von Aspern inkognito im ›Adlon‹ wohnt – genau so Hof wie vor dem Umsturz in seinem Ländchen. Ein paar Lakaien weniger und – kein Volk mehr. Aber innerhalb der Mauern seines allerliebst eingerichteten Jagdschlosses – Hofmarschall, Kammerherr, Haushofmeister, Bediente, alles wie einst im Mai. Abends große Toilette, die Damen ausgeschnitten, mit langen Handschuhen, die Herren im Frack mit Orden; der Kammerherr mit dem Stab voran: ›Seine Durchlaucht, der Herzog.‹ Tiefe Verbeugungen, Hofknickse. Man betet kurz, setzt sich, die wappengeschmückten silbernen Leuchter vor sich, und ißt – ißt ausgezeichnet.«
»Man ißt . . . Und du – Verzeihung, du ißt mit?«
Ilia lächelte. »Aber gewiß. Ich bin doch von Adel. Wenn die Noblesse auch noch nicht sehr alt ist.«
Jetzt lächelte auch Klara ein bißchen. Dieser Adel war nicht alt und nicht echt. War eigentlich vom Zufall erteilt. Emilia Endler hieß sie eigentlich. Und da in der Familie noch eine Emilia Endler, eine wenig reizvolle Tante, existiert hatte, so nannte sich Ilia zur Unterscheidung, ihren zweiten Vornamen zu Hilfe nehmend, Emilia Victoria Endler. Später, als die Tante hochbetagt gestorben war, abkürzend einfach: Emilia V. Endler. Just als sie von Hamburg nach Berlin übersiedelte, bekam sie ein paar Offerten von Geschäftsleuten, die das große »V« vor dem Familiennamen für das Adelsprädikat gehalten hatten und Frau Emilia v. Endler als Kundin wünschten.
Von den freien Sitten der Republik lächelnd Nutzen ziehend für Beruf und Fortkommen, ließ es Ilia dabei und nannte sich Geschäftsleuten gegenüber, wie diese sie genannt: Emilia v. Endler. An ihrer Wohnungstür aber und auf ihren Visitenkarten für die Kunden stand freilich nur: »Madame Ilia« – dieses »Ilia« in der Kinderzeit ein Kosewort, jetzt Künstlername, war aus dem etwas zu vulgären und gänzlich unmystischen »Emilia« entstanden. Dahinter Wohnung und Telephon. Und da sie, mit der Vorliebe geboren und von der Bühne her gewöhnt, ein wenig Maske zu machen, ihre Kunden stets in einer ausgezeichnet gearbeiteten hohen weißen Perücke, vor die obere Hälfte des Gesichts aber die Maske von Silberblech gebunden, zu empfangen liebte, so hieß sie bald in den Kreisen, die sich für mystische Dinge interessierten, »Madame Ilia« oder »die Dame mit der silbernen Maske«.
Diese silberne Maske, die dort auf den alten Folianten auf dem Tisch lag, ergriff Ilia jetzt in plötzlichem Einfall. Ohne etwas zu sagen oder zu erklären, legte sie die kühle Larve behutsam der erstaunt stillhaltenden Klara vor das Gesicht.
»Was tust du, Ilia?«
»Ich probiere etwas . . . Sie paßt dir ganz gut. Darunter das frische Gesichtchen, der hübsch geschnittene Mund mit den Lippen in beneidenswertem Naturrot und das Kinn mit dem Grübchen darin. Die weiße Lockenperücke muß dich noch besser kleiden.«
»Mich – die Perücke – wozu?«
Ilia nahm ihr die Maske wieder vom Gesicht und sah ihr ernst in die Augen. »Ich hab' eine große Bitte, Klara. Du mußt sie mir erfüllen!«
»Wenn's irgend geht – gewiß!« Klara sah ahnungslos zu Ilia hinüber.