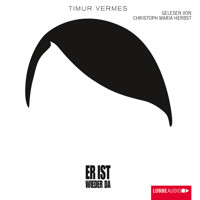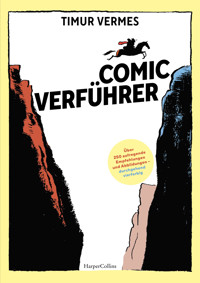9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom Autor von ER IST WIEDER DA!
"Ein großartiges Buch: lustig, böse, traurig!" KESTER SCHLENZ, STERN
Deutschland hat eine Obergrenze für Asylsuchende eingeführt, ganz Europa ist bis weit nach Nordafrika hinein abgeriegelt. Jenseits der Sahara entstehen riesige Lager, in denen Millionen von Flüchtlingen warten, warten, warten. So lange, dass man in derselben Zeit eigentlich auch zu Fuß gehen könnte, wäre das nicht der sichere Tod.
Als die deutsche Starmoderatorin Nadeche Hackenbusch das größte dieser Lager besucht, erkennt der junge Lionel die einmalige Gelegenheit: Mit 150.000 Flüchtlingen nutzt er die Aufmerksamkeit des Fernsehpublikums und bricht zum Marsch nach Europa auf. Die Schöne und die Flüchtlinge werden zum Quotenhit. Und während sich der Sender über Live-Berichterstattung mit Zuschauerrekorden und Werbemillionen freut, reagiert die deutsche Politik mit hilflosem Wegsehen, Kleinreden und Aussitzen. Doch je näher der Zug rückt, desto mehr ist Innenminister Joseph Leubl gefordert. Und desto dringlicher stellen sich ihm und den Deutschen zwei Fragen: Was kann man tun? Und in was für einem Land wollen wir eigentlich leben?
Timur Vermes‘ neuer Roman ist eine Gesellschaftssatire, aktuell, radikal, beklemmend und komisch zugleich. DIE HUNGRIGEN UND DIE SATTEN fängt dort an, wo der Spaß aufhört.
"Wenn Timur Vermes‘ Erstlingswerk ER IST WIEDER DA böse, realistisch und komisch ist, so ist sein zweiter Geniestreich böser, realistischer und komischer." CHRISTOPH MARIA HERBST
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 674
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Deutschland hat eine Obergrenze für Asylsuchende eingeführt, ganz Europa ist bis weit nach Nordafrika hinein abgeriegelt. Jenseits der Sahara entstehen riesige Lager, in denen Millionen von Flüchtlingen warten, warten, warten. So lange, dass man in derselben Zeit eigentlich auch zu Fuß gehen könnte, wäre das nicht der sichere Tod.
Als die deutsche Starmoderatorin Nadeche Hackenbusch das größte dieser Lager besucht, erkennt der junge Lionel die einmalige Gelegenheit: Mit 150.000 Flüchtlingen nutzt er die Aufmerksamkeit des Fernsehpublikums und bricht zum Marsch nach Europa auf. Die Schöne und die Flüchtlinge werden zum Quotenhit. Und während sich der Sender über Live-Berichterstattung mit Zuschauerrekorden und Werbemillionen freut, reagiert die deutsche Politik mit hilflosem Wegsehen, Kleinreden und Aussitzen. Doch je näher der Zug rückt, desto mehr ist Innenminister Joseph Leubl gefordert. Und desto dringlicher stellen sich ihm und den Deutschen zwei Fragen: Was kann man tun? Und in was für einem Land wollen wir eigentlich leben?
Über den Autor
Timur Vermes wurde 1967 in Nürnberg als Sohn einer Deutschen und eines Ungarn geboren. Er studierte in Erlangen Geschichte und Politik und arbeitete anschließend als Journalist und Ghostwriter. Er schrieb bis 2001 für die Abendzeitung und den Kölner Express und war später Textchef mehrerer People- und Lifestyle-Magazine. Sein 2012 bei Eichborn erschienener Roman Er ist wieder da ist eines der erfolgreichsten deutschen Debüts der letzten Jahrzehnte.
TIMUR VERMES
DIE HUNGRIGEN UND DIE SATTEN
ROMAN
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Roman ist eine Fiktion. Zwar waren schon 2016 laut UNO-Flüchtlingshilfe weltweit rund 70 Millionen Menschen auf der Flucht. Aber das heißt noch lange nicht, dass irgendeiner von ihnen eine zündende Idee haben muss.
Selbst wenn: Es ist keineswegs sicher, dass irgendein Fernsehsender über diese Idee berichten würde. Und sollte es trotzdem so weit kommen, ist es nicht sicher, dass Campino sich dazu äußert.
Überhaupt kann niemand garantieren, dass die geschilderten Personengruppen sich so verhalten werden, wie es das Buch unterstellt. Es ist durchaus möglich, dass alles ganz anders kommt.
Es ist nur nicht wahrscheinlich.
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2018 by Timur Vermes
Copyright für die deutsche Originalausgabe © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München
Textredaktion: Bärbel Brands, Berlin
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Einband-/Umschlagmotiv: © Johannes Wiebel | punchdesign
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-6546-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Ich hasse die Wirklichkeit.
Leider ist sie der einzige Ort,
an dem man ein anständiges Steak bekommt.
Woody Allen
I
1
Der Flüchtling versucht betont normal zu gehen, was nicht leicht ist, weil es sich nicht normal anfühlt. Ob sein Gang so natürlicher wird, kann er noch nicht sagen. Er weiß nur, dass das Normalgehen auch deshalb nicht klappt, weil ihn die Blicke der anderen nervös machen. Er zieht daraufhin den Kopf etwas ein, aber das ist der falsche Weg, das merkt er gleich an den Reaktionen: Wahrscheinlich sieht er jetzt aus wie ein buckliger Storch. Dann lieber Brust raus, Kopf hoch und grinsen.
Besser.
Er muss nur aufpassen, dass er nicht anfängt, huldvoll zu grüßen wie die alte Engländerkönigin.
Hätte er es früher tun sollen? Ging eigentlich nicht. Es ist ja nicht so, dass er ewig darüber nachgedacht hat. Er ist auch jetzt noch nicht sicher, ob es richtig war. Ändern kann er es auf jeden Fall nicht mehr.
Er entspannt sich langsam, das Grinsen wird zu einem Lächeln. Er lässt sich allmählich in seine neue Rolle fallen. Ist ja logisch, dass sie ihn ansehen. Wie sollte es auch anders sein: Wenn jeder Tag genauso ist wie der Tag zuvor, dann werden kleinste Veränderungen aufregend. Interessant ist, dass sein sichereres Auftreten andere Reaktionen hervorruft. Es wird weniger gekichert, und er bekommt öfter ein aufmunterndes Nicken oder Anerkennung. Zwei Kinder laufen ihm hinterher, so wie sie manchmal Autos nachlaufen. Es könnten noch mehr werden, aber dann kommt tatsächlich ein Auto, und seine Staubwolke reißt die Kinder mit sich fort.
Der Flüchtling beginnt mit der neuen Situation zu spielen. Ein Mädchen sieht ihn an, und er antwortet auf ihren Blick mit einem Tanzschritt. Sie lacht. Es fühlt sich gut an. Es war richtig. Es war’s wert. Er hätte es wohl doch früher tun sollen. Der Flüchtling biegt um die Ecke und sieht Mahmoud.
Mahmoud hockt auf dem Boden und beobachtet eine Gruppe von Mädchen. Der Flüchtling schiebt die Hände in die Hosentaschen und stellt sich neben Mahmoud. Mahmoud bewegt sich nicht.
»Das bringt nix«, sagt der Flüchtling zu ihm.
»Das weiß man nicht«, meint Mahmoud, ohne aufzublicken.
»Das weiß man. Du guckst falsch.«
»Ich guck, wie alle gucken.«
»Eben«, sagt er. »Alle gucken zu Nayla, alle gucken wie du. Woran soll sie merken, dass du besonders bist?«
»Weil es gar nicht um Nayla geht.«
»Sondern? Um Elani?«
»Vielleicht. Vielleicht nicht.«
»Das wäre ja noch blöder.«
»Woher willst du das wissen?«
»Weil es auch für Elani aussieht, als ob du Nayla anschaust. Dann denkt eben auch Elani, dass du wie alle bist.«
Mahmoud legt den Kopf in den Nacken und dreht die Augen nach oben, bis er den Flüchtling ansehen kann: »Hast du einen besseren Plan?«
»Warum gehst du nicht rüber, ganz cool, so dass Nayla schon überlegt, wie sie dich am besten abwimmelt. Und wenn du dann neben ihr stehst, wenn Nayla schon den Mund aufmacht – dann wendest du dich plötzlich an Elani.«
Mahmoud klappt seinen Kopf wieder nach vorne. Er denkt über den Vorschlag nach und sagt dann: »Das ist deine Nummer. Du bist so ein Quatscher. Ich bin mehr so ein Gucker. Meine Kraft liegt in meinem Blick. Wo hast du die Schuhe her?«
Mahmoud hat nicht ein Mal nach unten gesehen. Vielleicht liegt seine Kraft ja wirklich in seinem Blick.
»Man spart ein bisschen, wenn man selbst nicht raucht«, sagt der Flüchtling und hält Mahmoud die Zigaretten hin.
Mahmoud nimmt sich eine und sagt: »Aber man spart mehr, wenn man schnorrt.« Er steckt die Zigarette hinter sein Ohr und dreht sich in der Hocke zum Flüchtling, wie ein Automechaniker, der einen Schaden begutachtet. »Die sehen gut aus«, sagt er anerkennend, »die sehen sogar echt aus. Wenn ich nicht wüsste, dass du hier keine Echten kriegst, würde ich sagen …«
»Natürlich kriegst du hier Echte.«
Der Flüchtling klemmt die Schachtel wieder unter den linken Ärmel seines T-Shirts auf die breite Schulter. Das macht weder die Schachtel noch die Zigaretten attraktiver, aber man sieht sofort, dass er Zigaretten hat. Und Zigaretten sind in jedem Lager unentbehrlich, auch für Nichtraucher. Man kann damit Kontakte knüpfen, Leuten was Gutes tun, ohne dass man eine große Sache draus macht. Zigaretten kann jeder brauchen, wenn nicht für sich, dann für seine Eltern oder Geschwister oder für einen Freund wie Mahmoud.
Mahmoud klopft ungeduldig an das Bein des Flüchtlings. Er rüttelt so lange, bis der Flüchtling endlich das Bein hebt, damit der Schuhmechaniker auch die Sohle begutachten kann. »Geile Farbe. Bei wem kriegst du die?«, fragt Mahmoud von unten herauf. »Bei Mbeke? Dann sind sie nicht echt.«
»Stimmt.«
»Na also.«
»Was – na also?«
»Nicht echt.«
»Nö. Nicht von Mbeke.«
»Von wem denn sonst? Ndugu steckt die Nase nicht mehr ins Schuhbusiness, das weiß ich sicher.«
»Die sind auch nicht von Ndugu.«
»Dann sind sie erst recht nicht echt.«
»Dann sind’s wohl Fake-Shoes.« Der Flüchtling lacht.
Mahmoud richtet sich auf: »Jetzt sag schon!«
»Und wenn sie von Zalando sind?«
»Zalando verkauft keine Schuhe.«
»Für mich macht er vielleicht eine Ausnahme.«
Mahmoud mustert ihn. Keiner weiß, wie Zalando wirklich heißt. Alle wissen nur, dass er bei der Organisation arbeitet und Deutscher ist. Und dass er immer dasselbe antwortet, wenn man ihn um einen Gefallen bittet: »Was fragst du mich? Bin ich Zalando?« Ein selten blöder Spruch, wenn doch keiner seinen echten Namen kennt. Vielleicht ist er ja tatsächlich jener berühmte Zalando.
»Dann sagst du’s eben nicht«, sagt Mahmoud. Er holt die Zigarette hinter dem Ohr hervor und hält sie dem Flüchtling mit einem fragenden Gesichtsausdruck hin.
Der Flüchtling holt sein Feuerzeug aus der Hose. Wer Leute mit Zigaretten beglücken will, muss die Zigarette auch anzünden können. Sonst suchen die Leute jemanden mit Feuer, und dann ist ein brauchbares Gespräch unmöglich. Sie hören nicht mehr zu, sie vergessen die Hälfte oder kriegen sie erst gar nicht mit. Mahmoud und er gehen schweigend die staubige Straße entlang. Mahmoud schaut auf sein Smartphone.
»In Berlin essen sie jetzt Kartoffeln und Schweinefüße.«
»Wer will schon nach Berlin?«
»Ich nicht.«
»Ich auch nicht.«
»Es ist schön hier!«, ruft Mahmoud.
»Es ist herrlich«, antwortet der Flüchtling und breitet die Arme aus. »Die schönsten Steine der Welt. Sonne kostenlos. Was gibt’s in Berlin, was es hier nicht gibt?«
»Blonde Frauen«, sagt Mahmoud und raucht.
»Und wenn schon? Wer will blonde Frauen?«
»Ich. Zum Ausprobieren.«
»Aber Mahmoud!« Der Flüchtling stellt sich Mahmoud in den Weg, er nimmt ihn sanft bei den Schultern und sieht ihm mahnend ins Gesicht: »Blonde Frauen hat der Teufel gemacht. Wer Blonde ins Haus lässt, erntet Unglück. Du wirst krank. Deine Felder verdorren. Höre auf deinen alten Vater: Eine blonde Frau wird dich verfluchen, so dass alle deine Ziegen verhungern.«
»So ein Glück: Meine Ziegen sind schon verhungert. Jetzt hab ich eine blonde Frau gut.«
»Du hast nie Ziegen gehabt.«
»Umso ungerechter! Dann kriege ich sogar zwei blonde Frauen.«
Der Flüchtling lacht. Mahmoud auch.
»Und? Woher sind jetzt die Schuhe?«
»Gekauft.«
»Neu?«
»Neu.«
»Und wo nimmst du die Kohle her?«
»Du hättest die Kohle auch.«
»Schon. Aber ich geb sie nicht aus. Jedenfalls nicht für so einen Quatsch wie Schuhe.«
»Sondern? Für einen Schlepper?«
»Da kannste deinen Arsch drauf wetten. Aber für einen Spitzenschlepper.«
»Hört, hört«, spottet der Flüchtling, »sogar für einen Spitzenschlepper!«
»Schau an. Wieder einer mit Reiseplänen.«
Das kommt von Miki. Miki steht hinter seiner Bar am Lager-Highway. Er hat sie aus Brettern und Spanplatten zusammengenagelt, einige Wellblechteile und die Motorhaube eines alten Mercedes sorgen für Schatten. Anfangs war mal geplant, sie einheitlich anzustreichen. Aber wie es eben so ist, mal kommt jemand zu Besuch, mal regnet es, mal hilft einem der beste Freund nicht, weil man gerade was mit seiner Frau hat – schon sind fünf Jahre vorbei, und man wartet nur noch, bis die Bar zusammenfällt, damit man endlich eine neue bauen kann. Aber dafür ist sie leider zu stabil.
Die Bar ist nicht so klein, dass Miki sie unbehelligt führen kann, niemand kann das. Aber sie ist klein genug, dass ihm die Gangs nicht so genau auf die Finger schauen. Ohne Gangschutz kriegt er allerdings auch nicht immer Strom für seinen Kühlschrank.
»Und ob ich verreise!« Mahmoud bleibt stehen. »Dieses Drecksloch ist nämlich nicht für jeden das Ziel seiner Träume.«
»Sei mal nicht so sicher«, sagt Miki, »wie fühlt sich das an?« Er greift unter die Theke und wirft den beiden einen Eiswürfel über die Straße entgegen. »Ein kaltes Getränk, kurz vor der großen Reise?«
Der Flüchtling will den Eiswürfel auffangen, aber Mahmoud schnappt ihn sich zuerst und steckt ihn in den Mund.
»Danke, ich hab schon.«
»Komm«, sagt der Flüchtling, »ich lad dich ein.« Er schiebt Mahmoud zu Mikis Theke. »Zwei. Import. Und mach dir auch eins auf.«
»Danke, der Herr«, sagt Miki vornehm und stellt drei Flaschen auf die Theke, eine davon vor sich. Mahmoud ist einigermaßen überrascht.
»Erst neue Schuhe, dann Importbier. Hab ich was verpasst?«
»Weiß ich noch nicht«, sagt der Flüchtling. »Trink einfach. Vielleicht war’s auch ’n Fehler.«
»Bestimmt nicht«, versichert Mahmoud.
»Bier ist nie ein Fehler«, weiß Miki und nimmt einen großen Schluck. Es ist wirklich heiß.
»Sind vielleicht die Schlepperpreise gefallen?«, bohrt Mahmoud.
»Die für deinen Schlepper sicher nicht«, frotzelt der Flüchtling und beugt sich zu Miki. »Mahmoud spart auf einen Spitzenschlepper.«
Miki macht große Augen.
»Genau«, sagt Mahmoud, »hört auf meine Worte: Dieser Mann hier reist nicht in irgendeinem engen dunklen Lastwagen.«
»Sondern?« Miki lehnt sich an den Kühlschrank. Er nimmt das Bierglas vom Regal und fängt an, es zu polieren, als käme bald jemand, der Bier aus einem Glas trinkt.
»Dieser Mann legt sich gemütlich in den Schatten, bis der Schlepper kommt. Mit einem weißen Mercedes. Und cremefarbenen Sitzen. Dann springt der Schlepper aus der Tür. Er hat so eine Uniform an wie die Männer vor den teuren Hotels und trägt einen Sonnenschirm. Er rennt um das Auto herum, hält mir die Tür auf und sagt: ›Bitte einzusteigen, Bwana Mahmoud!‹«
»Er rennt um das Auto herum, um dir die Tür aufzuhalten?« Miki hält das Glas prüfend in die Sonne.
»So steht es geschrieben, ihr Ungläubigen. Und ich steige ein, und dann fahren wir über die Grenze. Und er fährt ganz gemütlich, und er fragt mich, ob mir die Gegend gefällt. ›Ich kann auch durch eine andere Gegend fahren, was immer Sie wünschen, Bwana Mahmoud‹, und ich sage: ›Nö, das passt schon. Hauptsache, wir kommen nicht zu früh.‹«
»Das darf natürlich nicht passieren«, spottet Miki.
»Ja, du machst dumme Witze, weil du keine Ahnung hast. Weil du nichts weißt von Deutschland. Aber ich weiß Bescheid, und ich sage dir, dass die Deutschen es nicht mögen, wenn man zu früh kommt.«
»Wenn man zu spät kommt«, korrigiert der Flüchtling.
»Und zu früh auch.«
»Quatsch!«
»Sagt der Schlepper auch, aber ich sage: ›Kein Quatsch. Weil das für den neuen Merkel unangenehm ist, wenn ich schon da bin, und er hat mein Zimmer noch nicht hergerichtet.‹ Also sage ich zu ihm: ›Wir fahren lieber noch mal über die Grenze.‹ Und er sagt zu mir: ›Wir können so oft über die Grenze fahren, wie Sie wollen, Bwana Mahmoud. Aber der neue Merkel hat vorhin angerufen, und er hat zwei Hotels für Sie leergeräumt, Sie sollen sich schon mal eines aussuchen.‹ Und dann«, sagt Mahmoud zufrieden und nimmt einen großen Schluck Bier, bevor er die Flasche sehr lässig und sehr präzise auf den feuchten Ring stellt, den sie auf dem Holztisch hinterlassen hat, »dann sage ich: ›Ich nehme das Hotel, wo das Klo und das Zimmer auf derselben Etage sind.‹«
»Guter Plan«, sagt der Flüchtling. Er nimmt sein Bier, stößt es an die Flaschen von Mahmoud und Miki und trinkt.
»Gut«, sagt Miki, »aber falsch. Wenn hier einer nicht in einen engen, dunklen Lastwagen kommt, dann dieser Mann.« Und dabei zeigt er mit dem Daumen auf sich. »Weil dieser Mann hierbleibt. Hier, im Drecksloch. Aber dich, mein Lieber, dich zocken sie ab, und dann schieben sie deine Leiche in die Wüste. In einer cremefarbenen Schubkarre.«
»Spielverderber«, sagt Mahmoud.
»Aber das Beste ist: Ich bin schon da, wo du hinwillst. Denn hier ist das Klo überall auf derselben Etage. So eine Etage findest du in ganz Europa nicht: fünfzig Quadratkilometer. Das ist die größte Suite der Welt!«
»Haahaa!«, macht Mahmoud. Er blickt weder zu Miki noch zum Flüchtling, sondern über die Zelte hinweg in den endlos blauen Himmel. Der Flüchtling merkt, dass Mahmoud jetzt nicht in ihre Gesichter sehen will. Die Fantasie war vielleicht übertrieben, aber sie war schön, und in ihren Mienen könnte Mahmoud nur erkennen, wie recht Miki hat. Zu viel Zeit ist seit dem Moment vergangen, in dem Deutschland die Türen aufgemacht hat. Damals, als sie noch eine Frau als Merkel hatten. Wer damals in Reichweite war, hatte das große Los gezogen. Aber das wird sich nicht wiederholen. Eineinhalb Jahre sitzen sie schon hier, und auf diese Zeit wird noch mehr Zeit folgen.
Der Flüchtling dreht sich um und lehnt sich neben Mahmoud mit dem Rücken an die Theke. Er blickt über die Straße. Es ist Nachmittag, die schnelleren, kräftigeren Kinder kommen vom Holzsammeln zurück. Als der Flüchtling das erste Mal im Lager auf sie geachtet hatte, waren sie damit schon mittags fertig. Aber die Wege werden weiter, wenn Millionen Menschen Brennstoff brauchen, Holz, Zweige, Dung, irgendwas. Millionen, und täglich werden es mehr. So ist das einfach: Neue Menschen kommen an, aber niemand kann weg. Früher hat sich der Zustrom von hier aus weiterverteilt, nach Marokko, nach Libyen, nach Ägypten oder auch wieder zurück in die Herkunftsländer. Aber das war vorher. Bevor Europa die Grenzen schrittweise geschlossen hat.
Ein sandfarbener Hund nähert sich. Es ist nicht mehr viel Hund übrig, eigentlich steht da nur eine Art fellbespannter Korb auf Beinen, der hechelt. Er sucht den Boden ab, der Blick beobachtet aufmerksam die Straßenränder. Er geht nirgends hin, um zu schnuppern, er sieht, dass es hier nichts gibt, an dem man schnuppern müsste. Dann bleibt er stehen und dreht den Kopf zu den drei Männern an der Bar. Er hat nur ein Auge, aber im Lager reicht das völlig. Niemand lockt den Hund, aber es wirft auch niemand mit Steinen auf ihn, immerhin. Der Hund beschließt, dass es die Mühe wert ist, mit dem Schwanz zu wedeln.
Miki macht eine müde Handbewegung. Der Hund stellt das Wedeln ein und geht weiter. So ähnlich hat sich Europa das mit den Flüchtlingen vorgestellt.
Als die Menschen in die Boote stiegen, hat Europa versucht, das Mittelmeer zu schließen. Und nachdem Europa gemerkt hatte, dass man ein ganzes Meer nicht schließen kann, dass man eine verwinkelte, zigtausend Kilometer lange Küste nicht einmal überwachen kann, haben sie die Grenze wieder aufs Festland verlegt, aber diesmal nach Afrika. Sie haben Ägypten, Algerien, Tunesien, Marokko bezahlt und ein bisschen auch die Libyer, aber natürlich weniger. Weil sie bis heute nicht wissen, wem sie in Libyen das Geld in die Hand drücken sollen. Aber das hat den Europäern nicht gereicht. Auch weil die Nordafrikaner dazugelernt haben: Sie haben öfter mal laut überlegt, wie es wäre, wenn sie auf diese Grenzen nicht ganz so sorgfältig aufpassen würden. Das hatten sie von den Türken, bei denen haben sie gesehen, wie viel Respekt und Beachtung man kriegen kann, wenn man am Flüchtlingshebel herumspielt. Also hatten die Europäer noch mal Geld in die Hand genommen und südlich der Sahara die nächste Linie gezogen. Genau deshalb ist für ihn auch Mahmouds Traum vom Spitzenschlepper eigentlich nicht mehr lustig. Denn es gibt inzwischen nur noch Spitzenschlepper.
»Ich verrate euch das Geheimnis«, sagt der Flüchtling, ohne zu den anderen beiden hinzusehen.
Sein Blick geht über das Camp, das endlose Camp. Er ist schon öfter an den Rand des Camps gelaufen. Das geht, wenn man viel Zeit hat. Dann sieht man auf der einen Seite das Nichts, und im Nichts gibt es Staub und Sand und Steine und noch mehr Nichts zwischen dem Nichts. Und auf der anderen Seite sieht man Zelte und zeltartige Hütten und hüttenartige Zelte und geflickte Zelte und löchrige Zelte und verlassene Zelte und überfüllte Zelte, und wenn man dann nichts zu tun hat, dann kann man sich überlegen, wo es trostloser aussieht. Wenn man sich nicht entscheiden kann, geht man schlafen und kommt einfach in ein paar Tagen wieder hierher. Man könnte auch gleich am nächsten Tag wiederkommen, aber wer noch halbwegs alle Sinne beisammenhat, tut sich das nicht an.
»Ich verrate euch das Geheimnis«, wiederholt der Flüchtling.
»Hm?« Miki macht mit dem Glas quietschende Geräusche.
»Hinter den Schuhen.«
»Es gibt ein Schuhgeheimnis?«
Mahmoud zeigt stumm nach unten. Miki beugt sich offenbar über die wacklige Theke, der Flüchtling merkt es, weil sich das kantige Brett knarzend unter seine Schulterblätter bohrt. Dann hört das Bohren auf, und Miki sagt: »Oho! Neue Schuhe!«
Das mit den Schleppern war die größte Lüge von allen: Sie wollten die Schlepper bekämpfen, hieß es. Dabei können Regierungen Schlepper nicht bekämpfen. Es ist wie bei Drogen und Nutten und Alkohol: Das Einzige, was Regierungen beeinflussen können, ist der Preis. Jeder Polizist, jedes Kriegsschiff, das sie losschicken, erhöht letzten Endes nur den Preis, und genau das war dann passiert: Die Preise sind gestiegen, und sie steigen immer noch. Bezahlen können die Tarife nur noch wenige, was unterm Strich darauf hinausläuft, dass die Schlepper jetzt für mehr Geld weniger arbeiten müssen. Und nicht nur das: Sie müssen auch weniger von diesem Geld abgeben, weil sie niemanden mehr dran beteiligen müssen.
Früher, als noch die Sache mit den Schlauchbooten funktioniert hat, da war das ein organisierter Massenmarkt mit jeder Menge Jobs quer durch Afrika. Es gab immer welche, die Informationen verteilen mussten, die Treffpunkte weitergaben, die Kundschaft für Transporte einsammelten, die Schwimmwesten besorgten. So ein Boot voller Leute, das braucht jede Menge Botengänge, einen Fahrer. Und sogar einer, der überhaupt kein Geld hatte, konnte sich die Überfahrt verdienen, indem er sich bereit erklärt hat, für das Schlauchboot den Steuermann zu machen. Das war immerhin noch eine ziemlich faire Aussicht für alle Beteiligten, weil ein Schlauchboot steuern kann noch der letzte Idiot. Aber jetzt?
Jetzt schickt man keine achtzig Leute mit einem Schlauchboot los, sondern acht Leute mit einem Kleinflugzeug. Oder mit einem alten Hubschrauber. Der Pilot ist eine Fachkraft. Das Flugzeug oder den Hubschrauber muss man zwar warten, aber auch das können nur Experten. Die Schlepper beschäftigen jetzt bloß noch Fachleute. Und die überflüssig gewordenen Helfer füllen die Auffanglager immer weiter auf.
»Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Sparen keinen Sinn mehr hat«, sagt der Flüchtling.
»Du gibst auf?«, fragt Mahmoud.
»Das sag ich nicht. Aber ich sage: Sparen ist sinnlos.«
»Gute Einstellung«, Miki klopft ihm von hinten auf die Schulter. »Noch ein Bier?«
»Ich sage: Sparen ist sinnlos. Das macht Saufen noch lange nicht sinnvoll.«
»Und wie willst du die Kohle dann zusammenbringen?«
»Keine Ahnung. Aber erklär mir mal, wie das noch funktionieren soll!«
Mahmoud verstummt. Was soll er auch dazu sagen: So viel Bier kann Mahmoud gar nicht in sich hineingießen, dass er nicht mehr weiß, dass der Flüchtling recht hat. So wie die Preise der Schlepper steigen, sinken die Aussichten, im Lager das nötige Geld zu verdienen. Obwohl das Lager jetzt über zwei Millionen Einwohner hat. Genug für eine ganze Stadt. Aber das Lager kann nie zur Stadt werden.
Denn das marode Land, in dem das Lager liegt, hat selbst schon genügend Städte, die nicht funktionieren. Es hat eine Regierung, die vor drei Jahren noch nicht an der Macht war und die es in fünf Jahren vermutlich nicht mehr sein wird. Dazwischen wird sie immer wieder von zwei anderen Gruppierungen angegriffen, die genauso gut regieren könnten und es demnächst vermutlich auch tun. Der einzige Grund, dass das Lager existiert und wächst, ist, dass es hier etwas gibt, was man nirgends sonst bekommt: Sicherheit, wenn auch nicht viel.
Die Sicherheit kommt vom Geld der Vereinten Nationen und der Europäer. Dafür hilft die gerade amtierende Regierung beim Schutz des Lagers, schon im eigenen Interesse, damit es auch weiterhin Geld gibt und Entwicklungshilfe und Lieferungen von Nichtangriffswaffen. Im Grunde verpachten sie eines der nutzlosesten Gebiete der Welt für einen rentablen Tarif, weshalb sich die beiden Rebellengruppen aber noch mehr bemühen, selbst an die Regierung zu kommen, um dann wiederum ihren Anteil an der Flüchtlingsernte einzustreichen.
Als Ergebnis wird das Lager seit nun schon fünfzehn Jahren kaum angetastet. Es gibt Sicherheit genug zum Überleben, aber nicht für eine Zukunft. Man kann sich im Lager einrichten, wie Miki. Man kann sogar eines Tages einen neuen gebrauchten Kühlschrank für Bier kaufen, wenn man an so viel Zukunft glauben möchte. Aber niemand wird hier eine Fabrik ansiedeln. Niemand wird Geld in diesen Zelthaufen stecken, der in zwei Wochen auch schon komplett verschwunden sein kann. Und darum wird niemand hier Arbeit anbieten können, weil es hier auch auf Jahrzehnte hinaus nichts geben wird außer Staub und Sand und Dürre.
Hier kann ein Mann nichts verdienen und eine Frau nur auf die einzige Art, mit der es Frauen seit Jahrtausenden tun. Aber so wie die Lage jetzt ist, kann selbst die schönste Frau der Welt hier nie so viel zusammenvögeln, dass ihre Ersparnisse die Schlepperpreise einholen, die die Europäer mit ihrer Grenzschließung hochgeschraubt haben. Das gilt für jeden im Lager, inklusive Mahmoud. Für den sogar noch mehr, weil den keiner vögeln will.
»Sparen ist sinnlos«, sagt der Flüchtling nüchtern. »Weil ich mich trotzdem jeden Tag weiter von der Summe entferne, die der Schlepper will.«
»Muss doch kein Spitzenschlepper sein«, bietet Mahmoud an.
»Macht das einen Unterschied?«
»Und was ändern da neue Schuhe?« Miki stellt sein Bierglas wieder ins Regal. »Du kommst doch trotzdem nirgendwo- hin.«
»Aber man läuft besser.«
Das stimmt übrigens wirklich. Die meisten tragen hier irgendwelche Strandlatschen oder Pantoffeln, sobald sie keine Kinder mehr sind, denn Kinder tragen überhaupt keine Schuhe.
»Als ob man hier so weit laufen müsste.«
»Aber Laufen kostet wenigstens nichts.«
Der Flüchtling hält inne. Er hat es eigentlich nur aus Trotz gesagt, aber dennoch kommt es ihm vor, als wäre er auf etwas gestoßen. Auf einen Zusammenhang, den er nur noch nicht recht benennen kann.
»Und?« Mahmoud sieht den Flüchtling erwartungsvoll an
»Nein, schau: Ich kann mir keinen Schlepper leisten, weil ich nicht genug Geld habe. Aber ich habe Zeit. Ich habe jede Menge Zeit. Ich sitze seit eineinhalb Jahren hier. Wenn ich jeden Tag nur zehn Kilometer gelaufen wäre, dann wäre ich fünftausend Kilometer weiter.«
Dazu fällt Mahmoud erst mal nichts weiter ein. Miki sagt auch nichts.
»Fünftausend Kilometer, das ist gar nicht schlecht.« Der Flüchtling denkt jetzt beim Reden oder umgekehrt. Er weiß auch nicht, worauf er hinauswill, aber er hat das Gefühl, als ob da irgendwo noch mehr brauchbare Gedanken herumliegen würden. »Fünftausend Kilometer. Gratis. Und das Geld, das sonst der Schlepper kriegt, das hätte ich immer noch.«
»Klar, und vielleicht noch was extra«, nörgelt Mahmoud. »Wovon lebst du eigentlich auf deinem Marsch?«
»Richtig, ich muss was essen, ich muss was trinken. Aber habt ihr euch schon mal ausgerechnet, wie viel ich für meine Ersparnisse essen und trinken kann?«
»Die Preise in Berlin sollen happig sein«, unkt Miki, aber es klingt nicht miesepetrig, eher neugierig. Auch er will wissen, wo diese Gedanken hinführen. Er stellt dem Flüchtling ungefragt noch ein Bier hin.
»Hey!«, protestiert Mahmoud, »und ich?«
»Denk dir was Schönes aus, dann kriegste auch eins«, bügelt ihn Miki ab.
»Ich hab also ein bisschen weniger Geld und bin fünftausend Kilometer weiter …«
Mahmoud hilft nach: »Die Grenzen?«
»Ich könnte mir Führer besorgen. Die kosten nicht ganz so viel.«
»Sicher, die warten auf dich und machen dir einen Sonderpreis. Also wenn ich Sonderpreise anbieten würde, dann meinem Spitzenschlepper. Die kommen nämlich wieder. Sonderpreis für Stammkunden.«
»Jaaa«, sagt der Flüchtling, »so ausgeklügelt ist der Plan noch nicht.«
»Und dann steht Herr Sonderpreis vor den Grenzanlagen der Europäer. Sie sagen, dass du aus einem ganz fabelhaften Land kommst und gar nicht weißt, wie gut es dir da geht. Und das war’s dann.«
»Ist ja gut …«
»Wie jetzt«, sagt Miki, »und dafür hab ich dir ein Bier hingestellt?«
»Ich hab keine Wunder versprochen!« Der Flüchtling versucht die beiden abzuwimmeln, aber es ist zu spät. Es ist, als hätte man eine Idee und wird im falschen Moment unterbrochen. Dann ist sie weg. Er versucht den Faden wieder aufzunehmen, er schließt die Augen und hofft, dass er den Gedankenstrom wieder erwischt, so wie die Träume, aus denen man erwacht und in die man zurückkehren kann, wenn man es richtig anstellt.
»Ich hab kein Geld, aber ich hab viel Zeit«, wiederholt der Flüchtling, »und ich habe zwei Füße …«
»Ja, das hatten wir schon.«
Und dann ist der Gedanke endgültig weg. Wütend greift er zur Bierflasche und nimmt einen großen Schluck, bevor Miki auf die Idee kommt, sie wieder wegzupacken. Das macht er manchmal, man sollte deshalb bei Miki nicht zu später Stunde und besoffen aufkreuzen, da kann einem schon mal so eine nur fast volle Flasche begegnen.
»Aber eines stimmt«, fasst er zusammen, »ob ich spare oder nicht, die Transportpreise kann ich nie einholen.«
»Komm«, tröstet Mahmoud, »das sieht doch nur jetzt so aus. Vielleicht fallen die Preise wieder, dann sind wir ganz schnell dabei.«
»Die fallen nicht«, sagt der Flüchtling bestimmt. »Europa will uns nicht. Niemand will uns. Und je weniger einer dich will, desto teurer wird die Reise.«
Darauf fällt keinem von ihnen noch was ein. Aber um seine Entschlossenheit zu unterstreichen, um die Richtigkeit seines Anfangsgedankens noch einmal zu betonen, spendiert er noch drei Bier. Und während sie trinken und brüten, geht ihm unablässig der Gedanke durch den Kopf, dass er in diesem Moment eine ganz einzigartige Gelegenheit verpasst hat.
2
Der Staatssekretär kann sich nicht entscheiden. Granit, haben sie gesagt, sei das härteste Material überhaupt. Oder Kunststein? Nicht dass es ihn sonderlich interessieren würde, als Staatssekretär hat man auch noch andere Dinge zu bedenken, aber Tommy hat recht deutlich gesagt, dass er keine Lust habe, alle Entscheidungen allein zu treffen. Weshalb der Staatssekretär jetzt mit der Kaffeetasse in der Hand vor verschiedenen Katalogen sitzt und Materialien vergleicht. Naturstein? Laminat?
»Laminat für die Arbeitsplatte«, hat der Staatssekretär gefragt, »ist das nicht eher was für Fußböden?«
»Zu Fußböden kommen wir noch.«
»Und was ist da der Vorteil? Können wir nicht einfach Holz nehmen?«
»Einfach Holz!« Tommy hat gelacht, als wolle der Staatssekretär mit Flipflops auf den Mount Everest. Er stand in kurzen Hosen im Flur und hatte natürlich den »Hello Kitty«-Rucksack über der Schulter, aber nicht einmal der furchtbare Kätzchenkopf hat den makellosen Arsch darunter entstellen können. Dann hat sich der makellose Arsch weggedreht, und leuchtend weiße Shorts sind auf ihn zugekommen, getragen von zwei gebräunten schlanken Beinen mit einem atemberaubenden Flaum blonder Haare. Er hat im Vorbeigehen etwas vom Couchtisch genommen, das aussah wie ein extrem dickes, extrem langweiliges Magazin, und ließ es dumpf auf den Tisch klatschen, wie ein enormes Steak aus Papier. »Da liest du dich schön ein, dann siehst du auch mal, womit sich normale Menschen befassen müssen. Ich kann dir das nicht alles vorbeten. Ich muss jetzt los, die Tapeten wählen sich nicht von allein aus.«
»Aber …«
»Sei froh, dass ich eine Vorauswahl für uns treffe. Samstagvormittag um halb elf beim Tapezierer, da machen wir’s dann fest, ich hab’s dir eingetragen.«
»Outlook oder Kalender?«
»Beides. Ich muss jetzt. Regier schön! Und grüß mir den Volker!«
Den Volker wird der Staatssekretär bestimmt nicht grüßen. Und er verflucht wieder einmal den Moment, in dem er Tommy zugesagt hat, dass sie zusammenziehen. Das war doch wunderbar praktisch gewesen, er in Berlin, Tommy in Hamburg und alle vierzehn Tage sie beide glücklich vereint. Er konnte abends treffen, wen er wollte, er konnte Hinterzimmergespräche führen bis in die Puppen, einfach mal wen abschleppen (gar nicht mal oft, ehrlich), einfach mal Leute heimbringen und bis um halb vier ein paar Strategien abkaspern. Das geht künftig auch, behauptet Tommy, und wahrscheinlich hat er recht: Man kann ruhig mal fünf Politiker mitbringen, ohne dass der Partner aus dem Bett fällt, wenn man Platz genug hat, um das Schlafzimmer schön weit weg zu legen. Und sie haben jetzt bald traumhafte zweihunderteinundfünfzig Quadratmeter, mit Dachterrasse. Da kommt ein Whirlpool drauf, und dann kann Tommy noch öfter das machen, was er wirklich am besten macht.
Und das ist ganz bestimmt nicht Kochen.
Granit ist toll, liest der Staatssekretär im Papiersteak, aber Naturstein wird leicht fleckig. Und saugt Flüssigkeiten auf. Außerdem ist Granit hart, und wenn man ein Glas etwas zu schnell drauf abstellt, geht es sofort kaputt. Der Staatssekretär überlegt, ob Leute anderswo die Gläser anders absetzen als bei ihm zu Hause, nämlich – also wie soll man sagen: normal. Außer wenn sie geworfen werden.
Der Staatssekretär blickt in seinem Katalog-Elend auf sein Telefon, in der Hoffnung, eine Mitteilung würde ihn erlösen. Es ist aber keine drauf. Er ruft die Kalenderfunktion auf: zwei Meetings, zwei Interviews. Kein Notfall. Er denkt an Tommys Hintern in den weißen Shorts, und dann denkt er plötzlich das Wort »Sommerloch«. Es ist wirklich gerade nichts los. Und er sollte froh darüber sein. Es war ja nicht immer so.
Der Sommer, der Herbst, in dem die dumme Kuh die Flüchtlinge ins Land geholt hat. Der Silvestervorfall in Köln. Die Prügel für den Türkei-Deal. Und dann nach dem Putsch noch mehr Prügel. Man kam aus den Krisensitzungen überhaupt nicht mehr raus. Er weiß nicht mehr, ob es September oder Oktober war, als er nach Hause kam und Tommy sagte: »Ich frage mich, wer überhaupt noch mit dir verhandelt, so wie du stinkst.« Vier oder fünf Tage am Stück war er nicht mehr aus den Sachen gekommen, und jetzt, wo sich die Aufregung weitgehend gelegt hat, wo die Flüchtlingszahlen zurückgegangen sind, wo man halt diesen neuen Bestand betreut oder abbaut oder fortbildet oder auch alles zusammen, da kann er Überstunden abbauen, da hat er endlich auch mal Zeit, was Gutes zu lesen.
Aber stattdessen liest er ja Küchenkataloge.
»Holz ist ein lebendiger Werkstoff«, steht da. Eben. Gutes altes Holz. Nachteile: anfällig für Feuchtigkeit, Frucht- und Gemüsesäfte, Blut. Dann muss man eben aufpassen, dass man sich nicht schneidet, denkt er zuerst, dann fällt ihm ein, dass vermutlich nicht das Blut des Kochs gemeint ist.
Zuletzt durfte er sogar irgendeine Verkehrsangelegenheit moderieren, so wenig war zu tun. Die Sommerpause steht bevor, der Wahlkampf ist schon zu spüren. Da passiert praktisch nichts mehr. Wenn Regierungen etwas tun, dann rasch nach dem Amtsantritt. Weil sie ihren Wählern zeigen müssen, dass die Wahl etwas bewirkt hat. Doch nach zwei, drei Jahren sind die angenehm dünnen Bretter gebohrt. Was danach übrig ist, ist riskant und mühsam.
Kunststoff. Nicht gut für heiße Pfannen. Sehr clever, eine Arbeitsplatte, die keinen heißen Topf verträgt – wer denkt sich so was aus? Und was soll man stattdessen nehmen? Was ist gut gegen Hitze? Stahl? Glas?
Ein Königreich für eine Staatskrise.
Das Einfachste wäre, wenn Tommy die Entscheidung fällen würde. Aber sie diskutieren grade ja nicht nur einen privaten Küchenherd, sondern auch einen privaten Krisenherd, einen sehr begrenzten Krisenherd, der erfreulicherweise die anderen Sektoren nicht betrifft, aber trotzdem muss man ihn beachten, damit er sich nicht ausweitet. Der private Krisenherd heißt »Der Herr Staatssekretär kann ja so wundervoll delegieren«, und das bedeutet, dass er sich in nächster Zeit ein wenig mehr in die häuslichen Dinge einbringen muss, weil Tommy ihm kürzlich mitgeteilt hat, er sei der Ansicht, dass er, Tommy, für ihn, den Staatssekretär, der geliebte Lebensgefährte sei und nicht eine von dessen Ministerialschlampen. Und dann wollte Tommy wissen, ob sie beide sich darüber einig seien, also über seine, Tommys, Nichtministerialschlampenhaftigkeit, denn sonst, sagte Tommy, und das teile er ihm nur mal eben in aller Freundschaft mit, denn sonst könne man die Sache hier gleich beenden.
Und das heißt, dass jetzt erst mal alles ein wenig komplizierter wird. Er hatte eigentlich gedacht, in die neue Küche käme halt auch wieder irgend so eine Pressspanplatte aus dem Baumarkt. Er geht sogar manchmal ganz gerne in Baumärkte. Der dezente Geruch nach Holz und Lösungsmitteln, die ordentlichen Regale. Die vielen Farbdosen. Schrauben, Winkel. Schraubenziehersets. Schraubenschlüsselsets. Nicht dass er handwerklich begabt wäre, aber wenn man so ein Schraubenschlüsselset hat, in jeder Größe, und ein Schraubenzieherset, in jeder Größe, gibt einem das nicht das gute Gefühl, dass man vorbereitet ist für jede Schraube, die einem das Leben vorsetzt?
Dekton. Das Wunderzeug schlechthin. Man kann darauf ein Schwein schlachten und eine Atombombe zünden, und dann, wenn die Erde in fünfzigtausend Jahren wieder von Mutanten bewohnbar ist, dann räumen die Mutanten den Schutt beiseite und sagen: »Oho, eine Dektonarbeitsplatte. Und praktisch wie neu!« Ist natürlich übertrieben, Tschernobyl hat ja gezeigt, dass man in so Atomgegenden viel schneller wieder wohnen kann und gar nicht mal so schnell mutiert. Für ihn ist dieser Ausstieg auch noch nicht völlig durch, er hat da mal mit ein paar Leuten von Vattenfall geredet, die haben ganz vernünftige Ansichten. Die Ökobilanz will er allerdings lieber nicht wissen. Die von diesem Dektonzeug. Ökobilanz ist für Tommy ja auch immer wichtig: »Schließlich hinterlassen wir das ja unseren Kindern!«
»Wir sind schwul.«
»Du musst öfter mal raus aus deinem Laden. Deine Partei vernagelt dir doch den Kopf. Aber so was von dermaßen!«
Das Handy klingelt. Endlich. Der Fahrdienst.
»Ich komm gleich runter.«
Jetzt aber schnell. Er hat schon öfter gemerkt, dass es ihm leichter fällt zu denken, wenn er unter Druck steht. Er hat von Küchen keine Ahnung. Tommy hat präzise Vorstellungen und will eine Küche, die auch nach was aussieht, wenn vielleicht mal der Minister kommt. Oder wenn der Staatssekretär vielleicht sogar mal selber Minister ist, und dann könne man sowieso nicht wissen, wer einen dann noch alles besucht. Der Schnuckelpremier aus Schweden?
Mmmmh.
Kurz denkt der Staatssekretär an Svensson in Boxershorts. Dann reißt er sich zusammen und ist rasch mal sehr professionell. Er nimmt sein Smartphone, vergleicht die Preise und wählt dann das Teuerste. Dann wird Tommy »typisch« sagen und schimpfen, dass er großkotzig sei (zehn Minuten), das könne man doch auch besser und billiger haben (zwei Minuten), dann wird er sagen, was er vorschlägt und in welcher Farbe (dreißig bis fünfundvierzig Minuten), und der Staatssekretär muss sich nur noch ein wenig zieren (fünf, besser fünfzehn Minuten) und dann nachgeben.
Als ob man das nicht alles schneller haben könnte. Aber manchmal muss man eben solche Umwege einbauen, darin unterscheidet sich der Umgang mit Tommy um keinen Deut von dem mit den Ministerialschlampen.
Doch das darf er Tommy natürlich nicht sagen.
3
Nadeche Hackenbusch lehnt sich zufrieden zurück. Sie weiß, dass man die ersten Wellen schon spürt, lange bevor sie im Sender eintrifft. Wie Druckwellen, wie den Wind vor einem Gewitter, dieses Aufrauschen in den Baumwipfeln, das anders klingt als die normale Brise. Wie das Summen der Gleise, das dem Zug vorauseilt.
Logisch wäre es ab dem Moment, in dem Sensenbrink seine Sekretärin noch einmal einschwört: Keine spontanen Telefonate durchstellen, und sie möge noch einmal alle Teilnehmer des Meetings anrufen, damit auch wirklich keiner fehlt. Aber tatsächlich flirrt ihr Name schon vorher durch die Gänge, wie ein Gerücht. Angestellte wittern so was offenbar wie Tiere ein Erdbeben.
»Ihr habt ja heute Großkampftag.«
»Kommt sie allein?«
»Und? Wieder Vollversammlung?«
Das will sie doch schwer hoffen!
Die Zeiten sind nämlich vorbei, wo sie abteilungsweise von Meeting zu Meeting getingelt ist. Anfangs ist sie sich dabei noch wichtig vorgekommen, bis sie gemerkt hat, dass man wesentlich wichtiger ist, wenn man dieselben Leute in weniger Meetings trifft. Letztes Jahr, als abzusehen war, dass die erste Staffel Rekordquoten hatte, hat sie es erstmals geschafft: Für die zweite Staffel gab es nur ein einziges Meeting, zu dem alle anzutanzen hatten. Und der Termin wurde ihr nicht vorgeschlagen – sie suchte ihn sich aus. Sie nahm natürlich den Juli.
»Wieso natürlich?«, fragt die Neue, die neben ihr in der Limousine sitzt.
»Weil dann immer welche ihren Urlaub unterbrechen müssen«, sagt sie, während sie einen Taschenspiegel aufklappt und ihr Make-up kontrolliert. Eine flüssige Bewegung, gleitend, Hand in die Tasche, Hand mit Spiegel heraus, noch während des Anhebens klappt er auf, ein Blick hinein während der kurzen Pause zwischen Anheben und Senken des Spiegels, Hand mit Spiegel gleitet in die Tasche, insgesamt keine zwei Sekunden.
»Macht die das nicht sauer?«
»Doch. Aber nur dann wirst du respektiert. Die wichtigen Leute, die Leute mit Geld, die Leute, die die Entscheidungen treffen, die muss man schlecht behandeln. Nicht die kleinen Leute. Schreiben Sie das bitte auf.«
Diese Neue notiert es in ihren Block. Nadeche Hackenbusch ist noch nicht sicher, ob das ein Ratgeberbuch werden soll oder ihre Memoiren, aber das ist einer ihrer Lieblingssätze, und der soll in jedem Fall drinstehen. Sie greift in die Tasche und holt einen Fünfzig-Euro-Schein heraus. Sie scheint ein eigenes Fach für Fünfzig-Euro-Scheine zu haben, so glatt geht das. Sie beugt sich vor und drückt den Schein dem Fahrer in die Hand. »Ist für Sie. Bevor ich’s später vergesse.« Dann lässt sie sich wieder in die Rückbank sinken.
»Die kleinen Leute musst du gut behandeln«, sagt sie. »Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Ich komme ja aus kleinen Behältnissen. Meine Mutter war selbst eine ganz einfache Frau.«
»Ah, Moment bitte.« Die Neue blättert in ihrem Block zurück. Dann sagt sie: »Ihre Mutter hat einen Unternehmer geheiratet – wollen Sie das wirklich als kleine Verhältnisse bezeichnen …?«
»Meine Mutter war eine ganz einfache Frau«, stellt sie klar. »Und ich werde meine Herkunft nie vergessen. Man muss wissen, wer man ist. Nur wer Wurzeln hat, ist auch ein Mensch.«
Sie hält kurz inne. Als nichts passiert, werden ihre Augen groß, und ihr Kopf nickt in die Richtung des Notizblocks.
»Pardon«, sagt die Neue. »Nur … wer Wurzeln … hat, ist auch … ein … Mensch.«
Sie nimmt die Dokumentation ihrer Worte zufrieden zur Kenntnis. »Anfangs habe ich immer zehn Euro gegeben«, sagt sie. »Aber dann hab ich gedacht, vielleicht ist das popelig. Dann habe ich zwanzig Euro gegeben. Aber da hab ich dann immer noch manchmal gedacht: Vielleicht ist das popelig. Und es ist ja doof, Trinkgeld zu geben, wenn man hinterher dauernd denkt, es war zu wenig oder so. Dann kann ich’s ja gleich bleiben lassen. Also geb’ ich jetzt fünfzig.«
»Und fünfzig sind nicht popelig?«, fragt die Neue.
Der Unterton der Frage gefällt ihr nicht. Wie meint die das? Ironisch? Kritisch? Süffidings?
»Einer, dem fünfzig nicht reichen, der will ja dann wohl hundert. Und hundert ist gierig.«
»Aber fünfzig nicht?«
Nadeche Hackenbusch macht ein missbilligendes, schmatzendes Geräusch. »Wie viel geben Sie denn so?«, fragt sie zurück.
»Ich weiß nicht«, sagt die Neue, »vielleicht fünf? Es kommt ja auch auf den Rechnungsbetrag an.«
»Eben nicht.« Sie schüttelt den schönen Kopf. »Ich merke schon, Ihnen kann man das nicht erklären. Schreiben Sie’s irgendwie zurecht, und dann sehen wir mal. Vielleicht streichen wir’s auch ganz raus.«
»Das mit dem Trinkgeld oder das mit den wichtigen Leuten?«
Die Neue wird hier nicht alt werden. Gott sei Dank hat sie eine sehr saubere Handschrift, wer immer danach kommt, wird ihre Notizen problemlos weiterverwenden können.
»Ich weiß noch nicht«, sagt Nadeche Hackenbusch und sieht abwesend aus dem Wagenfenster. »Vielleicht beides.«
»Schade, dass ich nicht nach Stunden bezahlt werde«, bedauert die Neue.
»Für Ihre Verträge sind Sie selbst verantwortlich.«
Nadeche Hackenbusch sieht auf die Uhr, dann greift sie nach ihrem Handy. »Madeleine? Du, ich bin’s, wir sind in zehn Minuten da. Könntest du bei denen anrufen und ihnen Bescheid sagen? Damit auf meinem Platz …? Genau. Oder nein, heute ist mir nach einem Cappuccino … Super … Süßstoff. Bist ein Schatz!«
Außen zieht die Stadt vorbei. Sie mag das. Einige ihrer Freundinnen von früher haben den Kopf geschüttelt, als sie mitbekamen, wie sich ihr Leben veränderte. Die Interviews, das Leben in der Öffentlichkeit, die ständige Bereitschaft, fotografiert oder angesprochen zu werden, und die Tatsache, dass es kein kurzer Boom war. Sondern dass es seitdem so geblieben ist. Doch sie hat das sofort geliebt, und sie genießt es noch immer. Es ist die Welt, in der sie sich wohlfühlt wie andere in ihrer Stammkneipe. Nicht zuletzt weil sie auch gerade durch diese Begleiterscheinungen permanent sicher sein kann, dass sie das Richtige tut. Sie liest die Tatsache, dass sie ein interessantes, beneidenswertes Leben führt, daran ab, dass ständig jemand um sie herumzappelt. Journalisten sind für sie wie der Kanarienvogel im Bergwerk. Solange einer herumspringt, ist alles okay.
Ihr Blick streift die Neue.
»Biegen Sie hier noch mal ab«, sagt sie dem Fahrer, »ich will mal sehen, was sie da hingebaut haben.«
»Dann sind wir aber nicht in zehn Minuten da.«
»Wir haben’s nicht eilig«, sagt sie sanft.
Weshalb sie eine halbe Stunde später zufrieden Sensenbrinks Entschuldigung annimmt, weil der Cappuccino kalt ist: »Können wir da mal einen frischen haben? Bitte!?«
»Aber nur wenn es keine Umstände macht!«, wehrt Nadeche Hackenbusch ab.
»Das ist doch keine Sache. Fräulein?!«
Sie haben den großen Konferenzraum unter dem Dach gewählt, auch diesmal wieder. Mit Blick über Hamburg. Man trifft sich im Hotel, im ersten Haus am Platz, nicht in einem dieser abgeschabten Senderäume in Köln oder München-Unterföhring, wo sie diese quadratischen Tische unter veralteten Designerlampen zusammenschieben. Sie mag das. Wenn es kleine Gedecke gibt und diese dreistöckigen Tellertürmchen für Häppchen oder Gebäck. Da können die Sender noch so angeben mit ihren Catering-Abteilungen, aber letzten Endes läuft es dann doch nur auf Kantinenkaffee hinaus und auf Kekse aus der Supermarktschachtel. Nein, sie will Stoffservietten, sie will beflissene Kellner, die alle dasselbe anhaben, sie will sehen, dass andere Leute Geld für sie ausgeben. Sie denkt kurz daran, dass sie das später der Neuen diktieren sollte. Oder ihrer Nachfolgerin.
Der Cappuccino kommt, kurz nachdem Sensenbrink die Präsentation abgefahren hat, er wird noch einmal anfangen müssen, und das ist auch gut so, findet sie, beim ersten Mal waren noch nicht alle still. Außerdem sieht sie das Logo ihrer Sendung so gern: »Auf der Flucht – Nadeche Hackenbusch ist ein: Engel im Elend«. Sie haben eine pfiffig-niedliche Häsin hineingezeichnet, mit Latzhosen und etwas zu großen Brüsten. Die Häsin ähnelt ihr, auch wenn sie nie Latzhosen tragen würde.
»Die Quoten sind gut«, sagt Sensenbrink und blendet einige Grafiken ein, »sie steigen noch immer. Wir kriegen die Alten, und wir kriegen die Jungen. Und wir haben das Thema noch immer exklusiv besetzt. Wir profitieren natürlich auch davon, dass anfangs keiner an das Format geglaubt hat.«
»Außer mir«, betont sie. Mag sein, dass sie damals kein anderes Angebot hatte, aber es gibt keine Sendung im Fernsehen, die nicht mit ihr und durch sie besser wird.
»Es ist kaum zu glauben, dass Sie nichts inszenieren«, sagt eine Blonde. Sie hat die Blonde schon öfter gesehen, aber sie kann sich ihren Namen nicht merken. Die Blonde ist jung, höchstens dreißig, allerhöchstens, aber trotzdem hat sie schon beim letzten Mal mehrfach etwas gesagt, das bei den anderen auf Aufmerksamkeit stieß. Kalkberger? Kalkbrenner? Es klang irgendwie nach Baumarkt. Sie nimmt sich vor, den Namen nächstes Mal zu notieren. Und sie weiß trotzdem nicht genau, wie sie die Bemerkung einordnen soll. Sarkastisch? Skeptisch?
»Prüfen Sie’s doch nach«, antwortet sie hart.
»Nein, nein, ich habe da gar keine Zweifel«, sagt die Blonde. »Es zeichnet die Sendung ja auch aus, diese Authentizität. Da sind ja wirklich Szenen dabei, da stinkt es förmlich durch den Bildschirm. Dafür bewundern wir Sie ja auch, und da spreche ich wohl für alle hier im Raum.«
Die Runde klopft mit den Knöcheln auf den Tisch. Sie lächelt und lässt es verlegen aussehen: »Ich kann Ihnen auch versichern, dass ich weiterhin dafür stehe, dass alles authentizistisch bleibt. Es geht ja zuallererst darum, dass diese Menschen unsere Hilfe brauchen.«
»Ja, aber ich könnte das nicht.« Das kommt von einer leisen, schüchternen Mausfrau am weit entfernten Ende des Tisches. »Da ärgere ich mich auch über mich selber, aber ich brächte es nicht fertig. Manchmal denke ich auch, dass diese Flüchtlingskinder ganz niedlich aussehen – aber allein schon diese Folge vor zwei oder drei Wochen …«
»Au, genau, die mit den Zähnen …«
»Boah, die Zahnfolge …«
Nadeche Hackenbusch sieht, wie Kärrner lächelt. Kärrner sagt fast nie etwas, obwohl es sein Sender ist. Er steuert Meetings mit seinem Gesicht.
»So ist es eben …«, sagt sie.
»Ja, aber die Zähne dieser Kinder waren doch praktisch schwarz!«
»Das war der einzige Moment, wo ich kurz dachte, dass Sie vielleicht doch tricksen«, sagt die Blonde. »Dass Sie sich ein paar besonders Schlimme rauspicken. Ich hab echt gedacht, das kann so gar nicht sein.«
»So ist es aber. Sie brauchen sich nur die Zähne der Eltern anzusehen. Das sind Leute, da müssen Sie ganz unten anfangen.«
»Und wie die ihren Kindern dann handvollweise den Würfelzucker gegeben haben …« Die Mausfrau ist ganz außer sich. »Da hätte ich den Fernseher anschreien können …«
»Ich weiß«, sagt Nadeche Hackenbusch verständnisvoll. »Zahnhygiene, Wahnsinn. Das ist auch nicht so, dass die alle ihre Zahnbürste auf der Flucht verloren haben, die hatten nie eine. Die halten Zahnpasta für eine Art Dichtungsmasse. Deswegen muss man da auch helfen.«
»Völlig richtig«, sagt Sensenbrink, »da geht es um die Sache. Aber das Tolle ist, wir haben da einen Nerv getroffen. Das sehen wir nicht nur an den Quoten, sondern auch an den Reaktionen auf Facebook. Das ist natürlich manchmal eklig, aber es macht auch betroffen. Es macht fassungslos. Das ist ja kein Zufall, dass den Kollegen die Zahnfolge als Erstes einfällt …«
»Der Zahnarztbesuch in dem Heim …« Das kommt von einem bis dahin unauffälligen Executive irgendwas. Er pustet kopfschüttelnd durch die dicken Backen. »Wie der in die Münder geguckt hat, einen nach dem anderen, und wie der dann das Gesicht verzieht, das kann man auch gar nicht spielen …«
»Das braucht man nicht spielen«, sagt Nadeche Hackenbusch schlicht. »Das ist ganz schlimm, was man da vorfindet. Da passieren Dinge, die hätte ich nie für möglich gehalten. Da gibt es Kinder, die sind noch keine vier Jahre alt, und die riechen schon aus dem Mund wie eine Klärgrube.«
In der Runde sehen sich die Senderverantwortlichen an. Sie kneifen ihre Lippen zusammen und lüpfen dabei ihre Augenbrauen in Anerkennung der Schwere der Lage. Sie überlegt, ob sie den schönen Satz schon jetzt platzieren soll, genau in diese Stille hinein, der Satz kommt immer hervorragend an, wenn sie ihn zu einer Zeitung sagt oder in eine Kamera, dann wird er fast immer gedruckt oder gesendet, und dann sind immer alle total überrascht, wie nachdenklich sie bei aller Schönheit doch ist und dass sie auch wirtschaftliche Zusammenhänge kennt. Aber dann kommt ihr diese vielleicht kritische Blonde zuvor und sagt:
»Und das in einem der reichsten Länder dieser Erde.«
Sogar mit »dieser Erde«, was immer noch mahnender wirkt als nur »der Erde«. So ein Miststück.
»Frau Karstleiter trifft den Nagel auf den Kopf«, greift Sensenbrink den Faden auf. »Das ist es aber, was unsere gemeinsame Sache weiterbringt. Das sind Bilder, die sind manchmal schwer zu ertragen, aber die bringen auch eine Betroffenheit, die sonst kaum noch zu erreichen ist. Das zeigt genau, wo wir hinmüssen. Dahin, wo es wehtut.«
»Da sind wir schon«, sagt sie energisch, »wenn Sie möchten, zeig ich Ihnen gern mal meine Füße nach einem Drehtag!«
Die Runde lacht herzlich und verständnisvoll, inklusive Sensenbrink. »Ich denke, wir sind uns alle im Klaren darüber, mit welchem Einsatz Sie das machen. Engel im Elend, das ist vor allem auch Ihr Baby, das steht und fällt mit Nadeche Hackenbusch. Es lebt von Ihrem Engagement, Ihrer Glaubwürdigkeit, Ihrer Bereitschaft, sich die Finger schmutzig zu machen und sich die Füße wundzulaufen. Aber – und ich bitte Sie, mir dieses kleine Wortspiel nachzusehen – trotz Ihrer strapazierten Füße möchten wir heute vorschlagen, einen Schritt weiter zu gehen.«
»Davon höre ich zum ersten Mal.« Sie versucht auf ihrer Stirn einige Zornesfalten zu kräuseln. Wenn sie etwas hasst, dann sind es Leute, die sie steuern wollen. Sie weiß, wie schwer es ist, unabhängig zu werden und zu bleiben. Sie weiß am besten, was gut für sie ist, und sie weiß, dass Werbeleute, Unternehmensberater, Medienmenschen am liebsten alles so machen, wie sie es schon mal bei jemand anders gemacht haben. Doch eine Nadeche Hackenbusch bleibt nur die einzigartige Nadeche Hackenbusch, wenn sie ihren eigenen Weg geht. Nicht dass die Gefahr groß wäre, ihre Position ist momentan zu gut, als dass ihr jemand was aufs Auge drücken könnte. Trotzdem sollten jetzt einige Zornesfalten signalisieren, dass sich Sensenbrink auf dünnes Eis begibt. Doch sie sieht rasch ein, dass sie darauf verzichten muss, wenn es nicht albern wirken soll. Man kann nicht alles haben: Falten und Botox.
»Ja, natürlich, davon können Sie auch nichts wissen, die Idee ist ja ganz neu«, sagt Sensenbrink hastig. »Sie müssen sich aber keine Sorgen machen, Sie wissen, dass wir hier nichts ohne Sie entscheiden …«
»Ich habe das letzte Wort«, sagt sie etwas zu trotzig.
»… ja, klar haben Sie das letzte Wort, keine Frage, was wäre Engel im Elend ohne die Nadeche Hackenbusch, aber ich bitte Sie trotzdem, sich den Vorschlag anzuhören, wir sehen hier eine einmalige Chance …«
Sensenbrinks Tonfall, seine Bemühungen beruhigen sie wieder. Sie lächelt das unbezahlbare Lächeln, das sogar die Frankfurter Allgemeine mal als »überwältigend« bezeichnet hat, und sagt: »Na gut.«
Sie sieht, wie diese Karstleiter aufsteht und nach vorne geht und ihre Notizen auf dem Stehpult ablegt. Sie zeigt leichte Zeichen von Anspannung, offenbar nicht nur weil sie vor Nadeche Hackenbusch spricht, sondern weil das Projekt einen bedeutsamen Umfang hat. Gar kein schlechtes Zeichen.
»Die zweite Staffel von Engel im Elend ist nicht nur ein gewaltiger Erfolg«, beginnt Karstleiter, »sie zeigt auch ein enormes Steigerungspotential: Zuschauerbefragungen haben ergeben, dass Nadeche Hackenbusch für ehrliches Engagement steht. Das Publikum schätzt vor allem die Abkehr von den Einzelfällen: Gerade dadurch, dass wir immer im selben Flüchtlingsheim sind, kann das Publikum ja auch die Besserung der Gesamtsituation verfolgen. Wir sollten diesen Schwung und den Enthusiasmus mitnehmen. Jetzt, wo wir noch etwa ein Drittel der Staffel nicht gesendet haben. Daher, verehrte Frau Hackenbusch, würden wir uns zum Abschluss ein Special wünschen. Vielleicht sogar ein mehrteiliges.«
Nadeche Hackenbusch runzelt die Stirn so gut es geht. Das klingt einfach nur nach mehr. Und mehr ist nicht immer gut, das weiß sie. Sie hat schon mal fürs Fernsehen in einer Model-WG gelebt, die auch supertoll angekündigt wurde, aber sich dann als grausiges Billigprodukt herausgestellt hat. Irgendjemand wollte die topmodellose Zeit mit modelähnlichem Zeug zusenden. Sie war zwar schon nach der zweiten Folge wieder weg, aber sie erinnert sich noch an die fürchterliche Siegerinnenehrung. Da war keine Kölnarena, da war keine Allianz-Arena, da war kein New York oder Paris, das war am Swimmingpool von einer Vier-Sterne-Absteige auf Mallorca, ohne jedes Publikum, das war so armselig, man hätte dem Siegermodel den hässlichen Preis genauso gut an einer Bushaltestelle in die Hand drücken können. Deshalb sagt sie skeptisch: »Das klingt vor allem erst mal billig.«
»Das Budget ist es nicht«, versichert Karstleiter sofort. »Wir stellen mehr zur Verfügung als für die normalen Staffelfolgen. Wir meinen es absolut ernst.«
Budget wirkt. Mehr Budget bedeutet, dass mehr bei ihr hängenbleibt.
»Wir wollen das eigentliche Produkt stärken, nicht schwächen. Wir wollen, dass Nadeche Hackenbusch den Dingen auf den Grund geht. Wir wollen, dass Sie da hingehen, wo fehlende Zahnbürsten noch das geringste Problem sind. In das größte Flüchtlingslager der Welt.«
Das wirft sie etwas aus der Bahn.
»Sind Sie verrückt?«
»Wieso?«
»Wissen Sie überhaupt, was da unten los ist? Da wird geschossen!«
»Da wird nicht geschossen«, sagt Karstleiter.
»Woher wollen Sie das wissen?«
»Da kann gar nicht geschossen werden. Sonst könnte man da doch keine Flüchtlinge sammeln.«
»Wenn da nicht geschossen würde, dann gäbe es keine Flüchtlinge. Schauen Sie doch mal in die Nachrichten!«
»Frau Hackenbusch, Frau Hackenbusch, wir sehen keinen Grund zur Beunruhigung«, wirft sich Sensenbrink dazwischen, »da ist alles voller Militär und Blauhelme und Hilfsorganisationen!«
»Das glaube ich nicht. Wo haben Sie das her?«
»Na ja, ich kann Ihnen jetzt auch nicht aus dem hohlen Bauch die Sendungen aufzählen, aber warum sonst sollten sich da die Flüchtlinge sammeln? Ich denke, wenn Sie sich mal gezielt über das Thema informieren …«
»So viel Zeit hab ich auch nicht, um dauernd irgendwelche Nachrichten zu sehen. Da stellen Sie mir erst mal ein Dossieux zusammen, und ich lasse das dann prüfen …«
»Frau Hackenbusch«, sagt diese Karstleiter jetzt ganz sanft, wie ein breitschultriger Pfleger, der schon die Zwangsjacke aufhält, »glauben Sie, wir schicken Sie ins Unglück? Wir riskieren dabei doch genauso viel wie Sie.«
»Das sehe ich ein bisschen anders.«
Sensenbrink schaut hinüber zu Kärrner, der ein unwilliges Gesicht macht. Er räuspert sich und sagt dann in einem sehr verbindlichen Tonfall: »Vielleicht sollten wir das Ganze mal aus einer anderen Perspektive sehen. Es will hier keiner wegreden, dass die Sache größere Risiken hat als irgendein Studiodreh in Ossendorf. Und daher ist die entscheidende Frage, ob es das wert ist.«
»Da kann ich Ihnen die Antwort gleich geben: keinesfalls!«
»Das ist hier auch genau so angekommen, das versteht sich«, sagt Sensenbrink jetzt mit erstaunlicher Ernsthaftigkeit. »Aber sehen Sie in uns mal für einen Moment auch den Partner. Ihren Partner.«
Und sosehr sie sich sträubt, sosehr sie sich nichts aus der Hand nehmen lassen will, so wenig kann sie doch verhindern, dass Sensenbrink immerhin eine Fußspitze in die Tür bekommt und sie eine Handbreit aufdrückt.
»Natürlich denken wir vor allem an unsere Interessen, aber es lässt sich nicht bestreiten, dass unsere Interessen und Ihre Interessen manchmal dieselben sind. Und Sie können uns eines glauben: Wenn wir mit Ihnen diese Risiken besprechen, dann nur deshalb, weil wir darin auch Chancen sehen. Für uns, das will ich auch gar nicht verheimlichen, aber eben auch für Sie. Denken Sie daran, was Sie und wir durch dieses Special erreichen könnten. Damit lassen Sie mit einem Schlag all diese Einrichtungs- und Renovierformate hinter sich. Die Partnersuchen und Vermisstenfahndungen …«
»Ich glaube nicht, dass mich irgendwer noch mit Vera Int-Veen in einer Liga sieht«, sagt Nadeche Hackenbusch widerspenstig.
»Mit so was brauchen Sie sich wirklich nicht vergleichen«, springt ihr Sensenbrink bei. »Aber bedenken Sie: Das dokumentiert auch Ihre Ernsthaftigkeit in einem nie dagewesenen Umfang. Nadeche Hackenbusch geht da hin, wo andere nicht hingehen. So wie Antonia Rados.«
»Antonella wer?«
»Antonia Rados. Die von RTL. Diese Kriegsgebietstante.«
»Kenn ich nicht.«
»Nicht so wichtig. Sagen wir’s so: Sie wären damit in der Kategorie Günther Jauch«, sagt Sensenbrink geduldig. »Das gab es bisher nur ein Mal in Deutschland: Kennen Sie noch die Margarethe Schreinemakers?«
Natürlich.
Jeder, der heute Botox benutzt, erinnert sich an Schreinemakers. Beste Sendezeit, drei Stunden, vier Stunden, Werbeblöcke so lang wie die ganze Lindenstraße, Überziehen war kein Problem. Die Blütezeit des Infotainment. Und jeder hätte gerne nach Hause getragen, was die Schreinemakers heimgetragen hat.
Versteuern hätte sie’s halt sollen oder so, irgendwas war da. Aber das kann ihr nicht passieren: Sie zahlt ihre Steuern, gern, jederzeit. Und das letzte Mal hat sie dann eben einfach gesagt: »Also, nach der Steuer und allem, da will ich, dass mir 2,5 Millionen übrig bleiben. Da haben Sie doch sicher einen in der Buchhaltung, der das ausrechnen kann.«
Sie hatten.
»Sie wären die neue Margarethe Schreinemakers. Aber mit der Ausstrahlung von Angelina Jolie«, schiebt diese verflixte Karstleiter jetzt nach.
Hat sie ihr angesehen, dass das mit der Schreinemakers ein guter Punkt war? Sie versucht sich nie etwas anmerken zu lassen, sie ist ja kein Amateur. Aber Sensenbrink hat schon einen Treffer gelandet, und jetzt diese Margarethe Jolie, das krallt sich sofort in ihrem Kopf fest. Das und die Aussicht, dass sie als Angelina Schreinemakers auch dann noch Bildschirmpräsenz und Wirkung haben wird, wenn sie das Botox eines Tages tatsächlich nötig haben sollte. Bis jetzt ist es ja nur vorbeugend. Pyrolaktisch. Aber Anne Will und die Maischberger und die Illner, die sind alle schon praktisch siebzig und müssen sich trotzdem von niemandem was sagen lassen. Obwohl die nichts können, was eine Nadeche Hackenbusch nicht genauso könnte.
Sie macht natürlich keine Zusagen. Sie wickelt den Senderbesuch so souverän ab, wie man es von ihr kennt. Aber als sie längst wieder in der Limousine sitzt und dieser Neuen wieder einen Absatz ihrer Lebensphilosophie diktiert, ist sie immer noch ungewöhnlich unkonzentriert. Sie ärgert sich fast darüber, aber trotzdem bleibt sie in Gedanken immer wieder an dem Trailer hängen, als wäre er schon fertig gedreht. Die kernige Stimme, und sie sagt:
»Heute Abend zu Gast bei Nadeche Hackenbusch: Seine Heiligkeit.«
4
Der Sitzungsleiter fehlt noch, deswegen erinnert die Stimmung an die in einer Schulklasse, wenn der Lehrer zu spät kommt. Was eigentlich erstaunlich ist, denn diese Klasse heißt: Bundesregierung. Aber man muss zu ihrer Verteidigung sagen: Es ist Sommerpause. Es ist Pause im Parlament, es ist praktisch überall Pause, die Bundesregierung kommt nur alle vierzehn Tage zusammen statt wöchentlich. Der Bundeskanzler ist im Urlaub, der Vizekanzler ebenfalls und die meisten Minister sowieso, weshalb sie ihre Vertreter schicken, die aber auch nichts zu bereden haben. Es sind deshalb auch Leute dabei, die das erste Mal überhaupt beruflich am Kabinettstisch sitzen. Heimlich ausprobiert haben sie die schwarzen Sessel und den einen in der Mitte natürlich alle schon mal, mit Selfie und dem Finger auf dem Kanzler-Klingelknopf und allem Drum und Dran, aber nicht alle wurden schon mal explizit hergeschickt, damit sie in einem von den Sesseln auch wirklich sitzen und etwas Sinnvolles tun.