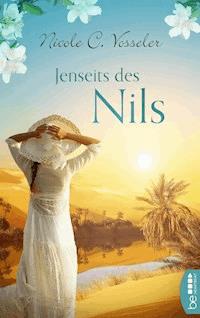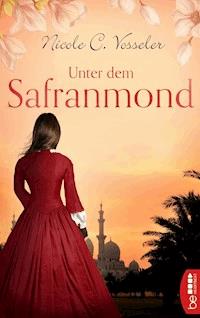1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie stellt sich der Vergangenheit: Der Familiengeheimnisroman »Die Hüterin der verlorenen Dinge« von Nicole C. Vosseler als eBook bei dotbooks. Seit Jahren sammelt Ivy Silvergren in New York verlorengegangene Gegenstände auf: ein gläserner Wal, eine Ballerina aus Porzellan und andere ungewöhnliche Dinge finden den Weg zu ihr. Aus dem Suchen und Finden hat sie einen Beruf gemacht, doch wichtiger als das sind ihr die Geschichten, die diese Fundstücke erzählen. Aber was ist mit Ivys eigener Geschichte und der ihrer Mutter, die verschwand, als Ivy noch ein Kind war? Nun, wo ihr Vater wieder heiraten will und sie gerade glaubt, mit dem einfühlsamen Pflastermaler Jack glücklich werden zu können, spürt sie, dass es an der Zeit ist, die Wahrheit herauszufinden. Und so folgt Ivy einen Sommer lang den Spuren ihrer Mutter … »Eine poetische Geschichte um Verlust, Trauer, Aufbruch und Wahrheitssuche.« Büchermagazin Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Liebesroman »Die Hüterin der verlorenen Dinge« von Nicole C. Vosseler. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Seit Jahren sammelt Ivy Silvergren in New York verlorengegangene Gegenstände auf: ein gläserner Wal, eine Ballerina aus Porzellan und andere ungewöhnliche Dinge finden den Weg zu ihr. Aus dem Suchen und Finden hat sie einen Beruf gemacht, doch wichtiger als das sind ihr die Geschichten, die diese Fundstücke erzählen. Aber was ist mit Ivys eigener Geschichte und der ihrer Mutter, die verschwand, als Ivy noch ein Kind war? Nun, wo ihr Vater wieder heiraten will und sie gerade glaubt, mit dem einfühlsamen Pflastermaler Jack glücklich werden zu können, spürt sie, dass es an der Zeit ist, die Wahrheit herauszufinden. Und so folgt Ivy einen Sommer lang den Spuren ihrer Mutter …
Über die Autorin:
Nicole C. Vosseler, geboren 1972 am Rand des Schwarzwalds, finanzierte sich ihr Studium der Literaturwissenschaften und der Psychologie mit einer Reihe von Nebenjobs. Bereits früh für ihre Kurzprosa, für Essays und Lyrik ausgezeichnet, wandte sie sich später dem Schreiben von Romanen zu. Nicole C. Vosseler lebt in Konstanz, in einem Stadtteil, der ganz offiziell Paradies heißt. Wenn sie nicht an einem ihrer Romane arbeitet, reist sie mit der Kamera um die Welt, wo sie sich als selbsternannte Food-Ethnologin betätigt, trotz ihrer Höhenangst auch mal einen Vulkan besteigt und auch sonst das Abenteuer sucht.
Nicole Vosseler veröffentlichte bei dotbooks bereits »Das Geheimnis des Perlenohrrings«.
Die Website der Autorin: nicole-vosseler.de
Die Autorin auf Facebook: facebook.com/Nicole-C-Vosseler
Die Autorin auf Instagram: instagram.com/nicolecvosseler/
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2024
Copyright © der Originalausgabe 2019 by HarperCollins
in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung eines Motivs von © Adobe Stock / jechm sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-212-1
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Nicole C. Vosseler
Die Hüterin der verlorenen Dinge
Roman
dotbooks.
Für die mutterlosen Töchter
Prolog
Das Gehirn ist ein seltsames Organ.
Gebieterin über unseren Körper und doch auf ihn angewiesen, vielleicht sogar der Sitz unserer Seele.
Ein biologischer Computer, immer unter Strom, selbst wenn wir schlafen, aber alles andere als unfehlbar. Die Quelle guter Absichten und böser Gedanken, von Genialität und Wahnsinn. Der Ort, wo Geister und Dämonen umgehen und Träume fliegen lernen.
Irgendwo in den Tiefen des Gehirns verbirgt sich der Ozean unseres Gedächtnisses. Eine Schattenmacht, die unsere Emotionen färbt und den Fluss dessen speist, was wir erinnern.
Manche Erinnerungen versinken in der Tiefe oder werden von der Zeit ausgewaschen. Andere sind wie ein Fels, jede Feinheit scharf eingeritzt.
Erinnerungen wie diese.
Ein bewegliches Muster aus Licht und Schatten füllte die Küche.
Komorebi sagte ihr Vater dazu. Der japanische Ausdruck für Sonnenlicht, das durch Blätter fällt. Er sammelte solche Wörter.
Die Ulmen vor dem Haus filterten auch den Lärm des aufbrandenden Verkehrs vorn auf der 8th Avenue und einer nahen Baustelle. Bis auf das Summen des Kühlschranks und das Klicken der Kaffeemaschine war es still.
Genauso still saß ihre Mutter auf einem der weiß lackierten Stühle, die bloßen Füße am Fenstersims abgestützt. Über den Kaffeebecher in ihren Händen hinweg verlor sich ihr Blick durch das offene Fenster.
Sie sah aus, als ob sie einen ihrer Spaziergänge durch Wolkenschlösser unternahm, vielleicht auch durch den Nebel zäher Gedanken. Schwer zu sagen für eine Außenstehende wie Ivy, die daran gewöhnt war, ihre Mutter und ihren Vater mit dem Märchenreich der Erwachsenen zu teilen. Mit Romankapiteln und Verszeilen, dem Klappern der Tastatur hinter einer geschlossenen Tür.
An jedem anderen Morgen wäre Ivy auf leisen Sohlen durch das Apartment getappt und hätte die Eingangstür sacht hinter sich zugezogen.
Nirgendwo jedoch stand eine abgedeckte Schüssel oder ein Backblech. Kein Hauch von Kakao oder Vanille hing in der Luft; nichts als das Aroma von Kaffee, der beißende Geruch aus dem Aschenbecher. Wenigstens der künstliche Zitronenduft aus dem übervollen Spülbecken ließ Ivy noch hoffen.
Draußen vor dem Fenster gurrte eine Taube. Ein anfangs begütigender Laut, der aber schnell nervenaufreibend wurde.
Endlich wandte ihre Mutter den Kopf.
Die Augen, sommerblau an guten Tagen, wirkten verhangen. Nur langsam klarten sie auf, während sie den modischen Zickzackscheitel in Ivys Haar erfassten, das erst neulich auf Kinnlänge gekürzt worden war. Das silberne Geflecht der Zahnspange, ebenfalls neu, das bei Ivys unsicherem Lächeln aufglänzte.
Als ob sie erst davonrollende Körnchen von Zeit einsammeln musste, um das Mädchen im Türrahmen als ihre Tochter zu erkennen, ein Jahr noch von der Middle School entfernt, das ersehnte Dasein als Teenager bereits fast in Sicht.
»Du bist ja schon fertig.«
»Es ist zwanzig nach acht.«
Der Mund ihrer Mutter dehnte sich zu einem Lächeln, das die Augen nicht erreichte.
»Viel Spaß in der Schule.«
Der frisch polierte Junimorgen büßte seinen Glanz ein.
»Du hast es vergessen.«
Das Gesicht der Mutter blieb leer, bis sie begriff.
»Wir gehen schnell zur Chocolaterie hinüber und holen dort etwas, ja?«
»Das reicht jetzt nicht mehr!«
»Sicher schaffen wir es noch, wenn ...«
»Du hast es versprochen!«
Es ging nicht darum, am letzten Tag vor den Sommerferien mit einer Schachtel Minztäfelchen oder Trüffel in die Schule zu kommen anstelle von selbst gebackenen Muffins oder Brownies.
Es ging um die Schulaufführung vor Weihnachten, bei der Ivy einen Solopart getanzt hatte. Um die Ausstellung ihres Kunstprojekts. Das Schulpicknick im Mai.
So viele gebrochene Versprechen und enttäuschte Hoffnungen.
Ivys Augen füllten sich mit Tränen.
»Kannst du nicht einmal eine Mutter sein wie alle anderen auch?«
Auf quietschenden Gummisohlen rannte Ivy davon und knallte die Tür zu, die Stille danach ein drückendes Gewicht zwischen den Schulterblättern.
Es gab nie ein Wort des Bedauerns, nie eine Abbitte. Keine Geste der Versöhnung. Keine Umarmung.
Was blieb, war die Erinnerung.
An das Wechselspiel aus Licht und Schatten und an die abgestoßenen Spitzen der Lederballerinas unter dem Tisch.
Das Gurren der Taube, im Nachhinein ein Ruf voll unerfüllbarer Sehnsucht und eigenartig orakelhaft.
Der Rest Kaffee in der Glaskanne. Der Geruch nach kalter Asche und schalem Rauch, trostlos am klaren Morgen. Ein Stapel geöffneter Briefe auf dem Küchenschrank; Ivys Stundenplan und der Zettel mit dem nächsten Zahnarzttermin, beide mit Magneten an den Kühlschrank gepinnt.
Das aus dem Schrank von Ivys Vater geborgte Holzfällerhemd, das – absichtlich oder zufällig? – die Farben ihrer Mutter wiederholte: Schwarz, Blau, Weiß.
Die Strähne dunklen Haars, die ihr in die Stirn fiel. Ihre Augen, auf andere Art blau als Ivys; ein Ozean am anderen Ende der Küche, den Ivy verzweifelt zu erreichen versuchte und dem sie dennoch nicht traute.
Kleine, nebensächliche Details, unzählige Male schon im Geist durchgegangen. Auf der Suche nach einem Vorzeichen, einem Zusammenhang, einer Bedeutung.
Mittwoch, der 30. Juni 2004, 8:24 Uhr.
Das letzte Mal, dass Ivy ihre Mutter sah.
Teil IZwölf Jahre, zehn Monate und dreizehn Tage danach
Kapitel 1
Es ist leicht, in New York verloren zu gehen.
Zu weitmaschig ist das Gitternetz der Straßen, perforiert von Durchgängen, die man erst auf den zweiten, den dritten Blick entdeckt. Zu gleichförmig sind die Gesichter der Häuserblöcke. Die Fassaden der Wolkenkratzer verschachteln sich zu einem verwirrenden Spiegelkabinett, und unter der Erde verzweigt sich das Labyrinth der Subway in alle Dimensionen.
In den Nächten verpixeln Myriaden von Lichtern die Finsternis. Gerade eine Handvoll davon ist charakteristisch genug, um als Signalfeuer zu dienen: One World Trade Center. Das Chrysler und das Empire State Building. Der Pool von Neonreklamen und LEDs am Times Square und das Logo von Pepsi-Cola auf der anderen Seite des East River, in Long Island City.
Zu gewaltig ist das Meer aus Menschen, das durch die Straßen schwappt. Und mit seinem Rhythmus von Ebbe und Flut wird auch das Treibgut auf Bahnsteigen und Bordsteinen angespült.
Stehen gelassene Regenschirme und vergessene Mäntel. Herausgerutschte Brieftaschen. Schlüsselbünde, die sich durch ein Loch in der Jackentasche gearbeitet haben. Hunderte von Mobiltelefonen jedes Jahr, die genauso unbemerkt aus einer Tasche geglitten sind wie Brillen mit und ohne Etui. Fast jede Woche finden sich irgendwo ein Zahnersatz, ein Hörgerät und manchmal auch eine verwaiste Beinprothese. Ein Geigenkasten, in der Eile oder in geistesabwesendem Zustand liegen geblieben, vielleicht auch in der Absicht, das verhasste Instrument loszuwerden.
Der Sommer bringt jedes Jahr wieder ein angelehntes und dann vergessenes Surfbrett. Vor Weihnachten stauen sich Berge von im Trubel untergegangenen Einkaufstüten an, und den ganzen Winter über verwandeln sich die Gehwege in einen Friedhof einzelner Handschuhe und herabgerutschter Schals.
Die Schuhe nicht zu vergessen. Unzählige Schuhe, die ständig überall in der Stadt stranden, partner- und herrenlos.
New York ist die Stadt von wasuremono – der japanische Ausdruck für alles, was irgendwo vergessen und liegen gelassen wurde. Was verloren ging.
Selbst der Central Park, der von oben betrachtet wie ein Schwimmbecken voll Moos inmitten von Manhattan liegt, ist ein Irrgarten aus verschlungenen Wegen und Baumwällen.
Umso konzentrierter wirkt Moe, während er mit einem gemächlichen Schritt nach dem anderen den Pendelbewegungen seines Besens folgt. Wie der Welt der Flaneure und Jogger entrückt und doch ganz im Hier, im Jetzt.
Moe ist einer der Letzten seiner Art, in diesem Amt langsam grau geworden und nach eigenem Bekunden um den Bauch herum ein paar Pfund zu schwer. Irgendwann in naher Zukunft wird auch er von einer der dröhnenden Maschinen ersetzt werden, die bürstend und saugend die Straßen und Gehwege bearbeiten. Die Folien von Schokoriegeln, die Papierservietten und Laubblätter, die sie dabei hinter sich zurücklassen, verärgern nicht wenige New Yorker, aber das ist der Preis des Fortschritts.
Noch gibt es Straßenkehrer wie Moe. Eine Insel der Ruhe in der Hektik der Stadt. Die Verkörperung einer unerschütterlichen Gelassenheit, wie sie nicht einmal mehr bei buddhistischen Mönchen zu finden ist, die in wehenden gelben Gewändern und mit Stressschweiß auf der Stirn durch die Straßen Chinatowns hasten.
Der Anblick Moes beflügelt jedes Mal Ivys Schritte, wenn sie ihn in seiner Uniform aus tannengrünem Kapuzenpullover, Cargohose und groben Schnürstiefeln entdeckt.
Heute bietet er einen surrealen Anblick, wie er da auf einem See aus rosafarbenen Blüten zu schweben scheint.
»The darling buds of May«, verkündet seine volltönende Stimme, jede Silbe mit einem feierlichen Nachhall versehend.
Moe ist ein Fan von Shakespeare. Er ist der Sound, der Rhythmus; Shakespeare war für ihn der erste Rapper.
Wenn Moe lächelt, entfaltet sich ein Fächer lebensweiser Linien unter seinen Augen. Trotz der Melange aus Salz und Pfeffer in seinen kurz geschorenen Haaren und im Stoppelbart mag man kaum glauben, dass er schon jenseits der sechzig ist und Großvater von Schulkindern.
Ivys Blick fängt sich an dem Hügel aus Blüten, den Moe bereits zusammengekehrt hat.
»Schade um diese Pracht«, murmelt sie.
»Sie werden so oder so schnell braun. Und es kommen noch genug nach. Wie hast du letzten Frühling dazu gesagt? Etwas Japanisches.«
»Hanami«, erwidert Ivy. »Sich an der vergänglichen Schönheit der Blüten erfreuen. Oder aware. Das Gefühl, wenn man weiß, dass ein besonderer Augenblick nicht von Dauer sein wird. Wie die allerersten Tage des Frühlings, bis man das Grünen und Blühen als selbstverständlich hinnimmt. Die letzten Tage des Sommers, wenn schon etwas vom Herbst zu ahnen ist.«
Wie Moe hebt sie die Augen zu dem Gewölbe aus blühenden Kirschzweigen über ihnen, ein ätherisches Gebilde aus Farbe und Duft.
»Ich habe mich immer gefragt, warum ausgerechnet das Japanische solche Worte kennt. Für die Poesie des Kleinen, Wunderbaren. Für das, was so schnell wieder vergeht. Warum sind diese Worte in anderen Sprachen so selten?«
Moe gibt ein scharfes Auflachen von sich, in dem sein gutmütiges Wesen durchklingt; bei ihm ein Ausdruck von Zustimmung oder Verwunderung, manchmal beides zugleich.
Mit andächtiger Miene nimmt er mit seinem Besen wieder den gleichmäßigen Rhythmus auf und verwirbelt Blütenfontänen wie Konfetti. Wann immer Sonnenstrahlen sein dunkles Gesicht streifen, schimmert es auf wie gealtertes Kupfer.
Moe hält inne und stützt sich auf dem Ende des Besenstiels ab.
»Vielleicht ist das so, weil es den meisten Menschen leichter fällt, solche Dinge nur zu umschreiben. Wenn es kein Wort dafür gibt, ist es nicht Teil unserer Welt. Dann kann man vergessen, dass nichts ewig ist.«
Sie tauschen ein Lächeln, das lange anhält, keine Worte mehr braucht.
Moe weiß um jenen Tag, als Ivy zehn Jahre alt war und ihr Leben implodierte. Als ihre Mutter verschwand, ohne Nachricht, ohne Ankündigung, ohne irgendetwas, das das Dunkel vielleicht erhellt hätte. So wie Ivy um den Krebs weiß, der Moes Frau Janet von innen her auffraß und ein großes Stück seines Lebens mit fortriss, was weder die Zeit noch die Kinder und Enkel zu heilen vermochten.
Moe deutet auf Ivys Umhängetasche.
»Hattest du heute Glück?«
Ivy wickelt ihren Fund behutsam aus einem der Stoffbeutel, die sie immer bei sich trägt. Auf der flachen Hand hält sie Moe den kleinen Walfisch aus blau schillerndem Glas entgegen, der seine Schwanzflosse in einem eleganten Bogen hochreckt.
Moe hebt die ergrauten Brauen. »Was sagt man dazu?«
Zwischen den Kaffeebechern und Sandwichverpackungen, die es nicht bis zum nächsten Mülleimer geschafft haben, sieht Moe selbst jeden Tag, was alles unbemerkt fallen gelassen oder vergessen wird. Bei Spiel und Spaß und Sport, in Lunchpausen und auf Wochenendpicknicks, in geselligen, romantischen und manchmal schicksalhaften Momenten.
Eine Jacke, in den ersten warmen Sonnenstrahlen ausgezogen und dann auf dem Rand des Springbrunnens liegen gelassen. Ein abgeliebter und sicher schmerzlich vermisster Plüschbär. Eine langstielige Rose, einsam auf einer Parkbank zurückgeblieben.
Er versteht Ivys Streifzüge durch die Stadt, auf der Suche nach Dingen, die verloren gegangen sind; die auf Parkbänken, Treppenstufen, Bordsteinen ausgesetzten Taschenbücher füllen Moes Bücherregale zu Hause in Queens. Ihm sind die Unterscheidungen nicht fremd, die Ivy zwischen dem Sweater eines Billiglabels und einem kunstvoll handgestrickten Pullover macht, der irgendwo vergessen worden ist. Zwischen den Tassen, Baseballkappen und Schirmen mit I love NY, die dutzendfach auf den Gehwegen enden, und einem handgefertigten Ohrring aus Silber am Rand eines Gullys.
Ivy geht es um das Einzigartige, Unersetzliche. Um die Bedeutung, die es für den Menschen haben mag, der es verloren hat.
Ein präparierter Kugelfisch.
Wheelers Zahnatlas in der 4. überarbeiteten Auflage von 1969.
Eine Langspielplatte der Bee Gees.
Ivy weiß, dass sie jedes dieser Stücke ins Fundbüro bringen sollte. Sie erträgt nur die Vorstellung nicht, diese Schätze zwischen den Fluten aus Mobiltelefonen, Geldbeuteln und Kleidungsstücken verschwinden zu sehen. Der Gedanke, dass sie womöglich niemals abgeholt werden, weil ihr Verlust zu lange unbemerkt geblieben ist, tut ihr in der Seele weh.
Deshalb hat Ivy für sich Regeln aufgestellt.
Keinen Gegenstand von Alltagsnutzen mitnehmen und nichts von hohem materiellem Wert.
Immer erst eine gewisse Zeit warten, ob der Besitzer zurückkehrt.
Den Fund an Ort und Stelle fotografieren und die genaue Lage notieren.
Die Kleinanzeigen der Zeitungen und im Internet im Auge behalten, ob jemand ein solches Objekt als vermisst meldet.
Bis dahin weiß Ivy jedes davon in ihrem Apartment gut aufgehoben.
»Was glaubst du, ist seine Geschichte?«, fragt Moe mit einem Blick auf die Glasfigur in Ivys Hand.
Alles Verschollene hat seine eigene Geschichte.
Kennedys Gehirn, das seit 1966 vom Nationalarchiv in Washington vermisst wird, und Mozarts Schädel.
Das Bernsteinzimmer und sieben der prunkvollen Fabergé-Eier aus dem Zarenschatz.
Die Männer, Frauen und Kinder der Kolonie von Roanoke in North Carolina und die Besatzung der Mary Celeste, die 1872 als Geisterschiff im Atlantik trieb.
Flug MH370 von Malaysia Airlines und Amelia Earhart, die mit ihrer Lockheed Electra über dem Pazifik verloren ging.
Ungelöste Rätsel, noch unerzählte Geschichten.
»Seine Geschichte?«
Ivy betrachtet den kleinen Wal, geformt wie ein Tropfen Wasser oder die Träne eines Riesen, sein Glasbauch warm von ihrer Hand.
Moe mag die Geschichten, die Ivy um diese herrenlosen, von ihr gefundenen Dinge spinnt.
Wie die Geschichte des japanischen Sushi-Meisters, der sich zu seinem ersten Arbeitstag im neuen Restaurant aufmachte. Sein Talisman, ein präparierter Kugelfisch, sollte dort einen besonderen Platz bekommen. Tapfer schirmte er das ebenso stachelige wie fragile Objekt in seinen Händen vor dem Gedränge in der Subway ab. Ein Ellbogenstoß in den Rücken genügte jedoch, und der Kugelfisch entglitt ihm gerade in dem Moment, als der Zug in der Spring Street Station zum Stehen kam und die Menschenmenge sich auf den Bahnsteig ergoss. Der Kugelfisch verhakte sich hier in einem Schal, dort in einem Mantelstoff und schaukelte von Schulter zu Schulter. Ein Spielball der kinetischen Energie einer Rushhour, bis der Sushi-Meister, im vorwärtsströmenden Getümmel hilflos eingekeilt, ihn aus den Augen verlor. Wohlbehalten und mit nur zwei abgeknickten Stacheln landete der Fisch in einem dunklen Winkel unter der Treppe der Subway station, wo Ivy ihn am 8. November 2014 fand.
Wheelers Zahnatlas gehörte vielleicht einem Zahnarzt, der sich seit seiner Pensionierung mit der Frage beschäftigte, wie sich der Charakter eines Menschen aus seiner Zahnform ableiten lässt. In einen kniffligen Punkt seiner Theorie vertieft, schreckten ihn schrilles Hupen und Bremsenkreischen auf, und begleitet von den Flüchen eines Taxifahrers hastete er weiter über die Straße. Erst etliche Häuserblocks später, als das Adrenalin in seinen Adern sich langsam wieder verflüchtigt hatte, fiel ihm auf, dass er den Zahnatlas nicht mehr unter dem Arm hielt. Ohne dass er sich daran erinnern konnte, in welcher Straße er fast unter das Yellow Cab geraten wäre. Es war die Fulton Avenue, wo Ivy den mitternachtsblauen Band am 30. September 2011 aus dem Rinnstein auflas.
Zu You Win Again oder Overnight von den Bee Gees hatten sich vielleicht ein Junge und ein Mädchen das erste Mal geküsst, damals, 1987, und sich dann aus den Augen verloren. Dreißig Jahre später, längst war er ein gestandener Mann und sie eine erwachsene Frau, saßen sie am Bethesda Fountain und schwelgten in Erinnerungen, und die Plattenhülle, ausgeblichen und mit abgestoßenen Kanten, wanderte in ihren Händen hin und her. Irgendwann legten sie die Platte zur Seite und wandten sich der Gegenwart zu, schlenderten gemeinsam durch den Park, auf einen Kaffee, dann zum Dinner. In der vagen Ahnung einer Zukunft, mit Herzklopfen und Schmetterlingen im Bauch.
Eine der Geschichten, die Moe am besten gefallen hatten, nachdem Ivy die Langspielplatte vom Rand des Brunnens mitgenommen hatte, unter den wachsamen Augen seines Bronzeengels, an einem sonnigen Maitag wie diesem.
Ivy schließt die Hand um den kleinen Wal aus Glas.
»Seine Geschichte kenne ich noch nicht.«
Ein geheimnisvolles Lächeln spielt um ihren Mund, als sie ihn sorgfältig wieder einwickelt und in ihre Tasche steckt.
»Vielleicht kann ich sie dir nächstes Mal erzählen.«
Während die Sonne den letzten Rest von Morgenkühle zum Schmelzen bringt, lässt sich Ivy weiter durch den Park treiben, zwischen Softballspielern und Frisbeewerfern und Skatern, Seifenblasenkünstlern und Breakdancern. Das Hufklappern der Kutschpferde mischt sich mit jazzendem Saxofon und Cello, und eine Gruppe Filmstudenten macht sich daran, mit Kamera und Stativ eine Szene zu drehen, in der einem ausgestopften Fuchs offenbar eine tragende Rolle zukommt.
Hinter der nächsten Gabelung versperrt eine Menschentraube den Weg. Ivy will schon umkehren, als ihr Blick am Zentrum der Aufmerksamkeit hängen bleibt.
Zwischen Jeansbeinen, Jogginghosen und den ersten Shorts lockt ein verwinkeltes Labyrinth den Betrachter in die Tiefe, in der sich Schlangen und Drachen winden und ein Phoenix seine Schwingen ausbreitet.
Nur gemalt natürlich. Aber beeindruckend real in seiner Dreidimensionalität. Durch die Lebendigkeit der Farben, die plastischen Details.
Eine unwiderstehliche Anziehungskraft geht davon aus, der Ivy sich willig überlässt.
Ein langhaariger Teenager in Sweatshirt und Trekkinghosen lässt sich dabei fotografieren, wie er mit panischer Miene und rudernden Armen in das Labyrinth zu stürzen scheint.
Ein Mädchen in Jeansshorts und Strickpulli löst ihn ab und geht über der Pflastermalerei lachend in die Hocke; Ivy kann sich das Bild vorstellen, auf dem sie sich später auf dem Rücken des Phoenix in die Luft erhebt.
Leise lächelnd staunt Ivy über dieses verblüffende Spiel mit der Perspektive, das ihre Wahrnehmung, ihren Orientierungssinn austrickst.
»Gefällt es dir?«
Die Männerstimme neben ihr ist lebhaft und warm. Eine Stimme wie ein Sonnenaufgang im Sommer, genauso freundlich, genauso erwartungsvoll.
Ivy nickt, noch immer im Sog der Tiefe gefangen.
»Es ist nur ... So viel Arbeit steckt darin, und in ein paar Stunden ist es schon verwischt, nach ein paar Tagen verblasst. Spätestens der nächste Regen wird es auslöschen.«
Überdeutlich ist Ivy sich ihrer dunklen und rauchigen Stimme bewusst; eine Stimme, die zu einer wesentlich älteren, größeren und robusteren Person zu gehören scheint.
»Das ist der Clou daran. Das Wissen um die Vergänglichkeit. Bilder im Museum sind für die Ewigkeit gemalt. Das macht sie unantastbar und schafft eine ehrfürchtige Distanz. Aber das hier ... Gerade dadurch, dass es nicht von Dauer ist, lädt es zum Mitmachen ein.«
Die Faust geballt, wirft sich gerade ein junger Vater in Pose, seinen vergnügt krähenden kleinen Sohn unter den Arm geklemmt, während die Mutter versucht, ihr Handy im optimalen Winkel auszutarieren, um für das Familienalbum ihren Superman als heldenhaften Retter aus dem Labyrinth fliegen zu lassen.
»Diesen Moment nehmen sie von hier mit. Das Staunen. Die Freude an der Illusion und am Spiel damit. Jede dieser Straßenmalereien wird in Dutzenden von Fotos überdauern, noch lange nachdem der Regen oder die Straßenreinigung sie weggewaschen hat. Und mit diesen Fotos bleiben genau solche Momente wie dieser in Erinnerung. Nur darauf kommt es an.«
Fortwährend in Bewegung ist das Gesicht, das zu dieser Stimme gehört. Der geschmeidige Mund. Die Grübchen, eine Aufreihung von Kerben, die sich neben den Mundwinkeln auffächern, während er spricht, und ihm etwas Pfiffiges verleihen. Die hellen Brauen über der Hornbrille, ein seltsam strenger Rahmen für seinen quecksilbrigen Blick. Ein fast jungenhaftes Gesicht, wäre die Kinnlinie nicht so kantig und so scharf gezeichnet.
Ein Lächeln öffnet sich auf diesem Gesicht, und er streckt Ivy seine Rechte entgegen.
»Jack. Jack Savant.«
Er ist nicht viel älter als Ivy, zwei oder drei Jahre vielleicht, und kaum einen halben Kopf größer. Auf drahtige Art sportlich, in seiner froschgrünen Kapuzenjacke, dem T-Shirt, das vielleicht einmal rot war oder schon immer diese verwaschene Farbe zwischen Orange und Rosa hatte.
Mit seinen kurzen sandblonden, wie vom Wind zerzausten Haaren scheint er weniger in diese Stadt zu gehören als vielmehr an die Küste. Nach Rhode Island vielleicht, nach Florida oder Kalifornien, sein Englisch ist zu glatt, als dass Ivy es irgendwo verorten könnte.
Etwas Leichtes und Fröhliches geht von ihm aus, eine Aura von Sonne und Meer, die ihn wie mit einem Goldschimmer umgibt.
Dagegen kommt Ivy sich vor wie eine blasse Mondsichel, die finstere Nacht im Rücken. Ein Geschöpf der Großstadt, zwischen Bibliotheken und Buchhandlungen großgezogen.
Plötzlich eingeschüchtert, vergräbt sie die Hände tiefer in den Manteltaschen.
»Ivy.«
Der Name Silvergren ist zu selten, um in dieser Stadt nicht sofort mit dem Schriftsteller in Verbindung gebracht zu werden, für seinen Roman Watershed mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Mit dem Vermisstenfall Lila Silvergren, der lange genug die Medien beherrschte und unvergessen ist, auch mehr als ein Jahrzehnt danach.
Wann immer Ivy kann, verzichtet sie darauf, ihren Nachnamen zu erwähnen.
Jacks Blick fällt auf seine Hand, die regenbogenbunt ist vom Kreidestaub. Keineswegs beleidigt, dass Ivy seinen Handschlag verschmäht, lacht er auf und klopft sich die Finger an seiner ausgefransten Jeans ab.
Hinter den Brillengläsern sprühen seine Augen blaue Funken, als er mit einer Kopfbewegung auf das Labyrinth deutet.
»Soll ich ein Foto von dir machen?«
Ivy schüttelt den Kopf und weicht zurück.
Mehr als die Hälfte ihres Lebens ist sie schon das Mädchen, dessen Mutter verschwand. Ein Zeichen auf ihrer Stirn, das neugierige und mitfühlende Blicke auf sich zieht, gut gemeinte Bemerkungen aus dem ganzen Spektrum menschlicher Trostworte und oft genug ein Wispern hinter ihrem Rücken.
Seitdem schreckt Ivy vor der leisesten Aufmerksamkeit zurück.
»Hast du heute noch etwas vor?«
»Ja«, antwortet Ivy mechanisch, wie immer in solchen Situationen, auch wenn sie erst am Spätnachmittag nach Brooklyn hinüberfahren wird.
»Schade.«
Obwohl in seinen Mundwinkeln noch ein Grübchenlächeln tanzt, verglimmt das Funkeln in seinen Augen. Plötzlich passt die massive Brille in sein Gesicht, wie eine Blende für seinen fokussierten Blick.
»Weißt du, was mich ins Grübeln bringt? Du ziehst die Schultern hoch und duckst den Kopf, als ob du dich am liebsten unsichtbar machen würdest. Und trotzdem trägst du einen roten Mantel. Als hättest du Angst, in der Stadt verloren zu gehen. Oder als wünschtest du dir, gefunden zu werden.« Obwohl sie sonst nicht auf den Mund gefallen ist, wenn es darum geht, Grenzen zu ziehen und sich abzuschotten, fehlen Ivy die Worte. Mit heißen Wangen sieht sie ihm stumm hinterher, wie er zu seinem Labyrinth und den Schachteln mit Malkreide zurückkehrt.
Die Hände in den Hosentaschen, vollführt er im Gehen auf seinen abgewetzten Chucks eine halbe Drehung.
»Bis bald, Ivy ohne Nachnamen!«
Sein Lächeln ist wie ein Sonnenstrahl, der durch Wolken bricht.
Kapitel 2
Ein junges Paar in zerrissenen Jeans und Lederjacken über den T-Shirts verharrt vor dem Reihenhaus aus Sandstein. Er mit buschigem Bart und Haarknoten, sie mit der duftigen Mähne, die Shampoo-Werbespots versprechen. Tuschelnd sehen sie zu den Fenstern hoch.
Schließlich wagen sie sich die Stufen hinauf, zwischen die liebevoll arrangierten Grünpflanzen in Tontöpfen, und knipsen aneinandergelehnt ein Selfie.
Ivy wartet ab, ob sie forsch genug sind, um an der Tür zu klingeln, in der Hoffnung auf ein Autogramm, ein paar Worte und einen Händedruck, vielleicht sogar ein gemeinsames Foto. Doch sie gehen weiter, die Köpfe über dem Handy zusammengesteckt. Mit einem Filter aufgehübscht, wird die Aufnahme sicher heute noch in die Welt hinausgeschickt werden und weitere Pilger nach sich ziehen.
Richard Silvergrens Bücher sind Kult. Niemand gräbt tiefer in den menschlichen Dramen von Krisen und Traumen und fördert dabei so viel literarisches Gold zutage.
Noch eindringlicher, noch aufsehenerregender durch die Parallelen zur Biografie des Autors. Den Brandgeruch eines dunklen Geheimnisses.
Es ist ein makabres Bündnis, das Tragödie und Ruhm miteinander eingegangen sind.
Joy öffnet die Tür, proper wie üblich in einer Folklorebluse und Edeljeans. Fast mädchenhaft sieht sie aus, mit ihrem Kurzhaarschnitt in der Farbe von Toffee. Auch nach vier Jahren ist es manchmal noch befremdlich für Ivy, dass Joy nur wenig älter ist als sie selbst, gerade dreißig geworden.
Ihre lichtbraunen Augen glänzen, als sie Ivy in die Arme schließt und in den Duft von italienischen Kräutern, warmem Brot und Hilfiger-Parfum hüllt. Sie hat gelernt, Ivy dabei nicht zu fest zu umschlingen. Wie Ivy gelernt hat, solche herzlichen Gesten von Joy anzunehmen.
Sie findet ihren Vater im Wohnzimmer, wo er sich aus den Zeitungsseiten erhebt, die er um sich ausgebreitet hat; früher haben sie samstags zusammen das knifflige Kreuzworträtsel der New York Times gelöst. Die Lesebrille auf dem Tisch ist das einzige Zugeständnis, das er bisher machen musste, seit er die fünfzig überschritten hat.
Sein schroffes Gesicht bleibt stoisch, während sich die wolkengrauen Augen aufhellen.
Eine kraftvolle Präsenz ist er, selbst in diesem großzügigen, lichtdurchfluteten Raum; einer dieser Männer, die mit den Jahren nicht weicher, sondern kantiger werden. Noch immer absolviert er morgens seine Joggingstrecke am Fluss entlang, durch den Brooklyn Bridge Park, und manchmal auch nachts. Es ist seine Art, zu meditieren und sich gleichzeitig einen Adrenalinkick zu holen.
Die Hände auf den Oberarmen des anderen, berühren sich kurz ihre Wangen, dann ruft auch schon Joy nach ihnen, zu Antipasti, Saltimbocca und Risotto alla milanese. Zu Dialogen über das Geschehen in der Welt und in den Vereinigten Staaten, das momentan so viel Gesprächsstoff bietet, abgerundet durch literarische Neuerscheinungen und die jeweils aktuelle Lektüre.
Jenseits der Fenster liegt der Garten bereits im Dunkeln, als Ivy mit ihrem Glas in das Wohnzimmer zurückkehrt und die Zeitungen behutsam zur Seite schiebt, um sich zu setzen. Während ihr Vater und Joy zwischen Küche und Esszimmer pendeln, dringen mit dem Klappern von Geschirr und Besteck ihre Stimmen herüber; klar und sprudelnd die von Joy, tief und résonant die ihres Vaters.
Eine Stimme wie ein Cello, schwärmte eine Journalistin einmal anlässlich eines seiner raren Interviews; Presse und Öffentlichkeit gegenüber ist er misstrauisch geworden, seit damals.
Im Lampenlicht hat der hohe Raum in Weiß und Creme etwas von einem golddurchwirkten Kokon. Gekonnt und wie beiläufig sind die gerahmten Bilder auf dem Kaminsims gruppiert, die Briefbeschwerer und kleinen Statuen zwischen den Büchern, mehr Kunst als Kitsch. Wie sich auch die Ethnoteppiche und die Glaskrüge mit Hortensien auf halbem Weg zwischen sophisticated und bodenständig bewegen; typisch für Joy, typisch für dieses Viertel.
Back to the roots, kommentierte die Vanity Fair die Rückkehr Richard Silvergrens auf die andere Seite des East River; als Kapitulation vor dem Mainstream kritisierte sie der Rolling Stone. Denn Brooklyn Heights mit seinen jetzt im Mai blühenden Bäumen ist nicht gleich Brooklyn. Namen wie Pineapple und Cranberry Street, verspielte Cafés, nostalgische Pubs und exquisite Japan-Restaurants haben nichts mit der rauen Realität von Brownsville und Crown Heights zu tun, die den jungen Richard Silvergren formte und der er in City of Fear und Brooklyn Vortex ein Denkmal gesetzt hat.
Für Ivy ist das Haus in der Willow Street nie mehr als eine vorübergehende Bleibe an Feiertagen und in den Ferien gewesen. Das Gefühl von Geborgenheit, das aus einem festen Dach über dem Kopf erst ein Zuhause macht, war schon verloren gegangen, bevor ihr Vater das Apartment im Village aufgab.
Die Weinflasche in der Hand, kommt er herein und schenkt Ivy nach.
»Was macht die Arbeit?«
Er hört gern von den kuriosen Dingen, die sie bei ihren Recherchen aufliest, ohne dass sie dabei Genaueres über ihr aktuelles Projekt verrät. Die Autoren und Professoren, Filmemacher und Künstler, für die sie in Archive und Bibliotheken eintaucht, verlassen sich auf Ivys Verschwiegenheit.
Falls ihr Vater enttäuscht ist, dass ihrer Neugier und Beharrlichkeit, ihrem Spürsinn nichts Kreativeres entspringt als Exceltabellen und zusammenfassende Berichte, so lässt er es sich nie anmerken.
Fern erscheint er ihr heute, während Ivy von Byssus erzählt, der aus den Filamenten einer Muschelart gewonnenen Meeresseide, die heute nur noch auf einer Insel Sardiniens gewoben wird, und von den grünen Sittichen in Tamil Nadu, die Orakelkarten mit ihren Schnäbeln ziehen.
Mit seinem Glas im Sessel zurückgelehnt, ist er genau jener Mann auf Buchumschlägen, in Zeitungen und Magazinen. Sein Gesicht ist das eines geborenen Skeptikers und wirkt sogar dann melancholisch, wenn sich ein Lächeln darauf andeutet. Ein Großstadtcowboy in schwarzem T-Shirt und Jeans, der noch auf Fotografien die beißende Note von Nachtclubs und Bars zu verströmen scheint.
Mächtig und überlebensgroß ist der Schatten seines literarischen Schaffens, vor dem es kein Entkommen gibt. Nicht für Ivy, nicht für Joy, noch nicht einmal für ihn selbst.
»Und bei euch?«
Sein Blick richtet sich abwägend und wie schuldbewusst auf sie. Mit einem Räuspern setzt er sich auf und fährt sich durch die zurückgekämmten Haare, die noch immer braun sind, aber gerade den ersten Grauschimmer zeigen.
»Ich muss etwas mit dir besprechen.«
Ivy umklammert ihr Glas.
Auch vor diesem Schwarzen Loch gibt es kein Entrinnen, unnachgiebig hält es sie in seinem Gravitationsfeld. Beide balancieren sie auf seinem Ereignishorizont, ohne sich jemals aus seinem Sog befreien zu können.
»Gibt es Neuigkeiten?«
Regelmäßig haben in den ersten Monaten Polizeibeamte vor der Tür gestanden. Mit einem in Plastik verpackten Kleidungsstück oder einem persönlichen Gegenstand, an einem Tatort aufgefunden. Mit dem Foto eines festgenommenen Vergewaltigers, eines Mörders, auf der Suche nach einer Verbindung, einem Muster. Mit dem unscharfen Standbild einer Überwachungskamera oder der Nachricht, dass jemand Lila Silvergren gesehen haben wollte, in Harlem, in Louisiana, in Alaska.
Besuche, deren Häufigkeit mit der Zeit und schwindender Wahrscheinlichkeit abnahm, von Telefonanrufen ersetzt wurden, schließlich versiegten.
Hartnäckiger zeigten sich die Privatdetektive, die Hellseher und Kartenleger, die ihre Dienste aufdrängten. Die Leute, die Lila Silvergren in einer Kommune in Idaho zu wissen glaubten. In einer Bar in Cancun. Im Keller des ohnehin immer schon suspekten Nachbarn festgehalten. Vom Geheimdienst oder von Außerirdischen gekidnappt.
Ein nicht enden wollender Strom an E-Mails, an Flyern und Briefen, der zusammen mit Beileidsbekundungen und Ratschlägen Wildfremder ständig den Briefkasten verstopfte. Erpresserschreiben, mit denen Trittbrettfahrer aus der Tragödie Kapital zu schlagen versuchten. Hassbriefe und Drohanrufe; Liebeserklärungen und Heiratsanträge, auf ihre eigene Weise nicht weniger abscheulich.
Einblicke in die Verdrehtheit des menschlichen Geistes, in seelische Abgründe und die Hässlichkeit der Welt, vor denen ihr Vater sie nur unzureichend schützen konnte.
Keine einzige Spur führte zu Lila Silvergren.
Es waren immer andere Hinterbliebene, deren Warten, deren Fragen ein Ende fanden. Andere waren es, die anfangen konnten, zu trauern und mit dem Schmerz zu leben, der nicht aufhören würde, aber endlich eine Form bekam und fassbar wurde.
Die hässlichste Art von Neid, die man sich vorstellen kann.
Die Hoffnung hat überlebt. Auf den einen Brief, den einen Anruf, den einen Besuch der Polizei, der endlich Gewissheit bringt. Mit menschlichen Überresten, einem Geständnis oder auch nur dem Hinweis, dass ihre Mutter doch noch irgendwo auf dieser Welt ist, unter einem anderen Namen, in einem anderen Leben.
Die grausamste Art von Hoffnung, die es gibt.
»Nein. Nichts von Lila. Aber darum geht es.«
Die Stirn in Falten gelegt, stellt ihr Vater das Glas ab und knetet seine Hände. Ivy sieht ihm an, wie sehr es ihn nach einer Zigarette verlangt, an der er sich festhalten, Zug um Zug das Unvermeidliche hinauszögern kann.
»Joy und ich wollen heiraten.«
Keine überraschende Nachricht, aber durch die Umstände unwirklich und für Ivy wie ein Tritt in die Magengegend.
»Du bist verheiratet.«
Mit einem Geist, der ruhelos umgeht und ihnen beiden genauso wenig Frieden gönnt.
»Joy wünscht sich ein Baby.«
Das Vakuum, das ihre Mutter hinterlassen hat, hat ihrer beider Leben eine andere Gestalt aufgezwungen. Ivy ist nur nicht bewusst gewesen, wie sehr Joy das Leben ihres Vaters noch einmal neu geformt hat.
»Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht.«
Seine Stimme klingt heiser, wie in langen Debatten abgenutzt.
»Aber ich will endlich klare Verhältnisse.«
In all den Jahren, in denen Freunde und Bekannte sich vorsichtig nach dieser Möglichkeit erkundigten, Polizeibeamte und Anwälte ab einem gewissen Zeitpunkt ebenso taktvoll wie routiniert dazu rieten, wollte er davon nichts wissen. Und nun hat er sich doch dazu entschlossen, das Warten und Hoffen in einem Akt der Willkür zu beenden. Das ungewisse Schicksal ihrer Mutter zu besiegeln, auf dem Papier eines Gerichtsdokuments.
»Es sind bald dreizehn Jahre«, sagt Joy leise von der Tür her. »Ihr müsst endlich damit abschließen können.«
Ivy nimmt sie kaum wahr, sie ist ganz auf ihren Vater fixiert.
»Du kannst sie doch nicht einfach aufgeben«, flüstert sie mit enger Kehle.
Wie aus Stein gemeißelt ist sein Gesicht, während seine Augen wund wirken; eine alte Verletzung, die langsam zu vernarben beginnt.
»Lila kommt nicht wieder, Ivy. Und ich verdiene diese Chance auf einen Neuanfang.«
Im Tunnel der Subway, tief unter Wasser und Fels, ist die Schwerkraft eine andere, turbulent und manchmal geradezu durchlässig. Das Rattern und Dröhnen, Klappern und Kreischen betäubt die Sinne; die hallenden Durchsagen, halb nach Mensch, halb nach Roboter klingend, verfremden die Wirklichkeit.
Ivys Blick bleibt an ihrer Spiegelung hängen. Im schmutzigen Kunstlicht lässt der rote Mantel ihre Haare kupfern schimmern, wie früher.
Erdbeerblond hatte ihre Mutter dazu gesagt, immer poetisch, immer wortmalerisch.
Manchmal kann sie Lilas Hände noch fühlen, wie sie über ihr Haar strichen und es mit den Fingern teilten, um die Zöpfe zu flechten, die Ivy als kleines Mädchen trug, oder die ein Gummiband um den Pferdeschwanz schlangen, ihr Flüsteratem dicht an Ivys Ohr, ihr gehauchtes Lachen.
Nie hat Lila gesehen, wie dieses rötliche Blond nach und nach zu einer Farbe wie Flachs ausblutete. Wie die Sommersprossen verblassten und mit der hellen Haut verschmolzen, während das zarte Gesicht kühnere Linien ausbildete. Sie hat nicht miterlebt, dass die Zahnspange zwei Reihen perfekter Zähne hinterließ, aber auch die Spur eines Lispelns. Wie der strahlende Kinderblick zu blauem Eis erstarrte.
Vor den Betonwänden und Stahlpfeilern rollt Ivys transparentes Spiegelbild vorüber. Ein Film in Endlosschleife, von dem Mädchen, das sie war, bis zu der Frau, zu der sie reifen wird, in zehn, in zwanzig Jahren.
Solange der Zug in seinem Luftstrom durch den Tunnel rauscht, scheint der Lauf der Zeit aufgehoben. Ein Raum für sich, in dem die Grenzen zwischen Niemals, Vielleicht und Immer zerfließen.
Fünfundvierzig Jahre alt ist ihre Mutter jetzt. Wäre es seit November.
Du musst loslassen, hat Joy ihr zugeflüstert, in einer Umarmung, die warm und weich war wie Joy selbst.
Ivy weißt nicht, wie das gehen soll. Ohne das Gleichgewicht zu verlieren und in das Schwarze Loch zu stürzen, um das ihr Leben kreist.
Oberhalb der feuchtheißen Subwaystation glitzert die City und pulsiert in ihrem gewohnt atemlosen Takt. Ein Lichtermeer, aufgewirbelt von der Energie der Samstagnacht.
In Wellen schlagen Gelächter und ausgelassene Stimmen über dem tosenden Verkehr zusammen. Lockrufe an das Leben, nach Vergnügen und Flirts, vielleicht sogar einer Romanze. Eine Sprache, die Ivy nicht beherrscht; um diese Zeit sind die Straßen wie eine fremde Galaxie für sie.
Die Schultern hochgezogen und die Hände tief in den Manteltaschen vergraben, eilt sie durch die Mulberry Street. Nicht am schicken Ende, wo die neuesten Trends, ethisches Bewusstsein und Parte di vivere Zusammentreffen, sondern in der Nähe des Columbus Park, wo sich unter Sternenbannern und italienischen Trikoloren chinesische und japanische Schriftzeichen aneinanderdrängen, vietnamesische und nepalesische.
Zwischen der Granitfassade der Bank, die in ihrem Namen einen Brückenschlag zwischen Ost und West verspricht, und dem Obst- und Gemüseladen, der auch taiwanesischen Bubble Tea vertreibt und Essensmarken der Lebensmittelhilfe akzeptiert, schließt Ivy die verbeulte Aluminiumtür auf. Im Dunst von Frittierfett und einer dissonanten Gewürzmischung hastet sie die Treppe hinauf, verfolgt von den Knallgeräuschen und konfusen Stimmen eines asiatischen Actionfilms und dem Protestkreischen eines Kleinkinds.
Nüchtern ist Ivys Apartment im ungefilterten Licht der Glühbirne. Die Kammer einer Nonne, in der nichts Verspieltes die strenge Ordnung entschärft, nichts Unnützes den Blick einfängt.
Du hast doch dein eigenes Leben, hat ihr Vater nach dem letzten Schluck Wein gesagt, bevor Ivy in den Mantel geschlüpft ist.
Alles, was Ivys Leben ausmacht, passt auf diese fünfhundert Quadratfuß, zwischen Nasszelle und Kochnische. Ordner voller Zeitungsartikel, nach Jahrgängen und dem Alphabet sortiert. Kartons mit sorgfältig dokumentierten Fundstücken, chronologisch aufgereiht.
Ein geheimes Archiv, das außer ihr niemand je zu Gesicht bekommt. Ihre einzigen Gäste sind die Bücher, die sie aus den Bibliotheken mitbringt und pünktlich wieder abgibt.
»Mein eigenes Leben«, wiederholt Ivy.
Ihre Stimme klingt wie ein hohles Echo zwischen den Wänden.
Einige Herzschläge lang harrt sie auf der Stelle aus, dem langsamen Strudeln des Schwarzen Lochs ausgeliefert. In einem Anflug von Neid auf ihren Vater, der mit Joys Hilfe dabei ist, sich diesem Sog zu entziehen. Mit einem Gefühl der Ohnmacht, dass er sie zwingen will, ihre Finger zu öffnen und die letzten Körnchen Hoffnung davonfliegen zu lassen.
Sie gibt sich einen Ruck und schaltet den Laptop auf ihrem Schreibtisch ein. In der Gesellschaft von Geistern, deren Gesichter und Geschichten sich in den Ordnerreihen hinter Ivy versammeln: Menschen, die wie vom Erdboden verschluckt sind.
Nicht in Zeiten des Krieges, in Krisenregionen oder in Ausnahmesituationen. Aus ihrem gewohnten Alltag, dem Blickfeld ihrer überschaubaren kleinen Welt sind sie verschwunden und nie wiederaufgetaucht. Kein Knöchelchen, kein Haar oder auch nur ein Wort.
Wie Ivys Mutter.
Ivy hat sich der sillage verschrieben. Ein französisches Wort, das die Fährte eines Tieres beschreibt. Das Kielwasser eines Bootes. Die Luftwirbel hinter einem Flugzeug. Der Duft, der von einem Parfum zurückbleibt.
Einmal mehr wird sie die Nacht damit füllen, nach Spuren zu stöbern, Fährten zu lesen.
Wo ist all das zu finden, was einmal verloren ging?
Objekt Nr. 78
Fundort: West 48th Street, zwischen 6th und 7th Avenues
Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 18. April 2012, 13:52 Uhr
Beschreibung:
Porzellanfigur einer Ballerina, Trikot und Spitzenschuhe hellblau, das mehrlagige Tutu aus weißer Porzellanspitze mit Blüten besetzt, teils vergoldet. Eine Rosenblüte im blonden Haarknoten. Das Puppengesicht wirkt verträumt, sehnsuchtsvoll.
Besondere Kennzeichen:
Die Unterseite des Sockels trägt den Stempel Dresden, Germany.
Der linke Arm fehlt, er ist an der Schulter abgebrochen.
Kapitel 3
Schweigend verfolgen Ivy und Moe das Kommen und Gehen auf der Fifth Avenue.
So früh am Morgen spielt sich zwischen dem Schneckenhaus des Guggenheim-Museums und der Puppenhausfassade der Neuen Galerie alles im Zeitraffer ab. Im Laufschritt wird aus dem Kaffeebecher getrunken, von einem Apfel, einem Donut abgebissen, über das Headset noch schnell das nächste Meeting vereinbart. Wer stehen bleibt, tut es nur, um an der Haltestelle nach dem Bus Ausschau zu halten und dabei von einem Fuß auf den anderen zu treten.
Ivy und Moe sind vermutlich die Einzigen, die in den Verschnaufpausen des Verkehrs auf das Wispern der jungen Blätter über sich achten.
»Das ist ein großer Einschnitt«, stellt Moe irgendwann fest.
An die Parkmauer gelehnt, nickt Ivy nur. Die letzten Tage waren so grau und bedrückend wie der Himmel über New York. Morketiden nennen die Norweger solch düstere Zeiten, in denen es nicht richtig hell werden will; wenigstens regnet es seit gestern nicht mehr.
»Kannst du etwas dagegen unternehmen?«
Ivys Blick folgt zwei jungen Müttern auf der anderen Straßenseite, die lachend und in eine lebhafte Unterhaltung vertieft die Buggys vor sich herschieben. Gekleidet im lässigen Schick, der gerade modern ist, und strahlend vor selbstbewusstem Glück.
Es fällt Ivy nicht schwer, sich Joy in dieser Rolle auszumalen, zwischen Yoga und Soja-Latte, in zwei oder drei Jahren. Ihren Vater kann sie sich daneben nicht vorstellen; sie kennt ihn nur als ihren eigenen Vater, solange sie zurückdenken kann.
Ivy zuckt die Schultern.
»Es wird nichts nützen. Nach all den Jahren ohne ein Zeichen, ohne eine Spur liegt der Schluss nahe, dass sie nicht mehr am Leben ist. Von allen denkbaren Möglichkeiten ist das die wahrscheinlichste.«
Eine pragmatische Entscheidung des gesunden Menschenverstands. Damit die, die noch da sind, Ruhe finden und weitermachen können, irgendwie.
»Das will mir immer noch nicht in den Kopf«, grübelt Moe halblaut. »An einem Tag ist jemand noch da – und am nächsten nicht mehr. Wie in Luft aufgelöst.«
Eine Obdachlose schlurft die Fifth Avenue hinunter, warm eingepackt in einen Anorak und einen um den Kopf gewickelten Schal, die Beine unter dem Rock unförmig in den Strickstulpen. Der Einkaufswagen, den sie müde vor sich herschiebt, ist vollgepackt mit zerschlissenen Plastiktüten.
Ivy sucht in diesem verwüsteten Gesicht nach etwas Vertrautem, einer Ähnlichkeit; eine Gewohnheit, die sich bei ihr tief festgesetzt hat.
Was, wenn es einen Unfall gegeben hatte? Auf der Straße, in der Subway, als ihre Mutter unterwegs war, um doch noch einen Cheesecake zu kaufen und ihn ihr in die Schule zu bringen. Einen brutalen Angriff, am helllichten Tag. Nachdem sie sich auf den Weg gemacht hatte, um Ivy abzuholen und mit einem Eisbecher den verkorksten Tag wieder ein bisschen zu glätten.
Mehr als ihre zersplitterten Knochen, ihre zerquetschten Organe hatte ihr Gedächtnis gelitten, wie Porzellan war es zerschellt. Eine Jane Doe, durch alle Raster gefallen, die seitdem ihr Dasein in einem Pflegeheim oder auf der Straße fristet, das Haar strähnig, das Gesicht vielleicht bis zur Unkenntlichkeit vernarbt. Irgendwo in einem Leben, das sie sich aus dem Nichts zusammengekratzt hat, für immer ahnungslos, wo sie hergekommen ist und was sie verloren hat. Wie sehr sie vermisst wird.
Variationen einer Geschichte, die Ivy sich selbst wieder und wieder erzählt hat. Denn es sind nicht Dämonen und Ungeheuer, die die menschliche Seele am meisten fürchtet, sondern die Leere. Das Nichts.
Horror vacui.
»Man kann es nicht begreifen«, erwidert Ivy, »weil man weiß, dass nichts und niemand einfach von der Erdoberfläche verschwinden kann. Es muss noch da sein, aber wir sehen es nicht mehr.«
Der Schlüsselbund, irgendwo im Haus. Das Handy, das man eben noch in den Fingern hielt, oder die Lesebrille.
»Niemand kann sich in Luft auflösen, Moe. Etwas bleibt immer übrig. Deshalb ist es zum Verrücktwerden, wenn ein Mensch spurlos verschwindet. Weil es den Naturgesetzen widerspricht und unsere Welt aus den Angeln hebt.«
Fast zwei Dutzend Bergsteiger und Sherpas sind am Mount Everest verschollen, unter Schnee und Eis begraben, von Gletscherspalten verschluckt. Dort, wo keines Menschen Fuß, kein Blick je hingelangen kann, irgendwo in dieser vertikalen Wüste ewigen Winters. Die so riesig, so gewaltig ist und doch nur ein Berg von vielen auf dieser Erde.
Wir Menschen sind so winzig in dieser weiten Welt, dass es zum Fürchten ist. Deshalb gaukeln wir uns vor, dass wir diese Welt zum Schrumpfen gebracht und gezähmt haben. Wir reden uns ein, dem Chaos unsere Ordnung aufgezwungen zu haben. Doch selbst die gut durchdachte Struktur unserer Städte ist nichts als eine Illusion; sie sind eine Wildnis geblieben, bereit, uns jederzeit zu verschlingen.
»Ich hätte dir ein anderes Ende gewünscht«, sagt Moe nach einer Weile.
George Mallorys Leiche wurde fünfundsiebzig Jahre danach gefunden, an einem Hang des Mount Everest, das Wrack der HMS Erebus einhundertneunundsechzig Jahre nach John Franklins verhängnisvoller Expedition, das der HMS Terror zwei Jahre später.
Selbst Einsteins Gehirn tauchte wieder auf, in zwei Einmachgläsern im Keller seines Pathologen.
Geschichten wie diese sind es, die sich Ivy und Moe erzählen, wenn sie einander in der City begegnen, unter der Reklametafel eines Mobilfunkanbieters, vor einem Deli oder Starbucks, am Eisenzaun eines Parks.
Ivys Rettungsanker. Mehr als die Stunden bei einem Psychologen damals, als sie schon zu groß war, um mit Puppen darzustellen, was sie fühlte, und noch zu sehr Kind, um für das Unfassbare, Unbegreifliche eine Sprache zu finden.
Geschichten davon, dass nichts für immer verloren bleibt. Dass selbst die schlimmste Befürchtung, die wahr wird, ein gutes Ende ist. Weil sie Gewissheit bringt.
»Ich hätte mir überhaupt ein Ende gewünscht.«
Es wird niemals ein Ritual des Abschieds geben. Nicht Trennung, Rosenkrieg und Scheidung. Kein Krankenhaus, kein Totenbett und keine Beerdigung.
Nur diesen eigenmächtig gezogenen Schlussstrich.
Ohne den Beweis des jeweiligen Gegenteils wird Ivys Mutter für immer wie Schrödingers Katze sein: lebendig und tot zugleich.
Kapitel 4
»Ivy!«
Es ist seine Brille, die sie zuerst wahrnimmt, diesen sperrigen Rahmen für seinen blau funkelnden Blick, auf der anderen Seite der Amsterdam Avenue.
Autohupen heulen auf, als Jack in einem halsbrecherischen Spurt über die Straße setzt. Ivy bleibt keine Zeit mehr, so zu tun, als hätte sie ihn nicht gesehen, sich in den nächsten Laden oder in ein Café zu flüchten.
In vollem Lauf stützt Jack sich auf der Motorhaube eines geparkten Wagens ab und landet mit einem Sprung vor Ivy auf dem Bürgersteig, vibrierend von einer Energie, die nichts mit der rastlosen Hektik Manhattans zu tun hat. Er hat sich heute Morgen nicht rasiert, eine körnige Spur wie von Sand bedeckt Wangen und Kinn, unbekümmert und ein bisschen verwegen.
»Dein Trick mit dem roten Mantel funktioniert! Ich habe dich schon von Weitem gesehen. Wohnst du hier in der Nähe?«
Ihre Hände verkrampfen sich in den Manteltaschen, und sie schüttelt den Kopf.
»Du bist nicht zufällig auch nach Downtown unterwegs? Heute ist ein guter Tag für ein neues Bild.«
Ivys Blick wandert zum Himmel, der bleiern auf der City lastet, und Jack lacht auf.
»Das Risiko gehe ich ein. Ich lasse mich aber auch gern davon abhalten. Hast du Lust auf einen Kaffee?«
»Keine Zeit.« Ivy setzt sich wieder in Bewegung.
»Natürlich nicht. Wir sind in Manhattan, hier hat niemand Zeit.«
Ivys Mundwinkel zuckt.
»Ich habe wirklich keine Zeit«, betont sie umso schärfer und beschleunigt dabei ihre Schritte. »Ich muss arbeiten.«
Eine Recherche über Homer Folks, einen der Pioniere der Sozialarbeit, steht auf dem Plan; ein Auftrag, den sie in den vergangenen Tagen vor sich hergeschoben hat. Sonst steht Ivy schon vor den Bibliotheken, wenn deren Türen sich gerade öffnen. Sie mag es, die Erste zu sein, die am Schalter ihr Anliegen vorbringt, und freie Auswahl bei den Arbeitsplätzen zu haben, am liebsten sitzt sie in einer entlegenen Ecke, einem versteckten Winkel.
»Lass mich raten. Du bist Chirurgin am Mount Sinai und flickst in der Notaufnahme Leute zusammen, die genauso kopflos über die Straße gerannt sind wie ich eben.«
Auch Jack geht nun schneller. Nach einer Drehung um die eigene Achse marschiert er rückwärts vor ihr her, ohne sich um die Passanten zu kümmern, die ihm und seinem Rucksack ausweichen müssen.
»Nein, warte, ich habe da so eine Ahnung. Wobei ... Wenn ich jetzt sage, du siehst aus, als würdest du in einer Eisdiele arbeiten oder Cupcakes verkaufen, klingt das sicher wie ein schlüpfriges und ziemlich plumpes Kompliment. Dann tippe ich lieber darauf, dass du deine Arbeitstage im neonbeleuchteten Büro einer geheimen Behörde verbringst. Fängst du Cyberkriminelle? Bist du selbst womöglich eine?«
Ein moderner Gaukler ist er, der leichtfüßig durch das Leben tanzt und sich von der Schwerkraft des Erwachsenseins nicht einholen lässt.
»Barkeeperin? Automechanikerin? «
Ivy will sich das Lächeln verkneifen, das sich auf ihr Gesicht drängt, doch es gelingt ihr nicht.
»Sonntags arbeitest du aber sicher nicht, oder?«
Ivy verbringt ihre Sonntage oft mit einem ihrer Rechercheaufträge. Manchmal auch ihre Nächte, wenn eine heiße Spur sie ködert oder sie sich mit einer Sackgasse nicht abfinden will.
Jack hakt sofort in ihr Zögern ein.
»Also Sonntag. Auf einen Kaffee. Und dann erzählst du mir von dir.«
Ivy schnappt gleich wieder zu. »Warum sollte ich?«
Jacks Brauen heben sich.
»Umso besser. Dann sitzt du einfach dekorativ herum, und ich rede die ganze Zeit über mich.«
Ivy hat eine Schwäche für diese Art von Ironie, sie kann gerade noch ein Glucksen hinunterschlucken.
»Lieber Tee statt Kaffee?«
Ivy beneidet ihn um die selbstsichere Gelassenheit und Beharrlichkeit. Darin erinnert er sie an ihre Kommilitonen auf dem College, obwohl etwas an ihm anders ist. Vielleicht die paar Jahre mehr Lebenserfahrung, vielleicht sonst etwas, sie kann es nicht genau ausmachen.
»Du bist doch nicht etwa eine Anhängerin dieser grünen Smoothies?«
Seine Hartnäckigkeit ist zu locker, zu unbeschwert, als dass Ivy sich bedrängt fühlt. Unvermutet hat sie Freude an diesem Spiel; ihre Schritte werden beschwingter.
»Einen Margarita? Du siehst aus wie jemand, der mittags lässig und ganz selbstverständlich einen Margarita in der Hand hält. Oder einen Martini, der passt noch besser zu dir.«
Endlich lässt Ivy ihrem Lächeln freien Lauf.
»Wenn schon, dann eine Cola.«
»Also Cola. Sonntag um drei? Am Sherman Monument?«
Ivy nickt, und Jack bleibt abrupt stehen; ein Geschäftsmann mit Aktentasche kann gerade noch einen Zusammenprall vermeiden.
»Dann bis Sonntag.«
Federleicht fühlt sich Ivy, während sie weiter die Amsterdam Avenue hinaufeilt. Als sie ihren Namen hört, dreht sie sich noch einmal zu Jack um.
»Atomphysikerin?«, ruft er ihr über die Passanten hinweg zu.
Ivy kann nicht anders, sie muss lachen.
Der Campus der Columbia University in Morningside Heights ist eine kleine Stadt für sich. Die klassischen Fassaden und der Luxus weiter Grünflächen lassen keinen Zweifel daran, dass hier die Elite lehrt, lernt und forscht. Welten entfernt von Ivys kleinem, namenlosem College; ihre Schulnoten hatten sich nie wieder vollständig erholt.
Die Wissenschaft vom Verlieren und Finden ist keine akademische Disziplin, in der man glänzen kann. Erstaunlich genug, dass Ivy in der Lage ist, ihren Lebensunterhalt damit zu bestreiten.
Hinter der gewichtigen Säulenfront der Butler Library, hoch oben über den ehrwürdigen Lesesälen, verbreitet im fünften Stock helles Holz immerwährenden Sonnenschein. Räume von der freundlichen Schlichtheit einer Schulbücherei, in denen nur Ausstellungsstücke wie ein antikes astronomisches Instrument und eine alte Druckerpresse ahnen lassen, welche Schätze sich hinter den Glaswänden des Archivs verbergen.
Ivy bemerkt den Irrtum sofort, sobald sie den angestaubten Kartondeckel anhebt, die erste Plastikbox darin öffnet. Die Aktenhefter enthalten nichts über die karitativen Aktivitäten des amerikanischen Militärs auf Kuba um 1900.
Sie wirft einen Blick auf die Signatur: MS#0439 statt MS#0438, wie von ihr angefordert; anstelle der Unterlagen zu Homer Folks sind die Dokumente einer gewissen Barbara Newhall Follett vor ihr auf dem Tisch gelandet.