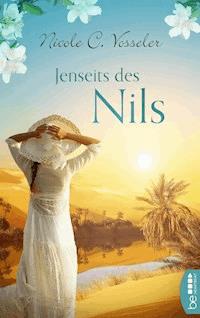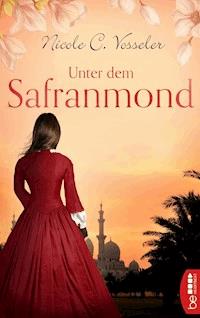5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn die Schatten der Vergangenheit die Gegenwart verdunkeln und jegliche Zukunft in Gefahr bringen
Cornwall, 1876. Helena Lawrence, mit siebzehn Jahren Vollwaise, sieht sich und ihren kleinen Bruder vor dem finanziellen Ruin. Der attraktive Ian Neville macht ihr ein Angebot: Er wird für ihr Auskommen sorgen, wenn sie ihn heiratet und auf seine Teeplantage im indischen Darjeeling begleitet. Nach anfänglichem Widerwillen sieht Helena keinen anderen Ausweg und reist mit Ian quer über den Subkontinent bis nach Darjeeling. Sie verliebt sich in das exotische, märchenhafte Land - und in ihren Mann. Doch Ian verbirgt ein dunkles und gefährliches Geheimnis, das Helenas Leben und ihre aufkeimende Liebe zu ihm für immer zu zerstören droht ...
Eine große Liebesgeschichte, die von der stürmischen Küste Cornwalls in die Wüsten Rajputanas und zu den grünen Hügeln und Tälern am Fuß des Himalaya führt.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 704
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
1 - Helena
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2 - Winston & Sitara
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
3 - Ian
1
2
3
4
5
Epilog
Schlussbemerkung
Über das Buch
Wenn die Schatten der Vergangenheit die Gegenwart verdunkeln und jegliche Zukunft in Gefahr bringen
Cornwall, 1876. Helena Lawrence, mit siebzehn Jahren Vollwaise, sieht sich und ihren kleinen Bruder vor dem finanziellen Ruin. Der attraktive Ian Neville macht ihr ein Angebot: Er wird für ihr Auskommen sorgen, wenn sie ihn heiratet und auf seine Teeplantage im indischen Darjeeling begleitet. Nach anfänglichem Widerwillen sieht Helena keinen anderen Ausweg und reist mit Ian quer über den Subkontinent bis nach Darjeeling. Sie verliebt sich in das exotische, märchenhafte Land - und in ihren Mann. Doch Ian verbirgt ein dunkles und gefährliches Geheimnis, das Helenas Leben und ihre aufkeimende Liebe zu ihm für immer zu zerstören droht …
Eine große Liebesgeschichte, die von der stürmischen Küste Cornwalls in die Wüsten Rajputanas und zu den grünen Hügeln und Tälern am Fuß des Himalaya führt.
Über die Autorin
Nicole C. Vosseler wurde 1972 in Villingen-Schwenningen geboren und studierte nach dem Abitur Literaturwissenschaft und Psychologie in Tübingen und Konstanz, wo sie heute lebt. 2007 wurde die SPIEGEL-Bestsellerautorin für ihren Roman »Der Himmel über Darjeeling« mit dem Konstanzer Förderpreis in der Sparte »Literatur« ausgezeichnet. Ihre Bücher wurden bisher in acht Sprachen übersetzt. Wie die Heldinnen ihrer farbenprächtigen Romane sucht auch sie gerne mal das Abenteuer.
Mehr über die Autorin und Hintergrundinformationen zu ihren Romanen finden Sie unter: https://www.nicole-vosseler.de/
Nicole C. Vosseler
Der HimmelüberDarjeeling
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2006/2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Textredaktion: Sünje RediesUmschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © thinkstock: Elen11 | Karinprijs; © shutterstock: Kateryna Yakovlieva | Pikoso.kz
eBook-Erstellung: Olders DTP.company, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5912-1
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Schließe die Augen und sage das Wort Indien.
RUDYARD KIPLING
All jenen gewidmet, die in den Schlachten des Lebens und der Liebe Narben davongetragen haben und dennoch hoffen, glauben und lieben.
1Helena
Die Kinder Liebender sind Waisen.
LEO TOLSTOI
Prolog
Argostolí / Kephallinia, 13. August 1864
Geliebte Schwestern,nur wenige Stunden nachdem sich diese Zeilen auf den Weg zu euch gemacht haben, werden wir ebenfalls aufbrechen, auch wenn sich unsere Reise als ungleich langwieriger und mühseliger erweisen wird. Eure Sorge um unser Wohlergehen kann ich nachfühlen, doch haben wir weder zur Zeit des englischen Protektorates noch seit der Rückgabe der Inseln Ioniens an Griechenland vor fünf Monaten Feindseligkeiten irgendeiner Art erfahren. Ich kann nicht genug betonen, nicht allem blind zu glauben, was in den Zeitungen geschrieben steht; niemals ist uns anders als zuvorkommend und gastfreundlich begegnet worden.
Dennoch ist in uns der Entschluss gereift, wieder in das Land unserer Herkunft zurückzukehren. Sieben Jahre ist es nun her, dass ich England und euch verlassen habe – sieben Jahre hier im goldenen Süden, die kaum mehr als ein paar Monate gewesen zu sein scheinen, und doch gleich einer Ewigkeit. London ist nur noch ein schwaches Abbild in meiner Erinnerung – der Lärm auf den Straßen, der so gänzlich anders ist als der Lärm hier, kühler und auf seine Weise geordneter – der Ruß und der Nebel und vor allem der Regen, der kalte immerwährende Regen …
Fast den ganzen Weg werden wir zu Wasser zurücklegen, über Italien und Frankreich, was nicht nur schneller, sondern auch angenehmer ist, wenn wir so auch den einen oder anderen wehmütigen Blick auf die Landstriche entbehren müssen, die uns so lange Heimat waren. Wir rechnen damit, unter günstigen Voraussetzungen in drei bis vier Wochen nach Dover überzusetzen, von wo aus ich euch dann eine Nachricht zukommen lassen werde. Meine besten Wünsche an Theodore und Archibald, auch in Arthurs Namen.
Der Federhalter ruhte einen Augenblick über dem Papier, ehe er erneut ansetzte, seine zierliche Spur hinterlassend.
Es wäre schön, nach dieser langen Zeit zurückzukehren und zu wissen, dass Vater seinen Groll gegen mich und vor allem gegen Arthur gemildert hätte und wenigstens einmal einen Blick auf seine Enkeltochter werfen würde, die er noch nie gesehen hat.
In Liebe umarmt euch – Celia
Sie atmete tief durch, wie von einer Last befreit, als sie die Feder aus der Hand legte und sich mit raschelnden Röcken erhob. Das Läuten der Kirchenglocken, die das Ende eines langen Arbeitstages verkündeten, drang durch die Schlitze der Fensterläden, die das Zimmer vor der Hitze des Sommers schützten, und brachte mit sich den Duft von sonnendurchglühtem Fels und trockenem Laub. Sie trat an das hohe Fenster, dessen Flügel in den Raum hinein aufstanden, löste den Haken aus seiner Verankerung und gab den Läden einen Stoß, dass sie nach außen aufschwangen und mehr von dem tiefen, rhythmischen Klang hereinließen, dazu eine Flut abendlichen, kupfergoldenen Lichts: heiß, ohne grell und giftig zu sein wie mittags.
Wie ein Spiegel lag das Wasser der Bucht da. Argostolí, die Hauptstadt der Insel, erstreckte sich vor dem Fenster: ein Meer aus mehrstöckigen, in klassischem Stil gebauten Häusern, blendend weiß und Kühle versprechend unter ihren Ziegeldächern. Zwischen ihnen ragten die Türme der vier orthodoxen Kirchen auf, deren nachhallende Glockenstimmen miteinander wetteiferten. Pinien und Zypressen lockerten die strenge Geometrie der Straßenzüge und ihrer Gebäude auf. Selbst zu dieser Stunde, die die Menschen von ihrem Tagwerk nach Hause zog, wirkte die Stadt verschlafen, als flösse die Zeit hier langsamer vorüber.
Zwei Hirten kamen an dem einsam an seinem Berghang klebenden Haus vorüber. In Pluderhosen, blusige Hemden und ärmellose Westen gekleidet, trieben sie mit lockenden Zurufen ihre Ziegen zwischen den mit Thymian durchsetzten Felsen hindurch. Den weißen Fes durch die Luft schwenkend, riefen sie der schönen jungen Frau des angglikós sográphos, des englischen Malers, Nettigkeiten und bedauernde Abschiedsworte zu, die Celia mit einem Winken und einer kurzen Erwiderung auf Griechisch beantwortete. Sie sah ihnen nach, wie sie ihren Weg in die Stadt hinunter weiterverfolgten, den mit Geröll bedeckten Pfad hinab, und auf zwei Gestalten trafen: einen Erwachsenen und ein Kind, die den Weg bergan in Angriff nahmen, zwischen dem Blaustern und den hohen Mastixsträuchern mit ihrem gefiederten Laub und den roten und schwarzen Beeren hindurch.
Celias Herz schlug rascher, als sie Arthur erkannte, braungebrannt wie einer der Griechen, sein dunkelbraunes Haar von der Sonne kastanienfarben durchkämmt. Die Hemdsärmel hochgerollt, hatte er die zusammengeklappte Staffelei geschultert; in der anderen Hand trug er eine auf einen Holzrahmen gespannte Leinwand, scheinbar unbesorgt um die noch frische Farbe darauf.
Von früher Jugend an lebt ich lieber als sonstwo auf den Küsten von Ionien und Attika und den schönen Inseln des Archipelagos, und es gehörte unter meine liebsten Träume, einmal wirklich dahin zu wandern, zum heiligen Grabe der jugendlichen Menschenheit. Griechenland war meine erste Liebe, und ich weiß nicht, ob ich sagen soll, es werde meine letzte sein – so hatte er Hölderlin, den deutschen Dichter, zitiert, und sich selbst damit gemeint. Dunkel wie ein Zigeuner, aber mit tiefblauen Augen, die alles, was sie sahen, in Schönheit zu verwandeln schienen, hatte er sie in dieses Abenteuer entführt, das sie vom ersten Moment an liebte, so wie sie ihn von jenem ersten Moment an geliebt hatte, in dem er als ihr neuer Zeichenlehrer ihr Elternhaus betreten hatte und sie sich gemeinsam über ihren Skizzenblock gebeugt hatten.
Rom, Die Ewige, Neapel und Syrakus, Delphi und Korinth, Salamis und Mykenä, Patras und Ithaka – rastlos hatten sie zwei Jahre lang die Stationen ihrer Reise ohne Ziel aneinander gereiht, trunken von der Sonne und dem Glück, einander gefunden zu haben. Erst unter der Akropolis von Athen, wo Helena im glühend heißen August vor fünf Jahren zur Welt gekommen war, hatten sie ein Zuhause gefunden, und hier auf Kephallinia waren sie zur Ruhe gekommen. Kephallinia, die Insel der Wunder, wie sie von den Einheimischen genannt wurde.
Es war die Wiege der abendländischen Kultur, die Arthur faszinierte, die Heimat unzähliger Götter- und Heldensagen, voller Leidenschaft, Kampf und Hass, Liebe und Tod, und jeden Morgen hatte er aufs Neue seine Staffelei aufgestellt und wie ein Besessener gemalt, Meer und Fels und Licht eingefangen und auf die Leinwand gebannt, die Geister der toten Helden und ihrer Geliebten wieder lebendig werden lassen. Die englischen, französischen und deutschen Reisenden, begierig, ein Stück dieser sonnendurchfluteten, ewigen Welt mit in die regnerische Heimat zu nehmen, deren Freunde, die zu Hause beim Betrachten der intensiven, wie von der Sonne in die Leinwand gebrannten Farben Fernweh verspürten, sie ermöglichten Arthur und Celia ein sorgenfreies, wenn auch nicht sonderlich üppiges Auskommen.
Lachen drang zu ihr herauf, vermischt mit einzelnen Wortfetzen der kraftvollen und biegsamen Sprache des Griechischen, und Celia sah, wie die beiden Hirten mit Helena schäkerten, die den Leinenbeutel mit den Pinseln und Farben ihres Vaters umgehängt hatte. Während ihr eigenes blondes Haar glatt wie gesponnenes Gold das Sonnenlicht reflektierte, umstanden Helenas Locken ihr Gesicht wie eine leuchtende Aureole, und manchmal glaubte man einen Hauch von Kupfer darin zu entdecken.
Chrysó mou …
Celia lief es im warmen Licht der Abendsonne kalt den Rücken herab.
»Chrysó mou, mein Goldkind!«, hatte die alte Frau Helena zugerufen und ihre krummen Finger nach dem kleinen englischen Mädchen in seinem weißen, ärmellosen Hängerkleidchen ausgestreckt.
Sie hatte im Schatten eines der Häuser auf einem Hocker gesessen und müßig das Markttreiben beobachtet. Helena hatte sich mit erhabenem Gleichmut in ihr Schicksal ergeben und sich auf ihren Schoß ziehen, sich küssen und liebkosen lassen, wie sie es von den Griechinnen erfahren hatte, seit sie geboren war. Mit sichtlicher Freude wanderten die knorrigen Hände über das von der Sonne getönte Gesichtchen und das widerspenstige Haar, flüsterte die Greisin Koseworte, bis ihre Berührungen in einen ruhigen, stetigen Rhythmus kamen.
»Chrysó, Goldkind, du bist zur Prinzessin geboren«, hörte Celia sie raunen, ihr zerfurchtes Gesicht andächtig entspannt. »Das Schicksal wird dich in die Fremde führen. Zwei Männer – Feinde – werden um dich werben, und du wirst das Geheimnis lüften, das ihr Schicksal aneinander bindet. Einer davon wird dein Glück sein. Doch lass dich nicht vom ersten Augenschein täuschen! Die Dinge sind oftmals nicht so, wie sie zunächst scheinen oder wie du sie sehen willst …« Ihre Stimme erstarb, ließ eine verheißungsvolle Anspannung in der Luft zurück, die nach Staub, Zwiebeln und süßen Trauben duftete.
»Können Sie mir sagen, was mich erwarten wird – mich und meinen Mann?«, hörte Celia sich selbst fragen. Ihre Worte, wie gegen einen inneren Widerstand gesprochen, waren kaum zu hören gegen das Stimmengewirr und Gelächter des Marktes.
Die alte Frau rührte sich nicht, als lauschte sie aufmerksam einer Stimme in ihrem Inneren.
Ruckartig öffnete sie die Lider, faltig wie die einer Kröte, Abwehr und so etwas wie Mitleid in den trüben Augen. Mit dem verhutzelten Daumen ihrer rechten Hand machte sie ein Kreuzzeichen über ihre Lippen, als wollte sie sie versiegeln, zu ihrem eigenen Schutz wie dem Celias, der es war, als griffe eine eisige Hand nach ihrem Herzen.
Hastig zerrte sie das erschrockene Kind vom Schoß der alten Hexe herunter und hinter sich her, mit dem Saum ihrer Röcke Wolken von Staub hinter sich aufwirbelnd, wie sie in großen Schritten die Stadt hinter sich zu bringen suchte, die ihr mit einem Mal so bedrohlich erschien.
Die Angst hatte sie nicht mehr losgelassen und an ihrer Liebe zu diesem Land zu nagen begonnen. Griechenland würde ihr fehlen – das greifbare Licht der Sonne, das scharfe Kontraste über die Landschaft zauberte, die Ebenen voll dürrer Disteln, der Duft von Holzkohle in den Pinienwäldern, der Gesang der Zikaden, das Funkeln der Luft, voll des Geruchs nach Laub und Erde und dem Salz des Meeres, doch sicher konnte sie sich hier nicht mehr fühlen.
Beschützend legte sie die Hand auf ihren noch flachen Bauch unter den leichten Musselinröcken, und stumm betete sie um Schutz für das ungeborene Kind und ihre Familie.
1
Cornwall, November 1876
Mit einem schleifenden Geräusch glitten ihre Röcke aus dem steifen schwarzen Material über den ausgetretenen Holzfußboden, und das Echo ihrer niedrigen Absätze klang ihr unangenehm laut in den Ohren. Vor der Tür, zu der sie ihre Schritte geführt hatten, hielt sie kurz inne, als müsste sie sich Mut zusprechen, ehe sie tief Atem holte und das fleckige Metall des Türknaufs kalt in ihrer Hand spürte. Unzählige Staubkörner, die der Luftzug der sacht aufgeschobenen Tür aufgewirbelt hatte, tanzten in den fahlen Lichtstrahlen, die durch das enge Fenster in den Raum fielen.
In der Mitte stand ein altersschwacher Schreibtisch nebst ledergepolstertem Stuhl, dessen Füllung durch Risse im Leder hervorzuquellen begonnen hatte. Hoch aufgetürmte, sich in alle Himmelsrichtungen neigende Papierstöße, abgebrochene und tintenbeschmierte Federhalter zeugten davon, dass hier bis vor nicht allzu langer Zeit noch gearbeitet worden war. Alle Wände waren bis zu den niedrigen, rußgeschwärzten Deckenbalken mit Büchern bedeckt, die einen muffigen Geruch verströmten. Verblichen und vernarbt drängten sich die Lederrücken aneinander – Werke von Platon und Aristoteles, Plutarch und Homer, viele davon gleich in mehreren Ausgaben vorhanden, Schriften aus der Archäologie, Philosophie, Rhetorik und Grammatik. Irgendwann hatte der Platz nicht mehr ausgereicht, den die aus einfachen Brettern gezimmerten Regale boten, und die Bücher wanderten auf dem Boden weiter, drängten sich an die Beine des Schreibtisches heran und wucherten in beängstigend schiefen Türmen in das Zimmer hinein.
Das Heiligtum ihres Vaters.
Sie schlug den Pfad ein, der durch diesen Dschungel der Gelehrsamkeit führte. Ein zerlesener Band lag ganz oben auf dem Papierwald, die Seiten eingerissen und vergilbt, eine Passage der eng gesetzten Typen angestrichen – vielleicht seine letzte Lektüre.
Lied – An Celia
Komm, meine Celia, lass uns bekunden,
Solang wir es vermögen, die Wonnen der Liebe
Zeit wird nicht unser sein auf ewig.
ER wird schließlich unser Wohl voneinander trennen.
Verschwende denn Seine Gaben nicht vergebens.
Sonnen, die untergeh’n, mögen sich wieder erheben:
Aber wenn wir einst dies Licht verlieren,
Wird mit uns ew’ge Nacht sein.
Ben Jonson
Durch die bucklige Scheibe sah sie hinunter auf eine kahle, nackt wirkende Küstenlandschaft, deren Strand silbrig schien im trüben Licht des Novembertages und sich unter der Wucht der heranbrandenden Wellen duckte.
»Mr. Wilson wartet unten.«
Ebenso wenig, wie sie Margarets Kommen bemerkt hatte, schien Helena auf ihre Worte zu reagieren.
»Mir ist nie aufgefallen, dass er immer mit dem Rücken zum Meer saß«, flüsterte sie tonlos.
Abschätzig ließ Edward Wilson, einer der Söhne aus der Kanzlei Wilson & Sons, Chancery Lane, London, seine Blicke durch den Raum wandern, den man einst wohl als Salon bezeichnet hatte. Ähnlich dem übrigen Haus schien auch dieser bessere Tage gesehen zu haben. Das Holz der längst nicht mehr zeitgemäßen Möbel war nachgedunkelt und zerkratzt, die pastellfarbigen Bezüge verblichen, an manchen Stellen fadenscheinig und notdürftig ausgebessert; doch ganz offensichtlich hielt man mittlerweile auch dies nicht mehr der Mühe wert.
World’s End – ein passender Name für diesen gottverlassenen Flecken Erde! Er hatte geglaubt, der Kutscher sei vom Weg abgekommen oder lieferte ihn in diesem unwegsamen Gelände einer Räuberbande aus, als endlich das halb verfallene Haus in Sicht kam, grau wie die schroffen Klippen unter ihm und ungeschützt vor dem scharfen Wind, der von der unruhigen See herüberfauchte. Die im Landesinneren noch üppigen Hügel schienen hier bis auf ihr Rückgrat abgemagert, und selbst der sonst im Land so ins Kraut schießende Baldrian verkümmerte im kargen Boden. Falls König Artus tatsächlich etwas weiter nördlich auf der Burg Tintagel seine Tafelrunde versammelt haben sollte – dieser Teil der Küste musste zweifellos jenseits der Grenzen seines Königreiches gelegen haben; wirkte er doch, als sei dahinter die Welt zu Ende, einsam und unwirtlich wie ein letzter Außenposten des britischen Empire an der Grenze zu einer kalten, nassen Hölle. Dies war kein Ort, an dem ein gesunder, normal empfindender Mensch länger ausharren würde als unbedingt notwendig, aber Arthur Lawrence war offensichtlich in den letzten Jahren nicht mehr er selbst gewesen. Vergangene Woche nun hatte der Herr in Seiner Gnade ihn endlich von seinem irdischen Leiden erlöst, und Wilson war die undankbare Aufgabe zugefallen, den spärlichen Nachlass zu verwalten. Er schnaubte verächtlich und strich sich über den farblosen Oberlippenbart.
Vor einem großflächigen Gemälde blieb er stehen, das mit seinen kräftigen Blautönen und dem strahlenden Weiß sofort den Blick eines jeden auf sich zog, der den Raum betrat, das sogar noch das letzte Quäntchen Licht, das hineindrang, zu absorbieren schien – man glaubte förmlich selbst auf der Terrasse zu stehen und das Sonnenlicht auf der Haut zu spüren. Auf der Bank aus geädertem kühlen Marmor saß eine Frau, madonnengleich und doch verführerisch in ihrer Unschuld. Meisterhaft hatte der Maler den hellen Schimmer ihrer Haut eingefangen, konnte man beinahe das Blut darunter durch das Flechtwerk der Adern pulsieren sehen und auf einen Blick aus ihren Augen hoffen, die wie aus dem Stoff des Meeres hinter ihr geschaffen zu sein schienen. Doch diese waren unverrückbar auf den Strauß purpurner und rosenfarbener Anemonen gerichtet, der ihr zu Füßen lag. Die Aussage des Gemäldes blieb rätselhaft, war es im Grunde wohl nur eine Art Denkmal, das Festhalten und die Würdigung einer einzigartigen Schönheit, und Wilson begann zu ahnen, dass Arthur Lawrence sie bis zum Wahnsinn geliebt haben musste.
Wie vielversprechend hatte einst alles begonnen! Sieben Jahre hatten sie in den südlichen Gefilden verbracht, ehe sie im September 1864 nach London zurückkehrten, in eine Stadt, die sie mehr als willkommen hieß. Arthur Lawrences Gemälde, die sonnendurchtränkten Landschaften, die greifbar lebendigen Szenen antiker Historie und Mythologie, waren begehrt, und nicht minder der temperamentvolle, vor Charme sprühende Künstler und seine elfenhaft schöne Frau. Gastgeber schmückten ihre Soireen und Soupers nur zu gerne mit dem jungen Paar, welches ein Hauch von Abenteuer und Boheme umwehte. Der Skandal, der Jahre zuvor die Gesellschaft erschüttert hatte, als der aus einfachen Verhältnissen stammende Zeichenlehrer mit der jüngsten Tochter des Ehrenwerten Richters Sir Charles Chadwick durchgebrannt war, sie sich mitten in der Nacht in Gretna Green, einem schottischen Dorf hinter der Grenze vom dortigen Friedensrichter, einem Schmied, trauen ließen, war vergessen. Und selbst die kritischsten Blicke der sorgsam über Tugend und Anstand wachenden Ladys wurden weich, wenn Celia eine Teegesellschaft betrat, ihre Umstände geschickt mit einem prächtig gemusterten Seidenschal kaschierend, an der Hand ihre kleine Tochter, in Lackschühchen und volantbesetztem Kleidchen, die glänzenden Locken von Satinschleifen gebändigt. Arthur Lawrence griff nach den Sternen des Künstlerhimmels; doch sein aufkeimender Ruhm sollte kaum fünf Monate währen, ehe die Götter sich unbarmherzig von ihrem Günstling abwandten.
Das Geräusch der Tür ließ Edward Wilson sich umdrehen. Margaret, der gute Geist dieses traurigen Hauses, klein und dunkel wie die ursprünglichen Bewohner dieser Grafschaft, von bald sechzig Jahren auf dieser Welt gezeichnet, deutete einen Knicks an, ehe sie zur Seite trat und die schlanke Gestalt eines jungen Mädchens in der Türfüllung erschien.
Unwillkürlich ließ Wilson prüfende Blicke zwischen dem Gemälde und Celias Tochter hin- und herwandern. Helena war schmaler, eckiger, dabei aber auch größer als ihre Mutter. Ihr Haar – eine wilde Mähne dichten, welligen Haares in einem hellen Honigton, das je nach Lichteinfall rötlich aufschimmerte – widerstand allen Zähmungsversuchen und reichte offen bis zu ihrer Taille hinab. Die schwarze Trauerkleidung stand ihr unvorteilhaft zu Gesicht, ließ die von ihrer Mutter ererbten Züge hart und streng wirken. Allein ihre Augen waren wirklich schön zu nennen: groß und außergewöhnlich in ihrer grünblauen Farbe, die an ein südliches Meer erinnerte, blickten sie scheinbar furchtlos in die Welt hinaus, schufen dabei aber eine Distanz, die unüberwindlich schien.
»Ich weiß, dass ich ihr nicht ähnlich bin«, riss ihre klare, kühle Stimme Wilson aus seinen Gedanken, »aber das ist wohl kaum der Grund für Ihren Besuch.«
Eine helle Röte stieg in Wilsons konturlosen Wangen auf. »Wollen wir nicht zuerst Platz nehmen?«, schlug er bemüht jovial vor und wies auf die drei niedrigen Sessel. Ohne ein weiteres Wort setzte er sich und begann, die Dokumente und Notizen, die er auf dem Teetisch ausgebreitet hatte, umzuschichten, um sich ein geschäftiges Aussehen zu geben. Aus den Augenwinkeln sah er, wie sich Helena niederließ und Margaret sich anschickte, es ihr gleichzutun. »Margaret, würden Sie uns bitte – «
»Mrs. Brown gehört seit langem zu unserer Familie und hat jedes Recht, hierbei anwesend zu sein«, fiel ihm Helena scharf ins Wort, das Kinn mit der Andeutung eines Grübchens herausfordernd in die Luft gereckt.
»Nun«, begann der Anwalt, »wie Sie zweifellos wissen, obliegt mir die Aufgabe, die Hinterlassenschaft Ihres seligen Herrn Vaters zu sichten und Ihnen zu übergeben. Da er offenbar zu Lebzeiten kein Testament verfasst hat, sind Sie, Miss Lawrence, und Ihr Bruder Jason als nächste Verwandte die einzigen Erben seiner weltlichen Habe. Leider«, er räusperte sich, »leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich nach Durchsicht sämtlicher Papiere, die mir zur Verfügung standen, ein erhebliches Defizit errechnet habe.«
»Ich gehe davon aus, dass dieses Defizit nicht so umfangreich ist, dass es sich nicht durch das Erbe meiner Mutter ausgleichen ließe, schließlich haben wir die vergangenen Jahre sparsam gelebt.« Wilson konnte den bitteren Ton aus ihren Worten heraushören und senkte den Blick, ein ungutes Gefühl in seinem sonst so kalten Herzen.
»Miss Lawrence«, begann er, die Augen starr auf die Zahlenreihen vor ihm gerichtet, »ich fürchte, dass die Summe, die Ihre selige Frau Mutter damals großzügigerweise von ihrer Tante Mrs. Weston bekam, um sie für den Ausschluss aus der Erbfolge der Chadwicks als Konsequenz ihrer Heirat zu entschädigen, längst aufgebraucht ist. Tatsächlich verbleibt nach Abzug aller Kosten für medizinische Hilfe, das Begräbnis und meines bescheidenen Honorars eine Differenz von etwa dreihundert Pfund zu Ihren Lasten.«
»Dann müssen wir World’s End beleihen.«
»Das Haus und das dazugehörige Land sind bereits mit vierhundert Pfund belastet.«
»Allmächtiger«, entfuhr es Margaret, während Helena unbeweglich vor sich hin starrte, ehe sie den Anwalt mit ihren Blicken durchbohrte.
»Wofür hat er all das Geld verwendet?«
»In seinen Unterlagen fanden sich Belege für finanzielle Transaktionen – Zahlungen an mehrere Fonds zur Förderung der Erforschung antiker Philosophie und Literatur. Insgesamt belaufen sich diese auf – « er blätterte zwischen einzelnen Seiten hin und her, »auf viertausendneunhundertdreiundsiebzig Pfund Sterling in einem Zeitraum von etwa acht Jahren. Unter Umständen waren es auch mehr, die Buchführung Ihres Herrn Vaters war mehr als unvollständig, vor allem in den vergangenen Monaten.«
»Gibt es eine Möglichkeit, diese Gelder zumindest zu einem Teil zurückzufordern?«
»Ich fürchte nein. Vor dem Gesetz war Ihr Herr Vater bis zu seinem Dahinscheiden im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Dies im Nachhinein auf rechtlichem Wege anzufechten, halte ich für ein aussichtsloses Unterfangen.«
»Meine Mutter besaß noch ein wenig Schmuck, den ich von ihr geerbt – «
»Ich habe einen Blick in die Schatulle geworfen. Die Stücke sind hübsch anzusehen, aber kaum von Wert.«
»Die restlichen Bilder, die noch hier im Haus – «
»Ihr Herr Vater hat nicht lange genug gemalt, um sich längerfristig etablieren zu können. Der Name Arthur Lawrence hat längst keine Bedeutung mehr.«
Mitgefühl begann sich in Wilson zu regen, als er das junge Mädchen betrachtete, das ihm noch vor wenigen Augenblicken so stolz gegenübergetreten war und nun vor den Scherben ihres bisherigen Lebens saß, gestraft dafür, dass ihr Vater nie über den Tod seiner Frau hinweggekommen war.
»Es – «, er hüstelte erneut und raschelte mit seinen Papieren, »es gibt ein Angebot seitens einer der beiden Schwestern Ihrer seligen Frau Mutter, Mrs. Archibald Ross, Sie bei sich aufzunehmen, als Gesellschafterin für ihre eigenen drei Kinder.«
»Was wird aus Jason?« Erneut ein bohrender Blick.
»Mrs. Ross würde es befürworten, wenn er in unserer Kanzlei eine Lehre als Schreiber begänne. Unterkommen könnte er gegen ein geringes Kostgeld selbstverständlich bei mir und meiner Familie.«
»Ausgeschlossen. Mein Vater wollte immer, dass Jason – «
»Miss Lawrence«, fiel ihr Wilson bemüht geduldig ins Wort, »Ihr Herr Vater – der Herr sei seiner Seele gnädig – hat offensichtlich die vergangenen zehn Jahre keinen einzigen Gedanken an Ihrer beider Zukunft verschwendet. Sie sollten sich mit diesem Los zufrieden geben – es gibt weitaus bedauernswertere.«
»Ich will keine Almosen.« Helenas Augen blitzten zornig auf. »Weder von Ihnen noch von meinen Tanten! Die Familie meiner Mutter hat von jeher auf uns herabgesehen, sie würden mich ihre Herablassung jeden Tag spüren lassen, den ich von ihrer Gnade abhängig wäre!«
Edward Wilson hob seine spärlichen Augenbrauen und spürte eine tiefe Befriedigung, als er einen Schlusspunkt unter dieses seinem Geschmack nach zu sehr ins Pathetische abgleitende Gespräch setzen konnte.
»Stolz muss man sich leisten können, Miss Lawrence. Mr. und Mrs. Ross haben bis zu Ihrer Volljährigkeit die Vormundschaft über Sie beide – ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl.«
Vom Rand der Klippen hatte man an dieser Stelle der Küste eine einzigartige Sicht auf den Atlantik. Wie von den Hieben eines Riesenschwertes gespalten, krallten sich die Felsen in den sandigen, wie Metallstaub wirkenden Untergrund. Das Meer, grau und trübe, schlug ungebärdig an den Strand, versprühte schmutzig weiße Gischt, und selbst die Alteingesessenen der Region, die das Meer seit Generationen im Blut hatten, gaben den alten Vers weiter, in dem es hieß, dass die Küste zwischen Padstow Point und der kleinen einsamen Insel von Lundy bei Tag und bei Nacht der Seeleute Grab sei. Vom Salzwasser aufgequollene, verwitterte Spanten und zersplitterte Masten, von der Brandung an Land gespuckt, zeugten vom unglücklichen Schicksal vieler Schiffe, denen die Launen von Sturm und Wellen zum Verhängnis geworden waren. Noch im Tageslicht schien diese Gegend düster und voller Dämonen – Namen wie Demon’s Cove, Devil’s Creek oder The Hanged Man für einen besonders bizarr geformten Teil der Klippen sprachen für sich; kaum zu glauben, dass nur wenige Meilen weiter südlich die Küste Cornwalls sonnenüberglänzt und farbenfroh sein sollte. Selten waren die Tage, an denen die Sonne den Dunstschleier über der Bucht durchbrach und für kurze Zeit der See einen blauen Schimmer, der Landschaft eine Spur grüner Hoffnung verlieh; danach versank der Küstenabschnitt von World’s End wieder in seiner Trostlosigkeit, die bis ins Mark von Mensch und Tier drang. Stunden konnten vergehen, ohne dass man auch nur die Silhouette einer einzelnen Möwe zu Gesicht bekam.
Doch nicht allein deshalb erregte die einsame Reiterin die Aufmerksamkeit des Mannes oben auf der Klippe; es war die Art und Weise, wie sie ritt – im Herrensitz, wild und halsbrecherisch, in einem Wirbel von brauner Pferdemähne und hellem Frauenhaar, dunklem Rocktuch und weißen Unterrocksäumen. Sand und Gischt stoben unter den donnernden Hufen auf. Als er sah, wie sie allmählich langsamer wurde, wendete er sein Pferd.
Achilles schnaubte und schüttelte sich, und Helena konnte nicht unterscheiden, ob es ihr eigener Atem war oder der des alten, schon ein wenig schwerhörigen Wallachs, der ihr so laut in den Ohren klang. Der rasante Galopp, der scharfe Wind, der von Norden her die Klippen entlang schnitt, hatten ihr Tränen in die Augen getrieben. Doch ihnen folgten andere, die ihre Ursache in den Ereignissen dieses Nachmittags und der Tage zuvor hatten. Sie ließ die Zügel locker, um sich mit dem Handrücken über die brennenden, nassen Wangen zu fahren, und Achilles, froh, ihrer heute so harten Hand entkommen zu sein, schlug einen gemächlicheren Schritt ein, blieb schließlich stehen, um Atem in seine müden Lungen zu schöpfen. Helena griff nicht ein; mit einem bitteren Zug in ihrem jungen Gesicht starrte sie auf das Meer hinaus, dessen monoton wütendes Rauschen sie Tag und Nacht begleitete, seit sie die griechische Heimat und mit ihr ihre Mutter und ihren Vater, wie sie ihn gekannt hatte, verloren hatte.
Eine einzige bitterkalte Januarnacht hatte alles zerstört. Arthur und Celia waren im Theater gewesen, anschließend bei einem Souper. Da Celia über leichtes Unwohlsein geklagt hatte, waren sie noch vor dem zweiten Gang aufgebrochen und hatten die Droschke in die Broadwick Street genommen. Frischer Schnee war gefallen, der die Straßen und die Häuser mit ihren Giebeln und Mauervorsprüngen wie gezuckert wirken ließ. Nichts davon verriet, dass sich unter seiner samtigen Oberfläche spiegelndes Eis gebildet hatte. Celia glitt auf den Stufen zur Eingangstür aus, und obwohl Arthur sie aufzufangen versuchte, stürzte sie. Mit dem Schrecken schien das Schlimmste überstanden zu sein, doch noch während Margaret, die treue Seele, die Celia seit ihrer Flucht aus dem goldenen Käfig ihres Elternhauses begleitet hatte, bis nach Griechenland und wieder zurück, sie auszukleiden und für die Nacht herzurichten begann, setzten Wehen ein, vier Wochen vor der Zeit.
Hastig in Decken gehüllt, wurde eine aus dem Schlaf aufgeschreckte und verwirrte Helena zur Schwester der Köchin gebracht, die zwei Straßenzüge weiter in Diensten stand, damit das kleine Mädchen nicht die qualvollen Schreie ihrer Mutter mit anhören musste, die Stunde um Stunde die nächtliche Stille des Hauses zerrissen. Als der silbrig blaue Morgen über der so still unter ihrer Schneedecke liegenden Stadt anbrach, war Arthur Lawrence Vater eines Sohnes – und Witwer.
Nach Celias Tod verfiel er zusehends, trank zu viel und aß zu wenig, kümmerte sich weder um den winzigen, schreienden Säugling noch um die in Fassungslosigkeit erstarrte Helena. Nichts schien ihn mehr berühren zu können. Erst das Drängen seiner Freunde, er sollte sich der Kinder wegen wieder verheiraten, riss ihn aus seiner Lethargie. Innerhalb einer Woche hatte er einen Nachmieter für das Haus gefunden, Leinwand, Pinsel und Farben verbrannt, die notwendige Habe gepackt und London verlassen.
Sie fuhren in Richtung Westen, nach Cornwall, woher Margaret stammte. Das windschiefe Haus aus rauem Stein, abseits der Küstenstädtchen Boscastle und Padstow, wurde ihr neues Heim, und während Margaret für die beiden Kinder sorgte, vergrub sich Arthur zwischen den Klassikern der Antike, auf der fieberhaften Suche nach Trost in seiner Trauer, auf der Flucht aus einer für ihn unerträglich gewordenen Welt.
Jenes eine Bild, ein paar wenige Schmuckstücke aus Korallen und venezianischen Glasperlen und schattenhafte Erinnerungen an Celias nach Lavendel und Petitgrain duftenden Berührungen waren alles, was Helena von ihrer Mutter geblieben war. Doch wenigstens hatte sie sich diese bewahren können, waren sie nicht so grausam zerstört worden wie die an ihren Vater, wie er einst gewesen war. Von Jahr zu Jahr fiel es Helena schwerer, sich an den Vater zu erinnern, den sie einmal gehabt hatte, wie er unter südlicher Sonne an der Staffelei gestanden und mit mal energischen, mal zärtlichen Bewegungen diese wunderbaren Bilder auf die Leinwand gezaubert hatte, sodass sie unwillkürlich den Atem angehalten hatte, um die Magie dieser Augenblicke nicht zu stören; wie er mit ihr gescherzt und in den Wellen umhergetollt, sie emporgehoben hatte, der Sonne entgegen, bis sie sie fast berühren zu können glaubte. Diesen Vater hatte es von einem Tag auf den anderen nicht mehr gegeben; ihn hatte eine unbegreifliche Macht zusammen mit Celia von ihr fortgeholt und einen verhärmten Mann zurückgelassen, vorzeitig vergreist, umgeben vom süßlichen Geruch des Alkohols, der seine Sinne allmählich abtötete. Helena hatte ihn dafür gehasst, dass er ihnen nur wenig mehr als Gleichgültigkeit entgegenbrachte. Oft erschütterte er brüllend und türenschlagend das Haus in seinen Grundfesten, um wenig später beschämt seine Hände auf ihre hellen Köpfe zu legen und sie damit in einen Zustand zweifelhaften Glücks zu versetzen. Dieser Mann war nun am Tag zuvor zu Grabe getragen worden, hier in der steinigen, toten Erde Cornwalls, und Helena wusste nicht, ob sie trauern oder erleichtert sein sollte.
Bitterkeit erfüllte sie, wenn sie an die Armut dachte, die sie erfahren hatten, die sie auch in dieser kargen Gegend ausgrenzte, während ihr Vater Hunderte von Pfund unwiederbringlich in irgendwelche geistigen Luftschlösser investiert hatte und sie beide nun am existentiellen Abgrund zurückließ. Die Angst um ihre und Jasons Zukunft schnürte ihr die Kehle zu, und gegen ihren Willen überließ sie sich dieser Schwäche. Sie tröstete sich damit, dass nur Achilles, das Meer und der Wind um ihre Tränen wussten und sie nicht verraten würden.
»Sie sind eine bemerkenswerte Reiterin.«
Mit einem Aufschrei riss sie an den Zügeln, als Achilles sich erschrocken aufbäumte und bockte, in einem Anflug von Panik ausbrach. Für einen Augenblick verlor sie das Gleichgewicht, drohte aus dem Sattel zu rutschen, fing sich rasch wieder, gestattete dem verwirrten Pferd eine paar schnelle, stolpernde Schritte, ehe sie ihn ausbremste und energisch wendete, in die Gischt hinein, die sie an seiner zitternden Hinterhand aufspritzen spürte.
»Sind Sie verrückt?«, schrie sie den fremden Reiter an, der wie aus dem Nichts hinter ihr aufgetaucht war. »Was zum Teufel fällt Ihnen ein, sich so anzuschleichen?« Wütend schob sie die Haarsträhnen aus dem Gesicht, die ihr vor die Augen gefallen waren und ihr die Sicht nahmen.
Im ersten Moment glaubte sie, einen Zentauren vor sich zu haben. Sie sah kaum, wo der Leib des Pferdes aufhörte und die Gestalt des Reiters in seinem dunklen Rock begann. Der Wind blies ihm das etwas zu lange Haar aus dem scharf geschnittenen, südländisch anmutenden Gesicht mit dem dichten Oberlippenbart – nachtschwarz war es, wie das schimmernde Fell seines Hengstes, der Achilles reglos und mit geblähten Nüstern musterte. Helena fühlte sich an die zahllosen Raben und Krähen erinnert, die in den verkrüppelten Bäumen hockten und mit ihrem heiseren Hab Acht, hab Acht aufflogen, das einem einen Schauder über den Rücken laufen ließ. Der Reiter verbeugte sich leicht im Sattel.
»Ich bitte Sie um Verzeihung, Miss. Es lag nicht in meiner Absicht, Sie und Ihr Pferd zu erschrecken und Sie dadurch in Gefahr zu bringen.« Seine Stimme war tief, mit einem kaum wahrnehmbaren Akzent darin, als hätte er lange Jahre im Ausland verbracht. »Aber ich dachte, ich könnte Ihnen vielleicht behilflich sein.« Er hielt ihr ein zusammengefaltetes Taschentuch hin, eher auffordernd denn mitfühlend.
Helena schoss das Blut ins Gesicht, peinlich berührt, dass ein Fremder beobachtet hatte, wie sie weinte, sie hilflos und schwach gesehen hatte. Übertrieben energisch warf sie ihr Haar zurück, das der Wind ihr immer wieder ins Gesicht wehte, und setzte eine stolze Miene auf.
»Vielen Dank«, gab sie herablassend zurück, »aber das ist nicht nötig!«
»Wie Sie meinen,« entgegnete er vergnügt und steckte das Tuch wieder ein. Lässig stützte er sich auf den Sattelknauf und musterte Helena eindringlich, als hätte er alle Zeit der Welt. Sie fühlte sich unbehaglich unter seinen forschenden, beinahe begutachtenden Blicken. Auf Anhieb hatte sie bemerkt, dass die Kleidung des Fremden elegant und modisch war, gut geschnitten und aus teuren Stoffen.
Um ihr äußeres Erscheinungsbild hatte sie sich nie weiter gekümmert – Kleidung hatte praktisch zu sein und sie nicht allzu sehr einzuengen; ein kleiner Riss mehr oder weniger, staubige Reiterstiefel oder Schlammspritzer auf ihren Rocksäumen waren nie etwas gewesen, das ihr Kopfzerbrechen bereitet hatte. Doch nun sah sie sich mit anderen Augen: das Trauerkleid aus kratzigem Wollkrepp, das ursprünglich einer Base Margarets gehört hatte, mit seinen weiten Röcken mittlerweile völlig unmodern und ihr an den Ärmeln zu kurz, ihr wildes, unordentliches Haar, ihre geröteten und rissigen Hände, die Reitgerte und Zügel umklammert hielten. Sie verspürte den brennenden Wunsch, ein bisschen mehr herzumachen als das. Beschämt wandte sie ihren Blick ab und fuhr sich verstohlen mit dem Handrücken über die nassen Wangen.
»In der Tat, bemerkenswert«, fasste der Fremde das Ergebnis seiner Betrachtung schließlich zusammen, und seine Stimme ließ Helena aufsehen. In seinen fast schwarzen Augen stand ein Funkeln, und eine Spur überheblichen Amüsements glitt über sein Gesicht, wie das eines Menschen, der sich an die Langeweile eines materiell gesicherten Lebens gewöhnt hat und der nun die Gelegenheit bekommt, einen anekdotischen Blick auf eine in den trüben Farben der Armut colorierte Szenerie zu werfen. Zorn und Scham vertieften die Röte auf Helenas Wangen, und finster erwiderte sie seinen Blick. Sein Mund unter dem Oberlippenbart verzog sich zu einem Lächeln, halb scherzhaft, halb spöttisch.
»Ich war mir sicher, bereits alle Dorfschönheiten in dieser Einöde zu Gesicht bekommen zu haben, aber Sie scheinen sich bislang vor mir versteckt gehalten zu haben.«
Margarets Warnungen kamen ihr in den Sinn, mit denen sie vergeblich versucht hatte, Helena von ihren Ritten am verlassenen Strand abzubringen, von unmoralischen Männern, die jungen Mädchen wie ihr auflauerten, um ihnen unaussprechliches Leid anzutun. Sie hatte diese Worte bislang mit einem unbekümmerten Lachen abgetan. Ohne sich zu bewegen, als gäbe es eine telepathische Verbindung zwischen ihm und seinem Pferd, ließ der Fremde es einen großen Schritt vorwärts machen, auf Helena zu, so dicht, dass sie den Geruch des Rappen wahrnehmen konnte und Achilles gelähmt vor Schreck seine Hufe in den Sand drückte. In einem Reflex holte sie mit ihrer Gerte aus und konnte im nächsten Augenblick nur mühsam einen Schmerzenslaut unterdrücken, als der Fremde sie in ihrer Bewegung hart am Handgelenk packte, so schnell, dass er sich gar nicht gerührt zu haben schien, und so fest, dass sie beinahe aus dem Sattel glitt.
»Vorsicht, Miss«, sagte er kalt, »ich habe bereits einen Schmiss im Gesicht – ich brauche keinen zweiten.«
Erst jetzt bemerkte Helena die Narbe, die quer über seine linke Wange lief. Einmal mehr errötete sie und fühlte sich beschämt und verlegen, unsicher, wie sie reagieren sollte.
»Ich kann Sie beruhigen«, fuhr er besänftigend fort, ohne jedoch den Druck seiner Finger zu verringern, »ich habe keineswegs die Absicht, Ihnen Gewalt anzutun. Eine solche Torheit hatte ich bislang nicht nötig, und ich werde ganz gewiss nicht heute damit anfangen. Obwohl«, gänzlich unverfroren ließ er seinen Blick über ihre Silhouette wandern, »obwohl eine solche Überlegung grundsätzlich vielleicht lohnenswert wäre …«
Er sah ihr wieder in die Augen, und sein spöttisches Lächeln vertiefte sich. Wie unter einem Bann starrte Helena ihm in die Augen, die sie wie in einem Sog zu ihm zu ziehen schienen, und sie glaubte, seitwärts aus dem Sattel zu rutschen. Ihr war heiß, und gleichzeitig spürte sie, wie sie eine Gänsehaut bekam. Ein unerklärliches, fremdartiges Gefühl zog ihr den Magen zusammen, breitete sich in ihr aus, ließ Herzschlag und Atem aus dem Takt kommen. Doch dann sah sie das Glitzern in seinen Augen, das erwartungsvolle Kräuseln seiner Mundwinkel, und erkannte, dass er genau wusste, was in ihr vorging, und dass er es genoss.
Zorn flammte in ihr auf, und sie straffte sich wieder, suchte sich ihm zu entwinden, erwiderte fest und unbeirrbar seinen Blick.
»Lassen Sie mich los – auf der Stelle«, forderte sie ihn leise, aber bestimmt auf und setzte mit einem leisen Fauchen hinzu, »Sie eitler, aufgeblasener Lackaffe – Sie Snob!«
Ein breites Lächeln erhellte sein Gesicht, ebenso unverschämt wie charmant. Helena wartete atemlos auf eine Erwiderung oder gar eine Handgreiflichkeit, doch ebenso plötzlich, wie er ihr Handgelenk gepackt hatte, ließ er es nun wieder los. Seine Finger hinterließen pochende, gerötete Male darauf.
Ihr Kinn herausfordernd in die Luft gereckt, zog sie Achilles’ Zügel an, wollte ihr Pferd an ihm vorbeilenken, doch wie selbstverständlich ließ der Fremde seinen Hengst vorwärts gehen und schnitt ihr den Weg ab. Helena schluckte, bemüht, sich ihre Verunsicherung, ja Angst, nicht anmerken zu lassen. Sie ahnte, dass er sie nicht einfach so gehen lassen würde – gleich, ob sie vorwärts in Richtung der steil aufstrebenden Klippen oder den offenen Strand entlang auszuscheren versuchte, er würde immer einen Lidschlag schneller sein, so sicher, wie er auf seinem Pferd saß. Seine Augen funkelten amüsiert, und Helena begriff, dass er mit ihr spielte und um seine Überlegenheit wusste.
Zu ihrer Linken erhob sich der Teil der Klippen, der als Witch’s Head bekannt war – ausgewaschene Stellen und Verwerfungen in einer Felswand, die leeren Augenhöhlen und dem wirren Haar eines Gorgonenhauptes ähnelten. Ein großer, an einen zahnlosen Mund erinnernder Hohlraum öffnete sich auf eine Landzunge aus nacktem Fels hinaus, die quer über den Strand hinweg bis ins Meer hineinkroch, an deren zersprungener Oberfläche sich pfeifend und zischend Wellen brachen, Strudel und Wirbel bildeten.
Sie riss an den Zügeln und bohrte Achilles ihre Absätze in die Flanken, zwang den Wallach scharf zur Seite. Er scheute, als sich vor ihm die raue Erhebung der Felsenzunge aufbaute, doch unerbittlich nötigte Helena ihn vorwärts. Mit zitternden Hufen hievte der Braune seinen gedrungenen Körper hinauf, fand in der Steinkruste Schritt für Schritt Halt, strauchelte und fing sich wieder, schlitterte auf der anderen Seite hinab, ehe er mit einem erleichterten Sprung im Sand landete und in einen fluchtartigen Galopp stolperte.
Fasziniert hatte der Fremde ihrem Husarenstück zugesehen, ohne Anstalten zu machen, ihr nachzusetzen, verfolgte mit seinem Blick das plumpe Pferd, das in einer Fontäne schweren Sandes auf der anderen Seite des Strandes davonpreschte.
Mit einem schwer zu deutenden Ausdruck in den Augen wandte er sich zu dem zweiten Reiter um, der wie ein Schatten hinter ihm aufgetaucht war.
»Ich will wissen, wer sie ist.«
An diesem Abend rührte Helena stumm und geistesabwesend in ihrer Kohlsuppe, ein Gericht, das sie ohnehin noch nie sonderlich gemocht hatte. Dass Margaret zum Trost für sie alle echten Speck hineingeschnitten hatte – auf ein paar Pennys mehr oder weniger kam es dieser Tage ja nun wohl auch nicht mehr an, hatte sie beschlossen –, bemerkte sie nicht einmal. Margaret warf ihr hin und wieder über den Tisch hinweg einen beunruhigten Blick zu, bezog Helenas heutige Schweigsamkeit aber auf den Besuch des Anwalts und dessen Eröffnung ihrer desolaten finanziellen Lage, und so schwieg sie ebenfalls, weil es nichts gab, was sie dazu Tröstendes hätte sagen können. Nur hin und wieder strich sie liebevoll über den strohblonden Kopf Jasons, dem die Ereignisse der letzten Tage, und die gedrückte Stimmung im Haus sichtlich zu schaffen machten, voller Sorge, was nun aus ihnen werden sollte.
Helena ging früh zu Bett, doch obwohl ihr Körper schwer war vor Erschöpfung, fand sie keinen Schlaf. Immer wieder betastete sie ihr Handgelenk, das noch immer brannte und schmerzte vom unerbittlichen Griff des Fremden, sah ihn im Geiste immer wieder vor sich, hörte seine Stimme, die etwas in ihr zum Klingen gebracht hatte, für das sie keinen Namen hatte. Endlich glitt sie in einen unruhigen Schlaf hinüber, in dem sie sich an einem Strand wiederfand. Tief hingen die schwarzen Wolken eines herannahenden Sturmes am fahlgrauen Himmel, und erste Windböen ließen das Meer aufkochen, Brecher mit voller Wucht ans Ufer klatschen. Ein Rabe, größer als sie selbst, breitete drohend vor ihr seine Schwingen aus, krächzte: Hab Acht, hab Acht, und seine funkelnden Augen waren die des Fremden.
2
An der Küste Cornwalls gab das Meer den Rhythmus vor, und sein Kommen und Gehen war der beständige, beruhigende Herzschlag des Landes und seiner Menschen. Es war ein eigentümlicher Menschenschlag, der hier lebte, bedächtig und bodenständig, geprägt durch das herbe Klima und die raue See. Sie waren den alten Zeiten verbunden, als Cornwall noch keltisch gewesen war, ihre Ahnen waren Schmuggler und Piraten, und noch bis in die jüngste Zeit hinein gab es dem Hörensagen nach Dorfbewohner, die im Sturm gekenterte, an den Felsen zerschellte Schiffe plünderten, manchmal gar Leuchtfeuer auf den Klippen entzündeten, die Segler in die Irre führten, in den sicheren Tod hinein. Tief verwurzelt waren sie im kargen Boden ihres Landes und ein wenig weltfremd; kaum jemand von ihnen war je weiter gereist als bis zum benachbarten Marktflecken oder in die nächstgelegene Stadt. Und die Geschichten, die sie sich an den langen Abenden erzählten, von Elfen und Feen, von Riesen und Rittern, von Druiden und Zauberinnen, schienen mehr Historie denn Mythos oder Märchen.
Sue Ansell war eine von ihnen, vor rund vierzig Jahren nur zwei Haustüren von dem Laden entfernt geboren, in dem sie nun schon über die Hälfte ihres Lebens verbracht hatte, zwischen Mehl, Zucker, Schuhwichse, Nähgarn und all den anderen Dingen des täglichen Lebens, die wenigen Briefe und Pakete, die das Dorf erreichten oder verließen, eingeschlossen. Ihren George hatte sie schon gekannt, ehe sie laufen konnte, und ihn in St. Stephen’s, auf einem kleinen Hügel vor der Stadt gelegen, geehelicht.
In den engen Zimmern über dem Laden hatte sie sechs Kinder empfangen, zur Welt gebracht und großgezogen, zwei davon auch dort wieder verloren – einen ihrer Söhne an der Staublunge, die er sich in der Zinnmine geholt und sich über Monate hinweg Stück für Stück aus dem Leib gehustet hatte. Ein Radius von fünf Yards reichte aus, um eine Karte von Sues Leben zu zeichnen.
Jeden Morgen öffnete sie pünktlich ihren Laden und schloss ihn abends wieder, sechs Tage die Woche. Nur sonntags, am Tag des Herrn, blieb die blaugestrichene Tür mit den Butzenscheiben verschlossen. Sie kannte jeden im Dorf, und jeder kannte sie, und was es an Klatsch und Tratsch in diesem Mikrokosmos gab, lief am hölzernen Tresen ihres Ladens zusammen, verteilte sich von dort weiter in die Küchen und Stuben und den einzigen Pub des Dorfes – wer ein Kind erwartete, wer im Sterben lag, wer wem schöne Augen machte und bei wem der Haussegen schief hing.
Doch langsam, kaum merklich, begannen sich die Zeiten zu ändern. Eine Zinnmine nach der anderen war erschöpft und wurde aufgegeben, hinterließ Arbeiter, die für andere Tätigkeiten nicht mehr zu gebrauchen waren, weil sie sich darin krankgeschuftet hatten, und andere, für die es keine Möglichkeit zum Broterwerb gab in einer Gegend, in der die Menschen mehr schlecht denn recht von dem lebten, was ihre kargen Felder hergaben, ihre Schafe und Kühe, von dem, was der Fischfang einbrachte.
Allerlei Wundersames hatte man nun auch schon vom Herrenhaus von Oakesley Manor gehört, seit es vor über einem Jahrzehnt eine neue Ladyschaft bekommen hatte. Wenig war übrig geblieben vom feudalen, aber ländlich geprägten Lebensstil der früheren Bewohner. Nicht genug, dass ihre Ladyschaft mehrmals im Jahr mit einem vollbepackten Wagen ins ferne London fuhr und sich dort wochenlang vergnügte, unbesorgt um die Kümmernisse und Sorgen ihrer Pächter. Jedes Mal kehrte sie mit Kisten und Schachteln zurück, die neue Kleider aus Samt und Seide enthielten, mit Spitzen, Stickereien und Posamenten, kleine Hüte, die von künstlichen Blüten und Bändern überquollen, elegante Schuhe mit hohen Absätzen. Und nun hatte sich dort auch noch Besuch eingefunden, wichtiger Besuch, wenn man den Erzählungen der Mädchen und Burschen vom Landsitz Glauben schenken durfte, ein Gentleman, der die Augen der Stubenmädchen glänzen ließ, wenn sie von ihm erzählten, und von dem die Burschen ebenso abfällig wie neidvoll sprachen. Geradezu märchenhaft muteten diese Erzählungen an, wenn darin der Orientale vorkam, mit dunkler Haut und einem Turban auf dem Kopf, der in dessen Diensten stand. Nein, sagte sich Sue Ansell kopfschüttelnd immer wieder, wenn sie davon hörte, früher hätte es so etwas hier nicht gegeben!
Deshalb blieb ihr an diesem grauen, stürmischen Novembertag beinahe das Herz stehen, als sie mit ihrer frisch gestärkten blauen Schürze wie jeden Morgen den Schlüssel in der Ladentür von innen umdrehte – einmal, zweimal –, und besagter Orientale vor ihr stand, in hellen Reiterhosen und langer Jacke mit einem kleinen Stehkragen, eine goldene Kordel quer über dem Oberkörper, wie das Rangabzeichen eines fremden Regimentes. Wie Lots Frau stand Sue da, den Mund sperrangelweit offen, und starrte diesen Menschen an, mit seiner braunen Haut und dem graumelierten Bart, und der Krönung an Exotik, dem leuchtend roten Turban, der sie mit seinen Wickelungen an eine Zwiebel erinnerte. Am liebsten hätte sie nach ihrem Mann gerufen, den sie im Lagerraum hinten kramen hörte, doch sie brachte keinen Laut heraus. Und dann sprach sie dieser Fremde auch noch an, in fehlerlosem, wenn auch nicht akzentfreiem Englisch, und verneigte sich höflich vor ihr.
»Guten Morgen, Madam, verzeihen Sie die frühe Störung – aber führen Sie zufällig auch Zündhölzer?«
»Zündhölzer?« Sues Stimme klang heiser. Sie klappte ein paarmal den Mund auf und wieder zu, ehe ein Ruck durch ihren Körper ging und sie energisch ihre ohnehin makellose Schürze glatt zog.
»Natürlich führen wir Zündhölzer«, entrüstete sie sich und fand in ihrer seit Jahren geübten Rolle der Geschäftsfrau Sicherheit. Sie eilte hinter die Theke, kramte in einem Fach unter der Tischplatte und legte eine Schachtel davon vor ihren befremdlichen Kunden, erleichtert, sich hinter ihrem hölzernen Schutzwall verschanzen zu können.
Der Fremde bezahlte mit einem Sixpence und verzichtete mit einer großzügigen Handbewegung auf sein Wechselgeld, fragte dann nach diesem und jenem, sprach über das Wetter, machte ihr Komplimente über den Laden und ihr adrettes Auftreten, die Sue erröten ließen wie ein junges Mädchen. Bald schon waren sie mitten in einer angeregten Unterhaltung über Cornwall, das Dorf und seine Bewohner, und so dachte sich Sue nichts dabei, als er sie nach einem jungen Mädchen mit wilden blonden Locken fragte, in einem schwarzen Kleid und auf einem zottigen braunen Pferd.
»Das muss die kleine Lawrence sein. Traurig, das mit ihrem Vater, aber der war ohnehin nicht ganz richtig im Kopf. Seltsamer Mensch, Künstler eben. Die Haushälterin, Marge, stammt hier aus der Gegend. Hat als junges Ding ihre Sachen gepackt und ist in die Stadt gefahren. War wohl ein ziemlicher Aufruhr damals. Na, wer weiß, warum sie auf und davon ist, ohne Grund macht so was doch niemand! Und dann war sie plötzlich wieder hier, mit ihrem Dienstherrn und den beiden armen mutterlosen Kindern, der Junge noch ein ganz kleines Würmchen. Wir haben sie hier nicht oft gesehen, sie hatten ja nie Geld. In die Schule sind die Kinder nicht gegangen, auch nicht zur Kirche. Marge manchmal, hat aber kaum je mit einem ein Wort gewechselt. Gestern war wohl ein Anwalt bei ihnen, wegen der Nachlassgeschichte, hat drüben im Pub übernachtet«, sie unterbrach ihren im Plauderton gehaltenen Redeschwall und ließ ihre Blicke wachsam durch den Laden huschen, als hätten sich zwischen den Regalen, Säcken und Fässern unliebsame Lauscher versteckt, dann reckte sie ihren kurzen, kompakten Körper über die Theke, dem Orientalen entgegen und fügte flüsternd hinzu: »Man hört, sie sind bankrott. Keinen Penny mehr, nur einen Haufen Schulden!« Sie schüttelte bedauernd den Kopf und wischte emsig mit einem Zipfel ihrer Schürze über die blitzblanke Tischplatte. »So was kommt von so was, wenn man sich für was Besseres hält. Helena – schon allein dieser Name! Kein vernünftiger Mensch lässt sein Kind so taufen – wahrscheinlich ist sie nicht mal getauft! Die Kinder können ja nichts für, aber draufzahlen tun sie jetzt dennoch. Keine Ahnung, was aus ihnen werden soll … Kein Bursche aus dem Dorf mit ’nem bisschen Hirn wird das Mädel freien. Ist schlecht erzogen, hat sich immer alleine draußen rumgetrieben, hat nichts, was sie in die Ehe mitbringen kann, und ist dazu nicht einmal hübsch. Nein, nein«, seufzte sie dann auf, »was für ein Elend – so was hätte es früher nicht bei uns gegeben …«
Als der exotische Fremde endlich den Laden verlassen hatte und hinter der nächsten Ecke verschwunden war, sprangen in den Nachbarhäusern fast gleichzeitig Türen auf, eilten die Hausfrauen herbei, die hinter ihren Fenstern, in ihren Vorgärtchen das Kommen des Orientalen beobachtet hatten, und bestürmten unter dem Vorwand, dringend noch Zwirn oder eine Nähnadel zu benötigen, Sue mit Fragen nach dem seltsamen Besuch. Und Sue erzählte bereitwillig, schmückte die Begegnung verschwenderisch aus, erzählte, er sei sehr interessiert an der Gegend und ihren Bewohnern gewesen, und die Frage kam auf, ob sein reicher Dienstherr vielleicht zu bleiben gedächte und warum, und in der an Spekulationen reichen Diskussion, die sich daraus entspann, hatte Sue bereits vergessen, dass auch Helena Gegenstand der Unterhaltung gewesen war.
Es war Nachmittag, als der Orientale die Tür zu dem Salon öffnete, der die beiden Gästezimmer im Nebenflügel von Oakesley Manor miteinander verband. Sein Dienstherr, leger in Hemd und Reiterhosen, hatte es sich in einem der blau-golden bezogenen Sessel bequem gemacht. Bei seinem Erscheinen senkte er die Zeitung, in die er vertieft gewesen war, und sah ihn erwartungsvoll an.
»Und?«
Der Mann mit dem Turban warf lässig die Zündholzschachtel auf den niedrigen Tisch mit den geschwungenen, geschnitzten Beinen. Sein Gegenüber runzelte die Stirn.
»Ist das alles?«
Ohne dazu aufgefordert zu sein, ließ sich der Orientale mit einem leisen Seufzen in dem zweiten Sessel nieder, streckte die Beine in den hellen, eng anliegenden Hosen und Reiterstiefeln weit von sich und begann, Sue Ansells Erzählung über das Mädchen am Strand zu rekapitulieren. Während er sprach, faltete sein Herr die Zeitung zusammen, legte sie beiseite und zündete sich mit den Streichhölzern aus Sues Laden eine Zigarette an.
In Europa und Übersee von Hand aus feingeschnittenem Tabak und dünnstem Papier gerollt, galten die teuren vorgefertigten Zigaretten in England und Frankreich als Luxusgüter. Während ihre Väter und Großväter noch missbilligende Blicke unter erhobenen Augenbrauen warfen, zogen die Söhne der Lords, Barons und Bankiers abends in ihren Salons und Clubs genüsslich an dem in seiner Papierhülle glimmenden Tabak, der so à la mode war. Wer es sich leisten konnte, umgab sich sogar mit einem Hauch von Exotik, wenn er Zigaretten rauchte, die aus den Manufakturen von Kairo stammten.
»Ich hatte Glück«, fuhr der Bedienstete des Fremden fort, »und traf diesen Anwalt noch im Pub an. Er war gerade im Begriff, wieder abzureisen, schien es gar nicht erwarten zu können, von hier fortzukommen. Ich konnte ihn jedoch überreden, noch ein, zwei Stunden zu bleiben und mir Gesellschaft zu leisten.«
Sein Gegenüber grinste und steckte sich eine neue Zigarette an. »Ich nehme an, deine Argumente waren einige Pfund schwer.«
Der Orientale schnaubte, dass seine Nasenflügel über dem graumelierten Bart verächtlich bebten.
»Die Loyalität gegenüber seinen Mandanten war diesem schmierigen kleinen Winkeladvokaten jedenfalls nicht allzu viel wert!«
Seine Worte ließen aus dem gegenüberliegenden Sessel ein Lachen ertönen.
»Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut du die Feinheiten des Englischen beherrschst, Mohan!«
Wäre jemand aus dem Haus unbemerkt Zeuge dieser Unterhaltung gewesen – er hätte sich über die Vertrautheit der beiden gewundert, die so gar nicht den Gepflogenheiten zwischen Herrschaft und Bediensteten entsprach. Doch es gab niemanden, der darüber erstaunt sein konnte, denn sie war allein auf die Momente beschränkt, in denen sie sich gänzlich unter vier Augen wussten, ehe sie wieder in die Rollen zurückfielen, die sie in der Gesellschaft spielten.
»Ich ziehe es vor, die Dinge beim Namen zu nennen«, kam prompt die Antwort, von einem Augenzwinkern unterstrichen, ehe Mohans Gesicht mit der braunen Haut wieder ernst wurde.
Aus dem Gedächtnis zitierte er die Zahlen, die ihm Edward Wilson genannt hatte, umriss die Familiengeschichte der Lawrences, berichtete von dem Beschluss, Helena und ihren Bruder in die Obhut ihres Vormunds zu geben, und fügte abschließend hinzu: »Die Anleihe für das Haus und die paar Quadratmeter Fels, auf denen es steht, läuft übrigens auf den Namen unseres geschätzten Gastgebers Sir Henry Claydon. Es gehört ihm also schon praktisch, wenn es auch ein schlechtes Geschäft war: Die Summe ist bei weitem höher als der tatsächliche Gegenwert.«
»Und ich nehme an, mehr als die trauernden Hinterbliebenen aufzubringen imstande sind?«
Mohan nickte bestätigend. Eine kleine Pause trat ein, in der der Fremde nachdenklich mit zusammengekniffenen Augen dem Zigarettenrauch nachsah.
»Was hast du vor?«, fragte sein Bediensteter schließlich. »Zu welchem Zweck sollte ich dir all diese Informationen beschaffen?«
Der andere beugte sich vor und drückte die Zigarette in einem Aschenbecher aus Kristall aus.
»Was du erzählt hast, scheint wieder einmal meine Überzeugung zu bestätigen, dass nahezu alles käuflich ist«, sagte er leise, mehr wie zu sich selbst, ehe er sich wieder aufrichtete. Mit der Spitze seines blank geputzten Stiefels zog er den vor dem Kamin mit seinem knisternden Feuer stehenden Hocker ein Stück heran und legte die Füße auf das Polster, einen nach dem anderen. Er lehnte sich im Sessel zurück, die gebräunten schlanken Hände entspannt auf den Armlehnen ruhen lassend, und sah Mohan mit einem Glitzern in den Augen an.
»Was glaubst du – wie hoch wird der Preis unserer kleinen Wildkatze vom Strand sein?«
Mohans dichte Augenbrauen zogen sich zusammen. »Was hast du vor?«
»Ich weiß es noch nicht.« Sein Gegenüber zuckte leicht mit den Schultern und legte den Kopf zurück auf die Lehne, betrachtete ebenso nachdenklich wie vergnügt die Stuckgirlanden, die sich über die Decke zogen, scheinbar unbeeindruckt von den dunklen Augen, die ihn kritisch musterten, als ahnten sie, was hinter seiner Stirn vor sich ging. »Vielleicht heirate ich sie.«
»Das ist nicht dein Ernst.«
»Weshalb nicht?« Sein Herr streifte den Orientalen mit einem amüsierten Blick.
»Das ist kein Spiel, Ian!« Mohans Stimme mit dem leichten, fremdländischen Akzent blieb leise, und dennoch war sie bestimmt, fast drohend.
»Dann mache ich es zu einem.« Ian richtete seinen Blick wieder auf Mohan und setzte hart hinzu: »Oder glaubst du, du könntest mich daran hindern?«
Dieser schüttelte den Kopf, halb verärgert, halb betrübt. »Ich begreife dich nicht.«
»Das musst du auch nicht.« Mit einem Blick auf das bemalte Zifferblatt der unter ihrer Glasglocke dahintickenden Uhr auf dem Kaminsims erhob er sich. »Ich will mich noch umziehen, ehe der Tee drüben serviert wird. Mal sehen, wie sehr sich der herrschaftliche Fisch inzwischen am Köder festgebissen hat.«
Während auf Oakesley Manor die letzten Lichter gelöscht wurden, blinzelte im oberen Stockwerk von World’s End noch das schwache Flämmchen einer heruntergedrehten Lampe in seinem Glaszylinder. Helena lag noch immer wach und starrte an die Decke, während ihre Gedanken umherhuschten, sich den Weg versperrten, Haken schlugen, einander wieder im Kreis herumjagten, wie sie es schon den ganzen Tag getan hatten, den sie rastlos im Haus umhergewandert war, aber sie fand keine Lösung, keinen Ausweg. Es war frostig im Zimmer, und doch glaubte sie, keine Luft mehr zu bekommen. Sie schlug die Decke zurück und sprang aus dem Bett, eilte mit bloßen Füssen über den unebenen Holzboden, riss das Fenster auf und sog tief die nasskalte Nachtluft ein. Es regnete, wieder einmal, und durch das gleichmäßige Rauschen drang das Donnern der Brandung an den Klippen. Seit sie englischen Boden betreten hatte, war ihr kalt gewesen, und nachdem ihre Mutter gestorben war, schien etwas in ihr eingefroren zu sein. Sie sehnte sich nach Sonne, nach Sonne und Wärme und einem leichten Herzen, wie sie es als Kind in Griechenland gehabt hatte. Würde sie nie wieder gute, sorglose Zeiten erleben?
Ein Geräusch schreckte sie aus ihren Gedanken auf. Knatternd flog ein Vogel auf, krächzte mein, mein, mein, und dann hörte sie einen Hufschlag, der sich in schnellem Galopp in der Dunkelheit verlor.
Rasch schlug sie das Fenster zu und sprang wieder in ihr Bett, verkroch sich unter der Decke, in der sich über die Jahre die Federn zu festen Klumpen zusammengeballt hatten, doch ihr furchtsam schlagendes Herz wollte sich nicht beruhigen. Ein Schluchzen kroch ihr die Kehle hoch; sie spürte Tränen hinter ihren Augen, doch sie biss die Zähne zusammen, kniff die Augen fest zu. Ich werde einen Weg finden, versprach sie sich selbst, es muss einen geben – es muss …
3
Wenn wir für die Möbel auch nur einhundertfünfzig Pfund bekämen, könnten wir schon einen Teil der Schulden decken.« Helena legte den Federhalter neben das Blatt, auf dem sie Schätzwerte addiert hatte, und blies sich in die geballten Fäuste. Selbst das hoch auflodernde Feuer hier in der Küche konnte der feuchtkalten, nebligen Luft des späten Vormittags kaum Einhalt gebieten, die durch Ritzen im Mauerwerk hereinzog. Sie griff nach einem der pappig schmeckenden Plätzchen, die Margaret aus wenig Butter, noch weniger Zucker und viel billigen Haferflocken buk.
»Selbst wenn – wie willst du den Rest begleichen? Immerhin noch fünfhundertfünfzig Pfund. Und dann haben wir noch nichts zum Leben.« Margaret biss den Faden ab und betrachtete prüfend ihre Flickarbeit an einem von Jasons Hemden.
Helena zuckte mit den schmalen Schultern. »Als Gouvernante Arbeit suchen, als Näherin – das wird sich finden. Ich habe mir gestern beim Pastor die Wochenendzeitung ausgeliehen – ein paar Annoncen sind dabei, die sich gut anhören, und er hat mir auch noch zwei Adressen in Exeter gegeben.« Sie gab sich selbstbewusst, aber Margaret konnte die Unsicherheit in ihrer Stimme heraushören. Ebenfalls in Trauer gekleidet, das grau gesträhnte Haar straff zurückgebunden, seufzte sie unhörbar auf, ehe sie ihre Hand über den Tisch streckte und Helenas kalte, tintenbefleckte Finger damit umschloss.
»Ich will deine Hoffnungen nicht zunichte machen, mein Kind, aber wir beide wissen, dass du keine einzige gerade Naht zustande bringst, und außer dem bisschen Griechisch, das dir nach all der Zeit in Erinnerung geblieben ist, weißt du nur das, was du dir angelesen hast. Das wird nicht reichen, um – «
Der Klang des Türklopfers hallte wie ein Donnerschlag durch das Haus und ließ beide auffahren.
»Grundgütiger, wer mag das bloß sein«, murmelte Margaret und erhob sich hastig, das Hemd in einem unordentlichen Bündel zwischen Helenas Tintenfaß und den geschälten Kartoffeln und Rüben für das Mittagessen zurücklassend.