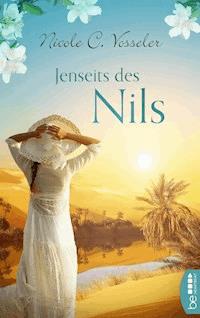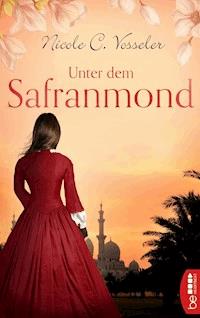5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Was erwartet sie am Ende des Rätsels? Der mitreißende Roman »Das Geheimnis des Perlenohrrings« von Nicole C. Vosseler jetzt als eBook bei dotbooks. Auf den Spuren des Schicksals ... Obwohl viele Jahre vergangen sind, seit sie ihre Eltern bei einem Brand verloren hat, erinnert sich Gemma immer noch voller Schrecken an diese Nacht. Die ganze Zeit scheint ein Puzzlestück zu fehlen, um zu verstehen, was damals passiert ist – bis zu jenem Tag, an dem sie ein mysteriöses Paket mit einem antiken Perlenohrring und den Zeilen eines alten viktorianischen Gedichts erhält. Gibt es einen Zusammenhang zu ihrem schrecklichen Verlust? Gemeinsam mit dem charmanten Oxfordprofessor Sisley Ryland-Bancroft begibt Gemma sich auf die Spurensuche ... Aber wie kann ein jahrhundertealtes Rätsel der Schlüssel zu ihrer eigenen Vergangenheit sein – und zu ihrer Zukunft? »Fein gesponnene und fesselnde Unterhaltung!« Kulturkurier Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Familiengeheimnisroman »Das Geheimnis des Perlenohrrings« von Nicole C. Vosseler, auch bekannt unter dem Titel »Die Farben der Erinnerung« wird Fans der Bestsellerautorinnen Corina Bomann, Kate Morton und Lucinda Riley begeistern! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Auf den Spuren des Schicksals ... Obwohl viele Jahre vergangen sind, seit sie ihre Eltern bei einem Brand verloren hat, erinnert sich Gemma immer noch voller Schrecken an diese Nacht. Die ganze Zeit scheint ein Puzzlestück zu fehlen, um zu verstehen, was damals passiert ist – bis zu jenem Tag, an dem sie ein mysteriöses Paket mit einem antiken Perlenohrring und den Zeilen eines alten viktorianischen Gedichts erhält. Gibt es einen Zusammenhang zu ihrem schrecklichen Verlust? Gemeinsam mit dem charmanten Oxfordprofessor Sisley Ryland-Bancroft begibt Gemma sich auf die Spurensuche ... Aber wie kann ein jahrhundertealtes Rätsel der Schlüssel zu ihrer eigenen Vergangenheit sein – und zu ihrer Zukunft?
»Fein gesponnene und fesselnde Unterhaltung!« Kulturkurier
Über die Autorin:
Nicole C. Vosseler, geboren 1972 am Rand des Schwarzwalds, finanzierte sich ihr Studium der Literaturwissenschaften und der Psychologie mit einer Reihe von Nebenjobs. Bereits früh für ihre Kurzprosa, für Essays und Lyrik ausgezeichnet, wandte sie sich später dem Schreiben von Romanen zu. Nicole C. Vosseler lebt in Konstanz, in einem Stadtteil, der ganz offiziell Paradies heißt. Wenn sie nicht an einem ihrer Romane arbeitet, reist sie mit der Kamera um die Welt, wo sie sich als selbsternannte Food-Ethnologin betätigt, trotz ihrer Höhenangst auch mal einen Vulkan besteigt und auch sonst das Abenteuer sucht.
Die Website der Autorin: nicole-vosseler.de
Die Autorin bei Facebook: facebook.com/Nicole-C-Vosseler
Die Autorin auf Instagram: instagram.com/nicolecvosseler/
***
eBook-Neuausgabe August 2023
Dieses Buch erschien bereits 2017 unter dem Titel »Die Farben der Erinnerung« bei Goldmann.
Copyright © der Originalausgabe 2017 by Nicole C. Vosseler, 2017 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-787-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Geheimnis des Perlenohrrings«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Nicole C. Vosseler
Das Geheimnis des Perlenohrrings
Roman
dotbooks.
Only connect ...
E. M. FORSTER
Für meinen Vater
Prolog
Die Nacht ist still, geschmeidig wie Olivenöl. Nach sonnengetränktem Stein duftet sie, nach Rosmarin und Thymian, beerensüß wie der Wein in den Gläsern abends auf dem Tisch.
Die Laken kühl auf der Haut, satt von der Wärme, dem Licht des Tages, kommt der Schlaf immer viel zu schnell.
Nie kann sie vom Silberlied der Zikaden genug bekommen. Von dem Murmeln unten im Haus, dem Lachen, sorglos und lebensfroh. Nie genug von der knisternden Musik aus dem Radio, die von dort heraufdringt. Unterbrochen vom Springbrunnen einer Stimme, die vergessen macht, dass es einmal ein anderes Zuhause gegeben hat, ein Land mit einer anderen Sprache.
Töne voller Glück und Geborgenheit.
Machtvoll ist der Schlaf, tief und dunkel. Eine Umarmung, die Sicherheit verspricht und morgen einen neuen Tag.
Zum Verräter wird er, als heißer Rauch durch alle Ritzen quillt, in den Augen beißt, Kehle und Lunge verätzt.
Sie kämpft gegen diesen feindlichen Schlaf. Gegen seine schwarzen Tentakel, die sie nicht loslassen wollen, und ihre Kinderstimme, hoch und grell, fräst sich in die Nacht. Nach ihrer Mutter schreit sie, nach ihrem Vater, in diesem bösen Traum aus Flammenhitze und Atemnot, der viel zu wirklich ist.
Ein glühendes Rechteck, ausgestanzt aus dem Zwielicht von Finsternis und Feuerschein, und darin die Silhouette eines Mannes.
Daddy! Daddy!
Er hebt sie hoch, setzt sie auf seine Schultern. Wie Hunderte von Malen zuvor, auf ihren Wegen über die grünen Hügel und unter den roten Dächern der Stadt.
Halt dich fest, so fest du kannst.
Erst glaubt sie, auf seinen Schultern zu fliegen, aus dem Fenster und in die Nacht hinaus, dann zu fallen, viel tiefer als nur zwei Stockwerke. Sie hat Angst, den Halt zu verlieren; Angst, ihm die Luft abzuschnüren, wenn sie sich allzu sehr an ihn klammert.
Die Blätter der Weinreben peitschen ihr ins Gesicht, Ranken schneiden in ihre Haut, einen schmerzhaften Herzschlag nach dem anderen. Dem Abgrund entgegen, der Rettung sein kann oder Tod. In die auflodernden Flammen hinein, die über ihre bloßen Ärmchen züngeln, Nachthemd und Haare versengen.
Ein holpriger Ritt über die Wiese ist es, der sie wild durchschüttelt, ihren Kopf hin und her schleudert. Seine Hände tun ihr weh, als er sie von seinen Schultern rupft.
Was auch passiert – du bleibst hier und rührst dich nicht!
Als ein Schatten hetzt er davon, eine Krähe in taumelndem Flug, und das Feuer saugt ihn auf.
Gierig verzehren die Flammen das Häuschen am Berg. Das Gerippe aus alten Balken wird sichtbar; Mauerwerk kreischt auf, Holz ächzt und zerbirst in Funkenschauern.
Der Boden erzittert unter der Lawine aus Stein und geschwärzten Trümmern, aus Feuer, Asche und Staub, die sich über den Hang ergießt.
Das kleine Mädchen bleibt allein in der Nacht zurück.
Kapitel 1
Montag, 4. September
Drei Uhr morgens.
Die Stunde des Wolfes, in der die Nacht am dunkelsten, am stillsten ist.
Die Zeit, in der Hexen ihr Unwesen treiben und ihr Meister, der Teufel, umgeht. Diese Stunde, in der das Böse erwacht und die meisten Verbrechen begangen werden. In der tiefste Ängste hervorkriechen und die Schlaflosen heimsuchen.
Die Stunde, in der Alpträume am realsten sind.
Selbst hier, abseits der Theater und Clubs, der Tattoo-Studios und Cafés unter der Regenbogenflagge, wo immer noch ein Hauch von Marihuana in der Luft liegt und von Love & Peace. Jenseits der Straßen, durch die Rock, Blues und Punk pulsieren und der rebellische Geist der Avantgarde. In denen sich der Rausch der Nacht dem Morgen entgegenstreckt, immer am Rand des Mutwillens, der Gewalt.
Hier, diesseits vom Washington Square Park und seinem Marmorbogen, versteckt zwischen klotzigen Apartmenthäusern, in denen es hip ist, reich zu sein wie Krösus, aber trendiger als am Central Park West. In einer der ruhigen, fast biederen Seitenstraßen, in der die Nächte still sind und verträumt, sogar in dieser Stadt, die angeblich niemals schläft.
Die Lampe auf dem Nachttisch streut ihren sanften Schein über Gemmas Gesicht. Über die Kissen und Laken, zerwühlt wie ein aufgerissenes Stück Asphalt. Im Halbdämmer des restlichen Schlafzimmers glüht das rote Auge des Fernsehers, im Lauf der Nacht vom Timer in den Standby-Modus versetzt.
Mit einem schmatzenden Geräusch löst sich Gemmas Unterarm vom Cover des Paperbacks, das sie im Schlaf an sich gepresst hat.
Gedämpftes Licht. Stimmen, die im Flüsterton aus dem Fernseher rieseln. Ein Buch. Gemmas dreifacher Talisman, um die Dämonen der Nacht in Schach zu halten.
Um diese Zeit werden sie ihr nichts mehr nützen, sie wird keinen Schlaf mehr finden, das weiß sie.
Sie stützt sich auf dem Waschbecken des winzigen Badezimmers ab, starrt sich selbst im Spiegel an, diese Fremde, die ihr viel zu vertraut ist.
Einzelne Locken haben sich aus dem Haargummi gelöst, kleben nass auf der Stirn, an den Schläfen; unter den Halogenlampen sieht ihr Gesicht grau und mürbe aus. Das Grün ihrer Augen ist zu einer undefinierbaren Farbe ausgelaugt, und die ersten Fältchen, nicht viele für vierunddreißig Jahre, haben sich vertieft.
Die Übelkeit wird sie den halben Tag begleiten, auch das weiß sie, und das Gefühl, nichts als staubige Holzwolle im Kopf zu haben.
Nach draußen zieht es sie, an die frische Luft, um in gleichmäßigen Joggingschritten den Schrecken des Traums davonzulaufen, seinen schalen Nachgeschmack auszuschwitzen und abzuschütteln.
Es ist noch zu früh. Selbst für die beschützte Idylle dort draußen, diese Hybride der Zehnerjahre aus neuem Yuppietum, grünen Smoothies und Fair-Trade-Kaffee mit Sojamilch.
Es ist die Nacht, der Gemma nicht traut. Reflexartig öffnet sie die Tür des Spiegelschranks, halbiert ihre Doppelgängerin mit einem scharfen Schnitt. Orange leuchten ihr die Tablettenfläschchen entgegen. Nur für den Notfall!, mahnt ihre eigene Handschrift auf einem Post-it, darunter erstreckt sich die Mobilnummer von Dr. Gould.
Gemma zögert, lässt dann die Schranktür zuschnappen.
Dies ist kein Notfall. Nur eine ganz gewöhnliche Nacht von Sonntag auf Montag; meist sind es die Wochenenden, die diese Träume mit sich bringen.
Während Kaffee durch die Maschine gurgelt, der Kühlschrank behaglich summt, schlägt Gemma Eier auf.
Backen beruhigt und tröstet. Das Abmessen von Mehl, Zucker und Backpulver hat etwas Verlässliches; all die vertrauten und tausendfach geübten Handgriffe, die aus simplen Zutaten einen Kuchen oder Muffins werden lassen, geben ihr Halt.
Wie früher, als Grandma noch da gewesen war.
Der frische Duft weicher Butter, der von Zitronenschale erinnern an zu Hause. An Nellie, die ihr das Backen beigebracht hat und deren Augen strahlen, wenn Gemma sonntags Selbstgebackenes in das Pflegeheim mitbringt.
Vanille und Zimt, Safran und Kakaopulver sind wie eine warme Umarmung. Nicht mit dem trügerischen Versprechen, dass alles gut wird, morgen oder nächste Woche oder in einem Jahr. Sondern mit der Gewissheit, dass alles für den Moment gut ist, mag dieser auch noch so flüchtig sein.
Wie Gemma es bei Nellie gelernt hat. Bei Grandma.
Nur das Einschalten des Herds bedeutet einen Augenblick blanker Angst für Gemma. Jedes Mal wartet sie darauf, dass das Gas explodiert und das kleine Apartment in Feuer aufgeht.
Bis die blauen Flämmchen zahm aufglimmen und sie wieder atmen kann.
Trotzdem hat sie sich für Gas entschieden, als sie hier einzog. Gas ist verlässlicher, wenn sie später wiederholt kontrolliert, ob der Herd ausgeschaltet ist. Wie sie sich auch vergewissert, ob alle Fenster geschlossen sind, nirgends mehr Wasser läuft, bevor sie die Wohnung verlässt und dann gründlich überprüft, ob sie wirklich die Tür hinter sich abgeschlossen hat.
Heute wird sie länger dafür brauchen. Auch das weiß sie.
Gemma fühlt sich einigermaßen aufgeräumt, als sie das Haus verlässt. Zumindest weiß sie, dass sie so aussieht, die maronendunklen Locken leger hochgesteckt, ein gesund wirkendes Nachglühen auf dem Gesicht, nach der Joggingrunde im ersten Licht des Tages, der heißen Dusche. Die restlichen Spuren der Nacht hat sie vor dem Spiegel sorgfältig wegretuschiert.
Wie frisch gewaschen ist dieser Morgen, nachdem sich die Hitze des Sommers selbst verzehrt hat. Die Bäume entlang der Straße filtern das Sonnenlicht; sattgrün sind sie wie die Sträucher der handtuchschmalen Vorgärten hinter niedrigen Eisenzäunen: Der Indian Summer ist noch einige Wochen entfernt.
Gemma schätzt es, in einer Straße zu leben, in der die Brownstones und Townhouses aufgereiht sind wie Macarons in einer mit Seidenpapier ausgeschlagenen Schachtel. Trotzdem genießt sie jeden Morgen den Augenblick, in dem sie auf die Fifth Avenue einbiegt. Eine der Schluchten in diesem menschengemachten Grand Canyon aus Stein und Stahl und Glas, auf dessen Grund mal zügig, mal stockend der motorisierte Fluss uramerikanischer Ungeduld vorwärtsströmt.
Sobald Gemma in das Brausen und Surren eintritt, in den Lärm aus Autohupen und kreischenden Bremsen, dem Radau der Baustellen und dem hallenden Heulen der Einsatzfahrzeuge, ist sie nur mehr ein Tropfen in diesem reißenden Fluss.
Ein einziger, winziger Tropfen inmitten von mehr als eineinhalb Millionen.
Männer in Anzug und mit Krawatte, deren gewichtige Stimmen es mit der Geräuschkulisse der Stadt aufnehmen wollen. Im Stakkato ihrer High Heels tippen Geschäftsfrauen Textnachrichten in Smartphones oder rufen lachend in Headsets. Mütter schieben mit einer Hand einen Buggy und halten in der anderen einen Kaffeebecher. Studenten mit Rucksäcken, die sich in die Klangwolke ihrer Kopfhörer zurückziehen.
Und dazwischen Gemma, ihre Sanduhrsilhouette in der New Yorker Uniform aus gut geschnittenem Hosenanzug und Trenchcoat. Das auf erwachsene Art noch immer mädchenhaft runde Gesicht mit den Katzenaugen ist dezent genug geschminkt, um nicht groß aufzufallen; eine Maske lässiger Toughness, die sie sich angewöhnt hat.
Drei Millionen Leben, immer in Bewegung, immer unterwegs, die sich im Vorbeigehen streifen, aber selten berühren. Es ist in diesem tosenden Fluss, dass sich die einzelnen Schicksale nahezu auflösen. In der Masse, in der Anonymität fließen all die kleinen und großen Tragödien ineinander zu einem kontinuierlichen Auf und Ab des Lebens.
Noch mehr seit der größten Tragödie von allen, die die Stadt ins Mark getroffen hat und die ganze Welt auf Jahre hinaus erschüttert. Eine Narbe ist geblieben, an der Südspitze der Insel und weithin sichtbar: eine Scherbe aus Glas, höher als alle anderen Wolkenkratzer, die geradewegs in den Himmel hineinschneidet. Daneben fangen zwei geisterhafte Fußstapfen aus fließendem Wasser und Bronzenamen das Nichts ein, das einmal die Zwillingstürme gewesen waren.
Seitdem sind sie hier alle Überlebende. Gezeichnet von den Ereignissen eines einzelnen Tages, unabhängig von dem, was das Leben davor und danach für sie bereitgehalten hat.
Es gibt keinen besseren Ort als Manhattan, um Zuflucht vor der eigenen Vergangenheit zu finden.
Am Union Square brüten die ersten Schachspieler vor ihren Brettern über dem nächsten Zug; von den Ständen des Farmers Market weht der Duft von frischem Gemüse herüber, von Kräutern und Schnittblumen. Gemma macht einen Bogen um die jungen Leute, die mit ausgebreiteten Armen Passanten anstrahlen, um Gratis-Umarmungen zu verteilen, wie die Pappschilder in ihren Händen es anbieten.
Unter dem grünen Pavillon taucht Gemma in den schnaubenden Drachenatem der Subway ein.
Vivaldi vibriert zwischen den gekachelten Wänden; schmeichlerische Töne, die ein älterer Mann mit seinen Bauarbeiterhänden der Violine entlockt. Für die teuren Behandlungen seiner krebskranken Frau spielt er, das teilen die schiefen Buchstaben auf dem Karton zu seinen Füßen mit.
Umso lieber schiebt Gemma die Kuchenbox unter den Arm und fasst in ihre Manteltasche. Seit Grandmas letzten Monaten weiß sie, was Krankenhäuser und Medikamente kosten, selbst wenn keine Heilung mehr in Aussicht ist, nur die Hoffnung auf ein wenig mehr Zeit.
Sein Dankeschön, als sie den eng zusammengefalteten Geldschein in den Korb fallen lässt, beantwortet sie mit einem knappen Nicken; danach sind ihre Schritte beschwingter. Jeder Zwanziger, den sie sonntagabends so faltet, dass er aussieht wie eine einzelne Dollarnote, und dann die Woche über an Straßenmusiker und Obdachlose verteilt, bedeutet einen Glücksmoment für Gemma.
Keinen Gedanken verschwendet sie daran, ob die traurigen Geschichten auf den Pappschildern stimmen. Ob die dramatische Lebensbeichte, mit der ein Schnorrer zwischen zwei Stationen die Passagiere im Zug überschüttet, auch der Wahrheit entspricht.
Ein geordnetes, solides Leben, fest verwurzelt in Job und Familie, in Freundschaften und Hobbys, ist in Wirklichkeit doch nur ein fragiles Gespinst.
Ein Missgeschick genügt, damit es reißt, eine falsche Entscheidung, ein Schicksalsschlag. Eine alte Wunde aus der Kindheit, längst vergessen, die wieder aufbricht. Ein Webfehler, der sich im Muster der Synapsen einschleicht und es unmöglich macht, noch innerhalb der Matrix alltäglicher Normalität zu funktionieren. In einer Kettenreaktion tut sich ein Riss nach dem anderen auf, und schneller, als man es für möglich gehalten hat, gleiten einem die Fäden aus der Hand.
Manchmal kommen ihr diese Geldscheine vor wie ein weiterer Talisman. Eine Absicherung dagegen, ebenfalls aus ihrer übersichtlichen Existenz herauszufallen. Obwohl Grandma ihr mehr hinterlassen hat, als sie für dieses kleine Leben braucht – ein schwacher Trost für all das, was sie verloren hat.
Vier Minuten dauert die Fahrt mit der Subway. Nicht viel länger als ein durchschnittlicher Popsong, normalerweise nicht lange genug, um Panik aufkommen zu lassen. Heute ist jedoch ein besonders schlechter Montag.
Eine achtlos fallen gelassene Plastiktüte, vom Sog des Zuges auf die Stromschiene zwischen den Gleisen gewirbelt, die zu schmoren beginnt. Ein Pappbecher, der dort kokelt und in Brand gerät. Eine Ratte, angelockt vom Geruch eines weggeworfenen Stücks Pizza, bekommt im Gleisbett einen Stromstoß und geht dann ebenfalls in Flammen auf.
Bilder von funkensprühenden Kurzschlüssen in der antiquierten Subway haken sich in Gemmas Kopf fest. Gedanken an die Brände, die jedes Jahr mehrere Hundert Mal den Betrieb lahmlegen, sogar die Evakuierung eines Zugs, einer Station nötig machen.
Eingezwängt zwischen Menschenleibern kämpft Gemma gegen die Vision eines flammenden Infernos in der Schwärze des Tunnels, dreißig Fuß unter der Erde. Gegen das Wissen um die Tonnen von Fels und Beton und Stahl über ihr; eine Vorstellung wie ein Schraubstock, der sich enger und enger um sie schließt.
Sie atmet, so gut sie kann, und vergewissert sich bei jedem Atemzug, dass es verschiedene Aftershaves und Parfums sind, die die muffige Luft im Zug pfeffern; Shampoos, Schweiß und Kaffeeatem und die künstliche, schon schale Minze eines Kaugummis. Kein Rauch, kein Feuer.
Die Stimme aus den Lautsprechern, die mit mechanischer Gelassenheit die nächste Station ankündigt, wird zum Rettungsanker; der Zug verlangsamt seine Fahrt und kommt in den Lichtern der Plattform zum Stehen.
Blind und taub lässt Gemma sich im Gedränge aus dem Abteil spülen, auf die Treppen zu, in das Labyrinth aus Gängen und Ebenen hinein.
Erst als die feuchtheiße Luft der Subway in angenehme Kühle umschlägt, sich die Menge um Gemma zerstreut, bleibt sie stehen, plötzlich aus dem Takt gebracht, plötzlich verloren. Die Menschen, die an ihr vorübereilen, verschwimmen zu Schlieren.
Wie ein Tritt in die Magengrube ist die jähe Unsicherheit, ob sie den Herd nach dem Backen tatsächlich ausgeschaltet hat, kein Flämmchen mehr brennt, kein Gas ausströmen kann. Ob sie die Tür hinter sich wirklich zugezogen und auch abgeschlossen hat. Sie muss umkehren, sie muss nachsehen, das Schlimmste verhindern; ein Drang, der so mächtig ist, dass er ihr den Magen umdreht und die Knie zittern lässt.
Bis sich die von den Wänden zurückgeworfenen Stimmen, die hallenden Schritte zu einem vertrauten Muster anordnen, an dem sie Halt findet. Im Sonnenlicht, das durch die riesigen Fenster hereinfällt und sich in Pfützen auf dem Steinboden sammelt, schmilzt der Nebel in ihrem Kopf und mit ihm die Panik.
Der hohe weite Raum des Grand Central Terminal ist ein sicherer Ort für Gemma.
Nicht, weil seit 9/11, seit den Bomben des Boston-Marathons schwer bewaffnete Soldaten der National Guard hier Wache halten und das Police Department mit Spürhunden Streife läuft. Sondern weil der gewaltige Granitbau ein Stück Ewigkeit verkörpert, unerschütterlich und unverrückbar, während in seinem Innern das Leben im vertrauten Rhythmus der Stadt pulsiert.
Gemma braucht nur wenige Schritte, um in den Takt New Yorks zurückzufinden. In routiniertem Laufschritt weicht sie den Touristen aus, die die Sternbilder am türkisgrünen Gewölbe bestaunen und abfotografieren, und fädelt sich zwischen die Menschen ein, die nach einem komplexen System durch den Bahnhof hasten.
Ihr Trauma ist für diese Episoden der Panik verantwortlich, das hat sie bei Dr. Gould gelernt, vielleicht unbewusst zuvor schon gespürt; das Trauma des Durchlebten ebenso wie des Vergessenen.
Nur Erinnerungsfetzen sind übrig geblieben. An ihre Mutter. Ihren Vater. Jene Nacht. Ein paar Bruchstücke mehr hat Dr. Gould zutage gefördert. Der große, überwältigende Rest ist von den durchlebten Schrecken wie ausradiert. Von der Zeit fortgespült, sie war ja noch so klein gewesen.
Ein doppelter Verlust, den ihre Seele seitdem zu kompensieren versucht.
Es wurde besser, mit den Jahren und Dr. Goulds Hilfe. Es wurde schlimmer, nach 9/11. Mit Grandmas Krankheit und Tod. Als Nellie irgendwann nicht mehr nur einfach alt war, sondern zunehmend gebrechlich und verwirrt.
Wenigstens ertrinkt sie nicht mehr in Angst und ihren Zwängen so wie früher einmal, sie hält sich mit Paddelschlägen tapfer über Wasser.
Wie ein Fisch schwimmt Gemma durch die Ströme von Passanten, im Aquarium aus spiegelnden Fassaden, auf Patience und Fortitude zu, die beiden steinernen Löwen, die hinter der nächsten Ecke auf sie warten.
Für Gemma gibt es keinen sichereren Ort als die New York Public Library.
Wachpersonal und ein ausgeklügeltes Sicherheits- und Brandschutzsystem behüten die Millionen von Büchern und Mikrofiches, Fotografien und Drucke, Manuskripte und Dokumente, Tagebücher, Notizen und Briefe: von Virginia Woolf, von Wordsworth, von Byron, Shelley und Keats und den schriftlichen Nachlass von Katharine Hepburn. Eine Gutenberg-Bibel, gleich sechs First Folios von Shakespeare und das erste auf amerikanischem Boden gedruckte Buch, das Bay Psalm Book von 1640. Ein Krönungsalbum der Romanows und aus dem Jahr 1493 eine einzigartige Ausgabe des Briefes, in dem Kolumbus die gerade entdeckte Neue Welt beschreibt.
Mit den Keilschrifttafeln untergegangener Zivilisationen und kostbaren Handschriften aus dem Mittelalter ist die New York Public Library mehr als eine wissenschaftliche Bibliothek. Ein Tempel der Bibliophilie ist sie, in dem Haarlocken von Charlotte Brontë, Walt Whitman und Edgar Allan Poe wie Reliquien aufbewahrt werden. Jack Kerouacs Krücken und der Brieföffner von Charles Dickens, aus Elfenbein und der Pfote seines geliebten Katers Bob gefertigt. Das Zigarettenetui von Truman Capote, Mary Poppins’ Regenschirm und die Stofftiere, aus denen A. A. Milne Pu, den Bären, und seine Freunde schuf.
Eine Kathedrale gesammelten Wissens, erbaut aus jedem noch so kleinen Detail über New York, Amerika und die Welt, über die Künste und Wissenschaften, in der die Grundlagen für die Polaroidkamera und für den Fotokopierer entwickelt wurden und wo Betty Friedan ihren Weiblichkeitswahn schrieb. Marlene Dietrich war hier, Grace Kelly und Jackie Kennedy Onassis; Bob Dylan, Norman Mailer und Tom Wolfe.
Millionen Besucher sind es jedes Jahr, die an sieben Tagen die Woche hierherkommen, um zu lesen, zu schreiben, zu recherchieren und zu lernen oder einfach nur, um die Schönheit des Gebäudes zu bewundern. Um diese Atmosphäre von Bücherliebe, Sammelleidenschaft und Wissensdurst aufzusaugen, die immer ehrwürdig und gewichtig ist, aber nie steif, nie verstaubt.
Zwischen den Mauern und Säulen und Treppen aus Marmor, den holzgetäfelten und oft verschwenderisch bemalten Wänden der Lesesäle verschmelzen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Eine Zeitlosigkeit, die sich gegen das Vergängliche alles Irdischen stemmt.
Eine Bastion gegen das Verlorengehen. Gegen das Vergessen.
Nirgendwo fühlt Gemma sich mehr zu Hause als im Lesesaal der Map Division. Mit seinen Atlanten und Nachschlagewerken, den Farben von Lindgrün und Gold und dunklem Holz ein Raum, in dem man automatisch seine Schritte, seine Stimme dämpft. Im weichen Licht, das durch die hohen Fenster fällt, und im Schein der Kronleuchter ein Raum wie eine warme Decke, eine Tasse Tee.
Zu Hause, das ist Gemmas Schreibtisch im angrenzenden Büro; so sehr, dass sie immer als Erste da ist, egal, wie viele frühe Stunden des Tages sie damit verbracht hat, sich nach einer schlechten Nacht wieder in den Griff zu bekommen, und als Letzte wieder geht.
Montags ist das E-Mail-Postfach der Map Division besonders voll: All die Studenten und Professoren, die über das Wochenende an den Lücken, den Sackgassen in ihren Recherchen verzweifelt sind. Die Lehrer, die dann erst dazu kommen, ihre Fragen zu formulieren oder den Besuch ihrer Klasse zu planen. Die Freizeithistoriker und Hobby-Ahnenforscher, denen werktags die Ruhe für ihre Passion fehlt.
Die ersten Anfragen fallen in die Zuständigkeit von Kathryn Farris und Mark Nygard; Gemma leitet sie gleich in deren interne Accounts weiter. Den Schriftsteller, der an einem Roman über Salem und seine Hexenverfolgungen schreibt und dazu Einsicht in die entsprechenden Karten von damals benötigt, wird sie selbst übernehmen. Genau wie die Studentin, die an einer Arbeit über den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg sitzt, und den Grafiker, der sich zur Inspiration den Mercator-Atlas von 1636 ansehen möchte.
Die nächste E-Mail enthält nur drei Zeilen.
Es wurde mehr; ich gab den Befehl;
dann gab es kein Lächeln mehr.
Da steht sie, als wäre sie lebendig.
Spam, der durch den Filter gerutscht ist, oder ein dummer Scherz von jemandem, der zu viel Zeit hat. Gemmas Hand an der Maus bewegt den Cursor automatisch auf das Icon, das die E-Mail in den Papierkorb befördert.
Der Klick dazu bleibt aus, als Gemmas Blick sich am Absender fängt: [email protected].
Der Familienname ihres Vaters, der angeheiratete Name ihrer Mutter. Der Nachname, der in ihrer Geburtsurkunde steht und den Grandma ändern ließ; der Umstände wegen, kurz nachdem sie die Vormundschaft übernommen hatte. Seit Gemma alt genug gewesen war, sich nicht nur über einen Vornamen zu definieren, sondern diesen auch um einen Nachnamen zu ergänzen, hat sie von sich selbst immer nur als Gemma Cabot gedacht.
Die Welle der Erinnerung, die durch Gemma flutet, versackt in einem Schwarzen Loch, das plötzlich aufklafft und sie verschlingt.
»Gemma?«
Jedes grau gesträhnte Haar akkurat an seinem Platz, tippt Kathryn konzentriert an ihrem Computer, einen Becher Kaffee und ein Stück des mitgebrachten Kuchens zwischen den Papieren auf ihrem Schreibtisch. Die Beine überkreuzt, hat Mark es sich auf seinem Stuhl gemütlich gemacht, während er gut gelaunt telefoniert und dabei seine Krawatte streichelt: Die Map Division in Interviews und Führungen ebenso locker wie fundiert nach außen zu repräsentieren ist ihm eine Herzensangelegenheit.
Gemma kann sich nicht daran erinnern, wie die beiden das Büro betreten und ihre tägliche Arbeit aufgenommen haben; trotzdem deutet nichts darauf hin, dass ihnen Gemmas Blackout aufgefallen wäre.
Die Furcht, für wer weiß wie lange die Kontrolle über sich verloren zu haben, ballt sich kalt in Gemma zusammen.
»Gemma? Alles in Ordnung?«
Linda aus dem Lesesaal, mit ihrem hellblonden Pixie-Cut eine moderne Tinkerbell im Hosenanzug, mustert sie, die Stirn gerunzelt.
»Entschuldige, ich war in Gedanken. Was hast du?«
»Jemanden mit speziellen Fragen zu den Karten von Captain Cooks Reisen.«
Dankbar für die Ablenkung vertieft Gemma sich in Lindas Notizen.
»Hast du vielleicht Lust, heute Abend etwas trinken zu gehen? Nur Jada, Claire, Gavin und ich. Und Andrew.«
Die Art, wie Linda seinen Namen hinzugefügt, ihn betont hat, lässt Gemmas Wangen warm werden. Noch mehr, als sie Lindas blassgraue Augen auf sich spürt. Als ob sie ahnt, wie oft Andrew Sullivan durch Gemmas Gedanken spukt, seit er letzten Monat zum Team der Map Division gestoßen ist.
Der Kontrast zwischen seinem tintendunklen Haar und dem irritierend wachen, blauen Blick verleitet Gemma zum Tagträumen. Nur zu gern lässt sie sich von seiner Stimme umgarnen, geschmeidig und mit gerade genug Schärfe wie ein White Russian, die ihr Komplimente zu ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung macht, dahinter ein kaum verborgenes Interesse an ihr als Person. Als Frau.
Die Rückkehr in die Realität ist jedes Mal ein Sturz aus großer Höhe.
Es ist eine Sache, mit Linda oder Claire zum Lunch im Bryant Park zu sitzen, mit Kathryn oder Mark in einer Kaffeepause zusammenzustehen, wenn es fast immer um die Arbeit geht, persönlich ist, aber nicht privat.
Einen Abend unter Kollegen, irgendwo in der Stadt, in der fremden Umgebung einer Bar, traut Gemma sich nicht zu. Nicht diese Intimität, die sich unweigerlich mit fortschreitender Stunde einschleicht: Erzählungen von überfürsorglichen Müttern und von Vätern, die sich im Alter wieder wie Teenager gebärden. Leichtherzige Klagen über sture Ehemänner und kapriziöse Freundinnen, über Hypotheken, renitente Kinder und ungerechte Lehrer.
Gemma fürchtet die Fragen, die mit jedem Schluck näherrücken. Diese Fragen nach den menschlichen Koordinaten ihrer Existenz. Es gibt keinen Weg, vom Drama in ihrer Familie zu erzählen, ohne hastige Entschuldigungen heraufzubeschwören. Verlegene Blicke und ein Unbehagen, das die Stimmung am Tisch tötet.
Sie hat es versucht, früher einmal, mit Freundschaften und Liebesbeziehungen, und irgendwann aufgegeben. Zu viele Verabredungen waren es, zu denen sie zu spät oder gar nicht erschien. Zu viele in letzter Minute abgesagte Wochenendtrips, weil sie es nicht schaffte, sich von ihrem Apartment zu trennen. Von all den Dingen, die sie überwachen und kontrollieren muss, um das drohende Unheil abzuwenden.
Es braucht einen Heiligen mit engelsgleicher Geduld, um es mit jemandem auszuhalten, dessen Tage straff um Ängste und deren Kontrolle organisiert sind. Der Licht und eine beständige Geräuschkulisse braucht, um einschlafen zu können. Der in Panikstarre verfällt, wenn ein Steak auf dem Grill anbrennt, einen kerzenerleuchteten Raum nicht romantisch, sondern beängstigend findet und morgens um halb vier Kuchen bäckt.
Jemanden wie Fiona.
Erst eine zugeloste Mitbewohnerin im College mit eigenen Problemen, später eine Schicksalsgefährtin an hellen und dunklen Tagen. Ein Band, das Zeit und Entfernung, ihrer beider Eigenarten und Schwierigkeiten überdauert hat und Gemma umso kostbarer ist.
Denn selbst in dieser Stadt der Exzentriker und Neurotiker, in der Stunden beim Psychiater so alltäglich sind wie ein Besuch der Oper oder im Museum, ist es nur schwer, jemandem begreiflich zu machen, dass auch Jahre auf der Couch ein solches Handicap nicht restlos beseitigen, sondern nur den Umgang damit lehren.
»Ich kann heute Abend nicht. Pilates.«
Gemma ist bewusst, dass sie in einem Käfig aus Defiziten sitzt, aus verschwiegenen Wahrheiten und Notlügen. Aber wenigstens geben ihr seine Gitter die Verlässlichkeit, die sie braucht.
Kapitel 2
Freitag, 15. September
Gemmas Augen haben sich am Bildschirm festgesaugt. An der dritten E-Mail von [email protected] in zwei Wochen.
Ihr Herz war – wie soll ich’s sagen – zu leicht zu erfreuen, zu leicht beeindruckt; sie liebte, worauf ihr Auge fiel, und ihr Blick schweifte weit umher.
Es hat nicht die Fertigkeiten einer Spezialistin für altes Kartenmaterial gebraucht, nicht das Recherchewissen einer Bibliothekarin, um diese Zeilen zu identifizieren und einzuordnen. Eine einfache Google-Suche mit Copy & Paste hat genügt: My Last Duchess von Robert Browning, irgendwann nach seiner Italienreise im April 1838 geschrieben und 1842 in seinen Dramatic Lyrics veröffentlicht.
Ein dramatischer Monolog zur Zeit der italienischen Renaissance, in dem der Herzog von Ferrara dem Emissär eines Grafen, des Vaters seiner künftigen Braut, bei einem Rundgang seine Kunstschätze präsentiert: das Porträt seiner letzten Herzogin, von ihm aus Eifersucht und Hochmut zum Schweigen gebracht.
Eine bildreiche und schaurige Historienerzählung, die sich nach überlieferter Lesart auf Alfonso II. d’Este bezieht, den fünften Herzog von Ferrara. Ein Blaubart, der angeblich seine erste Frau Lucrezia aus dem Hause Medici vergiftete, um Barbara von Österreich heiraten zu können, obwohl es für diese Tat keine historischen Belege gibt.
Was will [email protected]? Eine verschrobene Art des Flirts? Eine nicht weniger sonderbare Einladung zu einem bizarren Spiel?
Das waren keine Zeilen, die ein schüchterner Verehrer schicken würde, eher ein Stalker.
Ein Grund, weshalb Gemma die E-Mails nicht beantwortet, sondern sie in einem eigenen Ordner ihres internen Accounts aufbewahrt; dass sie es gewohnt ist, zu dokumentieren, zu archivieren und zu kategorisieren, ein anderer.
Jeder hier in der Map Division hätte sie in die Hände bekommen können und sicher auch gleich ohne Zögern gelöscht. Wäre Gemma nicht verlässlich die Erste morgens mit Zugriff auf den Account, so gut wie nie krank und nur im Urlaub, wenn die Verwaltung sie dazu drängt.
Und die Einzige, die in diesen E-Mails eine Bedeutung sucht und findet: Zwischen diesen E-Mails und ihrer eigenen Biografie gibt es mindestens einen Berührungspunkt zu viel, um es als bloßen Zufall abzutun.
Italien, wo Gemma als kleines Mädchen ein Dreivierteljahr gelebt hat; ein ganzes Jahr hätte es werden sollen. Wo sie bei einem Hausbrand ihre Eltern verloren hat: Sylvia Elizabeth Forsythe Cabot Bernstein, die ihrer Herkunft abtrünnig gewordene Park-Avenue-Prinzessin. Clifford Bernstein, Professor für Geschichte am Vassar College mit Schwerpunkt auf der italienischen Renaissance.
Seltsam, solche Fakten im Nachhinein gelernt zu haben wie die der Geometrie oder wie Vokabeln, anstatt sie bewusst mitzuerleben.
Die unterschwellige Drohung in den Gedichtzeilen jagt ihr keine Furcht ein. Es ist die Angst davor, ihnen zu viel Bedeutung beizumessen, die ihr zu schaffen macht.
Kindheitsmuster drängen sich auf: Die Überzeugung, es hätte an jenem Tag Vorzeichen gegeben. Etwas im Flug der Vögel, dem Flackern der Kerzen. Ein bestimmtes Lied im Radio, verschüttetes Salz oder ein gesagtes Wort, das zum verhängnisvollen Zauberspruch wurde.
So wie sie danach, nachdem Grandma sie nach Hause geholt hatte, überall nach weiteren Zeichen Ausschau hielt. Auf Plakaten und Verkehrsschildern. Im Fernsehprogramm und in den glänzenden Magazinen neben Grandmas Sofa.
Damit sie dieses Mal aufmerksamer war und Grandma und Nellie warnen konnte. Damit die beiden nicht auch einfach von dieser Welt verschwanden und nie wieder zurückkamen.
»Deine Post.«
»Danke.«
Es ist ein dicker Packen, den Mark auf ihrem Schreibtisch ablegt, obwohl sie auch die reguläre Post unter sich aufteilen.
Großformatige Kuverts aus steifem Papier, darin die luxuriösen Kataloge, die Auktionshäuser und Kunsthändler auch in der digitalen Ära noch drucken lassen, um ihre Schätze würdig zu präsentieren. Bescheidenere Mappen, die den Bestand einer aufzulösenden privaten Sammlung dokumentieren. Anschreiben von Nachlassverwaltern und manchmal von Personen aus dem ganzen Land, die etwas auf dem Dachboden gefunden haben, von dem sie glauben, es könnte für die Map Division von Wert sein. Kleine Werbegeschenke, die signalisieren sollen, dass man die Bibliothek nicht nur aufgrund ihres Rufs und ihres Status, sondern auch als Geschäftspartner schätzt: Der jährlich veröffentlichte Finanzbericht zeigt, dass Stiftungserträge, Einnahmen und Spenden, Zuschüsse und Förderungen auch in schwierigen Zeiten wie diesen für ein solides Budget sorgen.
Der Inhalt eines kleinen gepolsterten Umschlags lässt Gemma die Stirn runzeln; ein Goody, eingewickelt in ein paar Seiten der Las Vegas Sun, schmierig von Druckerschwärze, hat sie noch nie auf ihrem Schreibtisch gehabt.
Ratlos dreht sie das Gebilde aus silbernem und goldenem Draht zwischen den Fingern. Erst auf den zweiten Blick ähnelt es einem Anhänger oder einem Ohrring, zu verschnörkelt, um modisch zu sein. Nichts Wertvolles, die drei Perlen, die am unteren Rand aufgefädelt baumeln, sind aus Plastik, aber es ist von geschickten Fingern gefertigt.
Eine Ahnung streift sie. Ein blasser Lichtschweif in der Finsternis des Nichtwissens. Des Rätselns. Als ob sie diese Form in ihren Händen schon einmal irgendwo gesehen hat, vor langer Zeit, ohne sich bewusst daran zu erinnern.
Das Unbewusste lässt sich nicht täuschen, erklärt Dr. Gould ihr oft, überzeugt, ihre Gier nach Kontrolle ließe nach, je mehr sie aus diesen dunklen Tiefen ans Licht heraufholt. Manchmal klingt es für Gemma wie eine Warnung. Als ob sie sich vor dem fürchten muss, was dort alles lauert.
Der Umschlag ist in Las Vegas abgestempelt. Gemma kennt niemanden dort, und ihr fällt niemand ein, der ihr etwas so Merkwürdiges schicken würde, in sperrigen Druckbuchstaben an sie adressiert und ohne Absender.
Gemma stopft das Schmuckstück mitsamt dem Zeitungspapier zurück in den Umschlag und vergräbt ihn tief in einer der Schreibtischschubladen.
»Ich bin die nächsten Stunden in der Gruft.«
Sieben Stockwerke tief reicht das Magazin der Bibliothek; zusammen mit den zwei Etagen unter dem Bryant Park mehr als einhundert Regalmeilen, die nur selten ein Besucher während einer Führung zu sehen bekommt, kaum häufiger ein Journalist oder ein TV-Team.
Die Gänge, in denen der Bestand der Map Division lagert, ähneln tatsächlich den Räumen einer Gerichtsmedizin: klinisch und steril unter den Neonlampen, in dieser Nicht-Farbe zwischen Beige, Grau und bleichem Grün. Die vergitterten Stahltüren, nur von ausgewählten Schlüsselkarten zu öffnen, erinnern an den Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses.
Ein riesiger Tresor für eine halbe Million geografischer Dokumente, eine der größten und vielfältigsten Sammlungen der Welt.
Gemma ist gern hier unten, allein in dieser allumfassenden Stille, beruhigend durch das gleichmäßige Summen der Klimaanlage. Hier sind die Regale nicht zu einem gigantischen Bücher-Tetris wie drüben am Bryant Park optimiert; es gibt kein elektronisches Abrufsystem, das mittels einer ausgefeilten Technik jedes Buch in weniger als vierzig Minuten in den Lesesaal befördert.
Hier braucht es Kraft, um einen der Atlanten aus seinem Fach zu wuchten, und gleichzeitig Feingefühl, um den kostbaren Folianten dabei nicht mehr zu strapazieren als nötig. Dasselbe Fingerspitzengefühl, das die Karten und Stadtpläne in den flachen Schubladen der Rollregale verlangen, von denen noch lange nicht alle katalogisiert sind.
Der Teil ihrer Arbeit, den Gemma am meisten liebt: die Biografie einer Karte zu verfassen, ihr Zuhause mit einer Anschrift zu versehen.
Die ersten Karten und Atlanten dieses Bestandes sind gerade digitalisiert und online gestellt worden. Ein sinnvoller Schritt, und doch kommt nichts dem Zauber gleich, die Originale zu sehen, zu berühren.
Das in unterschiedlichem Ausmaß gealterte, oftmals brüchige, dann wieder erstaunlich zähe Papier unter den Händen, ist sich Gemma des Laufs der Zeit bewusst, wie er sich vom sechzehnten bis in das einundzwanzigste Jahrhundert spannt. Die Geschichte von Städten, Ländern und Kontinenten, Menschen und Nationen ist hier greifbar, detailreich in diesen Zeugnissen festgehalten; die Geschichte aber auch dieser Sammlung, seit 1898 zusammengetragen und 1911 hierher umgezogen.
Ein Archiv, das seither nie aufgehört hat, zu wachsen und an Tiefe, an Bedeutung zu gewinnen: Im Zweiten Weltkrieg nutzte sogar der militärische Geheimdienst die Karten hier zur Vorbereitung der Angriffsstrategie.
Gemma liebt diese Entdeckungsreisen durch Raum und Zeit; das verbindet sie mit Kathryn und Mark. Diese Gegenwärtigkeit des Vergangenen. Ein Sinn für Geschichte und Geschichten. Für Systematik und Ordnung.
Eine Ordnung, die Gemma heute vermisst. Dass sie den Gedichtzeilen Namen, Daten und Orte zugeordnet hat, beruhigt sie nicht, im Gegenteil. Doch sie kann den Versen Brownings nicht entkommen, so weit sie sich auch zwischen die Rollregale zurückzieht, so tief sie auch in den Inhalt der flachen Schubladen abtaucht.
Eine Last sind diese Verse, verstörend und bedrückend.
Benommenheit breitet sich in Gemma aus. Ein Gefühl des Unwirklichen, als ob die Ebenen der Welt ins Rutschen geraten sind.
Bis sie begreift, dass es die massive Wand des Rollregals ist, die sich unaufhaltsam auf sie zubewegt.
»Halt! Hier ist noch jemand! Stopp!«
Der Gedanke an den Sicherheitsmechanismus blitzt in ihrem Kopf auf, und doch sieht sie sich von Tonnen aus Stahl zerquetscht wie ein Insekt. Von all diesem aufgehäuften Wissen zermalmt.
»Stopp! Anhalten!«
Mit aller Kraft stemmt sie sich gegen das Regal, mag es auch noch so sinnlos sein; erst als die Wand wieder stillsteht, schafft sie es, sich zitternd durch den engen Tunnel hindurchzuzwängen.
Die endlosen Reihen der Regale liegen verlassen da, ihre Kurbelräder wie schwarz glänzende Augen.
»Hallo? Ist da jemand?«
Ihre Stimme verhallt ungehört. Über dem stoischen Summen der Klimaanlage ist nur ihr eigener Atem zu hören, merkwürdig verzerrt und wie verdoppelt. Fast ein Flüstern, ein Raunen.
Wo ist es?
»Hallo?«
Schweiß rinnt ihr über die Schläfen, durchnässt die Bluse unter dem Blazer, dabei fröstelt sie.
Sie hat nie an die Geister geglaubt, von denen Eunice so gern den Touristen erzählt, wenn sie vor den Lesesälen im oberen Stockwerk Aufsicht hat, ihre raue Stimme zu einem unheilvollen Flüstern gedämpft. Wohl aber an den Dämon des Wahnsinns, der immer schon gegenwärtig schien, immer lauernd, immer drohend, seit jener Nacht in Italien.
Als ob in dem kleinen Mädchen damals etwas kaputtgegangen war, das erst jetzt, so viele Jahre später, sein ganzes Ungemach entfaltet.
Pandoras Büchse, an deren Deckel die E-Mails bereits gerüttelt haben, hat sich für Gemma geöffnet.
Kapitel 3
Sonntag, 17. September
Die Sonne, die durch die Glasfront strömt, lässt die verblichenen Farben des Aufenthaltsraums karibisch leuchten. Unter den Goldsprenkeln, die vom Fluss hereintanzen, verschwinden die Kratzer im Boden und die angeschlagenen Kanten des Mobiliars.
Nellies Augen schimmern feucht, und ein Lächeln zittert um ihre welken Lippen.
»Sylvia! Endlich! Warum kommst du deine alte Nellie jetzt erst besuchen?«
Hinter Gemmas Brustbein fühlt es sich wund an, als sie die Hand auf ihrer Wange umschließt und behutsam drückt.
»Nicht Sylvia. Ich bin es. Gemma.«
Ein Schatten legt sich auf Nellies Gesicht, braun und faltig wie eine Dattel. Um ihre weißen Brauen zuckt es, dann entzieht sie Gemma abrupt die Hand.
»Das weiß ich doch!«
Wie sich ihre knorrigen Finger, kaum mehr als dürre Ästchen, in ihrem Schoß unruhig verschlingen und wieder lösen, verrät ihre Verwirrung. Es tut weh, mitanzusehen, wie es Nellie verlegen macht, dass Vergangenheit und Gegenwart in ihr langsam zu einem ununterscheidbaren Brei zerfließen.
Für den Moment lenken frisch aufgebrühter Kaffee, der Blütenhauch aus den Vasen und das Aroma des Zitronenkuchens in der geöffneten Box vom Geruch nach Medikamenten ab, nach Desinfektionsmittel und alten Menschen.
Gemma hätte Nellie gern exklusiver untergebracht; die Mittel, die Grandma eigens dafür hinterlassen hat, hätten es hergegeben. Nellie hatte sich dagegen gesträubt. Sie wollte ihren Lebensabend unter anderen Haushälterinnen verbringen, zwischen Lehrerinnen und Buchhaltern, Chauffeuren und Ladenbesitzern im Ruhestand.
Also war es das Pflegeheim von Riverview auf Roosevelt Island geworden, diesem schmalen Streifen Land, der sich inmitten des East River unter die Queensboro Bridge duckt.
Jäh erhellt sich Nellies Miene wieder. »Du hast Kuchen mitgebracht!«
»Lemon Drizzle Cake«, erklärt Gemma ein zweites Mal.
»Dass du daran gedacht hast ...« Nellie ist genauso gerührt wie zehn Minuten zuvor schon einmal und streichelt rasch über Gemmas Handrücken, wie verstohlen.
Nellie scheint gut aufgehoben hier, wirkt glücklich in ihrem hellen Zimmer mit Blick ins Grüne, auf den Fluss und die Skyline Manhattans dahinter.
Zwei alte Damen, ihre Haartönungen auf die flauschigen Jogginganzüge in Pink und Lila abgestimmt, sitzen kichernd über einem Kartenspiel zusammen. An eine Galapagos-Schildkröte erinnert der Mann, der über seine Gehhilfe gebeugt durch den Raum schlurft. Ein anderer Senior im Rollstuhl schaut auf den Fluss hinaus, seine Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen. Vielleicht döst er auch in dieser sonntäglichen Ruhe; erst nach dem Mittagessen werden Besucher in das Pflegeheim strömen.
Seit den auf beiden Seiten zwar freundlichen, aber unbeholfenen Begegnungen mit Nellies Nichten und Neffen, deren Kindern und Enkeln, kommt Gemma lieber am Vormittag. Schließlich ist sie nicht im eigentlichen Sinne Familie, obwohl es sich danach anfühlt.
»Wie geht es dir?«, erkundigt sie sich, während sie den Kuchen anschneidet. »Was gibt es Neues?«
Nellie beugt sich vor; hinter den Brillengläsern blitzen ihre Augen auf.
»Dieser Neue, Mr Washington – du erinnerst dich, ja? Da drüben. Am Fenster. Im karierten Hemd, mit der blauen Kappe. Nicht so auffällig, sonst merkt er noch, dass wir über ihn reden! War früher bei der Post. Und jetzt stellt sich heraus – er schummelt beim Bingo! Hat noch nicht einmal ein schlechtes Gewissen, wenn man ihn dabei erwischt!«
»Nein!« Ein Schmunzeln im Mundwinkel, gibt Gemma sich entrüstet und schiebt die gefüllte Kaffeetasse näher zu Nellie. »Er sieht so harmlos aus.«
Nellie geht auf diese Bemerkung nicht ein; sie ist mit den Gedanken längst schon woanders. Immer häufiger ähneln Gespräche mit ihr einem Korb voller Wolle, über den eine Katze hergefallen ist: Endlosschleifen, festgezurrte Knoten, ausgefranste Fäden.
Andächtig bewegt Nellie den ersten Bissen Zitronenkuchen im Mund, eine Fülle von Regungen auf dem Gesicht und Verwunderung im Blick. Als würde sie Fragmente der Vergangenheit herausschmecken und halb vergessene Erinnerungen.
»Zitronentarte«, murmelt sie. »Die mochte deine Mutter am liebsten. Hauchdünner Mürbeteig, eine Schicht dunkler Schokolade und eine aus selbst gekochter Himbeermarmelade unter dem Lemon Curd. Ja, das hat sie geliebt. Dass jeder Mundvoll buttrig und fruchtig schmeckt, süß und salzig und säuerlich und herb. Wie das Leben, hat sie einmal gesagt. Und ich dachte, was redest du da, du bist doch viel zu jung, du kannst davon noch gar nichts wissen.«
Die Kuchengabel in ihrer Hand zittert; mit unsicheren Fingern legt Nellie sie auf den Tellerrand. Aus dem Ärmel ihres Cardigans nestelt sie ein Stofftaschentuch hervor und wischt sich über die Wangen.
»Sie klang so glücklich, zuletzt. In den Briefen, den Postkarten. Die paar Mal, die sie aus Italien anrief. Immer nur kurz, weil es doch so teuer ist.«
Gemma hat sie wieder und wieder gelesen, in verschiedenen Stadien ihres Lebens. Die Briefe, diese Postkarten, die, zusammen mit anderen Briefen, anderen Karten, mit Fotos zwei Stahlkassetten in Gemmas Bücherregal füllen.
Erst diese Woche hat Gemma sie wieder zur Hand genommen, diese Sätze voller Sonne und Lebensfreude. Auf der Suche nach einem Hinweis inmitten dieser Poesie aus Landschaften, Städten und Menschen. Nach einer Spur zwischen den Schilderungen von üppigen Mahlzeiten und dolce far niente und einer unbekümmerten kleinen Gemma, die ihr fern und fremd ist.
»Kannst du dich erinnern, woran genau mein Vater in Italien gearbeitet hat? Ich weiß darüber so gut wie nichts.«
Nellie blinzelt hinter ihrer Brille, reibt sich mit dem Taschentuch über die Nase.
»Ach, Kind, das ist so lange her ... Und meistens hat Sylvia mit Mrs Cabot darüber gesprochen.«
Nellies Blick kehrt sich nach innen.
An der Art, wie sich ihre Stirn verwirft, ihr Kinn zuckt, die Finger rastlos über den geblümten Rock wandern, ist herauszulesen, wie sehr es sie anstrengt, durch den zähen Schlamm ihres Gedächtnisses zu waten. Gemma bereut ihre Frage auch sofort.