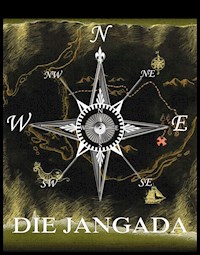
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist die illustrierte Version dieses Klassikers. Hauptfigur ist Joam Garral, der Eigentümer einer Hacienda und Plantage ist, die jenseits der brasilianischen Grenze in Peru am Ufer des Amazonas liegt. Joam Garral wurde vor Beginn der eigentlichen Handlung als junger Mann halbverhungert im Urwald aufgefunden und von dem Portugiesen Magalhaes, dem Begründer der Hazienda gesundgepflegt und in die Familie aufgenommen. Joam Garral heiratete Magalhaes Tochter und übernahm die Leitung der Hazienda, reiste jedoch niemals nach Brasilien. Die eigentliche Handlung des ersten Bandes setzt 23 Jahre später ein, als Minha, die Tochter Joam Garrals heiraten will. Die Hochzeit soll bei den Schwiegereltern, die in Belém leben, gefeiert werden. Für die Reise lässt Joam Garral ein riesiges Floß, die Jangada, bauen, auf dem ein komplettes Dorf einschließlich Kirche Platz findet..... (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Jangada
Jules Verne
Inhalt:
Jules Verne – Biografie und Bibliografie
Die Jangada
Erster Band.
Erstes Capitel. Ein Waldkapitän.
Zweites Capitel. Dieb und Bestohlener.
Drittes Capitel. Die Familie Garral.
Viertes Capitel. Bedenklichkeiten.
Fünftes Capitel. Der Amazonenstrom.
Sechstes Capitel. Ein niedergelegter Wald.
Siebentes Capitel. Einer Liane nach.
Achtes Capitel. Die Jangada.
Neuntes Capitel. Der Abend des 5. Juni.
Zehntes Capitel. Von Iquitos nach Pevas.
Elftes Capitel. Von Pevas nach der Grenze.
Zwölftes Capitel. Fragoso bei der Arbeit.
Dreizehntes Capitel. Torres.
Vierzehntes Capitel. Weiter stromabwärts.
Fünfzehntes Capitel. Noch weiter stromab.
Sechzehntes Capitel. Ega.
Siebzehntes Capitel. Ein Angriff.
Achtzehntes Capitel. Das Diner bei der Ankunft.
Neunzehntes Capitel. Eine alte Geschichte.
Zwanzigstes Capitel. Unter vier Augen.
Zweiter Band.
Erstes Capitel. Manao.
Zweites Capitel. Die ersten Stunden.
Drittes Capitel. Ein Rückblick.
Viertes Capitel. Moralische Beweise.
Fünftes Capitel. Materielle Beweise.
Sechstes Capitel. Der letzte Schicksalsschlag.
Siebentes Capitel. Entschlüsse.
Achtes Capitel. Erste Versuche.
Neuntes Capitel. Weitere Versuche.
Zehntes Capitel. Ein Kanonenschuß.
Elftes Capitel. Was sich in dem Etui befand.
Zwölftes Capitel. Das Document.
Dreizehntes Capitel. Worin von Chiffren und Ziffern die Rede ist.
Vierzehntes Capitel Ganz nach Belieben!
Fünfzehntes Capitel. Letzte Bemühungen.
Sechzehntes Capitel. Vorbereitungen.
Siebzehntes Capitel. Die letzte Nacht.
Achtzehntes Capitel. Fragoso.
Neunzehntes Capitel. Das Verbrechen von Tijuco.
Zwanzigstes Capitel. Der untere Amazonenstrom.
Die Jangada, Jules Verne
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
Jules Verne – Biografie und Bibliografie
Franz. Schriftsteller, geb. 8. Febr. 1828 in Nantes, gest. 24. März 1905 in Amiens, studierte in Paris die Rechte, muß sich aber schon früh auch den Naturwissenschaften zugewandt haben, denn gleich sein erster Roman, der die Reihe jener originellen, eine völlig neue Gattung begründenden Produkte Vernes eröffnete: »Cinq semainesen ballon« (1863), zeugt von jenem Studium. Der Erfolg, dessen sich diese Schöpfung erfreute, bestimmte ihn, die dramatische Laufbahn, mit der er sich bereits durch mehrere »Comédies« und Operntexte vertraut gemacht hatte, zu verlassen und sich ausschließlich dem phantastisch-naturwissenschaftlichen Roman zu widmen. V. führt seine Leser auf den abenteuerlichsten, stets aber physikalisch motivierten Fahrten nach dem Monde, um den Mond, nach dem Mittelpunkte der Erde, »20,000 Meilen« unter das Meer, auf das Eis des Nordens, auf den Schnee des Montblanc, durch die Sonnenwelt etc., und man kann nicht leugnen, daß er es verstand, die ernste Lehre, wenigstens die große Fülle seiner realen Kenntnisse, mit dem Faden der poetischen Fiktion geschickt zu verweben und dem unkundigen Leser eine gewisse Anschauung von naturwissenschaftlichen Dingen und Fragen spielend beizubringen. Wir nennen hier seine »Aventures du capitaine Hatteras« (1867), »Les enfants du capitaine Grant«, »La découverte de la terre« (1870), »Voyage autour du monde en 80 jours« (1872), »Le docteur Ox« (1874), »Un hivernage dans le glâces«, »Michel Strogoff (Moscou, Ireoutsk)«, »Un capitaine de 15 aus«, »Les Indes noires« (1875), »La maison à vapeur«, »Mathias Sandorf« (1887), »Claudius Bombarnai«, »Le Château des Carpathes« (1892), alle bereits in vielen Ausgaben erschienen und von der Lesewelt verschlungen, auch meist ins Deutsche übersetzt und in Form von Ausstattungsstücken mit nicht geringem Erfolg auf die Bühne gebracht (vgl. »Les voyages an théâtre« von V. und A.Dennery). Die »Œuvres complètes«
Vernes erschienen 1878 in 34 Bänden (illustrierte Ausg. 15 Bde.).
Romane:
Fünf Wochen im Ballon. 1875
Reise zum Mittelpunkt der Erde. 1873
Von der Erde zum Mond. 1873
Abenteuer des Kapitän Hatteras. 1875
Die Kinder des Kapitän Grant. 1875
Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer. 1874
Reise um den Mond. 1873
Eine schwimmende Stadt. 1875
Abenteuer von drei Russen und drei Engländern in Südafrika. 1875
Das Land der Pelze. 1875
Reise um die Erde in 80 Tagen. 1873
Die geheimnisvolle Insel. 1875 und 1876
Der Chancellor. 1875
Der Kurier des Zaren. 1876
Reise durch die Sonnenwelt. 1878
Die Stadt unter der Erde. 1878
Ein Kapitän von 15 Jahren. 1879
Die 500 Millionen der Begum. 1880
Die Leiden eines Chinesen in China. 1880
Das Dampfhaus. 1881
Die „Jangada“. 1882
Die Schule der Robinsons. 1885
Der grüne Strahl. 1885
Keraban der Starrkopf. 1885
Der Südstern oder Das Land der Diamanten. 1886
Der Archipel in Flammen. 1886
Mathias Sandorf. 1887
Ein Lotterie-Los. 1887
Robur der Sieger. 1887
Nord gegen Süd. 1888
Zwei Jahre Ferien. 1889
Die Familie ohne Namen. 1891
Kein Durcheinander. 1891
Cäsar Cascabel. 1891
Mistress Branican. 1891
Das Karpatenschloss. 1893
Claudius Bombarnac. 1893
Der Findling. 1894
Meister Antifers wunderbare Abenteuer. 1894
Die Propellerinsel. 1895
Vor der Flagge des Vaterlandes. 1896
Clovis Dardentor. 1896
Die Eissphinx. 1897
Der stolze Orinoco. 1898
Das Testament eines Exzentrischen. 1899
Das zweite Vaterland. 1901
Das Dorf in den Lüften.1901
Die Jangada
Erster Band.
Erstes Capitel. Ein Waldkapitän.
Phyjslyddqfdzxgasgzzqqehxgkfndrxujugiocytdxvks bxhhuypohdvyrymhuhpuydkjoxphetozsletnpmvffov pdpajxhyynojyggaymeqynfuqlnmvlyfgsuzmqiztlbq gyugsqeubvnrcredgruzblrmxyuhqhpzdrrgcrohepqu fivvrplphonthvddqfhqsntzhhhnfepmqkyuuexktogz gkyuumfvijdqpzjqsykrplxhxqrymvklohhhotozvdks ppsuvjhd.
Der Mann, welcher das Schriftstück betrachtete, dessen letzten Absatz diese sonderbare, unverständliche Anhäufung von einzelnen Buchstaben bildete, blieb in Gedanken versunken stehen, nachdem er dasselbe wiederholt aufmerksam durchlesen hatte.
Das ganze Schriftstück umfaßte gegen hundert, nicht einmal in Worte abgetheilte Zeilen. Es schien bereits vor vielen Jahren aufgezeichnet zu sein, denn das starke Papier, welches obige Hieroglyphen bedeckten, war schon von einem gelblichen Hauche überzogen.
Nach welcher Regel jene Buchstaben an einander gereiht waren, konnte nur jener Mann wissen. Solche Chiffreschriften ähneln in gewissem Sinne den modernen Panzer-Geldschränken und verdanken ihre Sicherheit demselben Princip. Die Combinationen, welche sie zulassen, zählen nach Milliarden, und das ganze Leben eines Rechenkünstlers würde nicht hinreichen, dieselben einzeln darzulegen. Man muß das »Wort« kennen, um den diebessicheren Cassaschrank öffnen, und muß von der »Chiffre« unterrichtet sein, um ein derartiges Kryptogramm enträthseln zu können. Das obige hätte, wie sich noch zeigen wird, auch den scharfsinnigsten Lösungsversuchen getrotzt; sein hochwichtiger Inhalt rechtfertigte diese Vorsicht.
Der Mann, welcher das Document aufmerksam entzifferte, war nur ein gewöhnlicher Waldkapitän.
In Brasilien versteht man unter der Bezeichnung »Kapitães do mato« gewisse Beamte, denen die Verfolgung entflohener Negersklaven obliegt, eine Institution, welche noch vom Jahre 1722 her datirt. Jener Zeit dachten höchstens wenige philanthropische Köpfe an die dereinstige Emancipation der unglücklichen Sklaven, und es bedurfte mehr als eines Jahrhunderts, ehe solche Ideen von den hochcivilisirten Völkern aufgenommen und verwirklicht wurden. Jetzt erscheint es uns als ein Recht, als das erste natürliche Recht des Menschen, frei zu sein, sich nur selbst anzugehören, und doch mußten erst Jahrtausende vergehen, bevor einige Nationen diesem edlen Gedanken Ausdruck zu geben wagten.
Im Jahre 1852 – das heißt zur Zeit, da diese Erzählung spielt – gab es in Brasilien noch Sklaven und folglich auch Waldkapitäne, um Flüchtlingen aus deren Reihen nachzuspüren. Verschiedene Rücksichten auf politische Oekonomie hatten hier den Zeitpunkt der allgemeinen Emancipation weiter hinausgeschoben; doch besaß der Neger schon das Recht, sich freizukaufen, und wurden seine Kinder schon als Freie geboren. Fern konnte der Tag also nicht mehr sein, an dem dieses herrliche Land, in dem drei Viertel von ganz Europa bequem Platz fänden, unter seinen zehn Millionen Bewohnern keinen einzigen Sklaven mehr zählte.
Das Amt der Waldkapitäne sollte wirklich in nächster Zeit eingehen, und schon damals lohnte die Wiedereinbringung flüchtiger Sklaven entschieden weniger als früher. Wenn die Waldkapitäne in dem langen Zeitraume, da das Geschäft noch reichere Ernten abwarf, nur eine Gesellschaft von Abenteurern bildeten, meist zusammengewürfelt aus Freigelassenen und Deserteuren, welche niemals in besonderer Achtung standen, so liegt es auf der Hand, daß die Sklavenjäger jener Zeit nur dem Auswurf der Gesellschaft angehörten, und allem Anscheine nach verunzierte auch der Mann mit obigem Schriftstück keineswegs die verächtliche Rotte der »Kapitães do mato«.
Dieser Torres – so lautete sein Name – war weder ein Mestize, noch ein Indianer oder Neger, wie die meisten seiner Kameraden; er war vielmehr ein Weißer von brasilianischer Abstammung, der in der Jugend etwas mehr Bildung genossen hatte, als seine dermalige Beschäftigung erheischte. Alles in Allem durfte er als einer jener Ausgestoßenen gelten, wie man solche in allen entlegenen Gebieten der Neuen Welt antrifft; und zur Zeit, wo das brasilianische Gesetz Mulatten oder Mischlinge als solche von gewissen Aemtern ausschloß, würde Jener, wenn dieses Gesetz bei ihm Anwendung fand, nicht seiner Herkunft, wohl aber seiner persönlichen Unwürdigkeit wegen ausgeschlossen worden sein.
Augenblicklich befand sich Torres übrigens gar nicht in Brasilien. Er hatte dessen Grenze überschritten und streifte seit mehreren Tagen in den Wäldern Perus umher, in welchem sich der Oberlauf des Amazonenstromes sammelt.
Torres war ein Mann von etwa dreißig Jahren, von kräftiger Constitution, auf welche, Dank seinem außergewöhnlichen Temperamente und seiner eisernen Gesundheit, die Strapazen eines so regellosen Lebens keinen Einfluß zu haben schienen.
Er war von mittlerer Größe, breitschulterig, hatte regelmäßige Züge, ein sicheres Auftreten, das Gesicht von der glühenden Atmosphäre der Tropen gebräunt, und trug einen schwarzen Vollbart. Aus den, unter den eng zusammenstehenden Brauen halb versteckten Augen leuchtete ein lebhafter aber frostiger Blick, wie er zügellosen Naturen eigen zu sein pflegt. Selbst zur Zeit, als das heiße Klima ihn noch nicht gebräunt hatte, würde sein Gesicht gewiß niemals roth geworden sein, sondern hätte sich höchstens unter der Einwirkung verderblicher Leidenschaften verzerrt.
Torres trug die sehr primitive Tracht der Waldläufer; Alles verrieth, daß sie lange im Gebrauch gewesen war; den Kopf bedeckte ein quergesetzter, breitkrämpiger Lederhut, an den Lenden hing eine Hofe aus grobem Wollenstoff, welche sich in den Schäften der starken Stiefeln verlor, welch' letztere den solidesten Theil des gesammten Costüms bildeten; das Ganze umschloß ein verschoffener, gelblicher »Poncho«, vor dem weder die Jacke noch die Weste, welche des Mannes Brust bedeckten, zu sehen waren.
Lebte Torres früher als Waldkapitän, so lag es doch auf der Hand, daß er dieses Geschäft jetzt, wenigstens unter den augenblicklichen Umständen, nicht mehr betrieb, dies erkannte man schon an seiner mangelhaften Ausrüstung mit den zur Verfolgung der Neger nöthigen Angriffs- und Vertheidigungswaffen. Er führte keine Feuerwaffen, weder Büchse noch Revolver. Im Gürtel stak nur eine sogenannte. »Manchetta«, welche mehr einem Säbel als einem Jagdmesser ähnelte. Daneben trug Torres noch eine », Enchada«, das ist eine Art Axt, vorzüglich angewendet bei der Jagd auf Nage- und Gürtelthiere, welche in den Wäldern des oberen Amazonenstromes in Ueberfluß vorkommen, während von eigentlich reißenden Thieren fast nichts zu befürchten ist.
Auf jeden Fall war unser Abenteurer an jenem Tage, am 4. Mai 1852, ganz außerordentlich vertieft in die Lectüre des Schriftstückes, auf dem seine Augen hafteten, oder die Urwälder Südamerikas, welche er zu durchstreifen gewohnt war, ließen ihn trotz ihrer Pracht und Herrlichkeit kalt. Nichts vermochte ihn von seiner Beschäftigung abzulenken; weder das langgezogene Geschrei der Brüllaffen, das Saint Hilaire sehr treffend mit dem Dröhnen der Axt des Holzfällers vergleicht, wenn dieser Baumäste ablöst; noch das trockene Rasseln der Ringe einer Klapperschlange, welche allerdings den Menschen kaum angreift, aber freilich sehr giftig ist; weder die schreiende Stimme der gehörnten Kröte, der unter der Classe der Reptilien der Preis der Häßlichkeit zukommt, noch auch das sonore, tiefe Quaken des Ochsenfrosches, welcher, wenn er den Ochsen auch an Größe nicht übertrifft, diesem an Stärke der brüllenden Stimme doch gleichsteht.
Torres hörte nichts von all' diesem Heidenlärmen, gewissermaßen die Gesammtstimme der Urwälder der Neuen Welt. Am Fuße eines prächtigen Baumes hingestreckt, bewunderte er nicht einmal das hohe Astwerk dieses »Pao ferro« oder Eisenbaumes mit dunkler Rinde und einem Holze, so hart wie das Metall, dessen Stelle es an den Waffen und Werkzeugen der wilden Indianer vertritt. Im Gegentheil! Völlig von seinen Gedanken erfüllt, drehte und wendete der Waldkapitän das merkwürdige Document zwischen den Fingern. Mit Hilfe des ihm bekannten Schlüssels wußte er jeden Buchstaben richtig zu deuten; er las, überlegte den Sinn der für jeden Anderen gänzlich unverständlichen Zeilen, und ein böses Lächeln flog über seine Züge. Dann begann er halblaut einige Sätze zu murmeln, welche in der unermeßlichen peruvianischen Waldwüste doch Niemand hören, jedenfalls kein Mensch richtig verstehen konnte.
»Ja, ja, sagte er, das sind so gegen hundert recht sauber geschriebene Zeilen, die für Einen, den ich kenne, von unzweifelhafter hoher Bedeutung sind. Dieser Jemand ist sehr reich! Für ihn handelt es sich dabei um Tod und Leben – auf alle Fälle muß das etwas Tüchtiges abwerfen!«
Noch einmal betrachtete er das Schriftstück mit gierigem Blicke.
»Ein Conto Reis allein für jedes Wort dieses letzten Satzes gäbe schon eine recht nette Summe!«1
»O, dieses Sätzchen hat seinen Werth! Es umfaßt den Gesammtinhalt dieses Documents und nennt die betreffenden Personen beim richtigen Namen! Freilich, um jenen Satz richtig zu verstehen, muß man zuerst die Anzahl Worte, die er enthält, zählen, und wenn das Einer gethan hätte, blieb ihm dessen wirklicher Sinn doch noch verborgen!«
Mit diesen Worten begann Torres heimlich zu zählen.
»Achtundfünfzig Worte, sagte er, das macht achtundfünfzig Contos! Hm, ein Sümmchen, mit dem man in Brasilien, in Amerika, überhaupt überall auskommen könnte, selbst ohne etwas dabei zu thun! Aber wenn mir alle Worte dieses Blattes zu demselben Preise bezahlt würden! Ei, das ergäbe Hunderte von Contos! Alle Teufel, hier ist ein hübsches Vermögen einzuheimsen oder ich bin der Dümmste der Dummen!«
Es sah aus, als ob Torres' Hände schon die enorme Summe unter sich hätten und die Goldrollen krampfhaft umschlössen.
Plötzlich nahmen seine Gedanken eine andere Richtung.
»Endlich, sagte er, nähere ich mich dem Ziele und werde sicherlich die Strapazen dieser Reise nicht zu bereuen haben, die mich von der Küste des Atlantischen Oceans bis zum Oberlauf des Amazonenstromes führte. Dieser Mann konnte ja Amerika verlassen haben, sich jenseits der Meere aufhalten, wie hätte ich da seiner habhaft werden können? Doch nein, er ist noch da, wenn ich einen dieser Bäume erkletterte, könnte ich das Dach des Hauses sehen, das er mit seiner ganzen Familie bewohnt!«
Darauf ergriff er wiederum das Papier und bewegte es mit fieberhafter Hast hin und her.
»Noch heute, fuhr er fort, werde ich ihm gegenüber stehen! Noch heute soll er wissen, daß seine Ehre, sein Leben von diesen Zeilen abhängt! Und wenn er den Schlüssel zu haben verlangt, um diese zu entziffern – ei nun, so wird er ihn eben bezahlen – wenn ich will, mit seinem ganzen Vermögen, ja, mit seinem Blute! Alle Wetter! Das ehrenwerthe Mitglied der Miliz, das mir dieses kostbare Document auslieferte, mir dessen Geheimnisse enthüllte und mir sagte, wo ich seinen früheren Collegen finden würde, und unter welchem Namen er
sich schon lange Jahre hindurch verborgen hielt, dieser brave Mann hat sich dabei gewiß nicht gedacht, daß er damit mein Glück begründete!«
Noch ein letztes Mal warf Torres einen Blick auf das vergilbte Papier, dann faltete er es vorsichtig zusammen und steckte es in ein festes kupfernes Etui, das ihm auch als Geldtasche diente.
Wenn Torres' ganzes Vermögen sich in diesem, an Größe etwa einer Cigarrentasche ähnlichen Etui befand, würde er in keinem Lande der Welt für reich gegolten haben. Wohl besaß er eine Kleinigkeit von allen Goldmünzen der Nachbarstaaten, z. B. zwei Doppelcondors der Vereinigten Staaten von Columbia, jeder etwa hundert Francs an Werth, die gleiche Summe in venezuelischen Bolivars, ferner peruanische Sols, einige chilenische Escudos zu höchstens fünfzig Francs und andere kleine Münzen. Alles zusammen erreichte eine runde Summe von etwa fünfhundert Francs, doch wäre Torres gewiß in Verlegenheit gekommen, wenn er über deren Erwerb hätte Aufschluß geben sollen.
Seit wenigen Monaten war er, nach plötzlicher Aufgabe des Amtes als Waldkapitän, dem er in der Provinz Para obgelegen hatte, dem Thale des Amazonenstromes folgend, über die Grenze gegangen und jetzt auf peruanisches Gebiet übergetreten.
Der Abenteurer kannte übrigens nur sehr beschränkte Bedürfnisse und überhaupt kaum nothwendige Ausgaben. Für Wohnung und Kleidung brauchte er nichts. Der Wald lieferte ihm die Nahrung, die er nach Art der Waldläufer ohne Unkosten zurichtete. Im genügten einige Reis für Tabak, den er in den Missionen oder in einem Dorfe kaufte, und ebensoviel für Branntwein, seine Kürbisflasche zu füllen. Er konnte also mit Wenigem weit genug kommen.
Als er das Papier in dem metallenen Etui, dessen Deckel hermetisch schloß, verwahrt hatte, steckte Torres dasselbe nicht in die Tasche des Kittels, den der Poncho bedeckte, sondern glaubte aus übergroßer Vorsicht besser zu thun, wenn er es neben sich in einer hohlen Wurzel des Baumes, an dem er lag, verbarg.
Das war eine Unklugheit, die ihm theuer zu stehen kommen sollte.
Es war sehr heiß, die Luft drückend und schwül. Hätte die Kirche des nächsten kleinen Fleckens eine Schlaguhr besessen, so würde diese jetzt zwei Uhr Nachmittags angezeigt haben, und Torres hätte das bei der eben herrschenden Windrichtung hören müssen, denn er befand sich nur zwei Meilen davon entfernt.
Ihn kümmerte die Zeit aber offenbar blutwenig. Er pflegte sich, so gut es ging, nach der Höhe der Sonne über dem Horizonte zu richten, und bei einem Abenteurer kommt es ja bei den gewöhnlichen Vorkommnissen des Tages auf militärische Pünktlichkeit nicht an. Er frühstückt oder ißt zu Mittag, wenn es ihm beliebt oder wenn es angeht. Er schläft, wo und wann die Müdigkeit ihn überwältigt. Wenn auch der Tisch für ihn nicht jeden Augenblick gedeckt ist, so findet er doch stets ein Bett am Fuße eines Baumes bereit, gleichgiltig ob in einem dichten Gebüsch oder im offenen Walde. Auf Bequemlichkeit machte Torres keine besonderen Ansprüche. Nachdem er den größten Theil des Morgens marschirt war, aß er ein wenig, und jetzt fühlte er auch das Bedürfniß zu schlafen. Zwei bis drei Stunden Ruhe mußten ihn wieder hinreichend kräftigen, seinen Weg fortzusetzen. Er streckte sich also so bequem wie möglich auf dem Grase aus, um zu schlummern.
Torres gehörte jedoch nicht zu den Leuten, welche sich dem Schlafe überlassen, ohne hierzu gewisse Vorkehrungen getroffen zu haben. Er pflegte zunächst einen derben Schluck Branntwein zu nehmen und nachher eine Pfeife zu rauchen. Der Branntwein erregt das Gehirn und der Tabak verträgt sich gut mit dem Dunst des Traumes.
Das war wenigstens seine Ansicht.
Torres setzte zuerst also die Lippen an die Kürbisflasche, die er an der Seite trug. Diese enthielt von dem in Peru unter dem Namen »Chica« und am oberen Amazonenstrome speciell als »Caysuma« bekannten Likör. Es ist das ein Destillationsproduct aus der in Gährung übergegangenen süßen Maniocwurzel, welchem der Waldkapitän mit seinem etwas verwöhnten Gaumen eine tüchtige Menge Tafia beizumischen liebte.
Als Torres einige Schlucke der Flüssigkeit verzehrt hatte, schüttelte er die Kürbisflasche und überzeugte sich mit Bedauern, daß dieselbe bald leer sei. »Werde ich wieder füllen müssen,« sagte er so vor sich hin.
Dann zog er eine kurze hölzerne Pfeife hervor, stopfte sie mit dem scharfen groben Tabak, dessen Blätter von dem alten »Petun« (einer ganz schlechten Tabakssorte) herrühren, den Nicot zuerst nach Frankreich einführte und damit zur Einbürgerung der ertragreichsten und verbreitetsten der Solaneen ungemein viel beitrug.
Dieser Tabak hat freilich nichts gemein mit dem Scaferlati erster Sorte, den die französischen Manufacturen produciren, Torres aber war in dieser Hinsicht ebenso wenig wählerisch wie nach vielen anderen Seiten. Er schlug am Stahl Feuer, entzündete eine Kleinigkeit von jener klebrigen Substanz, die unter dem Namen »Ameisenschwamm« – ein Absonderungsproduct gewisser Hymenopteren – bekannt ist, und setzte seine Pfeife in Brand.
Beim zehnten Zuge schon schlossen sich seine Augen, die Pfeife glitt ihm aus der Hand und er schlief ein oder versank vielmehr in eine Art Halbtraum, der kein wirklicher Schlaf ist.
Fußnoten
Zweites Capitel. Dieb und Bestohlener.
Torres schlief seit etwa einer halben Stunde, als unter den Bäumen ein Geräusch entstand, so als wenn Jemand mit bloßen Füßen vorsichtig heranschliche, um nicht gehört zu werden. Wäre der Abenteurer in diesem Augenblicke munter gewesen, so hätte er sicherlich auf jede verdächtige Annäherung ein scharfes Auge gehabt. Von jenem leisen Geräusch erwachte er freilich nicht, und der Andere vermochte sich ihm unbemerkt bis auf zehn Schritte vom Baume zu nähern.
Es war dies jedoch kein Mensch, sondern ein »Guariba«. Unter allen Affen mit Greiferschwanz, welche die Urwälder des Amazonenstromes bevölkern, wie die wirklich eleganten Sahuis, die gehörnten Sajus, die grauhaarigen Monos, die Saguins, welche auf ihrem fratzenhaften Gesicht eine Larve zu tragen scheinen – ist der Guariba unzweifelhaft der originellste. Gesellschaftlich und nicht eben bösartig, und in dieser Hinsicht sehr wesentlich verschieden von dem wilden, trägen »Mucura«, sucht er sich gewöhnlich anderen anzuschließen und wandert meist in größeren Trupps. Schon von fern verräth er seine Gegenwart durch den Lärmen monotoner Stimmen, der fast einem unmelodischen Kirchengesang ähnelt. Wenn er von Natur auch mehr gutmüthig ist, so darf man ihn doch nicht ohne gewisse Vorsicht angreifen. Auf jeden Fall ist, wie wir gleich sehen werden, ein eingeschlafener Reisender ernstlichen Gefahren ausgesetzt, wenn ihn ein Guariba in dieser Lage, also vertheidigungslos überrascht.
Dieser Affe, der in Brasilien auch den Namen »Barbado« führt, war von großer Gestalt. Die Geschmeidigkeit und Kraft seiner Gliedmaßen machten ihn zu einem sehr starken Thiere, ebenso geschickt, auf dem Erdboden zu kämpfen, wie von Ast zu Ast in die Gipfel der Waldriesen zu klettern und zu springen.
Der Guariba näherte sich vorsichtig und mit kleinen Schritten. Er sah nach rechts und links umher und wedelte dazu mit dem Schweife. Den Mitgliedern dieser Affenfamilie hat die Natur nicht allein vier Hände gegeben – wodurch sie sich eben als Vierhänder von den zweihändigen Menschen unterscheiden – sie hat sich sogar noch freigebiger bewiesen, indem sie jene eigentlich mit fünf ausstattete, da die Spitze ihres Schwanzes vollkommen zum Greifen und Festhalten geeignet ist.
Der Affe schlich also geräuschlos heran, wobei er einen tüchtigen Knüppel schwang, der in seiner kräftigen Faust zur gefährlichen Waffe werden konnte. Seit einigen Minuten mußte er den am Fuße des Baumes liegenden Menschen gewiß schon gesehen haben, die Unbeweglichkeit des schlafenden Mannes schien ihn aber zu veranlassen, denselben noch mehr aus der Nähe zu betrachten. Er kam also zögernd weiter heran und blieb endlich drei Schritte vor Jenem stehen.
Sein bärtiges Gesicht verzog sich zur Fratze, wobei die scharfen, elfenbeinweißen Zähne sichtbar wurden, und der Knüppel flog in einer, für den Waldkapitän keineswegs glückverheißenden Weise durch die Luft.
Torres' Aussehen weckte in dem Guariba offenbar keine besonders wohlwollenden Gedanken. Ob er etwa besondere Gründe hatte, dem Vertreter des Menschengeschlechtes, welchen ihm der Zufall, außer Stand sich zu vertheidigen, in die Hand lieferte, zu grollen? Vielleicht! Man weiß ja, wie genau sich manche Thiere an erlittene Unbill erinnern, und es war ja leicht möglich, daß dieser schon mit Waldläufern üble Erfahrungen gemacht hatte.
Vorzüglich bei den Indianern steht der Affe als Jagdwild in hohem Werthe, und sie verfolgen ihn, welcher Familie er auch angehört, mit wahrhaftem Nimrodseifer, nicht allein aus Vergnügen an der Jagd, sondern vor Allem, um ihn zu verspeisen.
Wenn der Guariba jetzt auch nicht geneigt schien, die Rollen zu tauschen, und nicht so weit ging, zu vergessen, daß die Natur ihn zum einfachen Pflanzenfresser gebildet hat, er also den Waldkapitän nicht wohl aufzehren konnte, so zeigte er doch offenbar nicht übel Lust, den, welchen er als natürlichen Feind erkannte, wenigstens zu vernichten.
Nachdem er jenen kurze Zeit betrachtet hatte, begann er den Baum zu umkreisen. Er ging nur langsam, hielt den Athem an, näherte sich jenem aber mehr und mehr. Seine Haltung war drohend, sein Gesicht wüthend. Den stillliegenden Mann mit einem Schlage zu tödten, wäre ihm gewiß ein Leichtes gewesen, und allem Anscheine nach hing Torres' Leben jetzt nur an einem Faden.
Wirklich stellte sich der Guariba noch einmal dicht neben den Baum und so an die Seite, daß er den Kopf des Schlummernden treffen konnte, und hob schon den Stock zum Schlage.
Wenn Torres aber eine Unvorsichtigkeit begangen hatte, das Etui, welches jenes Document und seine Baarschaft enthielt, neben sich in einer hohlen Wurzel zu verbergen, so rettete ihm dieser Umstand jetzt doch das Leben.
Ein Sonnenstrahl, der durch die Zweige drang, traf auch das Etui, dessen polirte Metallfläche dabei gleich einem Spiegel erglänzte. Der Affe wurde bei der, seiner Race eigenthümlichen Neugier aufmerksam. Seine Gedanken – wenn man bei einem Thiere von Gedanken sprechen darf – nahmen eine andere Richtung an. Er bückte sich, ergriff das Etui und wich einige Schritte zurück, während er jenes bis zur Höhe seiner Augen emporhob und nicht ohne Verwunderung bemerkte, wie dasselbe spiegelte. Vielleicht frappirte es ihn noch mehr, als er die in dem Etui enthaltenen Goldstücke klirren hörte. Dieses Geräusch entzückte ihn. Es sah aus, als ob ein Kind mit einer Klapper spielte. Dann führte er es zum Munde und seine Zähne erglänzten in dem Metall, ohne daß er es jedoch anzubeißen versuchte.
Offenbar glaubte der Guariba eine neue Frucht gefunden zu haben, vielleicht eine riesige, glänzende Mandel, mit frei in der Schale beweglichem Kerne. Mochte er diesen Irrthum auch bald einsehen, so veranlaßte ihn das doch nicht, das Etui wegzuwerfen. Im Gegentheil faßte er es noch fester mit der linken Vorderhand, ließ aber den Stock fallen, der dabei einen dürren Zweig zerbrach. Bei diesem Geräusch erwachte Torres, und hurtig wie alle Menschen, welche stets auf der Lauer liegen und bei denen der Uebergang vom Schlafen zum Wachen unvermittelt erfolgt, sprang er auf die Füße.
Sofort erkannte Torres auch, um was es sich hier handelte.
»Ein Guariba!« rief er laut.
Schnell ergriff er die neben ihm liegende Manchetta und setzte sich in Vertheidigungszustand.
Erschrocken wich der Affe zurück und flüchtete, da ihm einem wachenden Menschen gegenüber der Muth auszugehen schien, mit raschem Sprunge unter die dichten Bäume.
»Das war die höchste Zeit! rief Torres, der Schurke hätte mir ohne großes Federlesen den Garaus gemacht!«
Plötzlich bemerkte er in der Hand des Affen, der in der Entfernung von zwanzig Schritten stehen geblieben war und ihn angrinste, als wollte er ihn noch zum Narren haben, sein kostbares Etui.
»Der Spitzbube! rief er noch einmal. Wenn er mich nicht tödtete, so hat er mir doch weit Schlimmeres angethan! Er hat mich bestohlen!«
Der Gedanke, daß jenes Etui auch seine Baarschaft enthielt, machte ihm dabei keine so große Sorge; daß sich in dem Etui aber das Document befand, dessen Verlust ihm geradezu unersetzlich war, das brachte ihn ganz außer Fassung.
»Tausend Teufel!« wetterte er wüthend.
Da er nun um jeden Preis sein Etui wieder erlangen wollte, machte er sich auf, den Guariba zu verfolgen.
Er verheimlichte sich dabei nicht, daß es kein leichtes Stück Arbeit sein werde, das gewandte Thier einzuholen. Auf der Erde entfloh der Affe zu schnell, in den Bäumen zu hoch. Nur ein Büchsenschuß hätte seinem Laufe oder seinem Fluge ein Ziel setzen können; Torres besaß jedoch keine Feuerwaffe. Dolchmesser und Axt konnten dem Guariba doch nur etwas anhaben, wenn er ihm ganz nahe zu kommen vermochte. Es lag ihm bald klar vor Augen, daß er den Guariba nur durch List werde fangen können. Torres mußte also versuchen, was auf diese Weise zu erreichen war. Es blieb ihm nichts übrig, als vom Laufen abzustehen, sich hinter einem Baumstamm zu verbergen, in einem Dickicht zu verschwinden und den Guariba zu veranlassen, auch einzuhalten und vielleicht sogar zurückzukehren. Torres fügte sich dieser Ansicht; wenn der Waldkapitän aber verschwand, so wartete der Guariba einfach, bis er wieder erschien, und Torres kam damit zu keinem Ziele.
»Verdammter Guariba! rief er unwillig; so komm' ich nie zu Ende und er könnte mich wieder bis über die brasilianische Grenze wegführen. Wenn er nur das Etui fallen ließe! Aber nein! Der Klang der Goldstücke scheint ihn zu belustigen. Warte nur, Spitzbube, wenn ich dich erwische!...«
Noch einmal begann Torres die Verfolgung und wiederum wich der Affe zurück.
So verging wohl eine Stunde ohne jedes Resultat. Erklärlicher Weise ermüdete Torres nicht. Wie konnte er ohne jenes Document die erhoffte Summe gewinnen?
Endlich ward er wüthend. Er fluchte, stampfte den Boden mit den Füßen und drohte dem Guariba. Das störrische Thier antwortete ihm nur durch weitere Grimassen, die ihn allmählich außer sich brachten.
Torres begann seine Verfolgung von Neuem; er lief, daß ihm der Athem ausging, verwickelte sich in dem hohen Grase, in dem dichten Gebüsch und den verschlungenen Lianen, durch welche der Guariba wie ein Steeple-Chase-Reiter flüchtig dahin eilte. Ueber die Fußwege streckten sich zuweilen dichte Wurzeln. Er strauchelte und sprang wieder auf. Endlich begann er unwillkürlich zu rufen: »Hierher! Hierher! Haltet den Dieb!« als ob Jemand ihn hören könnte.
Bald fühlte er sich am Ende seiner Kräfte, der Athem verließ ihn und er mußte einhalten.
»Alle Teufel, platzte er heraus, wenn ich im Busche flüchtige Neger verfolgte, machten mir die Kerle nicht solche Mühe! Doch, ich werde ihn erwischen, den vermaledeiten Affen, gewiß ihn erwischen und laufen, so weit mich die Füße tragen! Wir wollen doch sehen, wer zum Ziele kommt!«
Als der Affe bemerkte, daß der Mann ihm nicht mehr nachlief, blieb auch er sitzen. Er ruhte aus, obwohl er noch lange nicht so erschöpft war wie Torres, der eben nicht weiter konnte.
So hockte er zehn Minuten da, knabberte an ein paar Wurzeln, die er im Fluge von der Erde aufgerafft hatte, und ließ von Zeit zu Zeit das Etui vor seinen Ohren klingen.
Voller Wuth warf Torres einige Steine nach ihm, die Jenen zwar erreichten, aber bei der weiten Entfernung nicht viel schadeten.
Zu einem Entschlusse mußte er gleichwohl kommen. Einerseits erschien es sinnlos, dem Affen mit so wenig Aussicht auf Erfolg noch weiter nachzulaufen; andererseits brachte es ihn in Harnisch, sich diesem unseligen Zufall, der alle seine Luftschlösser zerstörte, endgiltig zu fügen und nicht allein geschlagen, sondern von einem so albernen Thiere betrogen, überlistet zu sein.
Und doch mußte Torres sich sagen, daß der Dieb mit Einbruch der Nacht ohne Schwierigkeit für immer verschwinden werde, und er, der Bestohlene, würde noch obendrein die größte Mühe haben, aus diesem dichten Walde nur seinen Weg wieder zu finden. Die Verfolgung hatte ihn mehrere Meilen vom Ufer des Stromes hinweggeführt, und er konnte schon jetzt in Verlegenheit kommen, sich auf dem Wege dahin nicht zu verirren.
Torres zauderte; er versuchte seine Gedanken mit Ruhe zu sammeln, und nach einem letzten kräftigen Fluche wollte er schon jede Hoffnung auf die Wiedererlangung seines Etuis aufgeben, als er, mehr gegen seinen Willen, für das Document, von dem er einen so ausgedehnten Gebrauch zu machen gedachte, sich doch zu einer letzten Anstrengung aufraffte.
Er sprang also in die Höhe.
Der Guariba folgte seinem Beispiele.
Er that einige Schritte vorwärts.
Der Affe machte ebenso viele rückwärts; diesesmal aber hielt er, statt noch tiefer in den Wald zu fliehen, am Fuße einer gewaltigen Ficus an, welcher Baum im ganzen Becken des oberen Amazonenstromes überall in den verschiedensten Arten auftritt.
Sich mit den vier Händen an den Stamm zu klammern, mit der Geschicklichkeit eines Clown daran emporzuklettern, mit dem Greiferschwanze einen starken, vierzig Fuß über dem Erdboden horizontal ausgestreckten Ast zu erfassen und sich von da aus nach den höchsten Zweigen des riesigen Baumes, die sich unter der Last herabneigten, zu schwingen, war für den gewandten Guariba ein Spiel und das Werk weniger Augenblicke.
Hier richtete er sich nach Bequemlichkeit ein und setzte seine unterbrochene Mahlzeit fort, indem er von den Früchten pflückte, die er erreichen konnte. Torres hätte gewiß auch gern etwas gegessen und getrunken, das verbot sich aber von selbst, denn seine Tasche war mager und seine Kürbisflasche leer.
Statt nun jedoch zurückzukehren, begab er sich nach dem Baume, obgleich der Affe auf diesem vor ihm noch sicherer war, als vorher. Er konnte natürlich gar nicht daran denken, auch in die Höhe klettern zu wollen, denn sein Dieb hätte die Ficus einfach verlassen und sich nach einer anderen hinübergeschwungen.
Und immer klapperte er mit dem Etui vor seinen Ohren!
In seiner sinnlosen Wuth begann Torres nun auf den Guariba zu schimpfen. Die Titel, die er im anhing, sind gar nicht wiederzugeben. Er ging dabei so weit, Jenen nicht nur einen »Mestizen« zu nennen, was aus dem Munde eines Brasilianers weißer Race schon als grobe Beleidigung gilt, nein, er schimpfte ihn sogar »Curiboca«, das bedeutet einen Mischling von einem Neger und einer Indianerin. Unter allen Insulten, welche ein Mensch dem anderen anthun kann, giebt es aber keinen schlimmeren unter jenen äquatorialen Breiten.
Der Affe freilich als einfacher Vierhänder bekümmerte sich nicht im mindesten um alle die Schimpfworte, welche einen Menschen empört hätten.
Torres begann nun auf's Neue, mit Steinen, Wurzeln und Allem, was ihm in die Hand kam, zu werfen. Er bildete sich gewiß kaum ein, den Affen damit ernstlich etwas anhaben zu können, sondern er wußte einfach nicht mehr, was er that. Die Wuth über seine Ohnmacht dem Thiere gegenüber raubte ihm eben alle Besinnung. Vielleicht hoffte er einen Augenblick, daß der Guariba, wenn er sich von einem Aste zum anderen schwang, das Etui verlieren könne, wenn er es, um gegen seinen Angreifer nicht zurückzubleiben, ihm nicht etwa gar an den Kopf warf. Vergebens! Der Affe bemühte sich sorgsam, das Etui festzuhalten, blieben ihm doch, wenn er es auch mit der einen Hand umspannte, noch drei für allerlei Bewegungen frei.
Voller Verzweiflung wollte Torres schon den ungleichen Wettkampf aufgeben und nach dem Amazonenstrome zurückkehren, als sich ein unerwartetes Geräusch vernehmen ließ, das offenbar von menschlichen Stimmen herrührte.
Etwa zwanzig Schritte von der Stelle, wo der Waldkapitän sich befand, wurde gesprochen.
Torres' erste Sorge war, sich im dichten Gebüsch zu verbergen. Als vorsichtiger Mann wollte er sich nicht eher sehen lassen, als bis er wüßte, mit wem er es zu thun habe. Voller Neugier, klopfenden Herzens und mit gespannten Ohren wartete er, als plötzlich ein Schuß krachte.
Ein Schrei, und tödtlich getroffen stürzte der Affe schwer zur Erde hernieder, noch immer das Etui fest umklammernd.
»Alle Kukuk! rief Torres, das war eine Kugel, die zu gelegener Zeit kam!«
Jetzt sprang er, ohne Scheu gesehen zu werden, aus dem Busch hervor, als eben zwei junge Leute unter den Bäumen erschienen.
Es waren Brasilianer, nach Jägerart gekleidet, mit langen Stiefeln, einen leichten Hut aus Palmenfasern auf dem Kopfe und eine in der Taille zusammengehaltene Jacke oder vielmehr Blouse über dem Körper, welche im Walde natürlich bequemer zu tragen ist als der nationale Poncho. An ihren Zügen und der Farbe ihres Gesichtes erkannte man leicht, daß sie von portugiesischer Abstammung waren.
Jeder führte eine jener langen, spanischen Flinten, welche an die Feuerwaffen der Araber erinnern, die bei großer Treffsicherheit doch sehr weit tragen und welche die Waldläufer am oberen Amazonenstrome fleißig und erfolgreich gebrauchen.
Was eben geschehen war, konnte dafür als Beweis gelten. Aus schräger Entfernung von über achtzig Fuß, saß die Kugel dem Vierhänder doch mitten im Kopfe.
Außer jenem Gewehre trugen die jungen Leute im Gürtel noch eine Art Dolchmesser, in Brasilien »Foca« genannt, dessen sich die Jäger bedienen, wenn sie den Onça oder andere, in diesen Wäldern zwar nicht besonders gefährliche, aber in großer Anzahl vorkommende Raubthiere angreifen.
Offenbar hatte Torres bei diesem Zusammentreffen nichts zu fürchten und lief also eilig zu dem Körper des Affen hin.
Die jungen Leute aber, welche demselben Ziele zusteuerten, hatten nur einen kürzeren Weg zurückzulegen und befanden sich mit wenigen Schritten Torres gegenüber.
Dieser hatte seine volle Geistesgegenwart wieder erlangt.
»Besten Dank, meine Herren, sagte er erfreut, und lüftete ein wenig den Hut. Sie haben mir durch Erlegung dieses abscheulichen Thieres einen großen Dienst erwiesen!«
Die Jäger sahen zuerst einander an, da sie nicht verstanden, was dieser Dank bedeuten sollte.
Torres klärte sie mit einigen Worten über die Sachlage auf.
»Sie glaubten nur einen Affen zu schießen, sagte er, in Wahrheit aber haben Sie einem Diebe den Garaus gemacht!
– Wenn wir Ihnen genützt haben, erwiderte der jüngere der beiden Männer, so hatten wir zwar keine Ahnung davon, schätzen uns darum aber nicht minder glücklich, Ihnen diesen Dienst erwiesen zu haben.«
Er ging einige Schritte zurück, beugte sich über den Guariba und nahm das Etui aus dessen noch immer fest geschlossener Hand.
»Das gehört demnach Ihnen? fragte er.
– Ja freilich!« antwortete Torres, der das Etui rasch ergriff und einen erleichternden Stoßseufzer dabei nicht unterdrücken konnte.
»Und wem, mein Herr, habe ich für den mir erwiesenen Dienst zu danken?
– Meinem Freunde Manoel, Regimentsarzt in der brasilianischen Armee, erwiderte der junge Mann.
– Nun, wenn ich den Affen geschossen habe, warf Manoel ein, so hast Du, lieber Benito, mir ihn doch zuerst gezeigt.
– In diesem Falle, meine Herren, fuhr Torres fort, bin ich Ihnen also Beiden verpflichtet, ebenso Herrn Manoel, wie Herrn...?
– Benito Garral,« ergänzte Manoel.
Der Waldkapitän mußte alle Kräfte zusammenraffen, um bei der Nennung dieses Namens nicht zu erzittern, vorzüglich als der junge Mann höflich hinzusetzte:
»Die Farm meines Vaters Joam Garral liegt kaum drei Meilen von hier entfernt.1 Wenn es Ihnen beliebt, Herr...
– Torres, sagte der Abenteurer.
– Wenn es Ihnen beliebt, Herr Torres, daselbst vorzusprechen, werden Sie gastfreundlich aufgenommen werden.
– Ich weiß nicht, ob mir das möglich ist! erwiderte Torres, der in Folge dieser unerwarteten Begegnung nicht sofort zu einem Entschlusse kommen konnte. Ich glaube wirklich nicht, Ihr freundliches Anerbieten annehmen zu können!... Der Ihnen erzählte Zwischenfall hat mir zu viel Zeit geraubt...
Ich muß eiligst nach dem Amazonenstrome zurückkehren, dem ich bis nach Para folgen wollte...
– O, dann wäre es möglich, Herr Torres, fuhr Benito fort, daß wir uns auf diesem Wege wiedersehen könnten, denn noch vor Ablauf eines Monates wollte mein Vater mit der ganzen Familie dieselbe Tour machen.
– Ihr Herr Vater, versetzte Torres lebhaft, gedenkt also über die brasilianische Grenze hinaus zu gehen?...
– Ja wohl, das heißt zum Zwecke einer etwa dreimonatlichen Reise, gab Benito zur Antwort. Wir hoffen wenigstens, ihn dazu zu bestimmen, nicht wahr, Manoel?«
Manoel nickte mit dem Kopfe.
»Nun, meine Herren, nahm Torres wieder das Wort, dann könnte es wirklich zutreffen, daß wir uns unterwegs wiederfinden. Für den Augenblick kann ich indeß, zu meinem größten Bedauern, Ihrer Einladung nicht Folge leisten; doch danke ich Ihnen dafür und fühle mich dadurch nur doppelt verpflichtet.«
Mit diesen Worten verabschiedete sich Torres von den jungen Leuten, die seinen Gruß erwiderten und den Weg nach der erwähnten Farm einschlugen.
Jener beobachtete, wie sie sich entfernten.
»Ah, begann er, als Jene verschwunden waren, mit dumpfer Stimme, er wagt sich also über die Grenze! Nun, meinetwegen, so bekomme ich ihn desto sicherer in meine Gewalt! Glückliche Reise, Joam Garral!«
Der Waldkapitän wendete sich nun wieder nach Süden, um das linke Stromufer auf kürzestem Wege zu erreichen, und verschwand bald im dichten Walde.
Fußnoten
1 Wegmaße werden in Brasilien gewöhnlich nach der kleinen Meile von 2060 Meter Länge angegeben; die sogenannte große Meile mißt dagegen 6180 Meter.
Drittes Capitel. Die Familie Garral.
Das Dorf Iquitos liegt nahe dem linken Ufer des Amazonenstromes,
fast genau unter dem 74. Grade (westlicher Länge von Paris) in jenem Gebiete des großen Stromes, wo dieser noch den Namen Marañon führt und sein Bett Peru von der Republik Ecuador, gegen fünfundfünfzig Meilen westlich der brasilianischen Grenze, scheidet.
Iquitos wurde dereinst von Missionären gegründet, wie alle jene Haufen von Hütten, jene Weiler oder Flecken, die man im Becken des Amazonenstromes antrifft. Bis zum Jahre 1817 hatten sich die Iquitos-Indianer – jener Zeit die einzige Bevölkerung des Ortes – mehr in das Innere der Provinz und weit von dem Flusse zurückgezogen. Plötzlich versiechten aber in Folge vulcanischer Eruptionen die Quellen des Landes, und sie sahen sich genöthigt, ihre Wohnstätten nach dem linken Ufer des Marañon zu verlegen. Durch Vermischung mit den Flußindianern, den Ticunas und Omaguas, veränderte sich bald die Race, und heute beherbergt Iquitos nur eine gemischte Bevölkerung, der noch einige Spanier und zwei oder drei Mestizenfamilien hinzutraten.
Gegen vierzig höchst erbärmliche Hütten mit Strohdecken bilden das ganze regellos gebaute Dorf, das übrigens auf einer Stelle fünfzig Fuß über dem Flusse liegt. Eine aus horizontalen Baumstämmen hergestellte Treppe führt zu demselben hinauf und verbirgt es vor dem Blicke des Reisenden, wenn dieser nicht selbst jene Treppe erklimmt, denn es fehlt in der Nähe an jeder anderen Bodenerhebung.
Auf der oberen Fläche angelangt, erblickt man eine kaum widerstandsfähige Umzäunung aus verschiedenen Büschen und baumartigen Pflanzen, verbunden mit Tauen und Lianen, welche da und dort von den Gipfeln mächtiger Bananen und eleganter Palmen herabhängen.
Jener Zeit – und die Mode wird wohl heute kaum versucht haben, das ursprüngliche Costüm zu verdrängen – gingen die Iquitosindianer fast vollständig nackt. Nur die Spanier und die Mestizen, die mit Verachtung auf die eingebornen Mitbewohner des Ortes zu blicken pflegten, trugen ein einfaches Hemd, leichte baumwollene Beinkleider und einen landesüblichen Strohhut. Alle lebten in dem Dorfe höchst elend und ohne Verkehr mit einander, außer daß sie sich in den Stunden einmal versammelten, wo die Glocke der Mission sie nach der verfallenen Hütte rief, die als Kirche diente. Stand die Lebensweise in dem Dorfe der Iquitos aber auch auf der niedrigsten Stufe, wie das in allen Flecken am oberen Amazonenstrom der Fall ist, so brauchte man nur eine Meile an demselben Ufer des Stromes hinabzugehen, um eine reiche Niederlassung anzutreffen, wo für alle Bedürfnisse einer comfortablen Existenz gesorgt war.
Da lag nämlich die Farm Joam Garral's, wohin die beiden jungen Leute nach ihrer Begegnung mit dem Waldkapitän zurückkehrten.
Diese Farm, Meierei oder, um den landesüblichen Ausdruck zu gebrauchen, diese jetzt in aller Blüthe stehende »Fazenda« war vor langen Jahren schon an einer Biegung des Stromes bei der Einmündung des hier fünfhundert Schritte breiten Rio Nanay begründet worden. Nach Norden zu begrenzte sie dieser Fluß eine kleine Meile weit, und nach Osten erstreckte sie sich etwa eben so weit an dem großen Strome hin. Gegen Westen schieden sie mehrere kleine Wasserläufe, meist Nebenflüsse des Nanay und mehrere mittelgroße Lagunen von der Savanne und den zur Viehweide benutzten Campinen (das sind große, sumpfige Haidestrecken).
Im Jahre 1826 – sechsundzwanzig Jahre vor der Zeit, mit der diese Erzählung beginnt – hatte Joam Garral bei dem Eigenthümer der Fazenda Aufnahme gefunden.
Dieser Portugiese, Namens Magelhaës, trieb keine andere Industrie als die Ausbeutung der Wälder, und sein erst vor kurzer Zeit begründetes Etablissement dehnte sich kaum eine halbe Meile am Ufer des Flusses aus. Hier lebte Magelhaës – gastfreundlich wie alle reichen Portugiesen – mit seiner Tochter Yaquita, welche nach dem Tode der Mutter dem Hauswesen vorstand. Magelhaës war zwar ein tüchtiger Arbeiter, der vor keiner Mühe zurückscheute, doch fehlte es ihm zu sehr an höherer Bildung. Er wußte mit den wenigen Sklaven, die er besaß, und mit einem Dutzend Indianern, die er besoldete, wohl fertig zu werden, vermochte dagegen den Betrieb seines Handels nach außen hin nur sehr mangelhaft zu leiten. Aus Mangel an Kenntniß ging es mit dem Etablissement bei Iquitos auch nicht so recht vorwärts, und die Verhältnisse des portugiesischen Händlers blieben immer ziemlich gedrückte.
Unter solchen Umständen trat Joam Garral, der damals zweiundzwanzig Jahre zählte, Magelhaës zuerst entgegen. Völlig kraftlos und aller Hilfsmittel baar war er in das Land gekommen. Magelhaës hatte ihn halbtodt vor Hunger und Erschöpfung im nahen Walde gefunden. Der Portugiese besaß ein weiches Herz. Er fragte den Unbekannten nicht, woher er kam, sondern bekümmerte sich nur darum, was er bedürfe. Die trotz seiner Erschöpfung vornehme und stolze Erscheinung Joam Garral's machte auf ihn einen gewissen Eindruck. Er nahm sich also seiner an, half ihm weiter und bot ihm, zunächst für einige Tage, Aufenthalt in seinem Hause an, der das ganze Leben hindurch dauern sollte.
Wir geben hier kurz die Umstände wieder, unter denen Joam Garral in die Farm von Iquitos eintrat.
Von Geburt Brasilianer, war er ohne Familie wie ohne Vermögen. Gram und Kummer, sagte er, hatten ihn veranlaßt, auf Nimmerwiederkehr auszuwandern. Er bat seinen Wirth um Erlaubniß, von den ebenso schweren, wie unverschuldeten Unfällen, die ihn betroffen hatten, schweigen zu dürfen. Er suchte, er ersehnte ja nichts als ein neues Leben, ein Leben voller Arbeit. Mit dem Gedanken, in einer Fazenda des inneren Landes Unterkommen zu finden, war er auf gut Glück in die Welt gegangen. Unterrichtet und offenen Kopfes, zeigte seine ganze Erscheinung ein unerklärliches Etwas, woraus man in ihm einen verständigen Mann mit klarem Verstande und bewußtem Willen erkannte. Magelhaës lernte ihn schnell schätzen und bot ihm deshalb an, auf seiner Farm zu bleiben, wo er ganz geeignet schien, da einzuspringen, wo es dem würdigen Farmer an Kenntniß und Ausbildung mangelte.
Joam Garral ging ohne Zögern auf das Angebot ein. Früher hatte er zwar beabsichtigt in einem »Seringal«, das ist eine Kautschukmanufactur, Anstellung zu suchen, wo ein guter Arbeiter jener Zeit fünf bis sechs Piaster1
täglich verdiente und bei wenigem Glück Aussicht hatte, selbst Eigenthümer zu werden; Magelhaës belehrte ihn aber, daß dieser Lohn nur deshalb so hoch sei, weil es in den Seringals nur zur Erntezeit, das heißt wenige Monate hindurch, Arbeit gäbe und eine dauernde Stellung, wie sie der junge Mann wünschen mußte, da nicht zu erhoffen sei.
Der Portugiese hatte ganz recht. Joam Garral sah das ein und trat entschlossen in die Fazenda mit dem Vorsatze, ihr alle seine Kräfte zu widmen.
Magelhaës hatte seine gute That nicht zu bereuen. Seine Geschäfte gestalteten sich besser. Der Holzhandel, der auf dem Amazonenstrome bis Para betrieben wurde, gewann durch Joam Garral eine beträchtliche Erweiterung. Die Fazenda selbst vergrößerte sich Schritt für Schritt und dehnte sich am Ufer des Stromes bis zur Mündung des Nanay aus. Die Wohnung wurde zu einem stattlichen Hause umgeschaffen, mit einem Stockwerk übersetzt und mit einer Veranda umgeben; so lag sie halb versteckt unter prächtigen Bäumen, Mimosen, Sykomoren, Bauhinias und Paullinias, deren Stämme unter einem dichten Netze von Granaten, Bromelias mit scharlachrothen Blüthen und regellos verschlungenen Lianen ganz verschwanden.
In einiger Entfernung, hinter riesigen Büschen und unter dem Dickicht baumartiger Pflanzen, erhoben sich die Baulichkeiten, in denen das Personal der Fazenda wohnte, das Gesindehaus, die Hütten der Neger und die karaïbischen Wohnzelte der Indianer. Von dem mit Rosen und Wasserpflanzen eingerahmten Stromufer aus sah man also nur das erste Haus.
Eine geräumige, längs der Lagunen gelegene Campine bot treffliches Weideland. Hier tummelten sich zahlreiche Thiere. Diese wurden zu einer neuen Quelle reichen Ertrages in diesen fruchtbaren Landstrichen, wo eine Heerde sich in vier Jahren verdoppelt und dabei doch zehn Procent Ertrag abwirft, nur aus dem Nebenverkaufe des Fleisches und der Häute der für den Bedarf der Züchter geschlachteten Thiere. Auf anderen gerodeten Stellen wurden einige »Sitios« oder Anpflanzungen von Manioc und Kaffee angelegt. Die Zuckerrohrfelder machten bald die Anlage eines Mühlenwerkes zur Zermalmung der Rohrstengel nothwendig, aus denen Melasse, Tafia und Rum gewonnen wurde. Kurz, zehn Jahre nach dem Eintritte Joam Garral's war die Farm bei Iquitos zu einer der reichsten Niederlassungen am oberen Amazonenstrome geworden, und befand sich bei der sicheren Leitung durch den jungen Verwalter, der die Arbeiten im Inneren und die Geschäfte nach außen überwachte, noch immer in fortschreitendem Gedeihen.
Der Portugiese hatte nicht so lange gewartet, sich für Alles, was er Joam Garral verdankte, erkenntlich zu zeigen. Um ihn nach Gebühr zu belohnen, überließ er demselben zunächst einen Antheil an den Einkünften des Geschäftes; vier Jahre später machte er ihn zum wirklichen Theilhaber mit gleichen Rechten und gleichen Antheilen wie er selbst.
Seine Gedanken reichten aber noch weiter. Yaquita, seine Tochter, hatte ebenso wie er an dem schweigsamen, gegen Andere milden, gegen sich selbst strengen jungen Manne die liebenswürdigsten Eigenschaften des Geistes und Herzens bald genug erkannt. Sie liebte ihn; obwohl Joam aber gegenüber den Verdiensten und der Schönheit des munteren, thätigen Mädchens nicht unempfindlich blieb, so schien er doch, aus Stolz oder Schüchternheit, gar nicht daran zu denken, um ihre Hand anzuhalten.
Ein trauriger Unfall beschleunigte die Lösung dieser Frage.
Magelhaës wurde eines Tages beim Fällen eines Baumes von dem umstürzenden Stamme tödtlich verwundet. Fast bewegungslos nach der Farm zurückgebracht und im Vorgefühl seines nahen Endes ergriff er die Hand Yaquitas, die an seiner Seite weinte, legte sie in die Joam Garral's und verlangte von diesem einen Eid, daß er das Mädchen zum Weibe nähme.
»Du hast mein Glück begründet, sagte er, und ich werde nur dann ruhig sterben, wenn ich dieses Band geknüpft und die Zukunft meines Kindes gesichert weiß!
– Ich kann ja ihr ergebener Diener, ihr Bruder, ihr Beschützer bleiben, ohne deshalb ihr Gatte zu werden, hatte Joam Garral zuerst geantwortet. Ich verdanke Euch Alles, Magelhaës, und werde das niemals vergessen, der Preis aber, mit dem Ihr meine Leistungen belohnen wollt, übersteigt deren Werth!«
Der Greis verharrte bei seinem Herzenswunsche. Der Tod gewährte ihm nicht lange Zeit zum Warten, er drängte zu einem Versprechen und erlangte dasselbe.
Yaquita zählte damals zweiundzwanzig Jahre, Joam Garral sechsundzwanzig. Beide liebten sich und vermählten sich einige Stunden vor dem Tode Magelhaës', der noch die Kraft fand, ihren Bund zu segnen.
In Folge dieser Ereignisse wurde Joam Garral im Jahre 1830 der neue Fazender von Iquitos, zur größten Befriedigung Aller, welche zum Personal der Farm gehörten. Die Wohlfahrt der ganzen Niederlassung konnte unter der Vereinigung beider leitenden Kräfte in einem Herzen nur gewinnen.
Ein Jahr nach der Verehelichung schenkte Yaquita dem Gatten einen Sohn, zwei Jahre nachher eine Tochter. Benito und Minha, die Enkel des alten Portugiesen, sollten ihres Großvaters, die Kinder ihrer Eltern würdig werden.
Das junge Mädchen war ein reizendes Geschöpf. Niemals verließ sie die Fazenda. Aufgewachsen in einer reinen und gefunden Umgebung, inmitten der herrlichen Natur der Tropenzone, genügte ihr die Erziehung, welche sie seitens der Mutter genoß, und der Unterricht, den sie vom Vater erhielt. Was hätte sie in einem Kloster von Manao oder Belem weiter lernen können? Wo hätte sie bessere Vorbilder aller weiblichen Tugenden vor Augen gehabt? Würde Geist und Herz sich bei ihr fern vom Vaterhause reifer und zarter entwickelt haben? Auch wenn das Schicksal ihr einst nicht bestimmte, ihrer Mutter in der Bewirthschaftung der Fazenda zu folgen, so fehlte ihr gewiß nichts, um jeder beliebigen Stellung gerecht zu werden.
Mit Benito lag die Sache anders. Sein Vater wünschte, daß er eine so gründliche und vielseitige Ausbildung erlangen sollte, wie sie die großen Städte Brasiliens nur zu bieten vermöchten. Der reiche Fazender brauchte sich für seinen Sohn nichts zu versagen. Benito besaß glückliche Anlagen, einen offenen Kopf und schnelle Auffassungsgabe, neben Eigenschaften des Herzens, welche jenen des Geistes die Waage hielten. Mit dem zwölften Jahre wurde er nach Belem, der Hauptstadt der Provinz Para, gesendet und fand dort bei vortrefflichen Lehrern eine gründliche umfassende Ausbildung, die ihm später eine angesehene Stellung im Leben sichern mußte. In den Wissenschaften, wie in den Künsten blieb ihm nichts fremd. Er lernte, als ob das Vermögen seines Vaters nicht für ihn hingereicht hätte, auch ohne Arbeit zu leben. Er gehörte nicht zu Denen, welche sich einbilden, daß der Reiche müßig leben könne, sondern zu den thatkräftigen Naturen, die sich dieser natürlichsten aller Anforderungen nicht entziehen zu dürfen glauben, da nur die Arbeit den Menschen seines Namens würdig macht.
In den ersten Jahren seines Aufenthaltes in Belem hatte Benito die Bekanntschaft Manoel Valdez' gemacht. Dieser junge Mann, der Sohn eines Kaufmannes in der Provinz Para, lag seinen Studien in derselben Anstalt ob, wie Benito. Die Uebereinstimmung ihrer Charaktere und ihre Neigungen verband sie sehr bald zu inniger Freundschaft und machte sie zu wahrhaft unzertrennlichen Kameraden.
Der im Jahre 1830 geborne Manoel war ein Jahr älter als Benito. Er besaß nur noch seine Mutter, die von einem bescheidenen, von ihrem seligen Manne hinterlassenen Vermögen lebte. Nach Vollendung seiner Vorbereitungsstudien widmete sich Manoel der Arzneiwissenschaft. Er hatte eine leidenschaftliche Liebe für diesen edlen Beruf und beabsichtigte, in Militärdienste zu treten, wozu er sich besonders hingezogen fühlte.
Zur Zeit, wo wir ihm mit seinem Freunde Benito begegneten, hatte er schon eine erste Anstellung und verweilte jetzt während eines Urlaubes in der Fazenda, wo er von jeher seine Ferien zuzubringen pflegte. Dieser junge Mann von hübschem Aeußeren, vornehmer Erscheinung und mit etwas angeborenem Stolze, der ihm recht gut anstand, verkehrte als ein zweiter Sohn, den Joam und Yaquita zur Familie rechneten. Machte ihn diese Eigenschaft als Sohn des Hauses zum Bruder Benitos, so erschien ihm dieser Name gegenüber Minha noch unzureichend, und bald verband er sich mit dem jungen Mädchen durch ein innigeres Band als das der Geschwisterliebe.
Im Jahre 1852 – von dem zu Anfang unserer Erzählung schon vier Monate verflossen waren – zählte Joam Garral achtundvierzig Jahre. Unter einem verzehrenden Klima, das so schnell den Körper abnutzt, hatte er durch seine Enthaltsamkeit in Genüssen jeder Art, durch strenge Lebensordnung und vernünftige Arbeit da Widerstand geleistet, wo Andere vor der Zeit erliegen. Die kurz geschnittenen Haare und der volle Bart färbten sich schon grau und verliehen ihm das Aussehen eines Puritaners. Die sprichwörtliche Ehrlichkeit der brasilianischen Kaufleute und Fazenders spiegelte sich in seiner Erscheinung wieder, deren hervorragendster Zug die Geradheit seines Charakters war. Wenn auch von ruhigem Temperamente, erkannte man in ihm doch ein inneres Feuer, das nur sein fester Wille niederzuhalten vermochte. Die Klarheit seines Blickes verrieth eine bewußte Kraft, an die er gewiß niemals vergeblich appellirte, wenn es galt, mit seiner Person einzutreten.
Und dennoch konnte man an diesem ruhigen Manne, dem Alles im Leben nach Wunsch gegangen zu sein schien, eine gewisse Traurigkeit nicht verkennen, welche selbst Yaquitas Zärtlichkeit nicht zu besiegen im Stande war.
Warum dieser von Allen hochgeachtete Mann, der sich in den glücklichsten Verhältnissen befand, das nicht auch äußerlich zeigte, warum er seine volle Befriedigung nur in dem Glücke Anderer finden konnte, ob vielleicht ein geheimer
Kummer an seiner Seele nagte – das waren Fragen, die sich seine Gattin oft voller Besorgniß vorlegte.
Yaquita war jener Zeit vierundvierzig Jahre alt. Hier in dem Tropenlande, wo andere Frauen schon mit dreißig Jahren gealtert aussehen, hatte auch sie von Einflüssen des Klimas verhältnißmäßig wenig gelitten. Ihre etwas härter gewordenen, aber doch noch hübschen Züge zeigten den stolzen Typus der portugiesischen Race, in welcher ein schönes Gesicht sich so glücklich mit einer edlen Seele paart.
Der einundzwanzigjährige Benito mit seinem lebhaften, zu raschem Handeln geneigten Charakter, unterschied sich darin von seinem ernsteren, mehr überlegten Freunde Manoel. Für Benito war es eine große Freude gewesen, nach einjähriger Abwesenheit in Belem, so fern von der Fazenda, mit seinem jungen Freunde in das elterliche Haus zurückgekehrt zu sein, Vater, Mutter und Schwester wiedergesehen zu haben und sich, bei seiner Vorliebe für die Jagd, inmitten der prächtigen Wälder des oberen Amazonenstromes zu befinden, deren Geheimnisse der Mensch noch nach langen Jahren nicht vollständig entschleiert haben wird.
Minha zählte damals zwanzig Jahre und war ein reizendes junges Mädchen, brünett mit großen, blauen Augen, mit Augen, aus denen man in ihrer Seele lesen konnte. Von mittlerer Größe, schöner Figur und voll natürlicher Grazie, erinnerte sie lebhaft an das Bild Yaquitas. Etwas ernster als ihr Bruder, aber gut, mitleidig und wohlwollend, war sie geliebt von Allen, die mit ihr in Berührung kamen, was ohne Zweifel auch die niedrigsten Diener der Fazenda bestätigt hätten. Manoel Valdez, den Freund ihres Bruders, hätte man freilich nicht fragen dürfen, »wie er sie finde.« Dieser war dabei zu sehr interessirt, um eine unparteiische Antwort geben zu können.
Das Bild der Familie Garral wäre noch nicht vollendet und es würden ihm einige nicht unwichtige Züge fehlen, wenn das zahlreiche Personal der Fazenda hier keine Erwähnung fände.
Zuerst ist da eine alte, sechzigjährige Negerin zu nennen, Cybele, welche zwar frei war nach dem Willen ihres Herrn, aus Liebe zu ihm und den Seinigen aber Sklavin blieb. Das war Yaquitas Amme gewesen. Sie gehörte gänzlich zur Familie und duzte Mutter und Tochter. Das ganze Leben des guten Geschöpfes hatte sich in diesen Feldern, in den Wäldern auf diesen Ufern des Stromes, welche den Horizont der Farm begrenzten, abgespielt. Nach Iquitos war sie zur Zeit gekommen, als noch der Handel mit Negern im Schwunge war, hatte das Dorf niemals verlassen, sich daselbst verheiratet und als sie, frühzeitig verwitwet, ihren einzigen Sohn verloren, war sie in Magelhaës' Dienst verblieben. Von dem Amazonenstrome kannte sie nicht mehr, als das Stück, das vor ihren Augen vorüberfloß.
Neben ihr, und vorzüglich zur Pflege Minhas, befand sich eine hübsche, lachlustige Mulattin, in gleichem Alter mit dem jungen Mädchen, welche ihrer Herrin unendlich ergeben war. Diese hieß Lina. Sie gehörte zu den artigen, etwas verwöhnten Naturen, denen man eine gewisse Vertraulichkeit gern nachsieht, weil sie auf der anderen Seite ihre Herrinnen geradezu verehren. Lebhaft, keine Minute ruhig, anhänglich und schmeichlerisch zugleich, war ihr im Hause so gut wie Alles erlaubt.
Von anderen Dienern gab es zweierlei: Indianer, etwa hundert, welche für Lohn zu den Arbeiten in der Fazenda gedungen waren, und Schwarze, ungefähr noch einmal so viel, die zwar noch nicht eigentlich frei waren, deren Kinder aber nicht mehr als Sklaven geboren wurden. Joam Garral ging auf diesem Wege der brasilianischen Regierung voraus. Hier zu Lande wurden übrigens die von Benguela, Congo und der Goldküste herstammenden Neger meist besser behandelt als anderswo, und in der Fazenda von Iquitos hätte man vergeblich nach solch' traurigen Beispielen unmenschlicher Grausamkeit geforscht, wie sie in fremden Niederlassungen so häufig vorkamen.
Fußnoten
1 Etwa 24 Mark; ein Lohn, der zuweilen aber auch bis 80 Mark per Tag stieg.





























