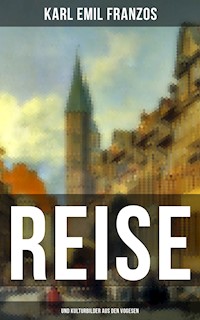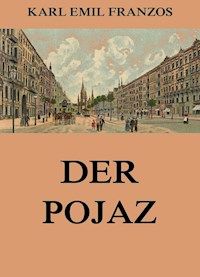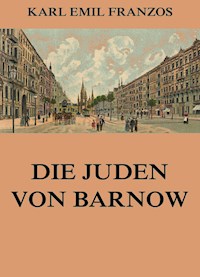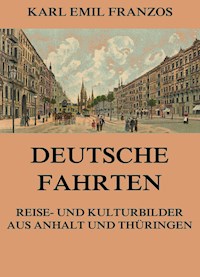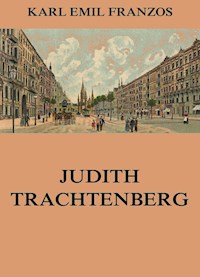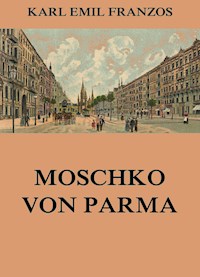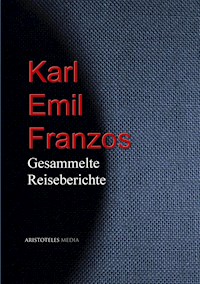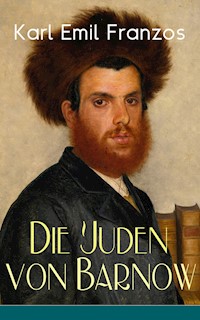
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Dieses eBook: "Die Juden von Barnow" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. In der Novellensammlung Die Juden von Barnow (1877), die jüdische Stetlgeschichten vereint, setzte Franzos seinem Heimatort Czortkow (dem fiktiven Barnow seiner Schriften) ein literarisches Denkmal. Diese Werke schufen die materielle Grundlage dafür, dass er sich mehr und mehr vom Tagesjournalismus abwenden und sich der Schriftstellerei im Hauptberuf widmen konnte. Karl Emil Franzos (1848-1904) war ein zu seiner Zeit sehr populärer österreichischer Schriftsteller und Publizist. Seine Erzählungen und Romane reflektieren die Welt des osteuropäischen Judentums und die Spannungen, denen er als Jude und Deutscher in Galizien und der Bukowina ausgesetzt war. Inhalt: Der Shylock von Barnow Nach dem höheren Gesetz Zwei Retter Der wilde Starost und die schöne Jütta Das "Kind der Sühne" Esterka Regina "Baron Schmule" Das Christusbild Ohne Inschrift
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die Juden von Barnow
Inhaltsverzeichnis
Der Shylock von Barnow
Gerade dem alten, grauen Kloster der Dominikaner gegenüber steht das große, weiße Haus des Juden, hart an der Heerstraße, die von Lemberg nach Skala führt und das düstere Städtchen durchschneidet. Wer in einem der kleinen, schmutzigen Häuser des Ghetto geboren ist, wächst in Ehrfurcht und Bewunderung auf vor diesem Hause und seinem Besitzer, dem alten Moses Freudenthal. Dieses Haus und dieser Mann sind der Stolz von Barnow. Und beide rechtfertigen auch, jedes in seiner Weise, diesen Stolz.
Da ist zuerst das Haus. Es ist, als wüßte es seinen Wert, so stolz und stattlich steht es da in seinem weißen, reinlichen Aufputz, mit der langen, glänzenden Fensterreihe des ersten Stockwerks, mit den bunten Kaufläden zu ebener Erde, zu beiden Seiten des mächtigen Torwegs, der einladend geöffnet ist. Denn dieses Haus ist ein Einkehrhaus, und die Edelleute wissen seine Vorzüge zu schätzen, wenn sie ins Bezirksamt oder zum Wochenmarkt in die Stadt kommen, und ebenso die Kavallerieoffiziere aus den Dörfern der Umgegend, wenn sie die Langeweile hereintreibt. Aber daneben ist das Haus auch ein Zinshaus, denn im ersten Stockwerk wohnen die vornehmsten Honoratioren von Barnow, der Bezirksrichter und der Arzt, zur Miete und daneben – noch alles mögliche dazu. Denn es ist fast schwer, zu sagen, was alles im Erdgeschoß zusammengedrängt ist. Da findet sich eine Lottokollektur und eine Assekuranzagentschaft für Vieh, Menschen und Getreide, eine Tuchhandlung und ein Spezereiwarenladen, eine Weinstube für die vornehmen Gäste und ein Branntweinschank für die Bauern. Und Kollekteur, Agent, Kaufmann und Wirt, dies alles ist Moses Freudenthal.
Aber der alte, hochgewachsene Mann mit den düsteren Zügen ist noch weit mehr. Seine Familie ist seit Menschengedenken die vornehmste im Städtchen, sein Betständer in der »Schul'« steht als der erste in der ersten Reihe. Wie nach seines Großvaters Tode sein Vater, so ist er nach seines Vaters Tode Vorstand der Gemeinde geworden, ohne daß er sich darum beworben, ohne daß es jemand eingefallen wäre, ihn nicht zu wählen. Er gilt als der frömmste und ehrlichste Mann der Judenschaft. Und dazu sein Reichtum, sein ungeheurer Reichtum!
Seine Glaubensgenossen halten ihn für einen Millionär, und sie haben recht. Denn ihm gehört nicht nur das Haus mit all dem, was drum und dran ist, auch mehrere Güter der Umgegend kann er mit größerem Rechte sein nennen als die polnischen Barone und Edelleute, die auf ihnen sitzen. Und das herrliche Gut Komorówka gehört vollends ihm, nachdem es die früheren Eigentümer, der kleine Graf Smólski und seine schöne Gemahlin Aurora, in wenigen Jahren vergeudet. Es ist ein schönes, großes Gut, und der Graf hatte nicht grundlos aus Verzweiflung den größten Rausch seines Lebens, als er es verlassen mußte.
Würde es euch nach all dem wundern, wenn ihr hören würdet, daß Moses Freudenthal nicht nur der reichste und stolzeste, sondern auch der meist beneidete Mann des Ortes ist?! Aber dem ist nicht so. Fraget den ärmsten Mann in der Judenstadt, den Thoralehrer, der mit seinen sechs Kindern am Hungertuche nagt, oder den Wasserträger, der die Woche hindurch vom frühen Morgen bis zum späten Abend vom und zum Stadtbrunnen keucht, fragt sie, ob sie mit Moses tauschen wollen, und sie würden euch »nein« sagen. Denn größer als dieses Mannes Reichtum ist sein Unglück.
Ihr könnt es ihm freilich nicht vom Gesicht ablesen, wenn ihr ihn so stolz und stattlich vor dem Torwege seines Hauses stehen seht. Unter dem kleinen schwarzen Sammetkäppchen quillt das Haar silbergrau hervor; silbergrau und dünn sind auch die beiden langen Locken, die nach der Weise der Chassidim an den Wangen herabfließen. Aber die Gestalt ist noch kräftig und ungebeugt, und der seltsam geschnittene, talarähnliche Judenrock aus schwarzem Tuche kleidet sie stattlich genug. Der alte Mann steht fast bewegungslos da und sieht dem Anstreicher zu, der die Türe des Branntweinladens mit frischer, giftgrüner Farbe überzieht und Flasche, Glas und Bretze gelb und weiß daraufmalt. Nur selten wendet er den Blick ab, um einem Grüßenden zu danken. Denn es ist heute wenig Leben auf der Gasse. Ein Haufe ruthenischer Bauern torkelt angetrunken zur Stadt hinaus; ein Edelmann fährt in leichter Britschka vorüber; einige arme Dorfgeher, welche die Woche über von Bauernhof zu Bauernhof gegangen und für Geld und Tücher Felle eingetauscht, ziehen, mit der erhandelten Ware auf dem Rücken, wieder ein. Die Last ist schwer und der Erlös gering, aber auf den bleichen, abgehärmten oder verschmitzten Gesichtern ruht doch ein Schimmer der Freude und des Stolzes. Denn wenige Stunden noch, und sie sind nicht mehr elende, mit Lumpen bekleidete Schacherjuden, an denen der Bauer seinen Witz und seine Peitsche prüft, sondern stolze Fürsten, die jubelnd in ihrem Palaste die wonnige Braut empfangen – die Sabbatruhe.
Nur wenige Stunden noch, denn die Sonne neigt zum Untergang, und der Freitagnachmittag geht zu Ende. In den Häusern rüsten sie überall für den Ruhetag; die Gasse liegt im hellen Sonnenglanze verödet. Nur vom Amte her kommt der Bezirksrichter, der gelbe, magere Herr Lozinski, mit einem jungen Fremden den Weg herauf und bleibt einige Minuten plaudernd bei Moses stehen, ehe er die Treppe zu seiner Wohnung emporsteigt. Sie sprechen von den schlechten Zeiten, wie hoch das Agio stehe, und dann, wie schön sich diesmal der April anlasse. Und es ist auch heute ein so lieber rechter Frühlingstag, wie ihn dieses Land sonst kaum im Mai zu erleben pflegt. Die Gassen der Stadt sind bis auf einige Kotlachen in der Mitte des Ringplatzes getrocknet, die Luft weht fast sommerlich lau, und im Garten der Mönche drüben blühen die Fruchtbäume und der Flieder. »Frühling! Frühling!« jauchzen die Christenkinder, die eben aus der Nachmittagsschule vorübereilen. »Es wird Frühling!« sagt der Herr Bezirksrichter, greift an den Hut und führt seinen Gast die Treppe empor. »Es wird Frühling«, wiederholt der alte Mann unten und streicht sich über die Stirn, als erwache er aus einem Traum – »es wird Frühling!«
»Ein merkwürdiger Mensch, der alte Moses!« plaudert oben der Bezirksrichter zu seinem Gaste, dem neuen Aktuar. »Ich weiß nicht, ein Sonderling. Man würde es ihm nicht ansehen; er weiß mehr vom Jus als der beste Advokat. Und denken Sie nur: Er ist der reichste Mann im ganzen Kreise. Man spricht von mehreren Millionen. Und dabei plagt er sich die ganze Woche, als müßte er sein Essen für den Sabbat verdienen!«
»Ein Schmutzian, wie die Juden alle«, sagt der Aktuar und ringelt den Rauch seiner Zigarre in die Luft.
»Hm, doch nicht! Er ist wohltätig, man muß sagen, sehr wohltätig. Das macht ihm aber keine Freude und das Verdienen auch nicht. Und doch spekuliert er fortwährend. Für wen? Ich bitte Sie, für wen?!«
»Hat er keine Kinder?« fragt der andere.
»Ja freilich! Das heißt, wie man's nimmt. Nach seiner Auffassung hat er keine. Aber kennen Sie seine Geschichte noch nicht?! Die weiß ja alle Welt – da sieht man, daß Sie aus Lemberg kommen. Da haben Sie wohl auch nichts von der Tochter des Alten gehört, von der schönen Esther Freudenthal? Das ist ja ein ganzer Roman, den müssen Sie hören!«
Der alte Mann, dessen Geschichte alle Welt kennt, lehnt unten noch immer an der Tür seines Hauses und sieht zu, wie die Blütenzweige im Klostergarten im Winde schwanken. Woran er wohl denken mag? An seine Geschäfte nicht. Denn seine Augen sind feucht geworden, und um die Lippen zuckt es einen Augenblick wie verhaltener Schmerz. Er legt seine Hand über die Augen, als blende ihn das Sonnenlicht.
Dann richtet er sich auf und schüttelt das Haupt, als wollte er die trüben Gedanken mit abschütteln. »Beeilt Euch! Es wird bald Sabbat!« ruft er dem Anstreicher zu und tritt näher heran, um die Arbeit zu besichtigen. Der kleine, buckelige Mann im abgeschabten polnischen Schnürrock ist eben mit den beiden Türflügeln fertig geworden und hinkt nun mit dem Farbentopf an den Fensterladen. Im heilsten Zinnoberrot hatte diese Tafel einst in schöneren Tagen geprangt, und in weißen Buchstaben war darauf jener schlichte Witz zu lesen gewesen, den man überall an den Schenkstuben der jüdisch-polnischen Städtchen findet: »Heute ums Geld, morgen umsonst!« Nun ist die Pracht längst dahin, die Worte sind unleserlich geworden, und emsig führt der Kleine den Pinsel mit dem saftigen Grün darüber hin. »Wißt Ihr noch, Pani Moschkos, plaudert er dabei, »daß auch dies hier mein Werk ist?« Und er deutet auf das schmutzige Braunrot des alten Anstrichs.
Aber Moses denkt wohl an Wichtigeres und blickt kaum auf. »So?« sagt er dann gleichgültig.
»Ei freilich!« fährt das Männchen eifrig fort. »Erinnert Ihr Euch nicht mehr! Vor fünfzehn Jahren war's und gerade an einem so schönen Tag wie heute, da hab' ich's gemalt. Das Haus war noch neu und ich noch ein junger Bursch. ›Ich bin zufrieden mit Euch, Janko!‹ habt Ihr damals gesagt. Ihr seid vor dem Tore gestanden, ich glaube gar, an derselben Stelle und neben Euch Eure kleine Esterka. Heilige Jungfrau, was war das Kind schön! Und wie lieb es gelacht bat, wie so ein weißer Buchstabe nach dem andern auf dem roten Grund herauskam! Es hat auch gleich gefragt, was sie bedeuten, das liebe Kind! Und drei Theresienzwanziger habt Ihr mir für die Arbeit gegeben. Ich weiß es noch ganz genau. Ich hab' damals gedacht: ›Janko! Das ist deine letzte Arbeit in Barnow.‹ Denn der alte Herr von Polanski hat mich nach Krakau schicken wollen, in die Malerschule. Aber er hat bald selbst nichts gehabt und sogar später seine Tochter Jadwiga aus Not und Durst verkaufen müssen, und so bin ich ein Anstreicher geblieben. Ja, der Mensch denkt und ...Teufel! Der Alte ist fort, und ich lüge da nur mich selber laut an wie ein Narr. Der Jud' zählt gewiß wieder seine Millionen ...«
Aber Janko irrt. Moses Freudenthal zählt in diesem Momente seine Schätze nicht. Und ungezählt gäbe er sie vielleicht hin, könnte er dadurch die Tatsache aus seinem Leben streichen, durch die er ärmer und elender geworden ist als der Bettler vor seiner Türe. Er hat sich in die große, dämmerige Wohnstube geflüchtet, in die kein Sonnenstrahl und kein Menschenlaut dringt. Hier darf er sich in den Sorgenstuhl werfen und aufschluchzen aus tiefstem Herzensgrund, ohne daß ihn die Leute fragen, was ihm fehle, hier darf er sein Haupt beugen und sein Haar zerwühlen und die Hände vor das Antlitz pressen. Er weint nicht, er betet nicht, er flucht nicht, aber zischend wie ein schriller Wehelaut klingt es immer wieder durch das öde Gemach: »Wie lieb das Kind gelacht hat ...!«
So sitzt er lange in der Dämmerung. Dann erhebt er sich und richtet den Blick nach oben, nicht wie ein Flehender – nein! Wie ein Mann, der sein gutes Recht fordert. »Mein Herr und Gott!« ruft er. »Ich flehe nicht, daß sie wiederkomme, denn durch meine Knechte ließe ich sie von meiner Schwelle jagen; ich flehe nicht, daß sie glücklich werde, denn sie hat zu viel gesündigt an dir und mir; ich flehe nicht, daß sie elend werde, denn sie ist mein Fleisch und Blut; ich flehe nur, daß sie sterbe, damit ich meinem einzigen Kinde nicht fluchen muß, daß sie sterbe, mein Herr und Gott, sie oder ich ...!«
Und oben schließt der Bezirksrichter seine Erzählung: »Was aus der hübschen Kleinen geworden ist, weiß man nicht. Man denkt nicht mehr an sie; auch der Alte scheint die Geschichte vergessen zu haben. Denn sie sind ein herzloses Volk, diese Juden, einer wie der andere ...«
* * * * *
Es ist Dämmerung geworden im Städtchen, aber Licht in den Herzen seiner Bewohner. Das düstere winkelige Ghetto strahlt im Glanze von tausend Kerzen und tausend frohen Menschenangesichtern. Wie ein gewöhnliches, natürliches Ereignis und doch zugleich wie eine geheimnisvolle, wonnige Offenbarung ist der Sabbat eingezogen in die Herzen und in die Stuben und hat alles Dunkel und alle Ärmlichkeit der Wochentage aus ihnen verscheucht. Heute ist jede Kammer erleuchtet und jeder Tisch gedeckt und jedes Herz selig. Der Thoralehrer hat des Hungers vergessen, der Wasserträger der harten Arbeit, der Dorfgeher des Hohnes und der Schläge und der reiche Wucherer der Prozente. Heute sind alle gleich und alle gläubige, fröhliche, demütige Söhne eines Vaters. Das dürftige Talglicht im Tonleuchter und die Wachskerzen im silbernen Kandelaber bescheinen dasselbe Bild. Die Tochter des Hauses und die kleinen Knaben sitzen still da und sehen der Mutter zu, die nach altem schönem Brauch ihren Segen über die Sabbatlichter spricht, der Vater langt vom Bücherbrett das mächtige Gebetbuch und gibt es seinem ältesten Knaben, daß er es ihm bis zum Tore der Synagoge nachtrage. Dann treten sie auf die Gasse; die Männer gehen mit den Männern, die Weiber mit den Weibern, wie es die strenge Sitte fordert. Sie sprechen nicht viel miteinander, und das wenige ernst und ruhig. Heute wird keine Klage laut und kein Jubelruf, denn in ihrem Innern ist es Sabbat, tiefer, heiliger Gottesfriede ...
Auch in dem großen, weißen Hause gegenüber dem Kloster strahlen die Sabbatlichter. Aber eine fremde Hand hat sie entzündet, und kein frommer Frauenmund spricht den Segen über sie. In der guten Stube prangt das feinste Linnen auf den Tischen und reicher schwerer Hausrat an den Wänden, doch kein frohes Kinderlachen klingt darin und kein liebes Wort. Nur die vielen Kerzen knistern leise im Verbrennen, und das gibt einen traurigen Ton.
Aber der alte Mann, der nun im Festtagsgewand in die Stube tritt, ist der Einsamkeit und dieser Töne schon seit Jahren gewohnt, seit langen, ewig langen fünf Jahren. Früher freilich hat er oft um sich blicken und lauschen müssen, ob die liebe Stimme nicht wieder klinge. Denn ein solcher Abend war es ja, da sein Kind von ihm gegangen. Heute jedoch schreitet er rasch durch die Stube, nimmt das schwere, ledergebundene Buch vom Brette und verläßt eilig das Haus. Oder fürchtet er gerade heute die Geister der Erinnerung, die ihm aus allen Ecken und Enden der einsamen, lichtbestrahlten Stube aufsteigen müssen?!
Wenn dem so, dann ist es töricht, ihnen entfliehen zu wollen, Moses Freudenthal! Sie heften sich an deine Fersen, und sie umschwirren dein Haupt, magst du noch so rasch dahineilen durch die engen, dämmerigen Gäßchen. Sie klingen in deinen Ohren, magst du es auch versuchen, mit den Begegnenden zu plaudern; sie stehen vor deinen Augen, magst du auch noch so gläubig aufblicken zu den Weihetäfelchen an den Pfosten des Gotteshauses! Und wie du durch die Reihen schreitest und dich auf deinen Sitz niederlassest, da schlagen sie vollends die Flügel über deinem Haupte zusammen, und sie blicken dich an aus den Lettern deines Buches, und sie rufen dir zu aus den Stimmen der Beter ...!
»Jubelt vor Gott! Brechet aus in Freude, in Jubelklang und Sang. Er richtet die Welt nach seinem Rechte, die Völker nach Gerechtigkeit!«
»Und den einzelnen?« schreit es in dem unglücklichen Mann auf. »Den einzelnen – zermalmt er!« Seine Augen ruhen auf den Zeilen des Buches, seine Lippen flüstern die Worte des Gebetes, aber er betet nicht, er kann nicht beten! Wie ein Gespenst erwacht sein ganzes Leben und drängt sich vor sein Auge, wie ein Gespenst und doch in quälender Greifbarkeit und Lebendigkeit ...
»Wer nicht mehr beten kann«, hat ihm sein alter Vater oft gesagt, und er muß heute der Worte gedenken, »den soll man wegweisen von dem Angesicht des Ewigen.« Noch weiß er sich des Tages ganz genau zu entsinnen, da er es vernommen. Damals war er ein Knabe von dreizehn Jahren gewesen und hatte eben zum ersten Male die Betriemen anlegen dürfen, zum Zeichen, daß er in den Bund der Männer getreten. An jenem Tage war ihm das Leben aufgegangen, nicht weich und feenhaft wie den Glücklichen dieser Erde, sondern hart und nüchtern wie den anderen Söhnen seines Volkes. Wie alle die anderen hatte auch er allmählich gelernt, um zweier Dinge willen zu leben: um zu beten und um Geld zu verdienen. Und als er siebenzehn Jahr alt geworden, da hatte ihn sein Vater in seine Stube gerufen und ihm dort kurz und kühl gesagt, in drei Monaten werde er heiraten und Chaim Grünsteins Rosele sei seine Braut. Er kannte das Mädchen nicht, er hatte es vorher nur zweimal gesehen, und recht angeschaut hatte er es eigentlich nie. Aber der Vater hatte für ihn gewählt, und so war es ihm recht gewesen. Und nach drei Monaten war das Rosele sein Weib ...
Horch! Jubelnd, sehnend, herzergreifend beginnt nun der Vorbeter das uralte Sabbatlied: »Lecho daudi likras kallo.« Und im stürmischen Chor stimmen die anderen ein: »Lecho daudi likras kallo« – komm, o Freund, der Braut entgegen, den Sabbat laßt uns fröhlich enpfangen!
Seltsames Weben in der Seele eines Volkes! Auf die Gottheit, und allein auf diese überträgt es alle Glut und alle Sinnlichkeit seines Herzens und seines Geistes. Demselben Volke, welches einst das Hohelied gedichtet, den ewigen Hymnus der Liebe, und die Geschichte der Ruth, die schönste Idylle der Weiblichkeit, demselben Volk ist in der tausendjährigen Nacht, Bedrückung und Ruhelosigkeit die Ehe ein Geschäft geworden, geschlossen, um Geld zu erwerben und um die Auserwählten Gottes nicht aussterben zu lassen. Und sie ahnen nicht einmal den entsetzlichen Frevel, der darin liegt.
Auch Moses Freudenthal nicht. Er hat sein Weib hochgehalten alle Tage ihres Lebens, wie auch sie ihm treu zur Seite gestanden in Freud und Leid. Es war Segen auf seinen Werken, und was er begann, glückte. Mit rastlosem Eifer studierte er die Sprache der Christen und die deutschen Gesetze; der dreißigjährige Mann lernte wie ein Knabe. Nicht die Geldgier allein trieb ihn, auch ein stolzes Streben nach Ehre und Wissen. Und dieses Wissen trug seine Früchte, er wurde reich, sehr reich. Die Edelleute und die Offiziere kamen in sein Haus und beugten sich vor seinem Gelde: aber durch seinen Stolz und seine Ehrlichkeit zwang er sie, sich auch vor ihm selbst zu beugen. Damals beneideten sie ihn alle, und wenn er vorüberging, dann zischelten sie einander zu: »Das ist der glücklichste Mensch im ganzen Kreise.«
Aber war er es wirklich?! Warum war dann seine Stirne so häufig umdüstert, warum weinte dann das Rosele, wenn es allein war, als wollte ihm das Herz brechen?! Auf dem Glücke dieser beiden Menschen, die sich erst allmählich in gegenseitige Achtung hineingewöhnt, lag ein schwerer Schatten: ihre Ehe blieb kinderlos. Und weil eine fremde Hand sie zusammengefügt, weil sie einander doch in tiefster Seele fremd gegenüberstanden, darum konnten sie es nicht verwinden und fanden in sich kein Gegengewicht gegen diesen Schmerz. Der stolze Mann trug sein Weh verschlossen in der Brust und sah fast unbewegt zu, wie sein Weib dahinwelkte. Wenn seine Leute von Trennung sprachen, dann schüttelte er das Haupt, aber sein Mund fand auch kein Wort der Liebe für die Unglückliche. So vergingen lange Jahre. Aber eines Abends – es war im Winter –, als er in die Stube trat und seinem Weibe den »guten Abend« bot, da erwiderte sie seinen Gruß nicht leise wie gewöhnlich, da blickte sie ihn nicht scheu und gedrückt an wie sonst, da eilte sie ihm entgegen, da preßte sie sich in seine Arme, als hätte sie jetzt erst das Recht, an seinem Herzen zu ruhen. Überrascht, dann in seligem Ahnen blickte er ihr in das erregte, hocherrötende Antlitz. Dann ergriff er ihre Hand, zog sie auf den Sitz neben sich nieder und lehnte ihr Haupt an seine Brust. Ihre Lippen bebten, aber sie fanden beide kein Wort für ihre Seligkeit, kein armes Menschenwort ...!
»Lobet Gott den Allgelobten!« tönt die Stimme des Vorbeters in die Träume des Brütenden. Und die Gemeinde erwidert: »Gelobt sei Gott, unser Herr, der da schaffet den Tag und schaffet die Nacht, der da wälzet das Licht vor die Finsternis und die Finsternis vor das Licht, Er, der Allmächtige, der Beständige, der Gott der Heerscharen!«
»Gelobt sei Gott!« – Mit welchen Gefühlen hatte Moses Freudenthal mit eingestimmt in diesen Ruf an jenem Sabbatabend vor zweiundzwanzig Jahren, an dem er zum erstenmal als Vater das Haus Gottes betreten! Wie hatte sein Herz geblutet und gejauchzt, wie hatte er geweint vor Freude und Schmerz! Denn wohl war ihm ein Töchterlein geboren worden, aber sein Weib war gestorben an der späten, schweren Geburt. Ergeben und ohne Klage hatte sie die ungeheuren Schmerzen ertragen, und selbst in ihren letzten Stunden noch ging ein leises Lächeln über das verblaßte Antlitz, sooft sie die Stimme der Neugeborenen vernahm. Und in jenen qualvollen Stunden hatten sich auch die Herzen der Gatten gefunden, die fremd geblieben in den langen Jahren ihrer Ehe. Er allein verstand es, warum sein Weib sagen konnte: »Nun kann ich zufrieden sterben«, und sie allein verstand es, warum er sich immer wieder über ihre Hand beugte und schluchzte: »Verzeih, Rosele, verzeih!« – »Das Kind«, flüsterte sie, »gib acht auf das Kind!« Dann zuckte sie zusammen und war tot. Und am nächsten Morgen trugen sie sie hinaus zum »guten Orte«. Er aber zerriß seine Kleider und streifte die Schuhe von seinen Füßen und saß sieben Tage und sieben Nächte auf dem Estrich des Totenzimmers,wie es Trauerbrauch ist in Israel. Er weinte nicht; trocken und glanzlos starrte sein Auge in die Flamme des Totenlichtes, das die Woche über brennen muß, damit die heimatlose Seele eine Ruhestatt habe auf Erden, ehe ihr Gott ihren Platz weist. »Er spricht mit der Toten«, flüsterten scheu seine Verwandten, als er immer und immer wieder vor sich hin murmelte: »Nun hätte alles gut werden können, und nun bist du tot!« Aber in milde Tränen löste sich sein Schmerz, als sie ihm das Kind brachten und fragten, wie es heißen solle. »Esther«, erwiderte er, »Esther, wie meine Mutter.« Lange hielt er sein Töchterchen auf den Armen, und seine Tränen fielen auf das kleine Antlitz. Dann gab er es der Wärterin zurück und war von da ab gefaßt und ruhig. So ging die Trauerzeit vorüber. Rastlos und emsig wie kaum vorher ging er an seine Geschäfte. Ein neuer Geist schien über den Mann gekommen, jeder Tag brachte kühne Unternehmungen und neue waghalsige Pläne. Was kein anderer versucht hätte, er wagte es, und das Glück blieb ihm treu. Nun führte er auch seinen Lieblingswunsch aus, kaufte den Platz gegenüber den Dominikanern und begann da ein großes Haus zu bauen. So vergingen die Tage in ruheloser Arbeit, des Abends aber saß er stundenlang an der Wiege seines Kindes und blickte in die weichen, noch unausgebildeten Züge. Und in den ersten Monaten hörte die Wärterin oft – es ward ihr fast unheimlich dabei –, wie er sich sogar des Nachts erhob, in der Kinderstube niederkauerte und lange Zeit stumm und bewegungslos im Dunkel auf die Atemzüge des schlafenden Kindes horchte. Die Tage wurden zu Monaten und Jahren, die kleine Esther wuchs heran und ward sehr klug und schön. Sie sah dem Vater ähnlich, hatte sein schwarzes, gelocktes Haar, die hohe Stirn und die festen geschlossenen Lippen, aber fremd und rührend standen in diesem trotzigen Kindergesichte die sanften blauen Augen der Mutter. Oft und viel mußte der Vater in diese hellen Kinderaugen blicken. Und in solchen Momenten umfaßt er wohl auch sein Töchterchen und preßte es an sein Herz und gab ihm tausend süße Schmeichelnamen; sonst wies der ernste, verschlossene Mann dem Kinde wenig seine fast wahnsinnige Liebe. Als Esther fünf Jahre alt geworden, zogen sie aus dem engen Hause in der Judenstadt in das große, weiße Haus gegenüber dem Kloster. Von da ab begann auch Moses für die Erziehung seines Kindes zu sorgen; in seiner Weise freilich, oder richtiger, in der althergebrachten Weise. Esther lernte kochen, beten und rechnen; so wußte sie genug für das Haus, für den Himmel und für das Leben. Und was hätte ihr auch der Vater noch außerdem lehren lassen sollen? Das Deutsche etwa? Sprechen konnte sie es, das Lesen und Schreiben schien ihm, wie allen Juden in Barnow, für ein Mädchen unnützer Luxus. Er hatte es gelernt, um seine Geschäftsbriefe zu schreiben und das bürgerliche Gesetzbuch zu verstehen; seine Tochter bedurfte keines von beiden. Oder konnte sie etwa durch größeres Wissen besser und glücklicher werden? »Wenn ein jüdisch Kind gut beten kann«, geht das Wort unter diesen verdüsterten Menschen, »so braucht es nichts anderes, um gut und heiter zu sein!« Und doch sollte die kleine Esther noch das Deutschlesen lernen und viel, viel mehr dazu ...
»Es war eine schwache Stunde!« murmelte der Mann und erhebt sich mit den anderen zu dem langen Gebete, das man stehend sprechen muß. »Eine schwache, törichte Stunde! Weh mir, daß ich nachgegeben, und Fluch dem, der mich dazu verführt!«
Oh, wie du da frevelst, Moses Freudenthal! Wie dich das Unglück auch geläutert und dich dein eigen Herz erkennen gemacht, noch immer kannst du es nicht erfassen, daß es eine Sünde gewesen, als du deinem Kinde das Licht und die Welt verschließen gewollt, und daß du recht getan, als du in jener Stunde gestattet, daß ein anderer sie ihm erschließe. O wie du frevelst, alter Mann, wie du dein Herz verhärtest in Selbstsucht und Unverstand, wenn du weiter sprichst: »Das war mein und ihr Unglück! Denn von da ab ward ihr Sinn verstrickt und abwendig gemacht mir und meinem Gotte! O Fluch, Fluch jener Stunde!«
Das aber war vor dreizehn Jahren gewesen, an einem milden, hellen Sommerabend. Auf den Häusern und Plätzen lag das Mondlicht, und der Staub der Straße glänzte weit hinaus wie mattes Silber. Moses Freudenthal saß auf der Steinbank vor seinem Hause und brütete vor sich hin. Es war ihm seltsam weich zumute; er mußte immer wieder, ohne daß er es wollte, seiner Jugend und seines verstorbenen Weibes gedenken. Ihm zur Seite saß sein neunjähriges Töchterchen, und blickte mit weit geöffneten Augen hinaus in die Mondnacht. Da kam ein Mann die Gasse herauf und blieb vor den beiden stehen. Moses erkannte ihn nicht sogleich, aber die kleine Esther sprang auf und jubelte: »Onkel Schlome! Das ist schön, daß du zu uns kommst!« Nun erkannte auch Moses den fremden Gast und stand befremdet auf. Was wollte Schlome Grünstein bei ihm, und woher kannte sein Kind den »Meschumed?« Er war sein Jugendgespiele und der Bruder seines Weibes, aber seit zwanzig Jahren und darüber hatte Moses kein Wort mit ihm gesprochen. Denn mit einem »Meschumed«, mit einem Abtrünnigen vom Glauben, darf der Fromme keine Gemeinschaft haben, und ein solcher Abtrünniger war Schlome in den Augen des Ghetto. Und doch war der bleiche, kränkliche Mann mit den weichen, träumerischen Zügen immer Jude geblieben, lebte still und friedlich unter den anderen und nützte seinen Reichtum zu Werken des Segens und der Barmherzigkeit. Aber der Makel und der Name klebten ihm aus seiner Jugendzeit unauslöschlich an.
Da war es ihm seltsam ergangen. Der Vater hatte den schüchternen und tiefsinnigen Knaben, der nur in seinen Büchern lebte und da allein Witz und Scharfsinn zeigte, zum Rabbi bestimmt. Schlome war damit zufrieden, studierte sich fast um seine Gesundheit und übertraf bald seine Lehrer. Denn in dem schwachen Knaben loderte eine verzehrende Sehnsucht nach Wissen und Erkenntnis. Diese Sehnsucht ward sein Verderben und der Fluch seines Lebens. Durch Geld und flehentliche Bitten bewog er den christlichen Schulmeister des Ortes, ihm heimlich, in späten Nachtstunden, das verbotene, verhaßte Hochdeutsch zu lehren und die »Christenweisheit«. Von der letztern aber wußte der Schulmeister selbst nicht allzuviel und half sich damit, daß er seinem ungestümen Schüler, kaum daß dieser lesen konnte, alle Bücher aus der Klosterbibliothek zuschleppte, deren er nur immer habhaft wurde. So las der heranreifende Jüngling die seltsamsten und wirrsten Dinge bunt durcheinander und legte sie sich oft seltsam genug zurecht. Da kam ihm auch eines Tages ein Buch in die Hände, das ihn dem Wahnsinn nahe brachte. Die Form und der Ton dieses Buches waren ihm wohlbekannt und vertraut, mahnten sie doch an die heilige Thora, aber der Geist, der durch diese Blätter zog,war ein anderer und – dem Jüngling erstarrte das Blut – ein milderer und sanfterer. Denn dieses Buch war das Neue Testament. Wie Frühlingsluft wehte es ihn daraus an, und doch sträubte sich sein Haar vor Entsetzen. Das also war die Götzenlehre der Christen, und so hatte jener Mann gelebt und gewirkt, den seine Väter gekreuzigt und von dessen Bilde man ihn noch jetzt in Haß und Verachtung das Antlitz abzuwenden gelehrt! Der Schlag war zu heftig, Schlome verfiel in gefährliche Krankheit und lag lange Wochen in schwerem Fieber. Oft und viel weinte und sprach der Bewußtlose von dem bleichen Nazarener und dem Kreuz und jenem Buche. Entsetzt hörten es die Eltern und die Nachbarn; sie forschten nach dem Zusammenhang und entdeckten endlich die heimlichen Studien. Bald ging das unheimliche Gerücht durch das Ghetto, Schlome habe Christ werden wollen und sei dafür von Gott mit Wahnsinn gezüchtigt worden. Aber der Jüngling genas und ging wieder unter seinen Glaubensgenossen einher, noch scheuer, noch bleicher, noch gedrückter als vorher. Was in seinem Innern tobte und kämpfte, erfuhr niemand, aber jedes Kind in der Judengasse nannte ihn den »Meschumed« und wußte zu erzählen, daß er seinem Vater mit heiligem Eide geschworen, Jude zu bleiben, wenn dieser ihm dagegen zweierlei gestatte: alle Bücher zu kaufen und zu lesen, die er wollte, und – unvermählt zu bleiben. Und er hielt seinen Schwur, auch nachdem ihn der Tod seiner Eltern reich und unabhängig gemacht. So verging sein Leben in dem engen finstern Ghetto. Er hatte nur einen Freund, das war David Blum, der Krankenpfleger, gleichfalls ein unglücklicher Mensch mit seltsamen Schicksalen. Aber diesen Freund gewann er spät und verlor ihn bald: David Blum starb, ob an den Folgen des Nervenfiebers, ob an gebrochenem Herzen, es war kaum zu entscheiden. Der »Meschumed« betrauerte ihn sehr, und dieser Tod riß eine tiefe Wunde in sein ohnehin so freudenarmes Leben; ihm war's, als wäre da ein Stück seines eigenen Herzens zur frühen Gruft gesunken. Und doch war nicht bloß beider Schicksal, sondern auch beider Natur grundverschieden gewesen: David stark und hochstrebend, aber spröde und phantastisch und darum für immer gebrochen, als ihn einmal die Hand des Schicksals traf: Schlome schwach und milde, ein Dulder, den das Schicksal beugen, doch nicht zermalmen konnte. So lebte er fort mitten unter den Menschen und dennoch entsetzlich einsam, selbst die Armen nahmen die Wohltaten nur zögernd aus seiner Hand. Und doch liebte er alle Menschen und am meisten die Kinder, die einzigen, welche diese Liebe erwiderten, obwohl auch sie aus Furcht vor den Eltern nur selten mit ihm verkehren durften. Die kleine Esther, das einzige Kind seiner verstorbenen Schwester, liebte er vollends fast abgöttisch, und auch sie hing inniger an ihm als an dem ernsten, verschlossenen Vater.
Das war der Mann, der in jener Mondnacht zur Steinbank kam, auf der Moses Freudenthal und sein Kind saßen. »Ich habe mit Euch zu sprechen, Schwager«, sagte er, als dieser ihn kalt und fragend ansah. Und dann, nachdem das Kind über seine Bitte zur Ruhe gegangen, wiederholte er noch einmal: »Ich habe mit Euch zu sprechen, vieles und Wichtiges. Setzt Euch nur neben mich, Ihr dürft's jetzt schon wagen, es ist keine lebendige Seel' mehr auf der Gasse ...« Moses setzte sich zögernd. »Es ist wegen des Kindes«, begann der »Meschumed«. »Die Sache drückt mir schon lang auf dem Herzen, und da ich eben vorüberging und Euch erkannte, mochte ich's nicht länger aufschieben. Seht, Schwager, Euer Kind wächst herrlich heran. Sie wird einmal sehr schön werden, aber, was noch mehr, sie ist schon heute sehr gut und so klug, daß es für ihre Jahre zum Verwundern ist. Ihr wißt es kaum, was für Fragen das Kind stellt und wie eigen es sich alles in seinem Kopf zurechtlegt; Ihr wißt es kaum, Schwager!« – »Und woher wißt ihr's?« unterbrach ihn Moses, und die Stimme klang hart und scharf. »Habe ich Euch gestattet ...« Aber der andere erhob abwehrend seine Hand. »Laßt das, ich bitte Euch, laßt das! Ich könnte Euch trotzig erwidern, daß Esther meiner Schwester Kind ist und daß ich gutes Recht und guten Grund habe zur Sorge und Liebe für Eure Tochter. Aber ich kann und will nicht so sprechen; Trotz und Zorn haben uns lange genug getrennt. Und selbst wenn Ihr mir sagtet, daß ich Eurem Hause fremd sei, fremd oder durch eigene Schuld entfremdet, ich würde nichts darauf erwidern. Denn um jemand liebzuhaben, dazu bedarf man nicht des Rechtes der Verwandtschaft, und die Welt ist nicht so reich an Liebe, daß man sie sich verbitten müßte. Aber – Ihr meint doch etwas anderes! Ihr fürchtet Gefahr für Euer Kind, wenn es mit mir verkehrt. Was Ihr jedem Eurer Diener gestattet, das glaubt Ihr mir nicht gestatten zu dürfen. Und so muß ich Euch fragen: Schwager! Haltet Ihr mich für weniger gut als den Letzten Eurer Diener?!« Er hielt inne, doch Moses erwiderte nichts. Es hatte den harten Mann eigen berührt, als er nun wieder die Stimme vernahm, die einst in seiner Jugendzeit so gut und treu zu ihm gesprochen. Aber er schüttelte es ab, und als Schlome seine Frage wiederholte, erwiderte er kalt und ernst: »Meine Diener sind fromm und halten fest an dem Glauben der Väter.« Er sprach die Worte vor sich hin und blickte nicht auf, sonst hätte er den Schmerz und die Bitterkeit sehen müssen, die um des andern Lippen zuckten. Aber es war kein bitteres Wort, das von diesen Lippen kam. »Seht, Moses«, sagte er tief aufatmend, »es steht ein gutes Wort geschrieben: ›An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!‹ Und mein Leben liegt klar vor Euren wie vor aller Augen. Ich war furchtbar einsam, gemieden und weltverloren, aber aus ganzer Seele habe ich mich gemüht, dieses Leben anzuknüpfen an das der anderen um mich her. Ich habe mich gemüht, es so nützlich zu machen, als es nach dem, was einmal geschehen, noch werden konnte. Ihr seid der erste Mensch – und Ihr werdet der einzige bleiben –, dem ich es sage, daß ich mir bewußt bin, mein möglichstes in dem getan zu haben, was man Wohltun nennt und was doch nur Menschenpflicht heißen sollte. Ich habe deshalb freilich kein glückliches und gutes Leben gelebt, aber richtet Ihr, Schwager, richtet Ihr, ob es auf Frevel und Torheit weist?« Moses strich mit der Hand über Stirn und Augen als müßte er sich auf die Antwort besinnen. Dann sagte er milder: »Über ein ganzes Leben richten und gerecht richten, das kann kein Mensch, das kann nur der allwissende Gott. Ich will glauben, daß es so ist, wie Ihr sprecht, und wohl Euch, wenn es so ist. Dann könnt Ihr ruhig der Stunde harren, wo Gott Euch richtet. Aber« – unterbrach er sich und fuhr dann fast scheu fort – »glaubt Ihr auch an Gott?!« – »Ja!« erwiderte Schlome und erhob sein Haupt »Ja! Ich glaube an ihn. Ich habe ihn in meiner Knabenzeit gesucht und gewähnt, er sei ein Gott des Zornes und der Rache und nur einem Volke das Licht und der Hort; ich habe ihn in meiner Jünglingszeit gesucht und gewähnt, er sei ein Gott der Liebe und des Erbarmens und doch nur denen gnädig, die ihn verehren in bestimmter Form und Satzung. Später habe ich ihn gefunden und erkannt; er ist kein Gott des Zornes und kein Gott des Erbarmens, er ist ein Gott der Gerechtigkeit und der Notwendigkeit. Er ist und ist allen, auch denen, die ihn leugnen!« Er hatte sich erregt erhoben, und als er so im Mondlichte vor Moses stand, überkam es diesen seltsam; ihm war's, als leuchte das Antlitz des Mannes. Er wußte nicht, wie ihm geschah, er mußte auf das Bild des Gekreuzigten blicken, das drüben im Klostergarten stand und sich in dem hellen Lichte scharf abhob vom dunklen Nachthimmel. »Und der dort?« mußte er fragen und erschrak fast, als er es gesprochen. – »Der dort«, erwiderte der »Meschumed«, und die Stimme klang wunderbar wehmütig und weich, »der dort war ein edler und großer Mensch, vielleicht der beste, der je auf Erden gewandelt. Aber er ist tot, und sein Geist ist erstorben, erstorben auch in jenen, die ihn ihren Erlöser nennen! Die Törichten – nur durch sich selber wird der Mensch erlöst, durch sich und in sich ...« Er hielt inne, auch Moses schwieg. So saßen die beiden Männer eine Weile stumm nebeneinander, jeder mit seinen Gedanken beschäftigt. Dann fragte Moses: »Und was wollt Ihr mit dem Kinde?« – »Ich will sein Lehrer werden«, erwiderte Schlome, »denn ich habe es sehr liebgewonnen in den seltenen Stunden, wo ich es sprechen durfte. Und glaubt mir, das ist kein gewöhnliches Kind! O wäre es doch ein Knabe! habe ich oft denken müssen und doch gleich wieder – Ihr wißt vielleicht, warum –, es ist gut, daß es ein Mädchen ist. Denn in diesem Kinde lebt ein großer Hunger nach Wissen und ein seltsames Ahnen des Lichts ...« Aber abwehrend unterbrach ihn der andere: »Ihr träumt, Schlome! Esther ist kaum neun Jahre alt, und ich, der Vater, habe nie dergleichen bemerkt.« – »Weil Ihr es nicht sehen wollt«, war die Antwort, »oder, verzeiht mir, nicht sehen könnt! Ihr haltet es für Träumerei oder Narrheit oder meint, es sei Kinderart so. Ich aber weiß, was es heißt, solches Sehnen im einsamen jungen Herzen zu tragen. Glaubt mir, es wäre Frevel, ließet Ihr all das verkommen, was da emporkeimt. Und darum bitte ich Euch: Erlaubt, daß ich Esthers Lehrer werde!« Und wieder war es lange still unter den Männern. Dann endlich erwiderte Moses: »Ich kann nicht, Schwager, ich darf nicht, auch wenn ich wollte. Nicht Euretwegen muß ich so sprechen; von Euch will ich alles Gute glauben und ebenso von dem, was Ihr das Kind lehren würdet. Aber es paßt nicht für meine Tochter. Sie soll ein einfach jüdisch Kind bleiben; ich will es so, und es wird so sein. Was soll sie Fremdes erfahren, was ihr Herz sehnsüchtig machen kann und traurig? Mein Kind soll ein frommes, schlichtes Weib werden; es ist das beste für sie, und darum eben will ich es so. Daß sie einen reichen, angesehenen Mann bekommt, dafür hab' ich gesorgt.« – »Ja!« erwiderte der »Meschumed«, und zum erstenmal in dieser Unterredung klang seine Stimme bitter und herbe. »Ja! Ihr seid sehr reich und habt Recht: so labt Ihr auch für einen reichen Eidam gesorgt. Das Mädchen ist nun neun Jahre alt; in sechs, sieben Jahren werdet Ihr ihm den reichsten und frömmsten Jüngling in der Runde aussuchen oder auch einen Witwer, wenn der noch reicher und frömmer ist. Sie wird ihn freilich nicht kennen, aber das tut ja nichts, dazu hat sie nach der Hochzeit Zeit genug! Dann wird sie ihn vielleicht fürchten oder hassen, oder er wird ihr gleichgültig sein. Aber auch das tut nichts! Denn wozu braucht ein jüdisch Weib die Liebe?! Doch nur, um Gott zu lieben und seine Kinder und – oh, daß ich's nicht vergesse! – sein bißchen Reichtum!« – »Ich verstehe Euch nicht«, sagte Moses zögernd, wie erstaunt. – »Ihr versteht mich nicht?« rief der andere und erhob sich erregt. »So könnt Ihr sprechen, Ihr?! O Schwager – denkt anmeine Schwester!« Moses Freudenthal zuckte auf wie ein Wild, das ein Schuß ins Herz getroffen. Er wollte zürnend erwidern, er wollte den fremden Mahner wegweisen von der Schwelle. Aber er konnte es nicht. Er mußte sein Haupt beugen vor dem Blicke des verachteten, gemiedenen Mannes; er mußte nach langem Kampfe leise, tief aufatmend sagen: »Es war nicht meine Schuld!« – »Nein«, sprach der »Meschumed«, und seine Stimme klang wieder mild und ruhig, »nein, es war nicht Eure, es war Eures und meines Vaters Schuld. Aber was Ihr an Eurem Kinde tut, das lastet auf Euch, nur auf Euch!« Und als der erschütterte Mann nichts zu erwidern vermochte, fuhr er fort: »Verhärtet nicht Euer Herz, auf daß Ihr nicht frevelt. Denkt an das Wort, das geschrieben steht: ›Gebet zu trinken denen, die es dürstet!‹ Schwager, darf ich Eurem dürstenden Kinde das Licht und das Leben zeigen?!« Auch darauf hatte dieser nichts zu erwidern vermocht, aber am nächsten Tage ging die seltsame, fast unglaubliche Kunde durch die Gasse, Moses Freudenthal habe sich mit Schlome, dem »Meschumed«, versöhnt und ihm sogar sein einziges Kind anvertraut.