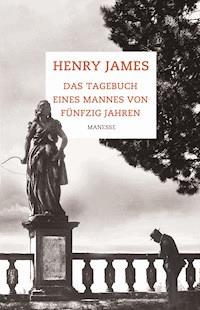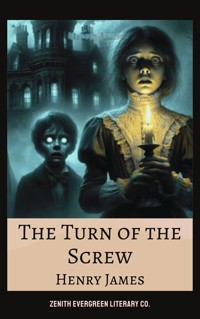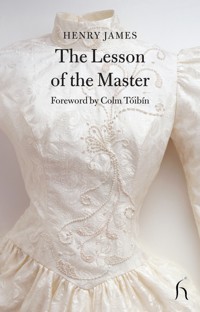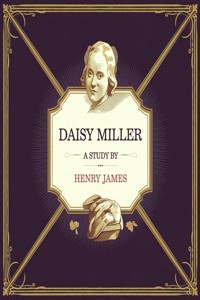6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer sagt, dass Blut dicker ist als Wasser? Henry James erklärt in seinem Roman «Die Kostbarkeiten von Poynton» die Familie zum Schauplatz boshafter Verteilungskämpfe. Nach dem gefeierten Erfolg von «Die Europäer» und «Washington Square» führen wir die Henry-James-Renaissance mit dieser Neuübersetzung eines Spätwerks fort.
Wertvolle Gobelins, Elfenbeinschnitzereien, edle Bronzen und alte spanische Altardecken ... Adela Gereth hat in «Poynton Park», ihrem Landsitz aus dem 17. Jahrhundert, lebenslang leidenschaftlich erlesene Einrichtungsgegenstände aus ganz Europa gesammelt. Dass nun weder Sohn Owen noch die von ihm umworbene Mona Brigstock diese Kostbarkeiten zu würdigen wissen, bereitet Adela Kopfzerbrechen. Dass das junge Paar sie ausquartieren will, bringt sie gar an den Rand der Verzweiflung. Dabei hat sie in Fleda Vetch doch bereits eine adäquate und sachkundige Schwiegertochter ausgemacht. Fleda findet tatsächlich nicht nur Gefallen am Haus, sondern auch an Owen – und sitzt plötzlich zwischen allen Stühlen. Bekannt für seine sprachliche wie psychologische Raffinesse, lässt uns Henry James auch mit diesem Roman wieder in die Abgründe menschlicher Beziehungen blicken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Wer sagt, dass Blut dicker ist als Wasser? Henry James erklärt in seinem Roman die Familie zum Schauplatz erbitterter Verteilungskämpfe. In gewohnt raffinierter Weise lässt er uns dabei über die wahren Absichten und Gefühle seiner Figuren im Unklaren. – Nach den großen Erfolgen von «Die Europäer» und «Washington Square» ist nun auch dieses Spätwerk des Jahrhundertautors in Neuübersetzung zu entdecken.
«Ein Schriftsteller, der, ohne zu belehren, uns doch klüger entlässt.»Verena Auffermann
Henry James (1843–1916) wurde in New York geboren, verbrachte jedoch die meiste Zeit seines Lebens auf Reisen, oftmals in Europa. Seinen Ruf als Meister der psychologischen Erzählkunst erschrieb er sich mit zwanzig Romanen und über hundert Erzählungen. Im Manesse Verlag erscheinen regelmäßig Erst- und Neuübersetzungen seiner Werke: «Die Europäer» (2016), «Das Tagebuch eines Mannes von fünfzig Jahren» (2015), «Washington Square» (2014), «Wie alles kam» (2012), «Die Drehung der Schraube» (2010), «Benvolio» (2009).
Nikolaus Stingl, geb. 1952, studierte Anglistik und Germanistik und ist seit den 80er-Jahren als Übersetzer tätig. Er übertrug u. a. Werke von Paul Auster, John Irving, Cormac McCarthy, Thomas Pynchon und Colson Whitehead ins Deutsche. Für seine Arbeit erhielt er zahlreiche Preise, so den Heinrich-Maria-Ledig-Rowohlt-Preis, den Literaturpreis der Stadt Stuttgart, den Paul-Celan-Preis und den Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW.
HENRY JAMES
Die Kostbarkeitenvon Poynton
Roman
Aus dem Englischen übersetztvon Nikolaus Stingl
Nachwort von Alexander Cammann
MANESSE VERLAGZÜRICH
1
Mrs. Gereth hatte erklärt, sie werde mit den anderen zur Kirche gehen, doch plötzlich schien es ihr, als müsse sie, schon bevor es Zeit für die Kirche war, für Abhilfe sorgen: In Waterbath wurde das Frühstück pünktlich eingenommen, und bis dahin blieb ihr noch immer fast eine Stunde. Wohl wissend, dass es bis zur Kirche nicht weit war, rüstete sie sich auf ihrem Zimmer für den kurzen ländlichen Spaziergang, und als sie, wieder auf dem Weg nach unten, die Flure durchmaß und die Einfältigkeit der Dekoration gewahrte, das ästhetische Elend des großen, geräumigen Hauses, spürte sie, wie die Flut der Verärgerung von vergangener Nacht zurückkehrte, all das wieder auflebte, was Hässlichkeit und Dummheit ihr an heimlichen Leiden zu bereiten vermochten. Warum ließ sie sich auf derlei Bedingungen ein? Warum setzte sie sich ihnen so unüberlegt aus? Der Himmel wusste, sie hatte ihre Gründe, aber die ganze Unternehmung geriet doch drastischer, als sie befürchtet hatte. Jeder Nerv verlangte dringend danach, ihr zu entfliehen, verlangte nach frischer Luft, der Gesellschaft von Himmel und Bäumen, Blumen und Vögeln. Im Badeort Waterbath würden sich die Blumen wahrscheinlich in der Farbe vergreifen und die Nachtigallen falsch singen; aber sie erinnerte sich auch an Schilderungen des Ortes, denen zufolge er jene Vorzüge besaß, die man gemeinhin als «natürlich» bezeichnet. Vorzüge, die er eindeutig nicht besaß, gab es jedenfalls genug. Es fiel ihr schwer zu glauben, eine stundenlang von der Tapete in ihrem Zimmer wach gehaltene Frau könne präsentabel aussehen; doch während sie in ihrer frischen Trauerkleidung durch die Eingangshalle raschelte, bestärkte sie gleichwohl das stets zur Salbung ihrer geselligen Sonntage beitragende Bewusstsein, dass sie wie üblich als einziger Mensch im Haus außerstande war, ihrer Aufmachung den schrecklichen Stempel jenes außergewöhnlichen Schicks aufzudrücken, wie ihn etwa die Frau eines Krämers kennzeichnen würde. Sie wäre eher zugrunde gegangen, als endimanchée1auszusehen.
Zum Glück wurde sie nicht auf die Probe gestellt, denn die anderen Frauen befanden sich nicht in der Halle, sondern waren damit beschäftigt, sich mit ebendiesem fatalen Ziel herauszuputzen. Sobald sie auf dem Gelände stand, erkannte sie, dass Waterbath mit seiner Lage, seiner Aussicht, die den richtigen Ton anschlugen und seinen Bewohnern ein Beispiel gaben, im Grunde hätte bezaubernd sein können. Wie hätte sie selbst, hätten ihr solche Elemente zu Gebote gestanden, den zarten Wink der Natur aufgegriffen! Plötzlich, an der Biegung eines Weges, traf sie auf ein Mitglied der Hausgesellschaft, eine junge Dame, die in tiefem, einsamem Sinnen auf einer Bank saß. Sie hatte die junge Frau schon beim Essen und auch hinterher noch beobachtet; junge Frauen betrachtete sie stets im Hinblick auf ihren Sohn, und zwar entweder besorgt oder spekulierend. Tief in ihrem Herzen hegte sie die Überzeugung, dass Owen trotz all ihrer Zauberwerke am Ende eine Banausin heiraten würde, und zwar nicht aufgrund von hinreichend zu nennenden Belegen, sondern schlicht aufgrund ihres tiefen Unbehagens, ihrer Auffassung, dass eine so spezielle Empfindsamkeit wie die ihre einer Frau nur als Quell des Kummers auferlegt worden sein konnte. Es würde ihr Schicksal, ihre Geißel, ihr Kreuz sein, dass man ihr abscheulicherweise eine Banausin ins Haus brachte. Diese junge Frau, eine der beiden Vetches, war nicht schön, und doch konnte Mrs. Gereth, als sie deren Glanzlosigkeit nach einem Lebenszeichen absuchte, ein solches Aussehen augenblicklich als die vorderhand geringste ihrer Heimsuchungen einstufen. Fleda Vetchs Kleidung zeugte von einer Idee, wenn auch vielleicht von nicht viel mehr; und das schuf eine Verbindung, wo sie schon sonst nichts mit ihr verband, zumal die Idee in diesem Falle echt und keine Nachahmung war. Mrs. Gereth hatte schon lange in den Rang der allgemeinen Wahrheit erhoben, dass das Naturell einer Banausin durchaus mit einer gewissen gewöhnlichen Hübschheit einhergehen konnte. Der Gesellschaft gehörten fünf junge Frauen an, und dass die Hübschheit von dieser hier – schlank, blass und schwarzhaarig – jemals Anlass zum Austausch von Plattitüden geben würde, schien weniger wahrscheinlich als bei den anderen. Die beiden weniger entwickelten Brigstocks, Töchter des Hauses, waren auf besonders langweilige Weise «reizend». Ein zweiter, scharfer Blick auf die junge Dame vor ihr brachte Mrs. Gereth die beruhigende Gewissheit, dass man ihr auch nicht vorwerfen konnte, erhitzt und geziert auszusehen. Sie hatten sich bislang noch nicht unterhalten, aber hier war eine ganz eigene Note spürbar, welche die beiden hinreichend miteinander bekannt machen würde, falls die junge Frau sich dieser Gemeinsamkeit auch nur im Geringsten bewusst zeigte. Mit einem Lächeln, das die Erschöpfung, die Mrs. Gereth in ihrer Haltung erkannt hatte, nur teilweise verscheuchte, stand sie von ihrem Platz auf. Die ältere Frau zog sie wieder nach unten, und eine Zeit lang, wie sie so beieinandersaßen, trafen sich ihre Blicke und loteten einander aus. «Bist du geheuer? Kann ich es aussprechen?», sagte jede zur anderen, und beide erkannten rasch, ja äußerten beinahe laut das ihnen gemeinsame Bedürfnis zu fliehen. Die ungeheure Zuneigung, wie es schließlich hieß, die Mrs. Gereth zu Fleda Vetch fassen sollte, begann praktisch mit der Entdeckung, dass das arme Kind noch prompter zur Flucht bewogen worden war als sie selbst. Dass das arme Kind außerdem nicht weniger rasch merkte, wie weit es nun gehen konnte, erwies sich an der immensen Freundlichkeit, mit der es sogleich hervorsprudelte: «Ist es nicht zu schrecklich?»
«Entsetzlich – entsetzlich!», rief Mrs. Gereth lachend. «Und es ist wirklich ein Trost, dass man es endlich aussprechen kann.» Sie hatte die Vorstellung, denn darauf zielte ihr Ehrgeiz, dass es ihr gelänge, diese unangenehme Eigenheit geheim zu halten, ihre Neigung nämlich, vom Vorhandensein des Schrecklichen unglücklich zu werden. Ihre Leidenschaft für das Exquisite war schuld an dieser Neigung, aber es war dies eine Leidenschaft, die sie niemals kundtat noch regelrecht auskostete, vielmehr begnügte sie sich damit, ihre Schritte davon leiten und sie in aller Stille in ihrem Leben wirken zu lassen, war sie sich doch allzeit bewusst, dass es wenig Geräuschloseres gibt als eine tiefe Hingabe. Daher beeindruckte sie auch der Scharfsinn der jungen Frau, die bereits den Finger auf ihre geheime Triebfeder gelegt hatte. Schrecklich nun aber, entsetzlich, war die innige Hässlichkeit von Waterbath, und über dieses Phänomen unterhielten sich die Damen, während sie im Schatten saßen und Erquickung aus dem großen, ruhigen Himmel sogen, an dem eben keine billigen blauen Teller hingen. Es handelte sich um eine grundsätzliche und systematische Hässlichkeit, Folge einer anormalen Wesensart der Brigstocks, bei deren Anlage auf das Prinzip des Geschmacks in weit mehr als dem üblichen Maße verzichtet worden war. Stattdessen war bei der Gestaltung ihres Heims ein anderes, bemerkenswert wirkmächtiges, aber unheimliches und obskures Prinzip geltend gemacht worden, mit deprimierend anzuschauenden Konsequenzen in Gestalt einer allumfassenden Sinnlosigkeit. Das Haus war gewiss schlimm, aber es wäre zu ertragen gewesen, wenn sie es nur in Ruhe gelassen hätten. Diese erlösende Barmherzigkeit war ihnen nicht gegeben; sie hatten es mit Flitterkram und Sammelalbenkunst überladen, mit seltsamen Auswüchsen und bauschigen Draperien, mit Plunder, bei dem es sich um Erinnerungsstücke von Dienstmädchen, und undefinierbaren Einrichtungsgegenständen, bei denen es sich um Auszeichnungen für Blinde hätte handeln können. Bei Teppichen und Vorhängen waren sie auf wüste Abwege geraten; sie bewiesen einen unfehlbaren Instinkt für Desaströses und waren auf Scheußlichkeiten offenbar so versessen, dass es ihnen fast etwas Tragisches verlieh. Ihr Salon, erwähnte Mrs. Gereth mit gesenkter Stimme, mache ihr das Gesicht brennen, und jede der neuen Freundinnen vertraute der anderen an, dass sie in ihrem Logis Tränen vergossen habe. In dem der älteren Dame gab es eine Reihe wunderlicher Aquarelle, der Familienscherz eines Familiengenies, und in dem der jüngeren ein Souvenir von einer Jahrhundert- oder sonstigen Ausstellung, worauf sie schaudernd anspielten. Das Haus war absonderlicherweise voller Souvenirs von Orten, die sogar noch hässlicher waren als das Haus selbst, und von Dingen, die zu vergessen eine Frage der Pietät gewesen wäre. Das schlimmste Schrecknis waren die riesigen Flächen von Firnis, etwas Aufdringlichem und stark Riechendem, mit dem alles beschmiert war: Fleda Vetchs Überzeugung nach vertrieben sich die Brigstocks an Regentagen die Zeit damit, ihn eigenhändig und unter ausgelassenem gegenseitigem Geknuffe aufzutragen.
Als Fleda mit schärfer werdender Kritik zu bedenken gab, dass mancher vielleicht etwas an Mona fände, unterbrach Mrs. Gereth sie mit einem protestierenden Ächzen, dem üblichen, gedämpften «Ach du meine Güte!». Mona war von den dreien die Älteste, diejenige, die Mrs. Gereth am stärksten in Verdacht hatte. Sie vertraute ihrer jungen Freundin an, dass es dieser Verdacht war, der sie nach Waterbath geführt habe; und er war so schwerwiegend, dass sie sich auf der Stelle, als Zuflucht, als Abhilfe, an den Gedanken klammerte, mit der jungen Frau vor ihr sei vielleicht etwas anzufangen. Jedenfalls war es diese eingebildete Bloßstellung, die den Schock noch verstärkt, sie veranlasst hatte, sich mit schrecklichem Frösteln zu fragen, ob das Schicksal wirklich darauf sinnen könnte, ihr eine Schwiegertochter aufzuhalsen, die an einem solchen Ort groß geworden war. Sie hatte Mona in der ihr angemessenen Umgebung gesehen, und sie hatte Owen, stattlich und schwerfällig, nicht von ihrer Seite weichen sehen; doch hatten diese ersten Stunden zum Glück nicht bewirkt, dass sich ihre Aussicht verdunkelte. Ihr war nun klarer, dass sie Mona niemals akzeptieren könnte, aber es war schließlich keineswegs ausgemacht, dass Owen sie darum bitten würde. Beim Essen hatte er neben jemand anderem gesessen, und hinterher hatte er sich mit Mrs. Firmin unterhalten, die so schrecklich war wie alle anderen, immerhin aber verheiratet. Seine Schwerfälligkeit, die sie in ihrem Mitteilungsbedürfnis ungescheut beim Namen nannte, hatte zwei Aspekte: zum einen seinen monströsen Mangel an Geschmack, zum anderen seine übertriebene Besonnenheit. Sollte es nötig sein, Mona gegenüber gebieterisch aufzutreten, würde man sich nicht sorgen müssen, denn so verfuhr er selten.
Aufgefordert von ihrer Begleitung, die gefragt hatte, ob es nicht wundervoll sei, hatte Mrs. Gereth begonnen, etwas über Poynton zu erzählen; sie hörte jedoch das Geräusch von Stimmen, das sie jäh innehalten ließ. Im nächsten Augenblick erhob sie sich, und Fleda konnte erkennen, dass ihre Unruhe sich keineswegs gelegt hatte. Hinter der Stelle, wo sie gesessen hatten, fiel das Gelände in Form einer langen, grasigen Böschung ziemlich steil ab, die Owen Gereth und Mona Brigstock, zwar für die Kirche gekleidet, doch ungezwungen scherzend, gerade heraufkletterten, wobei sie sich gegenseitig halfen. Als sie ebenes Gelände erreicht hatten, konnte Fleda den Sinn des Ausrufs deuten, mit dem Mrs. Gereth ihren Vorbehalten hinsichtlich Miss Brigstocks Persönlichkeit Luft gemacht hatte. Miss Brigstock hatte gelacht, ja war ausgelassen umhergetollt, doch dieser Umstand hatte auch nicht den Hauch eines Ausdrucks in ihrem Gesicht hinterlassen. Hochgewachsen, gerade und blond, mit langen Gliedmaßen und seltsam aufgeputzt, stand sie da, mit ausdruckslosen Augen und ohne dass ihre sonstigen Züge irgendeine erkennbare Absicht verrieten. Sie gehörte jenem Typus Mensch an, bei dem die Sprache bloße Absonderung von Lauten ist und das Geheimnis des Seins undurchdringlich und unzerstörbar gewahrt bleibt. Ihre Äußerungen, hätte sie sich denn geäußert, wären wahrscheinlich bewundernswert ausgefallen, aber was auch immer sie mitteilte, teilte sie auf eine in erster Linie ihr selbst bekannte Weise mit, ohne irgendwelche äußerliche Regungen. Anders Owen Gereth, der über vielerlei Regungen verfügte, allesamt ganz schlicht und unmittelbar. Kräftig und ungekünstelt, überaus natürlich und dabei vollkommen korrekt, wirkte er sinnlos betriebsam und angenehm langweilig. Wie seine Mutter und wie Fleda Vetch, doch nicht aus demselben Grund, war das junge Paar ins Freie gegangen, um vor der Kirche noch einen Spaziergang zu machen.
Die Begegnung der beiden Paare verlief spürbar unbehaglich, und Fleda, die über ein empfindsames, nun immer wacheres Wahrnehmungsvermögen verfügte, konnte den Mrs. Gereth zugefügten Schock ermessen. Die Alberei, die sie gerade flüchtig miterlebt hatten, hatte etwas Intimes – o ja, Intimes, und auch Kindisches – gehabt. Man begann gemeinsam in Richtung Haus zu schlendern, und dass die Liebenden, oder was auch immer sie waren, sich plötzlich getrennt sahen, vermittelte Fleda abermals eine Ahnung von Mrs. Gereth’ reaktionsschnellem Geschick. Sie spazierte mit Mona hinterher, während die Mutter von ihrem Sohn Besitz ergriff, wobei alle Bemerkungen, die sie im Gehen mit ihm austauschte, jedoch bezeichnend unverständlich blieben. Einen noch lebhafteren Eindruck von Mrs. Gereth’ Eingreifen gewann jenes Mitglied der Gesellschaft, in dessen geschärfterem Bewusstsein wir am einträglichsten nach einem Widerschein des kleinen Dramas suchen werden, um das es uns hier geht, aus dem Umstand, dass sich zehn Minuten später, auf dem Weg zur Kirche, eine wiederum andere Paarbildung ergeben hatte. Owen ging mit Fleda, und die junge Frau fand Erheiterung in der Gewissheit, dass sich dies der Regie seiner Mutter verdankte. Sie empfand auch noch anderes als erheiternd: etwa die Feststellung, dass Mrs. Gereth nun neben Mona Brigstock ging; etwa die Beobachtung, dass sie sich jener jungen Frau gegenüber ungemein leutselig benahm; etwa die Überlegung, dass sie, meisterlich und klug, mit großem, hellwachem Geist, zu jenen Menschen gehörte, die sich als Einfluss geltend machen; schließlich etwa das Gefühl, dass Owen Gereth absolut schön und entzückend begriffsstutzig war. Diese junge Frau hatte sogar vor sich selbst wunderbar zartfühlende, stolze Geheimnisse; doch indem sie sich nun dem Gedanken ergab, dass es von angenehmer Wirkung und recht bemerkenswert war, dumm zu sein, ohne Anstoß zu erregen – ganz gewiss von angenehmerer Wirkung und bemerkenswerter, als wenn man klug und grässlich war, kam sie deutlicher Erkenntnis so nahe wie überhaupt je bei der Beschäftigung mit solchen Dingen. Owen Gereth jedenfalls war mit seiner Körpergröße, seinen Charakterzügen und seinen Fehlern von Letzterem weder das eine noch das andere. Sie selbst stellte sich darauf ein, falls sie je heiraten sollte, sämtliche Klugheit beizusteuern, und ihr gefiel der Gedanke, dass ihr Mann eine Kraft sein würde, die sich für Lenkung dankbar erzeigte. Auf ihre bescheidene Weise war sie desselben Geistes Kind wie Mrs. Gereth. An jenem erhitzten, verworrenen Sonntag ereignete sich etwas Großes; ihr kleines Leben erfuhr eine eigentümliche Beschleunigung. Ihre dürftige Vergangenheit fiel von ihr ab wie ein Kleidungsstück der letzten Saison, und während sie am Montag zur Stadt fuhr, starrte sie aus dem Zug auf die Felder rings um die Stadt und in eine Zukunft voller Dinge, die sie besonders liebte.
2
Diese unterschieden sich zahlenmäßig nicht von jenen Dingen, von denen Poynton überquoll, wie sie von Mrs. Gereth zu erfahren die Muße gehabt hatte. Poynton, im Süden Englands, war das erklärte oder vielmehr nicht mehr erklärte Zuhause dieser Dame: Es war unlängst in den Besitz ihres Sohnes übergegangen. Der Vater des Jungen, eines Einzelkinds, war zwei Jahre zuvor gestorben; in London bewohnte Owen mit seiner Mutter im Mai und Juni ein Haus, das ihnen großzügigerweise Colonel Gereth, Onkel und Schwager der beiden, überlassen hatte. Owens Mutter hatte sich Fleda Vetchs auf so gewinnende Weise angenommen, dass die junge Frau es binnen sehr weniger Tage für möglich hielt, in Cadogan Place beinahe ebenso sehr miteinander zu leiden, wie man in Waterbath miteinander gelitten hatte. Das Haus des freundlichen Militärs war ebenfalls eine schwere Prüfung, doch im folgenden Monat schufen den beiden Frauen wenigstens ihre Bekenntnisse Linderung. Mrs. Gereth war dank der raren Vollkommenheit von Poynton in der unangenehmen Lage, zurückschrecken zu müssen, egal, wohin sie sich wandte. Ein Vierteljahrhundert lang hatte sie in so inniger Verbundenheit mit dem Schönen gelebt, dass das Leben, wie sie ohne Weiteres zugab, für sie ein wahrhaftiges Narrenparadies geworden war. Sie konnte ihr Haus nicht verlassen, ohne Gefahr zu laufen, sich dem auszusetzen. Sie sagte es zwar nicht ausdrücklich, aber Fleda erkannte, dass sie in England nichts wirklich mit Poynton Vergleichbares entdecken konnte. Es gab viel grandiosere und prächtigere Orte, aber es gab kein so vollkommenes Kunstwerk, nichts, was auf den wirklich Kundigen so wirken würde. Das Schicksal hatte ihr, indem es ihr solche Bausteine an die Hand gegeben hatte, eine unschätzbare Möglichkeit geschenkt; sie wusste, wie selten gut sie es getroffen und dass sie ein außerordentliches Glück genossen hatte.
Da war zunächst einmal das erlesene alte Haus selbst, frühes siebzehntes Jahrhundert, in allen Teilen von höchster Erhabenheit: eine Provokation, eine Inspiration, eine einzigartige leere Leinwand. Dazu kamen noch das Verständnis und die Großzügigkeit ihres Mannes, sein Wissen und seine Liebe, ihrer beider völliges Einvernehmen und ihr schönes gemeinsames Leben, sechsundzwanzig Jahre des Planens und Suchens, eine lange, sonnige Ernte des Geschmacks und der Neugier. Zu guter Letzt, das wollte sie gar nicht leugnen, war da auch noch ihre persönliche Gabe, das Genie, die Leidenschaft, die Geduld des Sammlers – eine Geduld, eine fast schon infernalische Durchtriebenheit, die es ihr ermöglicht hatte, dies alles trotz begrenzter finanzieller Mittel zustande zu bringen. Bei jedem anderen hätte das Geld nicht gereicht, sagte sie voll Stolz, bei ihr hingegen schon. Sie hatten auf vieles im Leben gespart, und es gab vieles, worauf sie hatten verzichten müssen, aber dafür hatten sie in jedem Winkel Europas jeden Dämon von einem Juden abgegrast2. Die arme Fleda, die von Haus aus weder einen Penny noch irgendetwas Schönes besaß und deren einziger Schatz ihr feiner Verstand war, fand es faszinierend, diese echte englische Lady, frisch und zart, Anfang fünfzig, voller Ausgelassenheit und Überzeugung erklären zu hören, sie sei selbst der geschickteste Jäger, der je auf Großwild ausgegangen sei. Fleda, deren Mutter tot war, hatte nicht einmal so etwas wie ein Zuhause, und ihre beste Aussicht auf ein solches bestand darin, dass ein gewisser Anschein dafürsprach, ihre Schwester werde sich mit einem Kuraten verloben, dessen ältester Bruder angeblich Grundbesitz hatte und ihm vielleicht etwas davon überlassen würde. Ihr Vater bezahlte einige ihrer Rechnungen, mochte aber nicht mit ihr zusammenleben; und letzthin hatte sie in Paris, zusammen mit mehreren hundert anderen jungen Frauen, ein Jahr in einem Atelier verbracht und sich mit einem Kurs bei einem impressionistischen Maler für die Schlacht des Lebens gerüstet. Sie war entschlossen zu arbeiten, doch ihre Impressionen – vielleicht stammten sie auch von jemand anderem – waren bislang ihr einziges Material. Mrs. Gereth hatte ihr versichert, sie möge sie, weil sie über eine außergewöhnlich feine Naseverfüge; doch unter den gegebenen Umständen war eine feine Naseeine zweifelhafte Gabe: In den trockenen Räumen, in denen sie sich hauptsächlich bewegte, hätte sie sich einen chronischen Katarrh zuziehen können. Sie wurde fortwährend zum Cadogan Place beordert und, noch ehe der Monat um war, dabehalten, um einen Besuch abzustatten, an dessen Ende, wie man übereinkam, alles anders sein sollte als zu Beginn. Sie hatte das teils frohlockende, teils beunruhigende Gefühl, ihrer gebieterischen Freundin rasch unentbehrlich geworden zu sein, wofür diese denn auch einen durchaus hinreichenden Grund nannte, indem sie ihr sagte, es gebe niemanden, der sie verstehe. Dabei konnte man in diesen Tagen sein Verständnis für Mrs. Gereth ungeheuer erweitern, obwohl sich alles grob in dem Umstand zusammenfassen ließe, dass sie sich elend fühlte. Warum dies so sei, versicherte sie Fleda, könne diese erst dann vollständig ermessen, wenn sie die Objekte in Poynton gesehen habe. Diesen Zusammenhang, exakt eine jener Bewandtnisse, die in ihrer inneren Rätselhaftigkeit für jeden anderen nur ein weißer Fleck gewesen wäre, konnte Fleda vollkommen begreifen.
Die junge Frau hatte das Versprechen erhalten, dass sie das wunderbare Haus Anfang Juli gezeigt bekäme, dann nämlich, wenn Mrs. Gereth gleichsam wie in ein Zuhause dorthin zurückkehren würde; doch noch vor dieser Initiation legte sie den Finger auf jene Wunde, die in der gequälten Seele der armen Dame am stärksten schmerzte. Es handelte sich um die Not, die sie bedrängte, um die Furcht vor der unvermeidlichen Übergabe. Was Fleda sich anhören musste, war die Bestätigung des Verdachts, dass Owen Gereth Mona Brigstock heiraten, sie seiner Mutter zum Trotz heiraten und dass eine solche Tat unabsehbare Weiterungen haben würde. Diese waren Mrs. Gereth, wie ihr Gegenüber erkannte, mit einer Lebhaftigkeit gegenwärtig, die zuweilen fast nicht mehr von Vernunft bestimmt war. Sie würde Poynton hergeben müssen, und zwar an ein Produkt von Waterbath – das war das Unrecht, das an ihr nagte, die Demütigung, angesichts deren Fleda erst dann würde angemessen erschauern können, wenn sie den Ort kannte. Freilich kannte sie Waterbath, und sie verabscheute es – diese Befähigung zu Mitgefühl besaß sie. Ihr Mitgefühl war verständig, denn sie durchdrang die Materie tief: Mit Entsetzen gewahrte sie, während sie sich den Sachverhalt zum ersten Mal klarmachte, die grausame englische Sitte der Enteignung der einsamen Mutter. Mr. Gereth war offensichtlichtlich ein sehr liebenswürdiger Mensch gewesen, aber er hatte die Dinge auf eine Weise hinterlassen, welche der jungen Frau zu denken gab. Das Haus samt Inhalt war als ein einziges, prächtiges Objekt behandelt worden; alles sollte geradewegs an seinen Sohn gehen, und seine Witwe sollte Unterhalt und ein Cottage in einer anderen Grafschaft bekommen. Gänzlich unberücksichtigt geblieben waren deren Beziehung zu ihren Schätzen, die Leidenschaft, mit der sie auf sie gewartet, für sie gearbeitet, sie ausgelesen, sie einander und des Hauses würdig gemacht, sie betrachtet, geliebt und mit ihnen gelebt hatte. Er hatte offenbar angenommen, sie werde allfällige Fragen mit ihrem Sohn regeln und er könne sich auf Owens Zuneigung und Owens Gerechtigkeitssinn verlassen. Und im Ernst, so fragte die arme Mrs. Gereth, wie hätte er – er, der instinktiv den Blick von allem Abstoßenden abwandte – denn auch etwas so Anormales wie eine Brigstock aus Waterbath vorhersehen sollen? Er war in genügend hässlichen Häusern gewesen, doch diesem speziellen Albtraum war er entgangen. Dass der Erbe des schönsten Gegenstands in England auf den Gedanken verfallen könnte, es einem so ungemein fragwürdigen Mädchen auszuliefern – mit etwas so Widernatürlichem war schlichtweg nicht zu rechnen gewesen. Von der Fragwürdigkeit der armen Mona sprach Mrs. Gereth so, als wollte sie sagen, sie verletzte beinahe den Anstand, und ein unaufgeklärter Zuhörer hätte sich gefragt, welche Verfehlung das Mädchen sich hatte zuschulden oder vielmehr nicht zuschulden kommen lassen. Aber Owen war das alles schon von Kindesbeinen einerlei gewesen, er hatte, was sein Zuhause anging, nie im Geringsten Stolz oder Freude empfunden.
«Ja, aber wenn es ihm einerlei ist …!», rief Fleda mit einer gewissen Unbesonnenheit aus, hielt jedoch jäh inne, ehe sie ihren Satz beendet hatte.
Mrs. Gereth sah sie recht streng an. «Wenn es ihm einerlei ist?»
Fleda zögerte; sie hatte noch keine eindeutige Vorstellung. «Nun … dann wird er sie hergeben.»
«Was hergeben?»
«Na, diese schönen Dinge.»
«Sie wem geben?» Mrs. Gereth schaute noch unnachgiebiger.
«Ihnen natürlich – damit Sie sich daran freuen, sie für sich haben.»
«Und sein Haus ist dann so nackt und bloß wie Ihre Hand? Es gibt nichts darin, was nicht kostbar wäre.»
Fleda überlegte; ihre Freundin hatte sie mit einem unterdrückten Ingrimm zurechtgewiesen, der sie ein wenig aus der Fassung brachte. «Ich meine natürlich nicht, dass er Ihnen alles überlässt; aber er könnte Sie die Sachen aussuchen lassen, an denen Sie am meisten hängen.»
«Das würde er wohl auch, wenn er frei wäre», sagte Mrs. Gereth.
«Wollen Sie damit sagen, sie würde ihn, wie die Dinge liegen, daran hindern?» Zwischen den beiden Damen war Mona Brigstock inzwischen nur noch «sie».
«Mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln.»
«Aber doch gewiss nicht, weil sie etwas von diesen Dingen versteht und sie zu schätzen weiß?»
«Nein», erwiderte Mrs. Gereth, «sondern weil sie zum Haus gehören und das Haus Owen gehört. Falls ich irgendetwas haben wollte, würde sie, mit dieser unbewegten Maske, schlichtweg sagen: ‹Das gehört zum Haus.› Und auf jedes Argument, jede Erwägung von Großzügigkeit würde sie Tag für Tag, ohne mit der Wimper zu zucken, mit der Stimme einer Puppe, der man auf den Bauch drückt, immer nur wieder und wieder antworten: ‹Das gehört zum Haus – das gehört zum Haus.› Hinter dieser Haltung würden sie sich verschanzen.»
Fleda war erstaunt, ja leicht bestürzt darüber, wie Mrs. Gereth das Ganze durchdacht, sich der Vorstellung einer Schlacht mit ihrem einzigen Sohn ausgesetzt hatte. Diese Worte veranlassten sie zu einer Frage, die ihr bislang nicht taktvoll erschienen war: Sie brachte den Gedanken zur Sprache, ob es nicht möglich wäre, dass ihre Freundin weiterhin in Poynton lebte. Würden die beiden wirklich bis zum Äußersten gehen wollen? War denn kein hochherziger, eleganter Kompromiss denkbar und zustande zu bringen? Könnten sie nicht unter einem Dach wohnen? War es denn so ganz und gar unvorstellbar, dass ein verheirateter Sohn mit einer so bezaubernden Mutter für den Rest ihrer Tage das Zuhause teilte, das ihm schön zu machen sie über zwanzig Jahre aufgewendet habe? Mrs. Gereth quittierte diese Frage mit einem matten, mitleidsvollen Lächeln; sie erwiderte, ein gemeinsamer Haushalt sei in einem solchen Fall durchaus nicht vorstellbar, und Fleda müsse sich nur im schönen England umschauen, um zu erkennen, wie wenige Menschen ihn sich je hatten vorstellen können. Er gelte immer als etwas Absonderliches, als «Verirrung», als Produkt überstrapazierter Gefühle; und sie müsse gestehen, dass sie zu etwas derart Verstiegenem so wenig imstande sei wie Owen. Und selbst wenn, so würden sie immer noch mit Monas Hass rechnen müssen. Manchmal verschlug es Fleda den Atem ob der heftigen Sprünge und Auslassungen aus Mrs. Gereth’ Mund im Verlauf des Gesprächs.
Es war dies das erste Mal, dass sie von Monas Hass hörte, obwohl es ganz gewiss nicht Mrs. Gereth’ bedurft hatte, um ihr zu verraten, dass sich diese junge Dame, aus der Nähe betrachtet, als insgeheim störrisch erweisen würde. Etwas später machte Fleda die Beobachtung, dass fast jede junge Frau einen Menschen hassen würde, dem es so deutlich zuwider war, etwas mit ihr zu tun zu haben. Zunächst jedoch lieferte Mrs. Gereth im Gespräch mit ihrer jungen Freundin einen etwas plastischeren Beweggrund für ihre Verzweiflung, indem sie fragte, wie man denn irgend von ihr erwarten könne, mit den neuen Eigentümern dazusitzen und die Gräuel, die diese im Haus verüben würden, zu akzeptieren – oder besser gesagt, auch nur für einen Tag zu ertragen. Fleda wandte ein, dass sie ja schließlich nichts zerbrechen oder verbrennen würden; und auf Drängen gab Mrs. Gereth zu, dass es dazu wohl tatsächlich nicht kommen würde. Sie spreche davon, dass die beiden die Sachen vernachlässigen, sie ignorieren, sie tollpatschigen Dienstboten überlassen würden (es gebe darunter keinen einzigen Gegenstand, der nicht mit größter Liebe behandelt werden müsse) und in vielen Fällen wahrscheinlich durch Stücke ersetzen wollten, die irgendeiner vulgären, modernen Vorstellung des Praktischen genügten. Vor allem sah sie schon im Voraus mit schreckgeweiteten Augen die Abscheulichkeiten, die sie zwangsläufig daruntermischen würden – die unerträglichen Relikte von Waterbath, die kleinen Konsolen und rosa Vasen, das Beutegut von Basaren, die Familienfotografien und illustrierten Texte, die hausbackene Kunst und hausbackene Biederkeit von Monas grässlichem Heim. Ob es denn nicht ausreiche, einfach anzuführen, dass Mona sich Poynton im Geiste einer Brigstock nähern und im Geiste einer Brigstock mit ihrer Erwerbung verfahren würde? Ob Fleda es denn wirklich für denkbar halte, wollte Mrs. Gereth wissen, dass sie den Rest ihrer Tage ein solches Geschöpf um sich haben wolle?
Fleda musste erklären, sie halte das für ganz und gar undenkbar und Waterbath sei eine Warnung gewesen, die zu übersehen leichtfertig wäre. Zugleich überlegte sie insgeheim, dass ihnen vieles schon jetzt für ausgemacht galt und dass ihre Spekulationen, insofern Owen Gereth ihres Wissens seine Verlobung rundweg bestritten hatte, auf keineswegs festem Grund standen. Es schien unserer jungen Dame, dass Owen in schwieriger Lage ein angeborenes Geschick an den Tag legte; er behandelte die ins Haus gebrachte Vertraute des seiner Mutter zugefügten Unrechts mit einer schlichten Höflichkeit, die beinahe ihr Gewissen belastete, so tief empfand sie, dass es für ihn den Anschein haben mochte, als schlüge sie sich gegen ihn auf die Seite jener Dame. Sie fragte sich, ob er je erfahren würde, wie wenig das eigentlich der Fall sei und dass sie, da Mrs. Gereth darauf bestanden hatte, hier war, nicht um Verrat zu üben, sondern im Wesentlichen, um zu appellieren und zu beschützen. Dass seine Mutter Mona Brigstock nicht mochte, hätte ihn veranlassen können, den von seiner Mutter bevorzugten Menschen ebenfalls nicht zu mögen, und es war Fleda widerwärtig, sich vor Augen zu halten, dass es sich für ihn vielleicht so ausnahm, als diente sie selbst sich als beispielhaftes Gegenbild an. Dabei war freilich ganz klar, dass der glückliche junge Mann so wenig Gefühl für Beweggründe besaß wie ein Tauber für eine Melodie; ein Handicap, das ihr selbst zum Vor- wie zum Nachteil gereichen konnte. Er ging in den Geschäften, die London ihm in überreichem Maß zu bieten hatte, beständig ein und aus und fand dennoch mehr als einmal Zeit, ihr zu versichern: «Es ist schrecklich nett von Ihnen, dass Sie sich um meine arme Mama kümmern.» Wie sein rasches Sprechen, das seiner Schüchternheit wegen schwer zu verstehen war – es mutete meist so verzweifelt an wie ein «Angriff» bei irgendeinem brachialen Spiel –, vermittelten ihr die Kinderaugen in seinem Männergesicht, dass er dies wirklich sehr zu schätzen wisse und sie hoffentlich noch lange bleiben werde. Mit einem Menschen im Haus, der so gescheit war wie sie, hatte die arme Mama ja praktischerweise eine Beschäftigung. Für Fleda lag etwas Schönes in der Arglosigkeit, ja Bescheidenheit, die ihn offenbar nicht den leisesten Verdacht hegen ließ, zwei solche Schlauköpfe könnten sich womöglich mit Owen Gereth beschäftigen.
3
Sie, die beiden Schlauköpfe, fuhren endlich nach Poynton, wo der erwartungsfrohen jungen Frau die vollständige Offenbarung zuteilwurde. «Wissen Sie jetzt, wie ich mich fühle?», fragte Mrs. Gereth, als ihre hübsche Begleiterin sich drei Minuten nach ihrer Ankunft in der wunderschönen Eingangshalle mit einem leisen Nach-Luft-Schnappen und Rollen ihrer geweiteten Augen auf eine Sitzgelegenheit sinken ließ. Diese Antwort war deutlich genug, und im Entzücken des ersten Gangs durch das Haus wusste Fleda sich kaum mehr zu fassen. Sie verstand vollkommen, wie Mrs. Gereth sich fühlte – zuvor hatte sie es nur in Ansätzen verstanden; und die beiden Frauen umarmten einander unter Tränen angesichts der Festigung dieser zwischen ihnen bestehenden Bande, Tränen, die aufseiten der Jüngeren das natürliche und übliche Anzeichen ihrer Unterwerfung unter vollkommene Schönheit waren. Sie hatte nicht zum ersten Mal aus freudiger Bewunderung geweint, doch es war das erste Mal, dass die Herrin von Poynton, sooft sie ihr Haus auch schon gezeigt hatte, eine solche Schaustellung miterlebte. Sie frohlockte darüber; es ließ ihre eigenen Tränen rascher fließen; sie versicherte ihrem Gegenüber, ein solches Ereignis lasse ihr das arme alte Haus wieder wie neu und kostbarer denn je erscheinen. Ja, niemand habe jemals auf diese Weise Anteil bekundet, jemals nachempfunden, was sie zustande gebracht hatte: Die Menschen seien so ungemein ignorant und alle, selbst die Kundigen, soweit sie sich dafür hielten, mehr oder weniger beschränkt. Was Mrs. Gereth zustande gebracht hatte, war in der Tat ein erlesenes Ergebnis; und in einer solchen Schatzsucherkunst, einem derart verfeinerten Auswahl- und Vergleichsvermögen lag ein schöpferisches Element, lag Persönlichkeit. Sie hatte sich lobend über Fledas feine Nasegeäußert, und Fleda ergab sich nun der Fülle. Vorgefasste Meinungen und Bedenken fielen von ihr ab; nie hatte sie ein größeres Glück erlebt als jene Woche, die sie mit dieser Initiation zubrachte.
Beim Durchstreifen lichter Zimmer, deren Effekt ganz allgemein Präferenzen so wenig zuließ, als stünde sie unter Schock, beim Innehalten an offenen Türen, wo sich lange, freundliche Ausblicke boten, hätte sie, wenn sie es nicht schon gewusst hätte, nun auch selbst entdecken können, dass Poynton die Summe eines Lebens war. Sie war in großartigen Silben aus Farbe und Form, in den Sprachen anderer Länder und den Handschriften vortrefflicher Künstler niedergelegt. Sie enthielt ganz Frankreich und Italien, quer durch alle Jahrhunderte, auf ewig zusammengestellt. England, das waren die alten Fenster, aus denen man hinausblickte – England war die große Klammer. Während Mrs. Gereth draußen, auf flachen Terrassen, Gärtnern widersprach und die Natur verfeinerte, überließ sie es ihrem Gast, liebevoll das Messinggeschirr zu berühren, mit dem Louis quinze hantiert haben mochte, einfach dazusitzen und venezianischen Samt zärtlich in der Hand zu halten, sich über Kästen mit Emaillearbeiten zu beugen und an Vitrinen vorbei- und immer wieder vorbeizugehen. Bilder gab es nicht viele – die Paneele und Stoffe selbst waren das Bild; und in dem ganzen großen, vertäfelten Haus gab es keinen Zoll angeklebten Papiers. Was Fleda am meisten auffiel, war der hohe Stolz, der sich im Geschmack ihrer Freundin ausdrückte, ein feiner Dünkel, ein Stilgefühl, das sich, wie amüsiert oder amüsant auch immer, niemals auf Kompromisse einließ noch sich kleinmachte. Tatsächlich verspürte sie, wie es ihr diese Dame andeutungsweise vorausgesagt hatte, einen Respekt und ein Mitgefühl, das sie bislang nicht gekannt hatte; so vermochte die Vorstellung vom bevorstehenden Verzicht sie mit gleichem Schmerz zu erfüllen. Das alles aufzugeben und so zu sterben – dieser Gedanke schmerzte ihr in der Brust. Sie konnte nachvollziehen, dass man sich an all dies mit einer Zähigkeit klammerte, die sich um Würde nicht scherte. Einen solchen Ort geschaffen zu haben hieß, Würde genug besessen zu haben; ginge es darum, ihn zu verteidigen, war die allergrimmigste Haltung gerade recht. Nach einer so intensiven Inbesitznahme musste auch sie ihn aufgeben; denn, so überlegte sie, wo Mrs. Gereth’ Bleiben ihr selbst notdürftig eine Zukunft eröffnet hätte – die sich jenseits einer Kluft in sicheren Jahren dahinzog –, dort konnte das Erscheinen der anderen demselben Gesetz zufolge nur eine große, vage Drohung, das Aufgewühltwerden eines stillen Wassers bedeuten. Solcherart waren die Empfindungen einer hungrigen jungen Frau, deren Empfindsamkeit fast so groß war, wie ihre Gelegenheiten, Vergleiche anzustellen, gering gewesen waren. Den Museen hatte sie einiges zu verdanken, der Natur jedoch noch mehr.
Dass Owen weder mitgekommen war noch sich ihnen später angeschlossen hatte, lag daran, dass er London immer noch kurzweilig fand; doch blieb die Frage, ob die Kurzweiligkeit von London nicht lediglich das Einzige war, was seinem beschränkten Wortschatz zur Kurzweiligkeit von Mona Brigstock einfiel. Sein Verhalten verriet nämlich noch eine andere Uneindeutigkeit – etwas, was einer Erklärung bedurfte, solange sein Beweggrund nicht zutage trat. Wenn er verliebt war, was war dann los? Und was, mehr noch, wenn er es nicht war? Das Rätsel wurde endlich gelöst: Das entnahm Fleda dem Ton, in dem ein eines Morgens beim Frühstück geöffneter Brief Mrs. Gereth aufschreien ließ. Ihr Entsetzen geriet beinahe schrill: «Aber er bringt sie hierher mit – er möchte, dass sie das Haus sieht!» Sie, die beiden Frauen, flogen einander in die Arme und fanden, die Köpfe zusammengesteckt, bald heraus, dass der Grund, der verblüffende Grund, warum sich noch nichts getan hatte, darin zu suchen war, dass Mona – oder auch Owen – nicht wusste, ob Poynton ihr wirklich gefallen würde. Sie kam her, um sich ein Urteil zu bilden. Und könnte irgendetwas auf der Welt dem armen Owen ähnlicher sehen als die schwerblütige Redlichkeit, die ihn auf eine Antwort von ihr nicht hatte dringen lassen, ehe sie wusste, ob ihr zusagte, was er ihr zu bieten hatte? Dass er solche Bedenken trug, hatte man natürlich unmöglich unterstellen können. Wenn man sich nur erhoffen dürfte, jammerte Mrs. Gereth, dass die Erwartungen des Mädchens zunichtegemacht wurden! Es lag eine schöne Stimmigkeit, eine durchaus anrührende Aufrichtigkeit in ihrem Argument, dass das Haus, je besser es dann aussähe, desto besser die Vorstellungen zum Ausdruck brächte, denen es seine Entstehung verdankte – und desto weniger einen derart primitiven Verstand anspräche. Wie eine Brigstock denn irgend begreifen könne, worum es dabei gehe? Wie einer Brigstock eigentlich logischerweise etwas anderes übrig bleibe, als es zu verabscheuen? Noch während Mrs. Gereth leinene Schonbezüge wegzerrte, redete sie sich ein, wie wahrscheinlich eine verwirrte Verständnislosigkeit von Monas Seite, ein jähes Einbrechen ihrer Bewunderung sei, das sich für ihren Liebhaber als bestürzend erweisen würde – eine Hoffnung, deren Abwegigkeit wenigstens Fleda erkannte und die die seltsame, fast manische Neigung der armen Dame ermessen ließ, überall die Frage der «Dinge» einzuwerfen, alles Verhalten im Lichte irgendeiner eingebildeten Beziehung zu ihnen zu deuten. «Dinge» waren natürlich die Summe der Welt; nur waren für Mrs. Gereth die Summe der Welt seltene französische Möbel und asiatisches Porzellan. Dass Leute dergleichen nicht «hatten», konnte sie sich mit Mühe vorstellen, nicht aber, dass sie dergleichen nicht wollten und nicht vermissten.
Die jungen Leute sollten von Mrs. Brigstock begleitet werden, und da Fleda voraussah, unter welch strenger Beobachtung sie stehen würden, wurde sie sich schon vor dem Eintreffen der Gesellschaft eines amüsierten, diplomatischen Mitleids für sie bewusst. In fast dem gleichen Maße wie bei Mrs. Gereth war ihr Geschmack ihr Leben, obwohl ihr Leben dadurch irgendwie an Größe gewann. Außerdem hatte sie inzwischen noch eine andere Sorge: Es gab jemanden, den sie ungern gedemütigt gesehen hätte, auch nicht in Person einer jungen Dame, die nicht eben dazu angetan war, ihn überhaupt derartiges Zartgefühl vermuten zu lassen. Als diese junge Dame erschien, versuchte Fleda, soweit es ihr Wunsch, sich im Hintergrund zu halten, zuließ, in erster Linie diejenige zu sein, die sie herumführte, ihr das Haus zeigte und ihre Ignoranz überspielte. Owen hatte angekündigt, sie würden sich, da es sich mit den Zugverbindungen treffe, zum Mittagessen einfinden und vor dem Abendessen wieder abfahren; doch Mrs. Gereth hatte, ihrem System frappanter Höflichkeit getreu, eine Verlängerung vorgeschlagen und erwirkt: ein Abendessen mit anschließender Übernachtung. Ihre junge Freundin fragte sich, wie groß ihr Widerwille sein musste, dass sie schon im Voraus so reichlich dem Anschein opferte.
Bereits nach der ersten Stunde entsetzte Fleda die unbedachte Unschuld, mit der Mona die Rolle der Beobachterin einnahm, und auch die große Ungezwungenheit, mit der sie sie, wie eine gelangweilte Touristin in einer schönen Landschaft sitzend, ausfüllte. Sie spürte bis in die letzten Nerven, wie dieses Verhalten auf ihre Gefährtin wirkte, und hatte eben darum das Bedürfnis, die junge Frau wegzulocken, ihr eine barmherzige Warnung oder einen scherzhaften Wink zukommen zu lassen. Angelegentlichen Blicken jedoch begegnete Mona mit Augen, die blaue Perlen hätten sein können, ihre einzigen – dass Owen Gereth in solchen Augen nach seinem Schicksal und seine Mutter nach einem Bekenntnis, dass Poynton ein Erfolg sei, sollte forschen müssen, erschien Fleda seltsam. Mona selbst machte keine Bemerkung, die hier für Erleuchtung sorgte; ihr Eindruck jedenfalls hatte nichts mit dem Gefühl gemein, das Fleda Vetch, während die Schönheit des Ortes wie Musik hervorbebte, in Tränen hatte ausbrechen lassen. Sie war mit ihrem Schweigen so zufrieden, als hätte sie, wie ihre Gastgeberin hinterher ausrief, mit geschlossenem Mund einen Eisenbahntunnel durchfahren. Schon nach einer Stunde gelang es Mrs. Gereth, Fleda zu vermitteln, dass Mona von unmenschlicher Ignoranz sei; Fleda jedoch stellte, auf größere Genauigkeit bedacht, fest, dass ihre Ignoranz auf obskure Weise lebendig war.
Mona war nicht so dumm, nicht zu erkennen, dass irgendetwas – auch wenn sie kaum wusste, was – von ihr erwartet wurde, was sie nicht geben konnte; und als die einzige Möglichkeit, dieser Erwartung zu begegnen, legte ihr Verstand ihr nahe, ihre großen Füße fest aufzusetzen und in die andere Richtung abzuziehen. Mrs. Gereth wollte, dass sie sich irgendwie oder irgendwohin erhob, und war gewillt, sie zu hassen, wenn sie es nicht tat: Nun schön, sie konnte, ja wollte sich nicht erheben; sie bewegte sich bereits auf der Höhe, die ihr genehm war, und erkannte, dass sie, wenn sie schon dem Hass ausgesetzt war, wenigstens die Ruhe genießen sollte. Das auch zu verdienen, was sie auf sich zog, war für ein nüchternes Mädchen wie sie das geringste Problem; so hatte sie, da ein trüber Instinkt sie lehrte, sie werde es sich am ehesten verdienen, wenn sie keinen begeisterten Überschwang zeigte, und dieser Instinkt sich mit der Überzeugung verband, dass Owen und damit das Haus ihr eindeutig sicher waren, das Vergnügen, sowohl ehrlich sein zu können als auch Gewissheit zu haben. Brachte nicht gerade ihre Ehrlichkeit sie dazu, sich auf angriffslustige Weise unbeeindruckt von Poynton zu zeigen, insofern es einfach nur Poynton war, das man ihr als Anlass zu Überschwänglichkeit aufzwang? Für Mrs. Brigstock hatten solche Anlässe fast etwas Unanständiges; und so wurde ihr das Haus gerade wegen des seinem Namen innewohnenden Reizes unheimlich – und dass Mona irgendwo in der Dämmerung ihres Wesens dem Himmel dafür dankte, dass gerade sie das Mädchen war, das sich diesem Reiz verweigerte, dessen war sich Fleda sicher. Mona war ein Mensch, bei dem Druck an einem bestimmten Punkt unweigerlich dazu führte, dass er sich an der falschen anstatt, wie man es sich vom Druckausüben erhofft, der richtigen Stelle entlud. Zum Ausgleich dafür platzte ihre Mutter unentwegt los, erklärte alles für «höchst beeindruckend» und war sichtlich froh, dass Owens Eroberin so kurz davor war, zum Zuge zu kommen. Doch sie irritiere Mrs. Gereth mit ihrer Bewunderungsformel, die da lautete, dass alles, was sie sah, «im Stile von» irgendetwas anderem sei. Das sollte beweisen, wie viel sie gesehen, bewies aber nur, dass sie nichts gesehen hatte; alles in Poynton war im Stile von Poynton, und die arme Mrs. Brigstock, die sich als Einzige entschlossen zeigte, sich zu erheben, und eine Reisetrophäe mitgebracht hatte, eine am Bahnhof gekaufte «Damenzeitschrift», ein grässliches Ding mit Schnittmustern für Schonbezüge, das sie, da es ganz neu, die erste Nummer war und hübsch gemacht schien, freundlicherweise dem Haus zu überlassen anbot, kam «im Stile von» einer vulgären älteren Frau daher, die Silberschmuck trug und plumpe Gier als Sinn für das Schöne auzugeben versuchte.
Am Ende des Tages war für Fleda Vetch klar, dass der Tag, wie auch immer Mona urteilte, entscheidend gewesen war. Ob diese nun den Charme empfand oder nicht, sie verspürte auf jeden Fall die Herausforderung: Owen Gereth würde frühzeitig imstande sein, seiner Mutter das Schlimmste mitzuteilen. Als freilich die ältere Dame zur Schlafenszeit im Morgenmantel und stark erregt ins Zimmer der jüngeren kam und ausrief: «Sie hasst es, aber was wird sie tun?», da gab sich Fleda ahnungslos, spielte die im Dunkeln Tappende und pflichtete unredlicherweise der Vermutung bei, sie hätten zumindest eine Atempause gewonnen. Die Zukunft lag für sie in Finsternis, doch es gab einen Seidenfaden, an den sie sich im Düster klammern konnte: Sie würde Owen niemals preisgeben. Er selbst wiederum mochte das tun – er würde es sogar mit Sicherheit tun; allerdings war das seine persönliche Angelegenheit, und seine Missgriffe, seine Unschuld vergrößerten nur den Reiz, den er auf sie ausübte. Sie würde ihn decken, sie würde ihn beschützen, und er würde sie für nicht mehr als eine heitere Mitbewohnerin halten und ihre Absichten so wenig erraten wie seine scharfsinnige Mutter, die ihr doch Gescheitheit genug für alles zubilligte. Von Stund an hatte ihre Aufrichtigkeit Mrs. Gereth gegenüber einen Makel. Ihre bewunderungswürdige Freundin erfuhr weiterhin alles, was auch sie erfuhr: Unbekannt blieb nur ihr allgemeiner Beweggrund.
Vom Fenster ihres Zimmers aus sah die junge Frau am nächsten Morgen vor dem Frühstück Owen im Garten mit Mona, die neben ihm her schlenderte, mit aufmerksam geneigtem Parasol, aber ohne erkennbaren Blick für das große, blühende Bild, das Mrs. Gereth schon vor so Langem dort hatte entstehen lassen. Im Gehen schlug Mona immer wieder die Augen nieder, um den Glanz ihrer Lackschuhe zu erhaschen, die denen eines Mannes ähnelten und die sie leicht nach vorn schleuderte – was sie zu einem seltsamen Bewegungsablauf veranlasste –, um sie besser begutachten zu können. Als Fleda nach unten kam, war Mrs. Gereth im Frühstückszimmer, und Owen trat in diesem Augenblick gerade durch ein bis zum Boden reichendes Flügelfenster allein von der Terrasse herein und gab seiner Mutter einen sehr zärtlichen Kuss. Der Gastfreundin kam sofort der Gedanke, sie sei im Wege, denn war er nicht von einer Welle der Freude getragen worden, eben um noch vor der Abreise der Brigstocks anzukündigen, dass Mona endlich das süße Wort hervorgestammelt habe, auf das er schon so lange wartete? Er reichte Fleda mit seiner freundlichen Heftigkeit die Hand, doch es gelang ihr, ihm nicht ins Gesicht zu sehen: Das Spiegelbild von Monas großen Stiefelspitzen war nicht unbedingt das, was sie darin erblicken wollte. Sie konnte die junge Dame selbst recht gut ertragen, nicht aber Owens Meinung von ihr. Sie war im Begriff, in den Garten zu entschlüpfen, als ihre Bewegung von Mrs. Gereth unterbrochen wurde, die sie plötzlich wie zur morgendlichen Umarmung an sich zog, um dann, während sie sie mit der durch die Nachruhe gewonnenen Tapferkeit festhielt, herauszuplatzen: «Nun, mein lieber Junge, was hält deine junge Freundin denn nun von unserem Krimskrams?»
«Ach, sie findet ihn ganz nett!»
Seinem Tonfall entnahm Fleda sofort, dass er nicht gekommen war, um zu sagen, was sie vermutete: Es lag sogar etwas darin, was Mrs. Gereth’ Überzeugung bestätigte, die Gefahr sei gebannt. Sie war sich überdies sicher, dass er mit seinem Tribut an Monas Geschmack nur die beredten Worte wiederholte, mit denen das Mädchen selbst ihn bekundet hatte; ja, sie hörte förmlich in aller Deutlichkeit den wahrscheinlichen, wohlgelaunten Wortwechsel zwischen dem Paar: «Findest du sie nicht ziemlich lustig, die alte Bude?» – «Ach, sie ist ganz nett!», hatte Mona huldvoll bemerkt; und dann hatten sie wahrscheinlich, mit einem Klaps auf den Rücken, einen weiteren Wettlauf eine grüne Böschung hinauf oder hinunter veranstaltet. Fleda wusste, Mrs. Gereth hatte ihrem Sohn gegenüber noch kein Wort geäußert, das ihm gezeigt hätte, wie groß ihre Angst war; aber es war unmöglich, den Arm ihrer Freundin um sich zu spüren und nicht gewahr zu werden, dass diese Freundin nun von einer merkwürdigen Absicht bebte. Owens Antwort war kaum von einer Art gewesen, die zu einem Gespräch über Monas Empfindungsvermögen hätte überleiten können, dennoch fuhr Mrs. Gereth gleich darauf mit einer Unschuld fort, deren kalte Heuchelei Fleda ermessen konnte. «Hat sie denn irgendein Gefühl für schöne alte Dinge?» Die Frage war so süß wie das Morgenlicht.