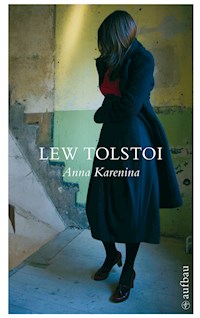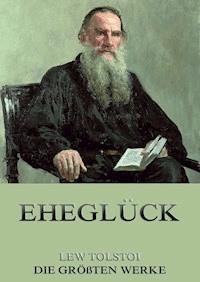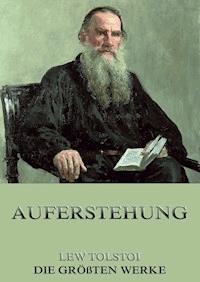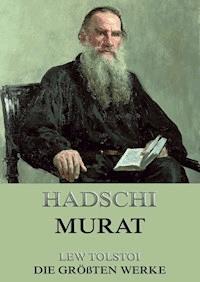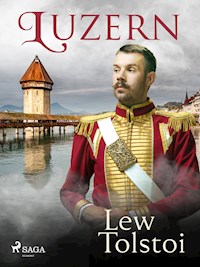7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Zu lieben ist ein Segen, geliebt zu werden Glück." Lew Tolstoi Auf einer langen Bahnfahrt erzählt ein Gutsbesitzer einem Mitreisenden die Geschichte seiner Ehe, die trotz bester Absichten in einer Katastrophe endete. Ein junges Paar erfährt, wie aus leidenschaftlicher Liebe mit den Jahren ein ruhigeres Famillienglück wird. Ein glücklich verheirateter Mann kommt nicht los von der Frau, die er vor seiner Ehe liebte. Lew Tolstois drei Ehegeschichten sind nicht autobiographisch, aber hinter dem fiktiven Geschehen spürt man die Betroffenheit des Autors, der vieles von dem Geschilderten selbst durchlebt und durchlitten hat. "Die Kreutzersonate ist eines der Wunder des Zeitalters." Heinrich Mann "Tolstoi ist einer der größten Psychologen." Daniel Kehlmann
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Lew Tolstoi
Die Kreutzersonate
Ehegeschichten
Herausgegeben und mit einem Vorwort von Margit Bräuer
Aus dem Russischen von Hermann Asemissen
Impressum
Das Nachwort zur Kreutzersonate
wurde von Dieter Pommerenke übersetzt.
ISBN E-Pub 978-3-8412-0167-6
ISBN PDF 978-3-8412-2167-4
ISBN Printausgabe 978-3-7466-6126-1
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2010
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Lew Tolstoi »Familienglück« aus Lew Tolstoi,
»Polikluschka, Frühe Erzählungen«
Bei Rütten & Loening erstmals 1967 erschienen
Lew Tolstoi »Die Kreutzersonate« und »Der Teufel«
aus »Der Tod des Iwan Iljitsch, Späte Erzählungen«
Bei Rütten & Loening erstmals 1970 erschienen
Rütten & Loening ist eine Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung morgen, unter Verwendung eines Fotos
von Kai Dieterich/bobsairport
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
Vorwort
Familienglück
Erster Teil
1
2
3
4
5
Zweiter Teil
6
7
8
9
Die Kreutzersonate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Nachwort zur »Kreutzersonate«
Der Teufel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Zweite Fassung des Schlusses
Lew Tolstoi
Gemälde von Ilja J. Repin, 1887
Vorwort
Am 1. Januar 1859 notiert Tolstoi in seinem Tagebuch: »Muß in diesem Jahre heiraten – oder nie.« Doch erst am 7. September 1862 teilt er seiner »lieben Freundin Alexandrine« mit, daß ihm das »größte Unglück oder Glück« widerfahren sei: »Ich alter zahnloser Narr habe mich verliebt.« Das Objekt seiner »Verliebtheit« ist die Arzttochter Sofja Andrejewna Bers: »Ein Kind! Könnte man meinen … Ein Kind!« (23. August 1862) Aber: »Ich liebe, wie ich nie geglaubt hätte, daß man lieben könnte. Ich bin von Sinnen, ich erschieße mich, wenn das so weitergeht … Jeden Tag denke ich, ich kann nicht länger leiden und gleichzeitig glücklich sein, und jeden Tag komme ich mehr von Sinnen. Bin wieder voll Sehnsucht, Reue und Glück fortgegangen. Morgen gehe ich hin … und sage alles oder erschieße mich.« (12./13. September 1862) Und schon am 23. September desselben Jahres heiratet der 34jährige Graf Tolstoi die 18jährige Sofja Andrejewna, seine Sonja, über die er am 30. Dezember in sein Tagebuch schreibt: »Ich werde sie immer lieben.«
Wie eine Parallele zu Tolstois eigener Brautwerbung liest sich die bereits 1859 geschriebene Erzählung »Familienglück«, gleichsam eine Vorwegnahme dessen, was Tolstois Tagebücher und Briefe später hierzu aussagen.
Auch der 36jährige Held der Erzählung, Sergej Michailytsch, wird von Zweifeln und Gewissensqualen bedrängt und scheut sich, seine Liebe zu gestehen, sich selbst und erst recht der 17jährigen Mascha: er, ein »alter, vom Leben verbrauchter Mann«, und sie, »noch ein Kind, eine Knospe, die sich erst noch entfalten wird«. Um so größer und himmelstürmender ist dann das Liebes- und Eheglück der beiden so ungleichen Gatten, das durch den Ehealltag und gegenseitige Enttäuschungen zwar wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt wird, aber den Verlockungen und Eitelkeiten, denen die so unerfahrene und unausgelastete junge Frau ausgesetzt ist, letztendlich standhält und nach der Geburt zweier Kinder in ein neues Gefühl einmündet, das die beiden Eheleute nunmehr verbindet. »Das frühere, unwiederbringliche Gefühl war zu einer teuren Erinnerung geworden, und ein anderes, von der Liebe zu den Kindern und dem Vater meiner Kinder bestimmtes Gefühl legte den Grund zu einem neuen, freilich ganz andersgearteten Lebensglück, das auch heute noch andauert …«, resümiert nicht ohne ein leises Bedauern die Heldin, aus deren Mund und Herzen das Ganze, mit einer bewundernswerten Einfühlung in die weibliche Seele, erzählt wird – das einzige Mal in Tolstois gesamtem Werk.
Die Reaktion auf die Erzählung konnte unterschiedlicher nicht sein: Während Romain Rolland »Familienglück« als »das reinste Werk, das Tolstoi jemals schuf«, bezeichnet und es als »das Wunderwerk der Liebe« preist, empfindet es Tolstoi selbst, der sich zu diesem Zeitpunkt in einer Lebens- und Schaffenskrise befand, als »unerträgliche Abgeschmacktheit«, als »ekelhaft und beschämend … mit einunddreißig Jahren rührende und erfreulich zu lesende Erzählungen zu schreiben«.
Doch anstatt »nicht mehr zu schreiben«, wie er es in einem Brief an Drushinin vom 9. Oktober 1859 ankündigt, folgen nur wenige Jahre später – in den glücklichen ersten Jahrzehnten seiner Ehe – »Krieg und Frieden« (1864–1869) und »Anna Karenina« (1873–1877), die in ihrer einzigartigen Meisterschaft zu den Gipfelwerken der europäischen Romanliteratur gehören.
»Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Art«, beginnt gleichsam programmatisch der Roman »Anna Karenina«, diese künstlerische Enzyklopädie zu Fragen der Liebe, Ehe und Familie.
Um Liebe, Ehe und Familie geht es auch in der 1889 vollendeten Erzählung »Die Kreutzersonate«, dem direkten Gegenstück zu der von poetischer Schönheit und versöhnlicher Harmonie erfüllten frühen Erzählung »Familienglück«. Dieses Meisterwerk aus dem Spätschaffen Tolstois erschüttert und erschlägt geradezu durch die leidenschaftliche Brutalität und selbstquälerische Wildheit, mit welcher der Hauptheld, der Gutsbesitzer Posdnyschew, einem zufälligen Reisegefährten die Geschichte seiner Ehe und den Mord an seiner Ehefrau erzählt, die er in einem Anfall von wahnsinniger Eifersucht erstochen hat. Wie er sich selbst und seinem Zuhörer mit einer minutiösen Analyse klarmacht, war der Eifersuchtsmord aber nur der Schlußpunkt einer Ehe, die ausschließlich auf Sexualität basierte und außer der Befriedigung der Wollust keinerlei seelische oder geistige Gemeinsamkeit der beiden Gatten kannte, so daß die Kluft zwischen ihnen immer tiefer wurde und die gegenseitige Entfremdung und Leere zu einem Dauerzwist und schließlich zu abgrundtiefem Haß führte. Die vermeintliche oder tatsächliche Untreue der Frau war für den Ehemann dann nur der letzte Tropfen, der das Faß zum Überlaufen und ihm selbst die Befreiung aus einer Ehe brachte, die zu einem Gefängnis geworden war.
Die »Kreutzersonate«, in welcher der Künstler Tolstoi mit faszinierender Intensität, Emotionalität und höchster Dramatik nicht nur eine individuelle Ehetragödie erzählt, sondern der tiefreligiöse Denker und Moralist Tolstoi zugleich den Stab über die konventionelle, bürgerliche Ehe bricht sowie Kirche und Staat anklagt, da sie die Scheinmoral, Heuchelei und Verlogenheit dieser Institution erst ermöglichten und schützten, schlug wie eine Bombe ein und wurde zum meistgelesenen und meistumstrittenen Werk Tolstois, das überschwengliche Begeisterung, aber auch Entsetzen und Empörung auslöste. Und die rigorose Verdammung und Verabscheuung jeglicher Sinnenlust durch einen fast mönchischen Asketismus, der an die Stelle des Geschlechtslebens das anzustrebende Ideal einer vollkommenen Keuschheit im Sinne des Evangeliums setzt, rief Befremden und Unverständnis hervor, das auch durch ein nachträglich verfaßtes, rein dogmatisches »Nachwort zur ›Kreutzersonate‹« nicht aus der Welt geschafft werden konnte, sondern durch die theoretische Begründung und Untermauerung der Aussagen Posdnyschews den Streit noch anheizte.
So wurde die Erzählung noch vor ihrem Erscheinen in Rußland verboten, fand jedoch in Abschriften weiteste Verbreitung und war nicht nur ein literarisches, sondern auch ein herausragendes gesellschaftliches Ereignis der Epoche. »Kaum vorstellbar, was sich abspielte, zum Beispiel nachdem die ›Kreutzersonate‹ und ›Die Macht der Finsternis‹ bekannt wurden«, schreibt die bereits erwähnte Alexandrine Tolstaja in ihren Erinnerungen. »Noch nicht zum Drucke freigegeben, wurden diese Werke bereits in Hunderten und Tausenden von Exemplaren abgeschrieben, sie gingen von Hand zu Hand, wurden in sämtliche Sprachen übersetzt und allüberall mit enormer Leidenschaftlichkeit gelesen; zuweilen schien es, als lebe das Publikum, alle persönlichen Sorgen vergessend, nur für die Literatur des Grafen Tolstoi … Wichtigste politische Ereignisse vermochten nur selten alle Welt derartig machtvoll und ausschließlich in ihren Bann zu ziehen.«
Ihr erstes Erscheinen erlebte die »Kreutzersonate« in Deutschland, wo sie in Berlin bereits 1890 in deutscher Sprache veröffentlicht wurde, und kein Geringerer als der Literaturnobelpreisträger von 1912, Gerhart Hauptmann, feierte in einem Geleitwort die »künstlerische und menschliche Größe« Tolstois, dessen Schriften »zu sehr Geschenke des Genius« seien, »als daß sie vorbildlich sein könnten«. Und Heinrich Mann mißt der »Kreutzersonate« einen außerordentlichen Stellenwert bei, wenn er in seiner Epochenbilanz »Ein Zeitalter wird besichtigt« schreibt: »Ich gedenke der völlig vereinzelten Wirkung der ›Kreutzersonate‹ – das Gebot der Keuschheit nach tausend Jahren wieder wörtlich, heilig genommen. Wir waren fremd angesprochen, der Ungläubigste erschrak, indes er zu lächeln meinte. Eine dynamische Moral (soeben hatte Nietzsche uns sogar ihre ohnmächtigen Reste ausgeredet) brach jäh herein. Sie machte Sensation, bis hinein in stumpfe Mengen, die nichts lasen. Die ›Kreutzersonate‹ ist eines der Wunder des Zeitalters.« Und er fährt fort: »Geistig Bewanderte haben ihr bald angesehen, daß die geforderte Keuschheit nur ein Teil des Ganzen war. Um die integrale Reinheit ging es, um das sittlich bestimmte Leben, die Wahrheit, die Wahrheit! – es komme nach, was mag, es komme gar nichts mehr.«
Unmittelbar nach der »Kreutzersonate« entstand, im November 1889, eine Erzählung zu dem gleichen Thema, der Tolstoi in der Endfassung den Titel »Der Teufel« gab. Auch hier will ein wohlhabender Gutsbesitzer nach einem ausschweifenden Junggesellenleben, wie es in seinen Kreisen üblich war, eine Ehe mit einem »reinen« Mädchen eingehen und ein vorbildlicher Ehemann werden. Doch durch seine vorehelichen »Sünden« ist eine Katastrophe gleichsam vorprogrammiert: Die Wollust in Gestalt seiner einstigen Geliebten, der sinnenbetörenden Bäuerin Stepanida, verfolgt ihn bis ins eheliche Schlafgemach und läßt sich weder durch den Gedanken an Frau und Kind noch durch harte körperliche Arbeit vertreiben. Der einzige Ausweg ist, sich selbst oder die teuflische Verführerin zu töten.
Obwohl der Erzählung ein reales Vorkommnis zugrunde liegt, das sich unweit von Jasnaja Poljana zugetragen hatte, sind doch auch deutlich autobiographische Bezüge auszumachen, wie Tolstois Tagebücher belegen. Auch in seinem eigenen Leben gab es einen solchen »Teufel«, die Bäuerin Axinja, mit der er eine lange, intensive Liebesbeziehung unmittelbar vor seiner Eheschließung unterhielt, die einzige von Tolstois nicht wenigen Frauenbekanntschaften aus seiner Junggesellenzeit, die Gegenstand ernsthafter Eifersuchtsszenen zwischen den Ehegatten wurde und in beider Tagebüchern bis ins hohe Alter eine Rolle spielte. Kein Wunder also, daß Tolstoi, der schon mit der »Kreutzersonate« heftige Auseinandersetzungen in der eigenen Familie hervorgerufen und sich vor allem den Zorn Sofja Andrejewnas zugezogen hatte, weil sie sich in Posdnyschews Ehefrau wiederzuerkennen glaubte und sich »vor den Augen der ganzen Welt gedemütigt« fühlte, das Manuskript des »Teufels« sorgfältig geheimhielt und es sogar in einem Sesselpolster eingenäht versteckte. Über die Reaktion seiner Frau, als sie die Erzählung dennoch entdeckt und gelesen hatte, schrieb Tolstoi am 13. Mai 1909 in sein Tagebuch: »Beim Frühstück war Sonja entsetzlich. Wie sich herausstellte, hatte sie ›Der Teufel‹ gelesen, und der alte Groll begann in ihr zu gären, für mich war es sehr niederdrückend.« Das Manuskript des »Teufels« wurde erst nach Tolstois Tod in Druck gegeben.
Die drei hier ausgewählten »Ehegeschichten« sind keine autobiographischen Werke, aber hinter dem fiktiven Geschehen spürt man die Betroffenheit und das Selbstbekenntnis des Autors, der – wie bei allen seinen künstlerischen Schöpfungen – das Geschilderte nicht erfunden, sondern selbst durchlebt und durchlitten hat; das Denken und Fühlen seiner Helden, ihre Liebe und ihr Haß, ihr Glück und ihr Schmerz verkörpern das Ringen Tolstois, seinen Kampf gegen den Zwiespalt zwischen dem Leben, das er in der Realität lebt, und dem idealen Leben, das er leben möchte, sie lassen hinter dem Eheglück des Sergej Michailytsch und der Ehetragödie Posdnyschews und Irtenjews Tolstois eigene Ehegeschichte erahnen, die ihn zwar nicht wie seine Helden zu Mord und Totschlag führte, aber ihn am Lebensende zur Flucht aus der Familie, aus seinem Heim trieb. Die »Kreutzersonate« und »Der Teufel« sind aber vor allem der überzeugende Beweis, daß Tolstoi, nachdem er zu Beginn der achtziger Jahre, auf dem Höhepunkt seines literarischen Ruhms, seinem bisherigen Leben mit dessen Wertevorstellungen und darunter auch seiner Kunst abgeschworen hatte, nach längerer künstlerischer Abstinenz wieder zur Belletristik zurückgekehrt ist und sie mit »Auferstehung«, der letzten seiner drei gewaltigen Romanepopöen, krönte. »Der Richter des Daseins«, schreibt Stefan Zweig, »ist wieder Dichter geworden.«
Margit Bräuer
FAMILIENGLÜCK
Erster Teil
1
Wir trugen Trauer um unsere Mutter, die im Herbst gestorben war, und verlebten den ganzen Winter einsam auf dem Lande – Katja, Sonja und ich.
Katja gehörte von alters her zum Hause, sie war unsere Gouvernante, die uns beide großgezogen hatte und der ich seit meiner frühesten Kindheit in Liebe anhing. Sonja war meine jüngere Schwester. In unserem großen Hause in Pokrowskoje verbrachten wir einen traurigen, finsteren Winter. Das Wetter war kalt und stürmisch, so daß die Schneewehen oft bis über die Fenster reichten; die Fensterscheiben waren meist zugefroren und undurchsichtig, und während des ganzen Winters gingen oder fuhren wir kaum einmal aus. Besuch kam selten; und wenn sich doch jemand bei uns einfand, wurde die Stimmung im Hause dadurch auch nicht heiterer und froher. Alle Besucher machten ernste, traurige Gesichter, sprachen so leise, als fürchteten sie, jemand zu wecken, seufzten und weinten auch oft, wenn sie auf mich und namentlich auf die kleine Sonja in ihrem schwarzen Kleidchen blickten. Es war, als ginge im Hause noch der Tod um; der Schrecken und Kummer, den er mit sich gebracht hatte, lag in der Luft. Die Tür zu Mamas ehemaligem Zimmer war verschlossen, und wenn ich abends beim Schlafengehen daran vorbeikam, wurde ich jedesmal von einem seltsamen, mit Schauder gemischten Verlangen ergriffen, einen Blick in diesen kalten, leeren Raum zu werfen.
Ich war damals ein siebzehnjähriges Mädchen, und gerade in dem Jahr ihres Todes hatte Mama vorgehabt, in die Stadt zu übersiedeln, um mich in die Gesellschaft einzuführen. Der Verlust meiner Mutter war für mich ein großer Schmerz, doch muß ich bekennen, daß dazu auch etwas der Umstand beitrug, daß ich, ein junges und, wie mir allgemein gesagt wurde, hübsches Mädchen, nun schon den zweiten Winter einsam und freudlos auf dem Lande verbringen mußte. Gegen Ende des Winters steigerte sich bei mir dieses Gefühl der Einsamkeit und drückenden Langeweile bis zu einem solchen Grade, daß ich kaum noch mein Zimmer verließ, nie das Klavier aufschlug oder ein Buch zur Hand nahm. Wenn Katja mich überreden wollte, das eine oder andere zu unternehmen, erklärte ich, es nicht zu können oder keine Lust zu haben, und fügte im stillen hinzu: Wozu? Wozu soll ich etwas unternehmen, da meine besten Jugendjahre ja doch unnütz vertan werden? Wozu also? Und auf dieses »Wozu« gab es keine andere Antwort als Tränen.
Man sagte mir, daß ich im Laufe des Winters abgemagert sei, daß mein Aussehen gelitten habe; aber darüber war ich nicht sehr bekümmert. Warum denn auch? Für wen? Mir schien, als sei mir bestimmt, mein ganzes Leben in dieser Einöde und ausweglosen Trübsal zu verbringen, der ich aus eigener Kraft nicht entfliehen konnte, ja nicht einmal wollte. Als der Winter seinem Ende entgegenging, begann sich Katja meinetwegen ernstlich Sorgen zu machen und faßte den Entschluß, mit mir unter allen Umständen ins Ausland zu fahren. Doch dazu war Geld nötig, und wir wußten noch so gut wie gar nicht, was uns nach dem Tode der Mutter verblieben war, und warteten von Tag zu Tag auf den Vormund, der herkommen und unsere Verhältnisse klären sollte.
Im März traf der Vormund ein.
»Nun, Gott sei Dank!« sagte Katja eines Tages zu mir, als ich müßig, ohne etwas zu denken und zu wünschen, wie ein Schatten aus einer Ecke in die andere wanderte. »Sergej Michailytsch ist angekommen, hat sich nach uns erkundigt und will zum Mittagessen herüberkommen. Nun mußt du dich aber aufraffen, Maschetschka«, fügte sie hinzu. »Denn was würde er sonst für einen Eindruck von dir bekommen? Er hat euch alle immer so liebgehabt.«
Sergej Michailytsch war unser nächster Nachbar und mit meinem verstorbenen Vater, obwohl er bedeutend jünger als dieser war, eng befreundet gewesen. Abgesehen davon, daß seine Ankunft unsere Pläne änderte und die Aussicht bot, das Landleben zu beenden, war ich von Kindheit an gewohnt, ihn liebzuhaben und zu verehren, und als Katja mich nun ermahnte, mich aufzuraffen, erriet sie wohl, daß Sergej Michailytsch unter allen unseren Bekannten derjenige war, bei dem es mir am schmerzlichsten gewesen wäre, mich in einem unvorteilhaften Licht zu zeigen. Über die herzlichen Gefühle hinaus, die gleich mir alle im Hause, von Katja und Sonja, seinem Patenkind, bis zum letzten Kutscher, für ihn hegten, hatte er für mich noch eine besondere Bedeutung, und zwar auf Grund einer Bemerkung, die Mama einst in meinem Beisein gemacht hatte. Sie hatte gesagt, einen solchen Mann würde sie sich einmal für mich wünschen. Damals hatte mich diese Bemerkung befremdet und sogar unangenehm berührt, denn mein Ideal hatte ganz anders ausgesehen. Der Held meiner Träume war von schlanker, schmächtiger Gestalt, blaß und melancholisch. Sergej Michailytsch hingegen, ein Mann von bereits fortgeschrittenem Alter, war groß, stämmig und, so schien es mir, stets fröhlich. Wie dem auch sei, Mamas Worte waren in meinem Gedächtnis haftengeblieben, und schon vor sechs Jahren, als ich elf war und er noch du zu mir sagte, mit mir spielte und mich das Veilchenmädchen nannte, habe ich mitunter nicht ohne leises Bangen darüber nachgedacht, was ich wohl täte, wenn er eines Tages den Wunsch äußern sollte, mich zu heiraten.
Vor dem Mittagessen, das Katja durch eine Spinatbeilage und Cremespeise bereichert hatte, traf Sergej Michailytsch ein. Ich hatte schon durch das Fenster gesehen, wie er in einem kleinen Schlitten angefahren kam, eilte jedoch, sobald der Schlitten um die Ecke zu uns einbog, in den Salon und wollte so tun, als hätte ich ihn gar nicht erwartet. Doch als dann in der Vorhalle Tritte laut wurden und seine lebhafte Stimme und Katjas Schritte ertönten, konnte ich nicht länger an mich halten und ging ebenfalls zu seiner Begrüßung hinaus. Er hielt Katjas Hand umfaßt, während er sich aufgeräumt und lächelnd mit ihr unterhielt. Als er mich wahrnahm, hielt er inne und starrte mich eine Weile wortlos an. Ich wurde verlegen und fühlte, daß ich errötete.
»Ach! Ist das zu glauben, daß Sie es sind?« sagte er dann und kam in seiner entschlossenen, schlichten Art mit ausgestreckten Händen auf mich zu. »Ist es möglich, sich so zu verändern! Wie erwachsen Sie aussehen! Was ist aus dem kleinen Veilchen geworden? Ein ganzer Rosenstock!«
Er ergriff mit seiner großen Rechten meine Hand und drückte sie so fest und herzlich, daß es fast weh tat. Ich nahm an, daß er mir die Hand küssen würde, und beugte mich schon etwas zu ihm vor; doch er beließ es bei einem nochmaligen Händedruck und sah mir dabei mit seinem festen, heiteren Blick gerade in die Augen.
Ich hatte ihn seit sechs Jahren nicht mehr gesehen. Er hatte sich in vielem verändert, war älter, männlicher geworden und trug jetzt einen dichten Backenbart, was ihn gar nicht kleidete; aber seine natürliche Art, sich zu geben, der offene, treuherzige Ausdruck des markanten Gesichts, die klugen glänzenden Augen und sein gewinnendes, fast kindliches Lächeln waren unverändert geblieben.
Binnen fünf Minuten sahen wir alle in ihm nicht mehr einen Gast, sondern einen vertrauten Hausgenossen – sogar die Dienstboten, an deren Dienstbeflissenheit zu merken war, wie sehr sie sich über seine Ankunft freuten.
Sergej Michailytsch benahm sich ganz anders als die übrigen Nachbarn, die uns nach Mamas Tode besucht und es für notwendig gehalten hatten, in unserem Beisein stumm dazusitzen und zu weinen. Er war gesprächig, heiter und erwähnte meine Mutter mit keinem Wort, so daß ich diese scheinbare Gleichgültigkeit seitens eines uns so nahestehenden Menschen anfangs sogar befremdend, wenn nicht gar ungehörig fand. Doch dann wurde mir klar, daß es sich bei ihm nicht um Gleichgültigkeit handelte, sondern um seine Abneigung gegen alles Erkünstelte, und ich war ihm dankbar dafür.
Abends setzte sich Katja im Wohnzimmer an ihren alten Platz, um den Tee einzuschenken, wie es schon zu Mamas Lebzeiten üblich gewesen war; Sonja und ich setzten uns neben sie. Der alte Grigori brachte dem Gast eine von Vaters Pfeifen, die er irgendwo ausgegraben hatte, und Sergej Michailytsch begann wie in früheren Zeiten im Zimmer auf und ab zu gehen.
»Wie viele schreckliche Veränderungen hat dieses Haus erfahren, wenn man alles überdenkt!« sagte er, vor uns stehenbleibend.
»Ach ja«, stimmte Katja seufzend zu; sie setzte den Deckel auf den Samowar, blickte zu Sergej Michailytsch auf und war dem Weinen nahe.
»Sie erinnern sich wohl noch Ihres Vaters?« wandte er sich an mich.
»Nur wenig«, antwortete ich.
»Wie schön wäre es jetzt für Sie, wenn er noch am Leben wäre«, sagte er leise und heftete seine Augen versonnen auf meine Stirn. »Ich habe Ihren Vater sehr liebgehabt«, fügte er noch leiser hinzu, während in seinen Augen, wie mir schien, etwas aufglänzte.
»Und nun hat Gott auch sie noch zu sich genommen!« sagte Katja, zog, die Serviette schnell auf die Teekanne legend, ihr Taschentuch hervor und brach in Tränen aus.
»Ja, schreckliche Veränderungen hat dieses Haus erfahren«, wiederholte er und wandte sich ab. »Sonja, zeige mir mal dein Spielzeug!« fügte er nach einer Weile hinzu und ging mit ihr in den Salon. Die Augen voller Tränen, sah ich Katja an, als er gegangen war.
»Ein so treuer Freund!« sagte sie.
Auch mir war dank dem Mitgefühl dieses lieben, doch immerhin fremden Menschen warm und wohl ums Herz geworden.
Aus dem Salon schallte das Jubeln Sonjas herüber, und man hörte, wie er mit ihr herumtollte. Ich ließ ihm Tee hinbringen; dann war zu hören, wie er sich ans Klavier setzte und mit Sonjas kleinen Händen auf die Tasten schlug.
»Marja Alexandrowna!« rief er herüber. »Kommen Sie doch mal, spielen Sie etwas!«
Mir gefiel, daß er sich in einem so natürlichen, freundschaftlich-gebieterischen Ton an mich wandte; ich stand auf und ging zu ihm.
»Spielen Sie dies hier!« Er zeigte, nachdem er im Notenheft geblättert hatte, auf das Adagio der Sonate Quasi una fantasia von Beethoven. »Nun wollen wir mal hören, wie Sie spielen«, fügte er hinzu und zog sich mit seinem Tee in eine Ecke des Salons zurück.
Ich hatte merkwürdigerweise das Gefühl, ich dürfe nicht nein sagen oder etwa den Einwand machen, daß ich schlecht spiele. So setzte ich mich gehorsam ans Klavier und begann zu spielen, so gut ich eben konnte, obwohl ich seinem Urteil mit einigem Bangen entgegensah; denn ich wußte, daß er die Musik liebte und etwas davon verstand. Das Adagio entsprach der Stimmung, die durch die am Teetisch wachgerufenen Erinnerungen ausgelöst worden war, und ich spielte es, glaube ich, recht gut. Beim Scherzo hingegen unterbrach er mich. »Nein, das gelingt Ihnen nicht«, sagte er, auf mich zukommend, »das lassen Sie lieber; aber der vorhergehende Satz war nicht übel. Sie scheinen etwas von Musik zu verstehen.« Dieses bescheidene Lob erfreute mich so, daß ich sogar errötete. Es war mir so neu und angenehm, daß er, ein Freund und Gefährte meines Vaters, mit mir ernsthaft wie mit seinesgleichen sprach und mich nicht mehr wie ehemals als Kind behandelte. Katja ging nach oben, um Sonja zu Bett zu bringen, und ich blieb mit ihm allein im Salon zurück.
Er erzählte mir von meinem Vater, wie sie sich miteinander befreundet und welch fröhliche Stunden sie einstmals gemeinsam verlebt hatten, als ich noch über meinen Märchenbüchern und bei meinem Spielzeug saß. Durch seine Schilderungen gewann ich zum erstenmal eine Vorstellung von meinem Vater als einem schlichten, liebenswerten Menschen, die ich bis dahin nicht gehabt hatte. Er fragte mich auch nach meinen Neigungen, meiner Lektüre und nach meinen Plänen für die Zukunft und gab mir Ratschläge. Jetzt war er für mich nicht mehr der fidele Onkel, der mit mir spaßte, mich neckte und mit mir spielte, sondern ein seriöser, natürlicher und mir wohlgesinnter Mensch, der mir unwillkürlich Achtung und Sympathie einflößte. Es war mir angenehm und machte mir Freude, mich mit ihm zu unterhalten, obgleich ich dabei eine gewisse Spannung empfand. Ich fürchtete für jedes Wort, das ich sagte; mir lag so sehr daran, seine Liebe, die ich bis jetzt nur als die Tochter meines Vaters besaß, selbst zu verdienen.
Nachdem sie Sonja zu Bett gebracht hatte, gesellte sich Katja zu uns und beklagte sich bei ihm wegen meiner Apathie, von der ich ihm nichts gesagt hatte.
»Das Wichtigste hat sie mir verschwiegen«, sagte er und schüttelte mit einem Blick auf mich vorwurfsvoll den Kopf.
»Was lohnt es, darüber zu sprechen«, verteidigte ich mich. »Es ist höchst langweilig und wird sich auch wieder geben.« (Ich hatte jetzt auch wirklich das Empfinden, nicht nur, daß meine Schwermut vergehen werde, sondern daß sie bereits vergangen sei, ja überhaupt nie existiert habe.)
»Es ist nicht gut, wenn man nicht imstande ist, Einsamkeit zu ertragen«, sagte er. »Sind Sie wirklich eine junge Dame?«
»Natürlich bin ich eine junge Dame«, erwiderte ich lachend.
»Nein, ich meine, eine unvernünftige junge Dame, die nur auflebt, wenn es darauf ankommt, anderen zu gefallen, die sich aber gehenläßt und für nichts Interesse hat, sobald sie allein ist. Alles tut sie nur für den Schein und nichts für sich selbst.«
»Sie haben ja eine nette Meinung von mir«, sagte ich, um überhaupt etwas zu sagen.
»Doch nein«, fuhr er nach kurzem Schweigen fort, »nicht zu Unrecht ähneln Sie Ihrem Vater! Der Kern ist da«, fügte er hinzu, und sein wohlwollender, prüfender Blick, der dabei auf mir ruhte, schmeichelte mir wieder und versetzte mich in freudige Verlegenheit.
Erst jetzt fiel mir in seinem Gesicht, das beim ersten Eindruck so heiter schien, der eigentümliche Ausdruck seiner Augen auf, deren zunächst klarer Blick allmählich mehr und mehr einen gespannten, ein wenig wehmütigen Zug annahm.
»Sie sollen und dürfen sich nicht dem Trübsinn hingeben«, sagte er. »Sie haben die Musik, von der Sie etwas verstehen, haben Bücher, Ihre Weiterbildung, haben das ganze Leben vor sich, auf das Sie sich jetzt noch vorbereiten können, damit Sie einmal keine Versäumnisse zu bereuen brauchen. In einem Jahr wäre es zu spät.«
Er sprach mit mir wie ein Vater oder Onkel, und ich merkte, daß er dauernd bemüht war, sich mir anzupassen. Einerseits kränkte es mich, von ihm für unter sich stehend gehalten zu werden, doch andererseits freute ich mich auch darüber, daß er es für der Mühe wert hielt, sich um meinetwillen einen Zwang aufzuerlegen.
Während des restlichen Abends sprach er mit Katja über geschäftliche Dinge.
»Nun, dann bis zum nächsten Mal, meine Lieben«, sagte er, als er aufstand und mir, auf mich zukommend, seine Hand reichte.
»Wann sehen wir Sie denn wieder?« fragte Katja.
»Im Frühjahr«, antwortete er, während er meine Hand noch in der seinen hielt. »Jetzt fahre ich nach Danilowka« – das war unser zweites Dorf –, »um dort, so gut ich kann, nach dem Rechten zu sehen, und anschließend muß ich wegen meiner eigenen Angelegenheiten nach Moskau; aber im Sommer sehen wir uns wieder.«
»Ach, so lange wollen Sie wegbleiben?« sagte ich ganz betroffen; ich hatte schon gehofft, ihn täglich zu sehen, und war nun wirklich sehr betrübt, und außerdem fürchtete ich, daß sich meine Schwermut wieder einstellen könnte. Das mußte sich wohl in meiner Miene und Stimme ausgedrückt haben.
»Ja, arbeiten Sie nur tüchtig, und blasen Sie nicht Trübsal«, sagte er in einem meinem Empfinden nach zu kühlen, oberflächlichen Ton. »Und im Frühjahr werde ich Sie dann examinieren«, fügte er hinzu und gab, ohne mich anzusehen, meine Hand frei.
In der Vorhalle, wohin wir ihn begleitet hatten, zog er hastig seinen Pelz an und vermied es abermals, zu mir hinzublicken. Es ist gar nicht nötig, daß er sich so bemüht, dachte ich. Meint er wirklich, daß mir so viel daran liegt, von ihm angesehen zu werden? Er ist ein guter, ein sehr guter Mensch – nichts weiter.
Dennoch schliefen Katja und ich an jenem Abend lange nicht ein und unterhielten uns angeregt, wenn auch nicht über ihn, so doch darüber, was wir im kommenden Sommer anfangen und wie wir den Winter verbringen würden. Die schreckliche Frage: »Wozu?« tauchte in meinen Gedanken nicht wieder auf. Mir schien es ganz einfach und selbstverständlich zu sein, daß man leben mußte, um glücklich zu sein, und daß ich für die Zukunft noch viel Glück zu erwarten hatte. Es war, als sei unser altes, finsteres Haus in Pokrowskoje unversehens von Leben und Licht erfüllt.
2
Mittlerweile war es Frühling geworden. Mein Trübsinn war vergangen und hatte unter dem Einfluß des Frühlings einer träumerischen, von unbestimmten Hoffnungen und Wünschen genährten Schwermut Platz gemacht. Obwohl ich jetzt nicht so müßig lebte wie zu Anfang des Winters, sondern mich sowohl mit Sonja als auch mit der Musik und mit Lesen beschäftigte, zog ich mich häufig in den Park zurück, um lange einsam durch die Alleen zu wandern oder auf einer Bank zu sitzen und mich Gott weiß welchen Gedanken, Hoffnungen und Wünschen hinzugeben. Mitunter, namentlich wenn der Mond schien, saß ich die ganze Nacht am Fenster meines Zimmers, oder ich schlich mich heimlich, damit Katja es nicht merkte, und oft nur in einem leichten Jäckchen in den Park und lief durch den Tau bis zum Teich; einmal wagte ich mich sogar in die Felder hinaus und ging dann mitten in der Nacht mutterseelenallein um den ganzen Park herum.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!