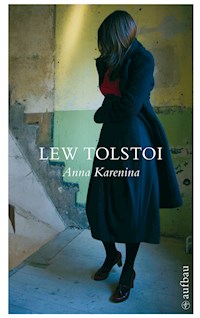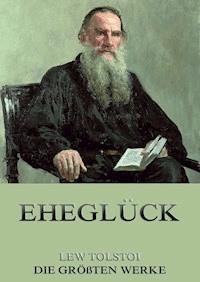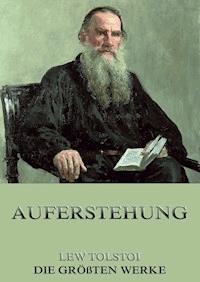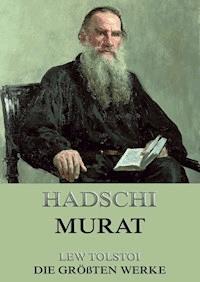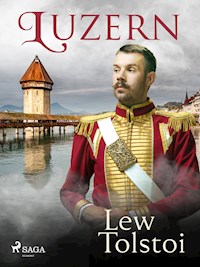Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Glück der Ehe - liegt es zwischen Himmel und Erde? Wer könnte es besser wissen, als der Großmeister der russischen Literatur: Lew Nikolajewitsch Tolstoi (1828 - 1910). Wir begegnen Maria Alexandrowna, genannt Mascha, und Sergej Michailytsch, ihrem 19 Jahre älteren Ehemann. Mascha entdeckt, dass das Eheleben und die Gefühle komplexer sein können, als sie in ihrer Verliebtheit angenommen hat. Und die Vorstellung vom Eheleben, das in dieser Zeit praktiziert wird, doch vielschichtiger ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
I. KAPITEL
II. KAPITEL
III. KAPITEL
lV.KAPITEL
V. KAPITEL
VI. KAPITEL
VII. KAPITEL
VIII. KAPITEL
IX. KAPITEL
I. KAPITEL
Wir trauerten damals um meine Mutter, die im Herbst gestorben war, und lebten ─ Katja, Sonja und ich ─ den ganzen Winter zurückgezogen auf dem Lande.
Katja war eine alte Freundin unseres Hauses, unsere Gouvernante, die uns großgezogen hatte und die ich kannte und liebte, solange ich zurückzudenken vermag. Sonja war meine jüngere Schwester.
Der Winter, den wir in Pokrowskoje, unserem alten Gutshause zubrachten, war düster und traurig. Es war kalt, der Wind fegte den Schnee in dichten Haufen hoch an den Fenstern hinauf; die Scheiben blieben gewöhnlich dicht zugefroren, und wir gingen und fuhren fast nirgends hin. Besuche kamen selten, und die wenigen, die sich einfanden, brachten weder Heiterkeit noch Unterhaltung in unser Haus. Alle hatten traurige Gesichter, alle sprachen so leise, als ob sie jemand zu wecken fürchteten, sie lachten nie, seufzten und weinten oft, wenn sie mich und besonders die kleine Sonja in ihrem schwarzen Kleidchen ansahen. Es war, als ob noch immer der Tod im Hause zu spüren sei, als ob seine Schrecknisse noch immer die Luft erfüllten. Das Zimmer der Mutter war geschlossen, aber sooft ich daran vorüberging, um mich schlafen zu legen, war mir zumute, als ob mich etwas in das öde, kalte Gemach hineinzöge.
Ich war damals siebzehn Jahre alt, und die Mutter wollte gerade in dem Jahre, in dem sie starb, in die Stadt über-siedeln, um mich in die Gesellschaft einzuführen. Der Verlust der Mutter war ein großes Unglück für mich, aber ich muß bekennen, daß ich in allem Kummer um sie auch das schmerzliche Gefühl hatte, jung und ─ wie alle sagten ─ hübsch zu sein und nun schon den zweiten Winter in tödlicher Einsamkeit auf dem Lande zubringen zu müssen.
Nach und nach erreichte die aus Gram, Einsamkeit und Langeweile gemischte Empfindung einen solchen Grad, daß ich das Zimmer nicht mehr verließ, das Klavier nicht mehr öffnete und kein Buch mehr zur Hand nahm. Wenn mir Katja zuredete, mich mit diesem oder jenem zu beschäftigen, gab ich zur Antwort: „ich habe keine Lust ─ ich mag nicht!“ ─ und im Herzen fragte eine Stimme: Warum denn? Warum etwas tun, wenn meine beste Lebenszeit so nutzlos vorübergeht? Warum? Und auf dies „Warum“ hatte ich keine andere Antwort als Tränen.
Ich hörte sagen, daß ich mager würde und mich zu meinem Nachteil verändere, aber auch das ließ mich gleichgültig. Was lag daran? Wer kümmerte sich darum? Mir war zumute, als ob mein ganzes Leben in dieser trostlosen Öde, dieser rettungslosen Lange-weile verfließen müßte, und dem zu entfliehen, hatte ich für mich allein nicht die Kraft, ja nicht einmal den Wunsch.
Zu Ende des Winters fing Katja an, für mich zu fürchten, und beschloß, mich so bald als möglich ins Ausland zu bringen. Dazu war Geld erforderlich, wir aber wußten kaum, was uns nach dem Tode der Mutter geblieben war, und warteten von Tag zu Tag auf den Vormund, der unsere An-gelegenheiten ordnen sollte.
Im März kam der Vormund endlich.
„Gott sei Dank!“ sagte Katja eines Tages, als ich wie-der ohne Beschäftigung, ohne Gedanken, ohne Wünsche wie ein Schatten aus einer Ecke in die andere schlich. „Sergej Michailowitsch ist angekommen. Er hat hergeschickt, sich nach uns erkundigen zu lassen, und wird zum Mittagessen hier sein. Nimm dich zusammen, liebe Maschetschka“, fügte sie hinzu. „Was soll er denn von dir denken? Er hat euch so lieb! Er hat alle so liebgehabt.“
Sergej Michailowitsch war einer unserer Nachbarn und ein Freund meines verstorbenen Vaters, obwohl viel jünger als dieser. Abgesehen davon, daß seine Ankunft unser Leben anders gestaltete und uns vielleicht die Möglichkeit gab, das Landgut zu verlassen, war ich von Kindheit an gewohnt, ihn zu lieben und zu achten, und Katja wünschte, daß ich mich zusammennähme, weil sie erriet, daß es mir unter allen meinen Bekannten am schmerzlichsten gewesen wäre, Sergej Michailowitsch gegenüber in ungünstigem Lichte zu erscheinen.
Und nicht allein, daß ich ihn ─ wie alle im Hause, von Katja und seinem Patchen Sonja an bis zum letzten Pferdeknecht ─ liebhatte, er besaß für mich noch eine besondere Bedeutung wegen einer Äußerung, die meine Mutter einst in meiner Gegenwart getan hatte. Sie sagte: einen solchen Mann hätte sie mir gewünscht. Damals fand ich das sonderbar, ja sogar unangenehm, denn mein Ideal sah ganz anders aus. Mein Ideal war jung, hager, blaß und schwermütig. Sergej Michailowitsch dagegen war kein Jüngling mehr, war groß, stark und, wie mir schien, immer vergnügt. Trotzdem aber kamen mir die Worte der Mutter häufig in den Sinn, und schon sechs Jahre früher, als ich elf Jahre alt war, er noch du zu mir sagte, mit mir spielte und mich „Veilchenkind“ zu nennen pflegte, fragte ich mich zuweilen mit einer gewissen Angst: Was soll ich tun, wenn er mich plötzlich heiraten will?
Kurz vor dem Mittagessen, dem Katja eine Mehlspeise, Creme und Spinatsauce zugefügt hatte, kam Sergej Michailowitsch. Ich sah ihn durchs Fenster, als er sich in einem kleinen Schlitten dem Hause näherte, eilte, sobald er um die Ecke bog, in den Salon und wollte mich stellen, als ob ich nicht auf ihn gewartet hätte. Als ich aber im Vorzimmer das Stampfen seiner Füße, seine laute Stimme und Katjas Schritte hörte, hielt ich´s nicht aus und ging ihm entgegen.
Er hielt Katjas Hand, sprach laut und lächelte. Sobald er mich sah, verstummte er, blieb stehen und blickte mich eine Weile an, ohne mich zu grüßen. Mir wurde unbehag-lich zumute, und ich fühlte, daß ich errötete.
„Ach! Ist's möglich? Sie sind's!“ sagte er dann in seiner einfachen, herzlichen Weise, indem er mit ausgestreckten Händen auf mich zukam: „Ist's möglich, sich so zu verändern? Wie Sie gewachsen sind! Das soll unser Veilchen sein? Es ist eine volle Rose geworden.“
Mit seiner großen Hand ergriff er die meinige und drückte sie fest, beinahe schmerzhaft. Ich glaubte, er würde mir die Hand küssen, und hatte mich schon zu ihm geneigt, aber er drückte mir nur noch einmal die Hand und sah mir mit seinem festen, heiteren Blick gerade in die Augen.
Ich hatte ihn seit sechs Jahren nicht gesehen und fand ihn sehr verändert. Er war älter, dunkler ge-worden und trug einen starken Bart, der ihm nicht gut stand; aber er hatte dasselbe einfache, offene, ehrliche Wesen wie früher und dasselbe Gesicht mit den kräftigen Zügen, den klugen, blitzenden Augen und einem freundlichen, beinahe kindlichen Lächeln.
Nach fünf Minuten hatte er aufgehört, unser Gast zu sein, und war für uns alle ein Familienglied, selbst für unsere Leute, deren Diensteifer bewies, wie sehr sie sich über seine Ankunft freuten.
Er benahm sich nicht wie unsere anderen Nachbarn, die, wenn sie nach dem Tode unserer Mutter kamen, für nötig hielten, zu schweigen und zu weinen, solange sie bei uns blieben; er war im Gegenteil gesprächig, heiter und erwähnte die Mutter mit keinem Wort, so daß ich diese Gleichgültigkeit anfangs sonderbar und von einem so nahestehenden Freunde sogar unpassend fand. Später aber sah ich ein, daß es nicht Gleichgültigkeit, sondern Aufrichtigkeit war, und dankte ihm dafür.
Abends setzte sich Katja zum Tee-Einschenken auf den alten Platz im Salon, wie es bei Mama der Fall gewesen war.
Ich und Sonja setzten uns neben sie, der alte Grigorij brachte Sergej Michailowitsch eine von des Vaters Pfeifen, und wie in früheren Zeiten fing er an, im Zimmer hin und her zu gehen.
„Wie viele traurige Veränderungen hier im Hause ─ wenn ich bedenke!“ sagte er plötzlich, indem er stehenblieb.
„Ja“ antwortete Katja mit einem Seufzer, deckte den Samowar zu und machte ein Gesicht, als ob sie weinen wollte.
„Sie erinnern sich wohl Ihres Vaters?“ fragte er, zu mir gewandt.
„Wenig!“ gab ich zur Antwort.
„Wie gut wäre es jetzt für Sie, wenn Sie ihn hätten!“ sagte er leise und nachdenklich, indem er auf meine Stirn niedersah. „Ich habe Ihren Vater sehr liebgehabt“, fügte er noch leiser hinzu, und ein feuchter Glanz kam in seine Augen.
„Der liebe Gott hat ihn uns genommen!“ rief Katja, legte die Serviette auf die Teekanne und fing an zu weinen.
„Ja, traurige Veränderungen sind hier vorgegangen!“ wiederholte er und wandte sich ab. „Sonja, zeige mir deine Spielsachen“, sagte er nach einer Pause und ging in den Saal hinaus. Mit Augen voll Tränen sah ich Katja an, als er hinausging.
„Das ist ein treuer Freund!“ sagte sie.
„Ja, gewiß!“ antwortete ich, und es wurde mir eigen-tümlich wohl und warm zumute bei dem Mitgefühl dieses fremden, guten Menschen.
Aus dem Saale klangen Sonjas Stimmchen und sein Scherzen mit ihr zu uns herein. Ich schickte ihm den Tee, und dann hörten wir, daß er sich ans Klavier setzte und mit Sonjas Händen auf die Tasten schlug.
„Maria Alexandrowna!“ rief er nach einer Weile. „Bitte kom-men Sie her, spielen Sie etwas.“
Es freute mich, daß er so einfach, freundschaftlich-befehle
risch mit mir sprach. Ich stand auf und ging zu ihm.
„Spielen Sie dies“, sagte er, indem er in einem Heft das Adagio der Beethovenschen Sonate quasi una fantasia aufschlug. „Lassen Sie sehen, wie Sie spielen“, fügte er hinzu und begab sich mit seinem Teeglas an das andere Ende des weiten Saales.
Ich fühlte ─ ich weiß nicht aus welchem Grunde ─, daß es unmöglich war, sein Verlangen abzuschlagen oder Vorbemerkungen über schlechtes Spiel zu machen.
Gehorsam setzte ich mich ans Klavier und fing an zu spielen, so gut ich konnte; übrigens fürchtete ich sein Urteil, denn ich wußte, daß er ein Musikfreund und -kenner war.
Das Adagio sprach dieselben Gefühle der Erinne-rung aus, die durch das Gespräch am Teetisch in mir wachgerufen waren, und mein Vortrag schien ihm zu genügen. Das Scherzo dagegen ließ er mich nicht spielen.
„Nein, das spielen Sie nicht gut“, sagte er herantretend.
„Lassen Sie's lieber. Das erste war nicht schlecht. Sie scheinen Verständnis für Musik zu haben.“
Dieses maßvolle Lob erfreute mich so sehr, daß ich errötete.
Es war mir neu und angenehm, daß Sergej Michailo-witsch, der Freund meines Vaters, ernsthaft und wie ein Gleichgestellter mit mir sprach, statt mich wie früher als Kind zu behandeln.
Katja ging hinauf, Sonja zu Bert zu bringen, und wir beide blieben allein im Saale.
Er erzählte mir von meinem Vater, wie er ihn kennengelernt und wie heiter sie miteinander verkehrt hatten, während ich noch bei meinen Schulbüchern und Spielsachen gesessen hatte. In seinen Erzählungen trat mir mein Vater zum ersten Male einfach als liebenswürdiger Mensch entgegen, wie ich ihn anzusehen bis jetzt noch nicht gelernt hatte. Später befragte er mich über meine Liebhabereien, meine Lektüre, wollte wissen, was ich jetzt vorzunehmen gedachte, und gab mir verschiedene Ratschläge. Er war nicht mehr mein heiterer, scherzender Spielkamerad, sondern ein ernster, einfacher, warmherziger Mann, der mir Achtung und Zuneigung einflößte. Mir war leicht und angenehm zumute, und doch fühlte ich einen gewissen Zwang, wenn ich mit ihm sprach. Ich fürchtete für jedes meiner Worte und wollte die Neigung, die ich jetzt nur dadurch erworben hatte, daß ich meines Vaters Tochter war, durch eigene Kraft verdienen.
Nachdem Katja mein Schwesterchen Sonja schlafen gelegt hatte, gesellte sie sich wieder zu uns und beklagte sich bei Sergej Michailowitsch über meine fast krankhafte Teilnahmslosigkeit, von der ich ihm nichts gesagt hatte.
„Die Hauptsache hat sie mit also nicht erzählt!“ sagte er und schüttelte halb lächelnd, halb vorwurfsvoll den Kopf.
„Was ist davon zu erzählen?“ antwortete ich. „Das ist sehr langweilig, und es geht vorüber.“ ─ Mir schien es wirklich, als ob mein Trübsinn nicht nur vergehen würde, sondern als ob er schon verginge oder nie vorhanden gewesen sei.
„Es ist schlimm, die Einsamkeit nicht ertragen zu können“, sagte er. „Sind Sie denn ein wohlerzogenes Fräulein?“
„Freilich bin ich ein solches Fräulein“, gab ich lächelnd zur Antwort.
„Nein! Ein schlechtes Fräulein, das nur lebt, solange man ihm huldigt, und zusammensinkt und an nichts mehr Freude hat, alles nur für andere, nichts für sich selbst.“
„Sie haben eine schöne Meinung von mir", antwortete ich, nur um etwas zu sagen.
„Nein“, sagte er nach kurzem Schweigen, „nicht umsonst sind Sie Ihrem Vater so ähnlich! Es steckt etwas in Ihnen...“, und sein guter, aufmerksamer Blick tat mir wohl und versetzte mich in freudige Verwirrung.
Erst jetzt bemerkte ich diesen nur ihm eigentümlichen Blick, der anfangs so heiter schien und dann immer forschender und selbst etwas traurig wurde.
„Sie sollen und Sie können sich nicht langweilen“, sagte er.
„Sie haben die Musik, für die Sie Verständnis haben, Bücher, Studien aller Art ─ vor Ihnen liegt das ganze Leben, auf das Sie sich nur jetzt vorbereiten können, wenn Sie später nichts zu bereuen haben wollen. In einem Jahr schon ist es zu spät.“
Er sprach mit mir wie ein Vater oder Onkel. Ich fühlte, wie er sich Mühe gab, sich mit mir auf gleichen Fuß zu stellen.
Es kränkte mich, daß er glaubte, sich zu mir herablassen zu müssen, und es war mir auch wieder schmeichelhaft, daß er für nötig hielt, um meinetwillen anders zu sein als sonst.
Den Rest des Abends sprach er mit Katja über Geschäftssachen.
„Und nun leben Sie wohl, meine lieben Freundinnen", sagte er schließlich, indem er aufstand, zu mir trat und meine Hand faßte.
„Wann sehen wir uns wieder?“ fragte Katja.
„Im Frühling“, antwortete er und hielt noch immer meine Hand. „Jetzt gehe ich nach Danilowka (unser zweites Landgut), sehe zu, wie es dort steht, richte ein, was ich kann, und begebe mich dann ─ auch wegen meiner eigenen Angelegenheiten ─ nach Moskau. lm Sommer sehen wir uns öfter.“
„Warum wollen Sie so lange fort?“ fragte ich betrübt. Ich hatte schon gehofft, ihn täglich zu sehen, und war über das Fehlschlagen dieser Hoffnung so bestürzt, daß meine ganze Mutlosigkeit wiederkehrte.
Wahrscheinlich drückte sich dies in meiner Stimme und meinem Blick aus, denn Sergej Michailowitsch sagte: „Ja, Sie müssen sich mehr beschäftigen, dürfen nicht wieder schwermütig werden.“ Dabei war sein Ton, wie mir schien, viel zu ruhig und kalt.
„Im Frühling werde ich Sie prüfen“, fügte er hinzu, ließ meine Hand fallen und sah mich nicht an.
Im Vorzimmer, wohin wir ihn begleitet hatten, be-eilte er sich, den Pelz anzuziehen, und vermied noch immer, mich anzusehen.
Warum gibt er sich diese unnötige Mühe? dachte ich. Ist's möglich, daß er glaubt, es wäre mir so ange-nehm, wenn er mich ansieht? Er ist ein guter Mensch ─ ein sehr guter ─, aber das ist auch alles!
Diesen Abend konnten Katja und ich lange nicht einschlafen und sprachen immer wieder ─ nicht von ihm, sondern wie wir den künftigen Sommer verle-ben und wo und wie wir den nächsten Winter zubringen würden. Die trostlose Frage: warum? kam mir nicht in den Sinn. Es schien mir klar und selbstverständlich, daß wir leben, um glücklich zu sein ─ und in der Zukunft sah ich Glück in Fülle. Unser altes, finsteres Haus in Pokrowskoje war plötzlich wie von Licht und Leben erfüllt.
II. KAPITEL
Der Frühling kam, und mein Trübsinn verschwand und verwandelte sich in schwärmerisches Sehnen voll unklarer Hoffnungen und Wünsche. Ich lebte jetzt ganz anders als bisher, beschäftigte mich bald mit Sonja, bald mit Musik, bald mit meinen Büchern, ging oft in den Garten, irrte lange, lange in den Alleen umher oder saß auf einer Bank, dachte an Gott weiß was, träumte und hoffte. Zuweilen blieb ich ganze Nächte lang ─ besonders im Mondschein ─ am Fenster meines Zimmers oder schlüpfte, in einen Mantel gehüllt, heimlich, daß es Katja nicht bemerkte, in den
Garten hinaus und wanderte im Tau am Teich entlang; einmal ging ich sogar ins Feld und lief allein in der nächtlichen Stille um den ganzen Garten herum.
Es fällt mir schwer, mich jetzt der Träumereien, die damals meine Phantasie erfüllten, zu erinnern und sie festzuhalten. Selbst wenn ich mich darauf besinne, wird es mir schwer zu glauben, daß dies wirklich meine Träume waren ─ so seltsam waren sie und so ganz dem Leben entrückt.
Ende Mai kehrte Sergej Michailowitsch, wie er versprochen hatte, von seiner Reise zurück.
Zu uns kam er das erste Mal an einem Abend, an dem wir ihn nicht erwarteten. Wir saßen auf der Terrasse und wollten eben Tee trinken. Der ganze Garten war schon grün, im Gebüsch hatten sich die Nachtigallen eingenistet, um die Petrifastenzeit zu feiern. Die struppigen Flieder-sträucher waren über und über mit Weiß und Lila besät. Die Blüten wollten eben aufbrechen. Das durchsichtige Laub der Birkenallee wurde von der untergehenden Sonne durchleuchtet. Die Terrasse lag im kühlen Schatten. Reich-licher Nachttau breitete sich über die Grasflächen. Vom Hof klangen die letzten Tageslaute und die Stimmen der heimgetriebenen Herde herüber; der einfältige Nikon fuhr mit der Wasser-tonne längs der Terrasse hin, und der kalte Strahl aus seiner Gießkanne bildete auf der frisch umgegrabenen Erde dunkle Kreise um die Stäbe der Georginen. Auf der Terrasse blitzte und brodelte der blank geputzte Samowar, und auf der weißen Serviette standen Sahne, Brezeln und anderes Ge-bäck. Katja spülte mit ihren rundlichen Händen in ihrer häuslichen Weise die Tassen. Ich konnte ─ da mich nach dem Bade hungerte ─ den Tee nicht erwarten und aß im voraus Brot mit frischer dicker Sahne. Ich trug eine leinene Bluse mit offenen Ärmeln und hatte über das nasse Haar ein weißes Tuch gebunden.
Katja war die erste, die den Ankommenden erblickte.
„Ach, Sergej Michailowitsch!“ sagte sie. „Wir haben eben von Ihnen gesprochen.“
Ich sprang auf und wollte flüchten, um mich um-zukleiden, aber er hielt mich an, als ich eben in die Tür schlüpfte.
„Wozu die Umstände auf dem Lande?“ sagte er, indem er mein Kopftuch lächelnd ansah. „Sie genieren sich doch nicht vor Grigorij, und ich bin wirklich für Sie nichts anderes als er.“
Mir kam es freilich vor, als ob er mich in anderer Weise ansähe, als es Grigorij tat, und ich fühlte mich befangen.
„Ich komme gleich wieder“, antwortete ich und machte mich von ihm los.
„Was haben Sie gegen Ihren Anzug?“ rief er mir nach.
„Sie sehen aus wie ein Bauernmädchen.“
Wie sonderbar er mich angesehen hat! dachte ich, während ich mich oben eilig umkleidete. Gott sei Dank, daß er wieder da ist ─ nun wird sich unser Leben heiterer gestalten.
Nachdem ich mich im Spiegel betrachtet hatte, lief ich vergnügt die Treppe hinunter, und ohne verber-gen zu wollen, daß ich mich beeilt hatte, trat ich atemlos auf die Terrasse.
Er saß am Tisch und sprach mit Katja über Geschäftssachen. Als er mich erblickte, lächelte er, fuhr aber mit seinem Bericht fort. Seinen Mitteilungen nach befanden sich unsere Angelegenheiten im besten Stande. Wir sollten nur noch den Sommer auf dem Lande zubringen und dann zu Sonjas Erziehung entweder nach Petersburg gehen oder ins Ausland.
„Ja, wenn Sie mit uns ins Ausland reisen wollten!“ sagte Katja. „Allein würden wir uns vorkommen, als ob wir uns im Wald verirrt hätten.“
„Ach, wie gerne reiste ich mit Ihnen um die Welt!“ antwortete er halb scherzend, halb im Ernst.
„Gut denn“, sagte ich, „lassen Sie uns eine Reise um die Welt antreten.“
Er lächelte und schüttelte den Kopf.
„Und mein Mütterchen, und meine Geschäfte?“ antwortete er. „Aber lassen wir das ─ erzählen Sie mir lieber, wie Sie gelebt haben. Waren Sie wieder verdrießlich?"
Als ich ihm erzählte, daß ich mich eifrig beschäftigt und gar nicht gelangweilt hätte, und als Katja meine Worte bestätigte, lobte er midı und liebkoste mich mit Worten und Blicken, als ob ich ein Kind wäre und er ein Recht dazu hätte. Mir kam es wie etwas Notwendiges vor, ihm alles Gute, was ich getan hatte, ausführlich und offenherzig mitzuteilen, ihm aber auch alles, womit er unzufrieden sein konnte, wie in der Beichte zu gestehen.