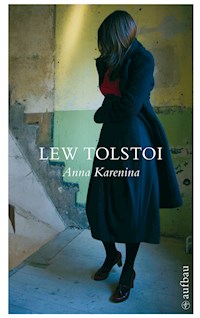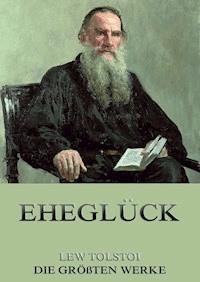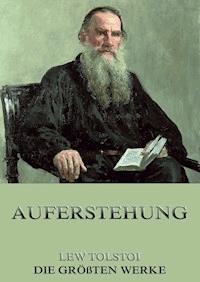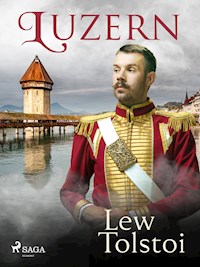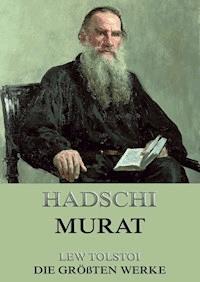
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tolstoj erzählt in seiner unnachahmlichen Art vom Schicksal eines Kameraden im Kaukasus-Krieg Mitte des 19. Jahrhunderts.
Das E-Book Hadschi Murat wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hadschi Murat
Lew Tolstoi
Inhalt:
Lew Nikolajewitsch Tolstoi – Biografie und Bibliografie
Hadschi Murat
Vorrede
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Hadschi Murat, L. Tolstoi
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849624439
www.jazzybee-verlag.de
Lew Nikolajewitsch Tolstoi – Biografie und Bibliografie
Berühmter russ. Schriftsteller, geb. 9. Sept. (28. Aug.) 1828 im Gouv. Tula auf seines Vaters Besitzung Jasnaja Poljana, erhielt daselbst eine gute häusliche Erziehung und bezog 1843 die Universität Kasan, wo er ein Jahr orientalische Sprachen und zwei Jahre die Rechte studierte. 1848 machte er in Petersburg das juristische Kandidatenexamen und begab sich dann wieder nach Jasnaja Poljana in die Einsamkeit und Stille des Dorfs zurück. Bei einer Reise in den Kaukasus (1851) fand er am militärischen Leben Gefallen und trat in das Heer ein. Man nahm ihn als Junker in die 4. Batterie der 20. Artilleriebrigade am Terek auf, wo er bis zum Beginn des türkischen Krieges blieb. Während des Krieges befand er sich bei der Donauarmee des Fürsten Gortschakow, beteiligte sich am Gefecht an der Tschernaja (16. Aug. 1855) und war beim Sturm auf Sebastopol 8. Sept. (27. Aug.). Nach Beendigung des Krieges nahm er seinen Abschied, hielt sich mehrere Jahre abwechselnd in St. Petersburg und Moskau auf, reiste zweimal ins Ausland und zog sich endlich 1861 wieder auf sein väterliches Gut Jasnaja Poljana zurück, wo er, nachdem er 1862 Sophie Behr, die Tochter eines Moskauer Arztes, geheiratet, in größter Zurückgezogenheit und Einfachheit lebte. Durch seine beiden großartigen Romane: »Krieg und Frieden« (1865–69, 4 Bde.; deutsch von Strenge, 2. Aufl., Berl. 1888; von Roskoschny, das. 1891; ferner von L. A. Hauff, das. 1893, 2. Aufl. 1905, und in Reclams Universal-Bibliothek; franz., Par. 1879) und »Anna Karenin« (1874–76, 3 Bde.; deutsch von Graff, Berl. 1890; von Hauff, das. 1892; von Helene Mordaunt, das. 1896; auch in Reclams Universal-Bibliothek; franz., Par. 1885), von denen der erstere die Zeit der Napoleonischen Kriege behandelt, der andre in der russischen Gegenwart spielt, hat sich T. einen Ehrenplatz in der modernen russischen Literatur erworben. Er ist ein vortrefflicher Erzähler, der die echte epische Ruhe besitzt und die Sprache meisterhaft handhabt. Schon vor Abfassung des erstern der beiden genannten Romane schrieb er eine Reihe bedeutsamer Erzählungen und Novellen, und zwar: »Kindheit« (1852), mit den Fortsetzungen »Knabenzeit« (1854) und »Jünglingsjahre« (1855–57); ferner 1852: »Der Morgen des Gutsbesitzers«, »Die Kosaken« und »Der Überfall«; sodann während des Krimkriegs die Trilogie »Sewastopol im Dezember 1854, im Mai 1855, im August 1855« und »Der Holzschlag« (1855); 1856: »Aufzeichnungen eines Marqueurs«, »Zwei Husaren«, »Der Schneesturm« und »Die Begegnung im Detachement«; 1857: »Luzern« und »Albert«; 1859: »Drei Todesarten«, »Das Familienglück«; 1860: »Polikuschka«; 1861: »Der Leinwandmesser«. Bis zum Beginn der Abfassung des Romans »Krieg und Frieden« 1864 und dann wiederum nach dessen Vollendung beschäftigte sich T. vorzugsweise mit Volkspädagogik; er errichtete auf seinem Gut eine »freie Schule«, veröffentlichte in seiner Zeitschrift »Jasnaja Poljana« zahlreiche volkserzieherische Abhandlungen (»Über Volksbildung« etc.), die zum Teil eine lebhafte Polemik hervorriefen, und schrieb unter anderm ein Lesebuch in 4 Teilen (1870), das 1904 bereits die 23. und 26. Auflage erlebte. In die Jahre 1873–76 fällt die Abfassung seines zweiten Hauptwerks: »Anna Karenin«, worauf er, von dichterischen Arbeiten sich mehr abwendend, theologische Studien trieb und sich an die Übersetzung und Auslegung der Evangelien machte (vollständig nur als Manuskript; daraus: »Kurze Auslegung des Evangeliums«, Genf 1890; »Vereinigung und Übersetzung der vier Evangelien«, das. 1892 bis 1894, 3 Tle.; ferner Lond. 1892–94, 2 Tle.). In den 1880er Jahren schrieb er dann außer einer Anzahl für das Volk bestimmter kleinerer, tief humaner, von christlichem Geist getragener Erzählungen (fast sämtlich deutsch von W. Goldschmidt in »Volkserzählungen des Grafen Leo T.« in Reclams Universal-Bibliothek) verschiedene theologische, moralphilosophische und soziologische Abhandlungen: »Meine Beichte« (in Rußland nur als Manuskript zirkulierend; Lond. o. J., Genf 1889); »Worin besteht mein Glaube?« (in Rußland nur als Manuskript zirkulierend; Genf [2. Aufl.] 1892; Lond. 1892); »Worin besteht das Glück« (1882), »Was sollen wir also tun?« (1884–1885) etc. sowie die psychologisch meisterhafte Novelle »Der Tod Iwan Iljitschs« (1885) und das auch auf deutschen Bühnen mehrfach ausgeführte dramatische Sittengemälde »Die Macht der Finsternis« (1887). Bedürfnislosigkeit und Nächstenliebe vom Menschen fordernd, betätigt T. seine Lehren dadurch, daß er, unter Bauern lebend, selber wie ein Bauer arbeitet und jeden nach Kräften mit Rat und Tat unterstützt. Von neuern Werken nennen wir: die Novelle »Die Kreuzersonate« (mit Epilog, 1890 u. ö.), auf die als eine Entgegnung sein Sohn Lew Lwowitsch »Ein Präludium Chopins« veröffentlichte (Stuttg. 1898, Berl. 1899), das satirische Lustspiel »Früchte der Bildung« (letzte Ausg., Berl. 1896), die Erzählung »Herr und Arbeiter« (1895), »Politik und Religion« (Berl. 1894), »Das Himmelreich« (das. 1894, 2 Bde.), »Christentum und Patriotismus« (Genf 1895, Berl. 1896), »Briefe an einen Polen« (das. 1896), »Patriotismus oder Friede« (das. 1896), »Was ist die Kunst?« (1897, und die Fortsetzung »Über die Kunst«) und endlich den Roman »Auferstehung« (1897), der den Heiligen Synod veranlaßte, T. 21. (6.) März 1901 aus der griechisch-orthodoxen Kirche zu exkommunizieren. Von Tolstojs »Antwort an den Synod« wurde die deutsche Übersetzung (Anhang zu Tolstojs Broschüre »Der Sinn des Lebens«) im Oktober 1901 in Leipzig beschlagnahmt. Von seinen neuesten Schriften seien genannt: »Besinnet Euch! (Tut Buße.) Ein Wort zum russisch-japanischen Krieg« (deutsch von Löwenfeld, Jena 1904), »Shakespeare. Eine kritische Studie« (deutsch von M. Enckhausen, Hannov. 1906), worin er die Größe und Bedeutung Shakespeares zu erschüttern sucht, und »Die Bedeutung der russischen Revolution« (deutsch von A. Heß, Oldenb. 1907), in der er seinen Ansichten über die jüngsten Ereignisse in seinem Vaterland Ausdruck verleiht. Von den Gesamtausgaben von Tolstojs Werken ist die vollständigste 1889–1900 in Moskau in 16 Bänden erschienen. Eine neue Ausgabe, die auch die von der russischen Zensur verbotenen Schriften enthält, erscheint seit 1901 in Christchurch (England, bis jetzt Bd. 1–2, 6–10). Übersetzt worden sind die einzelnen Schriften Tolstojs in alle Kultursprachen, außerdem sogar ins Chinesische; seine »Gesammelten Werke« wurden in deutscher Übersetzung herausgegeben von R. Löwenfeld (Berl. 1891, Jena 1907) und von H. Roskoschny (Tolstojs »Gesammelte Schriften«, das. 1891 ff.). Ungemein zahlreich sind die Schriften über T. und seine Werke, sowohl die von Russen (Strachow, Drushinin, A. Grigorjew, D. Pissarew, Gromeka, Obolenskij, Bulgakow, Skabitschewskij, Mereschkowskij [deutsch, Leipz. 1903], Sergejenko [deutsch, Berl. 1900] etc.) als auch die von Nichtrussen: de Vogüé (»Le roman russe«, Par. 1886), Lion, Badin, Dupuis, Ralston, G. Dumas, Laart de la Faille, Steiner (Lond. 1904); von Deutschen: J. Schmidt, W. Henckel, Löwenfeld (Berl. 1892), Glogau (Kiel 1893), Anna Seuron (Berl. 1895), Ettlinger (das. 1899), E. Zabel (Leipz. 1901), E. H. Schmitt (das. 1901), Esther Axelrod (Stuttg. 1901), J. Hart (Berl. 1904) u. a. Vgl. seine »Biographie und Memoiren«, herausgegeben von P. Birukow, durchgesehen von L. Tolstoj (Bd. 1: Kindheit und frühes Mannesalter, Wien 1906). Sein Bildnis s. Tafel »Klassiker der Weltliteratur IV« (Bd. 12).
Hadschi Murat
Vorrede
Ich ging quer über die Felder nach Hause. Es war mitten im Hochsommer. Das Heu auf den Wiesen war bereits abgeerntet, und man ging daran, den Roggen zu mähen.
Es gibt um diese Zeit eine köstliche Auswahl von Feldblumen: da sind die in Rot, Weiß oder Rosa prangenden, duftigen, flaumig-weichen Kleeblüten, und die milchweißen, angenehm herb riechenden Sterne der Kamille mit dem grellgelben Kreis in der Mitte, und der gelbblühende Ackersenf mit seinem Honiggeruch, die schlanken, tulpenartigen, lila oder weiß gefärbten Glockenblumen, die kriechenden Wicken, die gelben, roten und rötlichen Skabiosen, der ins Bläuliche spielende kolbenförmige Wegerich mit dem leicht rosig angehauchten Flaum und dem kaum merklichen feinen Aroma, die anfänglich, zumal in der Sonne, hellblauen, später nachdunkelnden und zuletzt ins Rötliche übergehenden Kornblumen und die zarten, nach Mandeln duftenden, rasch welkenden Winden.
Ich hatte einen großen, in allen möglichen Farben prangenden Strauß gesammelt und ging nach Hause, als ich im Graben eine prächtige himbeerfarbene, in voller Blüte stehende Distel erblickte, von der Art, die man bei uns zu Lande »Tatarendistel« nennt und beim Mähen vorsichtig umgeht, falls sie jedoch zufällig von der Sense getroffen wird, sorgfältig aus dem Heu aufliest, damit man sich an den Stacheln nicht verwunde. Ich kam auf den Gedanken, diese Distel zu pflücken und mitten in meinen Strauß zu setzen. Ich stieg in den Graben hinab, trieb eine zottige Hummel, die sich in der Blüte festgesogen hatte und darin süß und sanft entschlummert war, von ihrem weichen Plätzchen und machte mich daran, die Blüte zu pflücken.
Das war jedoch keineswegs leicht: nicht nur, daß der stachlige Stengel, selbst nachdem ich meine Hand mit dem Taschentuch umwickelt hatte, nach meinen Fingern stach: er war auch so widerstandsfähig und fest, daß ich wohl fünf Minuten lang förmlich mit ihm kämpfte und jede Faser einzeln durchreißen mußte. Als ich die Blume endlich gepflückt hatte, war der Stengel schon ganz zerfetzt und zerfasert, und auch die Blüte selbst schien nicht mehr so frisch und schön, überdies paßte sie mit ihrer plumpen, groben Form nicht recht unter die übrigen zarten Blüten des Straußes. Ich bedauerte, die Blume, die an ihrem Platze recht schön gewesen war, unnützerweise abgerissen zu haben, und warf sie fort. »Welche Energie, welche Lebenskraft steckte doch in dieser Blume!« ging es mir durch den Sinn, als ich an die Anstrengungen dachte, die es mich gekostet hatte, sie zu pflücken. »Wie verzweifelt hat sie sich gewehrt, wie teuer ihr Leben verkauft!«
Der Weg zum Hause führte über frisch gepflügtes, schwarzes, fettes Brachfeld. Ich schritt auf der staubigen, dunklen Straße daher, einen flachen Abhang hinauf. Das gepflügte Land gehörte zum Gute und war sehr groß: zu beiden Seiten, wie auch nach vorn, sah man nichts als schwarzes, gleichmäßig durchfurchtes, noch nicht geeggtes Ackerland. Der Pflug hatte hier gute Arbeit geleistet, nirgends auf dem weiten Felde sah man auch nur ein Pflänzchen, einen Grashalm, alles war gleichförmig schwarz.
»Was für ein zerstörungssüchtiges Wesen ist doch der Mensch, wieviel lebende Organismen mannigfachster Art vernichtet er, um sein eignes Leben zu erhalten!« dachte ich, während ich unwillkürlich nach irgendeiner Spur von Vegetation inmitten dieses toten schwarzen Feldes ausschaute. Vor mir, rechts vom Wege, erblickte ich etwas wie einen kleinen Strauch. Als ich näher heranging, sah ich, daß es gleichfalls eine Tatarendistel war, von derselben Art wie jene, die ich vorhin um ihren Blütenschmuck gebracht hatte.
Die Distelstaude bestand aus drei Stengeln. An dem einen war die Blüte abgerissen, und der Stumpf starrte in die Luft wie ein Arm, dessen Hand abgehauen war. Die beiden andern Stengel trugen jeder eine Blüte. Diese Blüten waren einstmals rot gewesen, jetzt aber waren sie ganz schwarz. Der eine Stengel war geknickt, und die obere Hälfte mit der unansehnlichen Blüte an der Spitze hing herab; der andere Stengel war zwar von schwarzer Erde beschmutzt, doch ragte er immer noch gerade empor. Man sah, daß ein Rad über den ganzen stacheligen Busch hinweggegangen war, daß er sich dann aber wieder aufgerichtet hatte, wenn auch nicht ganz, denn er stand ziemlich schief, aber er stand doch jedenfalls, wie ein Mensch, dem ein Stück Fleisch aus dem Leibe gerissen, dem die Eingeweide umgekehrt, ein Arm ausgerenkt, ein Auge ausgestochen worden, der aber immer noch dasteht und dem Feinde nicht weicht, dessen Hiebe alle seine Brüder ringsum niedergemäht haben.
»Welche Energie!« dachte ich – »alles hat der Mensch hier besiegt, Millionen von Kräutern und Gräsern hat er vernichtet, und nur dieses eine leistet ihm Widerstand.« Und ich erinnerte mich einer Geschichte aus vergangener Zeit, aus der Epoche der Kaukasuskämpfe, die ich zum Teil miterlebt hatte, zum Teil aus den Schilderungen anderer Augenzeugen kannte und zum Teil aus der Phantasie ergänzte. Diese Geschichte, wie sie in meiner Erinnerung und meiner Vorstellung sich gestaltet hat, lasse ich hier folgen.
Erstes Kapitel
Es war an einem kalten Novemberabend des Jahres 1851, als Chadschi Murat in das etwa zwanzig Werst von der russischen Grenze entfernte, von einer unruhigen Bevölkerung bewohnte Tschetschenzendorf Machket geritten kam.
Das ganze Dorf war von dem herb duftenden Rauche des Kuhdüngers angefüllt, der in jener Gegend als Brennmaterial benutzt wurde. Der langgedehnte Gesang des Muezzin war soeben verstummt, und in der reinen Bergluft vernahm man deutlich, durch das Brüllen der Kühe und das Blöken der Schafe hindurch, die soeben über die gleich den Zellen einer Honigwabe aneinander gereihten Gehöfte des Dorfes verteilt wurden, die Kehllaute streitender männlicher Stimmen und die Unterhaltung der Frauen und Kinder unten am Springbrunnen.
Dieser Chadschi Murat war der durch seine kühnen Heldenstücke berühmte Nahib Schamyls, der nie anders als mit seinem Feldzeichen ausritt und stets von einigen Dutzend fanatischer Muriden umgeben war, die um ihn herum auf kühne Reckenart ihre Rosse tummelten. Diesmal jedoch ritt er, in seinen Baschlyk und seinen Filzmantel gehüllt, nur von einem einzigen Muriden begleitet, daher und suchte offenbar möglichst unerkannt zu bleiben. Die Mündung seiner Büchse lugte unter dem Mantel hervor. Seine scharf blickenden schwarzen Augen bohrten sich in das Gesicht jedes einzelnen Dorfbewohners ein, der ihm in den Weg kam.
Als Chadschi Murat in die Mitte des Dorfes gekommen war, ritt er nicht auf der Hauptstraße weiter, die nach dem Markte führte, sondern bog links in eine schmale Seitengasse ein. Er ritt bis zu der zweiten, auf halber Höhe des Berges in den Abhang eingegrabenen Hütte der Gasse, hielt sein Pferd an und sah sich um. Unter dem Schutzdache vor der Hütte war niemand zu sehen. Auf dem Dache jedoch, hinter dem frisch mit Lehm beworfenen Schornstein, lag unter einem Schafpelz ein Mann. Chadschi Murat stieß den auf dem Dache Liegenden mit dem Schaft seiner Reitpeitsche an und schnalzte mit der Zunge. Unter dem Schafpelz hervor kam ein alter Mann in einer Nachtmütze und einem fettglänzenden, abgetragenen Beschmet zum Vorschein. Die wimperlosen Augen des Alten waren rot und entzündet, und um sie zu öffnen, mußte er mehrmals heftig blinzeln. Chadschi Murat murmelte den üblichen Gruß: Salem aleikum!und enthüllte sein Gesicht. » Aleikum salem murmelte der Alte lächelnd mit dem zahnlosen Munde, nachdem er Chadschi Murat erkannt und sich auf den mageren Beinen emporgerichtet hatte. Dann zog er nicht ohne Mühe seine neben dem Schornstein stehenden Pantoffeln mit den Holzabsätzen an, steckte, ohne sich zu beeilen, die Arme durch die Ärmel seines ruppigen, nicht überzogenen Pelzes und kletterte auf der an das Dach gelehnten Leiter mit dem Gesäß voran vom Dache hinunter. Während er sich anzog und hinabkletterte, bewegte er beständig den auf einem dünnen, runzeligen, wettergebräunten Halse sitzenden Kopf hin und her und schmatzte mit dem zahnlosen Munde. Als er auf der Erde war, nahm er dienstfertig Chadschi Murats Pferd am Zügel und wollte ihm den rechten Steigbügel halten. Doch der gewandte, stämmige Muride, der mit Chadschi Murat gekommen war, sprang rasch vom Pferde, schob den Alten zur Seite und faßte statt seiner den Bügel. Chadschi Murat stieg vom Pferde und trat leicht hinkend unter das Schutzdach. Aus der Tür der Hütte kam ihm flink ein etwa fünfzehnjähriger Knabe entgegen, der mit seinen schwarzen, an reife Glanzkirschen erinnernden Augen voll Erstaunen auf die Ankömmlinge sah.
»Geh nach der Moschee und ruf den Vater,« befahl ihm der Alte. Dann ging er Chadschi Murat voran und öffnete ihm die knarrende Tür der Hütte.
Während Chadschi Murat die Schwelle überschritt, kam aus der nach dem Innern der Hütte führenden Tür eine nicht mehr junge, schlanke, hagere Frau in einem roten Beschmet über dem gelben Hemd und blauen Pluderhosen mit einigen Kissen heraus.
»Dein Eingang sei gesegnet«, sagte sie, verneigte sich tief und bereitete an der Vorderwand für den Gast einen Sitz aus den Kissen.
»Langes Leben sei deinen Söhnen beschieden,« antwortete Chadschi Murat, nahm den Filzmantel, die Flinte und den Säbel ab und übergab alles dem Alten. Der Alte hing die Büchse und den Säbel vorsichtig an ein paar Nägel neben die an der Wand hängenden Waffen des Hausherrn, zwischen zwei große Becken, die an der glatt beworfenen und sauber geweißten Wand glänzten. Chadschi Murat schob seine über den Rücken gehängte Pistole zurecht, schritt auf die Kissen zu, schlug die Schöße der Tscherkeska zurück und setzte sich auf die Kissen. Der Alte hockte neben ihm auf seine nackten Fersen nieder, schloß die Augen und hob die Arme mit den ausgestreckten Händen empor. Chadschi Murat tat das Gleiche; dann strichen beide, ein Gebet hersagend, sich mit den Händen über das Gesicht und vereinigten sie am Ende des Bartes.
» Ne chabar?« fragte Chadschi Murat den Alten – das heißt soviel wie: Was gibt's Neues?
» Chabar ick – gar nichts,« antwortete der Alte, während er mit seinen roten, leblosen Augen nicht in Chadschi Murats Gesicht, sondern auf seine Brust sah. »Ich lebe draußen im Bienengarten, und bin heute nur hergekommen, um einmal nach meinem Sohne zu sehen. Er weiß mehr.«
Chadschi Murat begriff, daß der Alte nicht sagen wollte, was er wußte, und was Chadschi Murat gleichfalls wissen mußte. Er nickte leicht mit dem Kopfe und fragte nicht weiter.
»Angenehme Neuigkeiten wenigstens gibt es nicht,« fuhr der Alte dann fort. »Nur so viel wüßte ich, daß die Hasen noch immer beraten, wie sie die Adler verjagen sollen. Die Adler aber zerfleischen bald den einen, bald den andern von ihnen. In der vorigen Woche haben die russischen Hunde den Leuten in Migiz die Heuschober verbrannt, der Schädel soll ihnen zerplatzen«, sprach der Alte grimmig mit seiner heiseren Stimme.
Der Muride Chadschi Murats trat ein. Mit den kräftigen Beinen weit ausschreitend, ging er kaum hörbar über den aus festgestampfter Erde hergerichteten Estrich, nahm gleich Chadschi Murat Filzmantel, Büchse und Säbel ab und hing alles, nur den Dolch und die Pistole bei sich behaltend, an dieselben Nägel, an denen bereits die Waffen Chadschi Murats hingen.
»Wer ist das?« fragte der Alte Chadschi Murat, indem er auf den Eintretenden zeigte.
»Das ist mein Muride. Eldar ist sein Name,« sagte Chadschi Murat.
»Es ist gut,« sprach der Alte und wies Eldar einen Platz auf einer Filzdecke neben Chadschi Murat an.
Eldar setzte sich, schlug die Beine übereinander und ließ seine schönen, an die eines Widders erinnernden Augen auf dem Gesichte des gesprächig gewordenen Alten ruhen. Der Alte erzählte, daß in der Woche vorher ein paar wackere Burschen aus dem Dorfe zwei Soldaten gefangen genommen hätten, den einen hätten sie getötet und den anderen nach Wedeno zu Schamyl geschickt. Chadschi Murat hörte zerstreut zu, blickte nach der Tür und horchte auf die Laute, die von außen her in die Hütte drangen. Unter dem Schutzdache vor der Hütte ließen sich Schritte vernehmen, die Tür knarrte, und der Hausherr trat ein.
Sado, der Besitzer der Hütte, war ein Mann von etwa vierzig Jahren, mit einem kleinen Bärtchen, langer Nase und ebensolchen, wenn auch nicht so glänzenden Augen wie sein fünfzehnjähriger Sohn, der jetzt hinter dem Vater in die Hütte trat und sich neben die Tür niederkauerte. Der Hausherr zog an der Tür seine Holzschuhe aus, schob die alte, schäbige Lammfellmütze auf dem schon lange nicht rasierten, mit schwarzem kurzem Haar bewachsenen Kopfe in den Nacken zurück und hockte sich Chadschi Murat gegenüber auf die Fersen nieder.
Gleich dem Alten schloß auch Sado die Augen, hob die Arme mit ausgestreckten Händen empor, sprach ein Gebet, fuhr mit den Händen über sein Gesicht hin und begann erst dann zu reden. Er erzählte, daß von Schamyl ein Befehl eingegangen sei, sich Chadschi Murats, ob lebendig oder tot, zu bemächtigen. Gestern erst seien Schamyls Abgesandte fortgeritten, und da das Volk es nicht wage, Schamyl zu trotzen, so sei jedenfalls die größte Vorsicht geboten.
»In meinem Hause«, sagte Sado, »wird, solange ich lebe, meinem Gastfreunde nichts geschehen. Was wird aber geschehen, wenn du ins Feld hinausreitest? Das ist zu erwägen!«
Chadschi Murat hörte aufmerksam zu und nickte beifällig mit dem Kopfe. Als Sado geendet hatte, sagte er:
»Es ist gut. Ich brauche jetzt gleich einen Boten, der den Russen einen Brief überbringt. Einer meiner Muriden wird hinreiten; nur hinführen soll ihn der Bote.«
»Ich kann meinen Bruder Bata mitschicken,« sagte Sado.
»Geh, hol' doch einmal Bata hierher,« wandte er sich zu seinem Sohne. Der Knabe schnellte empor, als wenn er Sprungfedern in den flinken Beinen hätte, und lief, die Arme hin und her schwenkend, rasch aus der Hütte. Zehn Minuten später kehrte er mit einem sehnigen, kurzbeinigen, von der Sonne ganz dunkel gebrannten Tschetschenzen zurück, der eine in allen Nähten geplatzte gelbe Tscherkeska mit zerfransten Ärmeln und ein Paar schlecht sitzende schwarze Lederstrümpfe trug. Chadschi Murat begrüßte den Eintretenden und begann sogleich, ohne viele Worte zu verlieren:
»Kannst du meinen Muriden zu den Russen führen?«
»Ja, das kann ich,« antwortete Bata munter. »Warum soll ich's nicht können? Kein Tschetschenze bringt ihn so sicher hin wie ich. Ein anderer würde dir alles Mögliche versprechen und gar nichts ausführen. Ich bring' ihn aber sicher hin.«
»Gut,« sagte Chadschi Murat. »Für deine Mühe erhältst du drei Silberrubel,« sagte er und hielt ihm drei Finger vor die Augen. Bata nickte, zum Zeichen, daß er ihn verstanden habe, mit dem Kopfe. Er fügte jedoch hinzu, es komme ihm nicht auf das Geld an, er tue es nur wegen der Ehre, Chadschi Murat zu dienen. Man kenne Chadschi Murat in den Bergen sehr gut und wisse, wie wacker er auf die russischen Schweine losgeschlagen habe.
»Es ist gut,« sagte Chadschi Murat. »Ein guter Strick ist lang, eine gute Rede aber kurz.«
»Nun, ich bin schon still«, sagte Bata.
»Kennst du die Stelle, wo der Argun gegenüber dem steilen Abhange die Wendung macht? Dort liegt eine Waldwiese, zwei Heuschober stehen darauf ...«
»Ja, ich kenne die Stelle.«
»Dort erwarten mich drei meiner Berittenen,« sagte Chadschi Murat.
» Aija,« sprach Bata und nickte mit dem Kopfe.
»Frag' nur nach Chan Mahoma. Chan Mahoma weiß, was zu tun und zu sagen ist. Ihn sollst du zum Fürsten Woranzow, dem russischen Befehlshaber, führen. Kannst du das?«
»Ja, ich werde ihn hinführen.«
»Hinführen und auch wieder zurückführen – kannst du das?«
»Ja, das kann ich.«
»Du führst ihn zurück und kommst mit ihm wieder nach der Waldwiese. Dort werde ich inzwischen eintreffen.«
»Alles werde ich tun,« sagte Bata, erhob sich, kreuzte die Arme über der Brust und ging hinaus.
»Nun muß ich auch noch einen Mann nach Tschechi schicken«, sagte Chadschi Murat zu dem Hausherrn, als Bata hinausgegangen war. »In Tschechi ist folgendes auszurichten ...«, fuhr er fort, während er an einer der an seiner Tscherkeska befestigten Patronen zu nesteln begann. Er ließ jedoch die Hand sogleich wieder sinken und schwieg, als er zwei Frauen erblickte, die in die Hütte eintraten. Die eine von ihnen war Sados Gattin, – dieselbe hagere, nicht mehr junge Frau, die vorhin die Kissen gebracht hatte. Die andere war ein noch ganz junges Mädchen in roten Pluderhosen und grünem Beschmet, mit einem Schmuck aus Silbermünzen, der die ganze Brust bedeckte. Am Ende ihres nicht sehr langen, dicken schwarzen Zopfes, der zwischen ihren Schultern über den schmalen Rücken herabhing, war ein Silberrubel befestigt. Sie hatte dieselben munter blinkenden schwarzen Kirschenaugen wie ihr Vater und ihr Bruder, suchte jedoch ihrem jugendlichen Gesichte einen strengen Ausdruck zu geben. Sie blickte die Gäste nicht an, doch sah man sogleich, daß sie ihre Anwesenheit fühlte.
Sados Gattin brachte einen niedrigen, runden, kleinen Tisch, auf dem sich Tee, Honig, Käse, Maiskuchen, Süßbrot und Butterfladen befanden. Das junge Mädchen trug ein Becken, eine Metallkanne und ein Handtuch herbei.
Sado und Chadschi Murat schwiegen, während die Frauen, in ihren weichen roten Schuhen unhörbar hin und her schreitend, den Tisch vor den Gästen bereitstellten. Eldar saß die ganze Zeit über, da die Frauen in der Hütte weilten, unbeweglich wie eine Statue auf seinem Platze und hielt die schönen Widderaugen auf die gekreuzten Beine geheftet. Erst als die Frauen hinausgegangen und ihre weichen Schritte hinter der Tür verhallt waren, atmete er erleichtert auf. Chadschi Murat faßte nun wieder nach der Patrone an seiner Tscherleska, zog zuerst die Kugel heraus und nahm dann einen zusammengerollten Zettel aus der Hülse.
»Das ist für meinen Sohn bestimmt«, sagte er, auf den Zettel zeigend.
»Wohin soll die Antwort gebracht werden?« fragte Sado.
»Zu dir, und du wirst sie mir geben.«
»Das soll geschehen,« sagte Sado und verbarg den Zettel in seiner Tscherkeska. Dann nahm er mit beiden Händen die Kanne und schob das Becken vor Chadschi Murat hin. Chadschi Murat streifte die Ärmel seines Beschmets an den muskulösen weißen Armen bis oberhalb der Handgelenke auf und hielt seine Hände unter den kristallklaren, kühlen Wasserstrahl, den Sado aus der Kanne herausfließen ließ. Das Gleiche tat hierauf auch Eldar. Während die Gäste aßen, saß Sado ihnen gegenüber und dankte ihnen immer wieder für ihren Besuch. Der an der Tür sitzende Knabe wandte seine blitzenden schwarzen Augen von Chadschi Murat nicht einen Augenblick ab und lächelte, als wollte er durch sein Lächeln die Worte des Vaters bestätigen.
Obschon Chadschi Murat seit vierundzwanzig Stunden nichts genossen hatte, aß er doch nur ein wenig Käse und Brot. Mit dem kleinen Messer, das er unter seinem Dolche hervorzog, nahm er etwas Honig, den er sich auf das Brot strich.
»Wir haben sehr schönen Honig, seit Jahren hatten wir nicht mehr so viel und so guten Honig,« sagte der Alte, offenbar stolz darauf, daß Chadschi Murat von seinem Honig aß.
»Ich danke,« sagte Chadschi Murat und hörte auf zu essen. Eldar hatte wohl noch Hunger, doch folgte er dem Beispiel seines Murschid, rückte vom Tische ab und reichte Chadschi Murat das Becken und die Kanne.
Sado wußte, daß er sein Leben aufs Spiel setzte, indem er Chadschi Murat bei sich aufnahm, da nach Ausbruch des Streites zwischen Schamyl und Chadschi Murat an alle Einwohner der Tschetschna, unter Androhung der Todesstrafe, das Verbot ergangen war, Chadschi Murat zu beherbergen. Er wußte, daß die Bewohner des Dorfes jeden Augenblick von der Anwesenheit Chadschi Murats in seinem Hause erfahren und seine Auslieferung verlangen konnten. Doch das machte Sado keineswegs bange. Er hielt es für seine Pflicht, einen Gast zu beschützen, selbst wenn es ihn sein Leben kosten sollte, und es erfüllte ihn mit Genugtuung und Stolz, sich sagen zu können, daß er so handelte, wie es seine Pflicht gebot.
»Solange du in meinem Hause weilst und mein Kopf mir noch zwischen den Schultern sitzt, wird niemand dir etwas anhaben,« sprach er zu Chadschi Murat.
Chadschi Murat sah ihm in die blitzenden Augen, und als er darin las, daß Sados Worte aufrichtig gemeint waren, sprach er mit einiger Feierlichkeit:
»Freude und langes Leben mögen dir zuteil werden.«
Sado kreuzte schweigend die Arme über der Brust zum Zeichen seines Dankes für die wohlmeinenden Worte.
Nachdem er die Fensterläden geschlossen und im Kamin Holz nachgelegt hatte, verließ er in ganz besonders froher und angeregter Stimmung das Gastzimmer und begab sich nach jenem Teil der Behausung, in dem die Seinigen wohnten. Die Frauen schliefen noch nicht, sondern sprachen von den gefährlichen Gästen, die im Gastzimmer nächtigten.
Zweites Kapitel
In derselben Nacht hatten drei Soldaten und ein Unteroffizier die fünfzehn Werst von dem Dorfe, in dem Chadschi Murat nächtigte, entfernte Festung Wosdwischenskoje durch das Schachgerinische Tor verlassen. Die Soldaten trugen kurze Pelze nebst Fellmützen und bis über die Knie reichende Stiefel, wie sie damals die kaukasischen Soldaten zu tragen pflegten; der gerollte Mantel war über den Rücken gehängt. Die Soldaten marschierten zunächst mit dem Gewehr über der Schulter auf der Straße daher; nach etwa fünfhundert Schritten bogen sie ab, gingen, mit den Stiefeln das trockene Laub aufwühlend, noch etwa zwanzig Schritte nach rechts und machten neben einer umgebrochenen Platane, deren Stamm auch im nächtlichen Dunkel noch sichtbar war, halt. An dieser Platane wurde in der Regel ein Geheimposten ausgestellt.
Die funkelnden Steine, die, solange die Soldaten durch den Wald marschierten, über die Baumwipfel dahin zu eilen schienen, hatten jetzt gleichfalls halt gemacht und blinkten hell zwischen den entlaubten Zweigen der Bäume hindurch. »Da wären wir,« sagte der Unteroffizier Panow trocken, während er das lange Gewehr mit dem aufgepflanzten Bajonett von der Schulter nahm und gegen einen Baumstamm lehnte, daß es nur so klirrte. Die drei Soldaten folgten seinem Beispiel.
»Nun hab' ich sie weiß Gott verloren!« sagte Panow ärgerlich. »Entweder habe ich sie zu Hause vergessen, oder sie ist mir unterwegs herausgefallen.«
»Was suchst du denn?« fragte einer der Soldaten mit munterer, kecker Stimme.
»Meine Pfeife – weiß der Teufel, wo ich sie gelassen habe!«
»Hast du wenigstens das Pfeifenrohr?« fragte dieselbe Stimme.
»Ja, hier ist's.«
»Wart, dann wollen wir gleich Abhilfe schaffen, du kannst aus der Erde rauchen.«
Es war eigentlich verboten, auf dem Geheimposten zu rauchen, aber dieser Geheimposten hier war eigentlich gar kein solcher, sondern eher eine vorgeschobene Wache, die lediglich darauf zu achten hatte, daß die Bergbewohner nicht, wie es früher geschehen war, unbemerkt ihr Geschütz an die Festung heranbrächten und diese beschössen. Panow sah nicht ein, weshalb er sich unter solchen Umständen das Vergnügen des Rauchens versagen sollte, und so ging er auf den Vorschlag des munteren Soldaten ohne weiteres ein. Der Soldat nahm sein Messer aus der Tasche und grub damit ein Loch in dem Waldboden aus. Nachdem er die Erde an allen Seiten glatt angedrückt hatte, setzte er das Pfeifenrohr hinein, füllte das Loch mit Tabak, drückte ihn fest hinein, und die Pfeife war fertig. Das Feuerzeug blitzte auf und erhellte für einen Augenblick das knochige Gesicht des Soldaten, der auf dem Bauche dalag. Ein Pfeifen ließ sich in dem Rohre vernehmen, und Panow zog mit Behagen den angenehmen Duft des glimmenden Tabakes ein.
»Na, hast du es fertig gebracht?« fragte er den Soldaten.
»Und ob – da, sieh doch!« antwortete dieser.
»Bist doch ein tüchtiger Kerl, Awdjejew – ein ganz durchtriebener Bursche.«
Awdjejew rückte zur Seite, um Panow Platz zu machen.
Während noch eine letzte Rauchwolke seinem Munde entstieg, legte Panow sich lang hin auf den Bauch, wischte das Mundstück des Pfeifenrohres mit dem Ärmel ab und begann drauflos zu dampfen.
Als alle der Reihe nach drangewesen waren, kamen sie ins Gespräch.
»Der Kompagniechef soll wieder mal in die Kasse gegriffen haben. Mächtig viel soll er verspielt haben,« sagte einer der Soldaten in lässigem Ton.
»Er wird's schon zurückgeben,« meinte Panow.
»Gewiß doch, er ist ein braver Offizier«, bestätigte Awdjejew.