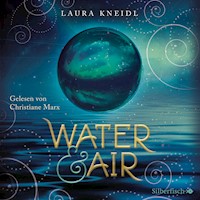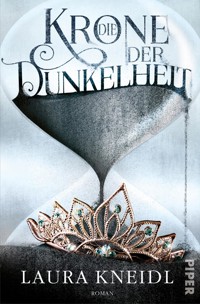
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Magie ist in Thobria, dem Land der Menschen, verboten – doch Prinzessin Freya wirkt sie trotzdem. Und das nicht ohne Grund. Vor Jahren wurde ihr Zwillingsbruder entführt und seitdem versucht Freya verzweifelt, ihn zu finden. Endlich verrät ihr ein Suchzauber, wo er sich aufhält: in Melidrian, dem sagenumwobenen Nachbarland, das von magischen Wesen und grausamen Kreaturen, den Elva, bewohnt wird. Gemeinsam mit dem unsterblichen Wächter Larkin begibt sich Freya auf den Weg dorthin und muss ungeahnten Gefahren ins Auge blicken. Zur selben Zeit setzt die rebellische Ceylan alles daran bei den Wächtern aufgenommen zu werden, welche die Grenze zwischen Thobria und Melidrian schützen. Ihr gesamtes Dorf wurde einst von blutrünstigen Elva ausgelöscht, und Ceylan sehnt sich nicht nur nach Rache, sondern möchte auch um jeden Preis verhindern, dass so etwas noch einmal geschieht. Doch ihr Ungehorsam bringt sie bei den Wächtern immer wieder in Schwierigkeiten, bis sie schließlich bestraft wird: Sie soll als Repräsentantin an der Krönung des Fae-Prinzen teilnehmen. Dafür muss sie nach Melidrian reisen, in ein Land, in dem es vor Feinden nur so wimmelt. Und während sich die beiden Frauen ihrem Schicksal stellen, regt sich eine dunkle Macht in der Anderswelt, welche Thobria und Melidrian gleichermaßen bedrohen wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
© Piper Verlag GmbH, München 2018
Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München.
www.ava-international.de
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Covermotiv: Guter Punkt, Miriam Verlinden unter Verwendung von shutterstock und thinkstock
Illustrationen: Gabriella Bujdosó
Karte: Markus Weber
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses EBooks sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Prolog – Weylin
Teil 1
1. Kapitel – Freya
2. Kapitel – ein Unbekannter
3. Kapitel – Freya
4. Kapitel – Ceylan
5. Kapitel – Freya
6. Kapitel – ein Unbekannter
7. Kapitel – Ceylan
8. Kapitel – Freya
9. Kapitel – Ceylan
10. Kapitel – Freya
11. Kapitel – Ceylan
12. Kapitel – Freya
13. Kapitel – Ceylan
14. Kapitel – Freya
15. Kapitel – Ceylan
16. Kapitel – Larkin
17. Kapitel – Ceylan
18. Kapitel – Freya
19. Kapitel – Ceylan
20. Kapitel – Freya
21. Kapitel – Ceylan
22. Kapitel – Freya
Teil 2
23. Kapitel – Kheeran
24. Kapitel – Freya
25. Kapitel – Weylin
26. Kapitel – Ceylan
27. Kapitel – Freya
28. Kapitel – Weylin
29. Kapitel – Freya
30. Kapitel – Kheeran
31. Kapitel – Freya
32. Kapitel – Larkin
33. Kapitel – Ceylan
34. Kapitel – Freya
35. Kapitel – Weylin
36. Kapitel – Freya
Teil 3
37. Kapitel – Ceylan
38. Kapitel – Kheeran
39. Kapitel – Freya
40. Kapitel – Weylin
41. Kapitel – Freya
42. Kapitel – Larkin
43. Kapitel – Kheeran
44. Kapitel – Ceylan
45. Kapitel – Kheeran
46. Kapitel – Ceylan
47. Kapitel – Freya
48. Kapitel – Weylin
49. Kapitel – Kheeran
50. Kapitel – Weylin
51. Kapitel – Freya
52. Kapitel – Kheeran
53. Kapitel – Weylin
54. Kapitel – Freya
55. Kapitel – Ceylan
Glossar
Danksagung
Für Verena
Prolog – Weylin
– Daaria –
Vor achtzehn Jahren
Die Luft in Daaria, der Heimatstadt der Seelie, schmeckte nach Asche, und der Wind trug den Geruch von Rauch mit sich. Lautlos betrat Weylin den Innenhof des Schlosses, in dem sich zahlreiche Fae tummelten, denn Königin Valeska hatte zum Fest geladen. In teure Gewänder gehüllt standen ihre Gäste beisammen, tauschten sich über die neuste Mode aus – goldene Ringe, welche die gesamte Länge ihrer spitzen Ohren zierten – und spekulierten über die jüngsten Angriffe der Elva – bestialische Wesen, die ihr Unwesen außerhalb der Stadt trieben –, als hätten sie Erfahrung im Kampf. Bedienstete des Hofes schwirrten währenddessen über den Platz, schenkten süßen Wein nach und reichten raffinierte Häppchen aus rohem Fisch und gegartem Fleisch. Zwei Schausteller tanzten über den Platz und erschufen mithilfe ihrer Magie und einiger Fackeln komplexe Skulpturen aus Feuer, deren Hitze Weylin sogar aus mehreren Fuß Entfernung spüren konnte.
Kaum einer der Anwesenden bemerkte ihn, und jene achtsamen Fae, die ihn dennoch wahrnahmen, wandten ihre Blicke eilig von ihm ab. Denn er war nicht wie sie. Er war ein Halbling. Ein Schatten. Ein Niemand. In ihren Augen hatte er keine Beachtung verdient. Und wäre da nicht seine schneeweiße Haut gewesen, hätte er mit seinen schwarzen Haaren und der dunklen Uniform wohl vollständig mit dem Mauerwerk verschmelzen können. Denn das Schloss im Herzen von Daaria war aus finsterem Vulkanstein errichtet worden und gehörte ohne Zweifel zu den beeindruckendsten Bauwerken des Landes. Selbst wenn Weylin seinen Kopf in den Nacken legte, konnte er die sechzehn Turmspitzen kaum ausmachen, auf denen das Ewige Feuer brannte – Flammen, die nie erloschen – als Zeichen für die niemals endende Macht des Königshauses.
Weylin allerdings brauchte keine Erinnerung an die Macht der Königin. Er spürte sie jeden Tag am eigenen Leib und sah sie im Spiegel, wenn er seinen Rücken betrachtete. Zwar waren die Wunden des Blutschwurs seit langer Zeit verheilt, doch noch heute konnte er die wulstige Narbe sehen, die in der Form eines Dreiecks unter seinem Nacken saß. Sie zeichneten ihn nicht nur als Sklaven, sondern vor allem als Verfluchten. Er hatte keine andere Wahl, als Valeska zu dienen.
An diesem Abend hatte sie ihn in ihre Gemächer bestellt, und das konnte nur zwei Dinge bedeuten: Entweder würde er heute Nacht das Bett mit ihr teilen oder für sie morden. Beide Möglichkeiten waren ihm zuwider. Hätte er eine Wahl, würde er lieber eine ganze Armee mit seinen bloßen Händen töten, als noch einmal in das Bett dieser Frau zu steigen. Doch Valeska liebte es, auch im Schlafgemach die Oberhand zu haben, und niemand war gehöriger als ein Blutsklave, der gezwungen war, jedem Wort aus ihrem Mund zu gehorchen.
Weylin erschauderte, und obwohl er es nicht wollte, trugen ihn seine Füße durch das Schloss, bis zu einer Flügeltür, die mit goldenen Ornamenten verziert war. Zwei Fae aus der Leibgarde flankierten das Schlafgemach der Königin. Anders als Weylin besaßen sie das typisch rote Haar der Seelie. Doch im Gegensatz zu den meisten Fae ihrer Art trugen sie es nicht lang, sondern kurz geschoren, so wie der Kodex der Garde es verlangte.
Die Blicke der Wachmänner waren starr geradeaus gerichtet, und sie reagierten auf Weylins Anwesenheit ebenso wenig wie all die anderen Fae. Was hatte er auch erwartet? Eine freundliche Begrüßung? Ein Lächeln? Nein, ein Halbling wie er war dergleichen nicht wert, denn er war nicht mehr als ein Spielzeug in den Händen der Königin. Doch sie schienen über seine Ankunft informiert zu sein, denn ohne ihn aufzuhalten, ließen sie ihn vorbeiziehen. Er stieß die Türen zu den königlichen Gemächern auf. Der Raum, der sich nun vor ihm auftat, versetzte ihn jedes Mal aufs Neue ins Staunen. Er war viel größer als das Zimmer, das er in der Libelle bewohnte, einer Taverne unweit des Schlosses. Und die Wände waren so hoch, dass sie jedem Geräusch ein Echo verliehen, obwohl sie mit roten Stoffen in den verschiedensten Schattierungen kunstvoll verziert waren. Schwarze Felle mit kurzen Borsten an den Beinen und langen Zotteln am Rücken, die von wilden Elva stammten, schmückten als Teppiche den Boden. Dem Schlafgemach schlossen sich ein Waschraum und ein Kleiderzimmer an, dessen Inhalt wertvoll genug war, um ein ganzes Stadtviertel davon zu ernähren.
Wie von selbst richtete sich Weylins Blick auf das große Himmelbett, in dem er schon zu oft gelegen hatte. Valeska rekelte sich nicht darin, was er als ein gutes Zeichen wertete. Stattdessen stand die Königin an einem geöffneten Fenster und betrachtete ihren Garten, der ein Kunstwerk in sich war mit seinen geschwungenen Kieswegen, den dunklen Bäumen und den Blumenbeeten, deren Farben an flüssige Lava erinnerten. Die Blüten verbreiteten einen herben Duft, der selbst den Geruch der Asche zu verdrängen vermochte, der aufgrund der brodelnden Berge auf der Vulkanhöhe stets über der Stadt zu hängen schien.
Die Königin rührte sich nicht und nahm Weylins Anwesenheit mit keinem Wort zur Kenntnis. Ihm war es nicht gestattet, zuerst zu sprechen, und Valeska wusste das. Sie kostete dieses Machtspiel jedes Mal aus. Doch selbst wenn er das Wort hätte ergreifen dürfen, so hatte er der Königin nichts zu sagen.
Schweigend trat er neben sie an das Fenster. Er konnte das Fest im Innenhof von hier aus nicht sehen, aber hören. Ein Musiker hatte begonnen auf einer Laute zu spielen, und das nicht sonderlich gut, wie Weylin feststellte. Er fragte sich, wie es dieser Fae überhaupt an den Hof geschafft hatte. Er schien noch nicht einmal zu bemerken, dass sein Instrument verstimmt war.
Weylin schnaubte über diesen Mangel an Talent und konnte spüren, wie das leise Geräusch Valeskas Aufmerksamkeit auf ihn lenkte. »Du bist spät dran«, sagte sie schließlich. »Ich mag es nicht, wenn man mich warten lässt.«
Weylin blickte die Königin an, und ein Lächeln trat auf seine Lippen, obwohl dies das Letzte war, was er wollte. Doch dieses Lächeln gehörte nicht ihm. Es war ein fremdes Lächeln, das sich jedes Mal auf sein Gesicht drängte, wenn er der Königin begegnete. »Ich bitte um Verzeihung.«
Eine Lüge.
Valeska nickte und wandte sich ihm vollständig zu. Eines musste man der Königin lassen, so hässlich ihr Inneres war, so hinreißend war ihr Äußeres. Ihr faltenfreies Gesicht war ein Meisterwerk der Ebenmäßigkeit, und ihre vollen Lippen und grünen Augen verliehen ihr ein jugendliches Aussehen. Das Haar fiel Valeska in roten Locken über die Schultern und umspielte die Ansätze ihrer Brüste.
»Was kann ich für Euch tun, Eure Hoheit?«
Valeska stieß ein Lachen aus, das in Weylins Ohren viel zu schrill klang, und schritt mit erhobenem Kinn in Richtung ihres Bettes, dessen Anblick ausreichte, um Übelkeit in ihm aufsteigen zu lassen. »Wieso so förmlich, Weylin? Wir sind doch unter uns.«
Nein, sind wir nicht, dachte er. Seit er das Zimmer betreten hatte, spürte er die Anwesenheit einer dritten Person. Das Lächeln, das er tragen musste, wenn er die Königin ansah, fiel in sich zusammen, als er seinen Blick durch den Raum gleiten ließ. In der dämmrigen Ecke, die am weitesten von ihm entfernt war, konnte er ein Flimmern in der Luft erkennen, wie es häufig an heißen Tagen zu sehen war. Aber das, was Weylin nun betrachtete, war kein Trugbild der Natur, es war ein magischer Schleier aus Luftmagie gewoben. Und nur wer wusste, wonach er suchte, konnte den Zauber durchschauen.
»Kommt raus, Samia!« Ihr Name klang wie ein Knurren aus Weylins Mund. »Ich weiß, dass Ihr hier seid.«
»Das hat aber lange gedauert«, antwortete eine rauchige Stimme aus dem Nichts, und im nächsten Moment verdichtete sich die zitternde Luft zu einer Gestalt, die ein Gewand aus weißen, grauen und schwarzen Federn trug. Samia hatte bereits Valeskas Vater gedient und gehörte seither zu den engsten Vertrauten der Familie. Und vermutlich gab es im ganzen Land keine zweite Fae wie sie, denn Samia war vollkommen farblos. Für gewöhnlich setzte der Alterungsprozess bei den Fae erst mit fünfhundert Jahren ein, aber Samias rotes Haar war schon vor dieser Zeit ergraut. Ihre Haut war aschfahl, und ihre eigentlich grünen Augen färbte sie sich mit einer speziellen Tinktur rabenschwarz. Sie erinnerten Weylin jedes Mal an den Schlund eines Vulkans. »Du wirst unzuverlässig.«
»Und Ihr seid keine Gefahr«, sagte Weylin gelangweilt. Er hasste die Spielchen der Fae und ihren ständigen Drang, ihre Macht und Magie unter Beweis stellen zu müssen. Er blickte zur Königin, die ihr kurzes Wortgefecht mit einem amüsierten Lächeln beobachtet hatte. Er hätte es ihr am liebsten aus dem Gesicht geschlagen. »Was wollt Ihr von mir, Eure Hoheit?«
Die Königin schritt noch immer durch den Raum. Sie erzeugte keinen Laut, und es war, als würde sie über den Boden schweben, und womöglich tat sie dies auch. Ebenso wie Samia konnte Valeska über das Element Luft herrschen. Nur war ihre Magie wesentlich stärker. Valeska verfügte über eine Macht, von der Weylin nur träumen konnte. Doch seinen Mangel an Elementarmagie glich er mit seinem Können als Krieger aus. Schließlich war er nicht ohne Grund der Schatten der Königin geworden.
»Ich habe einen Auftrag für dich«, sagte die Königin.
»Er ist von höchster Wichtigkeit«, ergänzte Samia.
»Lasst mich raten, Ihr hattet wieder einen Traum?«, fragte Weylin.
Samia schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Keinen Traum, eine Vision der Zukunft.«
Natürlich. Weylin richtete seinen Blick auf die Königin, sodass der Schwur ein Lächeln hervorbrachte, das es ihm ermöglichte, seine wahren Gedanken vor der Seherin zu verbergen. Einige Fae waren von den Göttern der Anderswelt nicht nur mit der Magie der Elemente gesegnet worden, sondern hatten zusätzliche Gaben erhalten. Sie konnten die köstlichsten Speisen zaubern, die großartigsten Geschichten erzählen und die lebhaftesten Bilder zeichnen. Weylin selbst gehörte ebenfalls zu den Beschenkten. Er war von den Göttern mit einem Talent für die Musik bedacht worden. Noten waren seine zweite Sprache, und jedes Instrument, das er nicht beherrschte, konnte er innerhalb weniger Stunden lernen. Doch Samia war seit jeher die einzige Fae, die behauptete, ein Talent dafür zu haben, die Zukunft sehen zu können. Es gab Gerüchte, dass sie dafür während der Vollmonde ein Blutopfer darbringen musste.
Allerdings hielt Weylin sie bloß für eine Hochstaplerin. »Und was habt Ihr in der Vision gesehen?«
»Vor zwei Tagen hat die Königin der Unseelie einen Jungen zur Welt gebracht«, erklärte Valeska an Samias Stelle. »Samia wurde ein Einblick in seine Zukunft gewährt.«
Weylin wusste von Königin Zarinas Schwangerschaft, aber die Nachricht über die Geburt eines Sohnes hatte ihn bisher nicht erreicht, obwohl die Gäste in der Libelle Klatsch und Tratsch liebten, vor allem über das andere Faevolk. »Soll ich dem Prinzen ein Geschenk überbringen?«
»Oh nein, wir wollen den Prinzen nicht beschenken.« Samia bedachte Weylin mit einem boshaften Lächeln, das ihre dunklen Augen nicht erreichte und ihn einmal mehr daran erinnerte, wen er vor sich hatte. »Wir möchten, dass du ihn für uns tötest.«
Seine Augen weiteten sich vor Unglauben. »Ihn töten?«
Samia nickte. »Der Prinz wird mit seiner Krönung ein großes Unglück über das Land bringen.«
»Was für ein Unglück?«
»Ich weiß es nicht.« Die Seherin richtete ihren Blick an die mit Stuck verzierte Decke. Sie erkundete das Muster, als würde sie mehr darin erkennen als nur die bloße Schönheit der Handwerkskunst. »Ich habe nur Dunkelheit gesehen. Sie wird sich zuerst über Melidrian legen, dann über Thobria und schließlich über die ganze Welt. Sie wird mit ihrer Schwärze alles ersticken.«
Weylin musste sich dazu zwingen, nicht mit den Augen zu rollen. »Und deswegen muss der Prinz sterben?« In all den Jahren, die er Valeska diente, hatte er schon einige fragwürdige Aufträge für die Königin ausgeführt. Widerwillig hatte er Köpfe von Hälsen geschlagen, Gliedmaßen abgetrennt, Frauen gefoltert und Kinder verschwinden lassen. Doch der Befehl, den Thronerben der Unseelie zu ermorden, übertraf alles, was er bisher für sie getan hatte.
»Ich vertraue Samia«, sagte Valeska. Sie stand nun wieder bei Weylin und streckte die Hand aus. Ihre warmen Finger mit den samtweichen Kuppen berührten seine Haut. »Unser Land lebt schon zu lange im Frieden. Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand wie der Prinz geboren wird.«
»Ist sein Tod wirklich notwendig? König Nevan ist jung. Sein Sohn wird erst in Jahrhunderten den Thron besteigen.« Weylin spürte, wie die Narbe aufglühte, die Valeska einst mit einem feuergebundenen Dolch in seine Haut geritzt hatte. Die Königin duldete keine Einwände. Was machte es also für einen Sinn, ihr zu widersprechen, wenn er sich ohnehin nicht weigern konnte? Aber sie sprachen hier nicht von einem Aufständischen, den er im Fluss ertränken sollte, sondern von dem zukünftigen König der Unseelie. Was immer Samia gesehen hatte, konnte kaum schlimmer sein als der Krieg, der ihnen drohte, sollte jemand herausfinden, dass Valeskas Schatten für die Ermordung des Jungen verantwortlich war.
»Die Ära von König Nevan neigt sich dem Ende zu«, erklärte Samia. Sie hatte die Hände in die langen Ärmel ihres federgeschmückten Gewandes geschoben. »Die Vision hat es mir gezeigt. Der Prinz wird der jüngste König aller Zeiten, und seine Machtergreifung wird nicht lange auf sich warten lassen.«
»Weylin.« Sein Name klang wie eine Drohung. Königin Valeska lächelte ihn an, doch weder Gutmütigkeit noch Gnade spiegelten sich in ihren Augen. Er erkannte die Entschlossenheit in ihrem Blick, und er wusste, sie hatte ihr Urteil längst gefällt. »Ich habe dich nicht hierher zitiert, um deine Meinung zu hören. Es gibt nur eine Sache, die ich von dir will, nämlich dass du den Prinzen für mich aus dem Weg räumst. Hast du verstanden?«
»Natürlich, meine Königin.« Ohne sich dagegen wehren zu können, verließen die Worte Weylins Zunge, und damit besiegelte er nicht nur sein eigenes Schicksal, sondern auch das des neugeborenen Prinzen.
Teil 1
1. Kapitel – Freya
– Amaruné –
Heute
Freya umklammerte den Dolch, den sie in den Ärmel ihres Umhangs geschoben hatte, fester und beschleunigte ihre Schritte. Eigentlich gehörte Amaruné, die Hauptstadt des sterblichen Landes, zu einem der sichersten Orte von ganz Thobria. Nirgendwo anders gab es mehr Wohlstand, mehr Hochschulen für Gelehrte und mehr Akademien für die königliche Garde als hier.
Doch die Wachen patrouillierten nur in den inneren Ringen der Stadt, welche wie eine Zielscheibe angeordnet war. Das Schloss der Familie Draedon bildete das Zentrum und war mit seinen adeligen Einwohnern und wohlhabenden Bürgern besonders schützenswert. Aber je weiter man sich vom Stadtkern entfernte, desto unbedeutender wurden die Menschen, desto schäbiger die Häuser und desto ärmer die Verhältnisse. Diese äußeren Bezirke interessierten die Garde nicht; wieso einen verwahrlosten Haufen Abfall bewachen?
Dem letzten Gardisten war Freya vor fünf Querstraßen ausgewichen, als sie die Schwelle vom dritten in den vierten Ring übertreten hatte. Dieser Bezirk war bereits bei Tag kein angenehmer Ort, doch jetzt in der Dunkelheit der Nacht krochen die schändlichsten Schatten hervor. Sie lauerten in den finsteren Ecken, die vom Licht der Monde nicht erreicht wurden. Blutgeld wechselte dort seine Besitzer. Diebesgut wurde verscherbelt. Mordaufträge abgesprochen. Und verborgen hinter Tüchern, die zwischen zwei Häusern gespannt waren, bezahlten manche Frauen und Männer ihre Schulden mit dem eigenen Körper ab.
Nein, diese Seite der Stadt war bei Nacht wahrlich kein Ort für eine Prinzessin, aber mittlerweile hatte sich Freya an die verdorbene Gesellschaft und die zerfallenen Gebäude mit den schiefen Dächern gewöhnt. Nur der beißende Gestank ließ sie jedes Mal aufs Neue die Nase rümpfen, denn während die inneren Ringe bereits mit den neuartigen Abwasserkanälen ausgestattet waren, sammelte sich hier der Dreck auf der Straße.
Ihr Weg führte Freya durch ein Labyrinth aus Gassen bis in den fünften Ring. Die Straßen hier waren noch unebener, und in der Dunkelheit musste sie darauf achten, nicht über herumliegenden Unrat zu stolpern. Eigentlich hatte Freya heute nicht vorgehabt, ihre Mentorin zu besuchen. Doch während des Banketts am Abend hatte ihr Vater, König Andreus, nicht aufgehört, von Talon zu erzählen. Die Geschichten über ihn hatten bei Freya alte Wunden aufgerissen, die nie ganz verheilt waren. Ihr Herz blutete vor Sehnsucht nach ihrem Bruder – ihrem Zwilling.
Vielleicht wäre dieser Schmerz für sie leichter zu ertragen gewesen, wenn es keine Hoffnung mehr gegeben hätte; doch die gab es. Denn egal was ihre Eltern und das Volk glaubten: Talon war noch am Leben.
Freya konnte es spüren, mit jedem Atemzug und jedem Schlag ihres Herzens. Ihre Eltern hatten ihn vielleicht aufgegeben – sie jedoch nicht. Und sie war bereit, alles zu riskieren, um Talon wiederzufinden. Sollte ihr Vater jemals erfahren, dass sie sich für die Suche nach ihrem Bruder der Magie zugewandt hatte, würde er sie dafür verbrennen lassen. Und weder seine Liebe für sie noch ihr königlicher Status würden sie dann vor dem Scheiterhaufen bewahren können. Freya war das egal. Damals war sie zu feige gewesen, um Talon zu retten. Sie hatte nur an sich gedacht und ihn seinem Schicksal überlassen, aber diesen Fehler würde sie nicht noch einmal begehen.
Sie erreichte Moiras Haus, und wie erwartet brannte noch Licht in der Hütte, denn die Alchemistin arbeitete, wenn alle anderen schliefen. Freya klopfte den vereinbarten Takt gegen das morsche Holz, um sich Moira zu erkennen zu geben. Sie lauschte den Schritten, die im Inneren erklangen. Kurz darauf wurde die Tür einen Spaltbreit aufgezogen.
»Was willst du hier, Mädchen?«, fragte Moira und spähte hinter dem morschen Holz hervor. Ihre Stimme hatte einen krächzenden Klang, der Freya immer an die Schreie der Krähen erinnerte, die das Schloss umflogen.
»Guten Abend, Moira«, sagte sie und zeigte sich unberührt von der schroffen Begrüßung. Sie nahm sie nicht persönlich, denn das Leben im fünften Ring ließ jede noch so gütige Seele hart und misstrauisch werden. »Ich brauche deine Hilfe.«
Unmut spiegelte sich in Moiras Augen. Ihre Haut war dunkel gebräunt und rissig wie altes Leder. Ihr Haar, das bei ihrer ersten Begegnung mit Freya noch von tiefem Schwarz gewesen war, war inzwischen von grauen Strähnen durchdrungen. »Ich habe keine Zeit für deinen Unterricht.«
»Ich bin heute nicht als Schülerin hier.« Freya hatte damit gerechnet, dass Moira versuchen würde, sie abzuwimmeln, aber darauf war sie vorbereitet. Sie schob sich die Kapuze aus dem Gesicht, lächelte die ältere Frau an und griff in eine Tasche, die ins Innere ihres Mantels eingearbeitet war. »Ich bin hier, um einen Suchzauber zu wirken«, sagte sie und zog eine Münze hervor, die trotz des fahlen Lichts golden glänzte.
»Wie lange willst du deinem Bruder noch nachjagen?«, fragte Moira und öffnete die Tür. Sie trug ein schlichtes braunes Gewand aus Leinen mit langen Ärmeln, die ihre vernarbte Haut verdeckten.
»So lange, bis ich ihn gefunden habe«, antwortete Freya und trat ein, dankbar für die Wärme, denn zu dieser Zeit des Jahres wurden nicht nur die Tage kürzer, sondern auch die Nächte kälter.
Freya ließ ihren Blick durch das Zimmer gleiten. Oberflächlich betrachtet wirkte es gewöhnlich. Es gab ein Feldbett, einen Tisch, eine Nische zum Kochen, und im Kamin brannte ein Feuer. Allerdings war es eine Öffnung im Boden, die sich üblicherweise unter einem alten Teppich versteckte, welche dieses Haus zu etwas Besonderem machte. Eine Leiter führte in den Keller – Moiras bestgehütetes Geheimnis.
Freya legte ihren Umhang mitsamt dem Dolch ab. Darunter kam ein schlichtes Kleid zum Vorschein. Es war aus dunkelgrünem Stoff genäht, ohne Perlen und ohne Stickereien. Sie trug auch keinen Schmuck, mit Ausnahme einer goldenen Kette, an der ein runder Glasanhänger befestigt war. Im Inneren des Anhängers funkelte ein orangefarbener Schimmer. Sie hatte sich bemüht, ein bürgerliches Aussehen anzunehmen, und dennoch wirkte ihre Kleidung zu königlich für die heruntergekommene Hütte mit den knarzenden Dielen.
»Du musst lernen loszulassen«, erwiderte Moira und legte ihr eine Hand auf den Arm. Ihr Gesichtsausdruck wurde sanfter, und sie lächelte, was die Fältchen um ihren Mund tiefer erscheinen ließ.
Freya schluckte schwer und schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht loslassen, denn Talon ist nicht tot. Ich kann es spüren.«
»Ich habe nicht gesagt, dass der Junge tot ist«, meinte Moira. »Aber kam dir schon einmal der Gedanke, dass es deinem Bruder dort, wo er jetzt ist, besser gehen könnte?«
»Auf keinen Fall!«, protestierte Freya. Sie musste täglich an ihn denken, und wenn Talon nur annähernd so fühlte wie sie, wollte er gefunden werden. »Wenn Talon an diesem anderen Ort glücklicher ist, werde ich das akzeptieren, aber ich muss mich mit eigenen Augen davon überzeugen.« Freya trat neben Moira. Der Geruch von verbrannten Kräutern haftete an ihrer Kleidung. »Lass es mich versuchen. Bitte!« Sie nahm Moiras schwielige Hand in ihre, legte den Dukaten hinein und schloss ihre Finger um die Münze. »Ich will es, und du kannst das Gold brauchen.«
Moira wog das Geldstück in ihrer Hand, ehe sie es in die Schürze ihres Kleides steckte. »Einverstanden, aber du wirst den Zauber alleine durchführen.«
»Natürlich«, antwortete Freya mit einem schmalen Lächeln. Sie hatte gewusst, dass sie Moira würde überzeugen können. Ihre Mentorin hatte sie noch nie im Stich gelassen. Sie ging zu der Öffnung im Boden und stieg die Leiter hinunter. Ihre Bewegungen waren bedacht, und ein leises Ächzen entkam ihren Lippen, jedes Mal, wenn sie ihren Fuß auf eine Stufe aufsetzte.
Freya folgte ihr nach unten und fand sich in einem Raum wieder, der dieselben Umrisse hatte wie der, der über ihren Köpfen lag. Die Decke war jedoch niedriger, und statt eines Schlaf- und Kochplatzes gab es hier nur einen großen Tisch und Schränke voller Fläschchen, Gläser und Tiegel. Ein Feuer brannte in einem weiteren Kamin, dessen Schacht sich hinter dem des oberen verbarg. Darüber hing ein Kessel, in dem Kräuter kochten. Zudem stapelten sich zahlreiche Bücher über Magie und die Faevölker, deren Besitz strafbar war, auf den Regalen, die an den Wänden hingen.
»Und du bist dir absolut sicher, dass du das tun möchtest?«, fragte Moira.
Freya nickte. Was hatte sie schon zu verlieren, abgesehen von einer Münze und ihrer Hoffnung, immer und immer wieder ihrer Hoffnung. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie diesen Suchzauber ausübte. Ihre eigene Magie war allerdings noch nicht so kraftvoll wie die von Moira. Diese lernte schließlich bereits seit Jahrzehnten, sich die Überreste der Magie in Thobria zu eigen zu machen. Doch es war nicht nur Stärke, die einem Zauber seine Macht verlieh, sondern auch der Wille und das Verlangen, mit dem er durchgeführt wurde. Und auch Glück spielte hinein. Manchmal funktionierten Zauber und manchmal nicht, denn die Magie wanderte wie eine Gruppe Zugvögel. Sie lag nicht wie eine ebenmäßige Decke über Thobria, sondern wie ein zerschlissener Lumpen mit unzähligen Löchern.
Mit wachsender Ungeduld beobachtete Freya ihre Mentorin dabei, wie sie den Tisch freiräumte, an dem sie bis eben gearbeitet hatte. Sie schnüffelte an verschiedenen Korken und ordnete sie den beschrifteten Fläschchen zu, da das Vertauschen von Zutaten fatale Folgen haben könnte. Anschließend wischte sie mit einem Lappen über das fleckige Holz, ehe sie ein Messer und eine Karte von Lavarus darauflegte.
»Die Karte ist neu«, stellte Freya fest und fuhr mit ihren Fingern die harten Linien nach. Lavarus war eine riesige Insel, geteilt in das sterbliche Land Thobria im Norden und das magische Land Melidrian im Süden. Dazwischen lag das Niemandsland, das Gebiet der unsterblichen Wächter, dessen Herzstück eine Mauer war, welche Thobria und Melidrian voneinander trennte. Für Thobrias Hauptstadt Amaruné hatte der Kartograf ein kleines Schloss eingezeichnet, während im südlichen Melidrian Nihalos, die Stadt der Unseelie, von einem Mond, und Daaria, die Stadt der Seelie, von einer Sonne markiert wurden.
Moira schöpfte mit einer Schüssel etwas von dem heißen Kräuterwasser aus dem Kessel über den Flammen und stellte sie neben die Karte. »Sie hat selbst gebraucht noch ein kleines Vermögen gekostet.«
»Sie ist wunderschön.«
»Morthimer hat sie gezeichnet.«
Freya hatte bereits von Morthimer gehört. Er war für seine detailgetreuen und zugleich kreativen Karten bekannt, die manchmal mehr Kunst als Wissenschaft waren. Angeblich war er verrückt, aber wer war Freya, um über ihn zu urteilen? Das, was sie hier tat, war ebenfalls verrückt. Und verboten obendrein. Strengstens verboten, selbst für eine Prinzessin. Doch während ein Großteil der Bevölkerung die Magie verabscheute, weil sie sie an den Krieg vor tausend Jahren und die Fae erinnerte, war Freya von ihr fasziniert. Das war nicht immer so gewesen. Erst Talons Verschwinden hatte sie der Alchemie und damit der Magie nähergebracht, und seitdem gierte sie nach dieser Art von Wissen. Die Vorstellung, eine Verletzung innerhalb von Sekunden heilen, ganze Ernten mit der Bewegung einer Hand heranzüchten und die Elemente beherrschen zu können, übte einen Reiz auf Freya aus, dem sie sich nicht entziehen konnte.
»Lass uns anfangen.« Moira entzündete eine ihrer selbst gegossenen Kerzen. Augenblicklich breitete sich ein angenehmer Duft in dem kleinen Raum aus. »Was hast du mitgebracht?«
»Eine alte Notiz von Talon, die er während des Naturkunde-Unterrichts gemacht hat.« Freya bückte sich und zog ein zusammengefaltetes Stück Papier aus ihrem Stiefel. Talons Schrift war groß und zeugte von der Selbstsicherheit, die er in ihren gemeinsamen Schulstunden immer gezeigt hatte.
»Du weißt, was zu tun ist?«
Freya nickte, und ihre Hände zitterten, wie jedes Mal, wenn die Möglichkeit bestand, dass sie ihren Bruder finden könnte. Nachdem er von ihrem Vater für tot erklärt worden war, hatte Freya ihre Mutter einmal gefragt, ob sie noch Hoffnung besaß. Denn sie selbst stellte sich immer wieder vor, wie es wäre, wenn Talon zu ihnen zurückkäme. In ihren Träumen marschierte er mit erhobenem Haupt in das Schloss, und es war, als wäre kein Tag vergangen. Sie fielen einander in die Arme, und ihr Vater rief ein Fest zu Talons Ehren aus.
Doch Königin Erinna hatte ihre Frage damals verneint und gesagt, das Verständnis für den Tod und auch seine Akzeptanz würden mit dem Alter wachsen. Freya wartete bis heute darauf, dass ihre kindlichen Hoffnungen vergehen würden, aber sie waren geblieben und etwas Größeres war aus ihnen entstanden: Gewissheit.
Womöglich lag es daran, dass Talon und sie sich den Leib ihrer Mutter geteilt hatten. Oder an ihrer Freundschaft und der tiefen Verbundenheit, die sie immer füreinander empfunden hatten und die stets über reine Geschwisterliebe hinausgegangen war. Was auch immer es war, Freya spürte tief in ihrem Inneren, dass Talon noch lebte.
In Gedanken beschwor sie ein Bild ihres Zwillingsbruders hervor und versuchte sich vorzustellen, wie er heute aussehen würde mit seinen schmalen Gesichtszügen, den blonden Haaren und den blauen Augen, die ihren eigenen so ähnelten.
Mit diesem Bild im Kopf griff sie nach dem Messer und drückte die Klinge, ohne zu zögern, gegen ihren linken Mittelfinger, dessen Kuppe von den zahlreichen Suchzaubern schon ziemlich vernarbt war. Obwohl die Wunde nur klein war, begann sie dennoch sofort zu bluten, und Freya zeichnete die Skriptura – ein magisches Symbol der Alchemie – auf Talons Notizblatt. Anschließend hielt sie das Blatt über die Kerze und beobachtete, wie das Papier Feuer fing. Es ringelte sich, die Ränder wurden schwarz, und Rauch schlängelte sich durch die Luft. Freya führte den Zettel über die Schale, Asche rieselte in das Wasser und färbte es trüb.
Sie wartete, bis ihr das Feuer zu heiß wurde und an ihren Fingerspitzen leckte, erst dann ließ sie die Papierreste in die Wasserschale fallen. Mit einem Zischen erloschen die Flammen, und zurück blieben nur kleine Stücke der Notiz, an der so viele vergangene Erinnerungen hingen. Eines Tages würden ihr die Andenken an Talon ausgehen, aber sie war bereit, jedes einzelne davon zu opfern, wenn sie dadurch die Möglichkeit hatte, ihren Bruder wiederzufinden.
»Jetzt das Pendel«, sagte Moira und reichte ihr einen spitzen Kristall, der an einer Lederkordel befestigt war. Freya legte das Pendel ins Wasser, das durch das angezündete Papier auch mit dem Element Feuer und durch die Kräuter mit dem Element Erde verbunden war.
Bitte, lass es funktionieren!
Sie legte ihre Hände über die Schale und konzentrierte ihre Gedanken noch ein letztes Mal auf ihren Bruder, bevor sie die feuchte Kordel aus dem Wasser nahm, wodurch der Kristall auch noch vom vierten Element – der Luft – gestreift wurde. Sie hielt das tropfende Pendel über die Karte und versetzte es etwas in Schwung. Der Kristall folgte seiner natürlichen, rotierenden Bewegung. Freya ließ weiter ihre Erinnerungen an Talon fließen und durchlebte den Moment seiner Entführung erneut in ihren Gedanken.
Nichts geschah. Die ausladenden Kreise des Pendels wurden immer kleiner, und der Kristall wurde nicht von Magie erfasst. Wütend starrte Freya ihn an. Sie wünschte sich, er würde eine Reaktion zeigen.
Irgendeine.
Sie verlangte nicht viel, nur die Andeutung einer Himmelsrichtung, um sie wissen zu lassen, dass Talon wohlauf und in Sicherheit war. Doch ohne einen Hinweis kam das Pendel zum Erliegen. Freyas Finger krampften sich um die Kordel, und Tränen der Frustration stiegen ihr in die Augen. Sie war nicht bereit zu akzeptieren, dass sie ihre Zeit ein weiteres Mal verschwendet und ihr Leben erneut für nichts riskiert hatte.
Freya bemühte sich mit aller Kraft, sich ihre Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Sie wusste, dass das Ausbleiben der Magie nicht ihre Schuld war. Die Mauer, welche vor Hunderten von Jahren errichtet worden war, teilte den Kontinent nicht nur in zwei Länder, sondern hatte die Magie mitsamt der Fae und Elva auch aus Thobria vertrieben. Denn Magie suchte stets nach anderer Magie, und da nur noch in Melidrian übernatürliche Wesen wohnten, zog es auch die Magie dorthin. Im sterblichen Land war deshalb nur ein schwaches Echo des früheren Zaubers zurückgeblieben.
»Es tut mir leid, dass es nicht geklappt hat«, sagte Moira, die Freyas Maske des Gleichmuts durchschaut hatte. Sie schenkte ihr ein Lächeln, und in ihren Augen lag mehr Trost, als Freya bei ihrer Familie je hätte finden können. »Vielleicht funktioniert es das nächste Mal.«
»Vielleicht«, erwiderte Freya mit einen Seufzen und wollte das Pendel gerade zur Seite legen, als es auf einmal zuckte und sich erneut zu bewegen begann.
2. Kapitel – ein Unbekannter
– In der Dunkelheit –
Früher war die Dunkelheit seine Verbündete gewesen, inzwischen war sie sein Feind. Er hatte die Sonne seit einer Ewigkeit nicht gesehen, und alles, was ihm geblieben war, war das gelegentliche Licht einer aufleuchtenden Fackel.
Seit Stunden beobachtete er eine Maus dabei, wie sie sich ein Nest baute. Sie zerrte Heu aus dem Bündel, das sein Bett war, und rannte damit davon. Das kleine Tier schlüpfte einfach durch die Gitter, die ihn seit Jahren gefangen hielten, und kehrte doch wieder zurück. Die Maus musste verrückt sein, einen Ort wie diesen freiwillig aufzusuchen, aber er würde sie nicht verscheuchen, denn er mochte ihre Besuche. Tatsächlich hatte er sogar begonnen, das Heu, seine einzige Wärmequelle, manchmal selbst aus der Unterlage zu ziehen und in kleine Stücke zu zerreißen, damit es das Tier leichter hatte.
Zuerst war die Maus unsicher gewesen, aber sie war mutig und hatte seine Hilfe am Ende angenommen. Er dachte seit Tagen darüber nach, wie er sie nennen sollte. Die Maus war nicht die richtige Anrede für seine einzige Freundin, aber ihm fiel kein Name ein, denn mittlerweile erinnerte er sich nur noch selten an seinen eigenen.
3. Kapitel – Freya
– Amaruné –
Was war das? Hatte sie dem Kristall versehentlich selbst neuen Schwung verliehen? Oder war das ein Windstoß gewesen? Freya zwang sich dazu, ihre Hand ruhig zu halten, um das Zittern ihrer Finger zu verbergen. Sie hielt die Luft an, und das Blut rauschte in ihren Ohren. Ohne ihr Zutun wurden die Kreise, die das Pendel beschrieb, immer größer und ausladender, bis sie die komplette Karte umfassten.
»Es funktioniert«, murmelte Freya. Mit offen stehendem Mund betrachtete sie den Kristall und rief sich abermals ein Bild ihres Bruders vom Tag seiner Entführung in Erinnerung.
Das Pendel drehte sich schneller und schneller, bis die Bewegung so abrupt stoppte, wie sie begonnen hatte. Der Kristall zeigte jedoch nicht auf die Mitte der Karte, sondern er schwebte in der Luft.
Freya glaubte an ihrer Aufregung zu ersticken. Sie beugte sich weiter über den Tisch, denn sie konnte ihren Augen nicht trauen. Nein. Das konnte nicht sein. Talon konnte nicht …
»Nihalos«, flüsterte Moira.
Die Stadt der Unseelie.
»Das ist unmöglich.« Freyas Stimme klang atemlos, auf einmal wurde ihr ganz schwindelig, und sie ließ sich gegen die Tischkante sinken, unfähig, sich noch länger aus eigener Kraft auf den Beinen zu halten. Talon konnte nicht an einem Ort wie diesem sein. »Das Pendel muss kaputt sein.«
»Nein, ist es nicht.« Moira bewegte die Landkarte. Der Kristall folgte ihr und zeigte weiterhin auf Nihalos. Freya stieß ein Keuchen aus, und die Alchemistin legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Hat dein Vater damals auch in Melidrian nach deinem Bruder suchen lassen?«, fragte sie und streichelte ihr beruhigend den Rücken, doch die Berührung spendete Freya keinerlei Trost.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, die Garde hat jeden Winkel Thobrias nach Talon durchkämmt, aber sie sind nie nach Melidrian vorgedrungen. Es gab keinen Grund, die Fae zu verdächtigen und das Abkommen zu brechen.«
»Verstehe«, murmelte Moira gedankenverloren und tätschelte ihr noch einmal die Schulter. »Lass uns nach oben gehen. Ich glaube, wir könnten beide einen Tee brauchen.«
Vor sieben Jahren
»Mein Leben liegt in Eurer Hand. Meine Zukunft in Eurem Tun. Bewahret mich vor dem Unheil und behütet mich vor den Fae …«
»… Lehret mich und formt mich …« Freya sprach die Worte der Gläubigen mit, die vor den Mauern des Palastes knieten und beteten. Sie kannte ihre Gesichter nicht, aber sie kannte ihre Stimmen, die jeden Morgen zu einem Chor anschwollen, um der königlichen Familie ihre Ehrerbietung entgegenzubringen. »… Schützet mich und wachet über mich.«
»Hör auf damit«, mahnte Talon. »Vater ist kein Gott.«
»Wieso sagst du das?«, fragte Freya. Ihr Bruder hatte es ihr schon öfter erklärt, aber sie verstand es nicht. Ihr Vater war der mächtigste Mann des Landes, und jeder wusste, dass die Draedons für das Abkommen verantwortlich waren, das die Fae aus Thobria verbannt hatte und mit ihnen die Elva, monströse Tiere, deren einziger Instinkt es war zu töten. Ihre Familie hatte Tausenden von Menschen das Leben gerettet und bewahrte seit gut einem Jahrtausend den Frieden zwischen den Ländern. Machte sie das nicht zu Göttern?
»Vater hat noch nie eine Fae oder Elva mit eigenen Augen gesehen, geschweige denn gegen eine gekämpft. Wir sollten die Wächter an der Mauer anbeten, die jeden Tag ihr Leben riskieren, um uns zu schützen«, erklärte Talon mit fester Stimme. Seit er gemeinsam mit ihrem Vater vor einigen Wochen die Mauer besucht hatte, war er besessen von den Männern in Schwarz und ihren magiegeschmiedeten Waffen. »Wenn ich erst einmal König bin, werde ich die Königsreligion verbieten, denn es gehört sich nicht, sich mit fremden Federn zu schmücken.«
»Du würdest sie wirklich verbieten?«, fragte Freya und blickte auf Talon herab, da sie in den letzten Monaten deutlich mehr gewachsen war als er. Sie bewunderte ihn für seine Entschlossenheit und Reife und wünschte sich, sie könnte ein bisschen mehr wie ihr Zwilling sein. Er fand immer die richtigen Worte, schien alles zu wissen und fürchtete sich nicht davor, seine Gedanken laut auszusprechen. Eine eigene Meinung und der Wille, diese durchzusetzen, zeichnet einen starken König aus, doch ein wirklich guter König stellt sich niemals über sein Volk, pflegte ihr Vater stets zu sagen, und wenn er recht hatte, würde Talon der stärkste König aller Zeiten werden.
Im Kräutergarten hinter dem Schloss wartete ihr Lehrer Ocarin bereits auf sie. Ocarin war ein amüsant anzusehender Mann, wie Freya fand, mit einem dicken Bauch und dürren Beinen, die eigentlich zu schmächtig waren, um sein Gewicht zu tragen. Er hatte eine Brille auf, die zu klein für sein rundes Gesicht war, und einen Anzug an, dessen Knöpfe jederzeit wegzusprengen drohten.
»Mein Prinz, meine Prinzessin, ich habe schon auf Euch gewartet«, sagte Ocarin und erhob sich von der Bank, die vor einem reich bepflanzten Beet stand. Er bedeutete Talon und ihr, sich zu setzen, ehe er selbst wieder Platz nahm, wobei es immer Talon war, der zu seiner Rechten saß. Manchmal störte es Freya, dass sie von ihrem Vater, den Leuten am Hof und ihrem Volk als weniger wichtig erachtet wurde als Talon, weil er der Thronerbe war und nicht sie. Doch heute verschwendete sie keinen Gedanken daran. Eifrig schlug sie ihr in braunes Leder gebundenes Notizbuch auf.
»Wer von euch kann mir sagen, was das ist?«, fragte Ocarin und deutete auf eine Pflanze mit zackigen Blättern und gelben Blüten, die abzweigten wie die Äste eines Baumes.
»Liebstöckel«, antwortete Talon.
»Hervorragend«, lobte Ocarin und nickte zufrieden. »Freya, als Nächstes seid Ihr dran. Was ist das?« Dieses Mal zeigte er auf eine Pflanze mit ovalen Blättern und violetten Blüten. Freya kniff die Augen gegen die Sonne zusammen.
Sie kannte die Antwort. Sie lag ihr auf der Zunge, denn sie hatte die Namen gestern gemeinsam mit Talon in der Bibliothek geübt. Zusammen hatten sie sich ein Gedicht überlegt – »Salbei!«, platzte es aus Freya heraus.
Talon schenkte seiner Schwester ein breites, von Stolz durchzogenes Lächeln, das seine Augen zum Leuchten brachte. Sie wiederholten dieses Spiel noch ein paarmal, ehe sie gemeinsam mit Ocarin durch den Kräutergarten spazierten. Immer wieder deutete ihr Lehrer auf Pflanzen, um deren Namen zu erfahren. Anschließend erzählte er ihnen mehr über die Wirkung der Blumen und Sträucher. Freya liebte die gemeinsamen Unterrichtsstunden mit Talon, diese wurden jedoch zunehmend seltener. Denn er wurde langsam, aber stetig auf seine Rolle als zukünftiger König vorbereitet, und immer öfter musste er mit ihrem Vater verreisen, an Sitzungen teilnehmen oder Strategien lernen, von denen sie nichts wissen sollte.
Ocarin war gerade in eine Erklärung über Wacholder vertieft, als Freya sie bemerkte: vier Männer. Sie tauchten wie aus dem Nichts aus dem Schatten eines Baumes auf und ragten wie Riesen in den Himmel. Ihre schlanken und zugleich muskulösen Gestalten waren in dunkle Kleidung gehüllt, und schwarze Tücher verdeckten ihre Gesichter, aber nicht die kalten Augen, die Freya und Talon fixierten.
»Ocarin.« Freya flüsterte den Namen ihres Lehrers. Er drehte sich um und entdeckte die Krieger sofort, denn das waren sie: Krieger. Freya war noch nicht vielen von ihnen begegnet; aber sie wusste es instinktiv.
Talon packte sie und zerrte sie hinter sich. Im selben Augenblick stellte sich Ocarin vor sie. Die Arme ausgebreitet versuchte er sie vor den Männern zu schützen.
Nur wenige Fuß von ihnen entfernt blieben diese stehen, lediglich ihr Anführer trat vor. »Geh uns aus dem Weg!«
»Nein.« Ocarin schüttelte den Kopf. Seine Stimme zitterte. »Auf keinen Fall!«
Freya schlang die Arme um ihren Oberkörper und drängte sich näher an Talon heran. Er legte ihr eine Hand auf die Schulter, und sie glaubte, ihn etwas flüstern zu hören, aber sie konnte ihn nicht verstehen, all ihre Aufmerksamkeit galt den Männern vor ihr. Zwei von ihnen hatten ihre Waffen gezogen und traten nun ebenfalls nach vorne. Sie wurden eingekesselt.
»Geh uns aus dem Weg!«, wiederholte der Mann, die Härte seiner Stimme ließ Freya erschaudern. Irgendetwas an ihm war falsch, schrecklich falsch.
»Nein«, sagte Ocarin erneut.
»Ich werde mich nicht noch einmal wiederholen.« Der Anführer der Gruppe neigte den Kopf, aber niemand regte sich; auch Ocarin nicht. Bis plötzlich ein Ruck durch seinen Körper fuhr. Zuerst begriff Freya nicht, was geschehen war, bis sie die Schwertspitze entdeckte, die aus Ocarins Rücken ragte. Sie wurde wieder herausgerissen, Blut tropfte zu Boden, und ihr Lehrer sackte röchelnd in sich zusammen. Freya wollte schreien, aber sie war vor Angst wie betäubt.
»Lasst meine Schwester in Ruhe!«, hörte sie Talon wie aus der Ferne rufen. Furchtlos trat er vor sie und streckte seine Arme aus, wie Ocarin es zuvor getan hatte. Die Krieger begannen zu lachen.
»Macht Euch keine Sorgen«, sagte der Anführer. »Wir interessieren uns nicht für die Prinzessin. Wir sind Euretwegen hier, junger Prinz.«
Der zarte Duft von Melisse mischte sich unter den Geruch der wilden Kräuter, die im Keller köchelten. Freya hatte sich neben den Kamin an den Tisch gesetzt, während Moira einen Tee für sie machte. Ihre Finger zitterten trotz der wärmenden Flammen, und sie versuchte zu begreifen, was eben passiert war. Sie konnte nicht glauben, nein, sie wollte nicht glauben, dass Talon tatsächlich in Nihalos war. Es rankten sich zahlreiche Geschichten um diese Stadt der Unseelie. Sie galten als das grausamere der beiden Faevölker, angetrieben von ihren Instinkten und vergiftet von dem Glauben an ihre Götter. Aus den Sagen, die man sich nachts zuflüsterte, und aus Moiras verbotenen Büchern wusste Freya, dass sie über die Elemente Wasser und Erde herrschten.
Manche dieser Fae besaßen den Erzählungen nach auch die Gabe, mit ihrer Magie das Wasser im Körper eines Lebewesens zu beeinflussen, so konnten sie ihn austrocknen lassen oder den Blutfluss stoppen, bis das Herz aufhörte zu schlagen. Doch ein solch schneller Tod wäre gnädig und untypisch für die Unseelie. Neben ihnen gab es auch noch die Seelie, die angeblich gnädigeren Fae, welche die Elemente Feuer und Luft beherrschten und in der südlichen Stadt Daaria lebten, die seit über einem Jahrhundert von derselben Königin regiert wurde.
Und dann existierten da noch die Elva, die in den Wäldern um die Städte Melidrians herum Zuhause waren. Diese Kreaturen waren wilder und bestialischer als die Fae und töteten zum Vergnügen. Sie konnten nicht nur Körper zerstören, sondern auch Seelen – Stück für Stück. Angeblich liebten sie es, ihre Opfer in den Wahnsinn zu treiben und ihnen dabei zuzusehen, wie sie den Verstand verloren. Sie zeigten ihnen die schlimmsten Erinnerungen ihrer Vergangenheit und die grausamsten Visionen ihrer Zukunft. Sie drangen mit ihrer Magie in den Geist einer Person ein und kehrten sein Innerstes nach außen, bis nur noch Scherben übrig waren und der Tod zur Erlösung wurde.
Freya wollte sich nicht vorstellen, wie es für Talon sein musste, an einem solchen Ort festgehalten zu werden. Und sie fragte sich, ob von dem Jungen, den sie gekannt hatte, überhaupt noch etwas übrig war, oder ob die Fae ihm seinen Lebenswillen bereits geraubt hatten.
»Trink das«, sagte Moira und stellte eine Tontasse vor ihr auf den Tisch. Der Tee duftete herrlich, aber Freya bezweifelte, dass er die Situation erträglicher machen konnte, dafür brauchte es etwas Stärkeres.
»Du hast nicht zufällig ein bisschen Wein?«, fragte sie nur halb im Scherz. Sie hatte sich den Moment, in dem das Pendel ausschlug, ebenso oft vorgestellt wie Talons Rückkehr, und in keinem dieser Tagträume hatte der Kristall auf einen solch schrecklichen Ort wie Nihalos verwiesen.
»Nein, Wein habe ich leider nicht«, antwortete Moira mit einem schiefen Lächeln.
»Schade!« Freya klammerte sich an ihren warmen Becher. Talon war tatsächlich am Leben, ihr Gefühl hatte sie nicht getäuscht. Es sollte eigentlich keine Rolle spielen, ob er in einer Taverne in Amaruné saß, in einer Mine im Schatzgebirge arbeitete oder von Elva umzingelt war.
Talon gehörte zu ihr, war ein Teil von ihr, und sie war es leid, sich wie eine halbe Person zu fühlen. Sie musste ihn zurückholen, und sie musste sich beeilen. Er war schon viel zu lange im magischen Land, und jeder Tag dort könnte sein letzter sein. Doch wie sollte sie ihn retten?
Das Abkommen zwischen den Ländern besagte, dass Menschen Melidrian und Fae Thobria nicht betreten durften. Das galt vor allem für die Männer ihres Vaters. Einen Gardisten loszuschicken, um in Nihalos nach Talon zu suchen, käme einer Kriegshandlung gleich. Außerdem wollte Freya nicht erklären müssen, woher sie das Wissen um Talons Aufenthaltsort hatte. Diese Erkenntnis brachte nämlich nicht nur sie, sondern auch Moira in Gefahr. Und sie konnte auch niemanden sonst schicken, da sie niemandem am Hof genug vertraute, um ihn mit einer solch wichtigen Aufgabe zu bedenken. Damit blieb ihr nur eine Möglichkeit: Sie musste Talon selbst zurückholen.
Es würde gefährlich werden, aber Freya hatte keine Angst vor den Fae, den Elva oder dem Tod, sie hatte Angst davor, Talon erneut zu verlieren. Sie würde eine Weile untertauchen und sich verstecken müssen, um nach ihm zu suchen. Aber sollte sie ihn aufspüren und mit dem rechtmäßigen Thronerben zurückkehren, wäre sie eine Heldin – und sollte sie scheitern, würde sie sich einfach entschuldigen und Melvyn DeFelice heiraten, wie es sich ihre Eltern wünschten. Und wenn sie im magischen Land sterben sollte – daran wollte sie nicht mal denken.
Freya blickte von ihrem Becher auf, als Moira einen Teller mit zwei Scheiben Brot vor ihr abstellte. Sie waren mit einer dünnen Schicht Butter beschmiert. »Warum musste es Nihalos sein?«
»Das ist die Schattenseite der Magie«, sagte Moira und setzte sich ihr gegenüber. Sorge und Verständnis lagen in ihrem Blick. »Sie ist unberechenbar, und man weiß nie, was sie einem bringt.«
Sie hatte diesen Satz schon häufig zu Freya gesagt. Magie war keine Wissenschaft. Magie war Leben. Magie war Glauben. Sie ließ sich in keiner mathematischen Formel festhalten und nicht in die Schranken weisen.
Magie war Freiheit.
»Warst du schon einmal im magischen Land?«, erkundigte sich Freya. Sie hatte Moira noch nie danach gefragt, denn der Gedanke, dass ein Mensch freiwillig die Mauer überwand und sich den Elva und Fae stellte, war lächerlich.
»Nein, aber ein Freund von mir.« Moira trank einen Schluck ihres Tees. »Sein Name war Galen. Er war ein talentierter Alchemist und konnte Dinge mit Magie wirken, von denen ich nur träumen kann. Sein Talent war ausnahmslos, doch ihm war es nicht genug. Er wollte ins magische Land reisen, um noch mehr über die Magie zu erfahren. Wir haben ihm gesagt, es sei ein Fehler, dennoch ist er gegangen.«
»Ist er zurückgekommen?«
Moira nahm sich eine Scheibe Brot und kaute darauf herum. Ihre Zähne waren nicht faulig, wie bei vielen anderen Einwohnern des fünften Rings, sie hatten dennoch eine gelbliche Verfärbung. »Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen, aber das hat nichts zu bedeuten. Galen ist ein zäher Bursche.«
Diese Antwort beruhigte Freya nicht im Geringsten, bestärkte sie allerdings in ihrem Vorhaben, Talon nicht den Fae zu überlassen.
Sie ließ von ihrem Tee ab, der bereits deutlich abgekühlt war, und griff nach ihrem Mantel. Aus einer der Taschen zog sie ein Säckchen hervor, das mit goldenen Dukaten und silbernen Nobelstücken gefüllt war. Sie legte es zwischen Moira und sich auf den Tisch. Erwartungsvoll blickte diese von ihr zum Geld und wieder zurück. »Angenommen, ein Mensch würde planen, nach Melidrian zu reisen, was würdest du ihm raten?«
»Ich würde ihm raten, einen Heiler aufzusuchen, denn er hat wohl den Verstand verloren.«
Freya schob das Geld in Moiras Richtung. »Und weiter?«
Moira schürzte ihre runzeligen Lippen und zögerte. Ihre Unentschlossenheit war nicht zu übersehen, und Freya wusste genau, was in der älteren Frau vorging. Sie wollte ihrer Prinzessin eine gut bezahlte Information nicht verwehren, aber zugleich war es ihre Pflicht, sie als ihre Schülerin zu beschützen.
»Ich werde nach Melidrian gehen«, sagte Freya und verlieh ihren Worten einen entschlossenen Nachdruck. »Du kannst mir helfen zu überleben und dabei noch etwas verdienen. Oder ich werde jenseits der Mauer mit diesen Münzen sterben.«
»Das wäre Verschwendung.«
Freya lächelte. »Dann hilf mir!«
»Das kann ich nicht.«
»Verstehe«, murmelte Freya und griff nach dem Säckchen. Kaum hatten ihre Finger den samtigen Stoff berührt, packte Moira ihr Handgelenk und hielt sie zurück. Freya hob den Blick.
»Ich kann dir nicht helfen«, wiederholte Moira. Sie neigte den Kopf, und eine Strähne ihres Haares löste sich aus ihrem Zopf. »Aber der unsterbliche Wächter, der im Verlies deines Vaters sitzt, kann es.«
4. Kapitel – Ceylan
– Niemandsland –
Ceylan zog den Mantel, den sie vor einigen Wochen einem Buchbinder in Limell abgenommen hatte, fester um sich. In der Nacht hatte es zu regnen begonnen und seither nicht mehr aufgehört. Begleitet vom monotonen Rauschen der Tropfen hatte sie sich bereits vor Sonnenaufgang auf den Weg ins Niemandsland gemacht. Ihre Kleidung war von dem langen Marsch durchnässt und klebte in feuchten Lumpen an ihrer Haut, die von einem goldenen Braunton war.
Eigentlich hatte Ceylan die Mauer und den Hauptsitz der Wächter schon vor einigen Tagen erreichen wollen, um sich als eine der Ersten für die Rekrutierung einzuschreiben. Zu ihrem Leidwesen hatte sie die letzten Tage allerdings in einem Gefängnis in Orillon verbracht. Man hatte sie dabei erwischt, wie sie versucht hatte, einen Laib Brot zu stehlen. Vermutlich konnte sie von Glück reden, dass man nicht beschlossen hatte, ihr die Finger abzutrennen.
Die Festnahme war ihre eigene Schuld. Sie war in Eile und unachtsam gewesen und hatte nicht bemerkt, dass der Sohn der Bäckerin an diesem Tag nicht zum Markt aufgebrochen war. Aber das war nun auch egal. Jetzt war sie frei, und der Wald vor ihr lichtete sich im Schatten der Mauer.
Der Klang von Stimmen mischte sich unter den prasselnden Regen, und Ceylan verspürte ein nervöses Ziehen in ihrem Magen, das ausnahmsweise nicht von ihrem Hunger stammte. Ein weiterer Nachzügler, der seit dem letzten Dorf vor ihr lief, blieb mitten auf dem Weg stehen. Der Junge musste das Mindestalter von siebzehn für die Rekrutierung erst kürzlich erreicht haben. Er hatte schmale Hüften und besaß offenbar keinerlei Muskeln. Seine Arme waren so dünn wie die Äste eines Dornbuschs. Er erweckte den Anschein, als könnte der kleinste Windstoß ihn zerbrechen. Vermutlich hatte ihn die Aussicht auf eine warme Mahlzeit an die Mauer getrieben, und nun stellte er seine Entscheidung infrage.
Die unsterblichen Wächter, welche das Land bewachten, hatten nur eine Mission: Sie mussten den Frieden bewahren, das Abkommen schützen und Elva, Fae und Menschen, die dagegen verstießen, zur Strecke bringen. Dafür riskierten sie jeden Tag ihr Leben und ließen ihre Menschlichkeit hinter sich. Zwar wurden sie nicht wirklich unsterblich, wie ihr Name verlauten ließ, aber sie bekamen Fähigkeiten verliehen, die sie stärker, ausdauernder, robuster und langlebiger machten als gewöhnliche Menschen, denn nur so hatten die Wächter überhaupt eine Chance gegen ihre übermächtigen Feinde.
Wie genau den Wächtern diese Fähigkeiten verliehen wurden, wussten nur die Wächter selbst und vermutlich die königliche Familie. Es war das wohl am besten gehütete Geheimnis des Landes, denn die Angst, dass jemand die Unsterblichkeit ausnutzen und für seine eigenen Zwecke missbrauchen könnte, war allgegenwärtig.
Ceylan hatte sich schon viele Male vorgestellt, wie das Ritual der Unsterblichkeit aussehen könnte, aber schon bald musste sie es sich nicht mehr nur ausmalen. In wenigen Tagen würde sie es wissen. Sie beschleunigte ihre Schritte und ging an dem Jungen vorbei. Der Wald öffnete sich, und sie trat auf die riesige freie Fläche aus Erde, Gras und flachen Hügeln, die sich vor der Mauer erstreckte. Das Niemandsland. Ein schmaler Landstrich, der niemandem gehörte. Nicht den Seelie. Nicht den Unseelie. Nicht den Elva. Und auch nicht König Andreus. Hier galten keine menschlichen Gesetze. Und auch die Regeln der Fae waren außer Kraft gesetzt. Alles, was zählte, war das Abkommen und die Teilung Lavarus᾽.
Dutzende Männer verteilten sich über den Platz und gingen ihren Aufgaben nach. Sie trainierten, pflegten ihre Waffen, hackten Holz, häuteten Tiere für das Abendessen oder saßen einfach nur beisammen und spielten unter einem Zelt Karten, ihre Schwerter griffbereit, sollte es einen Alarm geben.
Aber nicht nur ihre Waffen kennzeichneten die unsterblichen Wächter, man erkannte sie auch an ihrer Kleidung. Sie trugen dunkle Gewänder mit zahlreichen Gürteln, die sie um ihre Körper schnallten, dazu geschaffen, Waffen daran zu befestigen. An ihren Schultern waren Umhänge befestigt, und einige von ihnen trugen Mäntel, die mit hellem Pelz bestickt waren, um sich vor dem kaltnassen Wetter zu schützen.
Ceylans Aufmerksamkeit galt allerdings nicht nur den Wächtern, sondern auch dem Herzstück des Niemandslandes: der Mauer. Sie hatte die Mauer schon öfter gesehen. Nein, nicht einfach nur gesehen. Ceylan hatte sie besucht, um sich mit ihr vertraut zu machen, in dem Wissen, dass sie eines Tages zurückkehren würde, um ihr zu dienen. Heute war dieser Tag, und die Mauer hatte auf sie noch immer dieselbe einschüchternde Wirkung wie bei ihrem ersten Besuch vor sieben Jahren.
Mit ihren fünfhundert Fuß überragte die Mauer vermutlich sämtliche Gebäude des Landes, selbst das königliche Schloss in Amaruné reichte nicht so weit gen Himmel. Ceylan versuchte jedoch, sich von der Höhe der Mauer nicht beeindrucken zu lassen, schließlich war sie von Fae errichtet worden, und sie weigerte sich, mehr als Hass und Verachtung für diese Kreaturen zu empfinden. Mit Gewissheit konnte niemand mehr sagen, wie dieses Ungetüm aus Stein vor tausend Jahren entstanden war, aber die Sagen erzählten, dass die Seelie den dunklen Basalt aus der Vulkanhöhe geschlagen hatten, einem Gebirge nahe ihrer Heimat Daaria. Stein für Stein hatten sie die Mauer errichtet, um die Völker voneinander zu trennen und um die Magie aus Thobria zu vertreiben. Denn sie war ein Ungeheuer, das seinesgleichen suchte, und war daher fast gänzlich aus dem sterblichen Land verschwunden, was nicht weiter schlimm war, außer in den Augen der letzten verbliebenen Alchemisten.
Ceylan war in ihrem Leben schon einer Handvoll von ihnen begegnet, verschrobene Gestalten, die mit ihrer Kraft nur harmlose Taschenspielertricks wirken konnten. Dennoch waren sie auf dem Scheiterhaufen verendet – zu Recht. Denn unabhängig davon, wie schwach die Magie in Thobria auch war, ihre Ausübung war verboten und wurde mit dem Tod bestraft. Sie war ein Merkmal der Fae und Elva, und ihre Existenz erinnerte an eine Zeit und einen Krieg, den alle am liebsten vergessen würden. Schon damals hatten sich die Menschen, Fae und Elva wegen ihrer Andersartigkeit bekämpft. Jene mit Magie bedachten Kreaturen hatten sich für etwas Besseres gehalten und an ihre Überlegenheit geglaubt. Ein Glaube, der im Krieg zerschlagen worden war, da keine Seite gewonnen hatte.
Hinter sich vernahm Ceylan plötzlich Schritte. Sie drehte sich um und erkannte den Jungen von vorhin. Er wankte hinter einen der Büsche am Waldrand, beugte sich nach vorne und übergab sich mit würgenden Lauten.
Mit gerümpfter Nase wandte sich Ceylan ab. Sie konnte seine Nervosität verstehen, schließlich war dies auch für sie ein wichtiger Wendepunkt in ihrem Leben. Sie würde sich jedoch niemals die Blöße geben, ihren Mageninhalt vor den Augen der unsterblichen Wächter zu entleeren. Diese Männer waren Krieger mit Nerven aus Stahl. Sie würden über ihre Zukunft entscheiden, und das Letzte, was sie an der Mauer brauchten, waren Versager, die nicht einmal ihren eigenen Körper unter Kontrolle hatten.
Ceylan ignorierte die würgenden Geräusche hinter sich und sah sich auf dem Platz um. Wenige Fuß entfernt brannte ein überdachtes Feuer. Andere Anwärter wie sie scharten sich um die Wärme wie Motten um das Licht. Einige von ihnen erweckten den Eindruck, als würden sie bereits tagelang im Niemandsland ausharren, um auf ihre Rekrutierung zu warten. Gebannt beobachteten sie einen Trainings-Schwertkampf zwischen zwei Wächtern, die sich an dem schlechten Wetter nicht störten. Mit feuchten Haaren, schweren Mänteln und mit Matsch unter den stahlverstärkten Stiefeln gingen sie immer wieder aufeinander los.
Ceylan hatte in den letzten Jahren einige Kämpfe gesehen. Wenn es ihre Zeit zuließ, besuchte sie gerne die öffentlichen Übungskämpfe der Gardisten. Doch die Möchtegernkrieger, welche an der Akademie des Königs ausgebildet wurden, waren nichts im Vergleich zu diesen beiden Männern, die ihr Handwerk vermutlich schon seit Jahrzehnten erlernten.
Die beiden Wächter griffen einander schnell und schonungslos an. Kein Schritt wirkte unbedacht, und sie schienen instinktiv zu wissen, welches Manöver ihr Gegner als Nächstes wählen würde. Ihre Bewegungen waren wendig und besaßen eine Eleganz, die Ceylan nicht erwartet hätte. Und jedes Mal, wenn ihre Schwerter mit einem harten Knall aufeinandertrafen, klang es wie Donner im Regen.
Sie hätte den Kampf gerne weiter beobachtet, um zu sehen, welcher der Wächter als Sieger hervorgehen würde, aber sie wollte sich so schnell wie nur möglich einschreiben, denn sollte sie zu spät kommen und die Frist verpassen, würde sie drei Jahre warten müssen, bis sich ihr eine neue Chance bot.
Ceylan wandte sich von dem Kampf ab und überquerte den Platz. Ein Flattern breitete sich in ihrer Brust aus, denn einige der Männer – Anwärter und Wächter – beobachteten sie. Ob reine Neugierde oder mehr dahintersteckte, konnte sie nicht sagen, dennoch zog sie sich die Kapuze ihres Mantels tiefer ins Gesicht und unterdrückte das Verlangen, den Kopf in den Nacken zu legen und an der Mauer emporzublicken.
Eilig lief sie bis zu dem Stützpunkt der Wächter, einem flachen Gebäude direkt an der Mauer, mit einem Aussichtsturm, so hoch wie die Mauer selbst. Das Haus war ebenfalls aus dunklem Stein errichtet, und direkt daneben befand sich ein Tor, das mit einem komplexen Mechanismus versehen war, der es ermöglichte, an dieser Stelle einen Durchgang nach Melidrian zu öffnen. Entlang der Mauer gab es mehrere dieser Stützpunkte, um das gesamte Niemandsland zu bewachen, aber nur dieser Hauptsitz der Wächter war mit einem Tor versehen.
Vor dem Gebäude erblickte Ceylan eine Reihe aus jungen Männern, die vor einem überdachten Häuschen aus Holz standen. Am Dach des Häuschens hatte man ein Schild befestigt, auf dem etwas geschrieben stand, das Einschreibung bedeuten könnte. Ceylan war sich allerdings nicht sicher. Sie war gerade dabei gewesen, das Lesen und Schreiben von ihrer Mutter zu erlernen, als eine Meute Elva in ihr Heimatdorf eingefallen war. Kaltblütig hatten sie all die Menschen ermordet, die Ceylan je gekannt und geliebt hatte. Dieser Tag hatte ihr Leben verändert, und seitdem blieb ihr keine Zeit mehr für ihre Bildung, denn sie hatte andere Sorgen, wie etwa im Winter nicht zu erfrieren und im Sommer nicht zu verhungern, wenn die Ernten knapp ausfielen. Lediglich das Rechnen hatte sie gelernt, schließlich sollte man immer wissen, wie viele Münzen man bei sich trug.
Ceylan reihte sich unter den Wartenden ein und senkte den Blick auf ihre verschlissenen und vom Regen durchnässten Schuhe. Ihre Zehen konnte sie kaum mehr spüren. Ob die Wächter ihr ein neues Paar geben würden?
Die Warteschlange wurde schnell kürzer, und schon bald war sie an der Reihe. Das Kribbeln in ihrem Inneren wurde stärker, und die Härchen an ihren Armen stellten sich auf, als sie nach vorne trat.
»Name?«, bellte der Wächter in der Hütte.
Ceylan blickte auf, und beinahe wäre ihr vor Schreck ein Schrei entwichen. Das Gesicht des Mannes war so entstellt, dass man es gar nicht mehr als ein solches bezeichnen konnte. Seine Haut war geschmolzen und wie das Wachs einer brennenden Kerze an seinem Gesicht nach unten getropft, sodass Kinn und Hals durch zusätzliche Hautlappen miteinander verbunden waren. Dadurch konnte er seinen Kopf nicht heben, weshalb seine wimpernlosen Augen verdreht zu Ceylan aufblickten.
»Wird’s heute noch was, oder hast du es dir anders überlegt?«, fragte der Wächter. Seine Stimme klang harscher, als Ceylan es jemandem ohne Lippen zugetraut hätte.
Sie räusperte sich und schob sich die Kapuze aus dem Gesicht. »Mein Name ist Ceylan Alarion, und ich habe es mir nicht anders überlegt.«
Der Wächter starrte sie an. Blinzelte. Und dann begann er zu lachen. Sein Körper bebte, als hätte sie ihm gerade den besten Witz erzählt, den er seit Jahren gehört hatte. Dabei warf seine geschmolzene Haut unnatürliche Falten, die sein Gesicht abscheulich verzogen. Amüsiert schlug er mit seiner Hand auf die Tischfläche und brachte damit das Tintenfass vor ihm gefährlich ins Wanken.
Sein Lachen verstummte so plötzlich, wie es gekommen war, und ein schmerzerfüllter Ausdruck trat in seine Augen, die zu tränen begonnen hatten.
»Verdammt, Mädchen«, fluchte er und fuhr sich mit seiner Hand – einer unversehrten Hand – über das Gesicht. »Bring mich nicht zum Lachen. Diese Schmerzen machen keinen Spaß.«
»Wie ist das passiert?«, fragte Ceylan unverfroren. »Ich dachte, ihr Wächter verfügt über beeindruckende Heilungsfähigkeiten.«
Der Schreiber hörte auf, seine rote Haut zu streicheln. Er musterte sie eindringlich und fuhr sich mit der Zunge über die nicht vorhandene Oberlippe. »Schnell geheilt worden bin ich allemal, anderenfalls hätte ich vielleicht das Glück, tot zu sein. Diese vermaledeite Unsterblichkeit
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: