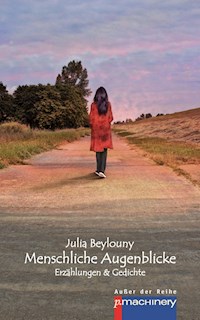Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Kannst du deiner Liebe so vertrauen, dass du für sie alles riskierst, was dein Leben ausmacht? Saila weiß, dass sie stumm bleiben muss, wenn sie andere und ihr Volk schützen will. Dass sie ausgerechnet durch diese Bürde für den Musiker Eskil zur Inspirationsquelle wird, hätte sie nie für möglich gehalten. Als sie sich in ihn verliebt, weiß sie, dass jedes weitere Treffen auch für ihn zur Gefahr werden könnte. Dennoch schafft Saila es einfach nicht, sich von Eskil fernzuhalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Clara
Du bist was ganz Besonderes!
Hör nie auf, an dich zu glauben.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1, Saila
Kapitel 2, Eskil
Kapitel 3, Saila
Kapitel 4
Kapitel 5, Eskil
Kapitel 6, Saila
Kapitel 7, Eskil
Kapitel 8, Saila, etwas früher an diesem Abend
Kapitel 9, Eskil
Kapitel 10, Saila
Kapitel 11, Eskil
Kapitel 12, Saila
Kapitel 13, Eskil
Kapitel 14, Saila
Kapitel 15
Kapitel 16, Eskil, etwas früher am selben Abend
Kapitel 17, Saila
Kapitel 18, für Diana
Kapitel 19, Saila
Kapitel 20, Eskil
Kapitel 21, Saila, etwas früher am selben Abend
Kapitel 22
Kapitel 23, Eskil
Kapitel 24, Saila
Kapitel 25
Kapitel 26, Eskil
Kapitel 27
Kapitel 28, Saila
Kapitel 29
Kapitel 30, Eskil
Kapitel 31, Saila
Kapitel 32
Kapitel 33, Eskil
Kapitel 34
Kapitel 35, Saila
Kapitel 36, Eskil
Kapitel 37, Saila
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40, Eskil
Kapitel 41, Saila
Kapitel 42, Eskil
Kapitel 43, Eskil, einige Minuten zuvor
Kapitel 44, Eskil
Kapitel 45, Saila
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49, Eskil
Kapitel 50
Kapitel 51, Saila
Epilog
Danke
Links
Prolog
Als ich Diana vor einigen Monaten zum ersten Mal sah, wusste ich augenblicklich, wer sie ist. Mein Vater hatte mir von ihrer Familie erzählt und mich neugierig auf sie gemacht. Ich war mit der Hoffnung auf die Insel gekommen, in ihr eine Freundin zu finden. Doch was ich wirklich in ihr fand, war so viel mehr.
An jenem ersten Tag im Februar stand sie in den Dünen und sah aufs Meer hinaus. Die Wellen tobten, Gischt spritzte auf und verwischte die Umrisse der Klippen und Landzungen zu nebligen Salzschlieren. Die Brandung leckte gierig am Küstensand, als wollte sie die ganze Insel verschlingen.
Ich atmete die Brise ein, beobachtete, wie der Wind Dianas braune Haare zerzauste, sie flattern ließ wie eine gehisste Flagge bei Sturm.
Ich ging auf sie zu, hatte sie beinahe erreicht, als sie sich umdrehte und mich bemerkte. Es brauchte einen Moment, bis sie begriff, wer ich war. Ihr Mund und ihre Augen öffneten sich zu einem ungläubigen Staunen, während sie mich vom Kopf bis zu den Füßen musterte. Sie griff nach meinen Händen, berührte meine Haut und meine Nägel und wurde sich bewusst, dass ich ebenso echt war wie sie selbst. Ihre Mimik verwandelte sich in ein Strahlen. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser ersten Frage.
„Wie ist dein Name?“, wollte sie wissen.
Ich lächelte und sie gab meine Hände frei.
„Nenn mir zuerst deinen“, erwiderte ich.
Meine Stimme ließ sie die Luft anhalten. Aber dann antwortete sie klar und deutlich: „Ich heiße Diana.“
„Und ich bin Saila. Du bist sehr mutig, Diana, mich anzusprechen.“
„Und du …“, stammelte sie. „Du bist wunderschön!“
Kapitel 1, Saila
Sie lagen bäuchlings in Bikinis am Strand, das Kinn in die Hände gestützt, die Waden in der Luft baumelnd. Es war Frühsommer geworden und Saila konnte sich nicht vorstellen, jemals wieder woanders zu sein als hier auf Sams Cliffs. Oder vielleicht doch; einen Ort gab es. Einen einzigen Ort, der sie immer anziehen und ihr das Gefühl geben würde, daheim zu sein.
Sie sah sich um. Viele Menschen tummelten sich am Wasser. Niemand schien Saila zu beachten oder anzustarren, niemandem schien aufzufallen, dass sie anders war. Ein seltsames Gefühl, nach all den Jahren zurück zu sein. Es würde noch eine Weile dauern, bis sie sich an das Leben hier gewöhnt hätte. Für den Augenblick gab es keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Sorgen, gehört oder bemerkt zu werden.
„Hey“, rief Diana und durchbrach ihre Gedanken. „Sag mal, wie kommst du eigentlich mit dem Schreiben voran?“
Saila blinzelte sie an.
„Oh, es geht“, flüsterte sie. „Ich verpacke es ein bisschen. Nur für den Fall, dass ich das Buch verliere und … Sicher ist sicher. Ich will nicht, dass die Geschichte in falsche Hände gerät.“
„Eine gute Idee!“, fand Diana. „Ich würde mich übrigens freuen, wenn du mir mal was draus vorliest, um meine Kenntnisse ein bisschen aufzupeppen. Ich gebe zu, dass ich mich nie wirklich dafür interessiert habe, weil einem so was eigentlich nicht passiert, verstehst du? Ich habe nie viel auf dieses ganze Gefasel gegeben. Verzeihst du mir?“
Die blauen Augen ihrer Freundin glitzerten im Sonnenlicht wie die Wellen des Ozeans.
„Natürlich verzeihe ich dir, Di!“, erwiderte Saila. „Und ja, ich lese dir gern einmal was vor. Du tust gut daran, dein Wissen …, wie nanntest du es? Aufzupeppen!“
Es war noch immer seltsam, zu sprechen. So wie es seltsam war, zu laufen. Worte und Füße holperten und drohten manchmal noch zu stolpern. Wie gut es da war, in den Armen von Windgeschöpfen zu landen!
„Prima!“, sagte Diana, lachte, und drehte sich auf den Rücken. „Hast du es dabei?“
„Wie meinst du das? Hier? Jetzt gleich etwa?“
„Wo ist das Problem?“
Saila hockte sich hin, rubbelte den feuchten Sand von Bauch und Dekolleté und griff nach kurzem Zögern in die Strandtasche. Sie nahm das kleine Notizbuch heraus. Es hatte ein mit Rosen verziertes Hardcover, und Saila fand es wunderhübsch. Diana hatte sie in einen Schreibwarenladen geführt und es ihr gekauft. Rosen waren die Blumen, die Saila mit Abstand am meisten liebte. So zart und doch robust gegen Kälte. Süß duftend und lieblich anzusehen, aber auch voller Dornen.
„Wenn du meinst, dass hier wirklich der richtige Ort dafür ist“, sagte sie und blätterte in dem Buch.
„Klar!“, bestand Diana auf das Vorlesen. „Wir sind am Strand! Das ist der beste Ort der Welt für ein gutes Buch!“
„Einverstanden. Dann hör zu und lerne.“
„Die Ohren sind gespitzt“, versicherte Diana, atmete ein paar Mal tief ein und aus, legte die Hände auf ihren flachen Bauch und schloss die Augen. „Ich bin bereit!“
Saila fand die Stelle, nach der sie gesucht hatte, und nahm eine bequeme Sitzposition ein.
„Gut“, begann sie. „Also, wir befinden uns irgendwo in der Vergangenheit. Diese Geschichte ist viel zu kostbar, um sie der Vergessenheit preiszugeben. Mein Vater hat sie mir einst erzählt. Er war der beste Geschichtenerzähler der Welt!“
„Ich bin gespannt!“
Eine Windböe blies Saila Haare ins Gesicht. Sie warf sie über die Schulter zurück.
„Der Erzähler ist ein junger Mann namens Lúmanon. Er befindet sich in einem fernen Land und erlebt erstaunliche Dinge.“
„Lúmanon! Wo steckst du?“, schallt Brokus’ Stimme durch die Kate an mein Ohr. „Komm schnell heraus, hier ist jemand, der nach dir fragt!“
Ich runzle kurz die Stirn und überlege, wer das sein könnte. Während ich über den Lehmboden durch den im Halbdunkel liegenden Korridor laufe, hoffe ich, es wäre Selliastan, mein bester Freund. Wir kennen uns, seit ich denken kann und haben alles zusammen erlebt, was Jungs in Fjondern erleben können.
„Ah, da bist du ja!“, sagt Vater und streckt den Arm nach mir aus, als ich ins Sonnenlicht trete. „Das ist Lúmanon, ist er nicht groß geworden?“
Vor uns steht ein Mann zu Ross. Mein Augenmerk fällt wie von selbst sofort auf das edle Tier. Ein Hengst, blutjung, temperamentvoll und ohne Zweifel noch nicht sehr lang an Sattel und Reiter gewöhnt. Ein durch Heißbrand gesetztes Zeichen auf der linken Hinterhand verrät die Herkunft des Tieres.
„Ein Rappe der Nachtmark, Junge“, spricht der Fremde mich an, als er bemerkt, wie ich das Pferd mustere. „Hast du das Zeichen des Hauses Glodriens schon einmal gesehen?“
Ich schüttle den Kopf und betrachte den eingebrannten Stern, in dessen Innerem ein Kreis und eine daneben gesetzte Sichel liegen.
„Es bezeichnet den Nachthimmel: Stern, Voll- und Halbmond. Ich sehe, du verstehst was von Pferden. Aber kannst du auch sprechen?“
Mein Vater Brokus versetzt mir einen Hieb ins Kreuz.
„Selbstverständlich, mein Herr.“
Der Fremde lacht so schallend, dass sein Pferd unruhig den Kopf hochreißt.
„Du gefällst mir, Lúmanon! Brokus, du hast ihn wohlerzogen! Mich erfreut, was ich sehe. Wann kann ich ihn mitnehmen?“
„Mich mitnehmen?“, wiederhole ich und starre Vater und den Fremden abwechselnd an. „Wohin denn mitnehmen?“
„Sei so gut und hole einen Krug Wasser, um das Pferd zu tränken, Lúmanon“, verlangt mein Vater und seinem Blick entnehme ich, dass er keinen Widerspruch duldet.
Ärger steigt in mir auf, im Gehen trete ich in den Staub, dass er aufwirbelt. Wieso schickt er mich weg, als wäre ich noch ein Kind? Ich habe große Lust, hinter dem Haus abzubiegen, den Waldweg einzuschlagen und zu Selliastan zu laufen. Aber zur Strafe würde mein Vater mich bis nach Sturmland jagen. Genügend Schauermärchen aus der Kindheit haben unseren Grusel jedenfalls geschürt, was die Fürsten Windlands angeht.
Vielleicht wäre es einen Versuch wert. Eine Mutprobe, um festzustellen, ob sie einem wirklich was tun würden.
Nein, ich muss verschwinden und Wasser holen, damit Vater und der Fremde ungestört über meine Zukunft reden können, ohne mich nach meinen eigenen Vorstellungen zu befragen.
Als ich den Krug in die Zisterne ablasse, ist sie wieder da. Klar und glockenhell; diese Melodie in meinem Kopf. Bilde ich es mir ein oder wird sie deutlicher, je älter ich werde? Mag sein, dass mein Verstand sie im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat. Oder jemand ruft nach mir.
Ich lache über meine dummen Gedanken, greife nach dem vollen Krug und gehe zurück zur Kate, wo ich einen Moment unter einem Holunderstrauch stehen bleibe, um die Männer zu belauschen.
„Er ist nun im siebzehnten Jahr bei dir, Brokus“, sagt der Fremde. „Du weißt, dass er nicht zu dir gehört. Das war die Bedingung damals.“
„Nicht nötig, mich daran zu erinnern.“ Die Stimme meines Vaters klingt leise. So spricht er, wenn ihm etwas schwerfällt oder er Schmerzen hat. „Es ist nur so, Tristan, der Junge ist mir eine große Hilfe und mir wie ein Sohn ans Herz gewachsen. Ich bin allein, wie du weißt.“
Der Mann auf dem Rappen zieht einen kleinen Beutel aus der Satteltasche und klimpert mit dessen Inhalt.
„Ich halte meinen Teil der Abmachung jedenfalls“, sagt er
und wirft meinem Vater das Säckchen zu. „Hiervon wirst du dir einen Knecht leisten können, ein eigenes Stück Land auf dem Friedhof und einen prachtvollen Stein, wenn die Zeit gekommen ist! Das ist mehr, als jeder Bauer Fjonderns sich wünschen kann!“
„Interessant, dass du diesen Namen eingeflochten hast“, bemerkte Diana und nickte zur Anerkennung.
„Wie gesagt, ich habe es ein wenig verpackt. Aber es muss auch einen Wiedererkennungswert haben.“
„Diese Geschichte …“ Diana setzte sich auf. Gedankenverloren schüttelte sie den Kopf. „Und dazu deine Stimme. Ich bekomme Gänsehaut, wenn du vorliest. Wahnsinn!“
„Soll ich weiterlesen?“, fragte Saila.
„Unbedingt!“
Ich habe genug gehört! Wütend stoße ich den Krug um, dass sich das Wasser unter den Holunderstrauch ergießt und renne davon. Mein Vater ruft mir nach, aber ich will ihn nicht hören. Vor allem will ich nicht verkauft werden wie ein Stück Vieh, das nun groß und fett geworden ist und bereit für den Schlachter!
Blind vor Zorn und mit Tränen der Wut in den Augen stolpere ich über den Waldweg Richtung Dorf. Selliastan ist sicher auf den Feldern. Aber eigentlich laufe ich ohne ein bestimmtes Ziel einfach nur fort.
„Stopp!“, rief Diana und winkte Saila zu.
„Was denn?“, wollte sie wissen. „Zu spannend?“
„Nein, aber da vorn!“ Ihre Freundin zeigte zum Ufer. „Da kommen zwei echt coole Typen in unsere Richtung und ich denke, wir sollten eine kurze Sicherheitspause einlegen.“
„Oh! Verstehe!“
Diana legte den Zeigefinger an die Lippen.
„Sobald sie an uns vorbei sind, darfst du weiterlesen. Aber bis dahin, sei brav.“
„Und wenn sie nun anhalten und uns ansprechen?“
„Überlass das mir!“, sagte Di und drehte sich um.
Tatsächlich steuerten die beiden Jungs direkt auf sie zu. Saila schätzte sie auf ein paar Jahre älter als Diana. Sie trugen Badeshorts, waren ziemlich muskulös, durchtrainiert und gut aussehend.
„Hallo, ihr zwei Hübschen!“, begrüßte der Größere sie und beide Jungs blieben vor ihnen stehen. Ihre Blicke waren arrogant und aufdringlich. „Was treibt ihr denn so? Zufällig sind wir neu auf der Insel. Vielleicht habt ihr ja Lust, uns die Gegend zu zeigen.“
„Hm, lass mich kurz nachdenken, haben wir das?“
Diana sah Saila an und Saila schüttelte kurz den Kopf.
„Ach, kommt schon! Der Tag ist zu schön, um ihn allein zu verbringen“, blieb der Größere hartnäckig.
Der Kleinere nickte. Er wandte sich an Saila und sagte: „Hübsches Notizbuch. Rosen sind meine Lieblingsblumen.“
Sie wich seinen Blicken aus.
„Das ist mein jüngerer Bruder Base“, erklärte der Größere. „Und ich bin Greg. Wir kommen vom Festland und verbringen den Sommer auf der Insel.“
„Wow! Es ist gerade mal Anfang Juni. Da habt ihr ja noch viel Zeit, Mädels aufzureißen“, antwortete Diana und drehte sich auf den Bauch.
„Und wer seid ihr?“, fragte Base.
„Wollen wir es ihnen verraten?“ Diana sah Saila an. Saila knabberte nachdenklich auf ihrer Unterlippe und zuckte erneut mit den Schultern.
„Okay, wir überlegen noch“, antwortete Diana den Jungs.
„Dürfen wir uns denn zu euch setzen?“
Saila schüttelte vehement den Kopf.
„Nein“, sagte Diana.
„Hey, deine Freundin hat dich ja voll und ganz im Griff“, bemerkte Greg und warf Saila einen verächtlichen Blick zu. „Kann sie auch mal was sagen oder bist du ihr Sprachrohr?“
„Ich bin ihr Sprachrohr.“ Diana stützte ihr Kinn ab.
Saila nickte zufrieden und sah die Jungs an.
„Na los, Greg, lass uns gehen. Hier gibt’s sicher noch mehr Mädels. Welche, die aufgeschlossener sind.“
„Mir gefallen diese beiden aber“, antwortete er.
Greg ging in die Hocke, wobei sich seine Wadenmuskulatur anspannte. Er malte kleine Kreise in den Sand und als er lachte, blitzten seine Zähne auf.
„Deal“, schlug er vor. „Eure Namen, und dann verschwinden wir. Vorerst. Die Insel ist jedoch überschaubar, und wenn wir uns das nächste Mal begegnen, geht ihr was mit uns trinken, einverstanden?“
Saila schaute Diana fragend an.
„Was kann er schon mit unseren Namen anstellen? Wir werden uns in Zukunft einfach vor ihnen verstecken“, wägte Diana ab. Saila überlegte, bevor ihre Lippen ein stummes Okay formten.
„Gebongt“, rief ihre Freundin Greg zu. „Also, das da ist Saila und ich bin Diana. Und nein, ihr dürft mich nicht Di nennen. Das dürfen nämlich nur meine Freunde.“
„Klare Ansage!“ Greg sah diese Konversation wohl als eine Herausforderung an. Als einen Flirt, der seinen Kampfgeist weckte. Armer Kerl. Er hatte keine Ahnung, dass er auf Granit beißen würde.
„Saila“, sagte Base und lächelte sie an. „Das ist ein sehr schöner Name. Schön und außergewöhnlich. So wie du.“
Saila griff nach ihrem Notizbuch und blätterte wieder darin herum. Sie würde gern weiterlesen und hoffte, die Jungs zögen endlich Leine.
„Auf nimmer Wiedersehen, Greg und Base.“ Diana erinnerte sie mit einem Winken an den Deal.
„Bis zum nächsten Mal“, sagte Greg.
Er erhob sich schwungvoll aus der Hocke. In einem anderen Leben hätte Saila die beiden vielleicht sympathisch gefunden.
„Ich freu mich schon auf den Drink mit euch!“, fügte Greg hinzu. Dann setzten sie sich in Bewegung und liefen in Richtung der Dünen. Ein paar Mal sahen sie sich noch zu den Mädchen um. Aber ihre Gestalten wurden kleiner und kleiner, bis sie irgendwann in den Sandbergen verschwunden waren.
„Wow!“, platzte es aus Saila heraus. „Denen will ich nie wieder begegnen!“
„Wieso eigentlich nicht?“, fragte Diana. „Ich fand sie irgendwie ganz süß!“
Sailas Blicke verharrten noch immer an der Stelle in den Dünen, an der die Jungs verschwunden waren. Sie schüttelte den Kopf und strich sich über die Arme, als wollte sie ein Frösteln vertreiben.
„Ich weiß es nicht. Irgendwas stimmt nicht mit ihnen. Sie machen mir … Angst.“
„Hm, eine interessante Aussage. Ich dachte schon, du würdest dich vor nichts und niemandem fürchten, Sai.“
„Ja, das dachte ich bis eben auch.“
„Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten“, stellte Diana fest, setzte sich auf und streckte sich. „Es ist gleich zwei Uhr. Ich bekomme langsam aber sicher Hunger. Entweder wir gehen jetzt zur nächsten Dönerbude oder du liest mir weiter vor. Schließlich will ich wissen, was aus Lúmanon wird. Wie reagiert sein Vater darauf, dass er weggelaufen ist?“
„Also lesen wir weiter und danach holst du dir deinen Döner.“ Saila suchte die Stelle in ihrem Rosenbuch heraus, an der sie zuvor aufgehört hatte, und legte sich bäuchlings in den Sand. Zu lesen wäre eine gute Ablenkung, um nicht mehr an die Jungs zu denken. Vor allem nicht mehr an Greg.
Ich erreiche die ersten Häuser Silions, die Frau des Bürgermeisters und die des Heilers sitzen im Garten unter einem Kirschbaum und trinken Tee. Sie erinnern mich an Hühner, die neugierig gurren, als ich vorbeilaufe. Kaum ein Mann ist um diese Zeit im Dorf anzutreffen. Nur aus Plautus’ Schmiede schallt das monotone Schlagen, das entsteht, wenn sein Hammer auf heißes Eisen trifft. In meiner Blindheit habe ich ganz vergessen, einen Bogen um die Schmiede zu machen.
„Lúmanon!“, klingt es wie das Säuseln eines Windgeschöpfes an mein Ohr. „Was tust du denn hier? Wolltest du etwa zu mir?“
Ich bleibe stehen, als Amaryllis auf die Straße tritt und mich begrüßt. Schnell wische ich meine Tränen fort, aber mein glühendes Gesicht steht dem ihres Vaters am Feuer in nichts nach.
„Sei gegrüßt“, presse ich hervor.
„Kein Pferd deines Vaters, das beschlagen werden müsste?“, fragt sie und schaut sich um. „Ist denn vielleicht was passiert? Mit Brokus?“
„Alles bestens.“
„Warum auch immer du hier bist!“ Sie strahlt über das ganze Gesicht und greift nach meinen Händen. Ihre Haut ist weich und zart, obwohl sie ihrer Mutter im Haushalt und im Garten hilft, manchmal sogar Plautus in der Schmiede. Sommersprossen zieren ihre Stupsnase, die grünen Augen schauen mich wach und aufgeweckt an, das kupferfarbene Haar entkommt immer irgendwie dem straffen Knoten an ihrem Hinterkopf. Amaryllis ist eine Schönheit, hat Charakter, und ich sollte mich glücklich schätzen, dass wir einander versprochen sind.
„Ich bin so froh, dich zu sehen!“, ruft sie und schwenkt unsere Hände hin und her. „Sag, bist du gerannt, oder wieso sind deine Wangen so erhitzt?“
„Ich muss weiter“, antworte ich und entziehe ihr meine Hände. „Dein Vater beobachtet uns. Ich will nicht, dass er sich am Eisen verbrennt.“
„Aber wir stehen mitten auf der Straße!“ Sie lacht mich aus. „Wo jeder uns sieht! Wir tun doch nichts Verbotenes, Lúmanon!“ Dann senkt sie ihre Stimme zu einem Flüstern. „Oh, ich wünschte, wir könnten durchbrennen.“
„Amaryllis!“
„Worauf warten wir denn? Wir sind längst keine Kinder mehr! Du kannst uns eine Hütte bauen und ich kann …“
„Ich muss dringend weiter“, unterbreche ich und denke mir eine Lüge aus. „Selliastan braucht meine Hilfe mit dem Vieh.“
„Oh, wenn das so ist.“
„Bis bald, Amaryllis.“
„Bis ganz bald, mein Geliebter!“
Im Weitergehen nicke ich Plautus zu, dem der Schweiß vom Kinn tropft und zischend ins Schmiedefeuer fällt.
Saila schlug das Notizbuch zu und legte es zurück in die Strandtasche.
„Das war’s“, sagte sie und sah Diana neugierig an. „Und? Gefällt es dir? Sei ehrlich!“
Ihre Freundin lag in der Sonne und strahlte.
„Es ist wunderschön!“, rief Diana, setzte sich auf, löste ihren Pferdeschwanz und schüttelte Sand aus ihren Haaren. Dann stand sie auf, entnahm der Tasche einen Jeansrock und ein helles Shirt, um sich anzuziehen.
„Ich will unbedingt wissen, wie diese Geschichte weitergeht!“ Sie kramte nach einer Haarbürste. „Aber jetzt muss ich was essen, mir hängt der Magen schon bis in die Kniekehlen!“
„Döner?“, fragte Saila.
„Döner!“, bestätigte Di.
Auch Saila stand auf, schlüpfte in ihre Caprihose und das rote Tank Top. Ihre Freundin reichte ihr die Haarbürste, und als sie damit durch ihre langen schwarzen Haare kämmte, ergossen sie sich wie Pech über ihren Oberkörper.
„Aber du bist ehrlich, okay?“, bat Saila. „Wann immer es eine Stelle gibt, die dir nicht gefällt, musst du mir das wirklich sagen.“
„Muss ich?“
„Musst du“, beharrte Saila und ließ die Bürste wieder in der Tasche verschwinden. „Schließlich bist du meine Nebelschwester! Ein Wesen, das mir ewige Treue versprochen hat!“
„Aber so war es nicht! Ich habe niemandem irgendetwas versprochen! Ich bin auch keine Nebelschwester! Du musst da was verwechseln! Schau mich an! Ich bin ein stinknormales Mädchen, das jetzt liebend gern mit den beiden Jungs von vorhin abhängen würde, denn dieses Mädchen hat jetzt Ferien, bevor sein Abschlussjahr beginnt und es ein wichtiges Theaterstück schreiben und auch noch proben muss, das …“ Diana stockte. Ihr Mund stand weit offen, dann schnipste sie mit den Fingern und sah Saila an. „Ich hab’s! Das ist die Idee! Oh, wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen? Mister Eisenhower wird mich lieben!“
„Wer?“
„Mein Lehrer! Komm jetzt! Ich verhungere!“
Kapitel 2, Eskil
Seine Hände ruhten seit geraumer Zeit auf den Tasten. Seine Blicke verharrten auf der Partitur, ohne bewusst darauf zu schauen. In seinem Kopf herrschte Chaos. Töne und Klänge vermischten sich zu Harmonien und Disharmonien, aus Dur wurde Moll, aus Freude Leid. Eskil schloss die Augen, summte eine Melodie vor sich hin, spielte sie auf dem Klavier nach und schüttelte immer wieder den Kopf. Er sprang auf, raufte sich die Haare, warf die Notenblätter zu Boden, um sie direkt wieder aufzunehmen und es noch einmal zu versuchen.
Das Fenster war angekippt, von draußen drang das Rauschen der Wellen an seine Ohren. Aber da war mehr zu hören als nur das Tosen der Brandung. Es war der Ruf der Sehnsucht oder irgendeiner Muse, die gefunden werden wollte. Das, oder er selbst war schlichtweg zu blöd zum Komponieren!
„Hier steckst du. Wo sonst?“, durchbrach die Stimme seiner Mutter das schmerzhafte Grollen seiner Gedanken. Eskil sah zur Tür. Ma lehnte am Holzrahmen und lächelte. Blonde Locken umrahmten ihr Gesicht. „Die Sonne scheint! Du hast Ferien! Was tust du hier drinnen?“
„Ma, …“
„Nicht, Ma! Da! Der Strand, das Meer!“ Sie zeigte zum Fenster, wo eine Brise die transparenten Schlaufenvorhänge blähte.
„Ich brauche meine Ruhe“, bat er. „Ich hab noch den ganzen Sommer lang Zeit, zum Strand zu gehen.“
„Und den ganzen Herbst und Winter, um zu komponieren.“
„Glaubst du, Beethoven hat auf schlechtes Wetter gewartet?“
Sie lachte. Eskil liebte das Lachen seiner Mutter. Manche Jugendliche mochten alles andere lieber hören als Töne oder Worte, die ihre Eltern von sich geben. Aber das Lachen seiner Mutter erinnerte ihn daran, wie schnell das Leben vorbei sein konnte. Er hatte sogar ein kleines Lied über ihr Lachen geschrieben und damit einen Wettbewerb in der Schule gewonnen. Vor vier Jahren, nachdem Ma den Krebs besiegt hatte.
„Eigentlich interessiert es mich nicht, auf wen oder was ein Beethoven gewartet hat“, sagte sie, hob ein Notenblatt auf, das Eskil auf dem Boden übersehen hatte, und reichte es ihm. „Mich interessiert nur, dass mein Sohn den Sommer nicht Trübsal blasend in seinem selbst erwählten Musikgefängnis verbringen soll. Na los.“ Sie stieß ihn an die Schulter. „Geh raus, hab Spaß, triff dich mit Freunden! Und dann kannst du auch wieder klar denken.“
Eskil runzelte die Stirn und überlegte, was das Beste in seiner Situation wäre. Vielleicht hatte seine Mutter recht. Die Inspiration kommt meistens dann, wenn man sie am wenigsten erwartet.
„Wo ist Dad?“, fragte er.
„Arbeiten. Oder möchtest du zum Heim? Ich könnte dich fahren, ich muss ohnehin noch einkaufen.“
„Lieb von dir, Ma. Aber ich denke, ich gehe wirklich ein bisschen an den Strand.“ Die Idee gefiel ihm immer besser, je länger er darüber nachdachte. „Ich komme hier gerade nicht weiter. Und je mehr ich mich unter Druck setze, desto weniger gelingt es.“
„Bravo!“, rief Ma. „Und vor dem Abendessen will ich dich nicht sehen.“
„Soll ich stattdessen Pfandflaschen sammeln und mir davon was Nahrhaftes kaufen?“
„Auch eine Idee! Dann kann ich mir das Kochen sparen.“
Eskil nickte.
„Ich hätte mich bei der Instrumentenwahl für die Gitarre entscheiden sollen“, sagte er. „Die ist handlicher für den Fall, dass ich mal auf der Straße spielen muss.“
„Jetzt hau schon ab“, lachte Ma, zwinkerte ihm zu und verschwand aus dem Zimmer.
Der Wind, der vom Meer herauf wehte, blies die quälenden Gedanken aus seinem Kopf. Eskil schloss die Augen und atmete die salzige Luft ein. Der Strandabschnitt, der nahe seinem Elternhaus lag, war so gut wie nie von Touristen oder Menschenmassen überfüllt. Das lag daran, dass die Küste hier rauer war als ein paar Kilometer weiter in die andere Richtung, und die Leute wollten ja fast immer nur baden und in der Sonne liegen. Sams Cliffs bot sowohl Naturstrände, Felsenküsten als auch Sandstrände.
Eskil genoss die Einsamkeit am Meer. Er war nie der gesellige Typ gewesen. Zwar hatte er Freunde in der Schule, und auch in der Nachbarschaft war er gern gesehen. Die Leute schätzten ihn für seine Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit, wie sein Vater einmal bemerkt hatte. Aber es ließ sich an einer Hand abzählen, auf wie vielen Partys er in seinem achtzehnjährigen Leben gewesen war. Pretty, eines der angesagten Mädchen aus seiner Stufe war der Ansicht, dass Eskil zu weich und zu zart sei für die Welt der Partys und des Alkohols. Vielmehr sei er – und das hatte sie wortwörtlich gesagt – eine Mimose. Ein schräger Junge, der seine Musik mehr liebe als zwischenmenschliche Beziehungen.
Eskil schmunzelte, wann immer diese Einschätzung in seiner Erinnerung aufkam. Pretty hatte nicht den Hauch einer Ahnung von den zwischenmenschlichen Kontakten, die Eskil pflegte.
Als er die Augen öffnete, löste er seine Sandalen, setzte sich in Bewegung und ging barfuß durch die Wellen, die auf den steinigen Strand rollten. Draußen auf dem Meer machte er die Umrisse der Klippen aus. Jener Klippen, die den wichtigsten Teil der Legende darstellten, die sich um Sams Cliffs rankte.
Zwei Gestalten, die einige Dutzend Meter vor ihm zwischen den Felsen erschienen, zogen seine Aufmerksamkeit auf sich. Eskil kannte jeden Einheimischen hier. Diese beiden Jungs hatte er noch nie gesehen. Vielleicht waren sie Tagestouristen oder Feriengäste, die den Sommer hier verbrachten.
„Oh, hey!“, rief einer der beiden plötzlich und winkte wild mit den Armen in der Luft. „Ja! Du da! Hey, komm doch mal her!“
Eskil sah sich um. Da sonst niemand zu sehen war, nahm er an, dass er gemeint war. Er ging auf die Jungs zu. Sie waren groß, einer hellblond, einer dunkelblond. Ihre engen Shirts ließen darauf schließen, dass sie viel Sport betrieben, was Eskil von sich selbst nicht behaupten konnte. Der einzige Sport, den er betrieb, war, seine Finger auf dem Klavier auf und ab tanzen zu lassen.
„Tag“, begrüßte er sie, als er nahe genug herangekommen war. „Kann ich irgendwie helfen?“
„Vielleicht kannst du das“, sagte der Dunkelblonde. „Was weißt du über die Klippen dahinten im Meer?“
„Die Klippen?“ Eskil sah erneut auf die Umrisse am Horizont.
„Ja, Mann. Wir wollen dort tauchen gehen. Wir suchen nach seltenen Muscheln und Korallen und so was.“
Bei dem Wort tauchen prustete Eskil.
„Ihr seid wohl übergeschnappt!“, rief er. „Da draußen ist es lebensgefährlich! Da kann man nicht tauchen. Ihr solltet euch eine andere Stelle suchen. Es gibt hier wunderschöne Riffe und Buchten, die harmlos sind. Da findet ihr alles, wonach ihr suchen wollt.“
„Hast du das auch gehört, Base?“, wandte der Dunkelblonde sich an den anderen Jungen. „Hat er was von lebensgefährlich gesagt?“
„Das hat er!“, bestätigte Base.
Die beiden grölten und gaben sich ein High-Five. Eskil runzelte die Stirn.
„Hör zu“, sagte der Dunkelblonde. „Vielleicht magst du uns für lebensmüde halten. Aber wir sind keine Weicheier, verstehst du? Wir sind hier, um Abenteuer zu erleben und nicht, um in irgendeiner seichten Bucht auf Luftmatratzen herumzupaddeln. Also sag uns einfach, wo man hier ein Boot chartern kann. Alles andere soll nicht deine Sorge sein, klar?“
„Wie ihr meint“, sagte Eskil und zuckte mit den Schultern. „Ich hab euch gewarnt. Ein Boot könnt ihr in Blue Haven bekommen. Da gibt es einen Verleih.“
„Na siehst du, geht doch. Los, Base, auf nach Blue Haven.“
Eskil sah den Jungs nach, wie sie über den Strand stapften und in ihr Unglück liefen. Genau das war der Grund, wieso er Leute seines Alters nicht ausstehen konnte. Sie waren allesamt großmäulig, hormongesteuert und glaubten, die Welt läge ihnen zu Füßen. Sie fühlten sich unsterblich und landeten nicht selten auf ihren dummen Klappen.
Eskil zog sein Handy aus der Hosentasche, wählte eine Nummer und lauschte dem Freizeichen.
„Bootsverleih Blue Haven, Curt am Apparat. Womit kann ich dienen?“
„Hey, Curt, hier ist Eskil.“
„Eskil, mein Junge! Schön, von dir zu hören! Wie geht es deinem Dad?“
„Es geht ihm gut, danke der Nachfrage.“
Eskil schob mit den Zehen ein paar Steinchen zusammen, bis eine Welle darüber rollte und die Kiesel mit sich riss.
„Braucht ihr Lack, oder wollt ihr nun doch das Bootshaus kaufen, über das wir vor zwei Wochen gesprochen haben?“
„Nichts von beidem“, erwiderte Eskil. „Es geht um zwei Jungs, die gerade auf dem Weg zu dir sind.“
„So?“ Curt lauschte auf. „Ärger im Anmarsch?“
„Kann ich nicht sagen. Aber ich hab sie hier noch nie auf der Insel gesehen. Sie sagten, sie wollten ein Boot chartern und raus zu den echten Sams Cliffs fahren. Zum Tauchen.“
„Zum Tauchen?“ Curt lachte, wie Eskil es zuvor auch getan hatte. „Wollen sie sich etwa umbringen?“
„Dasselbe habe ich sie auch gefragt. Egal. Ich wollte dich bitten, sie ein bisschen auszuhorchen. Wann sie los wollen und so. Und dann rufst du mich an, okay? Ich werde ihnen folgen. Nur für den Fall … du weißt schon. Ich kenne die Gewässer an den Klippen so gut wie meine Westentasche.“
„Eskil, du bist ein guter Junge, das bist du wirklich. Aber willst du das nicht lieber der Küstenwache überlassen?“, fragte der alte Mann am anderen Ende der Leitung.
„Nein.“ Er grinste und bohrte seine Zehen in den Sand. „Ich will ihre Gesichter sehen, wenn ich sie aus dem Wasser fische und sie zugeben müssen, dass ich recht hatte.“
Kapitel 3, Saila
„Und was genau hat es damit auf sich?“, fragte Saila und rührte mit dem Strohhalm in ihrer Cola. Cola war ein sehr interessantes Getränk, wie sie fand. Überhaupt waren alle sprudelnden Getränke ziemlich faszinierend. Saila konnte sich wie ein kleines Kind an den Bläschen erfreuen, die an die Oberfläche stiegen und leise zerplatzten.
„Ich meine, wieso sollte ich das tun?“
Diana saß ihr gegenüber und verspeiste einen Döner. Di liebte Döner über alles, und es machte ihr nicht im Geringesten was aus, wenn manche Leute allergisch auf den penetranten Geruch der Zwiebeln und des Knoblauchs reagierten.
„Du sollst es tun, weil du meine Freundin bist, weil ich alle deine Geheimnisse kenne und du bei uns wohnen darfst. Moment, lass mich kurz nachdenken. Ich bin sicher, da gab es noch einen weiteren Punkt.“
„Ach, Di, lieber bezahle ich für die Unterkunft, als dass du es mir jetzt bei jeder Gelegenheit unter die Nase reibst.“ Saila fing einen Tropfen auf, der an ihrem Glas herunterrann und leckte ihn vom Finger. Diana hörte auf zu kauen, zog einen Schmollmund und sah sie flehend an.
„Hör auf, so zu gucken!“, gluckste Saila. „Du siehst mit den vollgestopften Dönerbäckchen wie ein verfressener Hamster aus!“
Diana intensivierte ihren Bettelblick und klimperte dazu mit den Augen.
„Okay!“ Saila hob die Hände. „Ich mache es! Hast du gehört? Ich tu’s! Aber nur, wenn du auf der Stelle aufhörst, so zu gucken!“
„Danke! Ich wusste es!“
„Und was genau muss ich tun?“
„Schreiben“, mampfte Diana. „Weiter nichts. Und das kannst du doch so gut.“
Die Bedienung kam an den Tisch und fragte, ob sie noch etwas bestellen wollten. Diana verneinte, woraufhin die Kellnerin wieder verschwand.
„Wieso isst du eigentlich nichts?“, wollte Di wissen, als sie das letzte Stück Dönerfleisch in ihren Mund steckte.
„Mach ich nachher“, antwortete Saila, nippte an der Cola und schob das Glas dann von sich. „Erzählst du mir, worum es in dem Stück geht? Und was genau ich schreiben soll?“
„So richtig weiß ich das selbst auch noch nicht“, erklärte Diana, wischte sich mit der Serviette über den Mund und nahm die Strandtasche. „Kommst du? Ich denke, ich besorge uns einen Termin bei Mister Eisenhower. Wir besprechen es zu dritt. Er wird dich lieben!“
„Besprechen also, ja?“
Diana zwinkerte ihr zu und sie verließen die Dönerbude.
Am Abend ging ein riesiger, orangefarbener Vollmond über dem Meer vor Sams Cliffs auf. Saila hatte sich in ihr Zimmer zurückgezogen, ebenso wie Diana und deren Familie. Nun stand sie auf dem kleinen Balkon, der nach Osten zeigte, in die Richtung, in der auch die Klippen lagen, über deren Silhouette die Scheibe der Nacht stand.
Aus der Ferne war das Rauschen der Wellen zu hören. Von Osten als sanftes Säuseln, als wohliges Schmatzen, als leckte der Ozean an etwas, das er begehrte. Von Norden her als Donnern, als Bersten und Krachen. Dort traf das Meer auf Felsen.
Die Stimmen der Nacht zogen Saila an. Das Flüstern der See rief nach ihr, weckte eine Sehnsucht, die so tief ging, dass es schmerzte.
Sie verließ den Balkon, zog die Vorhänge zu, schlüpfte barfuß aus dem Raum und auf den dunklen Flur. Aus Dianas Zimmer drang gedämpfte Musik. Ein schwacher Lichtschein blinzelte unter dem Türspalt hindurch; ihre Freundin war noch wach.
Saila schlich an der Tür vorbei, auch am Zimmer von Ruby, Dis kleiner Schwester, aus dem die gleichmäßigen Atemzüge verrieten, dass sie schlief. Saila benötigte kein Licht, als sie die Treppe hinunterging, am Wohnzimmer vorbei, in dem Barry und Rita Pherson eine TV-Show ansahen. Leise wie auf Samtfüßen glitt sie aus der Haustür in die Nacht hinaus.
Es war spät, nach elf. Saila wusste, welche Gassen und Feldwege sie nehmen musste, um ungesehen zu bleiben. Sie wollte niemandem begegnen, der sich vielleicht wunderte, wieso sie barfuß lief, oder ihr unbequeme Fragen stellte, die sie nicht beantworten konnte.
Als die Häuser und Lichter der Ortschaft hinter ihr zurückblieben, als nur noch das silbrige Mondlicht die Nacht erhellte, sah sie die Umrisse des alten Hauses, das dem Verfall preisgegeben war. Einst war es imposant und ansehnlich gewesen, eines der schönsten Häuser der Insel. Doch seit dem Tod der damaligen Inselvorsteher und dem Neubau eines Rathauses, hatte sich niemand mehr für die Instandhaltung des Gebäudes verantwortlich gefühlt, was Saila bedauerte. Einerseits – andrerseits hätte sie das alte Gemäuer nicht für ihre Zwecke nutzen können, wäre es verkauft und wieder hergerichtet worden. Sie hätte stattdessen einen unbequemen Platz zwischen den Felsen als Versteck finden müssen. So gesehen war sie froh und dankbar, wie alles gekommen war, konnte das Haus als ihr Eigentum betrachten und in Sentimentalitäten versinken, wann immer sie es betrat.
Tatsächlich gab es noch einen Grund, wieso sie nachts oft herkam. Die hintere Veranda des Hauses lag ideal, sie endete an einer steilen Klippe und schloss mit dem Felsen ab. Etwa zwanzig Meter darunter tobten die Wellen und nur ein schmaler Pfad führte zu einem Landstreifen hinab, der bei Flut überschwemmt und bei Ebbe begehbar war.
Saila sah sich um, bevor sie durch den morschen Zaun kletterte, der das Haus umgab, und sich durch das Gestrüpp schlängelte, das einst ein gepflegter Garten gewesen war. Sie stieg auf die vordere Veranda, tastete sich über die brüchigen Dielen zur Haustür vor und schlüpfte hindurch. Drinnen roch es modrig. Wind, Salz, Sonne und Regen hatten dem Haus im Laufe der Jahrzehnte schwer zugesetzt, die Erosion begünstigt. Das Dach war undicht, Fenster gesplittert, Möbelstücke, die nicht von irgendwelchen Leuten fortgeschleppt worden waren, als die Zeit es noch erlaubt hatte, waren zu Wohnstätten von Mäusen und anderem Ungeziefer geworden. Sailas Herz schmerzte, wenn sie den Zustand des Hauses bedachte. Mehr als einmal hatte sie sich gefragt, was ihr Vater dazu gesagt hätte, wäre er noch am Leben. Sie könnte es renovieren lassen. Geld war das kleinste Problem. Dort, wo sie herkam, gab es davon im Überfluss. Aber noch hatte sie nicht entschieden, wo sie den Rest ihres langen Lebens verbringen wollte.
Sie stieg über die Möbel, ließ die verblichenen Bilder an den Wänden in ihren schiefen Verankerungen zurück und ging hinaus auf die hintere Veranda. Die Nacht war mild, das Tosen in der Tiefe nur halb so wild wie an anderen Tagen. Als Saila in die Wellen blickte, dachte sie an Diana. Di wusste von diesem Ort. Sie wusste alles. Wie gut, dass es die Phersons gab.
Das Meer hypnotisierte Saila. Sie zog das Tank Top aus und ließ es auf die Holzdielen gleiten. Ihre Finger tasteten nach Knopf und Reißverschluss der Caprihose, öffneten sie und streiften den Stoff von den Beinen. Saila löste die Schlaufen ihres Bikinioberteils, ließ es mit dem Slip zu Boden segeln und stieg auf das Geländer der Veranda. Mondschein tauchte ihren Leib in blass-bläuliches Licht. Der Wind erfasste ihre Pechhaare, um mit ihnen zu spielen. Salz und Gischt prickelten auf ihrer Haut. Ein Kribbeln ging durch ihre Glieder, ließ jede Zelle vor Erregung beben.
Saila sah hinunter in die tosende See, fixierte einen Punkt zwischen zwei Felsen, bevor ihr Körper sich straffte und zum Sprung ansetzte. Die Arme über dem Haupt zu einem Pfeil gespitzt, stieß sie sich ab, um wenige Sekunden später kopfüber in die Fluten zu tauchen und sich von ihnen verschlingen zu lassen.
Was dann geschah, war der Kampf zweier Herzen, die in ihr schlugen. Der Ozean raubte ihrem Leib die Eigenschaften des Landes und kleidete sie unter Schmerzen in das, was sie zu gleichen Teilen war. Silbrig glitzernde Schuppen stießen durch ihre Haut, hüllten sie in die Rüstung des Meeres, umschlossen ihre Brüste und ersetzten ihre Beine durch eine kräftige Flosse. Die sonst anliegenden, unauffälligen Hautfalten an ihrem Brustkorb füllten sich mit Meerwasser und öffneten sich zu pulsierenden Kiemen, die es Saila ermöglichten, unter der Oberfläche zu atmen.
Sie war ein Chamäleon der See, ein sich wandelnder Organismus, eine genetische Variante des Menschen, die sich vor Urzeiten entwickelt hatte.
Meerjungfrauen existieren jedoch nur noch in Mythen, in Märchen, Legenden und Kinderbüchern. Das war gut so, wie Saila fand.
Sie glitt am Grund entlang, folgte dem gerippten Meeresboden weiter in den Ozean. Das Mondlicht begleitete sie eine Weile, bevor es vor der Tiefe kapitulierte. Sailas Augen passten sich den Lichtverhältnissen an, dafür geschaffen, in der Dunkelheit zu sehen.
Die Klänge der See, das Rauschen, die Fischerboote an der Oberfläche und die fernen Walgesänge beruhigten ihren Geist. Hier unten im Meer stillte sie ihre Sehnsucht nach Freiheit und ihren Hunger. Sie fing Schalentiere und Fische, tauchte durch einen Schwarm Krill und aß sich satt. Das alles war so viel schmackhafter als Dianas Döner oder die Cola, deren Säure Sailas Magen rumoren ließ.
So lange hatte sie im Meer gelebt, so lange an Land. Doch nirgends hatte sie eine gefunden wie sie. Es gab Tage, da gab sie die Hoffnung auf, jemals fündig zu werden. Und dann gab es Tage, da war Saila sicher, nicht allein zu existieren. Sie wusste, dass ihr Volk sich zurückgezogen hatte. Sie kannte die Geschichten vom Krieg. Von den sinnlosen Opfern, die es auf beiden Seiten gegeben hatte. Saila ahnte, wohin ihr Volk gezogen war, um sich selbst und die Landmenschen zu schützen. Es zu finden, würde jedoch ein Leben lang dauern. Aber sie wollte es. Mehr als alles andere.
Spät in der Nacht schwamm sie zurück zur Küste, kroch auf den schmalen Landstreifen, den die Ebbe nun unterhalb des verfallenen Hauses freigelegt hatte. Saila legte sich in den Sand, sah hinauf in den Himmel und ließ sich vom Mondlicht bescheinen. Ihr Atem bebte, das Wasser verließ ihre Lungen. Ihre Haut veränderte sich, die Schuppen trockneten ein, die Schwanzflosse fiel auseinander und gab ihre Beine frei. Dieser Prozess erinnerte Saila an eine Salamander-Art, die in der Lage ist, ihre Schwänze abzuwerfen und neu zu bilden, wann immer Gefahr droht. Die Natur hat unzählige Wunder hervorgebracht, viele davon sind bis heute unerforscht.
Nachdem die Rückwandlung in einen Landmenschen vollzogen war, stand Saila auf, wrang ihre triefenden Haare aus und machte sich unbekleidet, wie sie war, über den schmalen Pfad zum Haus auf. Sie streifte durch Büsche und Hecken, um die hintere Veranda zu erreichen, wo sie ihre Kleider zurückgelassen hatte, als sie Stimmen im Haus vernahm und erstarrte.
„Jetzt sieh sich einer das hier an!“, hallte es an ihre Ohren. „Was für ein hässliches Bild! Wenn es in dieser Schrotthütte nicht schon längst vor sich hin gammeln würde, hätte ich es direkt abgefackelt!“
Eine Taschenlampe kam zum Einsatz. Saila bemerkte den Lichtkegel, wann immer er auf ein Fenster traf.
„Oder dieser Sessel hier!“, rief eine andere Stimme. „Nicht mal als Ratte käme mir der Gedanke, darin mein Nest zu bauen!“
Verächtliches Lachen folgte. Saila drückte sich an die Hauswand und traute ihren Ohren nicht. Sie kannte die Stimmen. Greg und Base befanden sich da im Haus, und sollten sie Saila oder ihren Bikini finden, brächte sie das in große Erklärungsnot.
„Was meinst du“, fragte Base. „Ob wir hier irgendwas Sinnvolles finden?“
„Keine Ahnung! Sperr einfach die Augen auf! Jede Kleinigkeit könnte ein Hinweis sein.“
Jemand trat gegen etwas, das mit einem Scheppern zu Boden fiel. Saila tastete sich vor bis zur Veranda. Mit größter Anstrengung schaffte sie es, ihren Slip zu ergattern, aber das Oberteil lag zu weit entfernt. Was um alles in der Welt hatten die Jungs hier verloren?
„Hörst du das?“, durchdrang Gregs Stimme die Nacht. „Da hat doch was geklappert!“
„Ach, du leidest bloß unter Verfolgungswahn! Lass uns weitersuchen.“
„Nein!“, beharrte Greg. „Ich bin sicher, dass da was ist. Glaub mir, dafür habe ich einen Riecher!“
Saila hatte keine Wahl. Sobald die Jungs rauskämen, würden sie ihre Kleider entdecken, und das musste sie um jeden Preis verhindern. Mit einem Satz sprang sie auf die Dielen, schnappte sich das Bikinioberteil, als einer der Jungs aus dem Haus kam.
„Was zum Henker …? Base! Komm sofort raus! Shit, beeil dich doch!“
Ehe Greg begriff, was geschah, schwang Saila sich auf die Brüstung der Veranda, setzte zum Sprung an und flog entlang der Felsen, um wenige Sekunden später erneut in die Fluten einzutauchen.
Ihr Herz brannte, und noch während die Verwandlung ihren Lauf nahm, schwamm sie um ihr Leben, obwohl sie wusste, dass die Jungs ihr nicht folgten. Doch das spielte keine Rolle. Die Angst, die sie bereits am Nachmittag am Strand vor den beiden verspürt hatte, war zurück. Irgendwas ging von den Jungs aus, und es weckte Sailas Urinstinkte.
Die gute Nachricht war, sie hatten sie nicht erkannt; zumindest hoffte sie das. Saila hatte es geschafft, ihren Bikini zu retten, in dem Greg und Base sie gesehen hatten. Die Hose und das Top waren irrelevant. Die Kleidungsstücke hatten in der Strandtasche gelegen, unter denen von Diana.
Die schlechte Nachricht lautete, in ihrer Eile und im Zuge der Verwandlung hatte Saila ihren Bikini dem Meer überlassen. Sie musste es irgendwie anstellen, ungesehen das Haus der Phersons zu erreichen – ohne Kleider.
Sie musste hinein gelangen, ohne jemanden aufzuwecken. Vielleicht durch eines der Fenster im Erdgeschoss oder durch den Keller. Wie beruhigend, das Dunkel der Nacht auf ihrer Seite zu wissen.
Der Teil der Insel, an dem Saila aus dem Wasser wollte, war weniger dicht besiedelt als der westliche Teil. Und um diese Uhrzeit hielten sich am Strand ohnehin keine Menschen mehr auf, sodass sie es wagen konnte, an Land zu gehen.
Sie schwamm zum Ufer, die Sinne geschärft, und verwandelte sich. Im Schutz der Dunkelheit lief sie durch die Dünen und die dahinter liegende Heidelandschaft, die direkt zum Haus der Phersons führte.
Als Saila Licht in Dianas Zimmer sah, atmete sie erleichtert auf. Sie nahm eine Handvoll Kiesel und warf einen nach dem anderen gegen das Fenster ihrer Freundin, hinter dem sich bald ein Schatten regte, das Fenster öffnete und in die Nacht hinaus sah.
„Psst!“, machte Saila. „Hier unten bin ich.“
„Was? Wer ist da?“
„Ich bin es, Di! Hättest du eventuell die Freundlichkeit, mich rein zu lassen? Ich wäre morgen nur ungern das Thema des Inselklatsches.“
„Ach, du glibberige Feuerqualle! Saila, bist du das?“
„Ja, und jetzt öffne endlich die Tür!“
Diana reckte sich aus dem Fenster, rieb sich die Augen und starrte sie an.
„Bist du etwa … nackt?!“
„Oh, tatsächlich, ist mir noch gar nicht aufgefallen! Vielleicht schreist du noch lauter, damit die Nachbarn auch im Bilde sind!“
„Warte“, bat Diana, verschwand für eine Sekunde vom Fenster, um dann zurückzukehren und eine Wolldecke herunter zu werfen. „Wickel dich da rein und dann komm zur Terrassentür, ich mache auf!“
Saila tat es. Wenig später stand sie ihrer Freundin gegenüber.
„Nicht zu fassen“, nuschelte Diana. „Du bist es wirklich. Ich dachte erst, ich wäre vor der Glotze eingepennt und würde träumen. Aber jetzt bin ich echt erleichtert, dass es kein Traum war! Glaub mir, die letzte Person, von der ich einen Nackttraum haben möchte, bist du. Saila, wieso bist du nackt?“
„Das willst du nicht wissen!“ Sie trat ein, bevor Diana die Tür wieder verschloss. Die Wolldecke hatte begonnen, das Meerwasser aus Sailas Haaren aufzusaugen.
„Greg und Base“, flüsterte sie. „Oh Gott, Diana, ich hoffe nicht, dass sie mich erkannt haben! Was, wenn sie es doch getan haben? Sie werden nach Antworten verlangen! Was soll ich bloß tun?“
„Okay, jetzt beruhig dich erst mal“, riet Di und legte ihr einen Arm um. „Lass uns erst mal raufgehen. Du ziehst dir einen Pyjama an und dann erklärst du mir in aller Ruhe, was dieses wirre Zeugs zu bedeuten hat.“
Kapitel 4
Saila stand am Ufer und sah aufs Meer hinaus. Wellen knabberten an ihren Knöcheln, hauchten feuchte Küsse und Liebkosungen auf ihre Haut, umspielten sie flüsternd und verlockend. Sie ignorierte die Aufforderung des Meeres, das sie für sich allein beanspruchte. Heute nicht, dachte sie. Vielleicht für lange Zeit nicht mehr.
Das wäre klug gewesen. Sie verschränkte die Arme vor der Brust, während Diana hinter ihr im Sand lag und sich sonnte.
„Mein Bikini steht dir richtig gut!“, rief ihre Freundin. „Er sitzt knackig und betont deine bildschöne Figur.“
„Ich will aber nicht, dass er irgendwas betont“, antwortete Saila. „Was sind schon Figuren, Gestalten oder Beine? Ich weiß nicht mal, wer oder was ich bin, Di.“
„Du denkst immer noch an gestern Nacht, hab ich recht?“
„Wie könnte ich nicht mehr daran denken.“
„Hey!“ Dianas Stimme wurde weich und einfühlsam. „Komm schon. Ich glaube nicht, dass die Jungs dich erkannt haben. Sonst wären sie längst auf der Suche nach uns.“
„Bin ich hier sicher, Di?“, fragte Saila und drehte sich zu ihr um.
„Wie meinst du das, sicher?“
„Na ja, sicher eben. Kann ich unter Landmenschen leben, ohne irgendwann erkannt zu werden? Und was, wenn mich jemand erkennt? Die Zeiten haben sich geändert. So was wie mich gibt es in dieser Welt nicht mehr. Sie würden mich in ein Labor bringen und an mir herumexperimentieren. Und du würdest mir nicht helfen können.“
„Sag das nicht zu laut!“, rief Di und sprang auf. Sie lief Saila in die Arme, packte sie und wirbelte sie herum. „Komm schon! Du bist sicher, solange ich dich beschütze! Und solange du nicht herausgefunden hast, wo deine Leute sich verstecken oder du hingehören willst, bleibst du natürlich hier! Ich hab dich viel zu liebgewonnen, als dich so schnell wieder gehen zu lassen.“
Saila fühlte sich geehrt und drückte Diana an sich. „Danke! Du bist die beste Freundin der Welt!“
„Das weiß doch jeder!“ Di setzte sie ab und stellte sie zurück in die Wellen. „So. Was machen wir jetzt? Gehen wir eine Runde schwimmen? Oder liest du mir was vor? Wir haben noch zwei Stunden Zeit, bevor wir den Termin bei Mister Eisenhower haben.“
Diana löste die Sonnenbrille aus ihren Haaren und schob sie zurück auf ihre Nase. Saila schaute sich um. Heute war es voller als an den vorherigen Tagen. Unzählige Menschen und Familien tummelten sich am Wasser und auf dem Strand. Ein Zeichen dafür, dass der Sommer unaufhaltsam voranschritt. Diana ging zur Strandtasche, nahm ein großes Handtuch heraus und breitete es im Sand aus. Sie setzte sich und klopfte auf eine freie Stelle neben sich.
„Komm her. Komm zu mir.“
Saila tat es. Schwimmen wollte sie in nächster Zeit besser nicht.
„Was haben die da nur gewollt?“, murmelte sie. „In meinem Haus. Wieso waren Greg und Base dort?“
„In deinem Haus?“ Diana lachte. „Witzig, dass du es so bezeichnest.“
„Ich begreife es einfach nicht!“
„Hier“, sagte Di, und schob das mit Rosen verzierte Buch zu ihr rüber. „Lies mir was vor, um auf andere Gedanken zu kommen. Alles Weitere wird sich zeigen. Mach dir keine Sorgen mehr drüber, okay? Diese dämlichen Kerle haben wohl nur eine Ruine entdeckt und fanden es spannend, darin herumzustöbern. Das ist nicht ungewöhnlich für halbwüchsige Menschenmänner.“
„Sie haben meine Hose gefunden. Das haben sie zweifellos“, flüsterte Saila. „Und mein Tank Top. Und sie haben eine nackte Frau gesehen, die von der Klippe gesprungen ist. Wahrscheinlich denken sie, ich hätte mich umgebracht. Die Polizei wird eine riesige Aktion draus machen.“
„Aber es gibt keine Leiche, keine Vermisste“, wandte Diana ein. „Und keine Beweise. Du könnest ebenso eine Geisteskranke gewesen sein, die sich nachts in Abbruchbuden entblößt und herumspukt. Und? Wie gesagt, sie haben keine handfesten Beweise.“
„Du kannst einen wirklich beruhigen, weißt du das?“
„Na ja, ich bin deine Nebelschwester.“
„Oh ja, das bist du!“
Diana hatte recht. Für den Moment gab es nichts, was sie hätten unternehmen können. Saila drehte sich auf den Bauch und nahm ihr Notizbuch zur Hand. Sie suchte nach der Stelle, an der sie beim letzten Mal zu lesen aufgehört hatte, und fuhr fort:
„Goldkorn, mein Freund!“, ruft Selliastan mir schon von Weitem zu, als ich durch das hohe Gras laufe. Er und ein paar andere Männer sensen das Feld ab, um Heu zu machen. Pellias und Ferodin runzeln die Stirn, als fragten sie sich, was ich um diese Tageszeit wohl hier tue, so ganz ohne Arbeitsgerät in den Händen.
„Goldkorn, Selli!“, erwidere ich den Gruß des Fjonder’schen Landvolkes, mit dem wir einander eine goldene Ernte wünschen.
„Wow“, unterbrach Diana. „Das ist ein sehr schöner Gruß! Ich wünschte, wir würden uns auch etwas mehr Sinnvolles wünschen.“
Di setzte einen grüblerischen Gesichtsausdruck auf.
„Hallo. Hey. Was geht ab? – Das ist doch erbärmlich, findest du nicht?“
Saila lachte.
„Was ist mit Guten Tag?“, wandte sie ein. „Da wünscht man sich einen guten Tag!“
„Bravo! Na los, lies einfach weiter, bis uns ein besserer Gruß einfällt.“
Als ich Selliastan erreiche, wischt er sich mit dem aufgekrempelten Hemdärmel Schweiß und Grünschnitt von der Stirn. Er stützt sich auf den Senswurf und blinzelt gegen das Sonnenlicht an.
„Was führt dich hierher? Geht es Brokus schlecht?“
Die Männer gehen ihrem Schnitt weiter nach, die Luft duftet nach frisch geschnittenem Gras.
„Nein, meinem Vater geht es gut. Kannst du dich hier für einen Moment losmachen?“
Selli zuckt die Schultern, grinst schief und lässt seinen Daumen über das Sensblatt fahren.
„Ich muss dengeln!“, ruft er den anderen Arbeitern zu und leckt frisches Blut von seiner Daumenkuppe. Dass er für mich lügt, ist ein tiefer Freundschaftsbeweis.
„Du bist der Beste, Selli!“
Wir verlassen das Feld Richtung Dorf, bleiben aber hinter den nächsten Bäumen stehen und lehnen uns an die Stämme.
„Los, raus mit der Sprache, Lúmanon, bevor sie uns im Schatten beim Langweilen ertappen“, drängt mein Freund.
Wir lachen, und Selli wischt sich ein letztes Mal durchs Gesicht.
„Da ist so ein Mann gekommen“, erzähle ich. „Mein Vater nennt ihn Tristan. Er reitet einen Rappen der Nachtmark. Ein edles Tier!“ Ich sehe meinem Freund in die Augen. „Hast du schon mal von einem Tristan gehört?“
„Noch nie. Was will er denn?“
„Mich abholen.“
„Was?!“ Mein Freund reißt die Brauen hoch. „Aber wieso denn, und wohin? In die Nachtmark?“
Ich zucke die Schultern und drehe einen Farnwedel zwischen den Fingern.
„Ich habe sie belauscht. Tristan gab meinem Vater Geld.“
„Und er hat es angenommen?“
„Ich bin davongelaufen.“
Selli kratzt sich hinterm Ohr und rubbelt Grasspäne aus seinen braunen Locken. Er ist wie jeder junge Bursche Silions wettergebräunt und von der harten Feldarbeit recht muskulös.
„Sprich mit Brokus“, rät er mir. „Du bist jetzt beinahe achtzehn und solltest selbst entscheiden, wer oder ob dich einer mitnimmt. Zudem steht deine Vermählung mit Amaryllis an. Oder soll sie auch mitgehen?“
„Von ihr war keine Rede.“ Meine Blicke schweifen ab. Sie wandern hinauf in die Baumkronen, deren Laub leise im Wind raschelt. Dort oben sehe ich diese wunderschönen Augen, höre die Melodie, die mich ganz und gar gefangen nimmt. „Wenn es nach mir ginge, müsste sie nicht mitgehen.“
„Was sagst du da?“ Selliastans Augen blitzen auf. Er schnaubt. „Sie ist das schönste Mädchen, das ich kenne!“, ruft er. „Und du willst sie abweisen? Was ist denn mit dir?“
Ich lache leise. Ich habe Schöneres gesehen. Gehört. Und das will ich wiederfinden. Wenn es auch nur ein Streich meiner Fantasie ist. Es weckt eine Sehnsucht in mir, die ich mit nichts und niemandem zu stillen weiß. Diese Augen, diese Melodie, sie machen mich besessen danach, ihren Ursprung zu finden.
„Geh mit mir nach Sturmland, Selli!“, spreche ich einen Blitzgedanken laut aus.
„Wie bitte? Jetzt verlierst du völlig den Verstand!“
„Ich meine es ernst!“, antworte ich und tatsächlich meine ich das auch.
„Nach Sturmland?!“ Meinem Freund steht die kindliche Panik der Gruselgeschichten ins Gesicht geschrieben. Ich packe ihn bei den Oberarmen und spüre kribbelnden Leichtsinn in mir, als ich ihn schüttle.
„Selli, vielleicht muss ich fort! Vielleicht nimmt dieser Tristan mich wirklich mit! Vielleicht habe ich keine Wahl, verstehst du? Wir zwei, wir haben so viel zusammen erlebt! Wir hatten die beste Kindheit, die man in Silion verleben kann! Ist es nicht so? Ein letztes Abenteuer, mein Freund! Eine letzte Mutprobe, bevor wir uns vielleicht nie wieder begegnen. Wer kann denn sagen, dass er die Zukunft kennt?“
Je mehr ich mich in Rage rede, desto mehr Gefallen finde ich an dieser Idee. Ich will nach Sturmland! Ich wollte es schon immer! Jetzt oder nie ist die Zeit dafür gekommen. Und ich will mit Selliastan dorthin.
Selli senkt den Blick. Er ist leicht blass um die Nase.
„Und wenn es wahr ist?“, flüstert er. „Wenn sie uns die Augen auspicken? Was dann, mein Freund?“
Ich stöhne auf.
„Das sind Schauergeschichten! Komm schon, wir sind jetzt Männer! Einmal muss dieser Spuk ein Ende haben! Und sei es nur drum, dass wir es unseren Kindern einst besser erzählen!“
„Vielleicht hast du recht“, räumt er ein. „Wir machen es! Wir gehen nach Sturmland, du und ich!“
Saila klappte das Notizbuch zu und legte es beiseite.
„Wie jetzt?“, beschwerte Diana sich. „Das war’s? Du hörst mittendrin auf? Und was ist mit Sturmland? Machen sie sich etwa heimlich aus dem Staub?“
„Wer weiß?“, antwortete sie und schob die Unterlippe vor. „Tut mir leid, Di.“
„Es tut dir leid? Soll das ein Witz sein?“
„Du bist einfach viel zu ungeduldig.“ Saila setzte sich auf. „Ich lese ein anderes Mal weiter. Vielleicht sogar schon gleich! Ich finde, wir sollten uns jetzt erst mal auf den Weg zu deinem Lehrer machen. Oder willst du zu spät kommen?“
Kapitel 5, Eskil
Seine Augen blieben geschlossen, während seine Finger das Sehen für sie übernahmen. Vielmehr waren es Gehör und Finger, die im Zusammenspiel Eskils feinfühligsten Sinne bildeten. Sein gesamter Körper verschmolz mit der Musik zu einer tiefen, sinnlichen Emotion. Das war Magie. Ein Meisterwerk, wie man es in der heutigen Zeit kaum mehr findet. Jeder Ton gab seinen ganz eigenen Beitrag zur Sinfonie. Jeder Fingergriff saß, jede Taste flehte darum, gedrückt und damit Teil der Melodie zu werden.
In seiner Trance schaffte Eskil es, jedes noch so kleine Hintergrundgeräusch auszublenden. Ein Husten, ein Seufzen, ein Stöhnen oder das Summen eines elektronischen Rollstuhls vermochten nicht zu ihm durchzudringen oder sein Spiel zu unterbrechen. Erst nachdem der letzte Ton im Raum und im Klangkörper des Klaviers verhallt war, öffnete er die Augen, erwachte aus seiner Hingabe und nahm den Applaus zur Kenntnis, der allein ihm galt.
„Das war wunderschön, vielen Dank!“, sagte Schwester Lioba, die rechts neben ihm stand. In der einen Hand einen steril verpackten Katheder, in der anderen eine Schnabeltasse. „Vergelt’s dir Gott, Eskil, dass du uns diese Freude bereitest.“
„Ich tue das gern“, versicherte er und sah in die leuchtenden Augen der alten Menschen, die er für kurze Zeit aus dem Gefängnis ihrer Demenz entlockt und in Verzückung versetzt hatte.
„Das war Chopin, nicht wahr?“, fragte eine alte Dame mit schneeweißen Haaren.
„Nicht ganz“, erwiderte Eskil, lächelte und stand vom Klavierhocker auf. „Beethoven.“
„Jaja, Chopin ist mein Lieblingsmusiker. Ich erkenne das sofort.“
„Ich spiele Ihnen gern auch mal was von Chopin, wenn Sie mögen.“
„Sind Sie denn der Mister Beethoven?“, fragte die alte Frau.
„Nein, ich bin Eskil. Erkennen Sie mich, Misses Bell?“
„Sicher doch!“ Sie griff nach seiner Hand und hob mit der Zunge die lockere Unterkieferprothese an. „Du veräppelst mich doch, Beethoven.“
Er schmunzelte und beugte sich zu der alten Dame hinunter. „Verraten Sie es niemandem!“, flüsterte er.
Daraufhin kniff sie verschwörerisch die Augen zu und nickte.
„Tu ich nicht“, flüsterte sie zurück.
Eskil verabschiedete sich von ihr und den anderen, nahm seine Tasche und ging am Büro seines Vaters vorbei.
„Hey, Dad, ich bin dann weg. Bis später.“
„Alles klar, bis später.“
Es war Jahre her, dass Eskil das Altenheim zum ersten Mal betreten hatte. Damals hatte sein Dad die Stelle des Heimleiters angenommen und weil seine Mom gearbeitet und die Schule oft früh geendet hatte, hatte Dad ihn mit hergebracht. Eskil erinnerte sich daran, wie er zwischen den alten Menschen Hausaufgaben gemacht oder gemalt hatte. Seitdem hatte er viele kommen und gehen sehen. Er wollte keine dieser Erinnerungen je missen. Dass er den Bewohnern seitdem regelmäßig auf dem Klavier vorspielte, gab sowohl ihnen als auch Eskil etwas.
Er verließ das Altenheim und überquerte die Hauptstraße, als ein markerschütternder Schrei ihn zusammenfahren ließ.
„Halt sie fest! Bitte, halt sie fest, Eskil!“
Er sah sich um, weil er nichts entdeckte, was er hätte festhalten sollen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand Candissa Marvery Abbyroy, seine hochgestylte Mitschülerin. Sie trug pinkfarbene Pumps, einen viel zu kurzen Minirock und ein Spaghettiträger Top. Ihre langen blonden Haare umspielten die schlanke Figur und das – wie Eskil zugeben musste – sehr hübsche Gesicht.
„Da vorn!“, rief sie verzweifelt und zeigte in eine bestimmte Richtung. „Sie sitzt jetzt unter dem Autoreifen des Pickups. Oh Gott, wenn der losfährt, ist sie tot! Bitte, tu doch was, um Gottes willen! Sie ist mein Baby!“
Eskil war verwirrt. Dennoch hielt er auf den Pickup zu, an dessen Steuer nicht mal jemand saß. Der Wagen parkte am Straßenrand und würde wohl kaum von selbst losfahren. Während er neben dem Wagen in die Hocke ging, um wonach auch immer Ausschau zu halten, tippelte Pretty auf ihren Pumps heran.
„Siehst du sie?“, fragte sie in purer Verzweiflung.
„Keine Ahnung“, antwortete er. „Wonach genau suche ich denn, Candissa?“
„Herrje, du bist und bleibst eine Mimose!“, schimpfte sie. „Aber wenn der Wind jetzt deine dämlichen Noten durch die Weltgeschichte wehen würde, dann könntest du auf einmal rennen, hab ich recht?“
Pretty ging auf der anderen Seite des Pickups in die Hocke. Ihr Minirock schob sich dabei noch höher, was Eskil dazu veranlasste, woanders hinzusehen. Er war nicht so jemand. Andere Jungs aus seinem Jahrgang hätten sicher nicht weggeschaut. Aber Eskil besaß einfach zu viel Anstand, als diesem Mädchen zwischen die Beine zu starren.
„Oh mein Gott, da ist sie ja!“, rief sie und streckte die Hand zum Hinterreifen aus. „Komm her, Baby, Mummy ist hier. Komm schon, hab keine Angst, niemand wird dir wehtun.“
Ein verängstigtes Fiepen ertönte und endlich sah Eskil, wonach sie suchte. Ein winziges weißes Hündchen duckte sich hinter den Autoreifen. Schwarze Miniaturaugen blinzelten ihn an und am Hals des Tieres prangte ein pinkfarbenes
Strasshalsband mit der Aufschrift Angel, was vermutlich der Name des Schoßhundes war.
„Ich komm nicht an sie ran“, wimmerte Pretty. „Wenn ich noch weiter unter den Wagen krieche, sind meine Klamotten ruiniert!“
„Warte, ich versuche es“, sagte Eskil und beugte sich so weit wie möglich vor. Tatsächlich bekam er das Tier zu fassen, packte es und zog es unter dem Pickup hervor. „Ich hab sie!“
„Oh, Eskil! Du bist der Größte!“
Pretty tippelte um den Wagen herum, öffnete eine kleine Handtasche und hielt sie ihm hin.
„Komm her, Darling! Setz sie hinein, Eskil. Oh, mein Püppi, tu mir das nie wieder an, hörst du?“
Er setzte das Hündchen in die Tasche, bevor Pretty es mit einer gefühlten Million Küsse überhäufte.
„Sag mal, Candissa, wie ist es eigentlich aus der Tasche raus gekommen?“