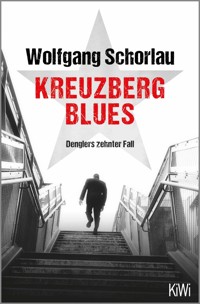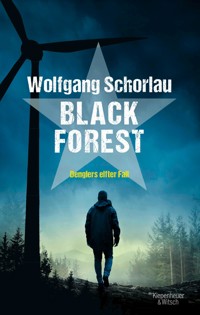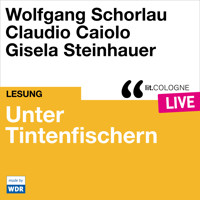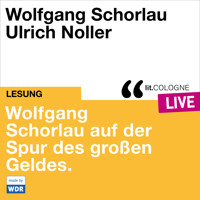9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Dengler ermittelt
- Sprache: Deutsch
Spannung und Aufklärung – diese einzigartige Kombination ist das Markenzeichen der Kriminalromane um den Stuttgarter Privatermittler Georg Dengler. Beiden Ansprüchen wird Wolfgang Schorlau auch in »Die letzte Flucht«, in dem es um die Machenschaften der Pharmaindustrie geht, glänzend gerecht. Der sechste Fall führt Georg Dengler nach Berlin. Professor Dr. Bernhard Voss, Arzt an der Charité, wird eines schrecklichen Verbrechens verdächtigt. Sein Verteidiger bittet Dengler um Unterstützung. Dieser steht plötzlich vor einem Abgrund an Manipulationen. Fast beiläufig erzählt Schorlau zugleich eine Geschichte über den Widerstand gegen »Stuttgart 21«, in dem Denglers Sohn Jakob aktiv ist. »Zwei Jahre lang habe ich über die Pharmaindustrie recherchiert«, schreibt Schorlau im Nachwort. »Ich kann es nicht anders sagen: Diese Industrie wird von einer beispiellosen kriminellen Energie getrieben.« Alle Fälle von Georg Dengler: - Die blaue Liste - Das dunkle Schweigen - Fremde Wasser - Brennende Kälte - Das München-Komplott - Die letzte Flucht - Am zwölften Tag - Die schützende Hand - Der große Plan - Kreuzberg Blues - Black ForestDie Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Wolfgang Schorlau
Die letzte Flucht
Denglers sechster Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Wolfgang Schorlau
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Wolfgang Schorlau
Wolfgang Schorlau lebt und arbeitet als freier Autor in Stuttgart. Neben den acht »Dengler«-Krimis »Die blaue Liste« (KiWi 870), »Das dunkle Schweigen« (KiWi 918), »Fremde Wasser« (KiWi 964), »Brennende Kälte« (KiWi 1026), »Das München-Komplott« (KiWi 1114), »Die letzte Flucht« (KiWi 1239), »Am zwölften Tag« (KiWi 1337) und »Die schützende Hand« hat er die Romane »Sommer am Bosporus« (KiWi 844) und »Rebellen« (KiWi 1399) veröffentlicht und den Band »Stuttgart 21. Die Argumente« (KiWi 1212) herausgegeben. 2006 wurde er mit dem Deutschen Krimipreis und 2012 mit dem Stuttgarter Krimipreis ausgezeichnet.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Schorlau ist ein dezidiert politischer Krimiautor.« Frankfurter Rundschau
Spannung und Aufklärung – diese einzigartige Kombination ist das Markenzeichen der Kriminalromane um den Stuttgarter Privatermittler Georg Dengler. Beiden Ansprüchen wird Wolfgang Schorlau auch in seinem neuen Roman, in dem es um die Machenschaften der Pharmaindustrie geht, glänzend gerecht.
Der sechste Fall führt Georg Dengler nach Berlin. Professor Dr. Bernhard Voss, Arzt an der Charité, wird eines schrecklichen Verbrechens verdächtigt. Sein Verteidiger bittet Dengler um Unterstützung. Dieser steht plötzlich vor einem Abgrund an Manipulationen.
Fast beiläufig erzählt Schorlau zugleich eine Geschichte über den Widerstand gegen »Stuttgart 21«, in dem Denglers Sohn Jakob aktiv ist.
»Zwei Jahre lang habe ich über die Pharmaindustrie recherchiert«, schreibt Schorlau im Nachwort. »Ich kann es nicht anders sagen: Diese Industrie wird von einer beispiellosen kriminellen Energie getrieben.«
Inhaltsverzeichnis
Disclaimer
Widmung
Motto
Erster Teil
1. Glück
2. Berlin im Dezember 2010: Entführung
3. Ankommen
4. Aufwachen
5. Telefonat
6. Erster Tag
7. Supercomputer
8. Lehmann
9. Seminar
10. Erste Nacht
11. Haftschock
12. Zweiter Tag
13. Akten
14. Zweite Nacht
15. Clapton
16. Dritter Tag
17. Sonnenblende
18. Erneut Moabit
19. Finn Kommareck
20. Christine Leonhard-Voss
21. Rüdiger Voss
22. Ausfahrt
Zweiter Teil
23. Dritte Nacht
24. Verfolgung
25. Vierter Tag (1)
26. Verloren
27. Vierter Tag (2)
28. Fahndung
29. Vierter Tag (3)
30. Friedrichstraße
31. Vierter Tag (4)
32. Am Abend
33. Birgit (1)
34. Sehnsucht
35. Birgit (2)
36. Im Taxi
37. Birgit (3)
38. Vierter Tag (5)
39. Tiergartentunnel
40. Bauchhöhle
41. Joggen
42. Fünfter Tag (1)
43. Anrufe
44. Schmerz
Dritter Teil
45. Schwarzer Donnerstag (1)
46. Krisenkonferenz
47. Schwarzer Donnerstag (2)
48. Fünfter Tag (2)
49. Verhöre
50. Verdorben
51. Nur Mut
52. Mappus weg
53. Dengler und Kommareck
54. Anonyme Meldung
55. Flucht (1)
56. Fünfter Tag (3)
57. Fahndung
58. Domina
59. Diagnose
60. Flucht (2)
61. Caipirinha
62. Der Polizeichef
63. Daniel
64. Olga
65. Spülen
66. Dahlem
67. Blaulichtparty
68. Fünfter Tag (4)
69. Dr. Rapp
70. Foto
71. Olga ermittelt
72. Dengler in der K-Bar
73. SMS an Daniel
74. Nelken
75. Erste Lüge
76. Verhaftung
77. Ende
78. Konferenz
Epilog
Nachwort
Lesetermine des Autors
Leseprobe »Black Forest«
Informationen zu diesem Buch:
www.schorlau.com
Dieses Buch ist ein Werk der Fiktion.
Alle Figuren entspringen meiner Phantasie.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen wäre Zufall.
Dieses Buch ist den mutigen Stuttgarter Jugendlichen gewidmet, die sich am 30. September 2010 im Stuttgarter Schlossgarten mit Sitzblockaden gegen die Zerstörung ihrer Stadt gewehrt haben.
In Erinnerung an Eddie Riethmüller, Roman Greschbach, Sieger Ragg und Peter O. Chotjewitz
Was sind das für Zeiten, wo
Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist
Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!
Bertolt Brecht, An die Nachgeborenen
Der Geschäftsmann hat gar oft ein enges Herz,
weil seine Einbildungskraft, in den einförmigen
Kreis seines Berufs eingeschlossen, sich zu fremder
Vorstellungsart nicht erweitern kann.
Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen, Sechster Brief
Das Einfache kompliziert zu machen, ist alltäglich;
das Komplizierte einfach zu machen, schrecklich einfach –
das ist Kreativität.
Charles Mingus
Erster Teil
1.Glück
Dengler flog.
Mit ausgebreiteten Armen schwebte er über eine weite Wiese, unter ihm frisches helles Frühlingsgrün, gesprenkelt mit dem warmen Gelb jungen Löwenzahns. Eine Bewegung der rechten Hand genügte – schon bog er in eine weitgezogene Rechtskurve. Ein Gedanke – und er beschleunigte den Flug, angezogen von der strahlenden Zitronenfarbe des Rapsfeldes am Horizont, dazwischen das silberne Band eines Flusses.
Er hatte keine Angst, er fürchtete sich selbst dann nicht, als zwei Hochspannungsmasten auftauchten. Nur eine kleine Kopfbewegung, schon stieg er hoch und höher, unter sich sah er Landschaft und Masten und Leitungen. Nichts konnte ihm gefährlich werden. Er fühlte sich frei, der Sonne und dem Glück so nah wie nie.
Georg Dengler senkte den Kopf, und in einem weiten Bogen flog er auf den Fluss zu, folgte seinem Lauf, beschleunigte über dem glitzernden Wasser das Tempo, raste dicht über der Oberfläche dahin.
Ob ich wohl träume, fragte er sich im Traum.
Er erwog diesen Gedanken ernsthaft, verwarf ihn dann aber wieder. Denn der kühle Wassernebel in seinem Gesicht war real, die Sonne wärmte seinen Rücken wirklich. All das war wahr. Spürbar. Nein, das konnte kein Traum sein.
Wann hatte er sich zuletzt so unbeschwert gefühlt? So leicht, so frei?
Das Rapsfeld kam näher. Wie ein zitronenfarbenes Meer lag es vor ihm, milder Duft ging von ihm aus, ein betörend schöner Geruch. Endlos segelte er durch diese Symphonie aus Gelb und Sonne und Wärme. Ein leichter Windstoß erfasste ihn, fast hätte er das Gleichgewicht verloren, aber er breitete die Arme aus und hatte sofort wieder die Balance gefunden. Aus dem Augenwinkel nahm er einen winzigen Schattenpunkt wahr, der das Lichtspiel durchbrach und sich näherte. Er spürte die Berührung seiner Schulter. Etwas Kleines hatte sich dort niedergelassen, etwas, was sich an ihm festkrallte. Er bewegte die Schulter. Er wollte es abschütteln.
2.Berlin im Dezember 2010: Entführung
Dirk Assmuss war ein kleiner, runder Mann, ein erfolgreicher Mann. Am Tag seiner Entführung kämpfte er sich durch das Berliner Schneegestöber. Er hatte den Kragen seines Mantels hochgestellt, mit der behandschuhten rechten Hand drückte er die beiden losen Kragenenden zusammen. Es nutzte wenig. Ein eisiger Wind fegte durchs Brandenburger Tor, und Assmuss, der ein gläubiger Mensch war, fragte sich, warum Gott die Stadt so hasste, dass er sie mit einem solchen Winter strafte und mit einem unfähigen Senat, der es nicht einmal schaffte, die Bürgersteige von Berlins Prachtstraße Unter den Linden vom Eis räumen zu lassen.
Obwohl es erst Nachmittag war, strahlten die Straßenlichter, die Weihnachtsbäume und die weihnachtlich dekorierten Schaufenster in die frühe Dunkelheit. Eine Gruppe japanischer Touristen, alle in sanftblauen Moonboots, trödelte kichernd vor ihm her, zwang ihn, für einen Moment auf die schneematschige Straße zu wechseln, um sie zu überholen.
Er hätte ein Taxi nehmen sollen.
Aber er hatte gedacht, die frische Luft würde ihm guttun. Nun bereute er diesen Entschluss. Die Kälte kroch in seine Hosenbeine, nahm den Zehen jedes Gefühl und quälte seine Ohren mit tausend eisigen Nadelstichen.
Wer Assmuss nicht kannte, würde ihn für einen gemütlichen Mann halten, für einen Typen wie den Großvater aus der Fernsehwerbung, der Kindern Karamellbonbons andreht. Fast eine Glatze, nur wenig graue Haare, ein volles Gesicht mit einigen Falten um die Augen- und die Mundwinkel. Auf den zweiten Blick wurde man jedoch gewahr, dass er sich trotz seiner fast hundert Kilo schnell und geschmeidig bewegte. Zielstrebigkeit ging von ihm aus, eine ruppige Energie, die nur wenige Männer mit diesem Körperumfang auszeichnet.
Assmuss hatte es weit gebracht. Nicht ohne Grund war er Europachef von Peterson & Peterson. Er hatte sich einen Platz im Heiligtum des Konzerns erobert, dem Board of Directors, am Firmensitz in Atlanta. Nicht nur das Wall Street Journal und das Handelsblatt handelten ihn als den künftigen Chef von Peterson & Peterson.
Er war gebürtiger Rheinländer, also war er katholisch und hatte Humor, und er wusste ihn einzusetzen. Er verfügte über einen unerschöpflichen Fundus an Tünnes-und-Schäl-Witzen, die er abends in kleineren Runden seinen Angestellten erzählte. Damen begeisterte er manchmal mit gemäßigten Anzüglichkeiten, und für große Tischrunden hatte er neben einigen anspruchsvollen jüdischen Witzen auch längere Zitate von Jaspers, Schopenhauer und Hannah Arendt parat. Er war ein Mann, der Eindruck machte, egal auf welchem Parkett.
»Unermüdlich im Dienst an der Gesundheit: Dirk Assmuss widmet sein ganzes berufliches Dasein dem medizinischen Fortschritt«, hatte die Frankfurter Allgemeine in einem Porträt über ihn geschrieben. Sein Vater hatte gewollt, dass er Arzt wird wie er selbst. Heilkunst und Kunst – das waren die beiden großen Leidenschaften in seinem Elternhaus gewesen. Heilkunst, dafür stand der Vater – und die Mutter wollte, dass der Sohn ein Künstler wird. Schon als Zehnjähriger hatte Dirk Assmuss mehr Museumsbesuche hinter sich als ein normaler Mensch in seinem ganzen Leben. Er erinnerte sich an die nicht enden wollenden Aufenthalte im Picasso-Museum in Barcelona. Sein Vater pilgerte regelmäßig zu den Kranken- und Lazarettbildern, die Picasso als junger Mann gemalt hatte. Wie hingebungsvoll die Mutter am Bett ihres Kindes sitzt! Wie gut der Maler die Aufmerksamkeit des Arztes getroffen hat und das Fahle im Gesicht des Patienten auf einen Ernährungsmangel schließen lässt!
Assmuss enttäuschte seinen Vater. An zwei Zehnteln im Notendurchschnitt scheiterte die Zulassung zum Medizinstudium. Nie hatte er sich als größerer Versager gefühlt als an dem Tag, als er sein Abiturzeugnis dem Vater vorlegte. Er hatte im Flur der Praxis warten müssen. Der Vater kam aus dem vorderen Behandlungszimmer, nahm das Zeugnis, las es, gab es ihm zurück und ging wortlos zurück zu seinem Patienten.
Auch über die Berufswahl seines Sohnes verlor er nie ein Wort. Selbst später, als Assmuss bereits erfolgreich war und viel mehr als sein Vater verdiente (er erwähnte es scheinbar beiläufig zweimal, einmal bei einem Abendessen, als er seine Eltern besuchte, einmal als er sie nach Barcelona einlud und sie – ganz ohne Museumsbesuch – ins Los Caracoles führte, eines der bekanntesten Restaurants der Stadt, ein Lokal, das der Vater der Preise wegen niemals besucht hatte): Nie redeten sie über seinen Beruf. Die Enttäuschung, die er seinem alten Herrn bereitet hatte, hätte er gern aus der Welt geschafft, sie war, so dachte er manchmal, der eigentliche Stachel, der ihn in seinem jetzigen Beruf so unentwegt antrieb.
Aber er enttäuschte auch seine Mutter. Sie hatte ihr Leben dem Ziel gewidmet, aus dem einzigen Sohn einen Künstler zu machen. Ihr war das Künstlerische nicht gegeben. Sie wusste es, denn sie malte auch. Mit großer Begeisterung spannte sie eine leere Leinwand in den Rahmen – und betrachtete mit der immer gleichen Enttäuschung das fertige Bild: Wie ein Kind, dachte sie, ich male wie eine Vierzehnjährige. Nie gelang es ihr, die Bilder, die sie manchmal klar, manchmal diffus in sich trug, angemessen auf die Leinwand zu übertragen. Ihr Sohn sollte es besser können. Und so schleppte sie ihn von klein auf in Museen und auf Vernissagen, in Ausstellungen und Ateliers.
Assmuss studierte Biologie an der Universität Hohenheim, medizinnah einerseits, aber inhaltlich und geografisch weit genug entfernt vom heimatlichen Brühl und dem stummen Vorwurf des Vaters sowie der Enttäuschung der Mutter, der alles im Gesicht stand und die nie darüber sprach. Nach dem Studium zog er ins Rheinland zurück. Mit dem ruhigeren Menschenschlag im Süden war er nie richtig warm geworden.
1980 unterschrieb er bei Bayer seinen ersten Arbeitsvertrag, zehn Jahre später schickte ihn der Konzern als Geschäftsführer einer Tochterfirma nach Japan. 1995 wechselte er zu Bayers Konkurrenten Peterson & Peterson, leitete von London aus deren Geschäftsfelder Pharma und Consumer Care. Seit 2000 war er für das europaweite Pharmageschäft mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln verantwortlich. Und er war, wie gesagt, auf dem Sprung nach ganz oben.
In Berlin hatte er ein Problem zu lösen.
Der deutsche Interessenverband funktionierte nicht mehr. Assmuss hatte mit Marlene Kritzer, der Geschäftsführerin des Verbandes der forschenden Pharmaunternehmen VFP, im Margaux zu Mittag gegessen. Anschließend hatten sie noch zwei Stunden in ihrem Büro am Hausvogteiplatz gesprochen.
Sie war unbelehrbar.
Assmuss ärgerte sich.
Sie machte zu viele Fehler.
Und sie überschätzte sich.
Wochenlang hatte die Kritzer die gesamte Lobbymaschine des Verbandes eingesetzt, um die Wahl des gesundheitspolitischen Sprechers der konservativen Parlamentsfraktion zu beeinflussen. Sie hatte einen verbandsnahen Abgeordneten durchbringen wollen und scheiterte damit. Der neue Sprecher äußerte sich nun öffentlich und halböffentlich abfällig über den Verband und damit auch über die »Großen Sechs«, über Peterson & Peterson, Bayer, Pfizer, Böhringer, Merck und Novartis, die im Verband den Ton angaben.
Das war schlecht fürs Geschäft.
Schlecht für die Pläne von Peterson & Peterson.
Schlecht für seine Pläne.
Sehr schlecht.
Ihn ärgerte besonders, dass Marlene Kritzer ihren Fehler nicht einsah.
Mangelnde Fähigkeit zur Selbstkritik produziert weitere Fehler, dachte Assmuss, während er vorsichtig den eisglatten Bürgersteig Unter den Linden hinaufging.
Er hätte ein Taxi nehmen sollen.
Er hatte der Kritzer viel nachgesehen. Vor einigen Monaten hatte die gesamte Presseabteilung des Verbandes gekündigt. Alle. Sogar die Schreibkräfte. Sie hielten es mit der Chefin nicht mehr aus. Sie würde die Angestellten tyrannisieren, hieß es, jeder müsse zu viele unbezahlte Überstunden machen, die Atmosphäre sei miserabel, die Chefin launisch und so weiter. Jeder, der die Kritzer kannte, wusste, dass die Leute recht hatten. Damals hatte er Kritzer gestützt. Damals war sie noch erfolgreich gewesen. Aber das hatte sich geändert.
Assmuss wusste, wann es Zeit war zu handeln.
Eine seiner Stärken.
Ihn fror.
Weihnachtliche Stimmung in Berlin. Er nahm sie nicht wahr.
Es stand viel auf dem Spiel.
Zwei Weihnachtsmänner kamen ihm entgegen. Einer trug einen schweren braunen Sack, der andere eine überdimensionierte Schelle. Die beiden unterhielten sich angeregt, ihre Weihnachtsmannschicht schien zu Ende zu sein. Sie wirkten entspannt und fröhlich.
Morgen um zehn Uhr würde die Verbandskonferenz beginnen. Die Elite der Branche traf sich zur zentralen Jahrestagung. Fünfunddreißig Unternehmen, keines unter 2 Milliarden Jahresumsatz. Aber für heute Abend hatte er die Vertreter der Großen Sechs zum Essen ins Adlon geladen. Dieser Kreis würde die wichtigen Entscheidungen treffen.
Er würde ihnen vorschlagen, Marlene Kritzer abzulösen.
Der eine der beiden Weihnachtsmänner hob seine Schelle, läutete und lachte. Assmuss drängte an ihm vorbei. Ihn fror noch immer.
Aber endlich war er am Adlon.
»Herr Dr. Assmuss? Eine junge Dame möchte Sie sprechen.«
Dirk Assmuss hob den Kopf und sah auf den Zettel, den der Hoteldiener ihm reichte.
Ich muss dich dringend sprechen. Susan
Das war Susans Handschrift, kein Zweifel, die korrekte Reihung der Buchstaben, nahezu alle miteinander verbunden. Nur das I stand allein. Typisch für Susan.
Aber wieso war sie in Berlin?
Sie müsste doch in London sein.
»Bitte, folgen Sie mir«, sagte der Hoteldiener und ging voran.
Assmuss folgte.
Der junge Mann in der eleganten grauen Hoteluniform schritt zügig voraus. Vom Hoteleingang des Adlon lief er mit schnellen Schritten an den wartenden Taxen vorbei, schaute sich noch einmal um, winkte Assmuss ermunternd zu, überquerte die Wilhelmstraße und steuerte auf einen dunklen Van zu, der einige Meter weiter vor einem Souvenirshop am Straßenrand parkte.
Es muss etwas schiefgegangen sein, dachte Assmuss. In Gedanken blätterte er die Geschäftsvorfälle des Londoner Büros durch. Keiner schien ihm schwerwiegend genug, dass Susan ihn nicht hätte anrufen können. Er hatte das Handy doch an. Während er seine Schritte verlangsamte, zog er das Blackberry aus der Tasche. Niemand hatte versucht, ihn zu erreichen, auch Susan nicht. Einige Mails waren eingegangen, aber keines von Susan.
Seine Gedanken rasten.
Sie kündigt, dachte er. Vielleicht kündigt sie.
Aber auch diese Überlegung verwarf er sofort wieder. Das hätte sie ihm auch übermorgen persönlich sagen können. Für die Mittagszeit war ein Treffen in London verabredet. Nein, es musste etwas sehr Wichtiges sein. Etwas, was den Vorstand betraf. Vielleicht hatte es mit ihm zu tun.
Sie wollen mich feuern.
Aber es gab keine Anzeichen dafür. Der Aufsichtsrat hatte nicht getagt. Außerdem hatte er einen guten Lauf. Die Zahlen stimmten. Wichtige Projekte liefen. Einige standen kurz vor der Markteinführung.
Vielleicht doch. Sie haben sich heimlich getroffen. Susan muss das mitgekriegt haben.
Beunruhigt beschleunigte er seine Schritte wieder.
Der Hoteldiener wartete vor dem Van auf ihn. Als Assmuss ihn erreichte, zog er die Tür auf.
»Bitte«, sagte der Mann.
Assmuss schaute verwirrt in das Wageninnere.
Er sah nichts. Er schob den Kopf vor.
»Susan?«, fragte er ins Dunkel.
Da traf ihn ein Schlag in den Rücken, ein Schlag mit solcher Wucht, dass er mit dem Oberkörper vornüber in den Wagen stürzte. Er fühlte, wie er an den Füßen hochgehoben und in den Van geworfen wurde. Dann klackte die Wagentür.
Der Hoteldiener war über ihm.
Ein zweiter Schlag traf ihn am Kopf, und er dachte nichts mehr.
3.Ankommen
Eine Fledermaus.
Dengler spürte, wie sie auf seinem Arm krabbelte. Sie wurde immer größer, schwerer, er spürte ihr Gewicht auf seinem Oberarm. Er wollte sich nach vorne beugen, damit sie von ihm abglitt. Er wollte weiterfliegen. Glücklich sein. Der Druck auf seinem Arm wurde fester.
»Sie müssen aufwachen«, sagte eine weibliche Stimme. »Wir landen in wenigen Minuten.«
Für einige Sekunden schwebte er im Zwischenreich von Schlaf und Wachen. Er wollte fliegen, weiter schweben. Doch langsam dämmerte ihm, dass er träumte.
Er weigerte sich, die Augen zu öffnen.
»Sie müssen Ihre Rückenlehne senkrecht stellen.«
Das Rapsfeld verschwand aus seinem Kopf.
»Bitte! Wir landen gleich.«
Dengler raffte sich auf. Er stellte seinen Sitz gerade. Von seinem Mittelplatz aus konnte er aus dem Fenster des Flugzeuges schauen. Die Maschine flog bereits tief. Er sah den Neckar, eingebettet in eine sommerliche Reben- und Industrielandschaft, und hörte das Summen der Hydraulik, als unter ihm das Fahrgestell ausfuhr.
Olga wartete auf ihn.
»Champagner!«, rief sie.
In der rechten Hand schwenkte sie eine Flasche Taittinger und in der anderen zwei Gläser.
Dengler küsste sie. Lange.
Neben ihnen machten zwei jüngere Männer anzügliche Bemerkungen, die er nicht genau verstand und auch nicht verstehen wollte. Eine ältere Frau schaute demonstrativ in die entgegengesetzte Richtung.
»Puh«, sagte Olga und streckte ihm die Flasche entgegen.
Dengler öffnete sie und füllte die beiden Gläser.
»Endlich bist du wieder da«, sagte sie. »War New York schlimm?«
»Sehr schlimm.«
Sie tranken, lachten, dann füllte Dengler die beiden Gläser erneut.
»Hast du etwas Nützliches gelernt?«, fragte sie, als sie später erschöpft in ihrem Bett lagen.
»Ja. Ich weiß jetzt, dass dein Gesicht aus 43 einzelnen Muskeln besteht«, sagte er und streichelte mit zwei Fingern ihre Stirn. »Manche davon kannst du willentlich bewegen, auf andere hast du keinen bewussten Einfluss.«
»Das FBI weiß etwas über meine Gesichtsmuskeln?«, fragte sie schläfrig.
»Alles.«
»Was?«
»Wenn du dich an etwas erinnerst, an etwas Schönes zum Beispiel …«
»Hmm, das mache ich gerade.«
»… dann wandern deine Pupillen nach links oben. Wenn du dir aber etwas ausdenkst, wandern sie nach rechts oben. Das kannst du nicht beeinflussen. Es ist hirnphysiologisch gesteuert. Unabänderbar. Wenn ich einen Zeugen frage, ob er sich an eine bestimmte Situation erinnert, und seine Augen wandern nach rechts oben, dann weiß ich, dass er lügt.«
»Aber ich habe meine Augen doch geschlossen.«
»Mist. Über das Erkennen von Lügnern bei geschlossenen Augen habe ich nichts gelernt.«
»Das kommt beim Seminar für Fortgeschrittene«, sagte sie schläfrig.
»Das Bundeskriminalamt wird mir keinen zweiten Kurs mehr sponsern.«
»Dann bleibst du hier. In meinem Bett. Für immer und ewig.«
»Das willst du?«
»Hmm.«
»Deine Pupillen wanderten eben nach rechts oben. Du hast es dir ausgedacht. Es ist geschwindelt.«
»Ich hab doch die Augen zu, du Lügner. Ich erkenne dich ganz ohne FBI-Seminar.«
Sie zog ihn an sich.
»In der Stadt herrscht Aufruhr«, sagte Mario. »Wir stehen vor einer revolutionären Situation.«
»Das ist völlig übertrieben«, sagte Martin Klein.
»Das ist totaler Quatsch«, sagte Leopold Harder.
»Eine revolutionäre Situation ist dadurch definiert, dass die unteren Klassen nicht mehr so wollen und die oberen nicht mehr so können wie bisher«, sagte Mario.
»Das könnte auf Stuttgart zutreffen«, gab Klein zu.
Denglers Freunde feierten seine Ankunft im Basta, dem Lokal, das im Erdgeschoss des Hauses lag, in dem Dengler, Martin Klein und Olga wohnten. Im ersten Stock waren Denglers Büro und Wohnung sowie Kleins Dreizimmerwohnung. Im zweiten Stock wohnte Olga.
»Aha, es geht immer noch um euren Bahnhof«, sagte Dengler. »Ich war fast den ganzen September nicht in der Stadt, hat sich also offenbar nicht viel getan in dieser Zeit.«
»Es ist eine bürgerliche Protestbewegung. Nicht die anarchistische Künstlerrevolte, von der Mario träumt, seitdem er auf der Welt ist«, sagte Leopold Harder.
»Davon träume ich, das stimmt. Ich träume von einer gerechten Gesellschaft.«
»Wir wollen bloß ein irrsinniges Bahnprojekt verhindern«, sagte Klein.
»So reden sie jeden Tag«, flüsterte Olga in Denglers Ohr. »Jeden Tag! Die ganze Stadt kennt kein anderes Thema. Der Bahnhof am Morgen, der Bahnhof am Mittag, der Bahnhof am Abend und auch in der Nacht. Montags rennen deine Freunde auf die Montagsdemo, dienstags treffen sich die Juristen, die Ärzte, die Unternehmer gegen Stuttgart 21, mittwochs findet ein Protest-Gottesdienst im Schlossgarten statt, donnerstags treffen sich neuerdings die Stuttgart-21-Befürworter zu einer Demonstration …«
»Demonstratiönle«, rief Klein dazwischen. »Zweihundert ältere Herren versammeln sich.«
»Freitags kann man zu den Senioren gegen Stuttgart 21 gehen, der Jugendinitiative gegen S 21, den Gewerkschaftern gegen S 21, man kann an einem Sitzblockadetraining teilnehmen oder …«
»… zu den Journalisten gegen Stuttgart 21 gehen«, sagte Harder, der als Wirtschaftsjournalist beim Stuttgarter Blatt arbeitete.
»Es gibt Psychologen gegen S 21«, sagte Klein, »Mediziner gegen S 21, es gibt …«
»Samstags findet die Großdemo gegen Stuttgart 21 statt«, fuhr Olga fort. »Nur sonntags ruht der Protestbetrieb. So sieht das aus in dieser Stadt.«
»Jeden Tag um 19 Uhr macht die ganze Stadt Lärm. Eine Minute lang. Das ist der Schwabenstreich. Eine gute Sache, endlich lernt man die Nachbarn auf den anderen Balkonen und hinter den Fenstern kennen.«
»Da kommt New York echt nicht mit«, sagte Dengler.
Die Freunde lachten.
Der kahlköpfige Kellner nahm dies als Zeichen und brachte eine neue Flasche.
Die Stimmung war so ausgelassen, dass Dengler das Handy nicht hörte.
»Es klingelt«, sagte Mario.
Dengler zögerte. Eigentlich hatte er keine Lust, außerdem wusste er, dass Olga es nicht leiden konnte, wenn er bei jeder Gelegenheit ans Telefon ging. Dann stand er aber doch auf, ging an der Bar vorbei ins Freie und nahm das Gespräch an.
4.Aufwachen
Der Kopfschmerz war umfassend, dumpf und andauernd. Es fühlte sich an, als sei das Gehirn geschwollen und drücke mit Macht gegen die Schädelwand.
Bloß nicht bewegen.
Sein Mund war trocken. Die Zunge schien ebenfalls geschwollen zu sein.
Es ist nur ein Traum, dachte er. Wieder mal ein Albtraum. Ich schlafe, und wenn ich aufwache, liege ich in meinem Bett im Adlon.
Er hielt die Augen geschlossen. Doch er schlief nicht. Stattdessen konzentrierte er sich auf den Kopfschmerz, und dabei fiel ihm wieder ein, wie der Hotelpage ihn zu einem schwarzen Van gelockt hatte.
Er hatte einen Zettel von Susan gehabt.
Dirk Assmuss bewegte die Zehen seines rechten Fußes. Sie krümmten und streckten sich. Kein Problem. Er hob den Fuß. Auch kein Problem.
Ich wurde entführt. Wenn ich nicht träume, dann wurde ich entführt.
Assmuss öffnete die Augen. Gleißendes Licht blendete ihn, er schloss sie sofort wieder. Nach ein paar Sekunden blinzelte er und wartete, bis sich seine Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten.
Dann sah er sich um.
Er lag auf einem großen Bett, wohl zwei Meter lang und zwei Meter breit. Metallgestell, mattschwarz, am Kopfende ornamental verschlungen. In der Mitte entdeckte er eine Handschelle, deren erste Fessel den Metallrahmen umschloss, die zweite hing an einer silbernen Kette, die sich über ein blaues Leintuch schlängelte und dann auf dem Fußboden verschwand. Assmuss’ Blick folgte ihr. Sie tauchte einen halben Meter weiter auf, führte zu einer zweiten Handschelle, deren erste Fessel die Verbindung zur Kette hielt und deren zweite sein Handgelenk umschloss.
Panisch richtete er sich auf.
Der Schmerz in seinem Kopf explodierte.
Assmuss legte sich zurück.
Ich muss ruhig bleiben. Peterson wird Lösegeld zahlen. Birgit wird Lösegeld zahlen. Es sind Betriebsausgaben, dachte er. Steuerlich absetzbare Betriebsausgaben. Die zahlen bestimmt. Peterson muss das bezahlen, nicht Birgit und ich. Die lassen mich doch nicht hängen.
Er spürte, wie erneut Panik in ihm aufstieg.
Bleib ruhig.
Ob Birgit bezahlen wird?
Plötzlich war er sich dessen nicht mehr sicher.
Vorsichtig richtete er sich auf.
Er befand sich in einem hellen Raum mit weiß gestrichenen Wänden. Neben dem Bett war ein Tisch. Zwischen Tisch und Bett stand ein weißer Eimer, zur Hälfte mit Wasser gefüllt, daneben ein zweiter Eimer mit einem festen Deckel und einer Rolle weißes Toilettenpapier. Auf dem Tisch: eine Plastikflasche mit Mineralwasser und ein Glas. Daneben lagen einige Aspirintabletten in grüner Verpackung. Hinter dem Tisch: ein großer metallfarbener Kühlschrank und ein weiß emaillierter Gasherd. Links daneben eine Tür. Sie war offen. Rechts vom Kühlschrank sah Assmuss eine zweite Tür. Verschlossen und massiv. Daneben auf etwa zwei Meter Höhe zwei vergitterte Fenster, durch die Tageslicht ins Zimmer fiel, darunter zwei Heizkörper. Es musste sich um eine Souterrain- oder Kellerwohnung handeln.
Assmuss überlegte, ob er um Hilfe rufen sollte. Er könnte SOS-Signale gegen die Heizkörper klopfen.
Er stand auf und prüfte, wie weit er mit seiner Fessel gehen konnte.
Er kam nur bis zum Tisch.
Er erreichte weder die Fenster noch den Kühlschrank oder den Herd, auch nicht die beiden Heizkörper.
Er setzte sich an den Tisch.
Er stützte den Kopf in seine Hände.
Er warf zwei Aspirin in das Glas, goss Wasser ein, wartete, bis die Tabletten sich aufgelöst hatten, und trank das Glas aus.
Er ging zurück zum Bett, legte sich hin und starrte die Decke an.
5.Telefonat
»Hallo?«
»Guten Abend, hier Lehmann, Dr. Hartmut Lehmann. Spreche ich mit Georg Dengler aus Stuttgart?«
»Ja.«
»Ich möchte Sie engagieren. Können wir kurz darüber reden?«
»Um was geht es?«
»Um den Fall Voss. Sie haben schon davon gehört?«
»Nein.«
»Professor Voss ist ein Freund von mir. Ich bin sein Anwalt seit vielen Jahren. Wir sind beide Mitglieder im gleichen rotarischen Club hier in Berlin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bernhard so etwas getan hat. Ich kenne ihn schon seit zehn Jahren. Seit mehr als zehn Jahren. Seine Familie. Seine beiden Kinder. Ich brauche Hilfe bei seiner Verteidigung. Sie wurden mir empfohlen.«
»Was wird Ihrem Freund vorgeworfen?«
»Mord! Lesen Sie keine Zeitungen? Er sitzt in Moabit ein.«
»Ich war ein paar Wochen im Ausland. Sie müssen mir schon etwas mehr über den Fall erzählen.«
»Können Sie nach Berlin kommen?«
»Sicher. Wann?«
»So schnell wie möglich. Morgen?«
Dengler zögerte. Er wollte keinen neuen Auftrag. Nicht sofort. Er hatte sich darauf gefreut, ein paar Tage mit Olga zu verbringen.
Andererseits: Sein Konto war leer.
Es gab eine erprobte Methode: Wenn er einen Auftrag lieber nicht annehmen wollte, verlangte er einfach ein überhöhtes Honorar. Dann erledigte sich die Sache meist von allein.
»Kennen Sie meine Konditionen?«, fragte er. »180 Euro pro angefangene Stunde plus Mehrwertsteuer und Spesen.«
»Das geht in Ordnung«, sagte der Mann, ohne zu zögern. »Seien Sie morgen um 14 Uhr in meiner Kanzlei. Geht das? Dr. Lehmann und Partner. Friedrichstraße 71.«
Dengler schwieg verblüfft.
»Hallo? Sind Sie noch dran?«, fragte der Mann.
»Um 14 Uhr bin ich bei Ihnen.«
»Kennt ihr zufällig den Fall Voss?«, fragte er, als er zurück an den Tisch kam.
»Scheußlich«, sagte Olga.
»Dieses Schwein«, sagte Mario.
»Noch gilt die Unschuldsvermutung. Der Mann ist noch nicht verurteilt«, sagte Leopold Harder.
»Könnt ihr mir mal sagen, um was es geht? Ich war drei Wochen nicht da, schon vergessen?«
Harder berichtete: »Einem Berliner Arzt wird vorgeworfen, ein neunjähriges Mädchen umgebracht zu haben. Erst hat er es offenbar entführt. Mehr als zwei Wochen lang wurde das Kind gesucht. Alle Zeitungen druckten das Bild. Die Eltern appellierten im Fernsehen an den Entführer. Fürchterliche Geschichte. Wir hatten jeden Tag irgendeine Story im Blatt. Einige Tage lang bestand die Hoffnung, dass das Mädchen noch lebend gefunden wird. Dann wurde sie gefunden: vergewaltigt und erschlagen. Schon am nächsten Tag wurde dieser Kerl festgenommen: Dr. Voss. Die Zeitung mit den großen Buchstaben war live dabei. Sie brachte ein Bild direkt von der Verhaftung, der Täter mit irrem Gesicht, grüner OP-Schürze, voll mit Blut. Die Beweise sollen eindeutig sein.«
»Was hast du damit zu tun?«, fragte Olga.
»Ich wurde eben von seiner Verteidigung engagiert.«
Nach dem Sex stritten sie sich.
»Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn du so einem Kerl hilfst«, sagte sie.
»Ich wollte diesen Auftrag auch nicht. Ich … noch habe ich ja nicht sicher zugesagt.«
»Aber du fährst nach Berlin. Morgen schon. Wir haben uns drei Wochen nicht gesehen. Drei Wochen, Georg. Wir haben einiges aufzuholen.«
»Ich weiß, aber …«
Wie sollte er es erklären?
»Ich hab den Preis um die Hälfte erhöht, aber der Anwalt will mich trotzdem, und jetzt muss ich da hin. Ich höre mir die Geschichte mal an.«
»Was redest du? Sag ab. Das ist einfach. Sag einfach ab.«
»Das geht nicht. Ich hab zugesagt.«
»Weißt du, dass der Kerl voller Blut war, als er verhaftet wurde? Eklig. Er sieht aus wie ein Mörder. Und du sollst keinem Mörder helfen. Keinem Kindermörder, Georg!«
»Vielleicht kann ich ihn sprechen und sehen, ob er lügt. Ich meine, das ist das, was ich gerade gelernt habe. Ich würde mein neues Wissen gern ausprobieren. Wenn er es war, ist der Auftrag ja schnell erledigt, dann bin ich auch schnell wieder da.«
Dengler schwang sich aus ihrem Bett. Er ging in das Zimmer nebenan, wo Olgas Computer standen.
»Du hast ja neue Hardware«, rief er.
»Ja«, sagte sie. »Einen neuen Supercomputer. Auch ich habe mich in der Zwischenzeit weitergebildet. Da du ja nie da bist, kann ich dir leider nichts von dem erzählen, was mich beschäftigt.«
Sie stand nun nackt in der Tür.
»Komm ins Bett und vergiss diesen Mörder.«
»Gleich.«
Er startete die Suchmaschine und buchte den frühen Flug nach Berlin.
6.Erster Tag
Assmuss wartete.
Endlos lange.
Zweimal pinkelte er in den weißen Eimer.
Die Kopfschmerzen zogen sich langsam zurück.
Draußen wurde es dunkel.
Er nahm noch ein Aspirin.
Gestern Abend hatte man ihn entführt, und noch immer hatte er niemanden gehört oder gesehen, wusste nicht, wo er war und warum er hier war.
Seine Gedanken drehten sich im Kreis. Bestimmt hatten die Entführer ihre Forderungen bereits gestellt. Vielleicht würde Peterson schon morgen zahlen.
Gleichzeitig wusste er, dass das kaum realistisch war. Wenn es um Geld ging, und um was sollte es sonst gehen, würde eine Transaktion in der Größenordnung, mit der man rechnen musste, nicht so schnell erfolgen. Trotzdem tröstete dieser Gedanke.
Ich schlafe ein, und morgen bin ich frei.
Er sah sich auf einer Pressekonferenz. Eine schöne dunkelhaarige Journalistin fragte ihn: Wie haben Sie nur diese schlimmen Tage überstanden?
Er schloss die Augen.
Es war nur ein Tag, hörte er sich sagen. Ich war gefesselt. Aber ich habe mich zur Ruhe gezwungen. Er sah in die bewundernden Augen der Journalistin.
Blitzlichtgewitter.
Seine Ernennung zum Chairman von Peterson & Peterson.
Was aber, wenn Peterson nicht zahlt?
Sein Herz raste plötzlich. Die Kehle fühlte sich wund an.
Er musste sich beruhigen.
Er atmete langsam durch die Nase ein und durch den Mund aus. Einmal, zweimal, dreimal. Wird Birgit bezahlen?
Sicher wird sie das.
Er schloss die Augen und stellte sich wieder die Pressekonferenz vor. Assmuss als Held.
Inmitten dieser Träumereien hörte er ein Geräusch.
Ein Schlüssel drehte sich zweimal im Schloss.
Assmuss richtete sich auf.
Er erschrak nicht.
Der Mann sah so aus, wie er sich einen Entführer vorgestellt hatte: schwarze Wollmaske, schwarze Jeans, schwarzer Pullover und schwarze Handschuhe. In der Hand trug er eine weiße Plastiktasche. Erstaunlicherweise war der Mann nicht viel größer als er selbst.
Er sagte kein Wort, und auch Assmuss blieb still. Der Mann ging um den Tisch herum, stellte die Tüte auf den Tisch, öffnete sie, nahm eine weiße Pappschachtel heraus und schob sie auf die andere Tischseite.
»Ich hoffe, Sie mögen Thailändisch.«
Seine Stimme klang angenehm. Tief, ohne ausländischen Einschlag. Kein Dialekt. Die Wollmaske dämpfte den Ton.
Assmuss nickte.
Der Entführer legte eine Serviette und eine Plastikgabel neben die Schachtel.
»Bier oder Cola?«
Assmuss schluckte. Cola wäre vernünftig …
»Bier, bitte.«
Der Mann zog zwei Dosen Heineken aus der Tüte und stellte sie auf die andere Tischseite.
»Essen Sie«, sagte er und setzte sich.
Assmuss hatte Hunger. Er stand auf und setzte sich an den Tisch.
Er sah zu dem Mann gegenüber.
Er ist stärker als ich, dachte er. Er hat die Tür nicht abgesperrt.
Ich kann ihn aber wohl kaum mit einer Bierdose niederschlagen. Aber ich könnte den Tisch umkippen.
Und dann? Was nützte das?
Er zog an der Handschelle und öffnete die weiße Schachtel.
»Thaicurry«, sagte der Maskierte.
Es roch gut. Assmuss aß.
Nach der zweiten Dose Heineken sagte der Mann: »Wollen Sie duschen?«
»Ich will wissen, was Sie von mir wollen.«
»Reden.«
»Reden?«
»Ja.«
»Mehr nicht?«
»Nein.«
»Kein Geld?«
»Kein Geld.«
»Über was wollen Sie mit mir reden?«
»Über Ihr Geschäft.«
»Über mein Geschäft?«
»Wie Sie Ihr Geschäft betreiben.«
»Schickt Sie Pfizer?«
»Nein.«
»Boehringer?«
»Nein.«
»Ein anderer Wettbewerber?«
»Ich komme nicht von der Konkurrenz.«
»Sie wollen wissen, wie Peterson sein Geschäft betreibt?«
»Ja.«
»Warum?«
»Sagen wir: Es interessiert mich.«
»Und dann?«
»Dann können Sie gehen.«
»Einfach so?«
»Ja. Ich werde Sie freilassen. Versuchen Sie nicht, mich zu identifizieren, zu finden, zu jagen. Dann passiert Ihnen nichts.«
»Hören Sie. Ich bin kein Chemiker oder Forscher oder so was. Ich bin eher Kaufmann. Ich kenne keine Rezepturen. Ich kann Ihnen keine Forschungsgeheimnisse verraten, weil ich sie nicht kenne.«
»Mir genügt das, was Sie wissen.«
»Mhm. Und wie lange wird das alles dauern?«
»Bis Sie alle Fragen beantwortet haben.«
»Und dann lassen Sie mich frei?«
»Ja.«
»Gibt es an der Sache einen Haken?«
»Ja.«
»Welchen?«
»Wenn Sie mich belügen, stehe ich auf und gehe – und komme erst am nächsten Tag wieder zurück. Sie bleiben dann einen Tag länger hier.«
Der Mann wollte etwas von ihm. Assmuss verstand noch nicht, an was genau der Mann interessiert war, aber es handelte sich offenbar um Informationen. Wenn er etwas von ihm wollte, dann stärkte das seine Position. Auch wenn er ihm Handschellen verpasst hatte. Sein Instinkt sagte ihm, dass er den Preis hochhandeln konnte. Er fühlte sich plötzlich wie in einer Geschäftsverhandlung, und darin kannte er sich aus.
Assmuss war ein Verhandlungsprofi. Sein wichtigster Grundsatz dabei lautete: unwichtige Sachen zuerst. Er vereinbarte mit seinen Verhandlungspartnern stets eine Verhandlungsliste und sorgte dafür, dass die für ihn unwichtigen Verhandlungsgegenstände vorne standen und zuerst besprochen wurden. Bei diesen unwichtigen Punkten gab er immer nach. Aber erst nach einem langen Schauspiel. Es sah aus, als würde sein Gegenüber ihm diese Zugeständnisse abringen.
Großes Schauspiel.
Das kann ich nicht allein entscheiden, da muss ich meinen Aufsichtsratschef befragen – so lauteten seine Standardfloskeln. Diese Lieferfrist kann ich unmöglich einhalten, wir müssten andere Kunden benachteiligen, sagte er, obwohl genügend Waren auf Lager waren. Kann ich irgendwo ungestört mit meinem Lagerleiter telefonieren? Wenn er dann allein in einem Raum war, rief er seine Kinder an oder Susan im Londoner Büro und redete ein paar Minuten mit ihnen. Dann ging er kopfschüttelnd in die Verhandlung zurück. »Ausnahmsweise«, sagte er dann. »Und mein Entgegenkommen muss unter uns bleiben.«
Wenn dann die wirklich wichtigen Dinge verhandelt wurden, meist war das der Preis, schaltete Assmuss um. »Ich habe Ihnen jetzt bei fünf wichtigen Punkten nachgegeben. Wir wollen doch eine langjährige Partnerschaft begründen. Jetzt müssen Sie mir entgegenkommen.«
Es klappte fast immer.
»Ich kann Ihnen natürlich keine Firmengeheimnisse verraten«, sagte er zu dem Maskierten.
»Sie werden meine Fragen beantworten.«
Assmuss witterte eine erste Verunsicherung bei dem maskierten Mann.
»Vielleicht sollten wir erst mal eine Liste mit Fragen erstellen. Fragen sammeln. Dann bringen wir sie in eine Reihenfolge …«
»Was verkaufen Sie?«
»Was ich verkaufe? Das fragen Sie mich? Ich vertrete ein Unternehmen, das Arzneien herstellt und vertreibt. Ich verkaufe Medikamente.«
Assmuss fühlte sich plötzlich überlegen.
Der Mann hatte keine Ahnung. Vielleicht war es ein Irrer. Er würde behutsam mit ihm reden. Ihn überreden, ihn freizulassen. In Gedanken sah er sich wieder auf einer Pressekonferenz, und er hörte sich zu der dunkelhaarigen Journalistin sagen: Ich habe den Täter überzeugt, aufzugeben. Es ist mir gelungen …
Ich muss den Irren hinhalten, bis die Polizei hier ist.
»Ich frage Sie noch einmal: Was verkaufen Sie wirklich?«
Assmuss blinzelte.
Er verstand die Frage nicht.
»Medikamente. Soll ich Ihnen die Namen sagen? Pertrulacon, Mezanin …«
Der Maskierte sah ihn an.
»Glauben Sie mir nicht? Dann sehen Sie doch ins Internet. Ich habe einen Wikipedia-Eintrag. Lesen Sie ihn.«
Der Entführer stand auf.
»Wie Sie wollen. Sie haben einen weiteren Tag Zeit, sich die Antwort zu überlegen.«
Assmuss blieb keine Zeit zu reagieren.
Er war wieder allein.
7.Supercomputer
»Also, jetzt erzähl mir doch bitte, was dich beschäftigt, wenn ich nicht da bin«, sagte Georg, als er wieder bei Olga im Bett lag.
»Na, komm mit«, sagte sie, stand auf und lief nackt ins Nebenzimmer.
Dengler seufzte und folgte ihr.
»Das sind zwei Rechner«, sagte sie. »Der erste ist ein ganz normaler Rechner.«
»Auf ihm habe ich vorhin den Flug nach Berlin gebucht.«
»Der zweite Rechner hinterlässt keine Spuren – beziehungsweise, er verwischt sie gleich wieder hinter sich.«
Sie setzte sich an die Tastatur.
Dengler fuhr ihr sanft mit der Hand über die Brüste.
»Nicht. Später. Ich muss mich konzentrieren. Schau her.«
Wieder tippte sie etwas ein. Unverständliche Zeichen flossen von einer Bildschirmseite auf die andere. Das Logo der Deutschen Bahn tauchte kurz auf, flackerte ebenfalls über den Bildschirm. Ein Passwort wurde verlangt. Der Rechner arbeitete – und war plötzlich einen Schritt weiter. Das Symbol eines Ordners erschien. Olga klickte darauf. Mehrere Dateien wurden aufgelistet.
»Olga, was machst du? Das ist doch nicht legal.«
Sie drehte sich um.
»Ich hab mal das Gerede von Martin überprüft. Ich hab ihm nicht geglaubt, dass die Bahn in Stuttgart nur Mist baut.«
»Olga, um Gottes willen, was heißt denn: du hast überprüft?«
»Wir sind hier« – sie deutete auf den Bildschirm – »auf einem Server der DB Projektbau GmbH, eine Tochterfirma der Deutschen Bahn. Und das hier« – sie öffnete eine Datei – »ist eine interne Studie der Deutschen Bahn. Schau her, die Überschrift lautet: ›Chancen und Risiken‹. Sie listet die Risiken für Stuttgart 21 auf, bewertet sie nach der Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts und nennt die voraussichtlichen Kosten. Guck mal, die Ingenieure listen 121 Risiken auf – und eine Chance! Hier zum Beispiel steht, dass mehr Grundwasser abgepumpt werden muss als geplant. Fast doppelt so viel. Damit wird der Druck auf die unteren Gesteinsschichten reduziert, unter denen das Stuttgarter Mineralwasser liegt. Sie wissen nicht, ob diese Gesteinsschichten dann noch stabil sind. Wenn sie brechen, ist es vorbei mit dem Mineralwasser. Guck mal, hier! Hier werden die fehlenden Baugrundstücke aufgelistet, die die Bahn noch nicht besitzt. Und es wird berichtet, dass der Baugrund tückischer ist als offiziell zugegeben. Dann noch eine Stellungnahme einer Baufirma, die die technische Machbarkeit infrage stellt, dass der Bahnhof, also das Bonatz-Gebäude, während der Bauarbeiten wie geplant abgestützt werden kann. Georg, hier ist ein Bericht darüber, dass sich keine Firma findet, die unter dem Fabrikgelände von Daimler den geplanten Tunnel bohren will. Niemand will für mögliche Produktionsausfälle aufkommen. Es ist ein Chaos! Ich habe auch Listen mit der Personalfluktuation bei den Ingenieuren. Die wissen, dass das Ganze mit unverantwortlichen Risiken behaftet ist. Die kündigen, sobald sie einen anderen Job gefunden haben.«
»Olga, das ist illegal, was du da machst.«
»Hier, schau: eine Aktennotiz. Ich lese vor: ›Alle Risiken, die kostenmäßig bewertet werden, sind mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von weniger als 50 Prozent einzugeben. Risiken, die kostenmäßig noch nicht bewertet sind, können mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent eingegeben werden.‹«
»Olga, wenn die dir auf die Spur kommen …«
»Die rechnen sich das Projekt schön, und Zahlen, die Stuttgart 21 teurer machen, lassen sie einfach unter den Tisch fallen.«
»Olga, das ist illegal. Du darfst nicht in fremde Computer eindringen.«
»Hinter fast der Hälfte der 121 Risiken haben sie Zahlen geschrieben. Zusätzliche Kosten. Die Ingenieure der Bahn gehen davon aus, dass Stuttgart 21 um 1,264 Milliarden Euro teurer wird, als der Bahnvorstand nach außen kundtut.«
»Olga, vielleicht sind das Gangster. Aber es sind mächtige Gangster. Sie mögen es sicher nicht, dass du in ihren Rechnern spionierst.«
»Ich wollte nur wissen, ob Martin und Mario recht haben. Mehr nicht.«
»Und was machst du nun mit diesen Informationen?«
»Nichts.«
»Mmh.«
»Was heißt ›Mmh‹?«
»Kannst du Martin diese Dateien schicken, ohne dass dich jemand erwischt?«
»Sicher kann ich das. Aber«, sie imitierte seinen Tonfall, »es ist illegal, Georg.«
»Mmh.«
Olgas Finger klapperten über die Tastatur.
»Morgen wird sich Martin wundern. Und jetzt komm ins Bett.«
Sie nahm ihn an der Hand.
8.Lehmann
Lehmann & Partner residierte im vornehmen Teil der Friedrichstraße, Hausnummer 71. Eine der besten Adressen der Stadt für eine Anwaltskanzlei. Als er die Eingangshalle betrat, fühlte Dengler sich wie in einem amerikanischen Film: Sie war verschwenderisch groß, roter Marmor, kalte, gepflegte Atmosphäre. Ein Lift mit Liftboy brachte ihn in den zweiten Stock, wo sich ein heller Empfangsraum unmittelbar hinter der Aufzugstür öffnete.
Die Empfangsdame war wirklich eine Dame, blaues Kostüm, streng, sehr gepflegt. Sie gab ihm das Gefühl, als habe sie den ganzen Tag auf ihn gewartet.
»Herzlich willkommen, Herr Dengler. Hatten Sie einen guten Flug? Dr. Lehmann freut sich schon auf Ihren Besuch.«
Sie führte ihn in ein Besprechungszimmer. Auf dem Tisch standen zwei kleinere Flaschen Mineralwasser und eine silberne Kaffeekanne. Italienisches Design. Durch das Fenster sah Dengler den Stau unten auf der Straße, hastige Fußgänger und schlendernde Touristen. Die Menschen trugen Hemden und Blusen. Er erkannte die Amerikaner an den kurzen Hosen, die Französinnen an den sehr knappen Miniröcken. Es würde ein heißer Spätsommertag werden.
»Ich weiß es zu schätzen, dass Sie so schnell nach Berlin kommen konnten«, sagte der Anwalt, nachdem er die Türe geschlossen, sich gesetzt und Kaffee eingeschenkt hatte. Dengler schätzte ihn auf etwa sechzig Jahre, weiße Haare, dünn, aber immer noch mit ein paar Locken im Nacken, schwarze Brille, grauer Anzug, gerader Schnitt, erkennbar nicht billig. Fester Händedruck, feines Lächeln.
»Lassen Sie mich gleich zur Sache kommen.«
Dengler zog sein schwarzes Notizbuch aus der Innentasche seines Jacketts.
»Bernhard Voss ist ein Freund. Bis vor Kurzem dachte ich, ich kenne ihn gut. Nun sitzt er wegen eines scheußlichen Verbrechens in Moabit. Ich bin kein Strafrechtler. Mein Fachgebiet ist Vertragsrecht. Aber wir haben natürlich auch einige Strafrechtler in der Kanzlei. Trotzdem brauchen wir jemanden, der die Fakten prüft. Neue Fakten sucht. Verstehen Sie?«
Dengler verstand nicht, aber er nickte.
»Die Beweislage ist verheerend. Was wissen Sie mittlerweile über den Fall?«
»Nur das, was ich in den Medien finden konnte. Kurz zusammengefasst ist das: Ihr Freund soll die neunjährige Jasmin Berner entführt, vergewaltigt und getötet haben. Was sind die wichtigsten Beweise?«
»Jasmin Berner wurde auf dem Schulweg entführt, dann offenbar versteckt, einige Tage später mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Kurz zuvor aber wurde sie vergewaltigt. Es gibt zahlreiche Hinweise auf Bernhard, unter anderem fanden sich an der Leiche Spermien von ihm.«
»Sicher?«
»Der DNA-Test ist eindeutig. Zu 99 Prozent.«
»Dann sieht es schlecht aus.«
Das Gesicht des Anwalts wirkte plötzlich alt und eingefallen.
»Vielleicht. Vielleicht muss ich mich wirklich damit abfinden, dass ein Mensch, den ich seit Jahren gut kenne, ein Mädchenmörder ist. Wer sieht schon wirklich in einen anderen hinein? Aber Bernhard? Ein Mörder? Ich kann es einfach nicht glauben. Und ich werde es erst glauben, wenn ich mit meinem Versuch gescheitert bin, seine Unschuld zu beweisen. Wissen Sie, Bernhard ist ein anerkannter Wissenschaftler. Er hat einen Beruf, in dem er absolut erfolgreich ist. International renommiert. Seine Forschung rettet Menschenleben. Manchmal witzeln wir, dass er zusammen mit seinem Bruder den Nobelpreis gewinnen wird. Er hat eine Familie, zwei Kinder, auch Mädchen. Er hat etwas zu verlieren. Stellen Sie sich einmal vor, wie es den beiden Mädchen geht. Seiner Frau! Bevor ich akzeptiere, dass ich mich getäuscht habe, werde ich alles unternehmen, um die Vorwürfe zu prüfen. Das bin ich ihm und mir schuldig. Deshalb will ich Sie engagieren. Verstehen Sie?«
Dengler nickte.
»Ich möchte mit Ihrem Klienten reden«, sagte er.
»Das wird nicht gehen. Er ist Untersuchungsgefangener in Moabit.«
Dengler hatte plötzlich Sehnsucht nach Olga. Sie hatte recht. Er sollte diesen Fall nicht annehmen. Er wollte nicht für einen Kindermörder arbeiten.
»Lesen Sie wenigstens die Akten«, sagte Lehmann leise.
»Ich muss den Mann sehen«, sagte Dengler. »Vorher kann ich nicht entscheiden, ob ich für ihn arbeiten will.«
»Sie dürfen nicht nach Moabit. Nur Anwälte dürfen zu ihm. Es ist nicht erlaubt.«
Dengler stand auf.
»Ich glaube, dieser Fall ist nichts für mich. Sie finden in Berlin sicher einen anderen Kollegen, der Ihnen hilft.«
Lehmann schien kleiner zu werden.
Dengler betrachtete sein Gesicht.
Der Mann war wirklich traurig. Das hatte er in dem New Yorker Seminar gelernt. Die Aufwärtsneigung der Augenbrauen bildet bei traurigen oder trauernden Menschen eine vertikale Falte zwischen den Brauen.
»Ich würde gern wissen, ob sich ein Mensch so perfekt verstellen kann«, sagt Lehmann. »Ich weigere mich, es zu glauben. Aber vielleicht bin ich zu naiv.«
Dengler zögerte. Der Mann tat ihm leid.
»Hören Sie. Ich muss Ihren Freund sehen. Ich bin objektiv, und ich verstehe mein Handwerk. Ich kann vielleicht herausfinden, ob Ihr Freund lügt oder nicht. Aber ich muss ihn sehen. Ich muss sein Gesicht sehen, seine Körperhaltung, seine Stimme – und seine Version der Geschichte hören. Kurz: Ich muss seine Gefühle lesen.«
»Gefühle lesen? Das klingt, nehmen Sie es mir nicht übel, ein wenig nach Küchenpsychologie …«
»Ich war gerade in New York. Es gibt eine riesige Forschungseinrichtung des FBI. Dort erforschen sie Mimik und Gestik. Sie gehen den Fragen nach, inwieweit der Mensch seine Mimik beeinflussen kann. Und vor allem, was steuerbar ist und was nicht, welche Gesichtsreaktionen unmittelbar sind, also die Wahrheit verraten. Ein spannendes Feld. Und sehr erfolgversprechend. Ich bin kein Spezialist in diesen Sachen, aber es wäre den Versuch wert.«
»Nun, schaden würde es nicht, wenn Sie Bernhard einmal sehen und sprechen könnten, vielleicht könnte Sie das überzeugen. Wie könnten wir das machen?«
Plötzlich schmunzelte er: »Es gibt einen Weg – etwas ungewöhnlich, aber es wird funktionieren. Wir machen Sie zu meinem Anwaltsgehilfen.«
9.Seminar
Zwei Stunden später unterschrieb Dengler einen Arbeitsvertrag. Nun war er Anwaltsgehilfe. Angestellt bei der Kanzlei Lehmann & Partner. Morgen würde er mit Lehmann ins Gefängnis Moabit fahren und Voss besuchen.
Den Mörder.
Den mutmaßlichen Mörder, verbesserte er sich.
Schließlich war er Polizist.
Ehemaliger Polizist, verbesserte er sich.
Der Polizeidienst hatte ihn mehr geprägt, als ihm recht war. Er wusste es. Einmal Bulle – immer Bulle. Alle anderen Fähigkeiten sind verkümmert. Alle außer einer: der Fähigkeit zur Menschenjagd. Das hatte er beim Bundeskriminalamt gelernt. Solange er Fahnder war, hatte ihn diese Spezialisierung nicht gestört. Aber jetzt, nachdem er resigniert das BKA verlassen hatte und als privater Ermittler arbeitete, fühlte er sich manchmal wie amputiert.
Hochgezüchtet wie ein Windhund.
Etwas fehlte ihm. Er wusste nur nicht, was es war.
Manchmal wünschte er sich, er hätte Talent zum Malen wie Mario, sein bester Freund. Mario entwarf seine Bilder manchmal in einem Zustand, den er den »kreativen Rausch« nannte. Er konnte dann bis in die frühen Morgenstunden vor der Leinwand stehen, ihm gelangen Kompositionen in Blau, Gelb, Rot, die Dengler faszinierten, ohne dass er genau begründen konnte, warum.
Er bewunderte Mario, weil er sich so für die Kunst begeistern konnte. Wenn er über Joseph Beuys sprach, einen der größten deutschen Künstler, so viel hatte Dengler gelernt, der soziale Plastiken erstellte, ohne dass Dengler recht begriff, wie diese Plastiken aussahen, dann glühten Marios Augen, er gestikulierte mit den Armen, lief dozierend im Zimmer auf und ab.
Dengler begeisterte sich für nichts.
Er beherrschte die Menschenjagd.
Mehr nicht.
Manchmal machte ihm das zu schaffen. Aber ihm fiel nichts ein, wofür er sich begeistern konnte.
Außer für Olga.
Dass diese Frau sich für ihn entschieden hatte, hielt er immer noch für eine Art Missverständnis ihrerseits. Er hatte keine Ahnung, was sie an ihm anziehend fand. Was hatte er ihr zu bieten? Er, der ein einziges Talent hatte und mehr nicht.
Irgendwann, da war er sich ganz sicher, würde sie ihren Irrtum bemerken und ihn verlassen. Dann würde die glücklichste Zeit seines Lebens vorbei sein. Er fürchtete sich vor diesem Augenblick, und er wappnete sich täglich dafür.
Und doch gab es Augenblicke, in denen er sich ihrer Liebe sicher war. Seltene Augenblicke voller Süße. Beide behielten ihre Wohnung und dachten nicht daran, zusammenzuziehen, und doch hatte es sich eingebürgert, dass sie die meisten Nächte in Olgas Bett verbrachten. Warum auch nicht. Ihre Wohnung war etwas größer, meist besser aufgeräumt als seine und lag im gleichen Haus nur ein Stockwerk über seinem Büro und seiner Wohnung.
Ihr Bett war nicht groß, eigentlich nur für eine Person gedacht, doch für sie beide fand sich reichlich Platz. Olga lag meist auf der linken Seite, Dengler schmiegte sich an ihren Rücken, hatte die rechte Hand um ihre Hüfte, auf ihren Bauch oder ihre Brust gelegt. Manchmal, wenn er sich vorsichtig umdrehen wollte, zog er langsam seine Hand von ihr weg. Dann schnappte sie im Schlaf danach, führte sie an die gewohnte Stelle und ließ sie nicht los. Diese schläfrige Geste liebte er, und wenn er sich deshalb nicht auf die andere Seite legen konnte, sah er ihr beim Schlafen zu, halb betäubt von Müdigkeit und ihrer Schönheit.
Wenn es ihm nun gelang, sich zu drehen, dann wendete auch sie sich, immer noch fest schlafend, robbte an ihn heran, drückte sich an seinen Rücken und umschlang ihn mit ihren Armen. Diese unbewussten Bewegungen Olgas waren für ihn wie schimmernde Kostbarkeiten, und dass sie ausgerechnet ihm geschenkt wurden, machte ihn glücklich und dankbar. Selbst im Schlaf waren sie miteinander verbunden.
Trotzdem dachte Dengler, dass er Olga im Grunde nicht verdient hatte und dass er sie eines Tages langweilen würde. Hatte er das Seminar in New York gebucht, um für sie interessanter zu werden? Es ging dort zwar auch um Menschenjagd, um Fahndung, aber auch um Menschenkenntnis und Psychologie. Er hatte gehofft, ihr besser zu gefallen, wenn er davon mehr verstand. Aber für sie, so schrieb sie ihm, waren die drei Wochen ohne ihn eine Qual gewesen. Sie hätte ihn gerne nach New York begleitet. Aber dann hätte er von dem Seminar nicht viel mitbekommen. Deshalb lehnte er ihr Angebot ab, auch wenn es ihm schwerfiel.
Das Bundeskriminalamt bezahlte den Kurs.
Die Behörde schuldete ihm noch etwas. Bei seinem letzten Fall hatte er für das BKA gearbeitet. Und wäre fast erschossen worden. Wenn Sie einen Wunsch haben, lassen Sie es mich wissen, hatte der Präsident gesagt. Wir stehen in Ihrer Schuld.
Dann kam das Angebot, das Seminar in New York zu besuchen.
Gefühle lesen.
Herausfinden, ob andere lügen.
Morgen würde sich zeigen, ob er etwas gelernt hatte.
Das Summen seines Handys holte ihn aus seinen Gedanken zurück.
»Martin hier. Georg, du glaubst nicht, was passiert ist.«
»Mach’s nicht so spannend.«
»Jemand hat mir eine interne Studie der Bahn zugeschickt. Deren Ingenieure bestätigen Punkt für Punkt alles, was wir gegen Stuttgart 21 ins Feld führen. Und sogar noch mehr.«
»Was wirst du damit machen?«
»Ich kenne einen Reporter vom Stern. Arno Luik.«
»Nie gehört.«
»Dem hab ich’s geschickt. Er überprüft das. Und wenn es stimmt, macht er eine große Story draus. Daran kann die Bahn nicht vorbei.«
»Ich hoffe, du unterschätzt die Macht des Geldes nicht, Martin.«
»Es geht um die Wahrheit, Georg. Um die Wahrheit.«
»Geld ist stärker als die Wahrheit.«
»Diesmal nicht, Georg. Diesmal nicht.«
Dengler wollte seinen Freund nicht entmutigen. Er legte auf.
10.Erste Nacht
Was meinte der Mann?
Was verkaufe ich?
Ich verkaufe verschreibungspflichtige Medikamente.
Das ist mein Job.
Mehr nicht.
Was denkt er? Denkt er, dass ich abgelaufene Medikamente in die Dritte Welt verschiebe? Das hatte er einmal in einem Film gesehen. In einem »Tatort«, aber er war sich dessen nicht mehr sicher, vielleicht war es auch ein anderer dieser zahlreichen Fernsehkrimis. Kommissarin Lund fiel ihm ein, die Serie hatte ihm gefallen, aber da war es um etwas anderes gegangen … um Afghanistan.
Um was ging es hier?
Organhandel? Denkt der Maskierte, ich verschiebe Herzen, Leber oder Milz? Auch darüber hatte er in einem Kriminalroman gelesen. Mankell? Er dachte nach. Auf den vielen Flugreisen las er entweder Geschäftsmemos oder Krimis. Vor ein paar Jahren war er Mankell-süchtig gewesen. Seine Frau hatte den Schweden nicht gemocht. Zu blutrünstig, sagte sie. In einem der Bücher ging es auch um etwas Medizinisches. Jetzt fiel es ihm wieder ein: Menschenversuche in Afrika. Aber nichts davon betraf ihn. Nichts davon betraf Peterson & Peterson. Die klinischen Tests wurden meist von Kliniken in den USA durchgeführt. Manche in Frankreich, einige in Deutschland. Aber da lief alles nach Vorschrift.
Der ewige Gärtner fiel ihm ein. Er hatte den Film gesehen, aber konnte sich nicht mehr genau erinnern. Ralph Fiennes hatte die Hauptrolle gespielt. Das wusste er noch. Er wusste auch noch, dass er den Film auf DVD gesehen hatte und dass er in Afrika spielte.
Aber er hatte mit Afrika nichts zu tun. Gar nichts.
Aber das schien der Entführer nicht zu wissen.
Was verkaufen Sie wirklich?
»Medikamente«, schrie er, so laut er konnte.
Dann: »Hilfe!«
Zehnmal. Hundertmal.
Bis er müde wurde und einschlief.
In der Nacht musste er scheißen.
Im Dunkeln hockte er auf dem Eimer. Mit beiden Händen tastete er nach dem Toilettenpapier.
Was verkaufen Sie wirklich?
Ein Irrer, dachte er. Ich bin einem Irren in die Hände gefallen.
11.Haftschock
Die Dame im blauen Kleid hatte für ihn ein Hotel nur wenige Schritte von der U-Bahn-Station Stadtmitte gebucht.
Lehmann bot ihm an, Kopien der Akten mitzunehmen, aber Dengler lehnte ab. Er wollte sich nicht mit dem Fall beschäftigen. Er wollte zunächst nur den Mann sehen und feststellen, ob er log oder nicht.
Er wollte ihn unvoreingenommen sehen, den mutmaßlichen Kindsmörder.