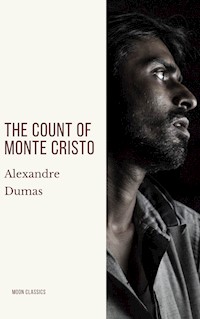4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BROKATBOOK
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Zwillingsmädchen und Bastarde eines Royalisten-Veteranen von 1793, den Marquis de Souday, mit Namen Mary und Bertha, denen fälschlicherweise ein schwefeliger Ruf zugeschrieben wird, werden grausam "louves Machecoul" genannt. Weit weg von diesen Klatschereien leben sie ihrer Einsamkeit in Ruhe, bis zu dem Tag, an dem das Schicksal zwei neue Charaktere auf ihren Weg bringt: Baron Michel de la Logerie, Sohn eines durch das Imperium bereicherten Bürgertums, und Marie-Caroline de Bourbon, Herzogin von Berry, die ihrem Sohn den Thron von Frankreich anbieten möchte, indem sie den vendeanischen royalistischen Geist erweckt. Geschrieben 1858.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Alexandre Dumas
Die Louves von Machecoul
1. Band
Ein Roman aus der Zeit der Vendée
Impressum
Texte: © Copyright by Alexandre Dumas
Umschlag: © Copyright by Gunter Pirntke
Übersetzer: © Copyrigh by Walter Brendel
Verlag: Das historische Buch Dresden / Brokatbookverlag
Gunter Pirntke
Altenberger Straße 47
01277 Dresden
Inhalt
Impressum
1. Kapitel: Charettes Adjutant
2. Kapitel: Die Anerkennung von Königen
3. Kapitel: Die beiden Zwillinge
4. Kapitel: Wie konnte Jean Oullier noch da sein, wenn er für eine Stunde zum Marquis kam, wenn er und der Marquis nicht schon seit zehn Jahren tot waren?
5. Kapitel: Ein Wurf Wölfe
6. Kapitel: Ein verwundeter Hase
7. Kapitel: Herr Michel
8. Kapitel: Die Baronin der Logerie
9. Kapitel: Goldgeflecht und Allegro
10. Kapitel: Wo die Dinge nicht ganz so sind, wie Baron Michel sie sich erträumt hat...
11. Kapitel: Der Vater
12. Kapitel: Noblesse oblige
13. Kapitel: Der Cousin von fünfzig Ligen
14. Kapitel: Petit-Pierre
15. Kapitel: Unangemessene Zeit
16. Kapitel: Courtin's Diplomatie
17. Kapitel: Das Kabarett von Aubin Courte-Joie
18. Kapitel: Der Mann aus der Logerie
19. Kapitel: Die Montaigu-Messe
20. Kapitel: Der Aufstand
21. Kapitel: Die Ressourcen von Jean Oullier
22. Kapitel: Bring es, Pussy! Bring es!
23. Kapitel: Wem gehörte die Hütte
24. Kapitel: Wie Marianne Picaut um ihren Mann weinte
25. Kapitel: Wo die Liebe denjenigen eine politische Meinung verleiht, die keine haben...
26. Kapitel: Der Baugé-Sprung
27. Kapitel: Die Gäste von Souday
28. Kapitel: Wo der Marquis de Souday bitterlich bedauert, dass Petit-Pierre kein Gentleman ist...
29. Kapitel: Der Alarm
30. Kapitel: Mein Freund Loriot
31. Kapitel: Wo der General einen Toast ausspricht, den er nicht geplant hatte...
32. Kapitel: Wo Meister Loriots Neugierde nicht genau befriedigt wird
33. Kapitel: Die Revolverkammer
34. Kapitel: Was anders endet, als Mary es erwartet hat
35. Kapitel: Blau und weiß
36. Kapitel: Wo der schönste Fuß in Frankreich und Navarra feststellt, dass Aschenputtels Pantoffeln ihm weniger gut passen würden als die Stiefel von Siebenbürgen.
37. Kapitel: Wo der kleine Peter die beste Mahlzeit seines Lebens zubereitet...
38. Kapitel: Gleichheit vor den Toten
39. Kapitel: Die Suche
40. Kapitel: Wo Jean Oullier sagt, was er von dem jungen Baron Michel hält...
41. Kapitel: Meister Jacques' Kaninchen
42. Kapitel: Über die Gefahr, sich im Wald in schlechter Gesellschaft aufzuhalten.
43. Kapitel: Wo Meister Jacques den Schwur hält, den er in Aubin Courte-Joie geleistet hat...
44. Kapitel: Wo gezeigt wird, dass nicht alle Juden aus Jerusalem sind...
45. Kapitel: Meisterzeichen
46. Kapitel: Wie man im Departement Loire-Inférieure im Mai 1832 reiste
1. Kapitel: Charettes Adjutant
Zufälligerweise, lieber Leser, haben Sie, um von Nantes nach Bourgneuf zu fahren, bei der Ankunft in Saint-Philbert sozusagen die südliche Ecke des Sees von Grand-Lieu abgeschnitten, und, den Weg fortsetzend, sind Sie nach einer oder zwei Stunden Fußmarsch, je nachdem, ob Sie zu Fuß oder mit der Kutsche unterwegs waren, bei den ersten Bäumen des Waldes von Machecoul angekommen.
Dort, links des Weges, in einer großen Baumgruppe, die zum Wald zu gehören scheint, von dem sie nur durch die Hauptstraße getrennt ist, müssen Sie die scharfen Spitzen zweier dünner Türmchen und das gräuliche Dach eines kleinen, zwischen den Blättern verlorenen Kastells gesehen haben.
Im Jahr 1832 war dieses kleine Schloss im Besitz eines alten Adligen namens Marquis de Souday und wurde nach dem Namen seines Besitzers Château de Souday genannt.
Der Marquis de Souday war der einzige Vertreter und der letzte Erbe eines alten und illustren Hauses der Bretagne; der Marquis de Souday, bereits Erbe, wenn nicht des Besitzes - es gab keinen anderen als den kleinen Herrn, von dem wir gesprochen haben -, so doch wenigstens des Namens seines Vaters, war der erste Page Seiner Königlichen Hoheit M. le Comte de Provence.
Mit sechzehn Jahren - so alt war der Marquis damals - waren die Ereignisse kaum mehr als Unfälle; außerdem war es schwierig, am epikureischen, voltairischen und konstitutionellen Hof von Luxemburg, wo der Egoismus seine freien Ellenbogen hatte, nicht zutiefst beunruhigt zu werden.
Es war Herr de Souday, der auf die Place de Grève geschickt worden war, um auf den Moment zu achten, in dem der Henker den Strick um Favras' Hals festziehen würde, und in dem er, indem er seinen letzten Atemzug tat, Seiner Königlichen Hoheit für einen unruhigen Augenblick seinen Frieden geben würde.
Er war mit großer Geschwindigkeit zurückgekehrt, um zu sagen, nach Luxemburg:
"Mein Herr, es ist vollbracht!"
Und mein Herr hatte mit seiner klaren und flötenden Stimme gesagt:
"Mittagessen, meine Herren! Mittagessen!"
Und sie hatten gegessen, als ob ein guter Herr, der Seiner Hoheit aus freien Stücken sein Leben geschenkt hatte, nicht gerade wie ein Mörder und Vagabund gehängt worden wäre.
Dann kamen die ersten dunklen Tage der Revolution, die Veröffentlichung des Roten Buches, der Rückzug von Necker, der Tod von Mirabeau.
Eines Tages, am 22. Februar 1791, hatte sich eine große Menschenmenge versammelt und umzingelte den Luxemburger Palast.
Es handelte sich um ein weit verbreitetes Geräusch. Monsieur, so hieß es, wollte fliehen und sich den Auswanderern anschließen, die sich am Rhein sammelten.
Aber Monsieur zeigte sich auf dem Balkon und legte einen feierlichen Schwur ab, den König nicht zu verlassen.
Und tatsächlich, am 21. Juni reiste er mit dem König ab, zweifellos um sein Wort zu halten, ihn nicht zu verlassen.
Er verließ ihn dennoch, und zu seinem Glück; denn er kam mit seinem Reisegefährten, dem Marquis d'Avaray, in aller Ruhe an der Grenze an, während Ludwig XVI. in Varennes verhaftet wurde.
"Meine Güte, mein Freund, gerne! Sind Sie noch ein guter Jäger?"
"Oh ja, Mr. Marquis, aber in den nächsten fünfzehn Minuten werden wir keine Wildschweine mehr jagen, das ist ein anderes Spiel."
"Das macht nichts; wenn Sie wollen, jagen wir diesen zusammen, wie wir den anderen gejagt haben."
"Im Gegenteil, Herr Marquis", fuhr Jean Oullier fort.
Und von diesem Moment an war Jean Oullier dem Marquis de Souday unterstellt, wie der Marquis de Souday Charette unterstellt war; das heißt, Jean Oullier war der Adjutant des Adjutanten des Generalobersten.
Charette gewann einige Zeit nach dem schrecklichen Sieg der Quatre-Chemins: es war der letzte, denn der Verrat stand bevor.
Opfer eines Hinterhalts wurde de Couëtu, Charettes rechte Hand, sein anderer Mann seit dem Tod von Jolly, und wurde erschossen.
In den letzten Tagen seines Lebens konnte Charette keinen Schritt tun, ohne dass sein Gegner, wer auch immer er war, Hoche oder Travot, sofort gewarnt wurde.
Umgeben von republikanischen Truppen, von allen Seiten umzingelt, Tag und Nacht verfolgt, von Busch zu Busch gejagt, von Graben zu Graben kriechend, wissend, dass er früher oder später bei irgendeinem Zusammentreffen getötet oder, wenn er lebend gefangen wird, auf der Stelle erschossen werden muss; ohne Asyl, vom Fieber verbrannt, vor Durst und Hunger sterbend, nicht wagend, die Bauernhöfe, denen er begegnet, um ein wenig Brot, ein wenig Wasser oder ein wenig Stroh zu bitten, hat er nur zweiunddreißig Mann um sich, darunter den Marquis de Souday und Jean Oullier, als er am 25. März 1796 erfährt, dass vier republikanische Kolonnen gleichzeitig gegen ihn marschieren.
"Gut!" sagte er; "In diesem Fall muss man hier bis zum Tod kämpfen und sein Leben teuer verkaufen."
Es war in der Prélinière, in der Gemeinde Saint-Sulpice. Doch Charette begnügt sich nicht damit, mit seinen zweiunddreißig Mann auf die Republikaner zu warten: Er geht ihnen voraus.
In der Guyonnière trifft er auf General Valentin, an der Spitze von 200 Grenadieren und Jägern.
Charette fand eine gute Position und grub sich ein.
Dort unterstützte er drei Stunden lang das Feuer von 200 Republikanern.
Zwölf seiner Männer fallen um ihn herum. Die Armee der Chouannerie, die aus vierundzwanzigtausend Mann bestand, als der Graf von Artois auf der Ile Yeu war, ist jetzt auf zwanzig Mann reduziert.
Diese zwanzig Männer stehen um ihren General herum, und nicht einer von ihnen denkt an Flucht.
Zum Schluss nimmt General Valentin ein Gewehr und stürmt an der Spitze der 180 verbliebenen Männer mit dem Bajonett.
Bei diesem Angriff wurde Charette durch eine Kugel am Kopf verwundet und ihm wurden drei Finger der linken Hand mit einem Säbel abgetrennt.
Der Marquis de Souday nahm Charette in die Arme, und während Jean Oullier mit seinen beiden Gewehren die beiden republikanischen Soldaten, die ihn bedrängten, tötete, stürzte er sich mit seinem General und sieben verbliebenen Männern in den Wald. Fünfzig Schritte von der Kante entfernt, scheint Charette wieder zu Kräften zu kommen.
"Plötzlich", sagte er, "hören Sie auf meinen letzten Befehl."
Der junge Mann bleibt stehen.
"Setzen Sie mich am Fuß dieser Eiche ab."
Souday zögerte, zu gehorchen.
"Ich bin immer noch Ihr General", sagte Charette mit gebieterischer Stimme; "gehorchen Sie mir!"
Der junge Mann, besiegt, gehorchte und legte seinen General an den Fuß der Eiche.
"So! Jetzt", sagte Charette, "hören Sie mir gut zu. Der König, der mich zum Oberbefehlshaber gemacht hat, muss wissen, wie sein Oberbefehlshaber gestorben ist. Gehen Sie zurück zu Seiner Majestät Ludwig XVIII. und erzählen Sie ihm, was Sie gesehen haben; ich will es!"
Charette sprach mit solcher Feierlichkeit, dass der Marquis de Souday, mit dem er sich mit Vornamen anredete, nicht einmal daran dachte, ihm zu widersprechen.
"Komm schon", fuhr Charette fort, "du hast keine Minute zu verlieren, lauf weg; hier sind die Blauen!"
In der Tat schienen die Republikaner am Rande des Abgrunds zu stehen.
Souday nahm die Hand, die Charette ihm entgegenhielt.
"Küss mich", sagte dieser.
Der junge Mann küsste sie.
"Genug, sagte der General. Gehen Sie weg!"
Souday warf einen Blick auf Jean Oullier.
"Kommst du?", sagte er.
Aber er schüttelte den Kopf mit einem finsteren Blick.
"Was soll ich da drüben machen, Mr. Marquis, sagte er, während hier..."
"Hier, was werden Sie tun?"
"Das sage ich Ihnen, wenn wir uns eines Tages wiedersehen, Mr. Marquis".
Jean Oullier und der Marquis de Souday gingen in den Wald.
Erst nach fünfzig Schritten fand Jean Oullier einen dichten Busch, schlüpfte wie eine Schlange hinein und winkte dem Marquis de Souday zum Abschied.
Der Marquis de Souday setzte seinen Weg fort.
Unser junger Page war zu sehr auf seinen Ruf als modischer junger Mann bedacht, um in Frankreich zu bleiben, wo aber die Monarchie ihre eifrigsten Diener brauchte; so wanderte er seinerseits aus, und da niemand auf einen achtzehnjährigen Pagen achtete, kam er ohne Unfall in Coblentz an und half, die Kader der Musketierkompanien zu vervollständigen, die sich dort unter dem Befehl des Marquis de Montmorin reformierten. Während der ersten Begegnungen kämpfte er tapfer mit den drei Condés, wurde vor Thionville verwundet, erlebte dann, nach vielen Enttäuschungen, die stärkste von allen durch die Entlassung der Leichen der Emigranten; eine Maßnahme, die so vielen armen Teufeln mit ihren Hoffnungen das Brot des Soldaten, ihre letzte Ressource, nahm.
Der Marquis de Souday wandte sich daraufhin der Bretagne und der Vendée zu, wo sie seit zwei Jahren kämpften.
Hier war der Zustand der Vendée.
Alle ersten Anführer des Aufstandes waren tot: Cathelineau war bei Vannes getötet worden, Lescure bei La Tremblaye, Bonchamp bei Cholet, d'Elbée war bei Noirmoutiers erschossen worden oder stand kurz davor.
Schließlich war das, was man die "große Armee" nannte, gerade in Le Mans ausgelöscht worden.
Diese große Armee war bei Fontenay, Saumur, Torfou, Laval und Dol besiegt worden; sie hatte in sechzig Schlachten den Vorteil gehabt; sie hatte allen Kräften der Republik die Stirn geboten, die nacheinander von Biron, Rossignol, Kléber, Westermann, Marceau befehligt wurden; sie hatte, indem sie die Unterstützung Englands zurückdrängte, ihre strohgedeckten Hütten in Brand gesetzt, ihre Kinder massakriert, ihren Vätern die Kehlen durchgeschnitten; Ihre Anführer waren Cathelineau, Henri de la Rochejaquelein, Stofflet, Bonchamp, Forestier, d'Elbée, Lescure, Marigny und Talmont gewesen; sie war ihrem König treu geblieben, als das übrige Frankreich ihn im Stich ließ; sie hatte ihren Gott angebetet, als Paris verkündete, dass es keinen Gott mehr gab; dank ihr verdiente die Vendée schließlich, eines Tages vor der Geschichte das Land der Riesen genannt zu werden.
Charette und La Rochejaquelein waren mehr oder weniger allein auf ihren Füßen geblieben.
Ludwig XVII. war gestorben, und am 26. Juni 1795 wurde Ludwig XVIII. im Hauptquartier in Belleville zum König von Frankreich proklamiert.
Am 15. August 1795, weniger als zwei Monate nach dieser Proklamation, brachte ein junger Mann Charette einen Brief des neuen Königs.
Dieser Brief, geschrieben aus Verona und datiert auf den 8. Juli 1795, gab Charette das rechtmäßige Kommando über die royalistische Armee.
Charette wollte dem König durch denselben Boten antworten und ihm für die Gunst, die er ihm gewährte, danken; aber der junge Mann wies darauf hin, dass er nach Frankreich zurückgekehrt sei, um zu bleiben und zu kämpfen, und bat darum, dass die Depesche, die er mitgebracht hatte, als Empfehlung an den Obergeneral verwendet werde.
Dieser junge Bote war kein anderer als der ehemalige Page von Monsieur, dem Marquis de Souday.
Als der Marquis sich zurückzog, um sich von den letzten zwanzig Meilen auszuruhen, die er gerade zu Pferd zurückgelegt hatte, fand er auf seinem Weg einen jungen Wächter, der fünf oder sechs Jahre älter war als er, und der, den Hut in der Hand, ihn mit liebevollem Respekt ansah.
Er erkannte den Sohn eines Teilpächters seines Vaters, mit dem er in der Vergangenheit gerne gejagt hatte, denn niemand konnte ein Wildschwein besser jagen und die Hunde besser unterstützen, wenn das Tier abgelenkt war.
"Hey! Jean Oullier", rief er, "bist du das?"
"Ich bin persönlich hier, um Sie zu bedienen, Herr Marquis", antwortete der junge Bauer.
2. Kapitel: Die Anerkennung von Königen
Der Marquis de Souday ging zu den Ufern der Loire und fand einen Fischer, der ihn zur Spitze von St. Gildas führte.
Eine Fregatte kreuzte in Sicht; es war eine englische Fregatte.
Für ein paar weitere Louis führte der Fischer den Marquis zur Fregatte.
Dort wurde er gerettet.
Zwei oder drei Tage später hob die Fregatte ein dreimastiges Handelsschiff auf, das in den Kanal einlaufen wollte.
Es war ein holländisches Schiff.
Der Marquis de Souday bat darum, an Bord zu kommen; der englische Kapitän ließ ihn an Bord nehmen.
Der niederländische Dreimaster setzte den Marquis in Rotterdam ab.
Von Rotterdam ging er nach Blankenbourg, einer kleinen Stadt im Herzogtum Braunschweig, die Ludwig XVIII. zu seiner Residenz erkoren hatte.
Er musste die letzten Empfehlungen von Charette ausführen.
Ludwig XVIII. saß am Tisch; die Mahlzeit war für ihn immer eine feierliche Stunde.
Der Ex-Page musste warten, bis Seine Majestät gespeist hatte.
Nach dem Essen wurde er vorgestellt.
Er erzählte die Ereignisse, die er vor seinen Augen hatte ablaufen sehen, und insbesondere die jüngste Katastrophe, mit solcher Beredsamkeit, dass Seine Majestät, die allerdings eher unbeeindruckt war, so beeindruckt war, dass sie zu ihm sagte
"Genug, genug, Marquis! Ja, der Ritter von Charette war ein tapferer Diener, wir erkennen es an".
Und er gab ihm ein Zeichen, dass er sich zurückziehen sollte.
Der Bote gehorchte; aber als er sich zurückzog, hörte er den König in mürrischem Ton sagen:
"Dieser Narr Souday, der nach dem Essen kommt, um mir diese Dinge zu erzählen! Es ist in der Lage, meine Verdauung zu stören!"
Der Marquis war empfindlich; er fand, dass es eine schlechte Belohnung war, nachdem er sechs Monate lang sein Leben aufs Spiel gesetzt hatte, von demselben Mann, für den er es aufs Spiel gesetzt hatte, einen Schwachkopf genannt zu werden.
Er hatte noch etwa hundert Louis in der Tasche und verließ noch am selben Abend Blankenburg mit den Worten: "Das ist doch nicht möglich!"
"Wenn ich so empfangen worden wäre, hätte ich mir nicht so viel Mühe gegeben zu kommen!"
Er kehrte nach Holland zurück, und von Holland ging er nach England. Es begann eine neue Phase im Leben des Marquis de Souday.
Dieser Mann, der der Verfolgung der höllischen Kolonnen getrotzt hatte, konnte den bösen Anregungen des Müßiggangs nicht widerstehen; er suchte überall und um jeden Preis Vergnügen, um die Leere zu füllen, die in seiner Existenz entstanden war, seit er nicht mehr die Wechselfälle eines vernichtenden Kampfes hatte, um sie zu besetzen.
Er lebte dieses Dasein schon seit zwei Jahren, als er zufällig in einem Tripotot der Stadt, in dem er einer der eifrigsten Gäste war, einen jungen Arbeiter traf, den eine jener scheußlichen Kreaturen, die es in London zuhauf gibt, gerade aus seinem Dachboden herausholte und zum ersten Mal produzierte.
Trotz der Veränderungen, die das Unglück in ihm bewirkt hatte, erkannte das arme Mädchen noch einen Rest von Herrschaft; sie warf sich dem Marquis weinend zu Füßen und flehte ihn an, sie vor dem schändlichen Leben zu bewahren, zu dem sie geweiht werden sollte und für das sie nicht taugte, da sie bis dahin klug gewesen war.
Das Mädchen war wunderschön, und der Marquis bot ihr an, ihm zu folgen.
Das Mädchen warf sich ihm an den Hals und versprach, ihm ihre ganze Liebe zu geben, ihm ihre ganze Hingabe zu weihen.
Der Name des unglücklichen Kindes war Eva.
Sie hielt ihr Wort, arm und ehrlich wie sie war, der Marquis war ihre erste und letzte Liebe.
Er flüchtete mit Eva in eine Dachkammer in Piccadilly. Das Mädchen konnte sehr gut nähen; sie fand Arbeit in einem Wäschegeschäft. Der Marquis gab Fechtunterricht.
Von da an lebten sie ein wenig von dem bescheidenen Produkt der Lektionen des Marquis und Evas Arbeit, viel von dem Glück, dass sie in einer Liebe fanden, die stark genug geworden war, um ihre Mittellosigkeit zu vergolden.
Und doch wurde diese Liebe, wie alle sterblichen Dinge, auf die Dauer abgenutzt.
Lange war der Himmel nicht bereit gewesen, diese uneheliche Verbindung zu segnen, doch endlich wurde Evas Wunsch nach zwölf Jahren erfüllt. Die arme Frau wurde schwanger und brachte zwei Zwillinge zur Welt.
Leider genoss Eva die ersehnten mütterlichen Freuden nur für wenige Stunden, dann nahm das Milchfieber sie mit.
Der Marquis trennte sich von seinen beiden kleinen Mädchen. Er brachte sie in einer Gärtnerei in Yorkshire unter und fand in ihrem Schmerz eine Welle der Zärtlichkeit, die die Bäuerin berührte, die sie wegbrachte.
Als er sich auf diese Weise von allem getrennt hatte, was ihn mit der Vergangenheit verband, erlag der Marquis de Souday dem Gewicht seiner Isolation; er wurde düster und wortkarg; Abscheu vor dem Leben ergriff ihn, und da sein religiöser Glaube nicht der stärkste war, hätte er aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem Sprung in die Themse geendet, wenn die Katastrophe von 1814 nicht rechtzeitig gekommen wäre, um ihn von seinen düsteren Gedanken abzulenken.
Nachdem er in seine Heimat zurückgekehrt war, die er nie wieder zu sehen hoffte, kam der Marquis de Souday ganz natürlich auf die Idee, Ludwig XVIII. um den Preis für das Blut zu bitten, das er für ihn vergossen hatte; aber Prinzen sind oft undankbar.
Der Marquis musste sich mit dem Kreuz von St. Louis, dem Rang und der Pensionierung eines Schwadronschefs begnügen und in seinem Land von Souday das Brot des Königs essen, das einzige Wrack, das der arme Emigrant aus dem immensen Vermögen seiner Vorfahren zusammengetragen hatte.
Das Gute war, dass diese Enttäuschungen den Marquis von Souday nicht daran hinderten, seine Pflicht zu tun, d.h. sein armes Castel wieder zu verlassen, als Napoleon seine wunderbare Rückkehr von der Insel Elba machte.
Napoleon fiel ein zweites Mal, ein zweites Mal kehrte der Marquis de Souday nach seinen legitimen Prinzen zurück.
Diesmal jedoch besser informiert als 1814, begnügte er sich damit, die Restauration um den Posten des Leutnants des Wolfsrudels im Bezirk Machecoul zu bitten, der ihm, da er frei war, eifrig gewährt wurde.
Während seiner ganzen Jugend eines Vergnügens beraubt, dass in seiner Familie eine erbliche Leidenschaft war, begann der Marquis de Souday mit Wut der Jagd zu frönen. Schon immer traurig über das einsame Leben, für das er nicht geschaffen war; nach seinen politischen Enttäuschungen noch misanthropischer geworden, fand er in dieser Übung das momentane Vergessen seiner bitteren Erinnerungen. So verschaffte ihm der Besitz eines Wolfsrudels, das ihm das Recht gab, kostenlos durch die Wälder des Staates zu streifen, mehr Genugtuung, als er empfunden hatte, als er vom Minister sein St.-Louis-Kreuz und sein Geschwaderführer-Zertifikat erhielt.
Der Marquis de Souday lebte schon seit zwei Jahren in seinem Schlösschen, streifte Tag und Nacht mit seinen sechs Hunden, der einzigen Mannschaft, die ihm sein karges Einkommen erlaubte, durch die Wälder, sah seine Nachbarn nur so viel, wie er musste, um nicht als Bär durchzugehen, und dachte so wenig wie möglich an die Hinterlassenschaften wie an den Ruhm der Vergangenheit, als er eines Morgens, als er aufbrach, um den nördlichen Teil des Waldes von Machecoul zu erkunden, auf der Straße einer Bäuerin begegnete, die auf jedem ihrer Arme ein Kind von drei oder vier Jahren trug.
Der Marquis de Souday erkannte diese Bäuerin und errötete, als er sie erkannte.
Sie war das Kindermädchen aus Yorkshire, dem er sechsunddreißig bis achtunddreißig Monate lang regelmäßig vergessen hatte, Kost und Logis für seine beiden Kindermädchen zu bezahlen.
Die tapfere Frau war nach London gefahren und hatte sich sehr geschickt an die französische Botschaft gewandt, um nach Informationen zu fragen. Sie kam durch die Vermittlung des Ministers von Frankreich, der keinen Zweifel daran hatte, dass der Marquis de Souday nicht glücklicher hätte sein können, seine Kinder zu finden.
Außergewöhnlich ist, dass er sich nicht völlig geirrt hat.
Die kleinen Mädchen erinnerten so sehr an die arme Eva, dass der Marquis einen Moment der Rührung erlebte; er umarmte sie mit einer nicht vorgetäuschten Zärtlichkeit, gab der Engländerin sein Gewehr zu tragen, nahm die beiden Kinder in die Arme und brachte diese unerwartete Beute zurück in sein Schloss, zum großen Erstaunen des Kochs aus Nantes, der sein Diener war und der ihn mit Fragen über den eigenartigen Fund, den er gerade gemacht hatte, überhäufte.
Dieses Verhör erschreckte den Marquis.
Er war erst neununddreißig Jahre alt und trug sich mit dem vagen Gedanken, zu heiraten, da er es für eine Pflicht hielt, ein so illustres Haus wie das seine nicht in seiner Person enden zu lassen; außerdem wäre er nicht böse gewesen, sich einer Frau für die Pflege des Haushalts aufzubürden, was ihm zuwider war.
3. Kapitel: Die beiden Zwillinge
Der Marquis de Souday hatte sich ins Bett gelegt und sich dabei dieses alte Axiom wiederholt: "Die Nacht ist für den Rat da".
Dann, in dieser Hoffnung, war er eingeschlafen.
Im Schlaf hatte er geträumt.
Er hatte von seinen alten Vendée-Kriegen mit Charette geträumt, dessen Adjutant er gewesen war, und vor allem hatte er von jenem tapferen Sohn des väterlichen Pächters geträumt, der sein Adjutant gewesen war: er hatte von Jean Oullier geträumt, an den er nie gedacht hatte, den er nie wieder gesehen hatte, seit dem Tag, an dem Charette gestorben war, sie sich im Wald von Chabotière getrennt hatten.
Soweit er sich erinnern konnte, lebte Jean Oullier, bevor er sich Charettes Armee anschloss, im Dorf La Chevrolière, in der Nähe des Sees von Grand-Lieu.
Der Marquis de Souday ließ einen Mann aus Machecoul reiten, der gewöhnlich seine Botengänge für ihn erledigte, und beauftragte ihn, indem er ihm einen Brief gab, sich nach la Chevrolière zu begeben, um herauszufinden, ob ein Mann namens Jean Oullier noch lebte und das Land noch bewohnte.
Jean Oullier war nicht tot.
Er war in der Chevrolière selbst.
Das war es, was aus ihm nach der Trennung vom Marquis de Souday geworden war.
Er hatte sich im Busch versteckt gehalten, wo er, ohne gesehen zu werden, sehen konnte.
Er hatte gesehen, wie General Travot Charette gefangen nahm, und behandelte ihn mit allem Respekt, den ein Mann wie General Travot für Charette haben konnte.
Aber es scheint, dass dies nicht alles war, was Jean Oullier sehen wollte, denn, Charette auf eine Bahre gelegt und weggetragen, blieb er immer noch in seinem Busch.
Zwar waren ein Offizier und eine Wache von zwölf Mann ihrerseits im Wald geblieben.
Eine Stunde, nachdem dieser Posten dort eingerichtet worden war, war ein Bauer aus der Vendée bis auf zehn Schritte an Jean Oullier vorbeigegangen und hatte das "qui-vive" des blauen Wächters mit dem Wort "ami" beantwortet, eine seltsame Antwort aus dem Mund eines royalistischen Bauern, der mit republikanischen Soldaten sprach.
Dann hatte der Bauer ein Wort der Ordnung mit dem Wachposten gewechselt, der ihn passieren ließ.
Dann endlich hatte er sich dem Offizier genähert, der ihm mit einem unbeschreiblichen Ausdruck des Ekels einen Geldbeutel voller Gold überreichte.
Danach war der Bauer verschwunden.
Wahrscheinlich waren der Offizier und die zwölf Männer nur im Wald zurückgeblieben, um auf den Bauern zu warten, denn kaum war er verschwunden, hatten sie sich auch schon versammelt und waren ihrerseits verschwunden.
Wahrscheinlich hatte Jean Oullier gesehen, was er sehen wollte; denn er kam aus seinem Busch heraus, wie er ihn betreten hatte, nämlich kriechend, stellte sich wieder auf die Beine, zupfte die weiße Kokarde von seinem Hut und ging mit der Sorglosigkeit eines Mannes, der seit drei Jahren jeden Tag sein Leben aufs Spiel setzt, in den Wald.
Noch am selben Abend kam er in der Chevrolière an.
Sein Haus war eine rauchgeschwärzte Ruine; seine Frau und seine beiden Kinder waren tot. Das ist es, was er gelernt hat.
Einen Moment später fiel er auf die Knie und betete.
Es war an der Zeit; er war kurz davor, zu lästern.
Er betete für diejenigen, die gestorben waren.
Dann, getränkt von jenem tiefen Glauben, der ihm die Hoffnung gab, sie eines Tages in einer besseren Welt wiederzufinden, biwakierte er auf diesen traurigen Ruinen.
Am nächsten Tag, bei Tagesanbruch, war er mit seiner Arbeit beschäftigt.
Allein, und ohne jemanden um Hilfe zu bitten, baute er seine strohgedeckte Hütte wieder auf.
Er lebte dort von seiner bescheidenen täglichen Arbeit; und wer Jean Oullier geraten hätte, die Bourbonen um den Preis für das zu bitten, was er, zu Recht oder zu Unrecht, für eine vollendete Pflicht hielt, hätte riskiert, die Einfachheit und Erhabenheit des armen Bauern zu empören.
Es ist verständlich, dass Jean Oullier mit dieser Figur einen Brief des Marquis de Souday erhält, der ihn als seinen alten Kameraden bezeichnet und ihn bittet, sich sofort zum Schloss zu begeben, und man versteht, dass Jean Oullier sich nicht hat warten lassen.
Er schloss die Tür seines Hauses ab, steckte den Schlüssel in die Tasche, und da er allein lebte und niemanden zu warnen hatte, verließ er sofort das Haus.
Der Bote wollte ihm das Pferd geben oder ihn wenigstens auf dem Rücken reiten lassen, aber Jean Oullier schüttelte den Kopf.
"Gott sei Dank", sagte er, "die Beine sind gut".
Und indem er seine Hand auf den Hals des Pferdes legte, deutete er mit einer Art gymnastischem Schritt an, welches Tempo das Pferd gehen konnte.
Es war ein kleiner Trab von zwei Kilometern pro Stunde.
Am Abend war Jean Oullier im Schloss von Souday.
Das erste, was der Marquis tat, war, Jean Oullier beiseite zu nehmen und ihm seine Position und die Peinlichkeit anzuvertrauen, die ihm dies bereitete.
Jean Oullier nahm jedoch das Angebot des Marquis de Souday an, seine beiden Kinder aufzuziehen, bis sie alt genug waren, um in ein Internat zu gehen.
Er würde sich in La Chevrolière oder in der Nähe eine gute Frau suchen, die den Platz ihrer Mutter einnehmen würde, wenn es überhaupt etwas gab, das den Platz einer Mutter für Waisenkinder einnehmen konnte.
So wurde beschlossen, dass Jean Oullier am nächsten Tag die beiden Kinder mitnehmen würde.
Um acht Uhr morgens, als der Wagen an die Eingangstreppe des Schlosses gebracht wurde, begannen die beiden Zwillinge, als sie erkannten, dass sie abgeholt werden würden, verzweifelt zu schreien.
Der Marquis de Souday setzte seine ganze Beredsamkeit ein, um seine Enkelinnen Bertha und Mary davon zu überzeugen, dass sie in der Kutsche viel mehr Vergnügen und Spaß haben würden, als wenn sie bei ihm geblieben wären; aber je mehr er sprach, desto mehr schluchzte Mary, und desto mehr tastete und umarmte ihn Bertha vor Wut.
Die Ungeduld begann den Marquis zu übermannen; und da er sah, dass Überredung nichts bewirken konnte, wollte er Gewalt anwenden, als er aufblickte und seinen Blick auf Jean Oullier richtete.
Zwei große Tränen kullerten über die gebräunten Wangen des Bauern und waren kurz davor, sich in der dicken Kette roter Koteletten zu verlieren, die sein Gesicht umrahmten.
Diese Tränen waren sowohl ein Gebet für den Marquis als auch ein Vorwurf an den Vater.
M. de Souday gab Jean Oullier ein Zeichen, das Pferd abzukoppeln, und während Bertha, die dieses Zeichen verstanden hatte, vor Freude auf der Veranda tanzte, sagte er dem Pächter ins Ohr:
"Sie werden morgen abreisen".
An diesem Tag, als das Wetter sehr schön war, wollte der Marquis die Anwesenheit von Jean Oullier ausnutzen, indem er auf die Jagd ging und sich von ihm begleiten ließ. Deshalb nahm er ihn mit in sein Zimmer und half ihm, seinen Expeditionsanzug anzuziehen.
Der Marquis, der, wie gesagt, ein Wolfshund war, war zu arm, um sich den Luxus eines Hundedieners zu gönnen; und er führte seine kleine Mannschaft selbst. Außerdem war er gezwungen, sich zwischen der Pflege des Defekts und der Beschäftigung mit dem Schießen aufzuteilen, und es kam selten vor, dass er nicht mit leeren Händen in seine Heimat zurückkehrte.
Bei Jean Oullier war das ganz anders.
Der kräftige Bauer, in seinen besten Jahren, erklomm die steilsten Rampen des Waldes mit der Kraft und Leichtigkeit eines Rehs : Er sprang über die Züge, wenn es ihm zu lang erschien, sie zu drehen, und dank seiner stählernen Sprunggelenke ließ er den Hunden keine Sohle; endlich unterstützte er sie bei zwei oder drei Gelegenheiten so glücklich, dass der gejagte Eber, der erkannte, dass er sich seiner Feinde nicht durch Flucht entledigen würde, schließlich auf sie wartete und in einem Dickicht Kopf machte, wo der Marquis die Freude hatte, ihn auf dem Hof zu erlegen; was ihm noch nicht passiert war.
Der Marquis kehrte beschwingt nach Hause zurück und dankte Jean Oullier für den köstlichen Tag, den er ihm verdankte.
Während des Abendessens war er in einer charmanten Stimmung und erfand neue Spiele, um die kleinen Mädchen auf seine Stimmung einzustimmen.
Als der Marquis de Souday am Abend in sein Zimmer zurückkehrte, fand er Jean Oullier im Schneidersitz in einer Ecke sitzen, nach Art der Türken oder Schneider.
Der tapfere Mann hatte einen Berg von Kleidern vor sich und hielt ein altes Samthöschen in der Hand, in dem er mit Wut die Nadel führte.
"Was in aller Welt machen Sie hier?", fragte der Marquis.
"Der Winter ist kalt in diesem Land der Ebene, vor allem, wenn der Wind vom Meer kommt; und zu Hause würde ich an den Beinen frieren, wenn ich nur daran denke, dass der Kuss durch solche Öffnungen die Ihren erreichen kann!" antwortete Jean Oullier und zeigte seinem Herrn einen Schlitz, der vom Knie bis zum Gürtel ging, in dem Höschen, das er gerade reparierte.
"Ah, Sie sind also ein Schneider?", sagte der Marquis.
"Ach!" sagte Jean Oullier, "wissen wir nicht ein wenig von allem, wenn wir mehr als zwanzig Jahre lang allein gelebt haben? Außerdem ist es einem nie peinlich, wenn man Soldat gewesen ist".
"Nun, war ich nicht auch einer?", fragte der Marquis.
"Nein; Sie waren ein Offizier, und das ist nicht dasselbe".
Der Marquis de Souday schaute Jean Oullier bewundernd an, legte sich dann hin, schlief ein und schnarchte, ohne im Geringsten die Arbeit des alten Chouans zu unterbrechen.
Mitten in der Nacht erwachte der Marquis.
Jean Oullier war noch am Arbeiten.
Der Berg an Klamotten hatte sich nicht merklich verkleinert.
"Aber du wirst nie fertig werden, selbst wenn du bis zum Tageslicht arbeitest, mein armer Jean!" sagte der Marquis.
"Ja, leider!"
"Dann geh zu Bett, alter Kamerad, und geh nicht, bevor nicht Ordnung in diesem ganzen Tohuwabohu ist, und wir werden morgen wieder jagen".
4. Kapitel: Wie konnte Jean Oullier noch da sein, wenn er für eine Stunde zum Marquis kam, wenn er und der Marquis nicht schon seit zehn Jahren tot waren?
Als der Marquis de Souday zur Jagd aufbrach, hatte er die Idee, seine Kinder zu küssen.
Daraufhin ging er hinauf in ihr Zimmer und fand zu seinem Erstaunen Jean Oullier vor, der ihm vorausgegangen war und die beiden kleinen Mädchen mit der Gewissenhaftigkeit und Hartnäckigkeit der besten Gouvernante wusch.
Und der arme Mann, den diese Beschäftigung an die Kinder erinnerte, die er verloren hatte, schien darin eine vollkommene Befriedigung zu finden.
Die Bewunderung des Marquis verwandelte sich in Respekt.
Acht Tage lang folgten die Jagden ohne Unterbrechung aufeinander, eine schöner und fruchtbarer als die andere.
Während dieser acht Tage, abwechselnd stachelig und sparsam, arbeitete Jean Oullier, in letzterer Eigenschaft, sobald er wieder zu Hause war, unermüdlich daran, die Toilette seines Herrn zu verjüngen; und er fand immer noch Zeit, das Haus von oben bis unten aufzuräumen.
Der Marquis de Souday, weit davon entfernt, seine Abreise zu beschleunigen, dachte mit Schrecken daran, dass er sich von einem so wertvollen Diener würde trennen müssen.
Von morgens bis abends, und manchmal von abends bis morgens, überlegte er in Gedanken, welche der Eigenschaften des Vendeaners ihn am meisten berührte.
Jean Oullier hatte das Gespür eines Bluthundes, um eine Rückkehr zum Brechen von Brombeeren oder auf taufeuchtem Gras zu entdecken.
Auf den trockenen und steinigen Wegen von Machecoul, Bourgneuf und Aigrefeuille bestimmte er ohne zu zögern das Alter und das Geschlecht des Wildschweins, dessen Spur nicht wahrnehmbar schien.
Noch nie hatte einer Hunde so unterstützt, wie Jean Oullier es konnte, auf zwei langen Beinen.
Schließlich war er an Tagen, an denen die Müdigkeit ihn zwang, dem kleinen Rudel eine Pause zu gönnen, unübertroffen in seiner Fähigkeit, die fruchtbaren Waldschnepfengehege zu erraten und seinen Herrn dorthin zu führen.
"Ah! Bei meinem Glauben, zur Hölle mit der Ehe!" rief der Marquis manchmal, wenn man glaubte, er sei mit dem Gedanken an etwas anderes beschäftigt. Was soll ich in dieser Galeere tun, in der ich die ehrlichsten Leute so traurig rudern gesehen habe? Ich bin kein junger Mann mehr, denn ich bin jetzt vierzig Jahre alt, und ich habe keine Illusionen, und ich habe nicht die Absicht, jemanden mit meinen persönlichen Vergnügungen zu verführen. Ich kann also auf nichts anderes hoffen, als mit meinen dreitausend Pfund Rente, von denen die Hälfte mit mir stirbt, eine alte Witwe in Versuchung zu führen; ich werde eine schimpfende, quengelnde, knurrende Marquise de Souday haben, die mir die Jagd verbieten kann, der der gute John so gut dient, und die den Haushalt gewiss nicht anständiger führen wird, als er es tut. Und doch", fuhr er fort, indem er sich aufrichtete und mit dem Oberkörper wippte, "sind wir in einem Zeitalter, in dem es zulässig ist, die großen Völker, die natürlichen Träger der Monarchie, auslaufen zu lassen? Wäre es nicht süß, meinen Sohn die Ehre meines Hauses erheben zu sehen? Während im Gegenteil ich, der ich nie eine Frau gekannt habe - zumindest keine legitime - was soll ich die Leute von mir denken lassen? Was werden meine Nachbarn über die Anwesenheit dieser beiden kleinen Mädchen zu Hause sagen?"
Diese Überlegungen, wenn sie zu ihm kamen - und das war gewöhnlich an Regentagen, wenn das schlechte Wetter ihn daran hinderte, seinen Lieblingsvergnügungen zu frönen - diese Überlegungen stürzten den Marquis de Souday manchmal in grausame Ratlosigkeit.
Er kam aus solchen Situationen heraus, wie alle unentschlossenen Temperamente, schwache Charaktere, alle Männer, die nicht wissen, wie man sich auf eine Seite stellt, indem man im Provisorischen bleibt.
Bertha und Mary hatten 1831 das Alter von siebzehn Jahren erreicht, und das Provisorium dauerte ewig.
Die Rassenreinheit der Marquisen von Souday tat Wunder, indem sie das saftige Blut des sächsischen Plebejers in sich aufsaugte: die Kinder von Eva sind zwei prächtige junge Mädchen mit feinen und zarten Zügen, schlanken und schmalen Taille, mit einer Neigung voll Adel und Auszeichnung.
Sie sehen sich ähnlich, wie alle Zwillinge; nur ist Bertha brünett wie ihr Vater, Mary ist blond wie ihre Mutter.
Jean Oullier war der einzige Lehrer von Evas Kindern gewesen, ebenso wie er ihre einzige Gouvernante gewesen war.
Der würdige Vendéen hatte ihnen alles beigebracht, was er konnte, lesen, schreiben, zählen, mit zärtlicher und tiefer Inbrunst zu Gott und der Jungfrau beten; dann durch den Wald zu laufen, auf die Felsen zu klettern, die Stechpalmen, Brombeeren und Dornenbäume zu durchqueren, alles ohne Müdigkeit, Angst oder Schwäche; einen Vogel im Flug, ein Reh im Lauf mit einer Kugel zu stoppen; schließlich die unbezähmbaren Pferde von Mellerault nackt zu reiten, so wild in ihren Wiesen oder Mooren wie die Pferde der Gauchos in ihrer Pampa.
Die beiden Kinder ihrerseits hatten ihre moralische Erziehung, die Jean Oullier im physischen Bereich so energisch vorangetrieben hatte, so gut wie möglich abgeschlossen; sie hatten beim Versteckspiel im Schloss ein Zimmer entdeckt, das wahrscheinlich seit dreißig Jahren nicht mehr geöffnet worden war.
Es war die Bibliothek.
Dort hatten sie etwa 1.000 Bände gefunden.
Jede von ihnen hatte einen Band nach ihrem Geschmack ausgewählt.
Die sentimentale, süße Mary hatte den Romanen den Vorzug gegeben, die turbulente, positive Bertha der Geschichte.
Bei der Erstkommunion der beiden kleinen Mädchen hatte der Pfarrer von Machecoul, der sie wegen ihrer Frömmigkeit und der Güte ihres Herzens liebte, einige Bemerkungen über die eigentümliche Existenz gewagt, auf die sie sich durch diese Erziehung vorbereiteten; aber diese freundlichen Ermahnungen waren an der egoistischen Gleichgültigkeit des Marquis de Souday zerbrochen.
Und die Erziehung, die wir beschrieben haben, hatte sich fortgesetzt, und aus dieser Erziehung hatten sich die Gewohnheiten ergeben, die Bertha und ihrer Schwester, dank ihrer schon so falschen Stellung, einen sehr schlechten Ruf im ganzen Land verschafft hatten.
Und in der Tat war der Marquis de Souday von Nichtjuden umgeben, die ihn sehr um die Abbildung seines Namens beneideten und nur nach einer Gelegenheit verlangten, ihm die Verachtung zurückzugeben, die die Vorfahren des Marquis wohl den ihren entgegengebracht hatten; und so begannen sie, als man sah, dass er in seinem Haus hielt und seine Töchter die Früchte einer unehelichen Affäre nannte, zu seiner Täuschung zu veröffentlichen, wie sein Leben in London ausgesehen hatte; Sie übertrieben seine Fehler; sie machten die arme Eva, die durch ein Wunder der Vorsehung so rein geblieben war, zu einer Tochter der Straße, und nach und nach wandten sich die Hobereaux von Beauvoir, Saint-Léger, Bourgneuf, Saint-Philbert und Grand-Lieu von dem Marquis ab, unter dem Vorwand, dass er den Adel entwürdige, von dem sie angesichts der Beerdigung der meisten von ihnen gut beraten waren, sich so viel Mühe zu geben.
Bald waren es nicht nur die Männer, die das gegenwärtige Verhalten des Marquis de Souday missbilligten und sein vergangenes Verhalten verleumdeten; die Schönheit der beiden Schwestern hetzte alle Mütter und Töchter im Umkreis von zehn Meilen gegen sie auf.
Kurzum, es wird so viel von Bertha und Mary erzählt, dass sie, was auch immer bis dahin gewesen war und was auch immer in Wirklichkeit noch die Reinheit ihres Lebens und die Unschuld ihres Handelns war, zu einem Objekt des Grauens für das ganze Land wurden.
Dieser Hass wurde von den Dienern der Schlösser, von den Arbeitern, die sich der Bourgeoisie näherten, von den Menschen, die sie beschäftigten oder denen sie Dienste leisteten, im Volk verbreitet; so dass - mit Ausnahme einiger armer Blinder oder einiger impotenter alter Frauen, die von den Waisen direkt gerettet wurden - die gesamte Bevölkerung in Blusen und Holzschuhen als Echo auf die absurden Geschichten diente, die von den Bonzen der Nachbarschaft erfunden wurden; und es gab keinen Holzfäller, keinen Holzschuhmacher aus Machecoul, keinen Bauern aus Saint-Philbert oder Aigrefeuille, der sich nicht durch das Abnehmen seines Hutes entehrt gefühlt hätte.
Schließlich hatten die Bauern Bertha und Mary einen Spitznamen gegeben, und dieser Spitzname, der von unten kam, wurde in den oberen Regionen als perfekt charakterisierend für die Begierden und Störungen, die man den Mädchen zuschrieb, bejubelt.
Sie nannten sie die Wölfe von Machecoul.
5. Kapitel: Ein Wurf Wölfe
Der Marquis de Souday blieb völlig gleichgültig gegenüber diesen Manifestationen der öffentlichen Animadversion; außerdem schien er nicht einmal zu ahnen, dass es sie gab. Als er merkte, dass ihm nicht mehr die seltenen Besuche abgestattet wurden, von denen er aus der Ferne glaubte, sie bei seinen Nachbarn machen zu müssen, rieb er sich freudig die Hände, um sich von den ihm verhassten Aufgaben zu befreien, die er nie außer unter Zwang und unter dem Druck seiner Töchter oder von Jean Oullier erledigte.
Hier und da fiel ihm etwas von den Verleumdungen ein, die über Bertha und Mary im Umlauf waren; aber er war so glücklich inmitten seines Faktotums, seiner Töchter und seiner Hunde, dass er spürte, dass es das Glück, das er genoss, gefährden würde, wenn er diesen absurden Bemerkungen die geringste Aufmerksamkeit schenkte.
Jean Oullier war nicht annähernd so philosophisch wie sein Meister.
Die Verachtung, die sowohl Reiche als auch Arme gegenüber den Waisenkindern nicht zu verbergen suchten, rührte ihn zutiefst; hätte er sich von der Bewegung seines Blutes mitreißen lassen, so hätte er mit jeder Physiognomie zu streiten gesucht, die ihm respektlos erschien, und er hätte die einen mit den Fäusten korrigiert und den anderen das geschlossene Feld angeboten; aber sein gesunder Menschenverstand ließ ihn begreifen, dass Bertha und Mary einer anderen Rehabilitation bedurften, und dass gegebene oder empfangene Schläge absolut nichts für ihre Rechtfertigung beweisen würden. Er fürchtete außerdem - und das war seine größte Angst -, dass die Mädchen durch eine der Szenen, die er so bereitwillig provoziert hatte, in der öffentlichen Stimmung ihnen gegenüber belehrt werden könnten.
Der arme Jean Oullier beugte sein Haupt über diese ungerechte Verwerfung, und große Tränen und inbrünstige Gebete zu Gott, diesem obersten Richtigsteller der Ungerechtigkeiten der Menschen, zeugten allein von seinem Kummer. Dort gewann er eine tiefe Misanthropie. Da er um sich herum nur die Feinde seiner lieben Kinder sah, konnte er nichts anderes tun, als die Menschen zu hassen, und er bereitete sich, während er von zukünftigen Revolutionen träumte, darauf vor, Böses mit Bösem zu vergelten.
Die Revolution von 1830 war gekommen, ohne Jean Oullier, der ein wenig damit gerechnet hatte, die Gelegenheit zu geben, seine schlechten Wünsche in die Tat umzusetzen.
Aber da der Aufruhr, der jeden Tag in den Straßen von Paris tobte, in einer bestimmten Zeit auch auf die Provinzen übergreifen konnte, wartete er ab.
Nun, an einem schönen Septembermorgen, waren der Marquis de Souday, seine Töchter, Jean Oullier und die Meute auf der Jagd im Wald von Machecoul.
Es war ein Tag, den der Marquis sehnsüchtig erwartete, und seit drei Monaten hatte er sich große Freude versprochen; es ging ganz einfach darum, einen Wurf Wölfe zu nehmen, den Jean Oullier entdeckt hatte, als sie ihre Augen noch nicht geöffnet hatten, und den er seitdem als der würdige Wolfsfänger, der er war, verwöhnt, gepflegt und verwaltet hatte.
Dieser letzte Satz bedarf für diejenigen unter unseren Lesern, die mit der hohen Kunst der Käuflichkeit nicht vertraut sind, vielleicht einer Erklärung.
So unpraktisch die Jagd eines alten Wolfes ist, wenn man ihn laufen lässt, und so langweilig und eintönig sie ist, so leicht, angenehm und amüsant ist die eines Wolfes von fünf bis sieben Monaten.
Um seinem Herrn diese reizvolle Freizeitbeschäftigung zu ersparen, hatte Jean Oullier, als er den Wurf entdeckt hatte, darauf geachtet, den Wolf nicht zu stören und zu erschrecken.
Schließlich hatte er sie eines Tages, als er urteilte, dass sie reif sein mussten für das, was er mit ihnen machen wollte, in einen Verkauf von einigen hundert Hektar zurückgelegt und die sechs Hunde des Marquis de Souday auf einem von ihnen ausgekoppelt.
Der arme Teufel von Louvart, der nicht wusste, was diese Rinden und Baumstammsplitter bedeuteten, verlor den Kopf: er verließ sofort das Gehege, in dem er seine Mutter und seine Brüder zurückgelassen hatte und in dem es noch, um seine Haut zu retten, Chancen auf eine Veränderung gab; er ging in einen anderen Hof, wo er eine halbe Stunde lang geschlagen wurde, wobei er wie ein Hase lief; dann, müde, seine großen Beine ganz taub fühlend, setzte er sich naiv auf seinen Schwanz und wartete.
Er wartete nicht lange, um zu erfahren, was er wollte; denn Domino, der Oberhund des Marquis, ein rauhaariger, grauer Vendeaner, kam fast sofort und brach mit einem Schlag seines Mauls seine Lenden.
Jean Oullier nahm seine Hunde zurück, brachte sie zu seiner Pause, und zehn Minuten später war einer der Brüder des Verstorbenen auf den Beinen, und die Meute pustete ihn weg.
Letztere, klüger, verließen das Gebiet nicht, so dass häufige Wechsel, mal von den überlebenden Wölfen, mal von der Wölfin, die sich den Hunden freiwillig anboten, den Moment seines Todes hinauszögerten, aber Jean Oullier kannte seinen Job zu gut, um den Erfolg durch solche Fehler gefährden zu lassen: Sobald die Jagd die lebhaften und direkten Gänge annahm, die die Gänge eines alten Wolfes charakterisieren, würde er seine Hunde bremsen, sie zu der Stelle zurückbringen, wo der Fehler aufgetreten war, und sie wieder auf die richtige Spur bringen.
Endlich, von seinen Verfolgern zu sehr bedrängt, versuchte der arme Wolfsjunge ein Stündchen; er verfolgte seine Schritte zurück und kam so naiv aus dem Wald heraus, dass er dem Marquis und seinen Töchtern nachgab; überrascht, den Kopf verlierend, versuchte er zwischen den Beinen der Pferde hindurchzulaufen; aber Herr de Souday, der sich über den Hals seines Pferdes beugte, packte ihn scharf am Schwanz und warf ihn den Hunden vor, die ihm bei seiner Rückkehr gefolgt waren.
Diese beiden aufeinanderfolgenden Hallalis hatten den Herrn von de Souday prächtig unterhalten, und er wollte nicht ruhen.
Er diskutierte mit Jean Oullier, ob er zurückkehren sollte, um die Gebrochenen anzugreifen, oder ob er die Hunde unter dem Wald zur Billebaude gehen lassen sollte, was von den Wölfen übrig geblieben war, die auf den Beinen sein mussten.
Aber die Wölfin, die wohl ahnte, dass sie immer noch wütend auf das war, was von ihrem Nachwuchs übrig war, überquerte die Straße zehn Schritte von den Hunden entfernt, auf dem Höhepunkt der Diskussion zwischen Jean Oullier und dem Marquis.
Beim Anblick des Tieres erhob die kleine Meute, die das Überqueren vernachlässigt hatte, nur ein Bellen und stürzte sich, trunken vor Wut, auf seine Spur.
Rufe, verzweifelte Schreie, Peitschenschläge, nichts konnte sie zurückhalten, nichts konnte sie aufhalten.
Jean Oullier spielte mit den Beinen, um sich ihr anzuschließen; der Marquis und seine Töchter galoppierten mit ihren Pferden zu demselben Zweck; aber es war kein scheuer und zögerlicher Wolf mehr, den die Hunde vor sich hatten: Es war ein kühnes, kräftiges, unternehmungslustiges Tier, das selbstbewusst ging, als ob es zu seiner Festung zurückkehrte, durchdringend geradeaus, unbekümmert um die Täler, Felsen, Berge und Bäche, die es auf seinem Weg vorfand, und das, ohne Furcht, ohne Hast, von Zeit zu Zeit umhüllt von der kleinen Mannschaft, die es verfolgte, zwischen den Hunden trottete und sie mit der Kraft seines schrägen Blicks und vor allem durch das Knacken seines gewaltigen Kiefers beherrschte.
Die Wölfin durchquerte drei Viertel des Waldes und nahm ihren Ausgang in der Ebene, als ob sie auf den Wald der Grand-Lande zusteuern würde.
Jean Oullier hielt Abstand, und dank der Elastizität seiner Beine blieb er drei- oder vierhundert Schritte von den Hunden entfernt. Durch die Steilhänge gezwungen, den geschwungenen Linien und Straßen zu folgen, waren der Marquis und seine Töchter zurückgeblieben.
Als diese ihrerseits am Waldrand angekommen waren und den Hang über dem kleinen Dorf an der Marne erklommen hatten, sahen sie eine halbe Meile vor sich, zwischen Machecoul und Brillardière, mitten im Ginster, der zwischen diesem Dorf und der Jacquelerie gesät war, Jean Oullier, seine Hunde und seine Wölfin, immer im gleichen Schritt und der geraden Linie folgend, in derselben Position.
Der Erfolg der ersten beiden Jagden und die Geschwindigkeit des Rennens hatten das Blut des Marquis de Souday stark erhitzt.
"Leck mich!" sagte er, "ich würde zehn Tage meines Lebens geben, um in diesem Augenblick zwischen Saint-Etienne de Mermorte und La Guimarière zu sein, um diesem schurkischen Wolf eine Kugel zu schicken".
"Sie geht natürlich in den Wald der Grand-Lande", antwortete Maria.
"Ja", sagte Bertha; "aber gewiss wird sie zu ihrem Wurf zurückkehren, solange die Jungen ihn nicht verlassen haben; so kann sie nicht weitermachen".
Der Weg, in den sich der Marquis soeben geworfen hatte, war steinig und von diesen unpassierbaren Spurrillen abgeschnitten.
Herr de Souday, der besser beritten war als seine Töchter und sein Tier besser lenken konnte als sie, hatte einen Vorsprung von einigen hundert Schritten auf sie herausgeholt; durch die Schwierigkeiten des Weges zurückgestoßen, sah er ein offenes Feld, warf sein Pferd hinein und ritt, ohne seine Kinder zu warnen, über die Ebene.
Bertha und Mary, die glaubten, dass sie immer noch ihrem Vater folgten, setzten ihr gefährliches Rennen auf dem versunkenen Pfad fort.
Sie waren etwa eine Viertelstunde gelaufen, getrennt von ihrem Vater, als sie sich an einer Stelle wiederfanden, wo der Weg tief eingeschnitten war zwischen zwei Böschungen, die von Hecken gesäumt waren, deren Zweige sich über ihre Köpfe hinweg kreuzten; dort blieben sie plötzlich stehen, weil sie glaubten, in geringer Entfernung das bekannte Bellen ihrer Hunde zu hören.
Fast im selben Augenblick ertönte wenige Schritte von ihnen entfernt ein Schuss, und ein großer Hase, mit blutigen, herabhängenden Ohren, kam aus der Hecke und rannte auf den Weg, während wütende Schreie "Nach! nach, Hunde! Tallyho! tallyho! " kam von dem Feld, das den schmalen Weg überblickte.
Die beiden Schwestern dachten, sie seien in die Jagd eines ihrer Nachbarn geraten, und wollten sich gerade diskret entfernen, als sie an der Stelle, wo der Hase sein Loch gemacht hatte, Rustaud auftauchen sahen, der aus vollem Halse schrie, einen der Hunde ihres Vaters, dann, nach Rustaud, Faraud, dann Bellaude, dann Domino, dann Fanfare, alle ohne Unterbrechung hintereinander her, alle jagten diesen unglücklichen Hasen, als hätten sie den ganzen Tag noch nie von einem edleren Spiel gehört.
Doch kaum war der Schwanz des sechsten Hundes aus der engen Öffnung herausgetreten, wurde er durch einen menschlichen Kopf ersetzt.
Dieser Kopf war die Gestalt eines blassen, verängstigten, strubbelhaarigen, hageräugigen jungen Mannes, der übermenschliche Anstrengungen unternahm, damit der Körper dem Kopf durch den engen Ausgang folgte, und der, während er gegen die Brombeeren und Dornen ankämpfte, die Töne von sich gab, die Bertha und Mary gehört hatten, nachdem fünf Minuten zuvor der Gewehrschuss gefallen war.
6. Kapitel: Ein verwundeter Hase
Es war blanke Wut, dass der arme Junge versuchte, sich zu befreien, und bei dieser neuen und höchsten Anstrengung, die er machte, nahm sein Gesicht einen solchen Ausdruck der Verzweiflung an, dass Maria davon gerührt war.
"Sir", sagte Mary zu dem jungen Mann, "ich denke, ein wenig Hilfe wäre nicht nutzlos für Sie, um von hier wegzukommen, werden Sie die Hilfe annehmen, die meine Schwester und ich bereit sind, Ihnen anzubieten?"
Er richtete sich auf seine Handgelenke auf und versuchte, sich vorwärts zu bewegen, wobei er der Vorderseite seines Körpers die diagonale Kraft verlieh, die Tiere der Ordnung der Schlangen laufen lässt, und bei dieser Bewegung drückte seine Stirn unglücklicherweise gewaltsam gegen den Abschnitt eines Astes eines wilden Apfelbaumes, den die Bauernschlange bei der Gestaltung der Hecke in eine scharfe, spitze Schräge geschnitten hatte. Der Ast schnitt in die Haut, wie es das schärfste Rasiermesser getan hätte. Der junge Mann, der sich schwer verwundet fühlte, schrie auf, und das Blut, das sofort in Hülle und Fülle heraussprudelte, bedeckte sein ganzes Gesicht.
Beim Anblick des Unfalls, dessen Ursache sie unwissentlich geworden waren, stürzten die beiden Schwestern auf den jungen Mann zu, packten ihn an den Schultern und schafften es mit einer Kraft, die man bei gewöhnlichen Frauen nicht findet, ihn aus der Hecke zu ziehen und auf die Böschung zu setzen.
Unfähig zu erkennen, wie wenig ernst die Wunde wirklich war, und sie nach ihrem Aussehen zu beurteilen, wurde Mary blass und zitterte, und Bertha, weniger beeindruckbar als ihre Schwester, verlor nicht einen Moment den Kopf.
"Lauf zu dem Bach", sagte sie zu Maria, "und tauche dein Taschentuch hinein, damit wir diesen unglücklichen Mann von dem Blut befreien können, das ihn blind macht.
Dann, als Maria gehorchte, wandte sie sich an den jungen Mann:
"Haben Sie große Schmerzen, Sir?", fragte sie.
"Es tut mir leid, Fräulein", antwortete der junge Mann, "aber ich habe im Moment so viele Dinge im Kopf, dass ich nicht sicher bin, ob es das Innere oder das Äußere meines Kopfes ist, das mir wehtut".
Dann brach er in Schluchzen aus, das er nur mit großer Mühe zurückhalten konnte:
""Ah", rief er, "der liebe Gott straft mich dafür, dass ich meiner Mutter nicht gehorcht habe!
Obwohl derjenige, der so sprach, sehr jung war, der junge Mann hätte in den Zwanzigern sein können, lag ein kindlicher Akzent in den seltsamen Worten, die er soeben ausgesprochen hatte, die so angenehm mit seiner Größe, mit seinem Jägergeschirr schwangen, dass die Mädchen trotz des Mitleids, das die Wunde in ihnen erweckt hatte, einen weiteren Lachanfall nicht zurückhalten konnten.
Der arme Junge warf den beiden Schwestern einen vorwurfsvollen und betenden Blick zu, während ihm zwei große Tränen aus den Augenlidern flossen.
Gleichzeitig riss er mit einer Bewegung der Ungeduld das mit frischem Wasser getränkte Taschentuch ab, das Maria ihm auf die Stirn gelegt hatte.
"Nun", fragte Bertha, "was machen Sie da?"
"Lasst mich gehen!", rief der junge Mann, "ich bin nicht bereit, eine Behandlung anzunehmen, für die ich verspottet werde. Oh, jetzt bereue ich, dass ich nicht meinem ersten Gedanken gehorcht habe, der darin bestand, wegzulaufen und eine hundertfache Verletzung zu riskieren".
"Ja, aber da Sie so vernünftig waren, es nicht zu tun", sagte Mary, "seien Sie wieder so vernünftig, sich von mir die Augenbinde wieder auf die Stirn legen zu lassen".
Und indem sie das Taschentuch aufhob, näherte sich das Mädchen dem verwundeten Mann mit einem solchen Ausdruck des Interesses, dass dieser, den Kopf schüttelnd, nicht als Zeichen der Ablehnung, sondern als Zeichen der Verzweiflung, antwortete: "Ja, aber da Sie so vernünftig waren, es nicht zu tun", sagte Mary, "seien Sie wieder so vernünftig, mich den Verband wieder auf Ihre Stirn legen zu lassen:
"Tun Sie, was Sie wollen, Mademoiselle".
Bertha hatte nichts von der Physiognomie des jungen Mannes verloren und sagte, "für einen Jäger sind Sie ein wenig empfindlich, mein lieber Herr".
"Ich bin kein Jäger, Fräulein, und erst recht nicht, nach dem, was mir widerfahren ist, bin ich bereit, einer zu werden".
"Es tut mir leid", sagte Bertha in demselben spöttischen Ton, der schon den jungen Mann empört hatte, "aber nach der Heftigkeit zu urteilen, mit der Sie gegen die Dornen und Brombeeren ankämpften, und vor allem nach dem Eifer, mit dem Sie unsere Hunde anfeuerten, durfte ich annehmen, dass Sie wenigstens danach strebten, ein Jäger zu sein".
"Oh nein, Fräulein, ich habe einer Erziehung nachgegeben, die ich nicht mehr verstehe, jetzt, wo ich kaltblütig bin und fühle, wie recht meine Mutter hatte, als sie diese Entspannung, aus der Qual und dem Tod eines armen wehrlosen Tieres Vergnügen und Eitelkeit zu schöpfen, lächerlich und barbarisch nannte".
Bertha sagte: "Hüten Sie sich, mein lieber Herr, denn wir, die wir dem Spott und der Barbarei frönen, werden Sie wie der Fuchs in der Fabel aussehen".
In diesem Moment war Mary, die wieder ihr Taschentuch in den Bach getaucht hatte, im Begriff, es zum zweiten Mal um die Stirn des jungen Mannes zu binden.
Aber er, der sie wegstößt:
- Um Himmels willen, Fräulein", sagte er zu ihr, "tun Sie mir einen Gefallen. Sehen Sie nicht, dass Ihre Schwester mich weiterhin verspottet?"
"Zeig mal, bitte", sagte Mary mit ihrer süßesten Stimme.
Aber er ließ sich von der Süße dieser Stimme nicht beeindrucken und erhob sich mit der klaren Absicht, wegzugehen.
Diese Hartnäckigkeit, die viel mehr die eines Kindes als die eines Mannes war, brachte die jähzornige Bertha zur Verzweiflung, und ihre Ungeduld, die von einem sehr respektablen Gefühl der Menschlichkeit beseelt sein sollte, drückte sich nicht weniger in Ausdrücken aus, die für ihr Geschlecht etwas zu energisch waren.
"Verdammt!", schrie sie, wie ihr Vater unter solchen Umständen geschrien hätte, "will dieser garstige kleine Kerl nicht auf die Vernunft hören? Ich werde seine Hände halten, Mary, und die des Teufels, wenn er sich bewegt".
Und Bertha, die die Handgelenke des Verwundeten mit einer Muskelkraft ergriff, die alle seine Bemühungen, sich zu befreien, lähmte, schaffte es, Marys Aufgabe zu erleichtern, und von da an hielt sie das Taschentuch fest über der Wunde.
Als dieser mit einer Geschicklichkeit, die einem Schüler von Dupuytren oder Jobert zur Ehre gereicht hätte, die Ligaturen ausreichend gefestigt hatte:
"Nun, Sir", sagte Bertha, "Sie sind kurz davor, nach Hause zurückzukehren, also können Sie zu Ihrer ursprünglichen Idee zurückkehren, und wir machen auf dem Absatz kehrt, ohne auch nur Danke zu sagen. Sie sind frei".
Aber, trotz dieser gegebenen Erlaubnis, trotz dieser gegebenen Freiheit, stand der junge Mann still.
Der arme Junge schien sowohl ungeheuer überrascht als auch tief gedemütigt zu sein, so schwach in die Hände zweier so starker Frauen gefallen zu sein; sein Blick ging von Bertha zu Mary und von Mary zu Bertha, ohne ein Wort zu finden, um ihnen zu antworten.
Schließlich sah er keine andere Möglichkeit, seiner Verlegenheit zu entkommen, als sein Gesicht zwischen den beiden Händen zu verstecken.