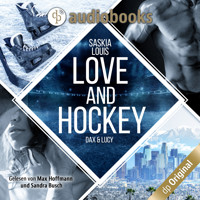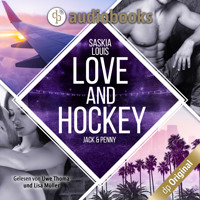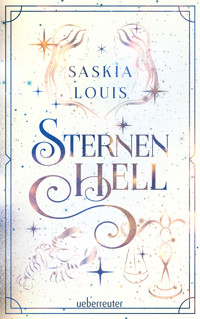Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Ueberreuter VerlagHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Was wäre, wenn man jede Art von Lüge sofort erkennen könnte? Die 17-jährige Fawn ist die beste Lügendiebin Mentanos, denn mit ihrer roten Magie entlarvt sie Lügen, sobald sie ausgesprochen werden. Ein lukratives Geschäft, denn in den Dunkeldieben findet sie immer freudige Abnehmer ihrer brisanten Ware. Doch ihr größter Raubzug geht schief: Im Haus der adeligen Familie Falcron wird sie von Caeden, dem Sohn und Familienoberhaupt, ertappt. Und schon findet Fawn sich selbst in der größten Lüge ihres Lebens wieder: Um nicht ausgeliefert und gehängt zu werden, muss sie ab sofort Caedens Verlobte mimen. Denn mit ihrer Fähigkeit will Caeden endlich den Mörder seines Vaters entlarven. Und so spielt Fawn das gefährliche Spiel mit, das sie immer weiter in die Abgründe führt und zwischen die Fronten geraten lässt. Lügen, Liebe und ein brisantes Geheimnis: Diese Geschichte hat alles, was ein Romantasy-Schmöker braucht!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über dieses Buch
Die 17-jährige Fawn ist die beste Lügendiebin Mentanos, denn mit ihrer roten Magie entlarvt sie Lügen, sobald sie ausgesprochen werden. Ein lukratives Geschäft. Doch ihr größter Raubzug geht schief: Im Haus der adeligen Familie Falcron wird sie von Caeden, dem Sohn und Familienoberhaupt, ertappt. Und schon findet Fawn sich selbst in der größten Lüge ihres Lebens wieder: Um nicht ausgeliefert und gehängt zu werden, muss sie ab sofort Caedens Verlobte mimen. Denn mit ihrer Fähigkeit will Caeden endlich den Mörder seines Vaters entlarven …
Der mitreißende Auftakt einer spektakulären Dilogie!
Inhalt
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
DIE WELT DER LÜGENDIEBIN
PROLOG
Das Blut rann zwischen meinen Fingern hindurch wie Sand durch ein Uhrglas. Es perlte meine Kleidung hinab, sammelte sich an meinen Füßen zu einer glatten Pfütze und spiegelte verzerrt mein Gesicht wider.
Rot. Überall rot.
Rote Wände, rote Dächer, roter Himmel. Die Farbe verfolgte mich. Sie war mein Anfang und würde auch mein Ende sein. Ich atmete zitternd ein, drückte die Hände fester auf meinen Bauch, doch die klebrige Flüssigkeit quoll unaufhörlich weiter daraus hervor.
Es war merkwürdig. Ich hatte immer gedacht, dass der Tod wehtun würde. Doch er war sanft. Beinahe zärtlich. Ich hatte keine Schmerzen, ich war nur müde. So unendlich müde. Ich wollte nicht mehr kämpfen, also schloss ich die Augen und fiel auf die Knie.
Der sandige Boden war warm, die Sonne hatte ihn aufgeheizt. Doch die Wärme drang nicht durch meine Haut.
»Fawn …«
Die Stimme war nur ein Flüstern. Ein Hauch. Kalten Fingern gleich strich sie mir über die Lippen und ließ mich erschaudern.
»Fawn, heute ist nicht der Tag, um zu sterben. Verstehst du mich?«
Ich schüttelte den Kopf, kniff die Augen fester zusammen, während das Salz meiner Tränen sich mit dem Geschmack nach Eisen mischte.
»Du wirst heute nicht sterben«, wiederholte die Stimme. Dunkel und ruhig – doch nicht genug, um mich hierzubehalten. Nicht diesmal.
»Fawn! Hör mir zu.« Raue Finger umfassten mein Gesicht und hielten es fest, sodass mein Kopf nicht nach vorne sacken konnte. »Mach die Augen auf. Sieh mich an. Du hast es mir versprochen. Du hast es mir verdammt noch mal versprochen!«
»Ich habe gelogen«, flüsterte ich und knickte zur Seite weg.
KAPITEL 1
Lügen sind ein lukratives Geschäft.
Das war das Erste, was meine Mutter mir beibrachte.
Meinem älteren Bruder Trent zeigte sie, wie er ein Hemd richtig faltete. Meiner Schwester Cora erklärte sie, wie man ein rostiges Rohr am Heizofen austauschte. Mich jedoch unterrichtete sie darin, wie man unbedachte Worte zu Geld machte.
Blutrote Lügen und fuchsiafarbene Halbwahrheiten waren die einzig wahre Währung. Egal, was das Königshaus behaupten mochte. Das war es, was sie mir jeden Abend vor dem Schlafengehen ins Ohr geflüstert hatte.
Und sie hatte recht, oder nicht?
Lügen verloren nie an Wert. Sie starben nicht aus. Sie verjährten nicht.
Die Menschen hatten zu viele Schwächen und Geheimnisse, die sie zwanghaft zu verbergen versuchten, als dass es anders sein könnte.
Vielleicht war es verwerflich, daraus Profit zu schlagen … aber wenn ich mich jemals unwohl damit gefühlt haben sollte, dann hatte ich mich mittlerweile erfolgreich vom Gegenteil überzeugt.
Mir gefiel es, den Menschen die Worte, die so unvorsichtig von ihren Lippen perlten, aus dem Mund zu stehlen. Denn ich war so verdammt gut darin! Ich wünschte mir manchmal nur, dass es weniger aufwendig wäre, eine brauchbare Lüge zu finden. Die alltäglichen Flunkereien von der Straße waren wertlos. Es waren die Geheimnisse der Reichen und Schönen, die ich sammelte. Und die waren schwer zu beschaffen. Schwer. Aber nicht unmöglich.
Nein, nie unmöglich, dachte ich und zog lächelnd den Lederriemen enger um meine Taille. Ich versicherte mich, dass ich genug Pergament und Glasphiolen in meinen mit Knöpfen versehenen Taschen hatte, und fragte mich, ob meine Mutter stolz auf mich wäre, wenn sie mich jetzt sehen könnte.
»Fawn?«
»Sei still, Finch.«
»Fawn, ich kann deine Unterhose sehen.«
Ich verdrehte die Augen. Na, vielleicht nicht stolz. Aber zumindest beeindruckt. Auch wenn ich meine Lügen natürlich an die von ihr verachteten Dunkeldiebe verkaufte – und nicht etwa an die Wächter, so wie sie es getan hatte.
»Findest du nicht, dass eine gelbe Unterhose einen falschen Eindruck vermittelt?«, murmelte Finch unzufrieden. »Die Leute könnten auf die Idee kommen, du hättest ein sonniges Gemüt. Das wäre selbst für deine Verhältnisse eine große Lüge.«
»Halt die Klappe.«
Zurzeit hing ich kopfüber von einem verräterisch weißen Dachgiebel und da ein Sturz aus zwanzig Fuß mich mein Leben – oder noch schlimmer, meine Geduld – kosten könnte, beließ ich es bei diesen Worten. Mir war durchaus bewusst, dass mir der Rock an den Ohren hing, aber Schamgefühl hatte in meinem Handwerk nichts verloren. Außerdem: Falls ich erwischt werden sollte, konnte ich mich in diesem Kleid noch immer als Dienstmädchen ausgeben.
»Und ich dachte immer, dass ich deine Unterhose erst sehe, wenn du mir deine ewige Liebe gestehst«, sinnierte Finch seufzend weiter und hätte ich meinen Fuß nicht zum Festhalten gebraucht, hätte er längst in seinem Rachen gesteckt.
»Finch, ich schwöre dir, wenn du nicht gleich – « Ich brach ab. Ein hölzernes Knarren ertönte und forderte meine gesamte Aufmerksamkeit. Hastig hob ich den Kopf, damit die Wache, die aus einem Fenster zwei Stockwerke tiefer sah, mich nur erkennen könnte, wenn sie sich rückwärts aus dem Haus lehnte. Obwohl die Sonne gerade erst ihren siebten Schritt getan hatte, war es bereits dunkel. Bis zum Friedensjahresende waren es nur noch knapp anderthalb Monate, sodass der hereinbrechende Abend Mentano bereits etwas früher als sonst in fahles Dämmerlicht tauchte. Die Dunkelheit half … aber ich hätte sie nicht gebraucht. Ich war schon über ein Dutzend Mal in das Anwesen der Falcrons eingebrochen. Ich kannte die Routine. Zwei Straßenpatrouillen, eine Menge Schlösser und ein vorhersehbarer Nachtwächter.
Die Bewohner des weißen Rings, dem reichsten Teil unseres Landes, waren ein vorsichtiges Völkchen. Ich schätze, je mehr man besaß, desto größer war die Angst, es zu verlieren. Dabei sorgten sich die hier wohnenden Weißen Magier und Adeligen regelrecht panisch um ihr Hab und Gut. Obwohl ich doch bloß die Worte brauchte, die so unbedacht ihren Mund verließen.
Der Fensterladen unter mir knarzte erneut, als der Wächter ihn weiter aufstieß und das Meer aus weißen Dächern sowie die Straße vor uns absuchte. Jetzt war selbst Finch still. Auch er hatte die Bewegung bemerkt. Den Atem anhaltend, presste er sich an die dünne Stange des Blitzableiters, auf dem er saß, den schmalen Kopf zwischen die breiten Schultern gezogen. Wie ein ängstliches Brathähnchen am Spieß. Er war kein Freund von Einbrüchen. Er war besser darin, zu verhandeln und Leute einzuschüchtern. Eine Fähigkeit, die die Dunkeldiebe für sich zu nutzen wussten. Ich war mir sicher, dass Finch eine schillernde Zukunft innerhalb ihrer Reihen vor sich hatte – doch bis es so weit war, würde er weiter für mich Schmiere stehen.
Mein Karriereweg unter Crow, dem Anführer der Dunkeldiebe, war noch unklar. Meine Zunge war zu schnell und zu scharf, um mir beim Handeln etwas Gutes zu tun. Ich hätte wohl schon das ein oder andere Mal den Kopf verloren, wenn die Diebe nicht wüssten, dass ich sein Liebling war.
Ich war eine gute Lügendiebin. Nein, ich war die beste Lügendiebin. Sie brauchten mich – eine Menge Ansehen oder gar Respekt genoss ich trotzdem nicht. Ich war schließlich weder gefährlich noch brutal oder sonderlich angsteinflößend.
Noch nicht. Aber das konnte sich jede Nacht ändern. Ich brauchte nur die richtige Lüge …
Meine Bauchmuskeln fingen gerade an zu brennen, als der Nachtwächter den Fensterladen mit einem Klappern wieder schloss und Finch wisperte: »Die Luft ist rein, die Straße leer. Also los.«
Sofort löste ich ein Bein vom hervorstehenden Giebel, stieß mich vom Dach ab und schwang vor und zurück. Die Hände hielt ich weit nach unten gestreckt, in Richtung der nahe liegenden diamantenen Laterne, die den sanft klappernden, sperrangelweit offenen Fensterladen direkt unter mir erhellte.
»Nur damit das klar ist«, flüsterte ich und erhöhte meine Geschwindigkeit. »Das einzige Mal, dass ich dir meine Unterwäsche freiwillig zeigen werde, ist, wenn ich sie dir zum Waschen gebe!« Im nächsten Moment löste ich das Bein.
Die Luft peitschte mir ins Gesicht, während ich mich in einer Pirouette um die eigene Achse drehte. Ich griff nach dem gebogenen Laternenmast, der ein unheilvolles Quietschen von sich gab, und schwang mich einmal um ihn herum, durch das offene Fenster, das mit nichts außer Luft und Vertrauen gesichert war.
Was dachten sich die Reichen nur dabei? Hatten Angst, bestohlen zu werden, waren aber gleichzeitig zu arrogant, um wirklich damit zu rechnen. Dummköpfe.
Geduckt landete ich auf dem weichen Teppich, der meinen Aufprall dämpfte. Er roch nach Lavendel und Hyazinthen. Nur schwer konnte ich mich von einem Schnauben abhalten. Wer parfümierte seinen Fußabtreter? Das war verwerflicher, als Lügen zu stehlen.
Ich atmete tief ein und aus und überprüfte noch einmal, ob meine Handschuhe gut saßen. Mir blieb nicht mehr viel Zeit, um etwas Brauchbares zu finden. Sobald die Sonne ihren nächsten Schritt tat und komplett unterging, nahm der Nachtwächter seine Position vor dem Eingang ein und machte es mir unmöglich, sicher und unbemerkt wieder aus dem Haus zu gelangen.
Aufregung pumpte durch meine Adern und trieb meinen Herzschlag an, während ich den Mund zu einem Lächeln verzog. Ich hatte etwa einen halben Sonnenschritt lang Zeit – also eine halbe Ewigkeit.
Noch immer vorgebeugt, huschte ich durch den dunklen Raum, die Arme angezogen, die Schritte federnd. Es war das Musikzimmer der Falcrons. Da unsinnigerweise kein Familienmitglied ein Instrument beherrschte, war es zu achtundneunzig Prozent der Zeit leer.
Ich glitt an dem schwarzen Flügel vorbei, ignorierte die bohrenden Blicke der Gesichter auf den Gemälden, die an den weißen Wänden hingen und alle ein anderes Familienmitglied der Falcron-Dynastie zeigten, und blieb vor den zwei Türen am anderen Ende der Dachkammer stehen. Die eine rot, die andere blau.
Probehalber drückte ich die Klinke der roten. Sie war natürlich verschlossen. So wie die vergangenen fünfzehn Male, die ich hier bereits eingestiegen war. Frustriert zog ich die Hand zurück. Ich war in jedem einzelnen Zimmer im Haus gewesen … bis auf dieses. Ich konnte das ein oder andere Schloss knacken, aber keines, das von den Falcrons selbst – den Anführern der Wächter, die für die Aufrechterhaltung der Energiekuppel über Mentano und somit den Schutz des gesamten Landes zuständig waren – mit weißer Magie verstärkt wurde. Da reichten weder Haarnadel noch Stoßgebete. Was versteckten die Falcrons nur hier? Ihre Juwelen? Ihr geheimes Rezept für den besten Eintopf Mentanos? Es machte mich verrückt, dass ich es nicht wusste!
Das nächste Mal, versprach ich mir, als ein dünner Sonnenstrahl meine Ferse berührte. Ich hatte nicht genug Zeit, um es weiter zu versuchen. Die Falcrons würden bereits am Esstisch sitzen. Das taten sie jeden Abend, sobald das Sonnenlicht die engen Gassen des weißen Rings nicht mehr erreichte. Seit drei Friedensjahren. So lange brach ich bereits in ihr Haus ein. Man könnte fast meinen, sie wären meine Zweitfamilie – obwohl ich nach den Regeln unseres geliebten Landes eigentlich ihr Fußabtreter war. Nur unparfümiert.
Ich presste ein Ohr an die blaue Tür. Als ich wie erwartet keinen Mucks dahinter vernahm, drückte ich sie vorsichtig auf.
Heute war Gelbtag. Der Tag, an dem die meisten höheren Bediensteten aus dem gelben Ring freihatten, und somit weniger Leute als sonst im Haus waren. Der Nachtwächter würde mittlerweile im unteren Stockwerk mit dem Küchenmädchen flirten. Die Patrouille draußen am Haus vorbeilaufen und sich nicht für sein Inneres interessieren. Den Tageswächter hatten wir bereits gehen sehen.
Zufrieden schloss ich die Tür wieder hinter mir. Der Gast, wegen dem ich hier war, würde hoffentlich ebenfalls bereits am Esstisch Platz genommen haben.
Nur Lord Kaltherz konnte mir jetzt noch gefährlich werden. Der einzige Sohn der Falcrons hatte eigentlich einen anderen Namen. Irgendetwas albern Aristokratisches, das sauer auf meiner Zunge schmeckte. Da er sich aber stets kalt und distanziert wie ein Eiszapfen mit Bindungsproblemen verhielt, hatte der Spitzname seinen richtigen Namen seit Langem verdrängt.
Das Problem bei dem Sohn der Falcrons war, dass er unvorhersehbar und, nicht zu vergessen, das einzige Familienmitglied war, das ich noch nie beim Lügen erwischt hatte. Das verunsicherte mich. Er war wie eine undurchdringliche glatte Wand aus Marmor, die man weder mit Meißel noch mit Hammer zerkratzen, geschweige denn durchbrechen konnte.
Er war ein paar Friedensjahre älter als ich, wie jeder Falcron ein mächtiger Weißer Magier und arbeitete bei den Wächtern, die sein Vater bis vor Kurzem als Befehlshaber beaufsichtigt hatte. Was genau er dort tat, wusste ich nicht. Wie gesagt: schwarzhaarige Wand aus Stein. Alles, was ich wusste, war, dass er keinem Zeitplan zu folgen schien.
Jyn, seine jüngere Schwester hingegen, die ein paar Friedensjahre weniger miterlebt hatte als ich, war so vorhersehbar wie die Sonnenstrahlen. Sie kam jeden Tag pünktlich gegen Mittag von ihrem Unterricht und schloss sich dann in das Zimmer mit der roten Tür ein, bis zum Essen geläutet wurde und sie sich auf direktem Wege zum Speisesaal begab. Vom Mittag- bis zum Abendessen jedoch öffnete sie für niemanden die Tür. Nicht für das Dienstmädchen, nicht für ihren Bruder und erst recht nicht für ihre Mutter.
Auch wenn die Falcrons nach außen hin einen anderen Anschein wahrten – sie waren eine sehr kaputte Familie. Mehr denn je, seit Lord Falcron vor ein paar Monaten ums Leben gekommen war. Sie waren fast noch kaputter als meine Familie. Und ich hatte das letzte Mal vor fünf Friedensjahren mit meinem Vater geredet. An dem Tag, als der Rote Magier vor unserer Tür gestanden hatte, um uns zu erzählen, dass meine Mutter bei einem Unfall im roten Ring gestorben war.
Heute jedoch hatte ich Glück. Lord Kaltherz befand sich weder auf der schmalen Treppe, die in den ersten Stock führte, noch im dahinterliegenden kargen Flur, dessen weißer Holzboden und die darin herumstehenden Vitrinen aus Diamant von goldenen, hässlichen Kronleuchtern erhellt wurden.
Ich huschte nach links, hörte Geräusche aus dem zu meiner Rechten liegenden Speisesaal und atmete erleichtert aus, als ich Lord Kaltherz’ dunkle, gelassene Stimme erkannte. Er saß schon beim Essen. Das war gut, denn um die Falcrons am besten belauschen zu können, musste ich in sein Zimmer. Ich eilte den Gang entlang, hielt die Ohren gespitzt und glitt ohne viel Federlesen durch die rechte der beiden am Ende gelegenen Türen.
Das Zimmer des Falcron-Sprösslings war der reinste Augenschmaus für jeden mit einer Vorliebe für blank polierte Oberflächen, karge Wände und die Farbe Schwarz. Ich war schon so oft hier drin gewesen, ich kannte es in- und auswendig. Das warme Licht der diamantenen Laterne vor dem Haus warf flackernde Schatten in den Raum und ließ ihn gespenstisch aussehen. Ein großes Polsterbett aus dunklem Leder dominierte das Zimmer und wurde in seiner Wuchtigkeit nur von dem Schreibtisch, der gegenüber dem Fenster stand, übertroffen. Ich hatte die Schubladen schon etliche Male durchwühlt, aber bis auf Papier, Kohlestifte, ein paar Zeichnungen von mir unbekannten Häusern, einem Familienporträt und ein paar grünen Stofffetzen nie etwas gefunden. Auch wenn ich klammheimlich immer auf ein Tagebuch gehofft hatte, in dem Lord Kaltherz seinen insgeheimen Traum von einer Karriere als Hoftänzer festhielt oder verliebte Gedichte an seinen zu großen Bizeps schrieb.
Ein einziges Gemälde hing an der Wand, direkt über dem Bett. Es zeigte einen Strand, eine Palme und das blaue Meer. Ich wusste, dass es solche Bäume und Orte früher einmal gegeben hatte. Dass das Meer blau gewesen war, bevor das Blut des draußen noch immer tobenden Kriegs es rosa gefärbt hatte. Aber das Bild hier war die erste Zeichnung davon gewesen, die ich je gesehen hatte. Dann waren da noch zwei diamantene Regale, die mit Pergamentrollen, ein paar Kerzen und goldenen Figuren bestückt waren. Lord Kaltherz war ganz schön unvorsichtig. Jede einzelne musste mindestens tausend Menti wert sein. Eine Summe, die den Bewohnern des grauen Rings, dem ärmsten Teil Mentanos, so fremd wie das hinter der Roten Wand liegende Ödland war. Seit das Königshaus die Rote Wand und die Energiekuppel um Mentano hochgezogenen hatte, um das Land vor dem Bündnis zu schützen, wurden sie nämlich nicht mehr mit Geld bezahlt.
Ich gab mir nicht mehr Zeit, Falcrons Einrichtung weiter zu bewundern. Stattdessen sprang ich auf den Schreibtisch und stellte mich auf die Zehenspitzen, um das Gitter des Lüftungsschachtes zu erreichen, der dieses Zimmer mit dem Speisesaal verband. In den neuen Häusern wurde mittlerweile komplett auf diese Schächte verzichtet. Sie waren zu klein, als dass sie vonnöten gewesen wären. Aber die alten Anwesen im weißen Ring, die so groß waren, dass sie Platz für fensterlose Räume hatten, waren ein einziges Labyrinth aus hölzernen Lüftungsvorrichtungen wie dieser.
Wie gewohnt konnte ich das Gitter leicht nach oben schieben und dann zur Gänze abnehmen. Ich legte es auf die polierte Tischplatte unter meinen Füßen, bevor ich mich durch die schmale Luke zog. Wenn mir der letzte Monat als Erntearbeiterin etwas gebracht hatte, dann waren es Muskeln! Für meine siebzehn Friedensjahre war ich schon immer etwas klein und schmal gewesen – aber das bedeutete auch, dass ich weniger Gewicht stemmen musste.
Ich hievte mich in den Schacht hinauf und landete mit dem Bauch schmerzhaft auf etwas Hartem, Rechteckigem. Leise stöhnte ich auf, zog den störenden Gegenstand unter mir hervor und hielt ihn mir vors Gesicht.
Das Licht, das von der Seite des Speisesaals aus in den Schacht schien, war dürftig und dennoch … Ich stutzte und öffnete verblüfft den Mund.
Es war ein Buch.
Ein in grünes Leder eingebundenes, handgroßes Buch, das schwer in meiner Hand lag. Nervös drehte ich es zwischen meinen plötzlich feucht gewordenen Fingern. Ein Buch hatte ich das letzte Mal in der Schule gesehen und das war drei Friedensjahre her. Wie war Lord Kaltherz da drangekommen und was zum Henker dachte er sich dabei, es hier zu verstecken?
Außerhalb von Schulen, dem roten Ring und Heilhäusern waren Bücher strengstens verboten. Allein der Besitz eines solchen konnte den Täter zehn Friedensjahre in den Minen kosten. Wenn dann noch herauskam, dass er sich unautorisiertes Wissen angeeignet oder es gar weitergegeben hatte … bedeutete das die Todesstrafe.
Ich schluckte und atmete zitternd ein, während ich ehrfürchtig über den rauen Einband und die darin eingravierten, goldenen Lettern strich.
Das Königshaus –vom ersten Friedensjahr bis heute
Stirnrunzelnd ließ ich es sinken. Lord Kaltherz riskierte sein Leben, um sich mit ein paar royalen Geschichten zu amüsieren? Das passte so überhaupt nicht zu seiner Persönlichkeit als steinerne Wand.
Zögerlich kaute ich auf meiner Unterlippe herum. War es nicht meine Pflicht als gute Bürgerin, dem Erben der Falcrons diesen gefährlichen Gegenstand abzunehmen? Er könnte ihn sonst noch in Schwierigkeiten bringen und damit wusste er sicher nicht umzugehen. Ich hingegen steckte andauernd in Schwierigkeiten. Ich bereitete mich quasi schon mein ganzes Leben lang darauf vor, ein Buch zu verstecken. Ich wusste auf jeden Fall, wie ich mich im Ernstfall zu verhalten hatte. Ja, bei mir war es mit Sicherheit besser aufgehoben. Außerdem wollte ich wissen, was so interessant an der Königsfamilie sein sollte, dass Lord Kaltherz dafür seinen Kopf riskierte!
Sicher, Lord Kaltherz würde dann wissen, dass jemand in seinem Zimmer gewesen war und das Buch entwendet hatte … aber was sollte er machen? Den Gegenstand, den er nicht besitzen durfte, als gestohlen melden? Er würde davon ausgehen, dass ein Hausmädchen es beim Putzen gefunden und verschreckt entsorgt hatte.
Tief atmete ich durch und steckte den kompakten Gegenstand mit einem mulmigen Gefühl in meine Tasche, bevor ich weiter durch den Schacht robbte.
Nach wenigen Fuß vernahm ich eine weibliche Stimme, die durch das Gitter vor mir wehte.
»… verstehe nicht, warum er nicht noch einmal mit ihr ausgehen will, Lord Heller. Sie ist so ein zuckersüßes Geschöpf.«
»Ah, Lady Falcron, man kann nicht bestimmen, an wen man sein Herz verliert«, antwortete eine dröhnende Männerstimme. »Ist es nicht so, Lord Falcron?«
»Wenn Sie das sagen, wird es wohl stimmen«, erwiderte Lord Kaltherz kühl.
»Dennoch«, beharrte Lady Falcron. »Sie ist wunderschön, aus gutem Haus und die …«
»… dümmste, oberflächlichste und langweiligste Frau, die unser süßer Fratz Caeden jemals getroffen hat?«, schlug eine neue Stimme vor.
»Jyn! So redet man nicht über andere«, tadelte ihre Mutter sie.
»Oh, Caeden hat nichts dagegen, wenn ich ihn ›süßer Fratz‹ nenne. Ich habe ihn gefragt.«
»Ich spreche von dem, was du über Lady Marla gesagt hast!«
»Aber ich habe es doch extra hinter ihrem Rücken getan. So funktioniert es doch im weißen Ring.«
Ich schmunzelte und wagte mich weiter vor, bis ich mit der Nase fast an das Gitter stieß und endlich sehen konnte, was vor mir geschah.
An der langen, gedeckten goldenen Tafel, etwa zwei Manneslängen unter mir, befanden sich vier Personen. Jyn saß mit dem Rücken zu mir. Ihre schwarzen Haare flossen in Wellen über ihr weißes Seidengewand. Schade. Ihre Lügen würde ich heute also nicht stehlen können. Dafür hatte ich jedoch perfekte Sicht auf Lord Kaltherz oder auch Caeden – was für ein dämlich schicker Name! –, der in schwarzem Hemd den Kopf des Tisches besetzte, sowie auf seine Mutter und den untersetzten bärtigen Lord Heller.
Er arbeitete als Sicherheitskommandant für die Wächter. Soweit ich wusste, war er der einzige Rote Magier, den die Falcrons beschäftigten. Weil er Lüge von Wahrheit unterscheiden und so Intrigen und Verbrechen innerhalb der Wächter leichter aufklären konnte. Das, was die weiße Magie der Falcrons nicht ermöglichte. Er gab heute seinen wöchentlichen Bericht ab – und war außerdem der Grund, warum Gelbtag der beste Tag für einen Ausflug in die Falcron-Räumlichkeiten war.
»Es wird Zeit zu heiraten, Caeden«, fuhr Lady Falcron fort und nickte dem Dienstboten zu, der ihr Wasser nachschüttete und dann zu seinem Posten an der mit schweren dunkelblauen Teppichen behangenen Wand zurückkehrte.
»Mysteriös«, erwiderte Lord Kaltherz trocken, den Blick der klaren grauen Augen auf seinen gefüllten Teller gerichtet. »Und ich dachte, dass es Zeit zum Essen sei.«
Lady Falcron schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Du bist zweiundzwanzig und wirst nach dem nächsten Friedensjahr den Posten deines Vaters übernehmen. Dafür brauchst du eine passende Partnerin. Beim Königshaus, in deinem Alter war ich bereits zwei Friedensjahre lang verheiratet!« Sie seufzte schwer und strich sich die mit grauen Strähnen durchsetzten dunklen Haare hinter die Ohren. »Ach, ich weiß noch, als ich so jung war wie ihr. Meine Schönheit hat selbst dem einflussreichsten Roten Magier die Sprache verschlagen. Ich war hübscher als die Blumen, die Lord Heller mitgebracht hat.« Sie deutete auf einen Strauß, der in einer Vase vor Caedens Teller stand, und presste den Mund zu einer dünnen Linie. »Du wirst bald verstehen, was ich meine, Jyn. Denn auch deine Blüte wird verwelken.«
»Tragisch«, bemerkte Jyn trocken und nahm eine Gabel ihres Essens, bevor sie hinzufügte: »Ich weiß nicht, wie das jedes Mal passiert, aber meine Kartoffeln schmecken so unglaublich verbittert.«
»Du meinst bitter, Schatz«, korrigierte Lady Falcron ihre Tochter.
»Oh nein«, sagte Jyn fröhlich. »Verbittert war schon das richtige Wort.«
Ich konnte es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich meinte fast zu sehen, wie sich Caedens Lippen nach oben bogen. Doch er versteckte sein Gesicht hinter einem Weinglas. Aber es war ebenso möglich, dass er nur seine Mundwinkel dehnte, die von zu wenigem Gebrauch sicherlich schon langsam einstaubten.
Lady Falcron gab einen missbilligenden Ton von sich und Lord Heller lachte nervös auf, bevor er sich angestrengt wieder seinem Essen zuwandte.
Okay, ich hatte genug Unsinn belauscht. Es wurde Zeit, an die Arbeit zu gehen. Ich legte mich flach auf den Bauch, zog Kohlestift und gläserne Phiole aus meiner Tasche und beschriftete sie mit Datum und Ort, bevor ich ein Stück Pergament zückte. Erst dann wandte ich mich wieder dem Tischgespräch zu. Diesmal jedoch nicht nur mit meinen Ohren.
Ich schloss die Augen und blendete einen Moment lang alles um mich herum aus. Konzentrierte mich nur noch auf meinen eigenen Körper, ließ die Nervosität abebben und verlangsamte meinen Atem. Die Luft, die ich einsog, roch nach Kartoffeln und schmeckte nach Eisen. Sie sammelte sich bitter auf meiner Zunge, stieg in meine Nase und setzte sich dort fest. Ich presste den Geschmack gegen meinen Gaumen, ließ mich einige Herzschläge lang bewusst auf den Geruch nach Essen ein … bevor ich ihn losließ.
Die Kälte, die die Nieten im Holz unter meinem Bauch ausströmten, fraß sich durch den dünnen Stoff meines Kleides und ließ mich erschaudern. Ich spürte sie auf meiner Haut, wie fremde Hände, die mich abtasteten … und ließ sie dann los.
Es waren keine Herzschläge. Es war nur ein einziges Korn, das durch die Sanduhr perlte. Doch als ich die Augen wieder öffnete, sah ich mehr als vorher. Meine anderen Sinne waren betäubt. Ich fühlte nicht mehr, ich schmeckte nicht mehr und ich roch nicht mehr. Stattdessen zeichneten sich die Konturen der Personen vor mir rötlich von ihrer Umgebung ab und die Bewegungen ihrer Lippen waren langsamer als noch zuvor. Deutlicher. Verzögert durch die schwache rote Magie, die durch meine Adern pulsierte.
Lügen zu stehlen, war nicht wie Atmen. Es war anstrengender. Es war Fingerspitzengefühl. Es war, als würde man seine gesamte Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt richten und ihn allein mit seinem Willen dazu zwingen, sich zu bewegen.
Eine Lüge war fein. Wie roter Staub, der von den Lippen stob, einen Atemzug lang in der Luft hängen blieb und sich dann verflüchtigte. Wenn ich nicht aufpasste, wenn ich nicht genau hinsah, dann verpasste ich sie. Und selbst wenn ich sie entdeckte, konnte ich sie immer noch falsch lesen. Denn Lüge war nicht gleich Lüge. Lügen waren facettenreich. Die leichteste Farbnuance entschied über ihre Wichtigkeit.
Lügen, die ausgesprochen wurden, um die Gefühle anderer nicht zu verletzen, blitzten magentafarben auf. Lügen, die Menschen nutzten, um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken, glänzten purpurfarben. Ausreden schimmerten malvefarben. All diese Lügen waren jedoch so gut wie wertlos. Auf dem Schwarzmarkt brachten sie kaum zwei Menti ein.
Ich suchte die blutroten Lügen. Die Lügen, die ein Geheimnis versteckten. Die Lügen, die etwas Großes verbargen. Die Lügen, die sich von Angst nährten und deren Entdeckung schreckliche Konsequenzen nach sich ziehen würde.
Das Schwierige war es dabei nicht, die Lüge zu erkennen. Das Schwierige war es, die Wahrheit dahinter zu finden. Aber das war nicht meine Aufgabe, dafür waren die Diebe, denen ich die Lüge verkaufte, zuständig. Ehrlich gesagt, interessierte die Wahrheit mich überhaupt nicht. Wahrheiten waren hässlich. Lügen hingegen, verheißungsvoll rot glänzende Lügen … waren wunderschön.
»Vielleicht sollten wir uns einfach dem Geschäftlichen zuwenden«, schlug Lady Falcron seufzend vor. Sie trug ein violettes weites Kleid, das bei jedem ihrer Seufzer vibrierte und wahrscheinlich so viel wert war wie eine der goldenen Figuren in Lord Kaltherz’ Zimmer. »Dann haben wir es hinter uns.«
»Oh, natürlich«, sagte Lord Heller resigniert und zog einen Bogen Pergament aus seinem schweren roten Mantel.
Nur den Magiern aus dem roten Ring war es erlaubt, diese Farbe zu tragen. Damit jeder bereits von Weitem um ihre Macht wusste.
Während die Weißen Magier für die Aufrechterhaltung der Kuppel zuständig waren und Mentano vor Angriffen von außen schützten, kümmerten sich die Roten Magier um die Ergreifung von Verbrechern innerhalb der Roten Wand. Sie waren es, die Streitereien beilegten. Die Diebe in die Minen verfrachteten. Sie waren es, die Mitglieder der Rebellengruppe der Wissensjäger verfolgten und zur Strecke brachten.
Lord Heller konnte das, was ich konnte. Was meine Mutter gekonnt hatte. Nur sehr, sehr viel besser. Und sehr viel weit entwickelter. Wahre Rote Magier, diejenigen, die ihre Gabe verfolgten und Unterricht darin nahmen, konnten Lügen nicht nur erkennen. Sie konnten Lügen erschaffen. Genauso konnten sie verbergen, ob sie logen oder die Wahrheit sagten … Aber warum sollten sie das tun, wenn sie glaubten, unbeobachtet zu sein?
»Ich muss Ihnen leider schlechte Nachrichten überbringen.« Die weiße Wahrheit staubte wie Puderzucker von Lord Hellers Lippen. »Natürlich habe ich nach dem letzten Zwischenfall die Sicherheitsmaßnahmen in all unseren Stützpunkten verdreifacht! Ich selbst habe die Ausbildung der neuen Nachtwächter überwacht und die Verstärkung der Schlösser beaufsichtigt.«
Eine purpurfarbene, wertlose Lüge. Ich ignorierte sie.
Er räusperte sich und sein Gesicht lief rot an. »Dennoch hat es in der letzten Woche weitere Einbrüche gegeben.« Entschuldigend wandte er sich Lady Falcron zu – und ich verstand ihn. Caedens Blick war zunehmend düsterer geworden, dem hätte ich mich auch nicht freiwillig ausgesetzt.
»Was für Einbrüche?«, presste er zwischen den Zähnen hervor, seine Stimme so leise, dass ich sie kaum verstand, und doch so bedrohlich, dass ich automatisch den Atem anhielt.
Lord Heller war offenbar entschlossen, weiterhin mit Lady Falcrons Kinn zu reden. In ihre Augen zu sehen, wagte er ebenfalls nicht.
»In drei Häusern von sehr wohlhabenden Kunden sind mehrere Nachtwächter überlistet worden, sodass es Eindringlingen möglich war, Dinge im Wert von mehreren Hundert Menti zu stehlen«, sagte er kleinlaut. »Außerdem gab es, fürchte ich, auch ein paar Einbrüche in die Lügenarchive und … Ihre persönlichen Räumlichkeiten im Wachhaus. Auch wenn nichts von Wert gestohlen wurde«, setzte er hastig hinzu.
»Was meinen Sie damit?«, fragte Caeden scharf. »Nichts von Wert?«
»Das würde mich auch interessieren«, sagte Lady Falcron pikiert.
Lord Heller schluckte hörbar. In diesem Moment wirkte er nicht wie ein mächtiger Magier. Er wirkte wie ein Kind, das mit der Hand in der Keksdose erwischt worden war. »Nun, in den Lügenarchiven wurden nur ein paar kleine Phiolen entwendet. Was Ihre Räumlichkeiten angeht … Sie haben nur einige wenige Pergamente mitgenommen. Persönliche Aufzeichnungen Ihres Vaters. Aber das ist nicht schlimm, von allem wurden Kopien angefertigt. Es ist kein Schaden entstanden.«
Lord Kaltherz schloss die Augen und rieb sich mit den Fingern darüber … Und in diesem Moment sah er so viel älter und so viel erschöpfter aus, als es ein Mann in seinem Alter sein sollte, dass ich ein paar Herzschläge lang Mitleid mit ihm hatte.
»Wie dumm sind Sie eigentlich?«, flüsterte er kaum hörbar. »Wir sind die verdammten Wächter! Wir sind für den Schutz Mentanos zuständig. Wir sind es, die verhindern, dass das Bündnis hier einfällt. Wir sind es, die Einbrüchen vorbeugen … und haben wichtige Lügen und persönliche Unterlagen an ein Pack wertloser, dreckiger Diebe, dem Abschaum der äußeren Ringe, verloren?«
Mein Mitleid verflog. Manchmal vergaß ich fast, dass Caeden kein Mensch war. Er war sechzig Prozent Muskeln und vierzig Prozent Arschloch.
»Und Sie wollen mir erzählen, dass das nicht von Wert ist?«
»Ich … natürlich, Sie haben recht. Das hatte ich nicht durchdacht«, ruderte der Rote Magier hastig zurück. »Aber sorgen Sie sich nicht. Ich bin an der Sache dran. Jemand aus unseren Reihen muss den Dieben geholfen haben. Ich habe schon über hundert Wächter befragt und bis jetzt noch keinen Lügner enttarnen können, aber das ist nur eine Frage der Zeit.« Das war nichts weiter als eine purpurfarbene Prahlerei – und schien auch keinen besänftigenden Effekt auf Lord Kaltherz zu haben, dessen Miene immer düsterer wurde. Wow, es war tatsächlich bemerkenswert, dass Lord Heller noch immer für die Falcrons arbeitete. Denn er brachte wirklich sehr oft unerfreuliche Nachrichten.
»Außer, es ist niemand unserer Leute, sondern jemand von außerhalb«, bot Jyn an, die die letzten Minuten über schweigend das Geschehen beobachtet hatte. »Jemand von außerhalb, außerhalb.«
»Niemand ist durch die Rote Wand gekommen, Jyn«, sagte Lady Falcron gereizt. »Deine Theorien drehen allmählich mit dir durch.«
»Oh, bitte, als wäre ich die Erste, die jemals daran gedacht hat, dass irgendwer die Rote Wand durchdrungen und uns infiltriert hat. Die Wand wird nicht von uns Weißen Magiern aufrechterhalten. Wir kümmern uns nur um die Kuppel. Außerdem steht sie bereits seit einer Ewigkeit und sie besteht aus Glas. Glas zerbricht.«
»Die Wand ist unzerstörbar, Jyn«, sagte Lord Heller, auf einmal todernst. »Die Magier aus dem roten Ring kümmern sich tagtäglich darum. Außerdem ist es nicht das Glas, was sie so stark macht, es ist das, was sich in dem Glas befindet, das Leben kostet. Das, was die fähigsten Roten Magier ihr jeden Tag zufügen.«
Seine Worte waren die Wahrheit. Die reine weiße Wahrheit.
»Tatsächlich?«, fragte sie interessiert. »Und was genau ist das?«
»Jyn«, sagte Caeden ruhig und seufzend verstummte seine Schwester. »Danke«, wisperte er, bevor er sich wieder an den Kommandanten seiner Sicherheit wandte. »Warum, wenn ich höflich fragen darf, warum, verdammt, erfahre ich erst jetzt von diesen Vorfällen?«
»Nun, ich selbst habe den zusammenfassenden Bericht erst diesen Morgen erhalten, also hielt ich es für angemessen, es Ihnen heute im Rahmen dieses Essens mitzuteilen«, erzählte Lord Heller, bemüht darin, das Kinn erhoben zu halten.
Eine malvefarbene Ausrede. Ich seufzte innerlich. Das mochte ja alles interessant sein und zugegebenermaßen erfüllte es mich mit einiger Genugtuung, dass auch die Bewohner des weißen Rings mit anderen Problemen konfrontiert wurden als damit, dass sie sich nicht für einen Nachtisch entscheiden konnten, aber dennoch … Das alles waren keine Lügen, die ich benutzen konnte! Über die Einbrüche würde Crow längst Bescheid wissen. Vielleicht steckte er sogar dahinter. Ich suchte nach etwas anderem. Etwas Persönlichem.
Ein leichtes Klirren durchschnitt die Stille, als Lord Kaltherz sein Besteck seelenruhig neben den Teller legte und die Hände auf dem Tisch faltete. »Lord Heller, wissen Sie noch, was ich Ihnen nach dem Tod meines Vaters gesagt habe?«
»Natürlich, Lord Falcron.«
»Und was war das?«
»Dass Sie mich nur weiterbeschäftigen, weil Ihr Vater mich für kompetent hielt, auch wenn Sie glauben, dass ich ein armseliger Schwachkopf bin.«
»Richtig. Und Sie geben sich wirklich nicht genug Mühe, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Ihre Kräfte …«, er streckte die Hand nach Lord Hellers Blumenstrauß auf dem Tisch aus, berührte ihn sacht mit den Fingerspitzen – und er zerstob zu rotem Staub, »… sind mehr als enttäuschend.«
Lord Heller sah zu der Stelle, an der die Blumen – lediglich eine Illusion, wie mir jetzt erst klar wurde – gestanden hatten, und schluckte schwer. »Nun, mit Verlaub, der plötzliche Tod Ihres Vaters hat auch mich erschüttert und vielleicht war ich in den letzten Wochen nicht konzentriert genug.« Er sah Lady Falcron fest in die Augen. »Ich drücke Ihnen noch einmal mein Beileid aus, Lady Falcron. Das muss für Ihre ganze Familie eine schwere Zeit sein, die für einige …« Sein Blick flackerte zu Caeden. »… Anspannung sorgt.«
Lady Falcron nickte salbungsvoll. »Vielen Dank. Es war ein tragischer Unfall.«
Ich weitete die Augen und sog zischend Luft ein.
Rot. Ihre Lippen waren blutrot.
»Wir versuchen, darüber hinwegzukommen.«
Und wieder … Rot. Blutrot.
Ich schlug mir die Hand vor den Mund, um vor Aufregung nicht laut zu quietschen.
Es war kein Unfall gewesen. Lord Falcron, einer der mächtigsten Männer Mentanos, war nicht aufgrund eines Unfalls gestorben, so wie es das Wochenblatt berichtet hatte! Meine Güte! Das konnte nur eins bedeuten: Mord. Ein Mord im weißen Ring. Das war … Das gab es nicht! Davon hatte ich noch nie gehört!
Hastig sah ich zu Caeden, um seine Reaktion … Moment. Erschrocken zuckte ich zurück. Kälte schoss durch meine Adern und mein Herz sprang mir in den Hals.
Caeden starrte mich an. Das Kinn leicht gehoben, traf sein klarer grauer Blick meinen, verhakte sich mit mir, durchleuchtete mich … nein, was redete ich da. Er konnte mich nicht sehen, ich war hinter dem Gitter, im Dunkel des Schachts verborgen. Ich blinzelte zitternd – und als ich das nächste Mal zu ihm sah, war sein Gesicht zu Lord Heller gewandt. Verwirrt zog ich die Augenbrauen zusammen. Hatte ich mir nur eingebildet, dass er hochgesehen hatte?
»Ich will nicht über Vater reden«, sagte er gelassen. »Ich möchte mehr über diese Einbrüche hören.«
Die Kälte ebbte ab und mein Herz sank zurück an seinen Platz. Ich drehte schon durch. Die Lüge, die ich gerade von Lady Falcrons Lippen gestohlen hatte, saß mir in den Knochen. Denn sie war … groß. Riesig. Aufregung und Euphorie durchströmten mich, während ich hastig den exakten Wortlaut aufschrieb, den Zettel zusammenrollte und ihn in die Phiole steckte, die ich sofort wieder verkorkte.
Das war die Lüge, die mich besonders machen würde. Das war die Lüge, die mich endlich aufsteigen lassen würde. Die mir das Ansehen und den Respekt bringen würden, den ich brauchte, um in die Reihen der Dunkeldiebe aufzusteigen.
»Mehr?«, fragte der Kommandant verwirrt. »Da gibt es nicht viel … mehr.«
»Lord Heller, zurzeit halte ich Sie für dümmer als die Kartoffeln auf meinem Teller«, sagte Caeden schlicht, die Lippen zu einem kühlen Lächeln verzogen, seine Augen voller Eis. »Es ist offensichtlich, dass die Diebe nicht nur hinter Materiellem her sind. Das, was sie uns nehmen wollen, ist unser Ruf. Und wenn das so weitergeht – wenn herauskommt, dass im verdammten Wachhaus, dem Stützpunkt der Wächter, eingebrochen wurde –, dann werden sie erfolgreich sein. Was taugt ein Wachhaus, das sich nicht einmal selbst schützen kann? Also erzählen Sie mir doch von Ihren wundervollen neuen Sicherheitsmaßnahmen, während ich mir überlege, wie ich Sie am besten entlassen kann, ohne Ihre Gefühle zu verletzen.«
Lord Heller fing gefasst an, irgendwelche Zahlen aufzuzählen, doch ich hörte ihm nicht mehr zu. Breit lächelnd betrachtete ich die gläserne Phiole in meiner Hand, während ich mich lautlos den Schacht zurück zu Lord Kaltherz’ Zimmer schob.
Ich hatte alles, was ich brauchte. Nichts wie raus hier.
KAPITEL 2
»Meine Güte, da bist du ja endlich!«, sagte Finch erleichtert, als ich wenig später keuchend aufs Dach zurückkletterte.
»Natürlich bin ich hier. Wo sollte ich sonst sein?«, fragte ich irritiert und klopfte den Dreck von meinem weißen Kleid.
»Klugscheißer!« Verärgert sah Finch mich an, während er vom Blitzableiter stieg und mir voran das Dach hinunterrutschte, bevor er zum nächsten sprang. Mentano hatte elf Millionen Einwohner und nur begrenzt Platz, weshalb die Häuser sehr eng aneinandergebaut wurden – zu unserem Glück. »Du hast Ewigkeiten gebraucht. Ich war kurz davor, unten zu klopfen und dir ein Ablenkungsmanöver zu verschaffen. Mann, ich dachte, sie hätten dich vielleicht erwischt und …«
»Oh, bitte. Natürlich haben sie mich nicht erwischt!« Ich verdrehte die Augen und lief geduckt über den breiten weißen Dachfirst. Die Gassen zwischen den Häusern waren schmal und die Spitzen der Dächer von unten nicht zu erkennen, aber ich musste ja nicht absichtlich auffällig sein. »Ich wurde noch nie erwischt! Ich bin …«
»… ein Schatten. Eine Fliege an der Wand. Ja, ja«, schnitt Finch mir das Wort ab. »Weißt du, irgendwann musst du dir mal einen anderen Vergleich ausdenken. Sonst fange ich an, deine Kreativität zu hinterfragen. Und ein bisschen weniger Arroganz würde dir auch nicht schaden«, setzte er im Plauderton hinzu. »Sie wird dich in den Minen nämlich nicht wärmen, wenn du mal wieder bei einer leichtsinnigen Aktion deinen Hals riskierst.«
Ich biss mir auf die Unterlippe, während ich nach dem Buch tastete, das bei jedem Schritt schwer gegen meinen Oberschenkel schlug. Finch hatte allen Grund, vorsichtig zu sein. Sein Vater war vor sechs Friedensjahren im Auftrag von Crow in ein Adelshaus eingebrochen – und nicht mehr zurückgekehrt. Zwei Friedensjahre später war er in den Minen verstorben. Es war nicht das erste Mal gewesen, dass so etwas passierte, aber es war das erste Mal gewesen, dass Finch und ich denjenigen kannten.
»Du musst dir keine Sorgen machen, Finch«, sagte ich mit sanfter Stimme. »Ich bin nicht leichtsinnig. Ich bin … abenteuerfreundlich. Und wenn du mal einen Herzschlag lang die Luft anhalten würdest, könnte ich dir sagen, dass ich heute die größte Lüge aller Zeiten gestohlen habe, die mich – und dich – um einiges reicher machen wird.«
Finch warf mir einen skeptischen Blick über die Schulter zu. Er hatte die Brauen missbilligend zusammengezogen, doch in seinen Augen blitzte reges Interesse auf. »Von wem?«, wollte er wissen. »Von Lord Kaltherz?«
Schön wärs. Nach allem, was ich wusste, hatte der in seinem Leben noch keine einzige Lüge erzählt. Tausende Halbwahrheiten, ja – aber keine Lüge. »Nein, Lord Kaltherz war heute mal wieder sein charmantes ehrliches Selbst. Sie ist von Lady Falcron. Finch, ihr Ehemann ist nicht verunglückt, er wurde ermordet.«
Abrupt blieb Finch stehen und ich wäre beinahe in seinen breiten Rücken gerannt. Das hätte katastrophale Folgen haben können, denn er war gebaut wie ein Baum, der zu viele Gewichte stemmte. Er hätte mich leicht vom Dach schubsen können.
»Was?«, fragte er ungläubig und wirbelte zu mir herum. »Aber Lord Falcron ist aus dem weißen Ring … und ein Weißer Magier!«
»Ich weiß.«
»Im weißen Ring wird nicht gemordet. Nie. Und wer sollte dazu in der Lage sein, einen Weißen Magier umzubringen? Die magischen Barrieren, mit denen sie sich schützen können, sind viel zu stark für jeden Normalsterblichen.«
»Ich weiß.«
Seine Augen wurden groß. »Wenn es wirklich kein Unfall war und sie sich die Mühe machen, es zu vertuschen …«
Ich grinste. »Ich weiß.«
Die Sache war die: In Mentano wurde nicht viel gemordet. Die Konsequenzen waren schlichtweg zu groß. Natürlich lebten die Leute in den äußeren Ringen viel ärmer als die Roten und Weißen Magier oder aber auch die Adeligen. Im grauen Ring, wo die erschöpften Arbeiter lebten, kam es ab und an auch zu blutigen Zwischenfällen. Doch niemand musste hungern, jedem wurde dieselbe medizinische Versorgung zuteil, jeder hatte ein Dach über dem Kopf. Sicher, es kam zu den ein oder anderen Übergriffen aus Eifersucht oder anderen persönlichen Gründen. Doch auch die waren rar gesät, denn die Roten Magier hatten bisher noch jeden Mörder gefasst und zur Strecke gebracht. Ausnahmslos.
Wenn also ein Mord im reichsten Ring an einem der mächtigsten Weißen Magier des Landes geschah und auch noch vertuscht wurde … dann musste das einen triftigen skandalösen Grund haben. Wenn ein einfacher Dieb, Erntearbeiter oder ein anderer Namenloser der Täter wäre, hätte das Wochenblatt es gemeldet.
Aber allein die Vorstellung, dass jemand ohne magische Fähigkeiten den Schutz durchdrungen haben sollte, den Weiße Magier um sich herum hochziehen konnten, war lächerlich! Nein. Ein Roter oder Weißer Magier musste den Mord begangen haben.
»Etwas Furchtbares ist passiert, Finch!«, sagte ich begeistert und umklammerte aufgeregt die Phiole in meiner Tasche. »Irgendetwas, das niemand wissen darf. Irgendetwas, das die Falcrons in Verruf bringen könnte. Oder etwas, das das Königshaus unter Verschluss halten will. Oder etwas, das mit den Wissensjägern zu tun hat. Vielleicht ist auch ein unantastbarer Roter oder Weißer Magier darin verwickelt!« Ich holte tief Luft. »Ach, ich habe keine Ahnung, aber es muss wunderbar schrecklich sein!«
Auch Finch verzog den Mund zu einem Lächeln. »Liebe Güte, Fawn, wenn du noch röter anläufst, kann man dein Gesicht bald nicht mehr von deinen Haaren unterscheiden.«
Mein Grinsen wurde breiter. »Halt die Klappe! Du hast deinen Platz bei Crow schon sicher. Mich will er immer noch dazu überreden, etwas ›Vernünftiges‹ mit meinem Leben anzufangen und meinen Vater stolz zu machen.« Als ob das möglich wäre. »Diese Lüge aber …« Ich klopfte auf meine Tasche. »… wird seine Meinung ändern. Und jetzt lauf weiter, wir sind spät dran. Oder möchtest du mich ebenfalls dazu überreden, doch lieber ehrliche Erntearbeiterin zu werden?«
Finch hob abwehrend die Hände. »Guck mich nicht so vorwurfsvoll an. Ich will dich dabeihaben. Illegale Machenschaften lassen sich immer besser mit der lasterhaften besten Freundin betreiben. Crow ist ein Idiot, wenn er dich nicht als Diebin in seinen Reihen wissen will.«
Ja, war er. Sein Problem war nur, dass er mich zu lange kannte. Er hatte mich immer noch als das zwölfjährige Mädchen im Kopf, das versucht hatte, ihm eine Münze aus der Tasche zu ziehen – weil sein bester Freund Finch mit ihm gewettet hatte, dass es sich nicht trauen würde.
»Er wird schon beeindruckt sein«, meinte Finch überzeugt, bevor er seitlich das nächste Dach hinunterglitt und auf der Regenrinne weiterbalancierte. Hinter ihm zeichneten sich die schwarzen Berge ab, unter denen die Minen lagen. Große, unbezwingbare Steinriesen, die all die Menschen gefangen hielten, die etwas Verbotenes getan hatten.
Ich erschauderte. Dieses unheilvolle Panorama war mir verhasster als ein Pfeil in meinem Oberschenkel. Die flachen Felsmassen stellten für jeden von uns einen Albtraum dar, in dem wir nie aufwachen wollten. Wenn ich meinen Blick weiter nach links schweifen ließ, konnte ich Baumwoll- und Getreidefelder erkennen. Wenn ich mich anstrengte, konnte ich sogar die Wand sehen, die als rote Linie unser Land umgab. Dahinter war nur ein fahler Streifen Dunkelheit zu erahnen, der sich bei Sonnenlicht in eine Landschaft aus Dreck und Asche verwandelte. Das, was von den anderen Ländern nach dem Angriff des Bündnisses übrig geblieben war.
Ich hatte mich immer darüber geärgert, nicht im Nordteil des grauen Rings geboren worden zu sein. Denn der lag am Meer, auch wenn es von Stränden aus Stein, nicht von Oasen aus Sand gesäumt wurde. Meine Mutter hatte mich vor etlichen Friedensjahren mal dorthin mitgenommen. Die scheinbaren Weiten des rosa Ozeans hatten mir einen kurzen Herzschlag lang das Gefühl gegeben, die Welt sei riesengroß und nicht von der Roten Wand begrenzt. Doch dorthin würde ich so schnell nicht wieder zurückkehren.
Finch lief weiter und ich beschleunigte meinen Schritt, da ich zwei für jeden der seinen machen musste.
»Ich liebe es, dass die Bewohner des weißen Rings in Schwierigkeiten stecken«, murmelte ich, auch wenn ich wusste, dass es moralisch fraglich war, sich am Leid anderer zu ergötzen …
Ein Pack wertlose, dreckige Diebe, dem Abschaum der äußeren Ringe.
Ach, wenn ich es mir so überlegte, ich kam mit dieser schlechten Seite meines Charakters gut zurecht. »Es ist so ungerecht, weißt du? Die Weißen führen ein so luxuriöses, aufregendes Leben, während das Spannendste, das bei uns passiert, ein Produktionsstau in der Schmiede oder ein witzig geformter Erzblock ist. Die inneren Ringe beschäftigen sich mit Intrigen, Geheimnissen und Beziehungsdramen. Wir arbeiten uns tot und haben keine Zeit für solch aufregenden Schwachsinn. Ist es zu viel verlangt, ein kleines Stück davon abzubekommen?«
Finch schnaubte und sprang über einen kleinen Vorsprung zum nächsten Dach, das nicht mehr weiß war. Wir hatten den gelben Ring, den Stadtteil der Dienstleister und Unterhaltungskünstler, erreicht, und eine Welle der Erleichterung durchströmte mich. Die schmutzigen senffarbenen Schindeln, über die wir jetzt liefen, waren sehr viel beruhigender als die blank polierten weißen.
»Wenn du so gerne bei den Weißen leben willst, Fawn, dann fordere doch einfach einen von ihnen heraus und erkämpf dir deinen Stand dort.«
Ich schnaubte laut. So ein Witzbold! »Natürlich, Finch. Und wenn ich schon dabei bin, werde ich den Prinzen zum Mann nehmen.«
Finch grinste über seine Schulter. »Ich muss dich enttäuschen, der Prinz hat bekanntermaßen nur ein Herz für eingesperrte Diebe oder aber auch geköpfte Spione. Du – mit all deinen Gliedmaßen und frei herumlaufend – wirst schlechte Karten bei ihm haben. Aber, hey, das Jahresende ist noch etwas hin. Du könntest also hart trainieren und deine Chance nutzen, in die elitären Kreise deiner Träume aufzusteigen.«
Ich seufzte schwer. Finch war ein solcher Dummschwätzer. Ja, beim Friedensfest, das am letzten Tag des Jahres stattfand, war es jedem erlaubt, einen beliebigen Bewohner des Landes – und somit auch einen Bewohner des weißen Rings – zu einem Duell um seinen Platz aufzufordern. Diese freundliche Geste des Königshauses war jedoch lächerlich. Man konnte nicht gegen einen Weißen gewinnen. Sie waren reich. Sie nahmen Unterricht in allem. Und falls ein Adeliger ohne magische Fähigkeiten sich selbst nicht fit genug fühlte, kaufte er sich einfach einen Magier, der an seiner Stelle dem Kampf beiwohnte.
Wenn man das Glück hatte, gegen einen Weißen Magier zu kämpfen, wurde man innerhalb eines Herzschlags mithilfe ihrer magischen Barriere zu Boden gerungen und ergab sich. Die Weißen Magier töteten oder verletzten ihre Angreifer eigentlich nie. Sie wurden schließlich dazu ausgebildet, die Bewohner Mentanos zu schützen, nicht umzubringen. Wenn man jedoch auf einen Roten Magier traf … nun, dann sprintete man am besten gleich aus der Arena, denn sonst kam man nicht als derselbe Mensch wieder heraus.
Die Fähigkeiten eines guten Roten Magiers waren grausam – und wenn man keine weiße Magie besaß, mit der man sich schützen oder ihre Illusionen zerstören konnte, hatte man ihnen nichts entgegenzusetzen.
Die Roten konnten einen alles vergessen lassen, was man jemals gesehen hatte. Sie erschufen Bilder, die man nicht von der Realität unterscheiden konnte. Sie trieben einen in den Wahnsinn, indem sie die schrecklichsten Lügen als nüchterne Wahrheit in den Kopf pflanzten. Sie pfuschten so lange in seinem Gehirn herum, bis man sich nicht mehr an seinen eigenen Namen erinnerte.
Und auch wenn es einige Dinge in meinem Leben gab, die ich gerne verdrängen wollte … auf fremde Hände, die mein Gehirn umgruben, konnte ich guten Gewissens verzichten.
Wir liefen schweigend weiter, endlose Augenblicke lang, die uns von einem Meer aus Gelb durch ein Meer aus Blau – dem Ring, in dem sich die Heilhäuser und Schulen befanden – in ein Meer aus Grau trieben. Das Zuhause der Arbeiter und Rohstoffernter. Finchs Zuhause. Mein Zuhause.
»Wo ist der heutige Treffpunkt?«, fragte ich außer Atem, nachdem wir über einen unangenehm breiten Spalt gesprungen waren.
»Haus der Treggs, wir sind gleich da.«
Ich nickte dankbar und warf einen Blick in den Himmel. Der Mond stand bereits hoch über uns, er würde nur noch einen halben Schritt brauchen, dann erreichte er seinen Zenit. Mist, wir waren verdammt spät dran. Die Dunkeldiebe hatten sich verschiedene Abwehrmechanismen ausgedacht, um von den Roten Magiern unentdeckt zu bleiben. Die Roten dachten, dass die Diebe im Untergrund und nachts arbeiteten, weshalb sie vor ein paar Friedensjahren ein paar Abwasserkanäle geflutet und blockiert hatten. Crow hatte daraufhin einen Monat lang Einbruchsverbot erteilt, damit sie dachten, sie hätten uns erwischt und wir bräuchten Zeit, um uns neu zu sortieren.
In Wirklichkeit war das Schwachsinn. Wer wollte schon nachts arbeiten? Und unter der Erde roch es schrecklich modrig. Nein, wir agierten bei Licht und von oben. Sobald der Mond den Zenit überschritten hatte, begann die Sperrzeit. Es gab keinen festen Stützpunkt, den würden die Roten Magier zu leicht finden. Der wöchentliche Treffpunkt wechselte stetig und wurde nur an drei Leute weitergeleitet, die jeweils ihre Untermänner informierten. Crow bezahlte Dutzende Familien dafür, ihre Dachböden ein Friedensjahr lang benutzen zu dürfen, sagte ihnen jedoch nie, wann er sich dort befinden würde. Die Bewohner wussten nur, dass sie von Sonnenuntergang bis zum Zenit des Mondes nichts dort oben verloren hatten. So konnten sie, wenn ein Roter sie danach fragte, wo die Diebe sich befänden, alle ehrlich mit Ich weiß es nicht antworten.
Die Angst vor den Roten Magiern war groß und das war der einzige Weg, den Menschen ein wenig Sicherheit zu geben. Viele Bewohner der äußeren Ringe beherrschten ein wenig rote oder weiße Magie. Wir lebten bereits seit langer Zeit eingeschlossen von der Roten Wand und Magie mischte sich nun einmal mit dem Blut. Aber niemand wusste sie wirklich zu nutzen. Außerdem war es gefährlich, mehr zu wissen als die anderen, deswegen gaben sich die Magietragenden meist Mühe, auch noch den letzten Funken ihrer Fähigkeit zu unterdrücken. Meine Mutter hatte das immer für schwachsinnig gehalten. »Lügen sind die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft unseres Landes, Fawn. Wenn man nicht lernt, Lüge und Realität zu unterscheiden, wird man blind durchs Leben laufen. Vergiss das nie.«
Aber sie war selbst eine Rote Magierin gewesen, wovor hätte sie sich fürchten sollen?
Finch verlangsamte seinen Schritt und als ich an ihm vorbeisah, bemerkte ich auch, warum. Ein dunkler Schatten hockte drei Manneslängen von uns entfernt auf dem Dachgiebel. Eine schlanke Gestalt, deren heller Schopf und bleiche Haut im Mondlicht weiß aufleuchtete und im starken Kontrast zu ihrer schwarzen Kleidung stand.
Ich verdrehte die Augen und drückte meine Hände in Finchs Rücken, damit er sich weiterbewegte. »Irgendwann werden dir die Augen aus dem Kopf fallen, so wie du Robyn anstarrst«, wisperte ich. »Und das wird der Tag sein, an dem ich ihr erzähle, dass du sie schrecklich liebst und vier Kinder mit ihr haben willst.«
Finch warf mir einen verärgerten Blick zu – doch selbst in der Dunkelheit erkannte ich, dass er rot wurde. Diese Farbe übersah ich nie. »Halt die Klappe. Ich dachte, sie ist vielleicht ein Feind.«
»Natürlich«, murmelte ich mitleidig. »Denn mit ihren weißen Haaren und ihrer unverwechselbar kurvigen Silhouette ist Robyn so schwer zu erkennen. Sie könnte jede sein!«
»Ja, könnte sie«, widersprach Finch vehement. »Rote Magier können jede Gestalt annehmen, Fawn.«
»So wie die eines verliebten Vollpfostens, der gerade versucht, seine beste Freundin zu belügen?«
Er schnaubte. »Bla, bla. Ich habe recht, du liegst falsch. Außerdem achte ich nicht auf ihre Figur.«
Oh, bitte. Er achtete auf nichts anderes.
»Was treibt ihr da hinten?«, zischte sie in diesem Moment und trat einen Schritt vor, sodass das fahle Mondlicht ihr bleiches herzförmiges Gesicht erhellte. Robyn hatte die Arme vorm Körper verschränkt, die roten Lippen geschürzt und das spitze Kinn gereckt. Mit ihren weißen Locken, den grünen Augen und ihrer Wespentaille war sie schöner als eine Marzipantorte mit Schleife – hatte dafür aber einen hohen Preis zahlen müssen. Sie redete nicht gern darüber, aber sie kam nicht aus dem grauen Ring so wie wir. Sie war im Nordteil des weißen Rings groß geworden, hatte mit vierzehn ihre Eltern bei einem Unfall verloren und war bei ihrem nächsten Verwandten abgeladen worden. Als ihr Onkel jedoch mehr an ihrem Körper als an ihrer Erziehung interessiert gewesen war, hatte sie kurzerhand ihre Sachen gepackt, war aus ihrem Ring geflohen – und wortwörtlich in meine Arme gerannt.
Meine Schwester Cora meinte immer, Robyn sei eine streunende Katze, die ich zu oft gefüttert hatte, sodass sie nie wieder von meiner Seite wich. Ich war froh, dass ich es getan hatte.
»Weißt du, dafür dass du eine Lügendiebin sein sollst, bist du ziemlich laut, Fawn«, bemerkte Robyn und schnalzte mit der Zunge. »Außerdem seid ihr zu spät. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber die meisten sind schon weg und der Rest packt grade ein. Hey, Finch.« Sie lächelte ihm knapp zu und er wandte hastig den Blick ab.
»Hey«, murmelte er.
Ich hielt einen Seufzer zurück und drängte mich an ihnen vorbei zum Ende des Dachfirsts, unter dem sich das Fenster des Dachbodens befinden musste.
Beim Königshaus Sweft, Liebe war lächerlich. Sie machte einen zum Idioten. Meine Mutter hatte sich ihr Leben lang nach einer tiefen Art der Liebe gesehnt, die mein Vater ihr nicht hatte geben können, und war stetig unglücklich gewesen. Mein Bruder ließ sich von seiner Frau herumkommandieren und hatte dadurch seine Persönlichkeit eingebüßt. Meine Schwester war seit Ewigkeiten in einen Heiler aus dem blauen Ring verknallt und knickte andauernd absichtlich um, um ihn wiederzusehen. Und Finch, der schlagfertigste und härteste Kerl, den ich kannte, verwandelte sich unter Robyns Blick in einen schüchternen Schuljungen.
Nein. Das ganze lächerliche Getue war nichts für mich. Ich würde meinen Verstand behalten, vielen Dank.
»Sie werden sich darüber freuen, auf uns gewartet zu haben«, sagte ich leichthin und lächelte Robyn selbstgefällig über die Schulter zu. »Lady Falcron war heute sehr redselig.«
Robyn hob eine dünne Augenbraue. »Was hat sie gesagt?«
»Erzähl ich dir nachher, warte hier oben«, murmelte ich, bevor ich über die Kante lugte, die offenen Läden ausmachte und mich im nächsten Moment mit den Händen vom Dach baumeln ließ. Zwei Herzschläge später schwang ich mich durch das darunterliegende Fenster.
Robyn hatte recht, die meisten Diebe waren schon verschwunden. Nur noch eine einzelne dürre Gestalt lungerte an der gegenüberliegenden Wand des schwach beleuchteten Raumes und verstaute gerade eine Handvoll gläserner Phiolen in einem Lederbeutel. Das war nicht optimal, denn wenn es mehrere Interessenten gab, war es leichter, den Preis hochzutreiben. Aber ich hatte keine Lust, sieben Tage auf das nächste Treffen zu warten. Ich war eine ungeduldige kleine Diebin, die nächste Woche ihren 18. Geburtstag feierte. Und wenn ich in die Reihe der Dunkeldiebe aufsteigen wollte, musste das passieren, bevor ich meine Arbeitsstelle antrat. Denn wenn mein Name erst einmal auf einem offiziellen Pergament erfasst war, war es sehr schwer unterzutauchen. Jugendliche in ihrer Orientierungszeit durch die Ritzen fallen zu lassen, war jedoch einfach. Ein kleiner Diebstahl beim zuständigen Ringvorsteher reichte.
»Hey, Nuthatch«, begrüßte ich den bärtigen Mann deshalb und lächelte ihm süßlich zu. »Eine schöne Nacht zum Handeln, findest du nicht?«
Mit den Dieben zu verkehren, war grundsätzlich nie eine gute Idee. Mit Nuthatch Geschäfte einzugehen, eine noch dümmere. Crows rechte Hand war dafür bekannt, aus reiner Missgunst schon den ein oder anderen Ruf zerstört zu haben – und eine Lügendiebin mit schlechtem Ruf war eine arbeitslose Lügendiebin.
Es wäre also klüger von mir, ihm meine Lüge nicht anzubieten. Sicherer, ihm den Rücken zu kehren und aus dem Fenster zu klettern. Aber um klüger zu sein, hätte ich in der Schule wohl besser aufpassen müssen. All die heroischen Geschichten über die Königsfamilie Sweft hatten mich nicht interessiert. Das Nötigste hatte ich mitbekommen, den Rest vermisste ich nicht.
Seit dem Tod meiner Mutter hatte ich ohnehin immer nur eins gewollt: zu lernen, mit Worten zu kämpfen, mit Lügen zu handeln und mit Namen zu drohen. Denn alles andere … alles andere war trostlos. Langweilig. Vorhersehbar. Vom Königshaus für mich geplant. Abgesehen davon machte es keinen Spaß, arm zu sein. In den unteren Ringen bekam man kein Geld. Wir wurden mit Essen und einem Dach über unserem Kopf bezahlt, konnten uns aber nichts kaufen, um unser Leben angenehmer zu gestalten. Als Dieb jedoch sah das anders aus.
»Du bist zu spät, Fawn«, sagte Nuthatch grimmig und befestigte den Lederbeutel an seinem Gürtel. »Geh nach Hause. Ich bin müde und will zu meiner Frau ins warme Bett krabbeln. Komm nächste Woche wieder.« Er hob die Hand und wandte sich zum Gehen.
»Ich habe eine Lüge von Lady Falcron«, stieß ich hastig hervor und zog die gläserne Phiole aus meiner Tasche.
Nuthatchs Hand hielt am Türgriff inne. Seine Augen weiteten sich und als er mich anblickte, zeichnete unverhohlenes Interesse seine Züge. »Lady Falcron?«, wiederholte er langsam und trat auf mich zu, den Blick gierig auf die Lüge in meiner Hand gerichtet.
Die flackernden Öllampen an der Wand ließen Schatten durch den Raum tanzen, sodass er noch gruseliger aussah als sonst. Nuthatchs Gesicht war der reinste Unfall. Dunkle Augen lagen eingesunken in seinem faltigen Gesicht. Eine Narbe zog seinen rechten Mundwinkel nach unten und seine zotteligen schwarzen Haare hätten einem Straßenköter weitaus besser gestanden. Aber er war Crows rechte Hand, er hatte Einfluss … er würde die Tragweite meiner gestohlenen Lüge verstehen.
»Ja, weißt du, ich habe am Abendessen der Familie Falcron teilgenommen«, sagte ich im Plauderton. »Angespannte Stimmung bei unseren Lieblingen, das kann ich dir sagen. Macht und Gold sind anscheinend wirklich nicht alles im Leben …«
»Du faselst, Fawn«, sagte Nuthatch ungeduldig und schob die Hände in die Hosentaschen. »Worum geht es bei der Lüge?«
Ich hob einen Mundwinkel. »Netter Versuch. Ich will erst über den Preis reden, bevor ich dir irgendetwas verrate. Alles, was du wissen musst, ist, dass sie groß ist. Weltverändernd groß.«
Nuthatch schnaubte und presste die Lippen zusammen. »Ich kaufe keine Katze im Sack. Ich will zumindest einen Anhaltspunkt.«
»Der Anhaltspunkt ist, dass sie von Lady Falcron stammt«, erklang eine tiefe Stimme hinter mir. Es war Finch, der sich nun neben mich stellte. »Niemand außer Fawn traut sich auf das Falcron-Anwesen, Nuthatch. Also machst du uns besser einen guten Preis. Wir fangen bei hundert Menti an. Eine Falcron-Lüge werden wir schneller los als ein Aktgemälde deiner Frau – also bilde dir ja nicht ein, dass wir keine anderen Optionen hätten.«
Nuthatch grummelte etwas Unverständliches und sah Finch dann düster an. »Bezahlt Fawn dich dafür, dass du ihren Leibwächter spielst?«, wollte er trocken wissen.
Finch grinste und legte einen Arm um meine Schultern. »Ist ihr wunderschönes Lächeln und ihr neckischer Charme nicht Bezahlung genug?«
Nun sank auch Nuthatchs anderer Mundwinkel nach unten. Offenbar war ihm klar, dass wir sein Lächeln nicht als Zahlung akzeptieren würden. »Ihr müsst euch mal in meine Position versetzen«, sagte er leise. »Woher soll ich wissen, dass die Lüge tatsächlich so viel wert ist? Hundert Menti … dafür könnte ich jemanden umbringen lassen!« Er verengte die Augen zu Schlitzen und fixierte mich wieder. »Fawn ist eine kleine Lügnerin und im Vergleich zu ihr kann ich ihr nicht von den Lippen ablesen, ob sie mich gerade nur an der Nase herumführt.«
Seine Worte hätten mich wahrscheinlich kränken sollen … doch das taten sie nicht. Sie machten mich eher stolz.
Gespielt bestürzt legte ich eine Hand auf die Brust.
»Nuthatch, was denkst du nur von mir? Ich gehe zurzeit einer rechtschaffenden Arbeit als Erntehelferin nach.«
»Natürlich«, sagte Nuthatch süßlich und seine sanfte Stimme stand in einem solchen Kontrast zu seinem hässlichen verzerrten Gesicht, dass meine Nackenhaare zu Berge standen. »So wie auch deine Mutter immer rechtschaffend war, nicht wahr?«
»Was willst du denn jetzt damit sagen?« Was wusste Nuthatch schon über meine Mutter?