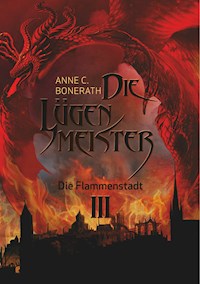
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein Lügenmeister darf kein Mitleid haben - und nicht nur das, auch Liebe, Freundschaft und jugendlicher Übermut machen Léas das Leben schwer. Seine mächtigen zauberischen Gegner spinnen immer wieder neue Intrigen, die für Léas' Freunde und für Chanan, die Liebe seines Lebens, undurchschaubar sind, aber auch er selbst fällt auf so manche Hinterlist rein. So gerät das Kind des Drachenmonds in der Welt von Maura'an immer wieder in brenzlige bis lebensbedrohliche Situationen - nur gut, dass er nicht nur über die Stimme der Macht verfügt, sondern auch schnell und pfiffig denken kann und so auch scheinbar aussichtslose Aufgaben meistert. Im dritten Teil der fantastischen Lügenmeister-Trilogie findet Léas so manche unbequeme Antwort auf viele Fragen, die - bewusst oder unbewusst - auf seiner Seele lasten. Diese inneren Konflikte spiegeln sich in den äußeren wider und gipfeln in SEINEN Ränken gegen Léas, die der junge Lügenmeister jedoch wie immer nicht mit Gewalt, sondern mit Köpfchen löst, egal ob er sich gegen machtbesessene Herzöge, Sechsarmer, Nachtauge oder IHN selbst durchsetzen muss ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1140
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Martin Für Gironimo und Sunny
Der Tag, an dem sich alle deine Wünsche zu erfüllen scheinen und sämtliche Träume wahr werden, ist der gefährlichste deines Lebens.
Ich kriege kaum noch Luft.
Das feuchte Nadelholz, welches er auf die Buchenscheite geworfen hat, qualmt – ich soll wohl ersticken. Doch nicht der Rauch wird mich töten, er hat es so eingerichtet, dass das Feuer schneller ist als der Qualm. Schon wegen des Lampenöls, mit dem meine Kleider durchtränkt sind. Die Hitze ist unbeschreiblich, sie frisst sich von meinem Rücken her durch meinen gesamten Körper. Mein Mantelsaum schwelt bereits. Und ich kann mich nicht bewegen! Wenn das doch bloß einer meiner schaurigen Tagträume wäre! Aber dieses Feuer ist Realität. Und nur noch eine dünne Lage Stoff von meiner Haut entfernt.
In meiner Kehle sammeln sich sämtliche Schreie dieser Welt, um in wenigen Augenblicken in einer glutroten Woge von Schmerz und Wahnsinn hervorzubrechen – und gleich darauf im Tosen der Flammen zu verstummen.
Ich möchte um Hilfe brüllen, obwohl es sinnlos ist. Niemand wagt sich in ein Haus, das ein Lügenmeister zur Richtstätte erklärt hat und niederbrennen will. Die wenigen Freunde, die ich auf dieser Welt noch habe, sind unerreichbar: Mein Herr hat mich verraten, Víllian ist in den Krieg gezogen und die einzige Frau, die ich jemals wirklich geliebt habe, wird bald einem anderen gehören.
Wenn ich nur meine Hände losbekäme! Doch die sind auf perfide Weise so gut fixiert, dass mir jede noch so kleine Bewegung Höllenqualen verursacht. Das Werk eines Meisters unserer Zunft. Mit Absicht so gewählt, dass der Verurteilte bis zum letzten Moment dagegen kämpft. Und das tue ich. Verglichen mit dem, was gleich passieren wird – vielleicht kann ich es aushalten. Ich muss es aushalten! Meine einzige und letzte Chance … Schweiß brennt mir in den Augen und mir laufen Tränen übers Gesicht vor Schmerzen. Ich beiße meine Zähne so fest zusammen, dass meine Kieferknochen knacken. Es gibt immer einen Weg! Selbst hier und jetzt!
Wie hatte es nur so weit kommen können? Wieso bin ich in diese Falle getappt, wo die Warnzeichen doch unübersehbar waren? Komme mir bloß niemand mit Leichtsinn! Daran lag es diesmal nicht. Oder höchstens ein bisschen. Vor allem lag es daran, dass ich mich endlich einmal um meine eigenen Angelegenheiten gekümmert habe. Leider nicht nur ich allein. Meine Feinde waren mir einen guten Schritt voraus. Und sie planten diesen Hinterhalt, noch während ich in fernen Landen weilte, an einem Ort tief im Süden dieser Welt, als meine Welt noch halbwegs in Ordnung war …
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Epilog
Kapitel 1
Varabor. Winzige, krumme Gässchen, in die sich kaum je ein Sonnenstrahl verirrte. Wo sich winzige Läden und Werkstätten aneinanderdrängten, die fensterlosen Geschäftsräume ebenso zur ewigen Finsternis verdammt wie die darüber befindlichen Stuben, deren Bewohner jeden Winkel ihrer schmalen, sechs-, sieben-, achtgeschossigen, aus weiß gekalkten Lehmziegeln errichteten Häuser auszunutzen pflegten.
Dann wieder breite Prachtstraßen, gesäumt von prunkvollen Palästen mit hohen Mauern, hinter denen herrliche Gärten eine Ahnung vom süßen Leben der gut betuchten Bürger vermittelten.
Windschiefe Sklavenhütten neben spitzgiebligen, zinnenbewehrten Handelskontoren, deren schmiedeeiserne Schutzgitter mit Rosen und Ranken verziert und mit Blattgold überzogen waren.
In einigen Vierteln bestand jedes dritte Gebäude aus einer zorva-Destillerie. Die Straßen dort waren verstopft mit übervoll beladenen Wagen aus der Provinz, von denen immer wieder einzelne Rüben herunterpurzelten und nicht selten Passanten verletzten. Wer hier wohnte oder arbeitete, hatte zeitig gelernt, den Kopf einzuziehen.
Düfte exotischer Gewürze waberten aus den meist weit geöffneten Fenstern und stiegen als wirre Mischung aus den Töpfen und Tiegeln der unzähligen Garküchen.
Es roch nach Braten, Fett, Backwerk, aber auch nach fauligem Fisch, nach Schweiß, Honig, Bienenwachs, Waltran, Lampenöl, verbranntem Horn und Holzkohle. Der Übelkeit erregende Gestank einer Gerberei mischte sich mit den blumigen Aromen, die aus einer Parfümmanufaktur drangen. Dort, wo die Männer zum Trinken und Rauchen zusammenkamen, schnupperte man Tabak und zorva, aber auch andere Drogen sowie den säuerlichen Geruch von frisch Erbrochenem.
In manchen Gegenden überlagerte der Geruch des Todes alles andere.
Nichtsdestotrotz war die Hauptstadt von Tourrh ein Ort, der vor Leben nur so strotzte.
Eine Stadt, die von Menschen unterschiedlichster Herkunft wimmelte. Da waren zunächst natürlich Tourrhaner aller bekannten Stämme vertreten. Dann groß gewachsene, ernste Nimorsier, die jedem, der dies zu erfahren (oder eben nicht zu erfahren) wünschte, erklärten, dass für sie der Rest der Welt aus hinterwäldlerischen, unkultivierten Barbaren bestand. An anderer Stelle traf man auf verwegene pandharische Piraten und Händler (böse Zeitgenossen behaupten, das sei ein und dasselbe) mit blitzenden, dunklen Augen und fast blau schimmerndem Schwarzhaar, die olivenbraune Haut auf Hochglanz geölt.
Doch etliche Seeleute hatten einen noch viel weiteren Weg zurückgelegt: Hellhäutige, stämmige Phuntier und sogar ein paar stolze (und ziemlich lärmende) Krieger aus dem sagenhaften, fernen Inselreich Mog Agath sowie eine Gruppe bunt und edel gekleideter Patriarchen aus Jerschewan, die ihre himmelhohen, spitz zulaufenden Hüte mit ebenso großer Würde zu tragen verstanden wie die halbrunden, reptilienhautüberzogenen Schilde. Schließlich gab es da Menschen, die aus so fernen Regionen unseres Planeten stammten, dass man sie auf Anhieb keinem bestimmten Land zuordnen konnte: Männer und Frauen mit einer Haut so dunkel wie Rauchbier oder aber von elfenbeinerner Blässe und mit ebenholzschwarzen Locken, den Tourrhanern auf den ersten Blick ähnlich, aber in Kleidung und Sprache von jenen völlig verschieden; oder jene kahl rasierten Herren in ihren langen, weiten Seidengewändern, deren Haut so rot wie sonnenbeschienene Ziegel glänzte.
Einmal erspähten wir gar eine Gruppe Männer, die waren über und über mit Schmuck behangen und hatten sich überdies durch Lippen, Nasenflügel, Ohrläppchen sowie jede sichtbare (und wahrscheinlich auch unsichtbare) Hautfalte Ringe und goldene Nadeln gestochen.
Und dann das Meer. Zum ersten, allerersten Mal das Meer!
Auch wenn der Hafen nur einen begrenzten Ausblick auf den schmalen Golf von Astragant erlaubte, bot er doch für geborene Landratten wie uns einen überwältigenden, ja geradezu beängstigenden Anblick.
Die Weite der offenen Steppe war nichts gewesen im Vergleich zu jenem unablässig murmelnden, sich auf und ab bewegenden, gierig schmatzenden und glucksenden, klatschenden, platschenden, spritzenden, seltsam riechenden, graugrünen, irgendwie lauernden Ding, das sich bis in die Unendlichkeit zu erstrecken schien …
Ich warf einen Blick über meine Schulter.
Unter all den merkwürdigen, gänzlich verschiedenen Blättern vom Baum des Menschengeschlechts, die der Seewind nach Varabor geweht hatte, waren die Chálagast ganz sicher nicht die ausgefallensten. Dennoch sorgten meine Begleiter und ich für Aufsehen. Man drehte sich nach uns um, wies mit den Fingern auf uns und tuschelte hinter vorgehaltenen Händen oder Fächern. Doch ganz genau wie im Norden des Landes näherte sich uns niemand in feindseliger Absicht. Die Leute waren ganz einfach neugierig.
Nach all den Wochen, in denen wir die eintönige Zentral-malashût praktisch einmal der Länge nach von Norden nach Süden durchquert hatten, wurden wir von den abertausend Reizen, die an jenem Ort gleichzeitig auf uns einstürzten, buchstäblich erschlagen. Wie Schlafwandler ließen wir uns vom Strom der Menschen durch Gassen und über Plätze treiben, staunten schweigend, unfähig, unsere Eindrücke in Worte zu fassen oder gar irgendetwas Nützliches zu unternehmen, außer darauf zu achten, dass unsere kleine Herde nicht auseinandergerissen wurde.
Erst als sich Dunkelheit über Hafen und Häuser breitete (was der quirligen Geschäftigkeit der Varaborer allerdings keinen Abbruch tat, so etwas wie eine offizielle Sperrstunde schien hierzulande entweder nicht zu existieren oder sie wurde einfach ignoriert), rafften wir uns auf, eine Herberge zu suchen. Wir fanden eine, die nicht nur saubere Betten und genießbares Essen zu bieten hatte, sondern auch in unmittelbarer Nähe zu den Landungsbrücken lag. Von dort aus wollten wir am folgenden Tag unsere Umfrage nach einem Schiff starten, das uns nach Astragant in Nîm bringen konnte.
Wir hatten so lange zwischen zugigen Zeltwänden oder unter freiem Himmel genächtigt, dass ich fürchtete, in dem engen Zimmerchen, das ich mit meinen Gefährten teilte, ersticken zu müssen. Ich strampelte meine Decken fort, verschränkte die Hände im Nacken und ließ die Ereignisse der letzten sechs Wochen an mir vorüberziehen.
Immerhin war uns auf der gesamten Strecke nichts Schlimmeres widerfahren, als dass sich eines der Packpferde eine so schlimme Kolik eingefangen hatte, dass wir es hatten töten müssen und der liebe Rolva, bei den Besinen richtiggehend aufgeblüht, wieder in düsterste Depressionen abgeglitten war. »Jetzt geht das wieder los«, hatte er gebrummt, als man ihm beim Abschied in den Sattel geholfen hatte. »Reiten und reiten und reiten und kein Essen und kein Feuer und Feinde und wieder ein Scheiß-Gebirge mit die Götter mögen wissen was für Ungeheuern und dann auch noch übers Meer!« Dann hatte er sich zu mir umgedreht und gelästert: »Wie ausgesprochen schlau von Ihnen, die Karte von Süd-Tourrh zu verbrennen, wo wir gerade die jetzt so nötig bräuchten!«
Richtig. Doch das hatte ich damals, in der Speisekammer der Sechsarmer, beim besten Willen nicht vorhersehen können.
Rolvas finstere Prognosen hatten sich zum Glück nicht bewahrheitet. Weder waren uns die Vorräte ausgegangen, noch waren wir im Kargast-Gebirge auf irgendwelche Unholde gestoßen. Stattdessen waren wir die ganze Zeit vor dem Winter auf der Flucht gewesen, der uns von Norden her auf den Fersen gefolgt war und uns in den Bergen vorübergehend eingeholt hatte.
Jenseits des Kargast aber hatte uns die von Feuchtigkeit schwere, warme Luft des Südens empfangen und unsere Mühen mit dem Anblick von riesigen Tabakpflanzungen, Melonen- und Reisfeldern, Weinbergen, in denen die Ernte gerade abgeschlossen war, Alleen und Spalieren von Pfirsich- und Aprikosenbäumen, Zypressen, Zedern, Pinien, sogar Palmen und winterblühenden blauen und goldgelben Glockenhecken, in deren Geäst die berühmten Honigsperlinge nach Nektar suchten, belohnt.
Zwar hatte auch hier an der Küste der Winter Einzug gehalten, doch was waren die kurzen Tage, die gelegentlichen kalten Regengüsse und der böige Ostwind gegen die tagelang anhaltenden Schneestürme in den Hohen Márchen, denen wir auf diese Weise entgangen waren?
Die eigentlichen Probleme, die jene Reise bereitgehalten hatte, waren ganz anderer Natur gewesen.
Da waren zum einen die zahllosen einsamen Nächte. Ich hatte mich so sehr daran gewöhnt, Chánans weichen, warmen Körper in meinen Armen zu spüren, wenn ich einschlief, und ihre ruhigen Atemzüge in meinem Nacken zu hören, wenn ich erwachte, dass ich mir nun auf schmerzhafte Weise unvollständig vorkam. Zu wissen, dass sie selbst fast noch mehr darunter litt als ich, machte es keineswegs leichter.
Und dann die Sache mit meinem Herrn … ich weiß weder, wie ich diese Episode in Worte fassen, noch, ob ich sie überhaupt erwähnen soll, denn passiert war ja eigentlich nichts …
Ian und ich waren ein Stück vorausgelaufen, um einen etwas zweifelhaften Weg über ein Hochplateau im Transkargast auszukundschaften. Um die Mittagszeit herum hatten wir uns einen sonnenbeschienenen, windgeschützten Winkel gesucht, der eine herrliche Aussicht über die rotbraunen Felsen und Grate der umgebenden Höhenzüge bot, und dort auf die übrigen drei gewartet. Ian hatte sich mit einem Seufzer gegen die warmen Steine gelehnt und seinen zerzausten Zopf gelöst. Für einen kurzen Moment hatte seine Mähne wie ein dunkles Banner im Wind geflattert, bevor er sie eingefangen, gebändigt und mit der Fingerfertigkeit jahrzehntelanger Übung neu geflochten hatte.
Er hatte meinen bewundernden Blick belächelt und mich an seine Seite gewunken: »Ich will dir ein Geheimnis verraten, Léas. Kannst du schweigen?«
Ich hatte nur genickt.
»Dieser Meister Lír glaubte wohl, uns in die Sklaverei zu verkaufen, sei das Schlimmste, was er uns antun könnte.«
»Und?«, meinte ich überrascht, »war es das etwa nicht?«
Ian schüttelte den Kopf. »Natürlich war es furchtbar, nicht zu wissen, was mit meiner Familie, was mit den Einwohnern von Tórleon, ja, was mit dir geschehen war, und dieser Schlangenzahn, nun, ich hab’ dir ja schon erzählt, was für ein Tier dieser Kerl war, aber –«, er senkte seinen Blick tief in meinen, »aber auf einmal jeglicher Verantwortung enthoben zu sein … Verstehst du? Es ist so viel einfacher, Befehle auszuführen, als sie zu erteilen. Geradezu erholsam.« Ian lachte leise.
»Erholsam?«
»Sag’s bloß nicht weiter, aber manchmal hab’ ich’s genossen.«
»Das ist nicht dein Ernst, Ian.« Ich war seinem Blick nicht ausgewichen und auch er hielt dem meinen weiter stand.
»Du wirkst verändert, mein Freund«, hatte er nach einer Pause festgestellt. »Seit dem Fest bei den Nomaden bist du so ernst und in dich gekehrt, dass ich dich kaum wiedererkenne. Was bedrückt dich? Und wie kann ich dir helfen?«
Ich hatte mit den Schultern gezuckt und eine betont unbeteiligte Miene zur Schau gestellt. »Weiß nicht. Erejks Tod vielleicht. Ich hab’ den alten Jäger sehr gemocht. Er fehlt mir.«
»Wir anderen vermissen ihn ebenfalls aufs Schmerzlichste. Nein, Léas, das ist es nicht, was dich bekümmert. Oder höchstens die halbe Wahrheit.« Er räusperte sich unbehaglich. »Ich würde nicht auf eine Antwort drängen, wenn Chánans Diener nicht ständig so merkwürdige Andeutungen fallen ließe.«
Ich war heftig zusammengefahren. Rolva, der elende Wurm! Hatte er endlich ein Mittel gefunden, es seiner Herrin heimzuzahlen? Laut hatte ich mit Unschuldsmiene gefragt: »Andeutungen? Was denn für Andeutungen?«
Ian hatte milde gelächelt. »Oh, er behauptet, du seist in jemanden verschossen. Eine unglückliche Liebe, die wohl niemals Erfüllung finden wird. Das waren seine Worte.«
Das Blut schoss mir ins Gesicht und erzeugte eine schier unerträgliche Hitze. Wie viel mehr hatte dieser Wicht verraten? Wie viel ahnte mein Herr?
Obgleich ich mir geschworen hatte, genau das tunlichst zu unterlassen, hatte ich meine Fühler ausgestreckt, um Ians Innenleben auszuloten. Dem Himmel sei Dank, er war weder wütend noch verletzt. Anders ausgedrückt, er hatte keine Ahnung, um wen es ging. Oder aber, er hatte die verkehrten Schlüsse gezogen (die so verkehrt ja auch nicht waren), denn als er jetzt seine Hand auf meinen Scheitel legte, spürte ich eine Art heftiger Wallung in ihm, eine Woge von Wärme und Zuneigung überflutete sein Herz. Seine Pupillen weiteten sich, bis sie fast alles Grün der Iriden verdrängt hatten. Mir war auf einmal unglaublich heiß und schwindelig.
Im selben Augenblick hatten wir von fern den Hufschlag mehrerer Pferde vernommen. Kaum eine halbe Minute später war Víll aus dem Sattel gesprungen und hatte sich lachend neben uns niedergelassen. »Was ist denn mit euch los? Weshalb glüht ihr so? Seid ihr gerannt?«
»Der Weg hier herauf war anstrengend und steil«, hatte Ian leise gemurmelt. »Und voller falscher Abzweigungen.«
Am späten Abend jenes Tages hatte ich mir Rolva zur Brust genommen. Um ihm begreiflich zu machen, dass es mir todernst war, hatte ich ihm angedroht, ihn in ein räudiges weißes Frettchen zu verwandeln, sollte er dem Télgon gegenüber ein einziges Wort über Chánan und mich fallen lassen. Daraufhin hatte er sein Lästermaul tatsächlich unter Verschluss gehalten. Seit jener Zeit jedoch spielte ständig ein hässliches, triumphierendes Lächeln um seine Lippen. Und ich wusste genau, was sich dahinter verbarg: der Gedanke, plötzlich Herr über das Schicksal anderer Menschen zu sein, Menschen zudem, die ihn immer wieder gedemütigt und beleidigt hatten. Ein Wort von mir und ihr seid erledigt.
Das war Rolvas Überzeugung.
Und natürlich hatte er recht.
Jeden Abend, bevor wir uns schlafen legten, hatten die Léon-Brüder und ich abwechselnd einen kleinen Teil unserer Abenteuer zum Besten gegeben. Als ich das Kapitel abgeschlossen hatte, in dem Lír mich mit seinem Räucherzeug außer Gefecht gesetzt und mich zwei Wochen lang erfolgreich am Schlafen gehindert hatte, waren Vílls Ohren knallrot vor Zorn gewesen und er selbst hatte geradezu gebrodelt.
»Und selbst dieses Monstrum hast du verschont, als er am Ende hilflos am Boden lag? Léas, wie konntest du nur?«
Ich hatte ihn groß angeblickt. »Die Betonung liegt auf hilflos, Víll. Und, so komisch es klingt, Lír wollte mir wirklich helfen – ja, lach du nur! Außerdem hatte er euch beiden das Leben geschenkt. Wie hätte ich ihn da töten können?«
Víll hatte sich mit seinem Daumen auf die Brust getippt und gewütet: »Wenn ich mit einem guten Schwert in der Hand meinem Todfeind gegenüberstehe, sehe ich zu, dass er Gelegenheit bekommt, die Gänseblümchen von unten zu betrachten. Krchchchch!« (Beim letzten Geräusch hatte er sich die Hände um den Hals gelegt und zugedrückt, um uns seine Meinung zu veranschaulichen.)
»Bravo, Víllian!«, hatte ich ausgerufen und ihm begeistert applaudiert. »Genau so argumentieren SEINE Diener: Vergiss dein blödes Gewissen! Wenn sich inzwischen selbst ihre ärgsten Gegner diese Art zu denken zu eigen gemacht haben, darf ER sich freuen: Dann hat ER nämlich keine Feinde mehr.«
Es hatte eine Weile gebraucht, bis mein unüberhörbarer Sarkasmus sich seinen Weg durch Vílls widerspenstige Hirnwindungen gebahnt hatte. Am Ende war das tiefe Rotviolett seiner Ohrmuscheln einer gesünderen Farbe gewichen und Vílls Gesicht hatte einen Ausdruck komischer Zerknirschung angenommen. »Auwei«, hatte er geächzt und sich auf die Lippe gebissen. »Mitten rein ins Fettnäpfchen, was? Aber die Vorstellung, dass jemand dir so etwas ungestraft antun darf, bringt mich um mein letztes Fitzelchen Verstand.« Er hatte abbittend die Hände gehoben. »Ja, ja, ich weiß schon, was ihr sagen werdet: Víllian Léon, halt deinen Schnabel und überlass das Denken den Pferden.«
»Das Denken sei dir gestattet«, hatte Ian schmunzelnd bemerkt. »Desgleichen das Reden. Immer vorausgesetzt, es geschieht in dieser Reihenfolge.«
Rolvas Lider hatten geflattert, während er laut überlegt hatte: »Hm, ein Jammer, dass Sie Meister Lírs Geheimrezept nicht an sich bringen konnten, für den Zaubertrank, der alle Wunden und Gebrechen im Handumdrehen heilen lässt.«
»Hab’ ich zuerst auch gedacht«, hatte ich zugegeben. »Später war ich froh darum. Denn«, ich hatte die Brauen gehoben und in die Runde geblickt, »wem hätte ich das Mittel zukommen lassen sollen, wem es verweigern? Wer wäre fähig gewesen, eine gerechte Entscheidung zu treffen? Ich jedenfalls nicht.«
Ian hatte die Pfeife aus dem Mund genommen und mich lange von der Seite angesehen. »Ilyána, was hättest du für einen Télgon abgegeben, wärest du auf der richtigen Seite des Bettes gezeugt worden, Léas!«
»Das kann ich dir verraten!«, hatte seine Schwester sich eingemischt. »Einen sehr langsamen. Einen, auf dessen Entscheidungen du ewig hättest warten müssen, weil er sie so lange hin und her gewälzt hätte, bis er sich hätte sicher sein können, niemandem damit wehzutun. Seine Untertanen hätten schließlich aus der Not heraus angefangen, selbstständig zu denken und zu handeln. Ihn hätten sie als zwar netten, aber völlig untauglichen Mann aufs Altenteil komplimentiert.« Sie hatte mich fröhlich angelacht, das erste Mal seit schier unendlicher Zeit.
»Alle würden dich lieben, Léas, aber keiner dich ernst nehmen.«
Und das von der Frau, die vor gar nicht allzu langer Zeit meine »übereilten« Entschlüsse bemäkelt hatte!
Irgendwann musste ich wohl doch eingeschlafen sein, denn als ich die Augen aufschlug und Ians hoch aufgeschossene Gestalt über mir aufragte, war es heller Tag. Ungeduldig drängte er mich zum Aufstehen.
»Komm, wir müssen zum Hafen. Wir haben schon genug Zeit vertrödelt. Ab heute kommt es auf jeden einzelnen Tag an.«
Während Rolva und seine Herrin noch im Traumland umgingen, war der notorische Langschläfer Víllian zu meiner Überraschung bereits gestiefelt und gespornt. Na ja, kein Wunder, schließlich sollte er heute endlich seine geliebten Hochseekähne zu Gesicht bekommen.
Vílls Begeisterung kannte in der Tat keine Grenzen.
»Uih!«, quietschte er. »Seht nur, eine tourrhanische Galeere! Keine Segel, dafür fünf Reihen Ruderer, um sie in schwierigen Gewässern manövrierfähig zu halten. Und dort, diese riesenhafte Karacke aus Nessedh! Schaut euch die Segel an, ist das nicht ein Irrsinn? Fock-, Besan-, Kreuz- und Großmast und alle voll aufgetakelt. Habt ihr das vergoldete Heckkastell gesehen? Die herrliche Galionsfigur am Vordersteven? Die schenkeldicken Ankerketten? He!« Er sprang in die Höhe und deutete mit dem Finger auf einen Verladekran. »Guckt mal da! Habt ihr so was schon mal erlebt?«
Hatten wir nicht und verfielen daher in angemessenes Staunen. Die enorme Apparatur wurde nämlich durch Muskelkraft angetrieben: Vier kräftige Männer, Sklaven allem Anschein nach, liefen wie zahme Eichhörnchen in einer Art hohlem Mühlrad, das über eine Welle mit dem Schwenkarm verbunden war, der auf diese Weise selbst schwerste Lasten zu heben in der Lage war. Eine schweißtreibende Arbeit, doch sehr effektiv, wie wir zugeben mussten.
»Wie nennt man diese kleinen, flachen Schiffe, die um die ganz großen herumfahren?«
»Ach, Léas!«, regte Víll sich auf. »Kennst du denn nicht mal den Unterschied zwischen einem Schiff und einem Leichter?« Víll war vollkommen in seinem Element. »Sie entladen die Frachtschiffe, die zu tief im Wasser liegen, um bis an den Pier heranfahren zu können, und folglich weiter draußen in der Fahrrinne ankern müssen. So wie jenen Riesen dort vorn – Göttin!« Víll schnappte nach Luft. »Freunde, mich trifft der Schlag!«
»Dafür siehst du aber noch recht gesund aus«, bemerkte sein Bruder ungerührt. »Was hat es mit diesem Boot auf sich?«
»Boot!«, wiederholte Víll mit Leidensmiene. »Ihr beide habt wahrhaftig keine Ahnung, was?« Mit gespielter Verzweiflung raufte er sich das unordentlich geflochtene Haar. »Sieht so ein plebejisches Boot aus? Himmel, das ist ein ausgewachsenes Schiff – und was für eins! Eine Großkogge der Seefahrergilde, ein Kraweelbau, ausgestattet mit Heckruder, Groß-, Fock-, Besan- und Schönwettermast, Vorder- und Heckkastell. Mindestens fünfzig Mann Besatzung, die nicht nur aus besonders bewährten Matrosen, sondern auch aus erfahrenen Kriegern besteht …« Víll holte angestrengt Luft. »Schaut euch die Wappenschilde an den Bordwänden an, ist das nicht herrlich? Die Wimpel über der Mars repräsentieren das Symbol der Seefahrergilde: die sich umschlingenden goldenen Fische …«
Mir schwirrte der Kopf von all den Begriffen, die Víll so leicht von der Zunge gegangen waren. Mars? Besan? Immerhin, eine Information war durch den Wust von nautischen Fachausdrücken zu mir durchgedrungen: Bei Vílls Objekt der Anbetung handelte es sich um ein Schiff der Seefahrergilde. Untertanen des Herzogs von Avellyn zwar, doch im weitesten Sinne auch unsere Landsleute. Ian schien denselben Gedanken zu verfolgen, denn er beschleunigte seine Schritte, um auf eine Gruppe von fünf Männern zuzusteuern, die eben einem Skiff entstiegen und nun in einer angeregten Diskussion mit einem Hafenbeamten vertieft waren. Alle fünf trugen knielange Tuniken aus weißer Wolle, schwarze Beinlinge, schwarze Gugel mit Kapuzen sowie einen weiten, meerblauen Mantel mit goldener Schließe. Bei zweien von ihnen blitzten an den Säumen ihrer Uniformen Kettenhemden hervor.
Mein Herr beachtete weder den Hafenmeister noch die Mehrzahl der anwesenden Schiffsknechte, sondern wandte sich unverzüglich an den fünften Mann, der durch seine Größe und die ungewöhnliche Länge und Fülle seines kastanienbraunen Haares aus der Gruppe herausstach. Ich sah und spürte die Verblüffung in dem Chálagast, ausgerechnet an diesem Ort einem Mann aus seinem eigenen Volk zu begegnen.
An diesem Tag stand das Glück wirklich auf unserer Seite: Der fremde Herr entpuppte sich nicht nur als ein Mitglied des Rhúven-Clans, sondern auch als Kapitän der Kogge, die unter dem schönen Namen Fhéhan glaennis – Schwertlilie – die Weltmeere befuhr.
»Alles, was recht ist«, brummte er, während er meinen Herrn einer akribischen Musterung unterzog, »Ihr behauptet also allen Ernstes, Euer Name sei Ianaeas Léon? Ehrlich gesagt hatte ich eine etwas andere Vorstellung von dem mächtigsten Télgon des Südens.«
»Was Ihr nicht sagt«, entgegnete Ian frostig. »Bedauerlicherweise bin ich nach monatelanger Gefangenschaft und einem schier endlosen Ritt durch die Steppe nicht in der Lage, Euch in drei Lagen Purpur und Hermelin, mit Wappenschild und Banner gegenüberzutreten, um meine Identität zu beweisen.« Er fixierte den Kapitän mit loderndem Blick. »Ich kann Euch nicht mehr als mein Wort und das meiner Begleiter dafür geben, dass ich der bin, der ich zu sein behaupte.«
»Schon gut, schon gut!«, beschwichtigte ihn der Seemann. »So oder so wird es mir ein Vergnügen sein, Euch nach Astragant zu bringen. Immer vorausgesetzt, Ihr könnt die Passage bezahlen.« Er zuckte bedauernd mit den Schultern. »Und wenn Ihr der Kaiser von Jerschewan wäret: Ich habe meine Vorschriften.«
Ians Miene sprach Bände. »Macht Euch darüber mal keine Gedanken«, antwortete er in bemüht sachlichem Tonfall, während er ein paar von Chánans übrig gebliebenen Silbermünzen zückte und dem Kapitän vor die Füße schleuderte.
Wie sich herausstellte, hatte die Mannschaft der Fhéhan glaennis ihren Heimathafen seit über einem Jahr nicht mehr angelaufen und war daher noch gar nicht über den Fall von Tórleon unterrichtet, geschweige denn von Ian und Vílls angeblichem Tod oder der neuerlichen Belagerung der Stadt durch Chárel Léons Verbündete. Sie zeigten sich sehr bestürzt ob der jüngsten Entwicklung der Dinge in ihrem Heimatland, obgleich Avellyn davon nur indirekt betroffen war.
Nachdem er sich die Neuigkeiten mit versteinerter Miene angehört hatte, schlug Kapitän Léas Rhúven (wie bereits an anderer Selle bemerkt, ein recht geläufiger Vorname) einen versöhnlicheren Ton an. Mein Namensvetter erbot sich, unsere Habseligkeiten samt der Pferde im Laufe des Tages an Bord schaffen zu lassen.
»Wir laufen mit der Flut aus, das heißt in den frühen Morgenstunden«, erklärte er. »Ihr habt also noch ein wenig Zeit, Euch die Stadt anzusehen. Vielleicht wollt Ihr auch ein wenig Abschied feiern? Meine Offiziere und ich werden heute Abend in der Kellerassel ein paar Gläschen Wein verkosten.« Er drehte sich um und wies auf ein Wirtshaus, keinen Steinwurf von der Stelle entfernt, an der wir gerade standen. »Wirklich zu empfehlen. Aber trinkt nicht zu viel von Frdeks Pandharischem und haltet euch bloß von seiner zorva fern! Die See im Golf von Astragant ist zwar erfahrungsgemäß ruhig und das Wetter der Jahreszeit zum Trotz erstaunlich stabil, dennoch –«, er lächelte wissend, »wenn man die Schaukelei nicht gewohnt ist …«
Täuschte ich mich, oder sah mein Herr schon jetzt ein wenig fahl und grün um die Nase aus? Sein Bruder jedenfalls wäre am liebsten sofort an Bord gestürmt, um jeden Winkel der Schwertlilie zu erkunden und den Matrosen mit seinen Fragen auf die Nerven zu gehen. Doch da half kein Bitten und Betteln: Der jüngere Léon würde sich bis zum nächsten Morgen gedulden müssen. Stattdessen eilten wir zu unserer Unterkunft zurück, um Chán die guten Neuigkeiten zu überbringen.
Anschließend beschlossen wir, dem Rat des Kapitäns zu folgen und auf Entdeckungen auszugehen.
»Dann sollten wir aber den Palast des hodor besichtigen, ich glaub’, das lohnt sich!«, ereiferte sich Víll und drängte voran, ohne auf unsere Zustimmung zu warten.
Leider kam man nicht wirklich nahe an das gigantische Bauwerk heran. Doch schon aus der Ferne wirkte der Wohnsitz der Herrscher von Tourrh wie eine überdimensionale Schatzkiste, die irgendein Verrückter zusätzlich mit buntem Zuckerguss überzogen hatte. Filigrane Steinmetzarbeiten, goldene Dächer und mosaikverzierte Giebel, Säulen aus rosa Marmor und elfenbeinerne Türknäufe ergänzten die ohnehin überladene, von weitläufigen Parkanlagen umgebene Pracht. Am Palast des hodor fand das überreizte Auge nicht eine Stelle, an der es ein wenig hätte ausruhen können.
»Zu viel des Guten«, urteilte auch Víllian. »Aber die Gärten sind schön.«
Wir gaben ihm recht. Hier gedieh alles, was die Flora im feuchtwarmen Klima des Südens zu bieten hatte: hohe Palmen, Lorbeerbüsche, rote und weiße Oleander, zarte Mimosen, schlanke Zypressen und wuchtige Zedern, ein Spalier von betäubend duftenden Orangen-, Zitronen-, auch Pfirsichbäumen, die sogar noch einige samtige Früchte trugen, Mandel- und Olivenbäume, Kissen von verblühtem Lavendel und Wolken einer blaublühenden Pflanzenart, die keiner von uns kannte. Bunte Vögel sangen in den Wipfeln oder schaukelten auf den Zweigen, Honigsperlinge stritten mit winzigen roten Hörnchen um die überreifen Früchte, wohlgenährte, langfellige Katzenwesen dösten zwischen Brunnen und Bänken, während einige blasiert und gelangweilt wirkende Pfauen über eine spiegelnde Terrasse spazierten.
Selbstverständlich durften wir auch diese Wunder nur aus sicherer Entfernung durch eine Lücke im spitzenbewehrten Eisenzaun betrachten. Die prachtvollen Gärten waren dem gewöhnlichen Volk ebenso wenig zugänglich wie der Palast selbst.
Einige Stunden später, es ging bereits auf Sonnenuntergang zu, holten wir uns in einer Garküche etwas zu essen, machten es uns mitten in der Altstadt auf einer Brunneneinfassung bequem und ließen das Leben an uns vorüberziehen.
Von irgendwoher drang Musik an unsere Ohren, jemand pries mit schrillen Rufen die Qualität seiner Kehrbesen an, ein Gemüsehändler schleppte einen Korb mit angefaulten Kohlblättern zu einem Abfallhaufen in einer dunklen Ecke. Von dort tauchte plötzlich eine Gruppe dunkelhäutiger Akrobaten auf, die menschliche Türme bauten und ihre Glieder auf alle möglichen und unmöglichen Weisen verbogen. Ich hatte gar nicht gewusst, dass man gleichzeitig auf Händen stehen, einen Becher Wasser mit den Füßen anheben und diesen dann auch noch, ohne sich zu verschlucken, austrinken kann. Eine kleine Zuschauermenge versammelte sich um die Artisten und spendete ihnen den gebührenden Applaus. Klirrend landeten einige Münzen auf dem schmutzigen Pflaster.
Für den Augenblick zufrieden mit der Welt, lehnte ich mich an den noch sonnendurchglühten Stein und kramte meine Pfeife hervor, stopfte sie, lieh mir von Víll Flintstein und Zunder und begann genüsslich zu paffen. Ja, dieser Brauch hatte etwas für sich. Es würde mir schwerfallen, darauf zu verzichten, wenn meine Tabakvorräte zur Neige gegangen waren, denn in meiner Heimat würde ich mir jenes Vergnügen nie und nimmer leisten können.
Vielleicht, grübelte ich mit fast geschlossenen Augen, vielleicht sollte ich ins Tabakgeschäft einsteigen … ein Schmuggler werden, wie Erejk in seiner wildbewegten Jugend. Aber im ganz großen Stil. Ich werde regelmäßig nach Tourrh und Pandhara reisen, bestes Kraut organisieren und das Rauchen im Ríen Fanuchíl so richtig populär machen. Schließlich gilt es als überaus gesund – ein wahrer Jungbrunnen für Herz, Lunge und Zeugungsorgane, wenn man den Ärzten Glauben schenken mag.
Ian war meinem Beispiel ohne Zögern gefolgt. Seine Schwester döste, müde vom Herumlaufen, den Kopf an seine Schulter gelehnt. Die letzten Sonnenstrahlen ließen ihr dunkles Haar aufleuchten und übergossen ihre Wangen mit einem zarten Schimmer.
Ach, Chán …, seufzte ich stumm. Zwar habe ich meinen geliebten Herrn wieder, dafür bist du mir jetzt ferner, als er es jemals war.
Menschen aller Rassen und Nationen flanierten an uns vorbei. Manche bestaunten uns kurz, andere gingen achtlos ihren Geschäften nach. Ein paar Soldaten passierten den Brunnen. Nur ein einzelner Mann, den die Uniformierten wohl begleitet hatten, blieb stehen und rührte sich nicht mehr von der Stelle. Durch meine halbgeschlossenen Lider erspähte ich ein ausgesprochen teures Paar Stiefel und seidene Beinkleider. Etwas wie eine undeutliche Erinnerung regte sich in mir. Doch bis ich mich endlich dazu durchgerungen hatte, mich träge aufzurichten, hatte sich der Mensch bereits umgedreht und war mit seiner Begleitung in der Menge verschwunden. Ich nahm einen tiefen Zug aus meiner Pfeife, rüttelte mich wieder in eine möglichst bequeme Position und vergaß die Episode augenblicklich.
Die Dämmerung fiel rasch und war nur von kurzer Dauer.
Chánan klagte über Kopfschmerzen und war dermaßen erschöpft, dass sie es vorzog, sich sofort in Rolvas Begleitung zu unserer Kabine auf dem Schiff zu begeben, statt vorher noch einen zu heben.
In der Kellerassel trafen wir richtig mit Kapitän Léas Rhúven und einigen seiner Offiziere zusammen, die sich bereits an dem wirklich hervorragenden Rebensaft labten. Bald waren wir mit den Seeleuten in ein angeregtes Gespräch vertieft, sodass wir gar nicht merkten, wie die Zeit dahinflog.
Irgendwann war der Rotwein wohl zur Gänze durch meinen Organismus gesickert, denn es überkam mich ein dringendes Bedürfnis. Der Wirt deutete auf eine halb hinter Fässern und Tonkrügen versteckte Pforte zum Hinterhof. Ich schlängelte mich vorsichtig zwischen all den Gerätschaften in die Dunkelheit hinaus, pfiff mir eins und bewunderte das von Sternen übersäte Himmelszelt, während ich mich erleichterte.
Ich hatte die Hosen noch kaum wieder hochgezogen, als mich ein metallischer Laut erstarren ließ. Oh, ich kannte dieses Geräusch nur allzu gut: Jemand hatte ein Schwert oder eine errouh aus der Scheide gezogen! Wie der Blitz wirbelte ich herum und da war er – waren sie auch schon über mir: vier, fünf, sechs, sieben, du lieber Himmel! Hatten die etwa die ganze Zeit über im Finsteren darauf gewartet, dass ein betrunkener Gast zum Austreten aus der Taverne torkeln würde, um ihn dann hier auszurauben? Ich war gerade dabei, den Mund zu öffnen, um einen kleinen Zauber zu wirken und gleichzeitig meine Freunde auf meine Lage aufmerksam zu machen, als ich einen der Angreifer erkannte. Vor lauter Verblüffung vergaß ich doch glatt zu brüllen: teure Kleidung, gepflegtes Blondhaar, ein öliges Grinsen auf dem tätowierten, fast weißhäutigen Gesicht.
»Na, madûsh, erinnerst du dich an mich?« Seine Stimme besaß genau die Art von butterweichem Klang, den ich stets verabscheut hatte.
»Ma … Ma … Maharan«, stotterte ich, immer noch ziemlich verdattert.
»Allerdings. Damals in Erkarin hattest du mich ja reichlich blamiert und beleidigt. Dabei hatte ich dir ein faires Angebot gemacht. Heute bin ich nicht gekommen, um zu verhandeln, Lügenmeister. Du wirst tun, was ich verlange, oder es bitter bereuen!«
Statt einer Antwort warf ich die Arme in die Luft und ließ siedendes Öl auf meine Angreifer hernieder regnen – oder sagen wir mal, ich ließ sie glauben, dass ihnen kochend heiße Fetttropfen auf Köpfe und Schultern prasselten. Kreischend vor Schreck und Panik ließen die Schurken von mir ab, um sich vor dem tödlichen Niederschlag in Sicherheit zu bringen. Während sie in alle Richtungen auseinanderstoben, schlenderte ich seelenruhig zur Schankstube zurück, wo Víll gerade einen seiner selbstgeschmiedeten Knittelverse zum Besten gab.
»Was war denn da draußen los?«, wollte Ian wissen. »Hat da nicht jemand geschrien?«
Von einem Augenblick zum nächsten entschied ich, meinen Freunden nichts von dem Angriff zu erzählen. Schließlich war mir nichts passiert, Maharans Bluthunde waren geflohen und außerdem wollte ich meinem Herrn nicht noch mehr Sorgen auf die Schultern laden, als er ohnehin schon mit sich herumschleppte. Daher schwindelte ich ihm etwas von liebestollen Katern auf dem Hof vor und drängte zum Aufbruch.
»Er hat recht«, nickte der Kapitän. »Es ist spät geworden und wir müssen früh wieder raus. Meine Matrosen haben schließlich auch nur bis Mitternacht Landurlaub. Ich muss ihnen mit gutem Beispiel vorangehen.«
»Ach, kommt, ihr Spielverderber!«, protestierte Víll. »Wenigstens noch eine Absackerrunde! Dieser Wein ist einmalig, euer brackiges Wasser an Bord dagegen werdet ihr noch lange genug schlürfen müssen.«
Widerstrebend nahm ich meinen frisch aufgefüllten Becher zur Hand und tat es meinen Freunden gleich, die einen Trinkspruch auf dieses Land und seine Einwohner ausbrachten, gleichzeitig aber ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, es so bald nicht wiederzusehen.
Ich stand mit dem Rücken zum Eingang, als die Tür lautstark und mit viel mehr Kraft als notwendig aufgestoßen wurde. Das Holz krachte gegen die Wand, von der eine gute Handvoll Putz abbröckelte. Víll erschrak, verschluckte sich und prustete seinen Wein über die Theke. Etwas weiter entfernt gab Ian ein überraschtes »Léas, hast du das ges…« von sich.
Dann brach plötzlich die Hölle über die kleine Spelunke herein. Im Handumdrehen wimmelte die Schenke von vermummten Kerlen, die ohne Vorwarnung begannen, die Einrichtung kurz und klein zu schlagen und mit Fäusten und Stöcken auf die Zecher einzuprügeln. Der Wirt und sein Bursche hechteten hinter den Tresen, andere Gäste flohen in Richtung »Klotür«, wieder andere, wie meine Freunde und Rhúvens Matrosen, gingen augenblicklich zur Verteidigung über.
Mir war sofort klar, dass das Überfallkommando keineswegs ungezielt auf die Anwesenden eindrosch: Mit den Hieben versuchten sie, möglichst viele Gäste zu verscheuchen oder außer Gefecht zu setzen. Kaum aber hatte sie meine Freunde erspäht, kamen errouhud und Messer zum Vorschein.
»O bitte, bitte, keine Waffen in meinem Haus!«, flehte der Wirt in seinem Versteck. »Alle guten Geister, warum alarmiert denn keiner die Hafenwache?«
Ich setzte über einen umgestürzten Tisch hinweg, stieß einen kleinen, fetten Kerl beiseite, kickte einen anderen in sein verlängertes Rückgrat, boxte einem dritten auf seine ohnehin platte Tourrhanernase und stieß dabei mit der Stimme der Macht die schaurigsten Verwünschungen aus. Allein, es rührte sich nichts! Nichts! Die verhüllten Gestalten drangen weiter auf die Gäste ein, ja, ich musste sogar mit ansehen, wie sich drei von ihnen auf Víllian stürzten und ihm ihre Dolche an die Kehle setzten.
Entgeistert hielt ich inne. Hatte ich meine Zauberkräfte irgendwie eingebüßt? Ein Blick auf die unschuldigen Trinker und den Wirt bewies mir das Gegenteil: Die hatte mein Bann getroffen, der an den Halunken offensichtlich abgeperlt war. Wie war das nur möglich?
Unterdessen hatte Víll seinen erbitterten Widerstand aufgegeben, während sein Bruder sich mit mehreren Kerlen auf dem Boden wälzte. Ich erhielt einen Schlag in die Magengrube, der mir für einige Sekunden die Luft benahm. Sobald die Sterne vor meinen Augen davongeflimmert waren, unternahm ich einen weiteren Versuch: »Sofort aufhören!«, schrie ich mit der Stimme und –- wurde ignoriert! Als hätte ich es mit Sechsarmern statt mit menschlichen Wesen zu tun!
Erst als die Angreifer eindeutig die Oberhand gewonnen hatten, legte sich der Lärm und es kehrte ein wenig Ruhe ein. Einer der Maskierten trat auf Víll zu, nahm einem seiner Freunde den Dolch, ein langes, schmales Ding, aus der Hand und drückte dem jüngeren Léon die Spitze aufs rechte Auge. Gleichzeitig nahm er das dunkle Tuch vom Gesicht. Es überraschte mich nicht sonderlich, Maharan Fedin vor mir zu sehen.
»Wirf das Messer weg!«, befahl ich ihm, außer mir vor Wut. »Und lass meinen Freund los, sonst wirst du mich kennenlernen!«
Ich sah, wie seine Hand, die den Dolch hielt, unmerklich zu zittern begann. Aber er schaffte es, wie auch immer, meinem Willen zu widerstehen, blickte mir geradewegs in die Augen und feixte: »Nicht nötig. Ich kenne dich schon. Ich weiß alles über dich, Lügenmeister! Aber ich kann dich nur sehr schwer hören, verstehst du? Meine Männer und ich haben uns die Ohren mit Wachs versiegelt, bevor wir hierher zurückkamen.« Sein Ausdruck änderte sich schlagartig. »Und nun wirst du meine Befehle befolgen!« Er hob gebieterisch eine Hand, als ich ihm widersprechen wollte. »Der erste lautet: Halt den Mund! Schweig, bis ich dir wieder erlaube zu sprechen.«
Maharan wies mit seinem Kopf auf das Stilett, dessen Spitze Víllians Lid ritzte. »Dein erstes Wort kostet ihn sein rechtes Auge. Das Gleiche geschieht, sollte es hier gleich anfangen, Schlangen und grünes Gift zu hageln! Oh, ich weiß natürlich, dass deine Trugbilder vollkommen harmlos sind, doch konnte ich meine Leute bislang noch nicht so ganz davon überzeugen. Drum lass es bleiben!«
Ich ließ den Kopf sinken. Meine Gabe verriet mir, dass er es bitterernst meinte. Er würde nicht zögern, seine Drohung wahr zu machen.
So leicht kann man also einen Lügenmeister überrumpeln: Man muss sich nur die Ohren verstopfen!, meldete sich mein innerer Kommentator voller Hohn zu Wort. Geradezu lächerlich einfach!
Dem hatte ich nichts entgegenzusetzen.
»Na, was ist?«, drängte der Prinz mit seiner unangenehmen Stimme, die mich aus unerfindlichen Gründen an Hirsebrei erinnerte: weich, warm und irgendwie klebrig süß.
Víll versuchte verzweifelt, seinen Kopf von der grausamen Messerspitze wegzudrehen, während Ian am Boden kauerte und sich den Kopf hielt. Die Gildenleute und die Gäste, die es gewagt hatten, Widerstand zu leisten, standen, Hände auf dem Scheitel, mit dem Gesicht zur Wand.
Ich nickte mit zusammengebissenen Zähnen.
Einer der Vermummten kam mit einem seltsamen metallenen Gegenstand auf mich zu, der mir nicht gefallen wollte. Ein wenig erinnerte das Ding an einen Maulkorb für besonders große, bissige Hunde. Maharan hatte doch nicht etwa vor – oh doch, genau das!
Blitzschnell hatte ich das Handgelenk des Mannes gepackt und es auf genau jene äußerst schmerzhafte Weise verdreht, die mir Meister Benga für solche Fälle beigebracht hatte.
Der Mann jaulte auf, scheppernd landete das eiserne Ding auf dem Boden. Dennoch ließ ich seinen Arm nicht los. Ich war weißglühend vor Zorn. Es hätte nicht viel gefehlt und ich hätte dem armen Kerl die Hand gebrochen. Ein halb unterdrücktes Keuchen von Víll brachte mich zur Vernunft. Maharans Messer drückte sich langsam aber sicher in seinen Augapfel. Mit einer unausgesprochenen Verwünschung stieß ich den Kerl von mir weg.
Verflucht, verflucht, verflucht!, wetterte ich stumm.
»Brav, brav«, lobte der Prinz. »So kommen wir weiter. Wenn du dir jetzt genauso folgsam meinen patentierten Knebel sowie diese schönen Armbänder anlegen lässt und mir nach draußen folgst, dann, aber auch nur dann, wird hier niemandem etwas geschehen. Die tapferen Seemänner kehren auf ihr schönes Schiff zurück und unser Wirt braucht nicht länger um den noch brauchbaren Rest seines Mobiliars zu bangen.« Er äugte höhnisch grinsend auf Vílls Gesicht herab, auf dem sich eine Mischung aus Empörung und Furcht spiegelte. Ich konnte die Schimpfworte förmlich hören, die ihm auf der Zunge lagen, doch eine Klinge knapp vorm Auge war sogar für den jungen Léon ein gewichtiges Argument, sie nicht auszusprechen.
»Das bezopfte Knäblein hier nehmen wir mit, um unseren madûsh zur Mitarbeit zu motivieren.«
Ian machte Anstalten, sich auf den Prinzen zu stürzen, doch schaffte er es kaum, sich aufzurichten. Aus einer geplatzten Augenbraue rann ihm Blut in hellroten Bächen über die Wangen.
Hatte ich jemals zuvor so vor ohnmächtiger Wut gekocht? Vermutlich. Doch diesmal haderte ich vor allem mit mir selbst. Ich hätte einen solchen Fall vorhersehen und mich rechtzeitig dagegen wappnen müssen! Schlimm genug, von einem tätowierten Pinkel aufs Kreuz gelegt zu werden, jetzt musste ich es mir auch noch gefallen lassen, dass man mir dieses schändliche Ding ins Maul schob, es festzurrte und abschloss. Zugegeben, es erfüllte seinen Zweck. Die Zunge wurde damit so weit an den Gaumen gedrückt, dass es einem unmöglich gemacht wurde, mehr als ein unverständliches Brummen von sich zu geben. Ich war so aufgewühlt, dass ich kaum mitbekam, wie man mir die Arme an den Ellbogen zusammenband.
»Lauf zum Schiff!«, rief Víll seinem immer noch benommenen Bruder zu, als man ihn fortschleppte. »Bring Chánan nach Hause und gib Vetter Chárel in meinem Namen einen Tritt in den Hintern! Mach dir um uns keine Sorgen, wir kommen schon zurecht!«
Dieser Aufforderung schloss ich mich von ganzem Herzen an.
Vor der Tür warteten drei Kutschen. Ich riss meine Augen auf: edelste Pferde, samt und sonders Rappen aus bester tourrhanischer Zucht, die Wagen gefertigt aus feinstem Holz mit Einlegearbeiten aus Ebenholz und Elfenbein, Sitzpolster aus Brokat und Leder, das mit einem Duftöl beträufelt worden war. Dazu ein immer noch grinsender Maharan Fedin, der sich den Rest seiner Maskerade vom Kopf wickelte und das Wachs aus den Ohren pulte.
Kaum hatte er mir gegenüber Platz genommen, da kletterte der schöne Knabe zu uns in die Kutsche, der ihm in Erkarin die errouh nachgetragen hatte, und begann ihm das künstlich gewellte Blondhaar zu ordnen. Der Prinz schlug geziert ein Bein übers andere und gab den Befehl zur Abfahrt.
»Also«, er beugte sich vor und blinzelte mich bedeutsam an, »du weißt hoffentlich noch, was ich von dir erwarte?«
Ich schloss gequält die Augen und ließ meinen Kopf in die duftenden Kissen sinken.
»Wirst du mir helfen, meinen Großvater davon zu überzeugen, dass ich der geeignetste Kandidat für seine Nachfolge bin?«
Ich gab mir einen Ruck, richtete mich wieder auf und schüttelte so heftig den Kopf, dass das Schloss an meinem »Maulkorb« wie wild klapperte.
»Schade.« Der Prinz zog eine enttäuschte Schnute. »Aber wir stehen ja erst am Anfang unserer Verhandlungen, Meisterschwindler – Léas, richtig?« Er drehte sich von mir weg, um seinem Sklaven auf die Finger zu klopfen, weil der zu grob mit dem Kamm an seinen Haaren gezerrt hatte. Dabei redete er unablässig weiter: »Morgen früh schicke ich dir ein Auge deines niedlichen Freundes und dann frage ich dich noch mal. Lautet deine Antwort wieder nein, kriegst du die Nase, dann einen oder zwei Finger und so weiter und so fort.«
Mir war schlecht. Wie hatte Kahalor sich ausgedrückt: diese Stadt sei verkommen? Wenn sie Kreaturen wie diesen widerlichen Adelsspross hervorbrachte, war sie es wert, dass man sie niederbrannte, ihre Mauern schleifte und ihre Geschichte aus der Erinnerung der Menschen tilgte.
Wir hätten auf Ian hören und den Weg über die Márchen wählen sollen, dachte ich verbittert. Nie, nie, nie hätten wir nach Varabor kommen dürfen!
»Ich sehe, du bist dabei, deine Haltung zu überdenken«, stellte Maharan befriedigt fest. »Sehr gut. Für einen Mann mit deinen Fähigkeiten dürfte die Aufgabe leicht zu bewältigen sein.« Er faltete seine gepflegten Hände im Schoß und lächelte entgegenkommend. »Ich bin auch nicht undankbar, obwohl ich dich jetzt zur Zusammenarbeit überreden muss. Wenn alles zu meiner Zufriedenheit erledigt ist, werden du und dein Freund als reiche Männer davonsegeln.« Er untermalte das letzte Wort mit einer imitierten Wellenbewegung. Ich aber hatte die Lügen hinter seinen Worten so deutlich vernommen, als habe er laut verkündet: »Freilich, wenn ich einst hodor bin, kann ich keine Zeugen meiner vergangenen Schandtaten gebrauchen!«
Du solltest erst mal lernen, wie man überzeugend lügt!, sinnierte ich verächtlich. Auf diesem Gebiet kannst du von mir noch einiges lernen und das wirst du – auf harte und schmerzhafte Weise, das verspreche ich dir!
Die Kutschen kurvten in einem Höllentempo durch die südliche Nacht. Zunächst rollten die Räder über uraltes Pflaster, später kratzten sie an Feldsteinen entlang, ruckelten durch ausgefahrene Rinnen und holperten über Wurzeln und Gräben. Offenbar hatten wir Varabor verlassen. Ich bemühte mich, an dem Mann und dem Jungen vorbei einen Blick aus dem Fenster zu erhaschen. Ein schwacher Duft nach vergorenem Obst mischte sich mit dem frischen, salzigen Wind, der in den letzten Stunden vom Meer her aufgekommen war. Maharan registrierte meine Verrenkungen und gab mir bereitwillig Auskunft: »Wir fahren zu einem meiner Landhäuser. Es wird dir gefallen, denn es liegt an einer wildromantischen Steilküste, weit ab vom städtischen Getriebe. Drumherum nichts als ausgedehnte Weinberge, Melonen- und Tabakfelder.«
Was ich später von Maharans Villa zu sehen bekam, hätte mir unter anderen Umständen tatsächlich gut gefallen. Im Moment aber hatte ich weder Augen für die reizvolle Lage noch für die interessante Architektur oder den von uralten, riesenhaften Zedern beschatteten Garten.
Im Abstand von wenigen Minuten tauchten die beiden anderen Wagen aus der Dunkelheit auf, verlangsamten ihr Tempo und wurden schließlich mit lautem »Brrrr!« im gepflasterten Innenhof des Gutes angehalten. Ihnen folgten noch zahlreiche Vermummte zu Pferd nach, die in den Kutschen keinen Platz mehr gefunden hatten. Insgesamt zählte ich fünfundzwanzig Mann, den Prinzen und seinen kleinen Sklaven nicht mitgerechnet. Wie viele Männer er im Inneren des Hauses noch zu seiner Verfügung hatte, konnte ich nicht mal abschätzen.
Hätte ich doch nur ein einziges Wort sprechen dürfen! Dann hätte mich auch eine dreimal so große Schar Leute nicht geschreckt.
In diesem Augenblick kam Víll hinter der Tür der letzten Kutsche zum Vorschein. In einer wilden Mischung aus Herausspringen und Gestoßenwerden purzelte er mir vor die Füße. Mit so viel Würde wie möglich rappelte er sich auf, klopfte sich den Staub von den Kleidern und warf den zerzausten Zopf über die Schulter zurück. Irgendwie wirkte mein Freund wie ein empörtes Gänseküken in der ersten Mauser.
Der Prinz fasste meinen Arm und zog mich ganz nah an sich heran. »Wenn du mir schwörst, keine dummen Tricks zu versuchen, darf der Langhaarige bei dir bleiben. Nimm meine Warnung bitte ernst! Denk dran: Er, nicht du, wird es sonst ausbaden müssen. Dich brauche ich schließlich noch, dein Freund aber ist mir so gleichgültig wie Fliegendreck auf der Wand.« Er lächelte sanft. »Tu nicht so unbeteiligt! Es fällt mir schwer zu glauben, dass du nach all dem, was du durchgemacht hast, um ihn zu finden, es vorziehst, ihn in handlichen Einzelteilen nach Hause zu schaffen.«
Ich gab ihm durch ein Nicken zu verstehen, dass ich mit allem einverstanden war, und trabte gehorsam hinter ihm her.
Das Haus war aus einem grob behauenen, rötlichen Stein erbaut. Im Inneren herrschte nach der kühlen Nachtluft draußen behagliche Wärme, die von einer gewaltigen Feuerstelle in der Küche herrührte. Ich konnte einen kurzen Blick in einen länglichen Raum mit rußgeschwärzten, dicken Balken und verschiedenen Sitzpolstern werfen, bevor man mich in ein enges Treppenhaus mit ausgetretenen Stufen scheuchte. Ein niedriges Pförtchen sprang auf und für den Bruchteil einer Sekunde glaubte ich das erschrockene Gesicht einer jungen Frau zu erblicken, auf das Schatten und Kerzenschein ein unregelmäßiges Muster malten.
»Willkommen«, sagte Maharan gedehnt, während er eine schwere, eisenbeschlagene Tür entriegelte. »Hier werdet ihr heute Nacht schlafen.« Er nickte mir zu. »Morgen fahren wir beide nach Varabor zurück, wo ich dich bei Hofe einführen werde. Danach kannst du dir einen Plan zurechtlegen und dich so bald wie möglich an die Arbeit begeben.«
Er tänzelte zu einem wackeligen Tischchen, auf das er die Öllampe, die er bis jetzt in der Hand getragen hatte, niederstellte. Meine Blicke glitten über ein gemauertes Podest an der kurzen Wand, auf dem einige Polster, Decken und Felle in einem wilden Durcheinander lagen, einen Schemel mit einer Waschschüssel und einem Wasserkrug und den besagten niedrigen Tisch, wo außer der Lampe eine Platte mit Früchten, etwas Brot und Käse sowie eine Karaffe mit Wein zu finden war.
Vílls Augenmerk hatte sofort dem Fenster gegolten. Aus zusammengekniffenen Lidern schätzte er die Stärke des eisernen Fensterkreuzes ab und überlegte, ob es gar möglich wäre, sich durch die Lücken zwischen den Stäben zu quetschen. Auch Maharan waren diese Blicke nicht entgangen. Der Prinz lächelte überlegen. Mit ausgesuchter Höflichkeit bat er uns, näher zu treten. Ich machte einen Schritt auf das Fenster zu – und wiederum drei zurück. Freilich, Maharan hatte eine Steilküste erwähnt, doch dass es direkt hinter seinem Haus mehrere hundert Klafter senkrecht in die Tiefe ging, hatte er mir verschwiegen.
Blitz und Donner, auf das Gitter vor dem Fenster hätte man wahrhaftig verzichten können!
»Gute Nacht!«, wünschte uns Maharan mit spöttischem Augenaufschlag und wandte sich zum Gehen.
»Mo-ment!«, platzte Víll heraus. »Bevor du verschwindest, wirst du meinem Freund dieses grässliche Folterinstrument abnehmen, oder …«
»Oder was?«, lachte der Prinz. »Nein, ich halte es für gescheiter, ihn den Maulkorb noch eine Weile tragen zu lassen. Zu meiner und vor allem deiner Sicherheit, junger Mann.« Er streckte einen manikürten Zeigefinger aus und brachte damit das Vorhängeschloss zum Schaukeln. »Großartige Erfindung, nicht? Ursprünglich war es als ein Mittel gegen andauerndes nächtliches Schnarchen gedacht. Habe es zu einem Spottpreis von einem Hausierer erworben, zu einem Kunstschmied gebracht und einige Verbesserungen vornehmen sowie ein Schloss anbringen lassen. Ich muss gestehen, dass ich von meiner eigenen Idee geradezu hingerissen bin.«
Vílls Ohren entwickelten schon wieder ihren gefährlichen Violett-Ton. Mit mehr Selbstbeherrschung, als ich ihm zugetraut hätte, rang er den sich ankündigenden cholerischen Anfall nieder und verlangte mit betont ruhiger Stimme: »Dann schneide ihm wenigstens die Fesseln durch!«
»Wieso denn ich?«, fragte der Prinz und tätschelte ihm leutselig die Wange. »Hast du nicht, noch, zehn gesunde Fingerchen und eine ganze Nacht lang Zeit? Viel Vergnügen beim Aufknoten!«
Die Tür fiel hinter ihm ins Schloss, der Riegel wurde knarzend vorgeschoben und wir waren alleine.
Augenblicklich war Víll zur Stelle, rüttelte aller Vernunft zum Trotz an der Klinke, linste durchs Schlüsselloch, wich zurück, als er sich Auge in Auge mit einer grimmigen Wache sah, und versetzte der Tür schließlich einen wütenden Tritt. Ich stampfte mit dem Fuß auf, um seine Aufmerksamkeit zu gewinnen.
»Ach so, ja!«, machte er. »Entschuldige, alter Junge.« Mit zwei raschen Schritten war er bei mir und kämpfte mit den Riemen, die meine Arme zusammenschnürten. Das verlangte ihm so viel Konzentration ab, dass seine Zunge zwischen den Zähnen hervortrat. Nach fast einer Viertelstunde vergeblicher Mühe blaffte er mich entnervt an: »Hast du da etwa selbst schon dran ’rumgezerrt? Das ist Leder, du Schafskopf! Da bleibt man verdammt noch mal schön still sitzen, damit sich die Knoten nicht noch straffer zuziehen! Mensch, ich brech’ mir noch sämtliche Fingernägel ab!«
Ich konnte nur hoffen, dass meine Blicke genau das zum Ausdruck brachten, was ich in jenem Moment am liebsten erwidert hätte.
Endlich hatte Víll seine schweißtreibende Arbeit beendet. Erleichtert streckte ich beide Arme aus. Víll betrachtete unterdessen den »Maulkorb« interessiert von allen Seiten. »Kann nicht behaupten, dass dich das Ding besonders ziert«, frotzelte er. Halbherzig fingerte er daran herum, riss dann plötzlich ruckartig am Schloss. Ich gab einen Schmerzenslaut von mir und schlug seine Hände weg. Hatte er vor, mir die Kiefer zu brechen, um das Teil abzukriegen? Fieberhaft begann ich mit der Suche nach einem »Irgendwas«, das man als Dietrich benutzen konnte. Doch Maharan war nicht dumm und diese Entführung gut vorbereitet. Es fand sich absolut kein brauchbares Werkzeug, kein Löffel, kein Nagel, kein gar nichts. Allein durch meine Willenskraft würde ich weder das Vorhängeschloss an meinem Mund, noch den schweren Riegel vor der Tür beseitigen können, dazu reichten meine Kräfte nicht aus. Außerdem hatte ich dem Prinzen um Víllians willen mein Wort gegeben: keine Tricks.
Víll las mir die wachsende Verzweiflung von den Augen ab. »Komm, hör auf, das hat keinen Zweck.« Er schob mir ein Kissen unter den Hintern und drückte mich mit sanfter Gewalt darauf nieder. »Fürchte, wir werden auf den Edelmann mit der bunten Stirn und sein Schlüsselchen warten müssen.« Misstrauisch schnüffelte er an der Karaffe. »Noch mehr Rotwein! Ich gäbe was für ein Glas herbes, dunkles Bier, das kann ich dir flüstern, mein Freund.« Nichtsdestotrotz füllte er etwas von der granatroten Flüssigkeit in zwei irdene Becher. Resigniert zog ich einen davon zu mir heran, legte die Hände darum und hob ihn an. Mitten in der Bewegung hielt ich inne. Wie sollte man mit diesem Höllenapparat im Mund etwas trinken?
Ich legte den Kopf auf meine Arme und gab mich endgültig der Verzweiflung hin.
Hilfe, ich ersticke!
Hustend und röchelnd, mit wild rudernden Armen und Beinen erwachte ich.
Was, um Himmels willen, ist das?, dachte ich voller Panik. Und – wo bin ich? Für einen kurzen Moment war ich überzeugt, ich sei mitten in der Steppe, in der allergrößten Mittagshitze, eingeschlummert. Mein Mund war voller Staub, doch sooft ich versuchte, den pappigen Klumpen auszuspucken, hatte ich direkt eine neue Ladung zwischen den Zähnen. Dann schoss ich in die Höhe, rieb mir die Augen – und erinnerte mich.
Unser Gefängnis war in helles Morgenlicht getaucht, das in Begleitung einer feucht-frostigen Brise von der See durchs scheibenlose Fenster herein flirrte. Ein gutes Dutzend Lachmöwen veranstaltete auf den Klippen unter dem Haus ein Höllenspektakel. Es hörte sich an wie der Feiertagsausflug eines Irrenhauses.
Vorsichtig tastete meine Rechte nach meinem Gesicht. Der Eisenknebel saß unverrückbar fest an seinem Platz. Ich war entsetzlich durstig und hatte einen Geschmack im Mund, als hätte ich aus der Speisekammer der Sechsarmer genascht. Verdrießlich schlüpfte ich in meinen Kittel und die weiten Leinenhosen und blickte mich suchend nach Víllian um, der irgendwo hinter meinem Rücken rumorte. Wasser plätscherte und spritzte auf. Der junge Léon summte leise vor sich hin, während er in aller Ruhe seine Morgentoilette verrichtete. Schließlich trat er in mein Blickfeld: frisch gewaschen, gekämmt, mit säuberlich geflochtenem Zopf und einem breiten Grinsen auf dem rosig gerubbelten Gesicht. Auf einer Handfläche balancierte er einen kleinen Brocken Seife, warf ihn unvermittelt in die Luft und fing ihn geschickt wieder auf, bevor er ihn mir unter die Nase hielt.
»Parfümiert. Lavendel. Fürchte, ich rieche wie meine eigene Großmutter. Die ist übrigens seit fünf Jahren tot und dürfte daher ohnehin nicht mehr besonders lecker riechen, aber zu Lebzeiten …«
Ich funkelte ihn bitterböse an. Víll stutzte, dann zog er ebenfalls ein Gesicht – eine gekonnte Karikatur meiner eigenen Leichenbittermiene. Da hatte ich plötzlich eine Eingebung. Ich pflückte die Seife von Vílls Handfläche und stürzte zur Waschschüssel, wo ich ein walnussgroßes Stück davon abbrach, das ich gut einweichte. Dann verteilte ich die schaumige Pampe großzügig zwischen dem »Maulkorb« und meinen Wangen.
Víllian beobachtete kopfschüttelnd meine Aktivitäten. »Das klappt nie und nimmer. Wenn du versuchst, den Knebel nach vorn herauszuhebeln, brichst du dir die Schneidezähne ab, und auf dem Weg nach hinten ist dir deine lange Ravenskell-Nase im Weg.« Und genauso war’s, zum Kuckuck! Zu alledem hatte ich jetzt auch noch den Mund voller Seifenlauge und das Gefühl, ein Lavendelfeld gefressen zu haben!
»Immerhin«, feixte mein Freund, »hast du tatsächlich nicht ein einziges Mal geschnarcht heut’ Nacht!«
Noch ein Wort und ich erwürge ihn! Stumm tobend wusch ich mir Hände und Gesicht, so gut es eben ging, ordnete meine Kleidung und gesellte mich dann zu ihm an den Tisch, wo Víll Brot, Früchten und Käse bereits eifrig zugesprochen hatte.
»Ich hatte halt Hunger!«, entschuldigte er sich mit bekümmertem Blick. »Du hast so tief und fest geschlafen, da hab’ ich mir gesagt: Víll, mein Junge, iss und trink lieber jetzt, so viel du kannst, damit dir der arme Léas nachher nicht dabei zuschauen muss.«
In einem Anfall von Jähzorn fegte ich die Obstschale vom Tisch und schmetterte die leere Weinkaraffe gegen die Wand. Danach war mir ein wenig, ein ganz klein wenig, wohler.
Wir müssen miteinander reden, wurde mir klar. Gibt es hier denn nichts, womit man schreiben kann?
Nein, nichts. Kein Papier, keine Tinte, keine Holzkohle, Kreide oder was auch immer. Nicht einmal die Tonscherben des Weinkrugs eigneten sich dazu. Maharan hatte offensichtlich beschlossen, es uns so schwer wie möglich zu machen, miteinander zu kommunizieren.
Mitten im angestrengten Grübeln (was mir in dieser Situation unheimlich schwer fiel, da ich nicht in der Lage war, auf meinen Knöcheln herumzubeißen) fiel mein Blick auf die Gürteltasche, wo ich wie alle meine Landsleute stets ein kleines Döschen mit wertvollem Salz stecken hatte. Mit fahrigen Fingern klappte ich den Deckel auf, kippte den Inhalt auf die Tischplatte, verteilte die kristalline Substanz und glättete sie mit der flachen Hand. Dann tauchte ich meinen kleinen Finger hinein und schrieb als Erstes: Du Ungeheuer! (Dick unterstrichen.)
Víllians Grübchen blitzten auf. »Gute Idee. Hätte von mir sein können.« Plötzlich wurde er ernst. »Jetzt verrat’ mir doch mal, was der Schnösel von dir will.«
Das Salz gab ihm die Antwort und setzte ihn darüber hinaus über das Dilemma in Kenntnis, in dem ich steckte. Er klopfte mir beruhigend auf die Schulter. »Gib dem parfümierten Krötenarsch bloß nicht nach, Léas! Wir sind im Handumdrehen hier ’raus, du wirst schon sehen, ob mit deiner Zauberkunst oder ohne. Zur Not packe ich ihn an seinen künstlich gekrausten Löckchen und lasse ihn aus dem Fenster baumeln, bis sein Haar wieder so glatt und ölig ist wie seine Zunge. Was meinst du dazu?«
Ich bin sprachlos, redete ich, nicht ohne Selbstironie, durch das Salz zu ihm.
Víll besaß den Anstand zu erröten.
Außerdem bezweifle ich, dass wir ihn werden überrumpeln können. Die Villa ist vom Keller bis zum Dachgeschoss vollgestopft mit Maharans Schergen und aus dem Fenster da –, ich drehte mich um und wies in die entsprechende Richtung, werde ich ganz bestimmt nicht (dreimal unterstrichen) klettern. Ich hob die Hände und ließ sie wieder fallen. Es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als mich zum Schein auf diesen Kuhhandel einzulassen. – Und du tust nichts, hörst du, gar nichts (in Großbuchstaben), außer dem, was man dir sagt! Versprochen?
»Bei meinem Schatten!«, tönte Víll und nickte wild.
Mit einem schabenden Geräusch wurde die Tür entriegelt. Unsere Köpfe ruckten gleichzeitig in die Höhe.
Der Prinz trat auf, eingehüllt in eine golden und blau abgesetzte Robe, in den seidenen Beinkleidern, die mir schon in der Stadt aufgefallen waren (hätte ich Trottel ihnen nur mehr Beachtung gezollt!), einem silberbeschlagenen Gürtel und dem schimmernden Helm, den er in Erkarin getragen hatte. Eskortiert wurde er von mehreren uniformierten Tourrhanern sowie einem glatzköpfigen Riesen mit rotbrauner Haut, der mit überkreuzten Armen in der Tür stehen blieb. Maharans kritischer Blick wanderte von mir über meinen Freund zu den zu Boden geworfenen Lebensmitteln, dem zerbrochenen Geschirr und meinen Buchstaben im Salz. Es war kaum anzunehmen, dass der Prinz Valchállas lesen konnte, dennoch löschte ich die Botschaft rasch mit meinem Ärmel aus.
»Ich entschuldige mich für all die Unannehmlichkeiten«, sagte der Prinz mit schlecht kaschierter Schadenfreude. »Aber ich dachte mir, deine Kooperation wird noch leichter zu gewinnen sein, wenn du ein wenig hungrig und durstig bist.«
Bei diesen Worten hielt es Víll nicht länger auf seinem Kissen. Mit glühenden Ohren grabschte er nach der Hälfte einer überreifen Honigmelone und schleuderte diese Maharan mitten ins Gesicht. Es klatschte und spritzte nicht schlecht, als sich dessen kleine, vornehme Nase ins Fruchtfleisch bohrte. Der Prinz sah plötzlich aus wie ein großer, verrückt ausstaffierter, blonder Affe. Leider war uns jener erhebende Anblick nur einen Lidschlag lang vergönnt, dann plumpste die runde Halbschale herab. Gelber Saft tropfte ihm von Nase und Wimpern und rann ihm in klebrigen Bächen bis in den Kragen.
O nein!, dachte ich nur und rollte die Augen gen Himmel. Das war der prompteste Bruch eines eben gegebenen Versprechens, den ich je erlebt habe. Víll, du bringst uns beide um!
Maharan zückte ein Mundtuch und gab gleichzeitig dem roten Riesen ein kaum sichtbares Zeichen. Der warf sich auf meinen Freund, drehte ihm die Arme auf den Rücken und klemmte ihn sich kurzerhand unter die Achsel. Da konnte Víll so viel zappeln, fluchen und um sich treten, wie er wollte, gegen jenes muskelbepackte Ungetüm hatte er keine Chance.
»Bring den ungezogenen Bengel zum Spielen in den Garten, Mapalahoroswintharababor. Dort kann er sich austoben und mit Fallobst um sich schmeißen, so viel und so lange er will. Und sorge dafür, dass er die Erwachsenen nicht stört!«





























