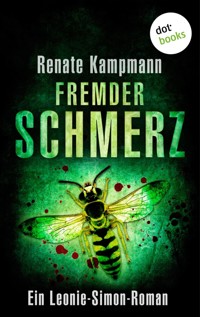Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Macht der Bilder Am Stadtrand von Hamburg wird eine Frau tot aufgefunden. Sie ist seltsam zugerichtet – wie das Opfer einer mörderischen Inszenierung. Rechtsmedizinerin Leonie Simon ist schockiert. Eigentlich wäre ihre Arbeit mit dem Obduktionsbericht beendet. Doch der Fall lässt sie nicht los. Als es weitere Opfer gibt, deutet alles auf einen Serientäter. Kurz darauf macht Leonie die Bekanntschaft des prominenten Thriller-Autors Georg Bachmann. Als der behauptet, in visionären Momenten die Morde vorhergesehen zu haben, werden Leonies Recherchen zum Albtraum und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ... Im Schattenreich Rechtsmedizinerin Leonie Simon ermittelt in eigener Sache: Die Hamburger Ärztin hat ein dunkles Geheimnis – vor über fünfundzwanzig Jahren wurde ihre Mutter ermordet. Das nie aufgeklärte Verbrechen verfolgt sie noch heute in ihren Träumen. Um endlich die Schatten der Vergangenheit loszuwerden, trifft sie eine Entscheidung: Sie muss den Mörder ihrer Mutter finden. Doch zunächst fordert die Arbeit im Institut die ganze Aufmerksamkeit der Rechtsmedizinerin. Ein ermordeter ausländischer Politiker, ein toter Polizist und eine Kellerleiche halten die Mitarbeiter in Atem. Als das Institut ins Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik gerät, liegen die Nerven aller blank. Und Leonie hat auf einmal das Gefühl, verfolgt zu werden … Die Presse über Renate Kampmann: "Dr. Leonie Simon, Rechtsmedizinerin – wenn Renate Kampmann sie nicht erfunden hätte, würde sie in der deutschen Krimi-Landschaft fehlen!" Doris Gercke "Besser als Patricia Cornwell." Bild am Sonntag "Nichts für schwache Nerven." FREUNDIN
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1180
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über „Die Macht der Bilder“:
Am Stadtrand von Hamburg wird eine Frau tot aufgefunden. Sie ist seltsam zugerichtet – wie das Opfer einer mörderischen Inszenierung. Gerichtsmedizinerin Leonie Simons ist schockiert. Eigentlich wäre ihre Arbeit mit dem Obduktionsbericht beendet. Doch der Fall lässt sie nicht los. Als es weitere Opfer gibt, deutet alles auf einen Serientäter.
Kurz darauf macht Leonie die Bekanntschaft des prominenten Thriller-Autors Georg Bachmann. Als der behauptet, in visionären Momenten die Morde vorhergesehen zu haben, werden Leonies Recherchen zum Albtraum und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Über „Im Schattenreich“:
Rechtsmedizinerin Leonie Simon ermittelt in eigener Sache: Die Hamburger Ärztin hat ein dunkles Geheimnis – vor über fünfundzwanzig Jahren wurde ihre Mutter ermordet. Das nie aufgeklärte Verbrechen verfolgt sie noch heute in ihren Träumen. Um endlich die Schatten der Vergangenheit loszuwerden, trifft sie eine Entscheidung: Sie muss den Mörder ihrer Mutter finden. Doch zunächst fordert die Arbeit im Institut die ganze Aufmerksamkeit der Rechtsmedizinerin. Ein ermordeter ausländischer Politiker, ein toter Polizist und eine Kellerleiche halten die Mitarbeiter in Atem. Als das Institut ins Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik gerät, liegen die Nerven aller blank. Und Leonie hat auf einmal das Gefühl, verfolgt zu werden …
Die Presse über Renate Kampmann:
„Dr. Leonie Simon, Rechtsmedizinerin – wenn Renate Kampmann sie nicht erfunden hätte, würde sie in der deutschen Krimi-Landschaft fehlen!“ Doris Gercke
„Besser als Patricia Cornwell.“ Bild am Sonntag
„Nichts für schwache Nerven.“ FREUNDIN
Über die Autorin:
Renate Kampmann, geboren 1953 in Dortmund, studierte Germanistik und Geschichte. Sie war Dramaturgie-Assistentin bei Peter Zadek am Bochumer Schauspielhaus, arbeitete als Journalistin, Radio-Redakteurin und TV-Producerin. Seit 1995 lebt sie als freie Schriftstellerin in Hamburg. Sie schrieb unter anderem Drehbücher für die TV-Serien Bella Block, Doppelter Einsatz und Das Duo.
Bei dotbooks erscheint Renate Kampmanns Krimi-Reihe rund um Rechtsmedizinerin Dr. Leonie Simon, die folgende Bände umfasst:
Die Macht der Bilder. Ein Leonie-Simon-Roman
Schattenreich. Ein Leonie-Simon-Roman
Fremdkörper. Ein Leonie-Simon-Roman
Fremder Schmerz. Ein Leonie-Simon-Roman
***
eBook-Neuausgabe September 2017
Copyright © der Originalausgabe „Die Macht der Bilder“ 2003 by Kindler Verlag GmbH, Berlin
Copyright © der Originalausgabe „Schattenreich“ 2003 by Kindler Verlag GmbH, Berlin
Copyright © der Neuausgaben 2015 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Bildmotives von shutterstock/BOONCHUAY PROMJIAM
E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-96148-017-3
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Doppelband Kampmann an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de
Renate Kampmann
Die Macht der Bilder & Schattenreich
Zwei Romane in einem Band
dotbooks.
Die Macht der Bilder
Kapitel 1
Sie hatte wieder den Albtraum gehabt. Seit sie nach Hamburg gezogen war, träumte sie ihn fast jede Nacht. Schweißgebadet setzte Leonie sich im Bett auf und versuchte, sich in der Realität ihres unaufgeräumten Schlafzimmers zurechtzufinden. Der Radiowecker, der neben ihrem Bett auf dem Fußboden stand, zeigte 4.48 Uhr. Durch die nicht ganz heruntergelassenen Rolläden schimmerte bereits Tageslicht. Es hatte keinen Sinn mehr, im Bett liegenzubleiben. Um sechs Uhr hätte sie ohnehin aufstehen müssen. Sie konnte ebensogut eine Stunde früher ins Institut fahren.
Also wälzte sie sich aus dem Bett und stolperte zwischen den noch unausgepackten Umzugskisten hindurch ins Bad. Sie fragte sich nicht zum ersten Mal während der vergangenen zwei Wochen, ob ihre Entscheidung, nach Hamburg zurückzukehren, nicht ein Fehler gewesen war.
Als sie unter der Dusche stand, klingelte ihr Handy. Hastig griff sie nach dem Handtuch. Es mußte irgendeinen kausalen Zusammenhang zwischen Duschen und Telefonen geben. Hatte sich darüber eigentlich schon mal jemand Gedanken gemacht? Das Handy lag im Wohnzimmer auf einem Bücherstapel. Mit feuchten Fingern griff sie danach.
»Simon ... Und warum rufen Sie nicht Doktor Hinrichs an? Der hat seit gestern Bereitschaft ... Ach so. Na gut, schießen Sie los.« Das Handy am Ohr lief sie zu einem kleinen Schreibtisch und griff nach Kugelschreiber und Papier. »Hm, ja, find ich schon.« Sie notierte die Adresse. »Ich fahr gleich los.«
Hinrichs hatte einen Motorradunfall gehabt. Der Tag fing ja gut an. Auf dem Weg zurück ins Badezimmer rubbelte sie sich die kurzen Haare trocken, der Föhn besorgte den Rest. Sie fuhr sich mit beiden Händen durch das noch leicht feuchte Haar. Zum Friseur müßte sie dringend. Aber zu welchem?
Zwanzig Minuten später saß Leonie im Auto und reihte sich in den beginnenden Berufsverkehr ein. Die Straßen glänzten vor Nässe, und an den Rändern hatten sich große Pfützen gebildet. In der Nacht mußte es heftig geregnet haben, auch jetzt war der Himmel noch stark bewölkt, und der Wetterbericht versprach keine wesentliche Besserung in den nächsten Tagen. Leonie registrierte nicht ohne Befriedigung, daß sich in den vergangenen zwanzig Jahren zumindest das Hamburger Wetter nicht verändert hatte. Bei ihren seltenen Stippvisiten hatte sie sich stets auf den Zweck ihres Besuches beschränkt und war so schnell wie möglich wieder abgereist. Erst jetzt, nach ihrer Heimkehr – war Heimkehr überhaupt das angemessene Wort? –, bemerkte sie, wie die Stadt sich verändert hatte. Sie war erschrocken über das Ausmaß der Ausländer- und Arme-Leute-Ghettos, die sich an der Peripherie der Stadt gebildet hatten, und enttäuscht über die Yuppiesierung einst gemütlicher Kleinbürger- und Studentenviertel, in denen jetzt coole Jungunternehmertypen den Ton angaben und die Preise verdarben. Die Neubauwohnung, die sie mit Beziehung und Bestechung in Eimsbüttel ergattert hatte, kostete sie unverschämte zwanzig Mark pro Quadratmeter. Ein Schnäppchen, meinte der Makler.
Leonie fuhr durch die sogenannten Walddörfer Wellingsbüttel, Poppenbüttel, Bergstedt in Richtung Wohldorf-Ohlstedt, Hamburgs nordöstlichsten Vorort. Dabei wurde die Gegend immer ländlicher und grüner. Pferdekoppeln, Wiesen und kleine Gehölze säumten die Straßen und die Häuser und Villen von Hamburgs Besserverdienenden. Die Alster war hier draußen nahe ihrer Quelle noch ein schmales Flüßchen, das Paddler, Radler und Spaziergänger bei schönem Wetter und an Wochenenden zu Tausenden anlockte. Angesichts einiger der teils gediegenen, teils protzigen, in parkähnlichen Gärten gelegenen Landhäuser machte sich in Leonie ein Gefühl breit, das Neid gefährlich nahe kam. Ihr mageres Bankkonto und ihre finanziellen Verpflichtungen kamen ihr in den Sinn, und sie konnte daran ganz und gar nichts Tröstliches finden. Andererseits kam sie zumeist ohnehin nur zum Schlafen nach Hause. Was sollte sie mit Haus und Garten anfangen?
Schon bevor sie nach rechts in den Schleusenredder einbog, sah sie die Blinklichter und quergestellten Polizeiwagen, die die Absperrung an der Einmündung der Straße bildeten. Trotz der frühen Morgenstunde hatten sich ein paar Dutzend Schaulustige eingefunden. Ein Großaufgebot der Polizei rückte in dem ruhigen Vorort nicht alle Tage an. Leonie kurbelte die Scheibe hinunter, als ein uniformierter Polizist auf ihren Wagen zutrat.
»Doktor Simon, Rechtsmedizinisches Institut.«
»Fahren Sie auf den Parkplatz, gleich da vorne rechts.«
Der Schleusenredder verlief durch den nördlichen Abschnitt des Wohldorfer Waldes. Nur auf der linken Seite standen noch vier oder fünf Villen. Auf der rechten Seite begann der Wald, in den von einem Waldparkplatz aus zwei Spazierwege hineinführten. Leonie parkte ihren alten Golf und holte den Tatortkoffer aus dem Kofferraum. Für alle Fälle hatte sie auch Gummistiefel, einen fusselfreien Overall und eine Plastikschürze dabei. Sie sah sich um. Der Platz wimmelte von Polizisten und Kollegen der Spurensicherung. Mitten auf dem Parkplatz stand ein Gebäude in verblichenem Gelb, das im Stil einer Gründerzeitvilla gebaut war. Es handelte sich um das Bahnhofsgebäude der ehemaligen Endhaltestelle der Kleinbahn Alt-Rahlstedt/Wohldorf-Ohlstedt, um dessen Erhalt sich ein Verein bemühte. Auf dieses Gebäude schien sich die allgemeine Aufmerksamkeit zu konzentrieren, und Leonie ging darauf zu. Ihr Blick fiel dabei zufällig auf eine Gruppe von Neugierigen, die ziemlich nahe herangerückt war und gerade von zwei Polizisten wieder zurückgedrängt wurde. Ein Mann mittleren Alters fiel ihr auf, der nicht zu der Gruppe Schaulustiger zu passen schien. Er wirkte übernächtigt und besorgt, und Leonie hatte den Eindruck, daß er nicht zufällig vorbeigekommen war.
Sie überlegte gerade, ob sie einen Polizisten auf ihn aufmerksam machen sollte, als ein in schwarzes Leder gekleideter Mann auf sie zukam, der ihr, wie sie zu ihrem Ärger spürte, die Röte ins Gesicht trieb. Im ersten Augenblick hatte sie die phantastische Vision, irgendein wahnwitziges Schicksal hätte Antonio Banderas nach Wohldorf-Ohlstedt verschlagen. Bedauerlicherweise war es nicht der spanische Hollywood-Star, der sich ihr mit langen Schritten näherte, aber sie dachte, er hätte eine verdammt gute Kopie abgegeben. Der Mann war ebenso dunkel und ebenso attraktiv wie sein Vorbild, nur leider, wie sie sofort Gelegenheit hatte festzustellen, nicht im entferntesten so charmant. Im Moment hatten seine schwarzen Samtaugen sogar einen außerordentlich mürrischen Blick.
»Wo ist Hinrichs?«
»Doktor Hinrichs hatte einen Unfall. Ich bin Doktor Simon, die neue Oberärztin.«
Er musterte sie von oben bis unten und schnaubte dann verächtlich.
»Sie sind das also. Ich hatte Sie mir älter vorgestellt. Dann kommen Sie mal mit.«
Leonie spürte, wie es anfing, in ihr zu brodeln. Er hatte älter gesagt und erfahrener gemeint. Dabei war er selbst höchstens Ende dreißig.
»Ich nehme an, Sie sind inkognito hier?«
»Hauptkommissar Kaminski, dritte Mordbereitschaft. Ein paar Minuten später und ich hätte Dienstschluß gehabt.«
»So ein Pech«, entgegnete Leonie mit Inbrunst. Kaminski hatte sie ums Haus geführt, zur Rückseite einer Verladerampe. Dort führte eine Treppe nach unten zu einer Kellertür. Über die Treppe hatte man zum Schutz gegen den Regen eine große Plastikplane gespannt. Einer der Polizeifotografen war noch bei der Arbeit. Er hockte auf den Stufen und fotografierte etwas am Fuß der Treppe. Als er sich erhob und für Leonie den Weg freimachte, sah sie die Leiche.
Eine vollschlanke Frau von etwa Anfang vierzig lehnte mit dem Rücken gegen die Kellertür, die Beine waren gespreizt und leicht angewinkelt. Sie war nackt, nur um ihren Hals war ein Schal geschlungen, der rechts oberhalb des Kopfes am Knauf der Kellertür festgebunden war und so verhinderte, daß die Leiche zur Seite wegsackte. Aus ihrem rechten Mundwinkel verlief eine Blutabrinnspur über Kinn und Hals bis auf die Brust. Brust, Schulter, Arme und Beine wiesen zahlreiche Stiche und Schnitte auf, und aus ihrer Vagina ragte eine Weinflasche.
»Wann wurde sie gefunden?« Leonie entnahm ihrer Tasche ein Paar Latexhandschuhe und zwängte ihre Hände hinein.
»Die Zentrale hat um 23.54 Uhr einen anonymen Anruf registriert. Die haben zuerst einen Streifenwagen hergeschickt. Ich nehme an, Sie wissen, wie das so läuft. Ich bin seit etwa halb zwei hier.«
»Und Sie haben es nicht für nötig gehalten, sofort in der Rechtsmedizin anzurufen?«
»Gnädigste, es hatte angefangen zu regnen. Und wir hatten alle Hände voll damit zu tun, abzukleben und Spuren zu sichern. Reifenspuren haben die unangenehme Eigenschaft, sich bei strömendem Regen in Matsch zu verwandeln.«
»Haben Sie wenigstens gleich die Rektaltemperatur gemessen?«
Kaminski blickte einen jungen Mann an. »Na?«
Der Kollege zuckte mit den Schultern. »Wie denn? Ich meine, so wie die da sitzt, wär ich ja schlecht rangekommen.«
»Großartig. Eine halbwegs genaue Todeszeitbestimmung können Sie sich jetzt getrost abschminken.«
Leonie stieg die Treppe hinab und hockte sich neben die tote Frau. Sie sah in das leere, völlig ausdruckslose Gesicht. Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, daß Menschen, die einen gewaltsamen oder besonders grausamen Tod erleiden, angst- oder schmerzverzerrte Gesichter haben. Im Moment des Todes entspannt sich die Muskulatur so vollkommen, wie das ein lebender Körper niemals kann. Die Glieder werden schlaff, und das Gesicht ist jeglicher Mimik beraubt. Was immer der Sterbende in der letzten Lebenssekunde gefühlt hat, ob Erleichterung oder Schrecken, Freude oder Schmerz, löscht der Tod aus seinem Gesicht. Leonie erinnerten die Gesichter der Toten an verlassene Häuser, hinter deren Fassaden niemand mehr zu Hause war.
Sie löste vorsichtig das Halstuch und reichte es dem jungen Kriminalbeamten, der es sofort in eine Papiertüte stopfte. Die Tote blieb steif und starr sitzen. Leonie untersuchte ihren Hals, mit Hilfe einer chirurgischen Pinzette die Bindehäute der Augen und versuchte dann, am Armgelenk die Totenstarre zu brechen, was ihr nicht mehr gelang, wie sie schon erwartet hatte.
»Kann mir mal einer helfen, sie raufzutragen?«
Leonie sah sich auffordernd um. Außer Kaminski, anscheinend der federführende Ermittler in diesem Fall, hielten sich drei weitere Kollegen der dritten Mordbereitschaft am Tatort auf. Dittberner, der jüngste der Truppe, war ein alerter, beflissener Softie-Typ, hinter dessen schwiegermutterkompatiblem Plüschlächeln Leonie beinharten Ehrgeiz und Intrigantenqualitäten vermutete. Stein, ein kleiner dünner Rothaariger, etwa im selben Alter wie Kaminski, trat still und zurückhaltend auf und wirkte von allen am ungefährlichsten, was aber täuschen konnte. Retzlaff, ein bierbäuchiger und schnauzbärtiger Wichtigtuer, alberte gerade mit einem Uniformierten herum und hinterließ bei Leonie den unangenehmsten Eindruck.
Auf Leonies Aufforderung kam Kaminski die Treppe herunter und packte die Beine der toten Frau. Leonie griff unter ihre Achseln, und zu zweit trugen sie sie nach oben und legten sie auf eine rasch ausgebreitete Plastikplane.
»Auf die Seite bitte.« Leonie holte ein Thermometer aus ihrer Tasche und schob es ins Rektum der Toten. Mit einem zweiten maß sie die Umgebungstemperatur. Dann untersuchte sie Rücken und Gesäß der Frau, die keine äußeren Verletzungen aufwiesen, und betastete an verschiedenen Stellen die Totenflecken. Sie arbeitete schweigend und ohne aufzusehen. Gern hätte sie die Flasche aus der Vagina entfernt, um der toten Frau wenigstens einen Teil ihrer Würde zurückzugeben, aber das mußte bis zur Obduktion warten.
»23,5 Grad Körpertemperatur. Brauchen Sie die Fingernägel?«
Kaminski nickte. »Und? Was ist nun?«
Leonie wickelte Plastikfolie um die Hände der Toten, um eine Verunreinigung der Nägel beim Transport zu vermeiden.
»Sie ist tot.«
Kaminski holte geräuschvoll Luft, und seine Augenbrauen rückten noch dichter zusammen. Er sah aus wie eine pechschwarze Gewitterwolke. Leonie fiel der alte Chauvi-Spruch ›Wissen Sie, wie entzückend Sie aussehen, wenn Sie wütend sind?‹ ein.
»Dank Ihrer Schlampigkeit kann ich Ihnen zur Todeszeit im Moment nur sagen, daß sie wahrscheinlich nicht länger als vierundzwanzig Stunden tot ist. Die Totenflecken sind überall noch wegdrückbar. Sie ist mit Sicherheit nicht hier gestorben. Die Blutabrinnspur am Kinn hätte dann auf der linken Seite sein müssen. Außerdem wurde nach ihrem Tod mindestens zweimal ihre Position verändert. Sie hat zuerst auf dem Rücken gelegen, dann auf der rechten Seite, und zuletzt ist sie in die sitzende Position gebracht worden. Beim letzten Positionswechsel war die Umlagerbarkeit der Totenflecken schon unvollständig.«
»Danke für den Vortrag. Haben Sie auch eine Todesursache auf Lager?«
»Nach der Obduktion bestimmt.« Leonie erhob sich aus der anstrengenden Hockposition und zog die Handschuhe aus. »Soll's heute noch sein?«
»Was sonst?«
»Gut. Sie klären das bitte mit dem Staatsanwalt.«
Leonie griff nach ihrem Koffer, nickte den anderen Polizisten zu und ging zu ihrem Wagen zurück. Dabei tappte sie in eine Pfütze, was ihr einen halb unterdrückten Fluch entlockte. Ihr fiel der Mann wieder ein, der ihr vorhin unter den Zuschauern aufgefallen war. Aber als sie sich suchend umblickte, konnte sie ihn nicht mehr finden. Wahrscheinlich war es ihm zu langweilig geworden.
»Frau Doktor Simon?«
Leonie blickte sich um. Der Polizeifotograf lief hinter ihr her. Sie blieb stehen.
»Thomas Schneider.« Er hielt ihr die Hand hin. Zögernd ergriff sie sie und drückte sie kurz. Leonie mochte Händeschütteln nicht besonders gern, wollte aber auch nicht unhöflich sein. Sein Händedruck war warm und fest. Er lächelte sie aus blauen Augen neugierig an.
»Sie sind neu bei den Rechtsmedizinern, stimmt's?«
»Ja, ich bin erst seit zwei Wochen hier.«
»Die neue Assistenzärztin?«
»Die neue Oberärztin.«
»Oh, pardon. Dafür sehen Sie aber noch ziemlich jung aus.«
Leonie lächelte. Bei ihm war das eindeutig ein Kompliment, das sie gern annahm. Gemeinsam gingen sie zu ihrem Auto.
»Ist eine nette Truppe in Ihrem Institut. Also, soweit ich das beurteilen kann.«
»Freut mich zu hören.« Leonie schloß ihr Auto auf und verstaute ihren Koffer.
»Lassen Sie sich von Kaminski nicht irritieren. Der ist an sich gar nicht übel.«
»So?« Wahrscheinlich meinte er es gut, aber Leonie war gegen derartige Ratschläge beinahe genauso allergisch wie gegen Macho-Allüren gröberer Art.
»Wir sehen uns ja sicher später im Institut.« Sie setzte sich hinter das Steuer, nickte dem Fotografen noch einmal zu und knallte die Tür ins Schloß. In flottem Tempo verließ sie den Parkplatz. Im Rückspiegel registrierte sie, daß Thomas Schneider ihr nachsah. Eigentlich ein ganz netter Junge, dachte sie, aber nicht ihr Typ.
Sie fuhr den Weg zurück, den sie gekommen war. Inzwischen war der Berufsverkehr stärker geworden, und sie hatte in den Staus vor den roten Ampeln reichlich Gelegenheit, über die Tote nachzudenken, die sie eben untersucht hatte. Beim Anblick der Leiche war ihr sofort klargeworden, warum Kaminski so schlechte Laune hatte. Der Zustand der Leiche und die Ablagesituation ließen Schlimmes befürchten. Wer immer dafür verantwortlich war, hatte es sehr wahrscheinlich nicht zum letzten Mal getan und vielleicht auch nicht zum ersten Mal. Einige der Stiche waren mit großer Wucht ausgeführt worden, so daß man den Abdruck des Messerheftes auf der Haut erkennen konnte. Leonie spürte ihr Herz schneller schlagen, wie immer, wenn sie solche Verletzungen sah oder daran dachte. Mit großer Verwunderung registrierte sie, wie wenig die Routine ihres Berufes in all den Jahren daran etwas geändert hatte. Natürlich hatte es auch mit Hamburg zu tun. Die Bilder ihrer Erinnerung waren wieder lebendiger geworden, drängender. Sie wußte, es würde niemals enden. Nicht, solange er lebte.
Um zwanzig nach acht fuhr Leonie auf den kleinen Parkplatz des Rechtsmedizinischen Institutes der Universitätsklinik Eppendorf. Der häßliche Flachdachbau war hoffnungslos veraltet und viel zu klein für die etwa fünfzig Menschen, die dort arbeiteten. Auch das kleinere Nebengebäude hatte kaum Erleichterung gebracht. Ein moderner Erweiterungsbau war nach jahrelangen Kämpfen um die Finanzierung endlich bewilligt worden. Der Rohbau, der mit dem alten Hauptgebäude ein L bildete, sollte mit etwas Glück im nächsten Frühjahr bezugsfertig sein und war der ganze Stolz von Professor Cordes, dem Leiter des Institutes.
Als Leonie das Haus betrat, räumte gerade der Medizinstudent seine Sachen zusammen, der in der Nacht Dienst an der Pforte getan hatte. Jan zwinkerte ihr durch die große Glasscheibe zur Begrüßung zu. Er war ein hübscher Junge und wußte das auch. Leonie lächelte und nickte in Richtung des Tagpförtners, der für sie gerade den Türöffner betätigte. Sie stemmte sich mit der Schulter gegen die schwere Tür und betrat die Eingangshalle. Von dort aus ging sie in die Pförtnerloge, zugleich Telefonzentrale, Nachrichtenumschlagplatz und erste Anlaufstelle für die Leichentransporte.
»Hallo, Frau Doktor Simon. Tut mir leid, daß Sie so früh rausmußten. Hat sich's wenigstens gelohnt?«
»Könnte man so sagen.«
Jan winkte grinsend zum Abschied. »Na dann. Carpe diem, Frau Doktor.«
Leonie griff nach dem Sektionsbuch. »Was liegt denn heute an?«
Pfeifer packte gerade ein üppiges Frühstückspaket aus. Er war lang und dünn und hatte ständig Hunger. Pfeifer war der dienstälteste Präparator und tat von morgens bis nachmittags zusätzlich Dienst an der Pforte.
»Doktor Silber hat eben mit der Brandleiche von gestern angefangen. Doktor Gabriel ist auf Außensektion, und Doktor Zhao hat um zehn den U-Bahn-Selbstmord. Am Nachmittag sind bis jetzt nur zwei wissenschaftliche Sektionen angesetzt.«
Leonie klappte das Sektionsbuch zu. »Gut. Dann hab ich ja noch einen Tisch frei. Gleich kommt ein Mordopfer rein, das sofort obduziert werden soll. Ich schätze, in spätestens einer Stunde wird sie hier sein. Sind Sie schon eingeteilt?«
»Bis jetzt noch nicht.«
»Fein, dann hätte ich gern, daß Sie mir assistieren.«
Sie arbeitete gern mit Pfeifer zusammen. Er war schnell, präzise und besaß einen trockenen Humor. Und von Rechtsmedizin verstand er mehr als die meisten Studenten, die im Haus ihr Unwesen trieben.
»Wie geht's Doktor Hinrichs? Weiß man schon, was passiert ist?«
»Er hat vorhin angerufen. War wohl alles nur halb so schlimm. Aber er ist krank geschrieben, Sehnenanriß am linken Unterschenkel.«
»Na, das hat mir heute noch gefehlt!«
Das bedeutete, daß sie den Dienstplan umschmeißen mußte. Sie sah ihr freies Wochenende wie eine Fata Morgana dahinschwinden. Und sie brauchte dringend ein paar freie Stunden, um endlich die Umzugskisten auszupacken, die Regale aufzubauen und was sonst noch an Schrecken in ihrer neuen Wohnung auf sie wartete. Sie wußte, wenn sie sich jetzt nicht darum kümmerte, bliebe alles so bis zu ihrem Auszug.
Leonie verließ die Pförtnerloge durch den kleinen Aufenthaltsraum, durch den sie unter Umgehung einer verschließbaren Glastür direkt in den Sektionstrakt gelangte. Gegenüber dem Lastenaufzug betätigte sie einen Türöffner und stieg hinab in den Leichenkeller. Heidi Zenker, die einzige Frau unter den Präparatoren, entkleidete gerade einen Neuzugang, eine ältere Frau, die mit einem Strick um den Hals eingeliefert worden war. Leonie warf nur einen flüchtigen Blick auf die Leiche und ging dann an den Kühlfächern vorbei und durch den kleinen in den großen Sektionssaal, in dem Doktor Silber gerade eine Brandleiche obduzierte. Der zweite Obduzent war Doktor Fuchs, einer der beiden Assistenzärzte, die noch in der Facharztausbildung waren. Fuchs schnitt gerade den Darm längs auf, während Silber bedächtig das Hirn in schmale Scheiben zerlegte. Die beiden blickten nur kurz auf, als Leonie durch die sich automatisch öffnende Stahltür hereintrat.
»Wie sieht's aus? Hat seine Versicherung heute ihren Glückstag?«
Silber nickte. »Ich würde sagen, ja. Der Kerl hätte ziemlich gute Chancen auf einen Preis für eine der dümmsten Methoden, sich aus dem Gen-Pool der Menschheit zu verabschieden.«
Malte Andresen, der Präparator, ein unauffälliger, aber kompetenter Mann, stopfte Zellstoff in die leere untere Schädelhälfte, stülpte das Schädeldach darüber und fixierte es mit zwei Metallstiften. Er grinste bei den Worten von Doktor Silber in sich hinein.
»So wie es aussieht, hat er den Brand selbst gelegt, aber die Verpuffungsgefahr nicht einkalkuliert. Er ist vorne wesentlich stärker verbrannt als auf der Rückseite. Wahrscheinlich hat er sich noch über den Brandbeschleuniger rübergebeugt, als er das Streichholz anzündete.«
Leonie interessierte der Fall nicht besonders, und sie fand, daß sie genug höfliche Neugier gezeigt hatte.
»Ich krieg da gleich ein Mordopfer rein, eine Frau, die in der Nacht in Wohldorf-Ohlstedt gefunden wurde. Nicht so ganz das Übliche. Ich hätte Sie gern dabei, wenn Sie hiermit fertig sind.«
»Wann?«
»Ich schätze in einer Stunde, spätestens in zwei.«
Das Telefon klingelte, und Andresen nahm den Hörer ab. »Für Sie, Doktor Fuchs.«
Fuchs verzog das Gesicht und betrachtete seine blutigen Handschuhe.
»Gut. Länger als eine Stunde brauche ich hier nicht mehr.« Silber schnitt ein kleines Stück Hirngewebe heraus und stopfte es in das bereits überquellende Glas, in dem die Gewebeproben für die histologische Untersuchung in Formalin konserviert wurden.
Fuchs hatte seine Handschuhe ausgezogen und flüsterte in den Telefonhörer: »... aber doch nicht jetzt. Was meinst du, was ich gerade mache?«
Leonie und Silber tauschten ein Lächeln. Leonie war noch nicht lange im Institut, aber sie hatte schon rausgefunden, daß Fuchs die Rolle des jugendlichen Liebhabers spielte. Er schien neben seinem beachtlichen Tagespensum im Institut noch ausreichend Kraft für häufig wechselnde Freundinnen zu haben.
Leonie verließ den Sektionssaal durch den zweiten Ausgang, durchquerte einen kleinen Vorraum, in dem jeder Obduzent sein persönliches Paar Gummistiefel stehen hatte und stieg im hinteren Treppenhaus zum Erdgeschoß hoch, wo sich ihr Büro befand. Als sie ihr Vorzimmer betrat, sah ihr Frau Thiele, ihre Sekretärin, schon vorwurfsvoll entgegen.
»Sie haben um halb zehn den Vorstellungstermin bei Doktor Voss.«
»Der Leichenstaatsanwalt. Den hab ich jetzt tatsächlich völlig vergessen.«
Leonie sah Frau Thiele schuldbewußt an. Sie wußte, daß sie das wieder ein paar Punkte gekostet hatte.
»Soll ich anrufen und sagen, daß Sie ein paar Minuten später kommen?«
»Nein, sagen Sie ganz ab. Ich krieg gleich ein Mordopfer rein, das sofort obduziert werden soll. Machen Sie einen neuen Termin aus.«
Frau Thiele zog ein säuerliches Gesicht und griff zum Telefon. »Wie Sie wollen.«
Leonie bedankte sich und verdrückte sich in ihr Büro. Es würde noch so weit kommen, daß sie Angst vor ihrer eigenen Sekretärin bekam. Sonja Thiele war bis zu seiner Pensionierung die Sekretärin von Medizinaldirektor Wäscher gewesen. Er und Obermedizinalrat Doktor Silber waren vom gerichtsmedizinischen Dienst des Gesundheitsamtes übriggeblieben und nach dessen Auflösung zum Rechtsmedizinischen Institut der Universität gekommen. Die Thiele und ihr Chef hatten in fast dreißigjähriger Zusammenarbeit eine offenbar symbiotische Beziehung entwickelt, und Leonie hatte schon bereut, daß sie bei ihrer Berufung ans Institut nicht eine Sekretärin ihrer Wahl gefordert hatte. Sonja Thiele würde Leonie nie akzeptieren, und Leonie hatte wenig Lust, sich ihrer Vorstellung von einer leitenden Persönlichkeit anzupassen.
Auf Leonies Schreibtisch stapelten sich Aktenordner, Korrespondenz, Notizen zu Gutachten, Tatortfotos und dergleichen mehr, und sie fragte sich, wie sich in bloß zwei Wochen so viel unerledigte Arbeit hatte ansammeln können. Die Antwort war nicht besonders schwer. Professor Cordes, der Leiter des Institutes, hatte seiner neuen Oberärztin großzügig alles übergeben, wozu er keine Lust hatte, und außer zum Golfspielen hatte er nur noch zu wenig Dingen Lust.
Leonie beschäftigte sich gerade mit dem Dienstplan – eine Arbeit, für die sie wenig Begeisterung hegte, weil man es damit niemandem recht machen konnte –, als die Pforte die Ankunft des Mordop fers meldete. Sie lief über die hintere Treppe in den Leichenkeller und betrat zum zweiten Mal an diesem Morgen den großen Sektionssaal. Die Brandleiche war verschwunden. Aber Doktor Silber diktierte noch sein Sektionsgutachten, und der Präparator säuberte den Stahltisch, während sein Kollege Pfeifer schon alles für die nächste Leiche am zweiten Tisch vorbereitete. Leonie zog sich um. Wie Doktor Silber trug sie bei jeder Obduktion den »vollen Wichs«: Gummistiefel, Kittel und Gummischürze, Plastikhaube, Mundschutz und Handschuhe. Andere Kollegen verzichteten meist auf Stiefel, Haube und Mundschutz und riskierten der Bequemlichkeit zuliebe eine Infektion.
Die Leiche des Mordopfers wurde hereingefahren und auf den Stahltisch gehievt. Doktor Silber beendete das Diktat und stürzte sich auf die Formulare, die noch auszufüllen waren.
»Ich bin gleich soweit.«
Leonie nickte und griff nach ihrem Diktiergerät. »Ich fang schon mal an.«
Sie begann die Befunde der äußeren Leichenschau zu diktieren. Das war diesmal wegen der vielen Schnitt- und Stichverletzungen und der zahlreichen Hämatome eine langwierige Angelegenheit. Als Hauptkommissar Kaminski den Seziersaal betrat, blickte sie nur kurz auf, unterbrach aber nicht ihr Diktat. Kaminski nickte Silber kurz zu und stellte sich etwas abseits, um Leonie bei ihren Umrundungen der Leiche nicht im Wege zu stehen.
Thomas Schneider, der Polizeifotograf, war kurz nach Kaminski hereingekommen und legte einen neuen Film ein. Leonie unterbrach ihr Diktat.
»Sie können ruhig anfangen, wenn Sie wollen.«
Schneider holte sich einen Fußschemel und fotografierte die Leiche von allen Seiten.
Leonie blickte Silber an, der gerade neben sie trat und interessiert die Leiche betrachtete. Er deutete auf bräunliche Hautvertrocknungen an Hand- und Fußgelenken.
»Sieht nach Fesselungsspuren aus.«
»Denke ich auch.« Leonie untersuchte die Stellen. »Die Verletzungen sind unterschiedlich alt, würde ich sagen.« Kaminski trat hinzu. »Was meinen Sie damit?«
Leonie sah ihn an. »Es ist vorstellbar, daß die Frau über einen längeren Zeitraum gefesselt war oder immer wieder neu gefesselt wurde. Manchmal hat sie sich gewehrt, hat an den Fesseln gezerrt, daher die Verletzungen.«
Kaminski winkte Schneider heran. »Fotografier das mal.«
Silber zog vorsichtig die Flasche aus der Vagina. »Wer macht denn so was?« Dann vermaß er die Eindringtiefe und machte Abstriche vom Flaschenhals und aus der Scheide. »Das Ding hat man ihr postmortal reingerammt. Keine vitalen Verletzungen.«
Leonie hatte sich inzwischen dem Hals der Toten zugewandt. »Keine sichtbaren Drosselmarken am Hals.« Sie drehte sich zu Kaminski um. »Falls sie mit dem Schal erdrosselt wurde, in dem sie an der Klinke hing, würde das die Sache erklären.«
»Ist sie nicht erstochen worden?«
»Glaub ich nicht. Ich denke, wir werden am Hals Unterblutungen im Unterhautfettgewebe und in der Muskulatur finden.« Leonie wandte sich an den Präparator. »Bevor Sie den Schädel öffnen, schneiden Sie ihr doch bitte noch die Fingernägel ab.«
Pfeifer griff nach einer kleinen Schere. »Einmal Maniküre, bitte sehr, bitte gleich. Ich hoffe, Sie haben ein paar Röhrchen dabei?«
Die Frage richtete sich an Kaminski, der daraufhin aus dem Rucksack, den er beim Hereinkommen über der Schulter getragen hatte, zehn durchsichtige Röhrchen und einige Etiketten hervorholte.
Doktor Silber griff nach dem großen Sektionsmesser. »Na denn, rein ins Vergnügen.«
Während Leonie ihren äußeren Befund zu Ende diktierte, öffnete Silber mit einem ypsilonförmigen Schnitt Brust- und Bauchhöhle der Toten und schälte die Haut von den Rippen.
Leonie legte das Diktiergerät weg. »Wo ist die Geflügelschere?«
Pfeifer reichte ihr die gewünschte Rippenschere, und Leonie entfernte mit ein paar kräftigen Schnitten die Brustplatte, um die Brustorgane freizulegen.
Kaminski zog sich diskret ein paar Schritte in Richtung Wand zurück. Er beobachtete Leonie und ertappte sich bei dem Gedanken, daß das eigentlich Männerarbeit sei. Ihm fiel noch rechtzeitig ein, daß ihn kein Geld und keine Gewaltandrohung zu diesem Job kriegen würden.
Die Präparation der Stichverletzungen ergab, daß keiner der tiefen Stiche tödlich gewesen war. Leonie erklärte Kaminski, daß bei allen tieferen Stichen und Schnitten keine Einblutungen zu finden waren, sie der Frau also wahrscheinlich erst nach Eintritt des Todes beigebracht worden waren. Nur die oberflächlichen Ritzer waren der Lebenden zugefügt worden. Leonie und Silber hatten über einige debattiert und kamen nun zu dem Schluß, daß diese vitalen Verletzungen der Frau zu unterschiedlichen Zeitpunkten beigebracht worden waren, wahrscheinlich sogar über einen Zeitraum von mehr als einer Woche. Die histologische Untersuchung des Gewebes würde das genauer klären können.
Der Fotograf sah Kaminski an. »Das klingt, als hättet ihr's mit einem dieser abgedrehten Sadisten zu tun.«
Kaminskis Antwort ging im Kreischen der oszillierenden Säge unter, mit der Pfeifer den Schädel öffnete. Leonie, die gerade die Leber der Toten auf das Organbrett hob, hielt in der Bewegung inne. In der Tür war eine ungewöhnliche Erscheinung aufgetaucht, und Leonie starrte sie mit offenem Mund an. Ein Mann, nein, ein Riese, bückte sich unter der Tür durch und betrat den Sektionssaal. Er war mehr als zwei Meter groß, hatte Schultern, die Platz genug für mindestens zwei anlehnungsbedürftige Frauen geboten hätten, und im Gegensatz dazu ein erstaunlich sensibles und freundliches Gesicht. Der Riese war in einen todschicken Maßanzug gekleidet und verströmte eine dazu passende teure Duftnote.
»Frau Doktor Simon, nehme ich an?« Der Riese verfügte über eine angenehme dunkle Stimme, die Bilder von Rotwein und prasselndem Kaminfeuer heraufbeschwor.
Leonie räusperte sich, nickte aber nur. Kaminski sah sie wütend an. Oder schien ihr das nur so?
»Tja, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt ...« Der Riese grinste Leonie an.
»Sind Sie etwa der Leichenstaatsanwalt?«
»Der zuständige Staatsanwalt für Tötungsdelikte, ja.«
»Tut mir wirklich leid, daß ich Sie heute versetzt habe, Doktor Berg, Entschuldigung, Doktor Voss. Aber Hauptkommissar Kaminski hatte es eilig.«
Voss lachte dröhnend. »Doktor Berg. Ich glaube, jetzt hab ich meinen Spitznamen weg, was?«
Kaminski, der neben Voss wie ein Halbwüchsiger aussah, brummte was von »uralter Witz«. Dann mußte er Voss die Details des Leichenfundes herunterbeten und zugeben, daß sie die Identität der Toten noch nicht hatten ermitteln können. Vielleicht brachte sie der Zahnstatus weiter. Da die Tote die Zähne ziemlich fest aufeinandergepreßt hatte, war die Abnahme eines Abdrucks bisher nicht möglich gewesen.
Silber, der sich eben mit der Präparation der Halsorgane beschäftigte, als Voss hereinkam, pfiff durch die Zähne. »Da schau her.«
Er sah Leonie an, und sie trat zu ihm. Leonie blickte in die vom Hals aus geöffnete Mundhöhle der Toten, dann winkte sie Kaminski und Voss an den Tisch. Alle vier, auch Silber, blickten ihr über die Schulter, sahen stumm auf die Tote hinunter. Diese starrte ebenso stumm zurück. Sie hätte auch gar nichts sagen können, denn man hatte ihr die Zunge herausgeschnitten.
Kapitel 2
Leonie zog den Kittel aus und stellte die Gummistiefel an ihren Platz in dem kleinen Vorraum. Während ihr Kollege Silber und der Präparator den restlichen Routinekram erledigten, verließ sie mit Kaminski, Schneider und Voss das Schlachtfeld. Voss sah sie nachdenklich an.
»Was glauben Sie? Ist das das Werk eines Verrückten?«
Leonie zögerte, sie hielt nichts von Spekulationen. »Ich glaube nicht, daß da jemand völlig die Kontrolle verloren hat. Aber bei mir sind Sie mit der Frage an der falschen Adresse. Psychologie ist nicht mein Fachgebiet.«
Voss wandte sich an Kaminski. »Ich möchte, daß Sie die Kilian-Walter hinzuziehen.« Er wandte sich wieder an Leonie. »Das ist unsere Polizeipsychologin, sie hat sich auf Fallanalysen spezialisiert. Ich möchte, daß wir uns alle zusammensetzen, und zwar so schnell wie möglich.«
Kaminski zuckte mit den Schultern. »Ich bin der Meinung, wir sollten erst mal abwarten, bis wir mehr über die Tote wissen. Wenn wir ihre Identität ermitteln können, haben wir damit vielleicht auch ihren Mörder am Wickel. Dann können wir uns die ganze Psychonummer sparen.«
Voss grinste. »Sie sind ein ziemlich konservativer Typ, Kaminski, was? Aber um die neuen Methoden kommen auch Sie nicht herum. Aber bitte, ein oder zwei Tage gebe ich Ihnen noch. Ich hab nichts dagegen, wenn Sie Ihre Hausaufgaben machen.«
Sie waren am Ausgang angelangt. Voss ergriff zu Leonies Erstaunen ihre Hand und küßte sie nonchalant. Kaminski beobachtete das Manöver angewidert.
»Frau Doktor Simon, es war mir ein besonderes Vergnügen. Auf gute Zusammenarbeit.«
»Vorsicht!« Leonie konnte gerade noch verhindern, daß Voss sich beim Hinausgehen den Kopf stieß. Kaminski verzog zum ersten Mal, seit sie ihn kennengelernt hatte, den Mund zu einem Lächeln. Leonie fand, daß ihm das recht gut stand. Aber wer sah mit einem Lächeln nicht besser aus als mit einem Gesicht wie ein magenkranker Preisboxer? Als er sich ihr zuwandte, schwand das Lächeln aus seinem Gesicht.
»Sie hätten ihm den Floh mit der Psychologin nicht ins Ohr setzen sollen!«
»Ich kenne Frau Kilian-Walter nicht, und ich weiß nicht, was Sie gegen sie haben. Herr Doktor Voss ist jedenfalls ganz allein darauf gekommen, sie hinzuzuziehen. Und wenn Sie mich fragen, hat er absolut recht damit.«
»Dieser ganze Psychoquatsch ist doch bloß wieder so eine neue Mode, mit der sich ein paar Maßanzugträger profilieren wollen. Ob sich einer den Scheitel links oder rechts zieht und als Kind lebende Frösche gefrühstückt hat, kann ich den Kerl, den ich suche, fragen, wenn ich ihn habe. Und kriegen tu ich ihn durch zähe Ermittlungsarbeit und durch sonst gar nichts.«
Kaminski machte Anstalten, auf den Fußboden zu spucken, besann sich aber Gott sei Dank im letzten Augenblick noch anders. Leonie hatte für diesen Tag genug von Kaminski. Er war ein hübscher Junge, aber ein entsetzlicher Ignorant.
»Ehrlich gesagt ist es mir völlig egal, wie Sie den Mörder dieser Frau schnappen. Drehen Sie jeden Stein in Hamburg um oder befragen Sie das Orakel von Delphi. Ist mir Jacke wie Hose. Hauptsache, Sie finden ihn, und zwar möglichst schnell.«
Leonie drehte sich um und ging den Gang zurück zu ihrem Büro.
»Warten Sie.« Schneider, der Fotograf, der sich die ganze Zeit im Hintergrund gehalten hatte, lief hinter ihr her.
»Ja?« Leonie blieb stehen. Sie sah, daß Kaminski verschwunden war, und stellte fest, daß ihr das auch nicht recht war. Warum war er nicht hinter ihr hergelaufen? Thomas Schneider kam lächelnd auf sie zu.
»Es war ein Vergnügen, Ihnen zuzuschauen.«
»Ich hoffe, Sie glauben nicht, daß ich zu Polizisten immer so unfreundlich bin. Aber Hauptkommissar Kaminski scheint eine Art zu haben, die nicht gerade meine beste Seite zur Geltung bringt.«
Schneider lachte. »Nein, das meinte ich nicht. Obwohl mir das gefallen hat. Mein Typ ist Kaminski auch nicht. Ich meinte die Obduktion, präzise, schnell und, wie soll ich sagen, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, ein ästhetisches Vergnügen. Sie sind eine Künstlerin.«
Leonie wußte nicht, was sie von diesem Kompliment halten sollte. »Danke.«
»Sagen Sie, haben Sie heute abend schon was vor?«
»Ich muß in meiner neuen Wohnung Bücherregale aufbauen, und etwa vierzig Umzugskisten stehen unausgepackt überall im Weg.«
»Regale aufbauen ist eine Spezialität von mir. Wann soll ich bei Ihnen sein?«
Seine Hartnäckigkeit hatte etwas Rührendes, aber genug war genug.
»Vielen Dank. Nett von Ihnen, daß Sie mir helfen wollen, aber das schaffe ich auch allein. Auf Wiedersehen.«
Leonie lächelte ihm kurz zu und ging in ihr Büro. Dort stand ihr Chef, Professor Cordes, und unterhielt sich mit Frau Thiele. Er blickte ihr entgegen.
»Na, Ihr erster interessanter Mordfall, wie ich höre?«
Er folgte ihr in ihr Büro. Leonie ließ sich seufzend auf ihren Schreibtischstuhl fallen, ihre Füße taten weh, wie immer nach einer längeren Obduktion. Cordes setzte sich ihr gegenüber.
»Ja, es gibt schon ein paar spannende Aspekte bei dem Fall. Die Sache beunruhigt mich.«
»Gibt es was, das ich wissen müßte?«
»O nein, so hab ich das nicht gemeint. Vom rechtsmedizinischen Standpunkt aus gibt es keine offenen Fragen. Die Frau ist erdrosselt worden, das steht eindeutig fest. Auch über Art und Bedeutung ihrer Verletzungen waren Herr Silber und ich uns jeweils einig.«
»Und um mehr brauchen Sie sich auch nicht zu kümmern. Alles andere ist nicht mehr unsere Angelegenheit.«
»Sehen Sie, Herr Professor, das ist das Problem. Ich kann in so einem Fall nicht einfach mein Gutachten runterschnurren und mir dann das Ganze aus dem Kopf schlagen. Manchmal beneide ich die ausländischen Kollegen, die mehr Kompetenzen haben als wir hier in Deutschland, die auch an der Spurensuche und -auswertung beteiligt sind.«
»Seien Sie froh, daß Sie das nicht auch noch am Hals haben. Ich sehe schon, mit Ihnen hab ich mir einen Workaholic ans Institut geholt, der am liebsten auch noch die Arbeit von anderen übernehmen möchte. Warten S' nur ab, Sie kriegen auch so noch genug um die Ohren.«
Leonie lachte und sagte, daran hätte sie nach den ersten zwei Wochen keinerlei Zweifel mehr. In der nächsten Stunde gingen sie gemeinsam ein paar organisatorische und verwaltungstechnische Fragen durch. Professor Cordes hatte beschlossen, sie nicht nur zu seiner Stellvertreterin im medizinischen, sondern auch im Geschäftsführungsbereich zu machen. Das würde wahrscheinlich Professor Meißner, dem neuen Chef der Toxikologie, nicht gefallen. Als Meißner sein Amt vor einem halben Jahr antrat, übernahm er kommissarisch die Funktion des geschäftsführenden Stellvertreters des Direktors, eine Funktion, die auch sein Vorgänger innegehabt hatte. Cordes wollte die beiden Leitungsaufgaben aber nun in einer Hand zusammenführen, einmal, weil ihm das sinnvoller erschien, und zweitens, weil er Meißner nicht besonders mochte. Er würde bald mit Meißner über seinen Entschluß reden müssen, und das behagte ihm gar nicht. Nachdem er Leonie noch ein paar Antrittsbesuche bei wichtigen Persönlichkeiten der Hamburger Juristen- und Politszene ans Herz gelegt hatte, verschwand er. Auf den Golfplatz, wie Leonie vermutete. Sie lehnte sich seufzend in ihrem Stuhl zurück. Als sie den Ruf nach Hamburg annahm, hatte sie nicht geahnt, daß ihre neue Tätigkeit mit so viel Verwaltungskram und Diplomatie verbunden sein würde.
In den folgenden drei Stunden kämpfte sie tapfer gegen die Stapel auf ihrem Schreibtisch an, schlichtete einen Streit zwischen einem Assistenten und einer AiPlerin um die Nutzung eines Computers und begutachtete einen neuen Doktoranden. Als irgendwann ihr Magen knurrte, fiel ihr auf, daß sie den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte. Ein Blick auf die Uhr bestätigte ihr, daß es für die UKE-Kantine schon zu spät war. Vielleicht konnte sie bei der Sekretärin von Professor Cordes ein paar Kekse schnorren. Frau Ohngemach hatte immer einen eindrucksvollen Vorrat an Plätzchen, Schokoriegeln und Gummibärchen in ihrem Schrank. Daß sie dabei nicht völlig aus der Form geriet, lag wahrscheinlich daran, daß sie großzügig davon abgab, wenn einer der Ärzte Hunger hatte. Und da geregelte Mahlzeiten nicht gerade typisch für den Arbeitsalltag eines Rechtsmediziners waren, mußte sie ziemlich oft aushelfen.
Leonie wollte gerade an Frau Thiele vorbei, als die ihr bedeutete, sie wolle ihr ein Telefongespräch durchstellen. Wer denn dran sei? Den Namen habe sie nicht verstanden, aber es sei ein Altenheim. Leonie ging zurück in ihr Zimmer und schloß die Tür hinter sich. Sie wußte, wer es war. Wahrscheinlich ging es wieder um Geld. Sie nahm den Hörer ab. Die Leiterin des Altenheims meldete sich, eine gewisse Frau Müllerschön. Leonie hatte zuletzt mit der früheren Leiterin Kontakt gehabt, sie wußte gar nicht, daß die Leitung gewechselt hatte. Frau Müllerschön erklärte mit deutlichem Vorwurf in der Stimme, sie habe den halben Tag herumtelefoniert, um herauszufinden, daß Leonie jetzt in Hamburg lebe. Leonie entschuldigte sich, sie habe noch keine Zeit gefunden, Änderungsmitteilungen zu verschicken. Das beträfe auch ein paar Dutzend andere Leute. Das besänftigte Frau Müllerschön ein wenig, und sie kam auf den Grund ihrer Suche nach Leonie zu sprechen. Sie bat sie, in den nächsten Tagen vorbeizukommen, sie müsse etwas Wichtiges mit ihr besprechen. Leonie fragte, worum es denn gehe. Aber Frau Müllerschön wollte damit nicht am Telefon herausrücken. Leonie sagte schließlich zu und legte beunruhigt auf. Ihre Intuition sagte ihr, daß etwas sehr Unangenehmes auf sie zukam. Sie hätte den Besuch gern so lange wie möglich aufgeschoben, aber sie wußte, daß ihr das nicht lag. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende war ihr Motto. Unangenehmes mußte sofort erledigt werden, sonst schlief sie noch schlechter als ohnehin.
Leonie hatte es den Appetit auf Kekse verschlagen, und sie versuchte, sich auf ein Gerichtsgutachten zu konzentrieren. Punkt halb fünf steckte Frau Thiele den Kopf durch die Tür und verkündete, daß sie jetzt Feierabend machen wolle. Frau Thiele funktionierte wie ein Uhrwerk. Leonie vermutete, daß sie noch nie eine Minute zu früh oder zu spät ihren Arbeitsplatz betreten oder verlassen hatte. Sie wünschte ihr einen schönen Abend, und als just in dem Moment das Telefon klingelte, hob sie gleich selbst ab. Eine junge Frau meldete sich, oder jedenfalls klang ihre Stimme wie die einer jungen Frau. Sie meldete sich nur mit Hallo und nannte nicht ihren Namen. Sie wollte wissen, ob sie mit der Ärztin spreche, die clic Tote aus Wohldorf untersucht hatte. Leonie bejahte und fragte, mit wem sie spreche, aber die junge Frau legte sofort auf. Leonie warf den Hörer auf die Gabel, sie hatte genug von mysteriösen Anrufen.
Sie arbeitete bis sechs, dann ging sie in den Leichenkeller, um die Eingänge des Tages zu besichtigen. Da sie Bereitschaftsdienst hatte, oblag ihr auch die äußere Leichenschau der bis zum Abend eingetroffenen Toten. Als sie beim Pförtner vorbeikam, roch sie schon, daß eine faule Leiche darunter war. Im Leichenkeller versorgte Heidi Zenker, die Präparatorin, gerade ungerührt den streng riechenden Neuzugang. Die »men in black« des Bestattungsunternehmens, das im Auftrag des Instituts alle Leichen aus dem Hamburger Stadtgebiet ins Institut überführte, zogen sich eilig zurück. Das »Mufflon« war ein alter Mann, der drei Wochen tot in seiner Wohnung gelegen hatte, bis eine Nachbarin die Polizei angerufen hatte. Wieder ein Mensch, den niemand vermißte, eine deprimierende Vorstellung. Als Leonie sich über die Leiche beugte, beschloß sie, sich auf dem Nachhauseweg nur einen gemischten Salat zu besorgen. Sie hatte sich in den letzten acht Jahren an manches gewöhnt, aber faule Leichen schlugen ihr immer noch ein wenig auf den Magen. Sie fand keine äußeren Anzeichen für einen nicht-natürlichen oder gewaltsamen Tod. Vermutlich würde die Staatsanwaltschaft auf eine Obduktion verzichten. Falls die Verwandten einverstanden waren, würde Leonie den Toten trotzdem zur Obduktion dabehalten. Die AiPler und Assistenten in der Facharztausbildung brauchten die Praxis, und manchmal wollten Verwandte auch Klarheit über die Todesursache.
Es waren noch drei weitere Tote zu besichtigen. Danach schob Heidi Zenker die Rollbahren wieder in den großen Kühlraum, wo die Neuzugänge auf die Obduktion oder die Freigabe warteten. Leonie stand einen Moment unschlüssig am Fuß der Treppe, dann ging sie in den Raum, in dem in Kühlfächern die Leichen der bereits obduzierten Toten bis zu ihrer Freigabe aufbewahrt wurden. Sie öffnete die Tür, hinter der die Leiche der unbekannten Ermordeten lag, die sie am Morgen seziert hatte. Sie zog sie heraus und starrte auf sie hinunter. Leonie hatte plötzlich das Gefühl, daß sie etwas übersehen hatte, etwas Entscheidendes. Aber sie hatte nicht die geringste Ahnung, was es sein konnte. Heidi Zenker trat zu ihr.
»Brauchen Sie mich noch, Frau Doktor Simon?«
»Nein, danke, Sie können ruhig nach Hause gehen.«
»Die hatte auch keinen schönen Tod.« Heidi Zenker sah auf das stille Gesicht der Toten.
»Wer hat den schon.« Leonie schob die Leiche zurück und schloß die Tür. »Wissen Sie, was Woody Allen mal gesagt hat? ›Ich hab keine Angst vorm Sterben, ich möchte bloß nicht dabei sein, wenn's passiert.‹«
Heidi Zenker grinste. »Ich könnt's nicht besser ausdrücken.«
Sie ging die Treppe rauf und verschwand. Leonie blieb allein im Leichenkeller zurück. Sie mußte noch ein paar Formulare unterschreiben. So eigenartig es für die meisten Menschen klingen mußte, aber Leonie war gern allein da unten. Für sie war es der sicherste Ort der Welt, ein Ort der Wissenschaft und der Stille. Die Lebenden waren es, die man fürchten mußte, nicht die Toten.
Eine halbe Stunde später verließ Leonie das Institut. Sie hatte keine Lust nach Hause zu gehen, aber es blieb ihr wohl nichts anderes übrig. Unterwegs hielt sie bei einem türkischen Gemüsehändler, der noch geöffnet hatte, und kaufte sich ein paar Tomaten, eine Gurke, ein Fladenbrot und ein großes Stück Schafskäse. Sie wollte wenigstens etwas Gutes essen, bevor sie den Rest des Abends Regale aufstellte.
Es war schon kurz nach acht Uhr, als sie in die Tiefgarage des Neubaus fuhr, in dem sie wohnte. Eine Tiefgarage war ein viel unwirtlicherer Ort als der Leichenkeller im Institut, fand Leonie. Und es roch auch nicht besser. Durch zwei schwere Eisentüren kämpfte sie sich zum Fahrstuhl im Untergeschoß. Sie fluchte, als sie merkte, daß der Fahrstuhl nicht kam. Sie hörte Stimmen und Lachen, die aus einem der oberen Stockwerke zu ihr drangen. Bestimmt standen die Idioten in der Lichtschranke. Konnten die sich nicht woanders unterhalten? Leonie hatte keine Lust, länger zu warten, und stapfte die Treppe hoch. Es wurde höchste Zeit, daß sie ihr Konditions- und Krafttraining wieder aufnahm. Sie hatte die vergangenen vier Wochen ausgesetzt und merkte langsam, daß es ihr fehlte. Schon beim Treppensteigen wurde sie kurzatmig. Als sie in ihrem Stockwerk ankam, fuhr der Fahrstuhl wieder. Typisch! Sie schloß auf und lud als erstes ihre Einkäufe in der unaufgeräumten Küche ab. Sie nahm sich nicht mal Zeit, den Anrufbeantworter abzuhören oder sich umzuziehen, sondern machte sich sofort an die Zubereitung des Salates. Der Hunger wühlte in ihren Eingeweiden. Gerade wollte Sie anfangen zu essen, als es klingelte. Resigniert ließ sie die Gabel sinken und ging zur Tür. Sie linste durch den Spion und blickte auf ein Flaschenetikett: Veuve Clicquot Ponsardin. Dann verschwand das Etikett, und Schneiders lachendes Gesicht tauchte in ihr Blickfeld. Sie öffnete.
»Was machen Sie denn hier? Woher wissen Sie überhaupt, wo ich wohne?« Das klang nicht sehr einladend, und Schneiders Lächeln erstarrte.
»Frau Thiele war so freundlich.«
»Na, der werd ich was, erzählen«, murmelte Leonie. Sie hatte Frau Thiele strikt angewiesen, ihre private Adresse und Telefonnummer nur nach Rücksprache mit ihr herauszugeben.
»Haben Sie mich nicht erwartet? Ich hatte auf Ihren Anrufbeantworter gesprochen.« Schneider hielt ihr die Champagnerflasche hin. »Zum Einzug.«
Leonie nahm ihm die Flasche ab. »Vielen Dank. So was Teures hab ich noch nie getrunken, glaube ich.«
»Dann wird's aber höchste Zeit. Wenn ich Sie störe, gehe ich wieder. Sie müssen's nur sagen.«
Leonie öffnete die Tür weit, um ihn hereinzulassen. »Schon gut, kommen Sie rein. Ich hab gerade Schafskäsesalat gemacht, der reicht auch für zwei.« Sie ging vor ins Wohnzimmer. »Paßt dazu Champagner?«
Schneider zuckte mit den Schultern. »Ich finde, Champagner paßt zu allem. Haben Sie Ihre Gläser schon ausgepackt?« Er sah sich suchend um.
»Nur die Wassergläser. Und ich hab im Moment auch keine Ahnung, in welchem Karton die restlichen Gläser stecken.«
»Egal. Zur Not schmeckt Champagner auch aus Wassergläsern. Her damit.«
Schneider öffnete die Flasche, während Leonie die Gläser und ein zweites Gedeck für ihn holte. Mit einem satten Ploppen sprang der Korken aus der Flasche, und der Champagner schäumte in die Gläser.
»Auf die neue Wohnung und die neue Oberärztin.« Schneider stieß mit Leonie an. Leonie nahm einen tiefen Zug und genoß das Prickeln auf der Zunge.
»Hm, daran könnte ich mich gewöhnen. Ich glaube, es war doch eine ganz gute Idee, daß Sie gekommen sind.«
Sie setzten sich und machten sich über den Salat her. Schneiders Kompliment wies Leonie bescheiden zurück. Schafskäsesalat war beinahe das einzige, was sie ohne größere kulinarische Katastrophen zustande brachte. Kochen hatte sie nie interessiert, außerdem fehlte ihr auch die Zeit dazu.
Nachdem das Eis gebrochen war, unterhielten sich die beiden angeregt über Gott und die Welt. Schneider war viel gereist, vor allem in Asien. Und er teilte Leonies Liebe zur Malerei. Sie zeigte ihm ihre Bilder, für deren Erwerb sie manchmal sogar Schulden gemacht hatte. Zusammen hängten sie die beiden größten und schwersten auf. Er fragte sie, wie sie das ohne ihn hätte schaffen wollen. Und um Mitternacht waren sogar alle Regale zusammengebaut und aufgestellt. Leonie spendierte jedem noch ein Bier, dann schickte sie ihn weg. Natürlich nicht, ohne sich zu bedanken und eine angemessene Revanche zu versprechen. Ihr kam noch in den Sinn, daß sie lange keinen so angenehmen Abend mit einem so netten, humorvollen Mann verbracht hatte, bevor sie todmüde ins Bett fiel. Sie schlief tief und traumlos, bis der Wecker um sechs Uhr klingelte, und fühlte sich, bis auf einen leichten Muskelkater so wohl, wie schon seit Tagen nicht mehr. Champagner schien ihr gut zu bekommen.
Im Institut wartete ihre Studentengruppe auf sie. Die beiden anderen Gruppen, die von Professor Cordes und Professor Meißner unterrichtet wurden, waren schon unterwegs. Ein Blick auf ihre Uhr bestätigte ihr aber, daß ihre Verspätung noch im Rahmen der akademischen Viertelstunde lag. Leonie hielt den Einführungskurs Rechtsmedizin ab, den alle Medizinstudenten nolens volens belegen mußten. Die meisten hatten nicht die Absicht, sich später auf Rechtsmedizin zu spezialisieren und absolvierten die Pflichtveranstaltungen in dem Bereich oft nur mit mäßigem Interesse. Nach dem Ende der Veranstaltung ging sie in ihr Büro. Als sie an der Pforte vorbeieilen wollte, hielt Pfeifer sie fest. Er deutete auf die schäbige kleine Sitzgruppe in der Eingangshalle, wo ein Mann saß, der nervös mit den Füßen scharrte.
»Der wartet schon seit einer viertel Stunde auf Sie, Frau Doktor Simon. Er sagt, er kommt wegen seiner Frau. Beckstein heißt er. Sagt Ihnen das was?«
»Nein, aber ich werde mit ihm reden.«
Leonie ging auf den Mann zu. Er war wahrscheinlich in den Vierzigern, sah aber älter aus. Seinem geröteten, aufgeschwemmten Gesicht nach ging er keiner Flasche aus dem Wege.
»Herr Beckstein? Sie haben nach mir gefragt?«
Der Mann sprang hastig auf. »Sie sind Doktor Simon?« Leonie nickte.
»Oh, ach so, ja.« Er schien was anderes erwartet zu haben.
»Was kann ich für Sie tun?«
Beckstein holte eine zerknitterte Tageszeitung aus der Brusttasche seines speckigen Jacketts. Auf der Titelseite des Boulevard-Blattes prangte unter einer reißerischen Schlagzeile in mindestens fünfzehn Millimeter hohen Buchstaben das Foto des gestrigen Mordopfers.
Der Mann hielt Leonie die Zeitung unter die Nase.
»Das da ist meine Frau. Aber ich bin's nicht gewesen.«
Es dauerte eine Weile, bis sie Kaminski ans Telefon bekam. Er meldete sich mit vollem Mund. Sie hatte ihn offenbar beim Bürofrühstück gestört.
»Simon. Guten Appetit. Sagt Ihnen der Name Monika Beckstein etwas?«
Kaminski schluckte und fragte, schon einigermaßen verständlich: »Wieso? Wer ist das?«
»Unsere Tote von gestern.« Leonie blickte auf den Mann, der ihr gegenübersaß und mit zitternden Händen einen Becher Kaffee zum Mund führte. »Ihr Mann sitzt mir gegenüber.«
»Ich bin in einer halben Stunde bei Ihnen. Halten Sie ihn fest.«
Leonie legte auf und lächelte Beckstein freundlich an. »Hauptkommissar Kaminski wird gleich hier sein.«
Beckstein drehte den Becher in seinen Händen. »Aber Sie sind bei dem Gespräch dabei, oder?«
»Wenn Sie es wünschen, Herr Beckstein. Aber es ist an sich nicht meine Aufgabe.«
Er nickte, sagte aber nichts.
»Warum sind Sie zu mir gekommen? Wollen Sie Ihre Frau noch einmal sehen?«
Beckstein hob erschrocken den Kopf. »Nee, bloß nich. Ich meine, ich kann so was nich sehen. Also, grundsätzlich.« Er machte eine Pause. »Ich wollte bloß wissen, was Sie gefunden haben. Sie haben sie doch untersucht, oder nicht?«
»Ich hab die Leiche obduziert. Aber ich darf Ihnen über das Ergebnis keine Auskunft geben.«
»Aber sie ist doch ... war doch meine Frau.«
»Das spielt in dem Zusammenhang keine Rolle. Tut mir leid.«
»In der Zeitung stand, daß sie ermordet worden ist.«
»Soviel kann man in jedem Fall sagen.«
»War's schlimm? Ich meine, für sie ... bis sie ...« Er schluckte.
Diese Frage beantwortete Leonie immer gleich, egal was passiert war. »Nein, ich glaube nicht, daß Ihre Frau sehr gelitten hat, als sie starb. Sie war sicher sofort tot. Sagen Sie, Herr Beckstein, Sie haben mir erzählt, daß Ihre Frau vor einiger Zeit zu Hause ausgezogen ist. Wann war das genau?«
»Ich weiß nich mehr. So vor drei, vier Monaten.«
»Und danach haben Sie sie nicht mehr regelmäßig gesehen?«
»Nee, wollte Sie ja nich. Deswegen isse ja abgehauen.«
»Sie haben vorhin gesagt, Sie waren es nicht. Wie kommen Sie denn darauf, daß man Sie beschuldigen könnte?«
Becksteins linkes Auge fing an zu zucken. Der Mann war offensichtlich in Panik.
»Is mir nur so rausgerutscht. Den Ehemann haben die Bullen doch immer als erstes an den Eiern. Der is ja immer an allem schuld.«
Er versuchte, seine zitternden Hände ruhig zu halten. Schließlich überwand er seine Scham und zog einen Flachmann aus der Tasche. »'tschuldigung. Aber auf den Schreck brauch ich was Kräftiges.«
Nachdem er getrunken hatte, wurde er ruhiger.
Als Kaminski in ihr Büro stürmte, hatte Leonie herausgefunden, daß Beckstein seine Frau zuletzt vor zweieinhalb Wochen gesehen hatte. Er hatte sie bei ihrer Freundin abgepaßt und wollte sie überreden, wieder zu ihm zurückzukommen. Es gab einen Streit, und er schlug zu. »Nur so'n Klaps, damit sie aufhört rumzuschreien.« Ihre neue Adresse kannte er nicht. Aber das glaubte ihm Leonie nicht.
Kaminski war schlecht rasiert und sah unausgeschlafen aus, aber im Gegensatz zu anderen Männern machte ihn das nicht unattraktiver. Er brachte ein halbes Lächeln zustande, als er Leonie begrüßte, dann wandte er sich an Beckstein.
»Warum haben Sie sich heute morgen nicht sofort bei der Polizei gemeldet? Frau Doktor Simon hat mit den Ermittlungen nichts zu tun.«
Kaminski sah Leonie nicht an, aber ihr war klar, daß sich der letzte Satz an ihre Adresse richtete und die Botschaft ›Misch dich ja nicht ein!‹ enthielt. Sie fing an, sich zu ärgern. Dieser Kaminski hatte wirklich ein Händchen dafür, sie in Minutenschnelle auf die Palme zu bringen.
Beckstein wand sich. »Weiß nich. War eben so'ne Idee.«
Kaminski hockte sich auf die Kante von Leonies Schreibtisch, als wäre das sein Büro und nicht ihres. »Verstehe. Und Sie haben sich weiter gar nichts dabei gedacht.«
Beckstein nickte, beäugte aber Kaminski unsicher, der sich jetzt zu ihm beugte und schnüffelte.
»Ist das Alkohol, was ich da rieche?«
»Ich brauchte einen Schluck auf den Schreck heute morgen. Ist das verboten?«
»Wie kommen Sie denn darauf? Es ist auch nicht verboten, sich bei der Rechtsmedizin nach einer Leiche zu erkundigen. Aber es beflügelt meine Phantasie.«
Beckstein sah Leonie vorwurfsvoll an. »Sehen Sie?«
Kaminski blickte über die Schulter zu Leonie. »Was meint er damit?«
»Herr Beckstein befürchtet, daß die Polizei ihn verdächtigen könnte.«
Kaminski wandte sich wieder an Beckstein. »Tatsächlich? Klar tun wir das. Reine Routine. Wenn Sie's nicht waren, ist das kein Problem für Sie. Oder?«
Beckstein schüttelte den Kopf. »Ich war's nicht. Ganz bestimmt nicht.«
Kaminski rutschte vom Schreibtisch. »Na fein. Dann würde ich vorschlagen, wir fahren jetzt ins Präsidium und unterhalten uns ein bißchen.«
Beckstein sah hilfesuchend zu Leonie. »Kann sie dabeisein?«
»Nein, kann sie nicht.«
»Tut mir leid, Herr Beckstein. Falls Sie sich's anders überlegen und Ihre Frau sehen wollen, kommen Sie ruhig noch einmal her. Das kann Ihnen niemand verweigern.«
Leonie sah Kaminski kampflustig an. Kaminski zuckte bloß mit den Schultern und öffnete die Tür für Beckstein.
»Dann wollen wir mal.«
Leonie schloß hinter den beiden die Tür und ignorierte den fragenden Blick ihrer Sekretärin. Es war sonnenklar, daß Kaminski vermutete, Beckstein habe Einzelheiten der Obduktion zu erfahren versucht, um sich besser auf die Befragung durch die Polizei vorbereiten zu können. Beckstein war natürlich hochverdächtig. Er war offensichtlich alkoholabhängig; er gab zu, seine Frau geschlagen zu haben, und sicher nicht zum ersten Mal; sie hatte ihn verlassen, und er wollte sie zurückhaben. Frauen, die sich von ihren gewalttätigen Ehemännern trennen wollten, endeten leider oft in der Leichenhalle. Leonie hegte keine Sympathie für Männer wie Beckstein, dennoch hatte sie den Eindruck, daß er die Wahrheit gesagt hatte. Leonie hielt sich selbst für einen klar und rational denkenden und handelnden Menschen, mit dem Begriff der Intuition ging sie deshalb sparsam um. Aber sie wußte auch, daß das menschliche Bewußtsein so seine Tricks besaß, um auf unterbewußte oder halb verarbeitete Fakten aufmerksam zu machen. Warum sie an Becksteins Unschuld glaubte, hätte Leonie jedoch nicht sagen können.
Den Rest des Tages dachte sie nicht mehr an die ermordete Frau, die jetzt den Namen Monika Beckstein trug. Leonie wurde überraschend zu einer Außensektion nach Itzehoe gerufen, was häufiger vorkam, weil Teile von Schleswig-Holstein und auch von Niedersachsen rechtsmedizinisch vom Hamburger Institut betreut wurden. Mit ihr zusammen fuhren Heidi Zenker als Präparatorin und Doktor Meiling Zhao als zweite Sekantin, da vor Ort kein zweiter Rechtsmediziner aufzutreiben war. Meiling Zhao war kurz vor Leonie als neue Assistenzärztin ans Institut gekommen. Sie hatte ihre Facharztausbildung in Düsseldorf abgeschlossen und war dann nach Hamburg gewechselt, wo sie bei ihrem Bruder wohnte. Ihre übrige Familie lebte in Shanghai, und sie hatte sie schon mehrere Jahre nicht mehr gesehen. Leonie vermutete, daß ihr Heimweh zusetzte, was sie sich aber, wenn es denn so war, nicht anmerken ließ. Meiling war eine zarte chinesische Schönheit, deren höfliches Lächeln und unerschütterliche Freundlichkeit ein stählernes Selbstbewußtsein und große Zielstrebigkeit und Zähigkeit verbargen. Sie hatte Leonie erzählt, daß sie, wenn sie alles gelernt habe, was es für sie in Deutschland zu lernen gab, nach China zurückkehren wolle, um dort als Rechtsmedizinerin zu arbeiten. Und Leonie bezweifelte nicht, daß sie es dort bald zur Institutsleiterin bringen würde, denn abgesehen von Fleiß und Willenskraft verfügte sie über ein erhebliches Talent. Die männlichen Institutsmitarbeiter hatten sich bei Meiling der Reihe nach einen Korb geholt und betrachteten sie inzwischen nicht mehr als exotische Zauberfee, sondern einfach als kompetente Kollegin.
In Itzehoe erregte das Damentrio, und insbesondere Doktor Zhao, bei den Polizeibeamten kein geringes Aufsehen, und ihre Arbeit wurde dementsprechend interessiert bis mißtrauisch beobachtet. Der Fall war nicht sonderlich aufregend, ein äußerlich unverletzter Toter neben dem Bahngleis, und Leonie und Meiling waren nach der Sektion übereinstimmend der Ansicht, es handle sich um einen natürlichen Tod durch Myokardinfarkt. Meiling, die sich auf Histologie spezialisiert hatte, wollte die Gewebeproben aber noch gründlich untersuchen.
Es war noch hell, als die drei Frauen wieder in Hamburg auf dem Institutsparkplatz eintrafen. Leonie registrierte flüchtig, daß auf der Straße vor dem Institut ein Wagen parkte, an dessen Steuer eine junge Frau saß, aber sie schenkte dem keine weitere Beachtung. Heidi Zenker hatte Dienstschluß und stieg gleich in ihren eigenen Wagen um, Leonie und Meiling betraten zusammen das Institut. Meiling lief die Treppe zu ihrem winzigen Büro im ersten Stock hinauf, das sie noch dazu mit Bernd Fuchs teilen mußte, dem einzigen Kollegen, der die Hoffnung noch nicht völlig aufgegeben hatte, mehr als nur ein Lächeln von ihr geschenkt zu bekommen. Leonie betrat das zentrale Instituts-Sekretariat ihrem Büro gegenüber, um nachzusehen, ob ein Fax für sie gekommen war. Die beiden Sekretärinnen, die für alle ärztlichen Mitarbeiter zuständig waren, hatten schon Feierabend. Aber in der danebenliegenden Bibliothek brüteten noch ein Doktorand und zwei AiPler über dicken Wälzern. Und an einem der verwaisten Sekretariats-Schreibtische saß zu Leonies Verwunderung der am Vortag verunglückte Doktor Hinrichs, dem sie den Fall Beckstein zu verdanken hatte. Sein linkes Bein steckte in einem eindrucksvollen Gips, zwei Krücken lagen neben dem Tisch. Hinrichs hatte sich aus seinem Fach bedient und sah seine Post durch.
»Was machen Sie denn hier? Sie sind doch krank geschrieben?«
»Ja, und? Soll ich mich deswegen zu Tode langweilen?«
Peter Hinrichs sah sie mit blutunterlaufenen Augen an. Offensichtlich hatte bei dem Unfall nicht nur sein Bein was abgekriegt. Aus der steifen Haltung seines Oberkörpers schloß Leonie, daß er sich außerdem ein paar Rippen angeknackst hatte.
»Sie riskieren Ihren Versicherungsschutz, wenn Sie trotz Krankschreibung hier herumstolpern und Ihnen was passiert. Aber das wissen Sie ja. Sie sehen übrigens beschissen aus, deswegen verkneife ich mir die Frage, wie's Ihnen geht.«
Hinrichs Lachen klang mehr wie ein Knurren, fand Leonie.
»Aber ich sollte vielleicht fragen, wie's Ihnen geht. Sie haben meinen jungen Freund Kaminski kennengelernt, wie ich hörte. Gefällt er Ihnen?«
Leonie hatte nicht die Absicht, sich provozieren zu lassen. »Wenn man so ungehobelte Typen wie Sie mag, Hinrichs, ist er wahrscheinlich eine Offenbarung. Sind Sie im gleichen Motorrad-Club?«
Hinrichs sah sie verdutzt an. »Wie kommen Sie denn darauf? Hat er Ihnen das erzählt?«
»War nur so eine Idee von mir. Wahrscheinlich, weil Kaminski auch in schwarzes Leder geschweißt herumläuft.«
Hinrichs warf einen wehmütigen Blick auf sein linkes Bein, dessen schwarzlederne Umhüllung bis zum Oberschenkel aufgeschlitzt war. »Das war meine Lieblingshose. Hab ich in L. A. gekauft.«