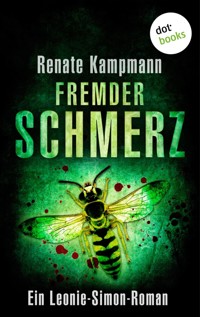Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Fall für Leonie Simon
- Sprache: Deutsch
Wenn Tote sprechen: "Im Schattenreich" von Renate Kampmann – jetzt als eBook bei dotbooks. Rechtsmedizinerin Leonie Simon ermittelt in eigener Sache: Die Hamburger Ärztin hat ein dunkles Geheimnis – vor über fünfundzwanzig Jahren wurde ihre Mutter ermordet. Das nie aufgeklärte Verbrechen verfolgt sie noch heute in ihren Träumen. Um endlich die Schatten der Vergangenheit loszuwerden, trifft sie eine Entscheidung: Sie muss den Mörder ihrer Mutter finden. Doch zunächst fordert die Arbeit im Institut die ganze Aufmerksamkeit der Rechtsmedizinerin. Ein ermordeter ausländischer Politiker, ein toter Polizist und eine Kellerleiche halten die Mitarbeiter in Atem. Als das Institut ins Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik gerät, liegen die Nerven aller blank. Und Leonie hat auf einmal das Gefühl, verfolgt zu werden … Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Im Schattenreich" von Renate Kampmann. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag. Die Presse über Renate Kampmann: "Dr. Leonie Simon, Rechtsmedizinerin – wenn Renate Kampmann sie nicht erfunden hätte, würde sie in der deutschen Krimi-Landschaft fehlen!" Doris Gercke "Besser als Patricia Cornwell." Bild am Sonntag "Nichts für schwache Nerven." FREUNDIN
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rechtsmedizinerin Leonie Simon ermittelt in eigener Sache: Die Hamburger Ärztin hat ein dunkles Geheimnis – vor über fünfundzwanzig Jahren wurde ihre Mutter ermordet. Das nie aufgeklärte Verbrechen verfolgt sie noch heute in ihren Träumen. Um endlich die Schatten der Vergangenheit loszuwerden, trifft sie eine Entscheidung: Sie muss den Mörder ihrer Mutter finden. Doch zunächst fordert die Arbeit im Institut die ganze Aufmerksamkeit der Rechtsmedizinerin. Ein ermordeter ausländischer Politiker, ein toter Polizist und eine Kellerleiche halten die Mitarbeiter in Atem. Als das Institut ins Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik gerät, liegen die Nerven aller blank. Und Leonie hat auf einmal das Gefühl, verfolgt zu werden …
Die Presse über Renate Kampmann:
„Dr. Leonie Simon, Rechtsmedizinerin – wenn Renate Kampmann sie nicht erfunden hätte, würde sie in der deutschen Krimi-Landschaft fehlen!“ Doris Gercke
„Besser als Patricia Cornwell.“ Bild am Sonntag
„Nichts für schwache Nerven.“ FREUNDIN
Über die Autorin:
Renate Kampmann, geboren 1953 in Dortmund, studierte Germanistik und Geschichte. Sie war Dramaturgie-Assistentin bei Peter Zadek am Bochumer Schauspielhaus, arbeitete als Journalistin, Hörspiel-Redakteurin und TV-Producerin. Seit 1995 lebt sie als freie Schriftstellerin in Hamburg. Sie schrieb unter anderem Drehbücher für die TV-Serien Bella Block, Doppelter Einsatz und Das Duo.
Bei dotbooks erscheint Renate Kampmanns Krimi-Reihe rund um Rechtsmedizinerin Dr. Leonie Simon, die folgende Bände umfasst:
Die Macht der Bilder. Ein Leonie-Simon-Roman
Schattenreich. Ein Leonie-Simon-Roman
Fremdkörper. Ein Leonie-Simon-Roman
***
Neuausgabe Oktober 2015
Copyright © 2003 by Kindler Verlag GmbH, Berlin
Copyright © 2015 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/gnatuk
ISBN 978-3-95824-236-4
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Schattenreich an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
http://instagram.com/dotbooks
Renate Kampmann
Schattenreich
Ein Leonie-Simon-Roman
dotbooks.
Prolog
Tief drang der Dorn der Brombeerranke ins zarte Fleisch des Kinderfingers ein, und ein dicker roter Blutstropfen quoll augenblicklich hervor, gefolgt von einem zweiten, einem dritten. Das hoch aufgeschossene dunkelhaarige Mädchen hatte bei dieser Operation nicht mit der Wimper gezuckt und reichte nun den Dorn an eine auffallend hübsche zarte Blonde weiter. Die Kleine starrte wie hypnotisiert auf den blutenden Finger der Freundin.
»Ich glaube, mir wird gleich schlecht.«
Die Dunkle schüttelte missbilligend den Kopf. »Stell dich nicht so an. Willst du nun mein Blutsbruder sein oder nicht?«
»Bruder geht gar nicht.«
»Na, dann eben Blutsschwester. Was ist jetzt? Tut auch gar nicht weh.«
Die Blonde nahm mit spitzen Fingern den Dorn, an dem das Blut der Freundin klebte. Vorsichtig stach sie in ihren Zeigefinger, aber so leicht, dass die Haut kaum verletzt wurde. »Au. Von wegen tut nicht weh.«
Kurz entschlossen nahm ihr die Dunkle den Dorn aus der Hand und stieß blitzschnell zu. Die Überrumpelte schrie empört auf. »Du bist gemein. Huh, mein Finger, mein Finger!«
Ein einziger Tropfen quoll hervor, und rasch presste die andere ihren immer noch heftig blutenden Finger auf den der Kleinen, sodass sich ihr Blut vermischte.
»Mein Blut ist dein Blut, und dein Blut ist mein Blut. Jetzt sind wir bis ans Ende unseres Lebens miteinander verbunden.«
Feierlich blickten sich die beiden Mädchen an, so ernst und wahrhaftig, wie man es mit neun Jahren nur sein kann.
»Ein Blutsbruder ist das Wichtigste auf der Welt, wichtiger als alle anderen Menschen«, erklärte das dunkelhaarige Mädchen.
»Und wenn man heiratet?«, fragte die Blonde skeptisch.
»Ich heirate nicht.«
»Woher willst du das wissen? Ich heirate mal einen Prinzen oder einen Millionär. Dann bekomme ich ganz viele schöne Kleider und eine Krone aus Diamanten.«
»Du spinnst ja.« Die schlaksige Dunkelhaarige tippte sich an die Stirn. »Prinzen gibt's gar nicht mehr, und Millionäre sind alle hässliche alte Knacker.«
»Das ist überhaupt nicht wahr.« Die Kleine zog eine Schnute, worüber die Freundin lachen musste.
»Heh, wir sind ja noch gar nicht fertig.«
»Nochmal piken lasse ich mich aber nicht.«
»Wir müssen noch etwas vergraben. Jede muss was geben, das ihr gehört.«
»Wieso?«
»Na, eben zur Besiegelung des Freundschaftspaktes.«
»Und was?«
»Etwas, das du lieber behalten würdest. Zum Zeichen dafür, dass dir unsere Freundschaft wirklich wichtig ist.«
Die Kleine schüttelte den Kopf. »Steht das auch in deinem blöden Karl-May-Buch?«
»Ja, und Karl May ist nicht blöd. Jedenfalls nicht so blöd wie deine Liebesromane.«
Die Dunkle vergrub ihre Hände in den Hosentaschen und fand nach einigem Wühlen, was sie suchte. Sie hielt ein Taschenmesser hoch. »Das hat mir mein Vater zum Geburtstag geschenkt. Wahrscheinlich krieg ich Dresche, wenn er merkt, dass es weg ist.«
Die Blonde überlegte, sichtlich unwillig, und griff schließlich in ihr Haar. »Das ist meine schönste Haarspange.« Auf der offenen Handfläche präsentierte sie eine Haarspange in Form einer voll erblühten Rose.
»So 'n billiges Ding? Davon hast du doch zu Hause eine ganze Schachtel voll.«
Die Dunkle deutete auf einen Ring, den ihre Freundin trug. Er war aus Gold und besetzt mit einem herzförmig gefassten synthetischen Aquamarinstein. »Den vergraben wir.«
Die Kleine hielt erschrocken die Luft an. »Den Ring? Nein! Nein, den geb ich nicht her.«
Die Dunkle sah sie an, sagte aber kein Wort. Der Blonden rannen plötzlich dicke Tränen aus den Augen. Unter kleinen Schluchzern streifte sie den Ring vom Finger und gab ihn der anderen.
Der üppige, mannshohe Rhododendronstrauch, an dessen Fuß das dunkelhaarige Mädchen mit bloßen Händen zu graben begann, begrenzte einen kleinen Park zu einer der hübschen Wohnstraßen in Klein Flottbek, einem der besseren Hamburger Wohnviertel, die sich entlang der Elbe bis nach Rissen hin erstreckten. Park und Straßen waren am späten Vormittag wenig belebt. Die beiden Mädchen fuhren deshalb erschrocken zusammen, als sie angesprochen wurden.
»Was macht ihr denn da?«
Ein Mädchen von etwa zwölf Jahren näherte sich den beiden Verschwörerinnen. Ihre leicht vorstehenden Augen weiteten sich, um zu sehen, was da gerade unter einer Schicht Erdreich verschwand.
»Das geht dich gar nichts an, du blöde Ziege.«
Die kleine Blonde funkelte das ältere Mädchen wütend an. Die nahm die Beleidigung ungerührt hin und deutete auf das Kleid der Blonden.
»Du hast dich schmutzig gemacht.« Wegen ihrer klobigen Zahnspange nuschelte sie stark.
»Na und? Was machst du eigentlich hier? Du hast doch noch Schule.«
Die Ältere senkte den Blick. »Deutsch ist ausgefallen.«
»Du lügst. Du schwänzt bloß wieder.« Die Kleine lächelte triumphierend. »Wenn das Papa erfährt, kannst du was erleben.«
Die Dunkelhaarige mischte sich ein. »Wir schwänzen doch auch.«
Ihr tat das Mädchen Leid. Obwohl drei Jahre älter als die kleine Schwester, war sie ihr in jeder Hinsicht unterlegen. Die Dunkelhaarige blickte von der einen zur anderen und fragte sich, ob bei der Geburt der einen im Krankenhaus wohl eine Verwechslung stattgefunden hatte. So etwas war schon passiert, das hatte sie in einer der Zeitungen gelesen, in die ihre Pausenbrote eingewickelt waren.
»Ich darf das. Weil ich schlauer bin als sie.«
Die Ältere nickte zustimmend. Nach kurzer Überlegung langte sie in die Tasche ihres abgetragenen Anoraks und förderte einen glänzenden Lippenstift zutage. Auf der offenen Handfläche hielt sie ihn der Schwester hin, die ohne zu zögern danach griff. Es war ein ganz neuer, zart-rosafarbener Stift. Die Augen der Kleinen glänzten.
»Woher hast du den? Geklaut?«, wollte die Dunkelhaarige von der Älteren wissen.
Die schüttelte nur den Kopf und sah ihre kleine Schwester an.
»Kann sein, dass ich Papa nichts sage. Ich bin schließlich keine Petze.« Der Lippenstift verschwand in ihrer Rocktasche. Sie wandte sich der Freundin zu. »Los, komm, wir gehen zu der Frau mit den kleinen Kätzchen. Ob die schon die Augen offen haben?«
»Willst du mitkommen?« Die Dunkelhaarige blickte das ältere Mädchen fragend an. Nach kurzem Zögern schüttelte sie den Kopf, wandte sich ab und ging. Ein unansehnliches Kind mit bereits sprießenden Brüsten und dem plumpen Gang der Übergewichtigen.
Am Ausgang des Parks lehnte lässig ein halbwüchsiger Junge an einem Baumstamm. Er rauchte und zündete sich gerade eine neue Zigarette an der alten an, als das Mädchen vorbeikam.
»Hallo.«
Verblüfft hob sie den Blick und vergewisserte sich, dass er wirklich sie meinte. »Hallo«, antwortete sie zaghaft.
»Willst du eine?« Der Junge hielt ihr seine Zigarettenpackung hin.
Dem Mädchen war bisher nie der Gedanke gekommen, eine Zigarette zu rauchen. Gar nicht auszudenken, welche häusliche Strafe das Rauchen mit sich brächte. Aber jetzt griff sie ganz automatisch nach der Zigarette, die einladend ein Stück aus der Packung herausragte. Der Junge nickte aufmunternd, aber er lächelte nicht. Er hatte kalte graue Augen und einen aufgekratzten Pickel am Kinn. Sie fand ihn hübsch und fragte sich, was er von einer wie ihr wollte.
Kapitel 1
»Das schaffen Sie nie. Ich komme zu spät. Ich komme viel zu spät.«
Dr. Leonie Simon warf einen amüsierten Seitenblick auf ihren Chef, Professor Cordes, den Leiter des Instituts für Rechtsmedizin der Universitätsklinik Eppendorf. Als sie an einer roten Ampel anhalten musste, blickte er zum zigsten Mal innerhalb der letzten fünf Minuten auf seine Armbanduhr. Er erinnerte Leonie an das weiße Kaninchen aus Alice im Wunderland, und sie konnte sich das Lachen nur mit Mühe verkneifen. »Machen Sie sich nicht verrückt. Ich bin zwar nicht Michael Schumacher, aber Ihren Flieger nach Frankfurt erwischen Sie allemal.«
Der Professor umklammerte seinen Aktenkoffer und sah starr geradeaus. Leonie hatte sich angeboten, ihn zum Flughafen zu fahren, weil das bestellte Taxi nicht erschienen war. Professor Cordes war normalerweise die Ruhe selbst, nur wenn er unter Zeitdruck geriet, wurde er manchmal etwas kopflos. In diesem speziellen Fall konnte Leonie seine Nervosität allerdings recht gut verstehen. Sollte er das Flugzeug nach Frankfurt verpassen, würde er sehr wahrscheinlich auch den Anschlussflug nach Tokio nicht erreichen. Eine Verspätung von einem vollen Tag war eine ziemlich peinliche Angelegenheit und würde keinen guten Eindruck bei den japanischen Kollegen hinterlassen.
Knapp zwanzig Minuten vor Abflug der Maschine nach Frankfurt bremste Leonie direkt vor dem Eingang zur Abflughalle vom Terminal 4 des Hamburger Flughafens. Ihr Chef hatte hektische Flecken im Gesicht, und er vergaß völlig, sich von seiner leitenden Oberärztin zu verabschieden, nachdem sie ihm sein Gepäck gereicht und ihm einen guten Flug gewünscht hatte. Leonie sah ihm lächelnd nach und zeigte einem Taxifahrer die kalte Schulter, der sie anhupte und beschimpfte, weil sie seiner Ansicht nach nicht schnell genug wegfuhr.
Es war ein kühler Oktobernachmittag. Die Wolkendecke war aufgerissen, und die Sonne tauchte Hamburgs Straßen in warmes Herbstlicht. Leonie hatte keine große Lust, sofort wieder an ihren Schreibtisch zurückzukehren. Während der Abwesenheit von Professor Cordes hatte sie die Institutsleitung inne, was ihrem Terminkalender schlecht bekommen würde. Zwar lud ihr Chef, auch wenn er in Hamburg war, so viel Arbeit wie möglich bei ihr ab und pickte sich selbst möglichst die Rosinen aus dem Kuchen. Aber die von ihr nicht geliebten Gremien- und Ausschusssitzungen blieben ihr dann meist erspart. Natürlich wurde von ihr erwartet, und sie richtete diese Erwartung auch an sich selbst, dass sie sich zu gegebener Zeit um die Leitung eines Institutes bewerben würde. In letzter Zeit jedoch zweifelte Leonie Simon, ob das der richtige Weg für sie war.
Mit diesen Gedanken beschäftigt, fuhr Leonie geradeaus die Sengelmannstraße entlang, anstatt nach rechts in die Alsterkrugchaussee einzubiegen. Sie bemerkte ihren Fehler erst, als sie an der Kreuzung Maienweg halten musste. In einem nur halb bewussten Entschluss bog sie nicht rechts in Richtung Eppendorf ab, sondern fuhr bis zur nächsten Ampelkreuzung und setzte den Blinker nach links. Die Alsterdorfer Straße lief direkt auf den Ohlsdorfer Friedhof zu. Leonie fuhr durch den Haupteingang und parkte den Wagen hinter dem imposanten Verwaltungsgebäude. Sie stieg aus und sah sich um. Vor ihren Augen erstreckte sich der mit vierhundert Hektar größte Friedhof der Welt, ein Stadtteil für sich und eine beeindruckende Parklandschaft, viel zu schön, um dort nur die Toten zu begraben. Der perfekte Ort für einen Sonntagsspaziergang. Dr. Leonie Simon jedoch war nicht zu ihrem Vergnügen gekommen. Vor über fünfundzwanzig Jahren war ihre Mutter auf dem Ohlsdorfer Friedhof beigesetzt worden, und seitdem war die Tochter nicht mehr da gewesen.
Nach so langer Zeit konnte sich Leonie nicht mehr erinnern, wo genau sich das Grab befand. Aber sie wusste, es konnte nicht allzu weit vom Haupteingang entfernt sein. Nach kurzer Überlegung überquerte sie die Straße und ging in südöstlicher Richtung, vorbei an der Bronzeplastik eines gefiederten Jünglings, hinein in die Park- und Gräberlandschaft. Sie passierte eine Anlage mit Polizeigräbern, das »Revier Blutbuche«, wandte sich dann nach Norden zu einem See, in dessen Mitte eine romantische kleine Insel lag. Sie war dicht bewachsen mit den größten Rhododendronsträuchern, die Leonie seit langem gesehen hatte, und beschattet von Buchen, Birken und Lärchen. Leonie versuchte, sich zu orientieren, und wechselte instinktiv wieder die Richtung, als sie hinter einem fast verblühten Rosengarten in einen Weg einbog. Es war inzwischen später Nachmittag, das Licht schwand und machte ihre Suche nicht leichter. Aber sie wusste, dass das Grab ihrer Mutter nun ganz in der Nähe sein musste. Reihe für Reihe schritt sie ab, suchte nach einer schlichten marmornen Grabplatte. Und da war sie. Margot Simon, 13.09.1939 – 26.04.1977. Kein Grabspruch, alles ganz einfach, geradezu unauffällig. Bepflanzt war das Grab mit Pachysandra, immergrün und pflegeleicht. Der Friedhofsgärtner konnte in den vergangenen Jahren nicht viel Arbeit damit gehabt haben. Nur ein einziges Mal hatte Leonie zusammen mit ihrer Tante Charlotte, der älteren Schwester ihrer Mutter, an dieser Stelle gestanden und zugesehen, wie ein Angestellter des Friedhofs die Urne feierlich ins Grabloch senkte. Anschließend hatte er eine Minute lang mit gefalteten Händen vor dem Grab verharrt und sich nach einer Verbeugung gemessenen Schrittes entfernt. Tante Charlotte hatte sich verstohlen ein paar Tränen von den Wangen getupft. Sie selbst hatte keine einzige Träne vergossen. Nur bruchstückhaft konnte sich Leonie an die Wochen und Monate erinnern, die auf die Ermordung ihrer Mutter folgten. Aber das Entsetzen, das sie für lange Zeit hatte erstarren lassen, das würde sie niemals vergessen.
Leonie beugte sich vor und wischte mit der bloßen Hand Schmutz und Staub fort, die der Wind über den Grabstein geweht hatte. Warum war sie gekommen? Sie wusste es nicht. Oder doch? Seit sie vor über einem Jahr nach dem Tod ihres Vaters aus seinem Tagebuch erfahren hatte, dass nicht er seine Frau umgebracht hatte, wie sie all die Jahre glaubte, arbeitete es in ihr. Die entscheidende Tagebucheintragung hatte sich ihr ins Gedächtnis gebrannt. Aber eher gehe ich selbst ins Gefängnis, als dass ich meine Tochter der Polizei ausliefere. Wenigstens das kann ich für sie tun. Gott steh uns beiden bei. Ihr Vater hatte geglaubt, sie habe die Mutter getötet, so wie sie ihn für den Mörder gehalten hatte. Mehr als fünfundzwanzig Jahre lang hatten sie sich gegenseitig verdächtigt und niemals auch nur ein Wort darüber verloren. Auch Polizei und Justiz waren offenbar von der Täterschaft ihres Vaters überzeugt gewesen, denn nach seinem wackeligen Freispruch mangels Beweisen hatte die Polizei keine weiteren Ermittlungen mehr angestellt. Seit Monaten schon nagte die Erkenntnis an Leonie, dass der Mörder ihrer Mutter, oder die Mörderin, seit einem Vierteljahrhundert frei und unerkannt lebte. Und das auch weiterhin tun würde, sofern sie nichts unternahm. Aber war das nach so langer Zeit überhaupt möglich? Die Spuren waren kalt, einige Zeugen inzwischen sicher verstorben. Leonie gehörte nicht zu den Leuten, die sich lange selbst etwas vormachen konnten. Sie wusste genau, warum sie bisher untätig geblieben war. Sie hatte Angst. Angst, alles wieder aufzuwühlen. Angst vor dem Schmerz und Angst vor dem Scheitern. Und noch mehr Angst, etwas zu finden, das sie nicht finden wollte. Aber sie wusste auch, dass sie keine Ruhe finden würde. Es lag nicht in ihrer Natur, sich mit ungelösten Fragen zufrieden zu geben. Sie musste eine Entscheidung treffen. Hier und jetzt am Grab der Ermordeten. Deshalb war sie gekommen. Leonie starrte auf die Inschrift und versuchte, sich an ihre Mutter zu erinnern. An ihr Gesicht, ihre Stimme, ihre Art, sich zu bewegen, den Geruch ihrer Haut. An ihr Lächeln. Es gelang ihr nicht. Sie konnte sich an einige Kleider ihrer Mutter erinnern. An ein Grauseidenes zum Beispiel, das sie zu besonderen Anlässen trug. Aber die Frau in dem Kleid war nur noch ein Schemen, ohne Gesicht und Stimme. Je intensiver Leonie ihre Gestalt zu fassen suchte, desto weiter zog sich ihre Mutter ins Schattenreich der Toten zurück. Wie Eurydike im Orpheus-Mythos. Sollte Leonie das als Warnung nehmen, nicht länger in die Vergangenheit zurückzuschauen, sondern nach vorn zu gehen und zu vergessen? Als Leonies Gedanken in die Realität zurückkehrten, hatte sich der Park um sie herum verändert, denn mit dem Schwinden des Lichts war Nebel aufgezogen. In dichten Schwaden schien er aus den Gräbern aufzusteigen, hüllte die Bäume und Büsche in schmutziges Weiß und dämpfte den Straßenlärm von den umliegenden Verkehrsadern. Leonie fürchtete sich nicht vor Nebel, sie liebte ihn sogar. Aber mit dem Nebel kamen auch Kälte und Feuchtigkeit. Sie fröstelte in ihrer dünnen Jacke. Raschen Schrittes entfernte sie sich ein Stück vom Grab und stellte schon bald fest, dass sie die Orientierung verloren hatte. Um das Grab ihrer Mutter zu finden, war sie kreuz und quer durch die Reihen gelaufen. Jetzt wusste sie nicht mehr, wo sie sich befand. Und der Nebel tat ein Übriges, um sie zu verwirren. Doch sofern man nicht die Nerven verlor, war es unmöglich, sich auf dem Ohlsdorfer Friedhof zu verlaufen. Wenn sie stur in eine Richtung ginge, würde sie bald auf einen der Hauptwege stoßen, und dann dürfte es nicht mehr allzu schwierig sein, zum Eingang zurückzufinden.
Tatsächlich erreichte sie bereits nach wenigen Metern einen Nebenweg, der zu einer der Hauptstraßen führen würde, auf denen auch Autos und Busse fahren durften. Leonie hielt sich rechts und marschierte durch den immer dichter werdenden Nebel, sie schätzte die Sichtweite inzwischen auf unter hundert Meter. Als wäre sie allein auf der Welt, dachte sie gerade, als eine Stimme aus dem Nebel zu ihr drang. Es war die Stimme einer Frau, und es klang wie ein leise ausgestoßener, ein wenig zittriger Schrei. Leonie sah in die Richtung, aus der der Ruf zu kommen schien. Am Rande der gerade noch sichtbaren Welt, am Fuß einer noch im vollen Laub stehenden Eiche, deren Stamm völlig von Efeu überwuchert war, glaubte sie den dunklen Schemen einer menschlichen Gestalt zu erkennen. Sie zögerte noch, als dem Schrei ein lautes und deutliches »Hilfe!« folgte. Leonie setzte sich in Bewegung. Sie lief an einem großen Behälter für Grünabfälle vorbei und hielt, einem schmalen Fußweg folgend, auf die Eiche zu. Aus den Nebelschwaden schälte sich langsam die gebeugte Gestalt einer alten Frau, die ängstlich zurückwich, als sie Leonie auf sich zukommen sah.
»Brauchen Sie Hilfe?«
Leonie sah sich um. Sie vermutete, dass jemand die alte Frau überfallen und beraubt hatte.
»Da!« Am ganzen Körper zitternd, deutete die Alte auf ein halb fertiges Grab, das neben der Eiche ausgehoben worden war. Auf dem Boden der etwa ein Meter tiefen Grube lag ein Mensch. Er lag auf dem Bauch, den rechten Arm unter dem Leib verborgen. Im Fallen musste er sich gedreht haben, denn seine Fußabdrücke in der weichen Erde an der unteren Schmalseite der Grube zeigten, dass er seitlich zum Grab gestanden hatte, wie auch ein unbekanntes Gegenüber, dessen Abdrücke ebenfalls deutlich zu erkennen waren. Leonie registrierte das alles ganz automatisch und vermied sorgfältig, die Abdrücke zu zerstören. Sie wandte sich wieder der alten Frau zu.
»Bitte, beruhigen Sie sich. Ich bin von der Polizei. Am besten, Sie setzen sich erst mal dorthin.«
Nach Leonies Erfahrung wirkte Polizei besser als Rechtsmedizin, vor allem beruhigender. Die alte Frau ließ sich zu einer Bank führen und versprach, dort sitzen zu bleiben, »bis die Kollegen eingetroffen sind«. Dann kehrte Leonie zum Grab zurück. Sie trat von der Längsseite an die Grube heran und stieg vorsichtig hinein. Das war nicht ganz leicht, ohne auf die bewegungslose Gestalt zu treten. Leonie zog die kleine Stablampe aus der Tasche, die sie wie auch die Latexhandschuhe stets bei sich trug. Dann ging sie neben dem Mann in die Hocke und legte eine Hand an die Halsseite. Es war kein Puls an der Hauptschlagader mehr festzustellen. Der Mann war tot. Und das nach ihrer vorsichtigen Schätzung und bei Berücksichtigung der kühlen und feuchten Luft schon seit mindestens vier Stunden, denn die Leichenstarre hatte eingesetzt und war auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Vorsichtig drehte sie den Leichnam halb auf den Rücken. Die Schusswunde befand sich dicht über der linken Augenbraue, an der Außenkante der Stirn. Das Einschussloch war kreisrund, es handelte sich um einen horizontalen Beschuss. Das Ausschussloch sollte also genau auf der gegenüberliegenden Schädelseite zu finden sein. Leonie suchte oberhalb des rechten Ohres, zunächst vergebens. Erst sorgfältiges Abtasten ergab eine kleine harte Schwellung an der Schläfe des Toten. Die Kugel hatte das Schädeldach noch durchschlagen, war aber in der Kopfschwarte stecken geblieben. Leonie schloss daraus wie auch aus der Größe des Einschusslochs auf ein langsames Projektil, wahrscheinlich vorn Kaliber 5,6 mm. Und noch etwas fiel ihr auf. Der Mann war möglicherweise nicht von seinem Gegenüber erschossen worden. Um die Einschusswunde waren keinerlei Schmauchspuren, keine Einsprengungen unverbrannter Pulverkörnchen zu sehen, wie es bei einem relativen Nahschuss der Fall gewesen wäre. Das konnte bedeuten, dass da draußen jemand auf der Lauer gelegen und auf die Gelegenheit zum Schuss gewartet hatte.
Als Leonie bei dieser beunruhigenden Überlegung angekommen war, hörte sie ein Geräusch, ein Rascheln, dann das Knacken trockenen Holzes. Der Adrenalinstoß bescherte ihr einen heftigen Schweißausbruch und gleich darauf die stumme Rüge, sich gefälligst zusammenzureißen. Der Täter war längst über alle Berge, er würde wohl kaum stundenlang durchs Gebüsch schleichen, um ihr einen Schrecken einzujagen. Sie brachte den Toten wieder in die Lage, in der sie ihn gefunden hatte, und kletterte aus der Grube. Es war wieder alles vollkommen still. Leonie lächelte der alten Frau beruhigend zu und zog das Handy aus der Tasche.
Das Polizeipräsidium befand sich in nächster Nachbarschaft zum Ohlsdorfer Friedhof, und so dauerte es kaum eine Viertelstunde, bis Hauptkommissar Kaminski mit den Kollegen Dittberner und Stein und den Technikern der Spurensicherung eintraf. Leonie erwartete die Truppe vor der Kapelle 4, einem Ende des 19. Jahrhunderts errichteten Prachtbau, den man für die Villa eines Großbürgers hätte halten können, wären da nicht die bunten bogenförmigen Kirchenfenster gewesen. Die Polizeiautos hielten am Straßenrand, und Kaminski, wie meist in schwarzes Leder gekleidet, diesmal aber ohne sein heiß geliebtes Motorrad, kam als Erster auf Leonie zu.
»Suchen Sie sich Ihre Kunden jetzt schon selbst auf dem Friedhof?«
Leonie ging nicht auf seine Bemerkung ein. Seit dem Serienmordfall im vergangenen Jahr, bei dem sie zum ersten Mal mit Kaminski zusammengearbeitet hatte, bemühte sie sich um Gelassenheit im Umgang mit ihm, auch wenn sie sich an seinen manchmal ziemlich ruppigen Ton und seinen ausgefallenen Humor bisher nicht gewöhnen konnte. Während sie das Denkmal für die »Hanseatischen Kampfgenossen« von 1813/14 passierten, schilderte sie ihm in knappen Worten, was sich ereignet hatte.
Kaminski hörte sich ihren Bericht an, ohne sie zu unterbrechen. Die Kollegen hatten inzwischen aufgeschlossen und hörten ebenfalls zu. Am Grab angekommen, machte Leonie die Spurentechniker auf die Fußabdrücke aufmerksam, und einer der Männer machte sich sofort an die Arbeit. Kaminski, Dittberner und Stein blickten auf den Toten hinunter.
»Ganz schön makaber«, meinte Stein. »Wird erschossen und kippt gleich in die Grube.«
Dittberner nickte. »Da würde mir schon als Erstes Selbstmord einfallen.«
»Und wo, bitte schön, ist die Waffe?« Kaminski sah Dittberner unter zusammengezogenen schwarzen Brauen an.
»Sagten Sie nicht, da müsse es noch einen zweiten Mann gegeben haben? Könnte der die Waffe mitgenommen haben?«, wandte sich Dittberner an Leonie. Die schüttelte den Kopf und erklärte den Beamten, welche Erkenntnis sie bei der ersten Untersuchung der Leiche gewonnen hatte. Nach ihren Angaben stellten Dittberner und Stein die Position der beiden Männer anhand der Fußabdrücke nach, und Leonie deutete in Verlängerung des Schusskanals im Kopf des Opfers die Richtung an, aus der der Schuss gekommen sein konnte. Zusammen mit zwei Technikern gingen sie und Kaminski in Richtung eines Grabes, neben dessen imposantem, aufrechtem Grabstein sich eine Säulenzypresse erhob. Einer der Techniker entdeckte einen abgeknickten Zweig in etwa einem Meter Höhe. Er roch an der Bruchstelle. »Der Bruch ist ganz frisch. Hier könnte jemand gestanden haben.«
»Tja, Jungens, dann amüsiert euch hier mal.« Kaminski wandte sich an Leonie. »Und wir zwei fahren zusammen in mein Büro. Für mich sind Sie jetzt in erster Linie Zeugin bei einem Tötungsdelikt und nicht Ärztin. Die Obduktion soll ein anderer machen.«
Leonie nickte. Sie hatte nach der Polizei im Institut angerufen und Dr. Fuchs informiert. Der Assistenzarzt und frisch gebackene Facharzt für Rechtsmedizin hatte sich unter anderem auf Schusswunden spezialisiert. Er würde die Obduktion zusammen mit einem zweiten Arzt vornehmen.
»Und was ist mit ihr?« Leonie deutete mit dem Kopf auf die alte Frau, die immer noch brav auf der Bank saß und den Beamten zusah, die den Tatort absperrten und mit der Spurensicherung an der Leiche anfingen.
»Sie war als Erste bei der Leiche.«
»Um die soll sich Stein kümmern.«
Kaminski gab dem Kollegen einen Wink. »Der kann gut mit alten Damen. Na, kommen Sie schon.«
Leonie war froh, den Friedhof endlich verlassen zu können. Es war inzwischen dunkel geworden, und sie fror erbärmlich. Kaminski war das nicht entgangen, und bevor er sie in seinem Büro noch einmal alles in allen Einzelheiten für das Protokoll auf Band sprechen ließ, besorgte er ihr eine Tasse brühheißen Kaffee und einen Cognac. Manchmal konnte Kaminski richtig menschlich sein, dachte Leonie und wärmte ihre Hände an der Tasse. »Was haben Sie eigentlich bei dem Nebel auf dem Friedhof gemacht?«, wollte Kaminski wissen, nachdem sie mit den Formalitäten fertig waren.
»Als ich hinfuhr, schien noch die Sonne. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass es Sie gar nichts angeht, was ich da gemacht habe.«
»Sie wissen genau, dass es mich sehr wohl etwas angeht. Wir haben es hier mit Mord zu tun, da sind Sie zu umfassender Auskunft verpflichtet.«
Leonie seufzte. »Okay, okay. Es sind keine Fernsehkameras in der Nähe. Sparen Sie sich Ihren Monolog.« Sie machte eine kleine Pause, ehe sie fortfuhr. »Ich habe das Grab meiner Mutter besucht. Es befindet sich ganz in der Nähe des Tatortes. Und der Zeitpunkt war reiner Zufall. Ich hatte Professor Cordes zum Flughafen gefahren, und weil ich nun mal in der Nähe war, dachte ich ... na ja ... ein spontaner Entschluss.«
Kaminski hatte ihr ruhig zugehört. Er kannte die Geschichte ihrer Familie.
»Wann waren Sie zuletzt am Grab Ihrer Mutter?«
»Ist lange her. Was hat das mit den heutigen Ereignissen zu tun?« Leonie sah ihn an, ihre Lippen wurden eine Spur schmaler.
»Gar nichts. Reine Neugierde. Und warum gerade heute?«
»Keine Ahnung. Aus keinem besonderen Grund.«
»Wirklich nicht? Na gut. Lassen wir das jetzt. Soll ich Sie nach Hause bringen?«
Leonies Wagen stand noch in Ohlsdorf. Sie waren zusammen in Kaminskis Dienstwagen zum Präsidium gefahren. Sie würde ihren Wagen morgen nach Öffnung des Friedhofs abholen müssen. Kaminskis Telefon klingelte.
»Ja?« Er hörte eine Weile zu und legte nach einem knappen »Bin gleich da« den Hörer auf.
Er wandte sich wieder Leonie zu.
»Gehen wir. Die Leiche ist auf dem Weg ins Institut.«
Leonie erhob sich. Zu ihrem eigenen Erstaunen war sie ziemlich wackelig auf den Beinen, als hätte sie im Fitness-Club etwas zu viel des Guten getan.
»Gut. Ich komme mit.«
»Nein, das werden Sie nicht. Ich setze Sie unterwegs ab, und Sie werden schön brav in Ihr Bettchen gehen und sich ausruhen.«
»Seien Sie nicht albern. Leichen sehe ich jeden Tag. Mir geht's gut.«
Kaminski schob sie zur Tür. »So sehen Sie aus.«
Unterwegs im Auto hingen beide eine Weile schweigend ihren Gedanken nach. Leonie ließ noch einmal die Ereignisse des Nachmittags Revue passieren. Ihr schien es jetzt schon, als läge das alles endlos lange zurück. Vielleicht weil die ganze Szene auf dem Friedhof so irreal war, auf einer Insel in der Zeit, ohne Bezug zu irgendetwas davor oder danach. Ihr fiel eine Frage wieder ein, die sie Kaminski schon in seinem Büro hatte stellen wollen, nachdem er das Telefongespräch beendet hatte.
»Wissen Sie schon, wer der Tote ist?«
»Wir sind noch dabei, Genaueres herauszufinden. Er hatte ein Flugticket bei sich, das auf den Namen Mohammed Utschaew lautet. Ein Rückflugticket nach Stockholm.«
»Oh«, sagte Leonie. »Klingt nach Ärger.«
»Mhm«, brummte Kaminski.
Leonie wusste, dass er dasselbe dachte wie sie. Der Mann war sicher kein Tourist und nicht wegen seiner Armbanduhr erschossen worden.
Gegen halb zehn hielt Kaminski vor dem Haus, in dem Leonie wohnte.
»Da wären wir.« Kaminski sah Leonie auffordernd an.
»Keine Angst. Ich steige freiwillig aus.« Leonie kletterte aus dem Wagen.
Während Leonie noch umständlich nach ihrem Schlüssel kramte, bog Kaminski bereits um die nächste Ecke. Erst als sie in der Badewanne lag und den Duft des Rosmarin-Ölbades genoss, kehrten ihre Gedanken wieder zu dem eigentlichen Grund ihres Besuchs auf dem Ohlsdorfer Friedhof zurück. Es war schon eigenartig! Nach Jahren besuchte sie das Grab ihrer ermordeten Mutter und stolperte in einen Mordfall hinein. Viele Menschen würden darin wahrscheinlich das schicksalhafte Wirken eines Gottes oder, je nach Glaubensbekenntnis, einer anderen jenseitigen Macht sehen wollen. Leonie hatte noch nie das Bedürfnis verspürt, ihre Existenz und das, was sie und andere seit ihrer Geburt daraus gemacht hatten, einem göttlichen Wesen in die Schuhe zu schieben. In ihren Augen waren alle Religionen und religiösen Welterklärungsmodelle hilflose Versuche, dem Sinnlosen einen Sinn und dem Chaos eine wenn auch fiktive Ordnungsidee abzutrotzen. Es war nicht leicht, allein auf einem Staubkorn am Rande des bekannten Universums sein kurzes Dasein zu fristen. Und dennoch! Schicksal oder Zufall, der Tote, den sie quasi am Grab ihrer Mutter gefunden hatte, bedeutete etwas. Er erinnerte sie daran, dass die Lebenden den Toten Gerechtigkeit schuldeten.
Nach dem Bad fühlte sich Leonie entspannt und noch viel zu munter, um ins Bett zu gehen. Seufzend holte sie eine Trittleiter aus dem Bad und schleppte sie in den Wohnungsflur. In einem Einbauschrank befanden sich zwei Kartons, die die persönlichen Hinterlassenschaften ihrer Eltern enthielten. Das, was Leonie weder verkauft noch entsorgt hatte: die Tagebücher ihres Vaters, die Briefe ihrer Mutter, die Familienalben, die Zeitungsausschnitte und all die Dokumente, die in einem Beamtenstaat dem Menschen erst zur Existenz verhelfen. Ganz oben auf der Leiter balancierend, zerrte Leonie die Kartons heraus. Beide waren ziemlich schwer, und sie war ein wenig aus der Puste, als sie sie neben ihrem Schreibtisch abstellte. Sie würde die Kartons nicht gleich öffnen und ihren Inhalt besichtigen. Auf einen Tag mehr oder weniger kam es nach all den Jahren nicht mehr an. Aber an diesem Abend fasste Leonie Simon den Entschluss, endlich ihre ganz persönliche Schuld zu begleichen. Sie würde den Mörder ihrer Mutter suchen und finden.
Kapitel 2
Das Institut für Rechtsmedizin der Universitätsklinik Eppendorf hatte endlich seinen Neubau bekommen. Das heißt, eigentlich handelte es sich um einen Anbau, einen neuen Flügel, der rechtwinklig an das alte Gebäude angesetzt worden war und mit ihm zusammen ein L bildete. Sobald der neue Trakt bezugsfertig war, hatten die Renovierungsarbeiten im alten Gebäude begonnen, und die würden voraussichtlich noch Monate dauern. Für das Personal bedeutete das permanentes Chaos, Lärm, Schmutz und Hinundherziehen zwischen den Räumen. Bisher hatte nur die Toxikologie in der oberen Etage des Neubaus ihre endgültige Heimat gefunden. Außerdem war der neue Sektionskeller bereits seit einiger Zeit voll in Betrieb, während der alte Teil in Staub und Dreck versank.
Als Leonie Simon am frühen Morgen in den Leichenkeller hinabstieg, freute sie sich wieder mit einem gewissen Besitzerstolz über die modernen Obduktionsräume und die sowohl qualitativ wie quantitativ verbesserten Möglichkeiten zur Aufbewahrung der Leichen. Sie suchte Dr. Bernd Fuchs, der schon vor acht Uhr mit der Obduktion einer Männerleiche begonnen hatte, die in der Nacht als ungeklärter Todesfall eingeliefert worden war. Die Umstände des Fundortes in einem Männerwohnheim waren dem Notarzt verdächtig vorgekommen, und er hatte die Polizei informiert. Als Leonie den Obduktionsraum betrat, rief Fuchs gerade »Heureka!«. Leonie trat neben ihn und sah, was ihn so begeisterte. Vor ihm auf dem Organbrett lag das Hirn des Toten, und er wies mit der Spitze des Skalpells auf etwas, das einem Laien in der rosagrauen Masse überhaupt nicht aufgefallen wäre.
»Ein geplatztes Aneurysma. Na also!«, sagte Leonie. »Das dürfte wohl der Übeltäter sein. Jedenfalls der unmittelbare.« Dr. Fuchs schnippelte seinen Fund heraus, um ihn in Formalin zu konservieren. »Er hat sich gestern Abend mit einem Saufkumpan geprügelt und dabei auch ein paar Schläge auf den Kopf abbekommen.«
»Das könnte natürlich den Tod herbeigeführt haben.« Dr. Fuchs, die AiPlerin, die ihm assistierte, und Andresen, der Präparator, fuhren mit ihrer Arbeit rasch und routiniert fort. Leonie sah noch eine Weile zu, dann verließ sie den Raum, nachdem sie Fuchs beiläufig gebeten hatte, später bei ihr vorbeizuschauen. Er signalisierte ihr nickend, dass er wusste, worum es sich handelte. Leonie ging über die vordere Treppe, die hintere war durch den Umbau nicht benutzbar, wieder ins Erdgeschoss hinauf und betrat ihr derzeitiges Büro. Frau Thiele, ihre Sekretärin, hatte schon Kaffee gekocht und gönnte sich ein Croissant dazu. Leonie nahm auch eine Tasse und blickte sich suchend um.
»Wo ist Othello?«
Othello gehörte quasi zur Erbmasse ihres Vaters, ein eigenwilliger, aber liebenswerter kleiner schwarzer Kater, der seine Heimstatt im Institut gefunden hatte und von fast allen verwöhnt wurde, besonders von Frau Thiele. Sein Futternapf stand frisch gefüllt neben ihrem Schreibtisch, und normalerweise wartete er schon auf sie, wenn sie morgens zum Dienst erschien.
»Wahrscheinlich treibt er sich wieder bei den Bauarbeitern herum. Sie geben ihm immer was von ihrem Frühstück ab, obwohl ich schon wer weiß wie oft gebeten habe, ihm nicht das Betteln anzugewöhnen. Außerdem geben sie dem Kleinen ungesundes Zeug, das gar nicht gut für ihn ist.«
Frau Thiele tat besorgt um Othellos Gesundheit, aber Leonie wusste genau, dass in Wirklichkeit die Eifersucht an ihr nagte. Seit Beginn der Bauarbeiten tauchte Othello deutlich seltener bei ihnen auf als früher. Die Baustelle übte offenbar eine ungeheure Faszination auf ihn aus, und weder Dreck noch Lärm schienen ihn zu stören. Er konnte Stunden damit verbringen, den Arbeitern zuzuschauen und durch das Chaos von Baumaterial, Schutt und Werkzeug zu stromern. Wenn er zu seinem Fressnapf zurückkehrte, war sein seidiges schwarzes Fell grau vom Staub, und Frau Thiele rückte ihm mit der Bürste zu Leibe, wobei sie ausgiebig mit ihm schimpfte, was ihn nicht im Mindesten beeindruckte.
»Othello ist ein schlauer kleiner Kerl. Der frisst schon nichts, was ihm schadet. Ihm geht es auch gar nicht ums Fressen, er ist einfach nur neugierig. Und sein liebster Mensch sind immer noch Sie. Das wissen Sie doch.«
Frau Thiele schenkte Leonie eines ihrer seltenen Lächeln. Leonie ging in ihr Büro und diktierte längst überfällige Korrespondenz auf Band, bis es klopfte und Bernd Fuchs den Kopf durch die Tür steckte. »Ist es gestattet?«
»Kommen Sie rein. Von Verwaltungskram lasse ich mich gern ablenken.«
Fuchs warf sich auf einen Stuhl und seufzte. »Ich bin hundemüde, war 'ne Menge los letzte Nacht.«
Fuchs hatte Bereitschaftsdienst, was im schlimmsten Fall bedeuten konnte, dass man sein Bett tagelang kaum sah. »Tut mir Leid, dass ich Ihnen auch noch die Schusswunde aufhalsen musste.«
Fuchs grinste. »Konnten Sie ja nicht ahnen, dass Sie auf dem Friedhof über eine Leiche stolpern. Aber ganz im Sinne des Chefs. Wo eine Leiche liegt, ist der Rechtsmediziner nicht weit.«
Fuchs spielte damit auf etwas an, was Leonie als eines der größten Verdienste von Professor Cordes betrachtete. Nirgendwo in Deutschland gab es ein so gutes und sicheres Leichenschauwesen wie in Hamburg. Cordes hatte es geschafft, dass grundsätzlich alle ungeklärten und nicht natürlichen Todesfälle zunächst ins Institut für Rechtsmedizin zur Begutachtung eingeliefert wurden. In anderen Bundesländern lag das in der Entscheidungsbefugnis von Polizei und Staatsanwaltschaft, was bedeutete, dass Rechtsmediziner oft nur die Toten zu sehen bekamen, die selbst für Laien ganz offensichtlich eines gewaltsamen Todes gestorben waren. Jeder zweite Mord blieb dadurch unerkannt, was einer Zahl von mindestens eintausendzweihundert Toten pro Jahr entspricht, deren Mörder gar nicht oder nur durch Zufall gefunden werden.
»Die Todesursache dürfte für Sie ja keine Überraschung sein. Ein Schuss aus einiger Entfernung. Eine Zone der Gewebszerstörung mit Einblutung in innere Hirnkammern. Die Kugel steckte in der Kopfschwarte, völlig verformt und aufgepilzt, ganz klar ein 5,6-mm-Projektil, Bleimantel, langsames, nur schallschnelles Geschoss.« Leonie nickte. »Dachte ich mir schon. Schalldämpfer und kein Schallknall. Der Täter ist wirklich auf Nummer sicher gegangen.«
»Und er hat ein Projektil gewählt, an dem auch der beste Ballistiker sehr wahrscheinlich keine Riefen mehr feststellen kann. Für den nächsten Mord braucht er nicht mal den Pistolenlauf auszuwechseln. Eine Patronenhülse wurde am Tatort auch nicht gefunden, er hat sie aufgesammelt.«
»Sie glauben, es war ein Profi?«
»Sie etwa nicht?«
Leonie nickte. »Manchmal ist es eben doch gut, wenn man zu spät kommt im Leben.«
Bernd Fuchs brauchte einen Moment, bis bei ihm der Groschen fiel. »Oh, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Also, grundsätzlich sind Amateure nervöser, dafür sind Profis gründlicher.«
»Das ist wirklich enorm beruhigend.«
Er betrachtete sie interessiert. »Sie machen sich doch nicht etwa Sorgen? Selbst wenn Sie den Mord beobachtet hätten, wüsste er doch nicht, wer Sie sind.«
Am nächsten Morgen wusste er es, jedenfalls wenn er einen Blick in die »Morgenpost« geworfen hatte. Leonie las fassungslos den Artikel über den »Friedhofsmörder«, der sich ausgiebig mit ihrer Person beschäftigte und ein großes Foto präsentierte. Natürlich fehlte auch nicht die Spekulation, sie könne den Täter gesehen haben. Sie rief sofort Kaminski an und beschimpfte ihn wegen dieser unglaublichen Tatsachenverdrehung. Der Kommissar kannte den Artikel schon und war genauso wütend wie Leonie. Eine Stunde später tauchte er im Institut auf. Leonie war immer noch so aufgebracht, dass sie ihn am liebsten rausgeworfen hätte.
»Halten Sie mich für so blöd, dass ich Sie zur Schießbudenfigur mache?«
»Und woher haben die's dann? Göttliche Eingebung?«
»Okay, Sie sind jetzt mächtig sauer, und ich habe dafür Verständnis. Aber es ist nun mal passiert. Es gibt immer Idioten oder Grünschnäbel, die sich vor den Pressebengeln verplappern. Bei uns wie bei jeder anderen Behörde, und in Ihrem Institut gab's auch schon den einen oder anderen, der das Wasser nicht halten konnte.«
»Ach so, am Ende bin ich noch selber schuld, oder wie?« Kaminski fuhr sich genervt mit der Hand durchs Haar. »Drehen Sie mir gefälligst nicht das Wort im Mund herum. Ich will ja nur sagen, es war keine böse Absicht.«
Leonie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. »Da bin ich aber beruhigt. Dieser Gedanke wird mir das Ende erleichtern, wenn ich irgendwann in den nächsten Tagen im Kugelhagel zusammenbreche.« Leonies Zorn war verraucht, und Kaminski grinste.
»Um Sie umzubringen, braucht der Kerl eine Elefantenbüchse. Aber mal im Ernst, ich glaube nicht, dass Sie in Gefahr sind. Wie es aussieht, ist der Kerl ein Profi und hat wahrscheinlich sofort nach dem Hit die Stadt verlassen. Und selbst wenn er den Artikel gelesen hat, wird er sich nicht der Gefahr aussetzen, Ihnen nachzustellen. Nur weil Sie ihn gesehen haben könnten.«
Leonie nickte. »Ich hoffe, Sie haben Recht. Wie kommen Sie voran?«
»Im Moment gar nicht. Wir haben über das BKA eine Anfrage nach Stockholm geschickt. Und wir suchen den Mann, mit dem sich Utschaew getroffen hat. Schwierig, wenn man nur die Schuhabdrücke hat. Die alte Frau war natürlich auch keine Hilfe. Gott sei Dank hat sie keine wichtigen Spuren zertrampelt.«
Leonie bedauerte, aber dem hatte auch sie nichts hinzuzufügen.
Ein paar Stunden später traf sich Leonie mit Vera Kilian-Walter, der Polizeipsychologin. Die beiden Frauen hatten sich bei dem Serienmordfall kennen gelernt und waren seitdem locker befreundet. Sie waren inzwischen zum Du übergegangen, wahrten aber eine gewisse Distanz. Die Abneigung gegen eine zu große Nähe bestand vor allem bei Leonie. Sie war nicht der Typ, der sich schnell an andere anschloss. Überdies fand sie im beruflichen Bereich eine gewisse Zurückhaltung angebracht. Man vermied dadurch Interessenkonflikte, wie sie aus eigener leidvoller Erfahrung nur zu gut wusste. Immerhin konnte sie mit Vera Kilian Dinge besprechen, die sie sonst mit sich ausmachte. Das bedeutete wiederum nicht, dass sie Veras Ratschläge befolgte. Leonies Aversion gegen »Seelenklempnerei« war immer wieder Gegenstand freundschaftlicher Kabbeleien zwischen den beiden Frauen, was ihr Einvernehmen aber nie ernsthaft trübte. Natürlich wusste Vera, was passiert war, und als die beiden sich zum Essen im »Borchers« trafen, einer netten Kneipe, günstig in der Mitte zwischen dem rechtsmedizinischen Institut und Veras Wohnung gelegen, plagte sie bereits mächtig die Neugierde, alles nochmal ganz genau aus erster Hand zu erfahren. Bei Leonies Bericht nahm der Leichenfund den größten Raum ein, den Anlass ihrer Anwesenheit auf dem Friedhof streifte sie nur beiläufig. Aber eine Vera Kilian konnte man nicht so einfach überlisten.
»Warum hast du das Grab deiner Mutter besucht? Was hast du geglaubt, dort zu finden?«
»Wie kommst du darauf, dass ich etwas gesucht habe?«
»Es soll Menschen geben, die es für tröstlich halten, das Grab ihrer Angehörigen zu besuchen.« Vera bedeutete dem Kellner, dass sie noch ein Glas vom selben Wein haben wollte.
Leonie zuckte mit den Schultern.
»Du versuchst, einen Weg zurück zu finden, nicht wahr?«
Leonie sah Vera erstaunt an. Manchmal war Veras Intuition wirklich verblüffend. Nicht umsonst war sie eine der besten Polizeipsychologinnen und Fallanalytikerinnen in Deutschland. »Es gibt keinen Weg zurück.«
»O doch, und ich glaube, du bist dabei, ihn zu betreten. Du willst den Mörder deiner Mutter aufspüren. Ich warte schon seit Monaten darauf, dass du endlich diese Entscheidung triffst.«
Die Kellnerin brachte den Salatteller mit Putenbruststreifen für Leonie und das Roastbeef mit Bratkartoffeln für Vera, deren barocke Formen mehr Kalorien verlangten als Leonies Windhundfigur. Die beiden aßen eine Weile schweigend. Aber Vera beherrschte die Kunst, gleichzeitig genussvoll zu kauen und verständlich zu sprechen.
»Was hast du vor? Wirst du beantragen, die Ermittlungen wieder aufzunehmen? Mord verjährt schließlich nicht.«
Leonie pickte lustlos auf ihrem Teller herum.
»Glaubst du im Ernst, dass irgendjemand bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft Interesse daran hat, einen uralten Fall wieder auszugraben, der als geklärt gilt? Mein Vater wurde damals nämlich nur freigesprochen, weil ihm der Mord nicht in letzter Konsequenz nachgewiesen werden konnte, und nicht etwa, weil ihn jemand für unschuldig hielt. Ich stand mit meiner Meinung damals absolut nicht allein da.«
Vera legte den Kopf schief. »Höre ich da Schuldbewusstsein durchklingen?«
»Schuld? Woran? Ich war praktisch noch ein Kind damals. Ich weiß, dass das Ausgraben von Schuldgefühlen eine Lieblingsbeschäftigung von euch Psychologen ist, aber bei mir brauchst du den Klappspaten gar nicht erst auszupacken.«
Im Dialog mit sich selbst hatte Leonie längst zugegeben, dass sie im tiefsten Verlies ihres Bewusstseins jede Menge Schuldgefühle weggeschlossen hatte. Nicht nur ihrem Vater gegenüber, sondern auch weil sie sich zum Zeitpunkt der Ermordung ihrer Mutter so sehr gewünscht hatte, von ihr befreit zu sein. Sie hatte ihrer Mutter beinahe genauso sehr wie ihrem Vater das Zerbrechen der Familie übel genommen. Zwar hatte er sie verlassen und war zu einer anderen Frau gezogen, aber Leonie warf insgeheim der Mutter vor, ihn mit ihren Launen vertrieben zu haben. In der Rückschau erschienen ihr die Jahre nach der Trennung der Eltern leichter als die Jahre davor mit dem hasserfüllten, würdelosen Kleinkrieg, den sich die beiden täglich lieferten. Aber damals hatte sie es anders empfunden. Es gab Tage, da hatte sie ihre frustrierte, sich selbst bemitleidende und überstrenge Mutter gehasst. Als sie ihre übel zugerichtete Leiche fand, schien es ihr für einen Moment, als habe sie selbst der Mutter das Messer in die Brust gestoßen. Es war, als hätten ihre dummen, kindischen Wünsche die Katastrophe ausgelöst, so wie Nadeln in einer Voodoo-Puppe den Tod des Verfluchten bewirken konnten. Zerstörungen, die in der Vergangenheit in der Familie angerichtet worden waren, konnte sie nicht wieder gutmachen. Und sie würde bis ans Ende ihres Lebens die Erinnerungen daran als Teil ihrer eigenen Geschichte ertragen müssen, aber dennoch hielt sie es für wichtig, den Mörder ihrer Mutter zu finden.
»Ich mag keine offenen Fragen. Ich muss das in Ordnung bringen, verstehst du?«
Vera Kilian lächelte. »Ich verstehe das sehr gut. Und ich bin sicher, dass du das Richtige tust.«
Eigenartigerweise war Leonie beruhigt, dass sie von Vera quasi die Absolution erhalten hatte.
»Und was hast du vor? Gibt es alte Ermittlungsansätze, die du weiterverfolgen kannst?«
Das genau war ihr Problem. Leonie hatte keine Ahnung, wo sie anfangen sollte. Einen Mordfall, der ein Vierteljahrhundert zurücklag, wieder aufzurollen war mühsam. Was sie vor sich hatte, war kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Und ob sie das Ziel je erreichen würde, war ungewiss.
Kapitel 3
Der Mann, der in den geheimen Dateien seines letzten Auftraggebers als »Dutch« geführt wurde, stand an den Landungsbrücken und betrachtete den hell erleuchteten nächtlichen Hafen. Er hatte im Hafenviertel in einem portugiesischen Restaurant zu Abend gegessen und befand sich auf dem Weg in sein Hotel. Dort galt er als einer von vielen in italienische Designer-Anzüge gekleideten Geschäftsleuten. Und als Geschäftsmann betrachtete er sich selbst auch, tätig in der vielfältigen Welt der Dienstleister. Für seine Art von Service gab es enormen Bedarf, mehr als die meisten Menschen sich träumen ließen. Männer und Frauen wie er, ja es gab auch Frauen in diesem Geschäft, reisten um die ganze Welt in Erfüllung ihrer Aufträge. Dutch war ein könnte man sagen, und er war einer der Besten in seiner Branche. In letzter Zeit, eigentlich schon seit er die vierzig überschritten hatte, machten sich bei ihm allerdings Ermüdungserscheinungen bemerkbar. Körperlich konnte er es mit jedem Dreißigjährigen aufnehmen, und seine psychische Stabilität war über jeden Selbstzweifel erhaben, dennoch machte ihm sein Beruf keinen rechten Spaß mehr. Immer seltener fühlte er sich von einem Auftrag wirklich herausgefordert. Der Kick bei der Vorbereitung eines neuen Jagdausflugs, wie er es nannte, ließ immer schneller nach. Der Geschmack eines erfolgreich durchgeführten Hits wurde von Mal zu Mal schaler. Er wusste selbst nicht, woran es lag. Vielleicht war es wirklich das Alter. Vielleicht war er einfach zu lange in dem Job, er war ein Dinosaurier und sollte daran denken aufzuhören, bevor es zum großen Artensterben kam. Die wenigsten seiner Profession beendeten ihr Leben im Altersheim.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!