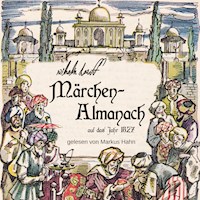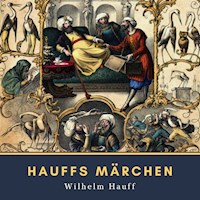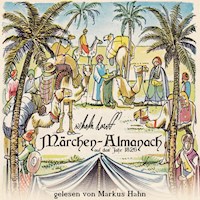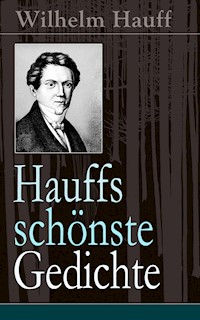0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Märchen bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Sämtliche Märchen mit 10 farbigen Bildtafeln und 21 Original-Graphiken Wilhelm Hauff (29. November 1802 - 18. November 1827) war ein deutscher Schriftsteller der Romantik. Er war ein Hauptvertreter der Schwäbischen Dichterschule. Unter den zahlreichen Werken, die der früh verstorbene Wilhelm Hauff in seinem nur drei Jahre währenden literarischen Wirken verfasst hat, ragen die Märchenalmanache heraus. Der kleine Muck, Zwerg Nase, Kalif Storch - sie und viele andere seiner Figuren erscheinen auch heutigen Lesern als gute alte Bekannte. Die vorliegende Ausgabe bietet sämtliche Märchen, die Illustrationen der Erstdrucke und zusätzliche 10 farbige Bildtafeln. Hauffs Märchen fallen in die spätromantische Literaturphase. Der erste Band um die Rahmenerzählung Die Karawane ist gekennzeichnet von hohem Einfühlungsvermögen in die orientalische Lebensweise. Der zweite Band um den Scheich von Alessandria und seine Sklaven verlässt den rein orientalischen Handlungsraum; Zwerg Nase und zwei von Wilhelm Grimm übernommene Märchen (»Schneeweißchen und Rosenroth« und »Das Fest der Unterirdischen«) stehen in der europäischen Märchentradition. Sein dritter Band, Das Wirtshaus im Spessart, behandelt eher Sagenstoffe als Märchen; die Schwarzwaldsage Das kalte Herz ist die bekannteste dieser Sagen. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 776
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wilhelm Hauff
Die Märchen des Wilhelm Hauff
Mit 10 farbigen Bildtafeln und 21 Original-Graphiken
Wilhelm Hauff
Die Märchen des Wilhelm Hauff
Mit 10 farbigen Bildtafeln und 21 Original-Graphiken
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Stuttgart (Metzler), 1826, 1827, 1828 4. Auflage, ISBN 978-3-954180-12-7
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Autor
Märchen als Almanach
Die Karawane
Die Geschichte von Kalif Storch
Die Geschichte von dem Gespensterschiff
Die Geschichte von der abgehauenen Hand
Die Errettung Fatmes
Die Geschichte von dem kleinen Muck
Das Märchen vom falschen Prinzen
Der Scheik von Alessandria und seine Sklaven
Der Zwerg Nase
Abner, der Jude, der nichts gesehen hat, Teil 1
Der arme Stephan
Abner, der Jude, der nichts gesehen hat, Teil 2
Der gebackene Kopf
Abner, der Jude, der nichts gesehen hat, Teil 3
Der Affe als Mensch, Teil 1
Das Fest der Unterirdischen
Schneeweißchen und Rosenrot
Der Affe als Mensch, Teil 2
Die Geschichte Almansors
Das Wirtshaus im Spessart
Die Sage vom Hirschgulden
Das kalte Herz – Erste Abteilung
Saids Schicksale
Die Höhle von Steenfoll – Eine schottländische Sage
Das kalte Herz – Zweite Abteilung
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Märchen bei Null Papier
Andersens Märchen
Die Märchen des Wilhelm Hauff
Weihnachten
Grimms Märchen
Tausendundeine Nacht - 4 Bände - Erwachsene Märchen aus 1001 Nacht
Grimms Sagen
Bunte Märchen
Sagen des klassischen Altertums
Grimms Märchen – Illustriertes Märchenbuch
Alice hinter den Spiegeln
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Autor
Wilhelm Hauff (29. November 1802 – 18. November 1827) war ein deutscher Schriftsteller der Romantik. Er war ein Hauptvertreter der Schwäbischen Dichterschule.
Unter den zahlreichen Werken, die der früh verstorbene Wilhelm Hauff in seinem nur drei Jahre währenden literarischen Wirken verfasst hat, ragen die Märchenalmanache heraus. Der kleine Muck, Zwerg Nase, Kalif Storch – sie und viele andere seiner Figuren erscheinen auch heutigen Lesern als gute alte Bekannte. Die vorliegende Ausgabe bietet sämtliche Märchen, die Illustrationen der Erstdrucke und zusätzliche 10 farbige Bildtafeln.
Hauffs Märchen fallen in die spätromantische Literaturphase. Der erste Band um die Rahmenerzählung Die Karawane ist gekennzeichnet von hohem Einfühlungsvermögen in die orientalische Lebensweise. Der zweite Band um den Scheich von Alessandria und seine Sklaven verlässt den rein orientalischen Handlungsraum; Zwerg Nase und zwei von Wilhelm Grimm übernommene Märchen (»Schneeweißchen und Rosenrot« und »Das Fest der Unterirdischen«) stehen in der europäischen Märchentradition. Sein dritter Band, Das Wirtshaus im Spessart, behandelt eher Sagenstoffe als Märchen; die Schwarzwaldsage Das kalte Herz ist die bekannteste dieser Sagen.
Märchen als Almanach
In einem schönen, fernen Reiche, von welchem die Sage lebt, dass die Sonne in seinen ewig grünen Gärten niemals untergehe, herrschte von Anfang an bis heute, die Königin Fantasie. Mit vollen Händen spendete diese, seit vielen Jahrhunderten, die Fülle des Segens über die Ihrigen, und war geliebt, verehrt von allen, die sie kannten. Das Herz der Königin war aber zu groß, als dass sie mit ihren Wohltaten bei ihrem Lande stehengeblieben wäre; sie selbst, im königlichen Schmuck ihrer ewigen Jugend und Schönheit, stieg herab auf die Erde; denn sie hatte gehört, dass dort Menschen wohnen, die ihr Leben in traurigem Ernst, unter Mühe und Arbeit hinbringen. Diesen hatte sie die schönsten Gaben aus ihrem Reiche mitgebracht, und seit die schöne Königin durch die Fluren der Erde gegangen war, waren die Menschen fröhlich bei der Arbeit, heiter in ihrem Ernst.
Auch ihre Kinder, nicht minder schön und lieblich als die königliche Mutter, sandte sie aus, um die Menschen zu beglücken. Einst kam Märchen, die älteste Tochter der Königin, von der Erde zurück. Die Mutter bemerkte, dass Märchen traurig sei, ja, hie und da wollte es ihr bedünken, als ob sie verweinte Augen hätte.
»Was hast du, liebes Märchen«, sprach die Königin zu ihr; »du bist seit deiner Reise so traurig und niedergeschlagen, willst du deiner Mutter nicht anvertrauen, was dir fehlt?«
»Ach! liebe Mutter«, antwortete Märchen: »ich hätte gewiss nicht so lange geschwiegen, wenn ich nicht wüsste, dass mein Kummer auch der deinige ist.«
»Sprich immer, meine Tochter«, bat die schöne Königin, »der Gram ist ein Stein, der den einzelnen niederdrückt, aber zwei tragen ihn leicht aus dem Wege.«
»Du willst es«, antwortete Märchen, »so höre: du weißt, wie gerne ich mit den Menschen umgehe, wie ich freudig auch zu dem Ärmsten vor seine Hütte sitze, um nach der Arbeit ein Stündchen mit ihm zu verplaudern; sie boten mir auch sonst gleich freundlich die Hand zum Gruß, wenn ich kam, und sahen mir lächelnd und zufrieden nach, wenn ich weiterging; aber in diesen Tagen ist es gar nicht mehr so!«
»Armes Märchen!« sprach die Königin, und streichelte ihr die Wange, die von einer Träne feucht war; »aber du bildest dir vielleicht dies alles nur ein?«
»Glaube mir, ich fühle es nur zu gut«, entgegnete Märchen, »sie lieben mich nicht mehr. Überall, wo ich hinkomme, begegnen mir kalte Blicke; nirgends bin ich mehr gern gesehen; selbst die Kinder, die ich doch immer so liebhatte, lachen über mich und wenden mir altklug den Rücken zu.«
Die Königin stützte die Stirne in die Hand, und schwieg sinnend. –
»Und woher soll es denn«, fragte die Königin, »kommen, Märchen, dass sich die Leute da unten so geändert haben?«
»Sieh, die Menschen haben kluge Wächter aufgestellt, die alles, was aus deinem Reich kommt, o Königin Fantasie! mit scharfem Blicke mustern und prüfen. Wenn nun einer kommt, der nicht nach ihrem Sinne ist, so erheben sie ein großes Geschrei, schlagen ihn tot, oder verleumden ihn doch so sehr bei den Menschen, die ihnen aufs Wort glauben, dass man gar keine Liebe, kein Fünkchen Zutrauen mehr findet. Ach! wie gut haben es meine Brüder, die Träume, fröhlich und leicht hüpfen sie auf die Erde hinab, fragen nichts nach jenen klugen Männern, besuchen die schlummernden Menschen, und weben und malen ihnen, was das Herz beglückt und das Auge erfreut!«
»Deine Brüder sind Leichtfüße«, sagte die Königin, »und du, mein Liebling, hast keine Ursache sie zu beneiden. Jene Grenzwächter kenne ich übrigens wohl; die Menschen haben so unrecht nicht, sie aufzustellen, es kam so mancher windige Geselle, und tat, als ob er geraden Wegs aus meinem Reiche käme, und doch hatte er höchstens von einem Berge zu uns herübergeschaut.« –
»Aber warum lassen sie dies mich, deine eigene Tochter, entgelten«, weinte Märchen, »ach! wenn du wüsstest, wie sie es mir gemacht haben; sie schalten mich eine alte Jungfer und drohten, mich das nächste Mal gar nicht mehr hereinzulassen.« –
»Wie, meine Tochter nicht mehr einzulassen?« rief die Königin, und Zorn erhöhte die Röte ihrer Wangen; »aber ich sehe schon, woher dies kommt; die böse Muhme hat uns verleumdet!«
»Die Mode? nicht möglich!« rief Märchen, »sie tat ja sonst immer so freundlich.«
»Oh! ich kenne sie, die Falsche«, antwortete die Königin, »aber versuche es, ihr zum Trotze, wieder meine Tochter, wer Gutes tun will, darf nicht rasten.«
»Ach Mutter! wenn sie mich dann ganz zurückweisen, oder wenn sie mich verleumden, dass mich die Menschen nicht ansehen oder einsam und verachtet in der Ecke stehen lassen?«
»Wenn die Alten, von der Mode betört, dich geringschätzen, so wende dich an die Kleinen, wahrlich sie sind meine Lieblinge, ihnen sende ich meine lieblichsten Bilder, durch deine Brüder, die Träume, ja ich bin schon oft selbst zu ihnen hinabgeschwebt, habe sie geherzt und geküsst und schöne Spiele mit ihnen gespielt; sie kennen mich auch wohl, sie wissen zwar meinen Namen nicht, aber ich habe schon oft bemerkt, wie sie nachts zu meinen Sternen herauflächeln und morgens, wenn meine glänzenden Lämmer am Himmel ziehen, vor Freuden die Hände zusammenschlagen. Auch wenn sie größer werden, lieben sie mich noch, ich helfe dann den lieblichen Mädchen bunte Kränze flechten, und die wilden Knaben werden stiller, wenn ich auf hoher Felsenspitze mich zu ihnen setze, aus der Nebelwelt der fernen blauen Berge, hohe Burgen und glänzende Paläste auftauchen lasse, und aus den rötlichen Wolken des Abends kühne Reiterscharen und wunderliche Wallfahrtszüge bilde.«
»O die guten Kinder!« rief Märchen bewegt aus, »ja es sei! mit ihnen will ich es noch einmal versuchen.«
»Ja, du gute Tochter«, sprach die Königin, »gehe zu ihnen; aber ich will dich auch ein wenig ordentlich ankleiden, dass du den Kleinen gefällst, und die Großen dich nicht zurückstoßen, siehe das Gewand eines Almanach will ich dir geben.«
»Eines Almanach, Mutter? ach! – ich schäme mich, so vor den Leuten zu prangen.«
Die Königin winkte und die Dienerinnen brachten das zierliche Gewand eines Almanach. Es war von glänzenden Farben, und schöne Figuren eingewoben.
Die Zofen flochten dem schönen Märchen das lange Haar; sie banden ihr goldene Sandalen unter die Füße und hingen ihr dann das Gewand um.
Das bescheidene Märchen wagte nicht aufzublicken, die Mutter aber betrachtete sie mit Wohlgefallen und schloss sie in ihre Arme: »Gehe hin«, sprach sie zu der Kleinen; »mein Segen sei mit dir. Und wenn sie dich verachten und höhnen, so kehre zurück zu mir, vielleicht dass spätere Geschlechter, getreuer der Natur, ihr Herz dir wieder zuwenden.«
Also sprach die Königin Fantasie. Märchen aber stieg herab auf die Erde. Mit pochendem Herzen nahte sie dem Ort, wo die klugen Wächter hauseten; sie senkte das Köpfchen zur Erde, sie zog das schöne Gewand enger um sich her, und mit zagendem Schritt nahte sie dem Tor.
»Halt!« rief eine tiefe, raue Stimme; »Wache heraus! da kommt ein neuer Almanach!«
Märchen zitterte als sie dies hörte; viele ältliche Männer von finsterem Aussehen stürzten hervor; sie hatten spitzige Federn in der Faust, und hielten sie dem Märchen entgegen. Einer aus der Schar schritt auf sie zu und packte sie mit rauer Hand am Kinn: »Nur auch den Kopf aufgerichtet Herr Almanach«, schrie er, »dass man Ihm in den Augen ansiehet, ob Er was Rechtes ist oder nicht?« –
Errötend richtete Märchen das Köpfchen in die Höhe und schlug das dunkle Auge auf –
»Das Märchen!« riefen die Wächter, und lachten aus vollem Hals, »das Märchen! haben wunder gemeint, was da käme! wie kommst du nur in diesen Rock?«
»Die Mutter hat ihn mir angezogen«, antwortete Märchen.
»So? sie will dich bei uns einschwärzen? Nichts da! hebe dich weg, mach dass du fortkommst«, riefen die Wächter untereinander und erhoben die scharfen Federn.
»Aber ich will ja nur zu den Kindern«, bat Märchen; »dies könnt ihr mir ja doch erlauben?«
»Lauft nicht schon genug solches Gesindel im Land umher?« rief einer der Wächter; »sie schwatzen nur unseren Kindern dummes Zeug vor.«
»Lasst uns sehen, was sie diesmal weiß«, sprach ein anderer –
»Nun ja«, riefen sie, »sag an, was du weißt, aber beeile dich, denn wir haben nicht viele Zeit für dich.«
Märchen streckte die Hand aus, und beschrieb mit dem Zeigfinger viele Zeichen in die Luft. Da sah man bunte Gestalten vorüberziehen; Karawanen mit schönen Rossen, geschmückte Reiter, viele Zelte im Sand der Wüste; Vögel und Schiffe auf stürmischen Meeren; stille Wälder und volkreiche Plätze und Straßen; Schlachten und friedliche Nomaden, sie alle schwebten in belebten Bildern, in buntem Gewimmel vorüber.
Märchen hatte in dem Eifer, mit welchem sie die Bilder aufsteigen ließ, nicht bemerkt, wie die Wächter des Tores nach und nach eingeschlafen waren. Eben wollte sie neue Zeichen beschreiben, als ein freundlicher Mann auf sie zutrat und ihre Hand ergriff: »Siehe her, gutes Märchen«, sagte er, indem er auf die Schlafenden zeigte, »für diese sind deine bunten Sachen nichts; schlüpfe schnell durch das Tor, sie ahnen dann nicht, dass du im Lande bist, und du kannst friedlich und unbemerkt deine Straße ziehen. Ich will dich zu meinen Kindern führen; in meinem Hause geb ich dir ein stilles, freundliches Plätzchen; dort kannst du wohnen und für dich leben; wenn dann meine Söhne und Töchter gut gelernt haben, dürfen sie mit ihren Gespielen zu dir kommen und dir zuhören. Willst du so?«
»Oh, wie gerne folge ich dir, zu deinen lieben Kleinen; wie will ich mich befleißen, ihnen zuweilen ein heiteres Stündchen zu machen!«
Der gute Mann nickte ihr freundlich zu, und half ihr über die Füße der schlafenden Wächter hinübersteigen. Lächelnd sah sich Märchen um, als sie hinüber war, und schlüpfte dann schnell in das Tor.
Die Karawane
Es zog einmal eine große Karawane durch die Wüste. Auf der ungeheuren Ebene, wo man nichts als Sand und Himmel sieht, hörte man schon in weiter Ferne die Glocken der Kamele und die silbernen Röllchen der Pferde, eine dichte Staubwolke, die ihr vorherging, verkündete ihre Nähe, und wenn ein Luftzug die Wolke teilte, blendeten funkelnde Waffen und helleuchtende Gewänder das Auge. So stellte sich die Karawane einem Manne dar, welcher von der Seite her auf sie zuritt. Er ritt ein schönes arabisches Pferd mit einer Tigerdecke behängt, an dem hochroten Riemenwerk hingen silberne Glöckchen, und auf dem Kopf des Pferdes wehte ein schöner Reiherbusch. Der Reiter sah stattlich aus, und sein Anzug entsprach der Pracht seines Rosses; ein weißer Turban, reich mit Gold gestickt, bedeckte das Haupt; der Rock und die weiten Beinkleider von brennendem Rot, ein gekrümmtes Schwert mit reichem Griff an seiner Seite. Er hatte den Turban tief ins Gesicht gedrückt; dies und die schwarzen Augen, die unter buschigen Brauen hervorblitzten, der lange Bart, der unter der gebogenen Nase herabhing, gaben ihm ein wildes, kühnes Aussehen.
Als der Reiter ungefähr auf fünfzig Schritt dem Vortrab der Karawane nahe war, spornte er sein Pferd an und war in wenigen Augenblicken an der Spitze des Zuges angelangt. Es war ein so ungewöhnliches Ereignis, einen einzelnen Reiter durch die Wüste ziehen zu sehen, dass die Wächter des Zuges, einen Überfall befürchtend, ihm ihre Lanzen entgegenstreckten.
»Was wollt ihr«, rief der Reiter, als er sich so kriegerisch empfangen sah, »glaubt ihr, ein einzelner Mann werde eure Karawane angreifen?«
Beschämt schwangen die Wächter ihre Lanzen wieder auf, ihr Anführer aber ritt an den Fremden heran und fragte nach seinem Begehr.
»Wer ist der Herr der Karawane?« fragte der Reiter.
»Sie gehört nicht einem Herrn«, antwortete der Gefragte, »sondern es sind mehrere Kaufleute, die von Mekka in ihre Heimat ziehen und die wir durch die Wüste geleiten, weil oft allerlei Gesindel die Reisenden beunruhigt.«
»So führt mich zu den Kaufleuten«, begehrte der Fremde.
»Das kann jetzt nicht geschehen«, antwortete der Führer, »weil wir ohne Aufhalt weiterziehen müssen, und die Kaufleute wenigstens eine Viertelstunde weiter hinten sind; wollt Ihr aber mit mir weiterreiten, bis wir lagern um Mittagsruhe zu halten, so werde ich Eurem Wunsch willfahren.«
Der Fremde sagte hierauf nichts; er zog eine lange Pfeife, die er am Sattel festgebunden hatte, hervor, und fing an, in großen Zügen zu rauchen, indem er neben dem Anführer des Vortrabs weiterritt. Dieser wusste nicht, was er aus dem Fremden machen sollte, er wagte es nicht, ihn geradezu nach seinem Namen zu fragen, und so künstlich er auch ein Gespräch anzuknüpfen suchte, der Fremde hatte auf das: »Ihr raucht da einen guten Tabak«, oder: »Euer Rapp’ hat einen braven Schritt«, immer nur mit einem kurzen »Ja, ja!« geantwortet.
Endlich waren sie auf dem Platz angekommen, wo man Mittagsruhe halten wollte. Der Anführer hatte seine Leute als Wachen ausgestellt, er selbst hielt mit dem Fremden, um die Karawane herankommen zu lassen. Dreißig Kamele, schwer beladen, zogen vorüber, von bewaffneten Anführern geleitet. Nach diesen kamen auf schönen Pferden die fünf Kaufleute, denen die Karawane gehörte. Es waren meistens Männer von vorgerücktem Alter, ernst und gesetzt aussehend, nur einer schien viel jünger als die übrigen, wie auch froher und lebhafter. Eine große Anzahl Kamele und Packpferde schloss den Zug.
Man hatte Zelte aufgeschlagen, und die Kamele und Pferde rings umhergestellt. In der Mitte war ein großes Zelt von blauem Seidenzeug. Dorthin führte der Anführer der Wache den Fremden. Als sie durch den Vorhang des Zeltes getreten waren, sahen sie die fünf Kaufleute auf goldgewirkten Polstern sitzen; schwarze Sklaven reichten ihnen Speisen und Getränke. »Wen bringt Ihr uns da«, rief der junge Kaufmann dem Führer zu.
Ehe noch der Führer antworten konnte, sprach der Fremde: »Ich heiße Selim Baruch und bin aus Bagdad; ich wurde auf einer Reise nach Mekka von einer Räuberhorde gefangen, und habe mich vor drei Tagen heimlich aus der Gefangenschaft befreit. Der große Prophet ließ mich die Glocken eurer Karawane in weiter Ferne hören, und so kam ich bei euch an. Erlaubet mir, dass ich in eurer Gesellschaft reise, ihr werdet euren Schutz keinem Unwürdigen schenken, und so ihr nach Bagdad kommet, werde ich eure Güte reichlich lohnen, denn ich bin der Neffe des Großwesirs.«
Der älteste der Kaufleute nahm das Wort: »Selim Baruch«, sprach er; »sei willkommen in unserem Schatten. Es macht uns Freude dir beizustehen; vor allem aber setze dich und iss und trinke mit uns.«
Selim Baruch setzte sich zu den Kaufleuten, und aß und trank mit ihnen. Nach dem Essen räumten die Sklaven die Geschirre hinweg, und brachten lange Pfeifen und türkischen Sorbet. Die Kaufleute saßen lange schweigend, indem sie die bläulichen Rauchwolken vor sich hinbliesen und zusahen, wie sie sich ringelten und verzogen und endlich in die Luft verschwebten. Der junge Kaufmann brach endlich das Stillschweigen: »So sitzen wir seit drei Tagen«, sprach er, »zu Pferd und am Tisch ohne uns durch etwas die Zeit zu vertreiben. Ich verspüre gewaltig Langeweile, denn ich bin gewohnt, nach Tisch Tänzer zu sehen oder Gesang und Musik zu hören. Wisst ihr gar nichts meine Freunde, das uns die Zeit vertreibt?«
Die vier älteren Kaufleute rauchten fort und schienen ernsthaft nachzusinnen, der Fremde aber sprach: »Wenn es mir erlaubt ist, will ich euch einen Vorschlag machen. Ich meine auf jedem Lagerplatz könnte einer von uns den anderen etwas erzählen. Dies könnte uns schon die Zeit vertreiben.«
»Selim Baruch, du hast wahr gesprochen«, sagte Achmet, der älteste der Kaufleute, »lasst uns den Vorschlag annehmen.«
»Es freut mich, wenn euch der Vorschlag behagt«, sprach Selim, »damit ihr aber sehet, dass ich nichts Unbilliges verlange, so will ich den Anfang machen.«
Vergnügt rückten die fünf Kaufleute näher zusammen und ließen den Fremden in ihre Mitte sitzen. Die Sklaven schenkten die Becher wieder voll, stopften die Pfeifen ihrer Herren frisch und brachten glühende Kohlen zum Anzünden. Selim aber erfrischte seine Stimme mit einem tüchtigen Zuge Sorbet, strich den langen Bart über dem Mund weg und sprach:
»So hört denn Die Geschichte von Kalif Storch.«
Die Geschichte von Kalif Storch
I.
Der Kalif Chasid zu Bagdad saß einmal an einem schönen Nachmittag behaglich auf seinem Sofa; er hatte ein wenig geschlafen, denn es war ein heißer Tag, und sah nun nach seinem Schläfchen recht heiter aus. Er rauchte aus einer langen Pfeife von Rosenholz, trank hie und da ein wenig Kaffee, den ihm ein Sklave einschenkte und strich sich allemal vergnügt den Bart, wenn es ihm geschmeckt hatte. Kurz man sah dem Kalifen an, dass es ihm recht wohl war. Um diese Stunde konnte man gar gut mit ihm reden, weil er da immer recht mild und leutselig war, deswegen besuchte ihn auch sein Großwesir Mansor alle Tage um diese Zeit. An diesem Nachmittag nun kam er auch, sah aber sehr nachdenklich aus, ganz gegen seine Gewohnheit. Der Kalif tat die Pfeife ein wenig aus dem Mund und sprach: »Warum machst du ein so nachdenkliches Gesicht, Großwesir?«
Der Großwesir schlug seine Arme kreuzweis über die Brust, verneigte sich vor seinem Herrn, und antwortete: »Herr! ob ich ein nachdenkliches Gesicht mache, weiß ich nicht, aber da drunten am Schloss steht ein Krämer, der hat so schöne Sachen, dass es mich ärgert, nicht viel überflüssiges Geld zu haben.«
Der Kalif, der seinem Großwesir schon lange gern eine Freude gemacht hätte, schickte seinen schwarzen Sklaven hinunter, um den Krämer heraufzuholen. Bald kam der Sklave mit dem Krämer zurück. Dieser war ein kleiner dicker Mann, schwarzbraun im Gesicht und in zerlumptem Anzug. Er trug einen Kasten, in welchem er allerhand Waren hatte. Perlen und Ringe, reichbeschlagene Pistolen, Becher und Kämme. Der Kalif und sein Wesir musterten alles durch, und der Kalif kaufte endlich für sich und Mansor schöne Pistolen, für die Frau des Wesirs aber einen Kamm. Als der Krämer seinen Kasten schon wieder zumachen wollte, sah der Kalif eine kleine Schublade, und fragte: ob da auch noch Waren seien? Der Krämer zog die Schublade heraus, und zeigte darin eine Dose mit schwärzlichem Pulver und ein Papier mit sonderbarer Schrift, die weder der Kalife noch Mansor lesen konnten. »Ich bekam einmal diese zwei Stücke von einem Kaufmann, der sie in Mekka auf der Straße fand«, sagte der Krämer, »ich weiß nicht, was sie enthalten; Euch stehen sie um geringen Preis zu Dienst, ich kann doch nichts damit anfangen.«
Der Kalif, der in seiner Bibliothek gerne alte Manuskripte hatte, wenn er sie auch nicht lesen konnte, kaufte Schrift und Dose und entließ den Krämer. Der Kalif aber dachte er, möchte gerne wissen, was die Schrift enthalte, und fragte den Wesir, ob er keinen kenne, der es entziffern könnte.
»Gnädigster Herr und Gebieter«, antwortete dieser, »an der großen Moschee wohnt ein Mann, er heißt Selim, der Gelehrte, der versteht alle Sprachen, lass ihn kommen, vielleicht kennt er diese geheimnisvollen Züge.«
Der Gelehrte Selim war bald herbeigeholt; »Selim«, sprach zu ihm der Kalif; »Selim, man sagt du seiest sehr gelehrt; guck einmal ein wenig in diese Schrift, ob du sie lesen kannst; kannst du sie lesen, so bekommst du ein neues Festkleid von mir, kannst du es nicht, so bekommst du zwölf Backenstreiche und fünfundzwanzig auf die Fußsohlen, weil man dich dann umsonst Selim, den Gelehrten, nennt.«
Selim verneigte sich und sprach: »Dein Wille geschehe, o Herr!« Lange betrachtete er die Schrift, plötzlich aber rief er aus: »Das ist lateinisch, o Herr, oder ich lass mich hängen.« »Sag was drin steht«, befahl der Kalif, »wenn es lateinisch ist.«
Selim fing an zu übersetzen: »Mensch, der du dieses findest, preise Allah für seine Gnade. Wer von dem Pulver in dieser Dose schnupft, und dazu spricht: Mutabor, der kann sich in jedes Tier verwandeln, und versteht auch die Sprache der Tiere.
Will er wieder in seine menschliche Gestalt zurückkehren, so neige er sich dreimal gen Osten, und spreche jenes Wort; aber hüte dich, wenn du verwandelt bist, dass du nicht lachest, sonst verschwindet das Zauberwort gänzlich aus deinem Gedächtnis und du bleibst ein Tier.«
Als Selim, der Gelehrte, also gelesen hatte, war der Kalif über die Maßen vergnügt. Er ließ den Gelehrten schwören, niemand etwas von dem Geheimnis zu sagen, schenkte ihm ein schönes Kleid und entließ ihn. Zu seinem Großwesir aber sagte er: »Das heiß ich gut einkaufen, Mansor! wie freue ich mich bis ich ein Tier bin. Morgen früh kommst du zu mir; wir gehen dann miteinander aufs Feld, schnupfen etwas weniges aus meiner Dose und belauschen dann, was in der Luft und im Wasser, im Wald und Feld gesprochen wird!«
II.
Kaum hatte am anderen Morgen der Kalif Chasid gefrühstückt und sich angekleidet, als schon der Großwesir erschien, ihn, wie er befohlen, auf dem Spaziergang zu begleiten. Der Kalif steckte die Dose mit dem Zauberpulver in den Gürtel, und nachdem er seinem Gefolge befohlen, zurückzubleiben, machte er sich mit dem Großwesir ganz allein auf den Weg. Sie gingen zuerst durch die weiten Gärten des Kalifen, spähten aber vergebens nach etwas Lebendigem, um ihr Kunststück zu probieren. Der Wesir schlug endlich vor, weiter hinaus an einen Teich zu gehen, wo er schon oft viele Tiere, namentlich Störche, gesehen habe, die durch ihr gravitätisches Wesen und ihr Geklapper immer seine Aufmerksamkeit erregt haben.
Der Kalif billigte den Vorschlag seines Wesirs, und ging mit ihm dem Teich zu. Als sie dort angekommen waren, sahen sie einen Storchen ernsthaft auf und ab gehen, Frösche suchend, und hie und da etwas vor sich hinklappernd. Zugleich sahen sie auch weit oben in der Luft einen anderen Storchen dieser Gegend zuschweben.
»Ich wette meinen Bart, gnädigster Herr«, sagte der Großwesir, »wenn nicht diese zwei Langfüßler ein schönes Gespräch miteinander führen werden. Wie wäre es, wenn wir Störche würden?«
»Wohl gesprochen!« antwortete der Kalif. »Aber vorher wollen wir noch einmal betrachten, wie man wieder Mensch wird. – Richtig! dreimal gen Osten geneigt und Mutabor gesagt, so bin ich wieder Kalif und du Wesir. Aber nur ums Himmels willen nicht gelacht, sonst sind wir verloren!«
Während der Kalif also sprach, sah er den anderen Storchen über ihrem Haupte schweben, und langsam sich zur Erde lassen. Schnell zog er die Dose aus dem Gürtel, nahm eine gute Prise, bot sie dem Großwesir dar, der gleichfalls schnupfte, und beide riefen: »Mutabor.«
Da schrumpften ihre Beine ein, und wurden dünn und rot, die schönen gelben Pantoffel des Kalifen und seines Begleiters wurden unförmliche Storchfüße, die Arme wurden zu Flügeln, der Hals fuhr aus den Achseln und ward eine Elle lang, der Bart war verschwunden und den Körper bedeckten weiche Federn.
»Ihr habt einen hübschen Schnabel, Herr Großwesir«, sprach nach langem Erstaunen der Kalif. »Beim Bart des Propheten, so etwas habe ich in meinem Leben nicht gesehen.«
»Danke untertänigst«, erwiderte der Großwesir, indem er sich bückte, »aber wenn ich es wagen darf zu behaupten, Eure Hoheit sehen als Storch beinahe noch hübscher aus, denn als Kalif. Aber kommt, wenn es Euch gefällig ist, dass wir unsere Kameraden dort belauschen, und erfahren, ob wir wirklich Storchisch können?«
Indem war der andere Storch auf der Erde angekommen; er putzte sich mit dem Schnabel seine Füße, legte seine Federn zurecht, und ging auf den ersten Storchen zu. Die beiden neuen Störche aber beeilten sich in ihre Nähe zu kommen, und vernahmen zu ihrem Erstaunen folgendes Gespräch:
»Guten Morgen, Frau Langbein, so früh schon auf der Wiese?«
»Schönen Dank, liebe Klapperschnabel! ich habe mir nur ein kleines Frühstück geholt. Ist Euch vielleicht ein Viertelchen Eidechs gefällig, oder ein Froschschenkelein?«
»Danke gehorsamst; habe heute gar keinen Appetit. Ich komme auch wegen etwas ganz anderem auf die Wiese. Ich soll heute vor den Gästen meines Vaters tanzen, und da will ich mich im Stillen ein wenig üben.«
Zugleich schritt die junge Störchin in wunderlichen Bewegungen durch das Feld. Der Kalif und Mansor sahen ihr verwundert nach; als sie aber in malerischer Stellung auf einem Fuß stand, und mit den Flügeln anmutig dazu wedelte, da konnten sich die beiden nicht mehr halten, ein unaufhaltsames Gelächter brach aus ihren Schnäbeln hervor, von dem sie sich erst nach langer Zeit erholten. Der Kalif fasste sich zuerst wieder: »Das war einmal ein Spaß«, rief er, »der nicht mit Gold zu bezahlen ist; schade! dass die dummen Tiere durch unser Gelächter sich haben verscheuchen lassen, sonst hätten sie gewiss auch noch gesungen!«
Aber jetzt fiel es dem Großwesir ein, dass das Lachen während der Verwandlung verboten war. Er teilte seine Angst deswegen dem Kalifen mit. »Potz Mekka und Medina! das wäre ein schlechter Spaß, wenn ich ein Storch bleiben müsste! Besinne dich doch auf das dumme Wort, ich bring es nicht heraus.«
»Dreimal gen Osten müssen wir uns bücken, und dazu sprechen: Mu – Mu – Mu –«
Sie stellten sich gegen Osten und bückten sich in einem fort, dass ihre Schnäbel beinahe die Erde berührten; aber, o Jammer! das Zauberwort war ihnen entfallen und so oft sich auch der Kalife bückte, so sehnlich auch sein Wesir Mu – Mu dazu rief, jede Erinnerung daran war verschwunden, und der arme Chasid und sein Wesir waren und blieben Störche. –
III.
Traurig wandelten die Verzauberten durch die Felder, sie wussten gar nicht, was sie in ihrem Elend anfangen sollten. Aus ihrer Storchenhaut konnten sie nicht heraus, in die Stadt zurück konnten sie auch nicht um sich zu erkennen zu geben, denn wer hätte einem Storchen geglaubt, dass er der Kalif sei, und wenn man es auch geglaubt hätte, würden die Einwohner von Bagdad einen Storchen zum Kalifen gewollt haben?
So schlichen sie mehrere Tage umher, und ernährten sich kümmerlich von Feldfrüchten, die sie aber wegen ihrer langen Schnäbel nicht gut verspeisen konnten. Zu Eidechsen und Fröschen hatten sie übrigens keinen Appetit denn sie befürchteten, mit solchen Leckerbissen sich den Magen zu verderben. Ihr einziges Vergnügen in dieser traurigen Lage war, dass sie fliegen konnten, und so flogen sie oft auf die Dächer von Bagdad, um zu sehen, was darin vorging.
In den ersten Tagen bemerkten sie große Unruhe und Trauer in den Straßen; aber ungefähr am vierten Tag nach ihrer Verzauberung saßen sie auf dem Palast des Kalifen, da sahen sie unten in der Straße einen prächtigen Aufzug; Trommeln und Pfeifen ertönten, ein Mann in einem goldgestickten Scharlachmantel saß auf einem geschmückten Pferd, umgeben von glänzenden Dienern; halb Bagdad sprang ihm nach, und alle schrien: »Heil Mizra! dem Herrscher von Bagdad!«
Da sahen die beiden Störche auf dem Dache des Palastes einander an, und der Kalife Chasid sprach: »Ahnst du jetzt, warum ich verzaubert bin, Großwesir? Dieser Mizra ist der Sohn meines Todfeindes, des mächtigen Zauberers Kaschnur, der mir in einer bösen Stunde Rache schwur. Aber noch gebe ich die Hoffnung nicht auf. Komm mit mir, du treuer Gefährte meines Elends, wir wollen zum Grab des Propheten wandern, vielleicht dass an heiliger Stätte der Zauber gelöst wird.«
Sie erhoben sich vom Dach des Palastes, und flogen der Gegend von Medina zu.
Mit dem Fliegen wollte es aber nicht gar gut gehen, denn die beiden Störche hatte noch wenig Übung. »O Herr«, ächzte nach ein paar Stunden der Großwesir, »ich halte es, mit Eurer Erlaubnis, nicht mehr lange aus, Ihr fliegt gar zu schnell! Auch ist es schon Abend, und wir täten wohl, ein Unterkommen für die Nacht zu suchen.«
Chasid gab der Bitte seines Dieners Gehör; und da er unten im Tale eine Ruine erblickte, die ein Obdach zu gewähren schien, so flogen sie dahin. Der Ort, wo sie sich für diese Nacht niedergelassen hatten, schien ehemals ein Schloss gewesen zu sein. Schöne Säulen ragten unter den Trümmern hervor, mehrere Gemächer, die noch ziemlich erhalten waren, zeugten von der ehemaligen Pracht des Hauses. Chasid und sein Begleiter gingen durch die Gänge umher, um sich ein trockenes Plätzchen zu suchen; plötzlich blieb der Storch Mansor stehen. »Herr und Gebieter«, flüsterte er leise, »wenn es nur nicht töricht für einen Großwesir, noch mehr aber für einen Storchen wäre, sich vor Gespenstern zu fürchten! Mir ist ganz unheimlich zumut, denn hier neben hat es ganz vernehmlich geseufzt und gestöhnt.« Der Kalif blieb nun auch stehen, und hörte ganz deutlich ein leises Weinen, das eher einem Menschen, als einem Tiere anzugehören schien. Voll Erwartung wollte er der Gegend zugehen, woher die Klagetöne kamen, der Wesir aber packte ihn mit dem Schnabel am Flügel, und bat ihn flehentlich, sich nicht in neue unbekannte Gefahren zu stürzen. Doch vergebens! Der Kalif, dem auch unter dem Storchenflügel ein tapferes Herz schlug, riss sich mit Verlust einiger Federn los, und eilte in einen finstern Gang. Bald war er an einer Türe angelangt, die nur angelehnt schien, und woraus er deutliche Seufzer, mit ein wenig Geheul, vernahm. Er stieß mit dem Schnabel die Türe auf, blieb aber überrascht auf der Schwelle stehen. In dem verfallenen Gemach, das nur durch ein kleines Gitterfenster spärlich erleuchtet war, sah er eine große Nachteule am Boden sitzen. Dicke Tränen rollten ihr aus den großen runden Augen, und mit heiserer Stimme stieß sie ihre Klagen zu dem krummen Schnabel heraus. Als sie aber den Kalifen und seinen Wesir, der indes auch herbeigeschlichen war, erblickte, erhob sie ein lautes Freudengeschrei. Zierlich wischte sie mit dem braungefleckten Flügel die Tränen aus dem Auge, und zu dem großen Erstaunen der beiden, rief sie in gutem menschlichem Arabisch: »Willkommen ihr Störche, ihr seid mir ein gutes Zeichen meiner Errettung, denn durch Störche werde mir ein großes Glück kommen, ist mir einst prophezeit worden!«
Als sich der Kalif von seinem Erstaunen erholt hatte, bückte er sich mit seinem langen Hals, brachte seine dünnen Füße in eine zierliche Stellung, und sprach: »Nachteule! deinen Worten nach, darf ich glauben, eine Leidensgefährtin in dir zu sehen. Aber ach! Deine Hoffnung, dass durch uns deine Rettung kommen werde, ist vergeblich. Du wirst unsere Hilflosigkeit selbst erkennen, wenn du unsere Geschichte hörst.« Die Nachteule bat ihn zu erzählen, der Kalif aber hub an und erzählte, was wir bereits wissen.
IV.
Als der Kalif der Eule seine Geschichte vorgetragen hatte, dankte sie ihm und sagte: »Vernimm auch meine Geschichte und höre, wie ich nicht weniger unglücklich bin als du. Mein Vater ist der König von Indien, ich, seine einzige, unglückliche Tochter, heiße Lusa. Jener Zauberer Kaschnur, der euch verzauberte, hat auch mich ins Unglück gestürzt. Er kam eines Tags zu meinem Vater und begehrte mich zur Frau für seinen Sohn Mizra. Mein Vater aber, der ein hitziger Mann ist, ließ ihn die Treppe hinunterwerfen. Der Elende wusste sich unter einer anderen Gestalt, wieder in meine Nähe zu schleichen, und als ich einst in meinem Garten Erfrischungen zu mir nehmen wollte, brachte er mir, als Sklave verkleidet, einen Trank bei, der mich in diese abscheuliche Gestalt verwandelte. Vor Schrecken ohnmächtig, brachte er mich hierher und rief mir mit schrecklicher Stimme in die Ohren:
›Da sollst du bleiben, hässlich, selbst von den Tieren verachtet, bis an dein Ende, oder bis einer aus freiem Willen dich, selbst in dieser schrecklichen Gestalt, zur Gattin begehrt. So räche ich mich an dir und deinem stolzen Vater.‹
Seitdem sind viele Monate verflossen. Einsam und traurig lebe ich als Einsiedlerin in diesem Gemäuer, verabscheut von der Welt, selbst den Tieren ein Gräuel; die schöne Natur ist vor mir verschlossen, denn ich bin blind am Tage, und nur, wenn der Mond sein bleiches Licht über dies Gemäuer ausgießt, fällt der verhüllende Schleier von meinem Auge.«
Die Eule hatte geendet, und wischte sich mit dem Flügel wieder die Augen aus, denn die Erzählung ihrer Leiden hatte ihr Tränen entlockt.
Der Kalif war bei der Erzählung der Prinzessin in tiefes Nachdenken versunken. »Wenn mich nicht alles täuscht«, sprach er, »so findet zwischen unserem Unglück ein geheimer Zusammenhang statt; aber wo finde ich den Schlüssel zu diesem Rätsel?«
Die Eule antwortete ihm: »O Herr! auch mir ahnet dies; denn es ist mir einst in meiner frühesten Jugend von einer weisen Frau prophezeit worden, dass ein Storch mir ein großes Glück bringen werde, und ich wüsste vielleicht, wie wir uns retten könnten.« Der Kalif war sehr erstaunt und fragte, auf welchem Wege sie meine? »Der Zauberer, der uns beide unglücklich gemacht hat«, sagte sie, »kommt alle Monate einmal in diese Ruinen. Nicht weit von diesem Gemach ist ein Saal. Dort pflegt er dann mit vielen Genossen zu schmausen. Schon oft habe ich sie dort belauscht. Sie erzählen dann einander ihre schändlichen Werke, vielleicht dass er dann das Zauberwort, das ihr vergessen habt, ausspricht.«
»Oh, teuerste Prinzessin«, rief der Kalif, »sag an, wann kommt er, und wo ist der Saal?«
Die Eule schwieg einen Augenblick, und sprach dann: »Nehmet es nicht ungütig, aber nur unter einer Bedingung kann ich Euern Wunsch erfüllen.«
»Sprich aus! sprich aus!« schrie Chasid, »befiehl, es ist mir jede recht –«
»Nämlich ich möchte auch gerne zugleich frei sein, dies kann aber nur geschehen, wenn einer von euch mir seine Hand reicht.«
Die Störche schienen über den Antrag etwas betroffen zu sein, und der Kalif winkte seinem Diener, ein wenig mit ihm hinauszugehen.
»Großwesir«, sprach vor der Türe der Kalif, »das ist ein dummer Handel, aber Ihr könntet sie schon nehmen.«
»So?« antwortete dieser, »dass mir meine Frau, wenn ich nach Haus komme, die Augen auskratzt. Auch bin ich ein alter Mann, und Ihr seid noch jung und unverheiratet, und könnet eher einer jungen schönen Prinzeß die Hand geben.«
»Das ist es eben«, seufzte der Kalif, indem er traurig die Flügel hängen ließ, »wer sagt dir denn, dass sie jung und schön ist? Das heißt eine Katze im Sack kaufen!«
Sie redeten einander gegenseitig noch lange zu, endlich aber, als der Kalif sah, dass sein Wesir lieber Storch bleiben, als die Eule heiraten wollte, entschloss er sich, die Bedingung lieber selbst zu erfüllen. Die Eule war hoch erfreut. Sie gestand ihnen, dass sie zu keiner bessern Zeit hätten kommen können, weil wahrscheinlich in dieser Nacht die Zauberer sich versammeln werden.
Sie verließ mit den Störchen das Gemach, um sie in jenen Saal zu führen; sie gingen lange in einem finstern Gang hin, endlich strahlte ihnen aus einer halbverfallenen Mauer ein heller Schein entgegen. Als sie dort angelangt waren, riet ihnen die Eule, sich ganz ruhig zu verhalten. Sie konnten von der Lücke, an welcher sie standen, einen großen Saal übersehen. Er war ringsum mit Säulen geschmückt und prachtvoll verziert. Viele farbige Lampen ersetzten das Licht des Tages. In der Mitte des Saales stand ein runder Tisch, mit vielen und ausgesuchten Speisen besetzt. Rings um den Tisch zog sich ein Sofa, auf welchem 8 Männer saßen. In einem dieser Männer erkannten die Störche jenen Krämer wieder, der ihnen das Zauberpulver verkauft hatte. Sein Nebensitzer forderte ihn auf, ihnen seine neuesten Taten zu erzählen. Er erzählte unter anderen auch die Geschichte des Kalifen und seines Wesirs.
»Was für ein Wort hast du ihnen denn aufgegeben?« fragte ihn ein anderer Zauberer. »Ein recht schweres lateinisches, es heißt Mutabor.«
V.
Als die Störche an ihrer Mauerlücke dieses hörten, kamen sie vor Freuden beinahe außer sich. Sie liefen auf ihren langen Füßen so schnell dem Tor der Ruine zu, dass die Eule kaum folgen konnte. Dort sprach der Kalif gerührt zu der Eule: »Retterin meines Lebens und des Lebens meines Freundes, nimm zum ewigen Dank für das, was du an uns getan, mich zum Gemahl an.« Dann aber wandte er sich nach Osten. Dreimal bückten die Störche ihre langen Hälse der Sonne entgegen, die soeben hinter dem Gebirge heraufstieg; »Mutabor«, riefen sie, im Nu waren sie verwandelt, und in der hohen Freude des neugeschenkten Lebens, lagen Herr und Diener lachend und weinend einander in den Armen.
Wer beschreibt aber ihr Erstaunen, als sie sich umsahen. Eine schöne Dame, herrlich geschmückt, stand vor ihnen. Lächelnd gab sie dem Kalifen die Hand: »Erkennt Ihr Eure Nachteule nicht mehr?« sagte sie. Sie war es; der Kalif war von ihrer Schönheit und Anmut so entzückt, dass er ausrief: es sei sein größtes Glück, dass er Storch geworden sei.
Die drei zogen nun miteinander auf Bagdad zu. Der Kalif fand in seinen Kleidern nicht nur die Dose mit Zauberpulver, sondern auch seinen Geldbeutel. Er kaufte daher im nächsten Dorfe, was zu ihrer Reise nötig war, und so kamen sie bald an die Tore von Bagdad. Dort aber erregte die Ankunft des Kalifen großes Erstaunen. Man hatte ihn für tot ausgegeben, und das Volk war daher hoch erfreut, seinen geliebten Herrscher wiederzuhaben.
Umso mehr aber entbrannte ihr Hass gegen den Betrüger Mizra. Sie zogen in den Palast, und nahmen den alten Zauberer und seinen Sohn gefangen. Den Alten schickte der Kalif in dasselbe Gemach der Ruine, das die Prinzessin als Eule bewohnt hatte, und ließ ihn dort aufhängen. Dem Sohn aber, welcher nichts von den Künsten des Vaters verstand, ließ der Kalif die Wahl, ob er sterben oder schnupfen wolle. Als er das letztere wählte, bot ihm der Großwesir die Dose. Eine tüchtige Prise, und das Zauberwort des Kalifen verwandelte ihn in einen Storchen. Der Kalif ließ ihn in ein eisernes Käfigt sperren und in seinem Garten aufstellen.
Lange und vergnügt lebte Kalif Chasid mit seiner Frau, der Prinzessin; seine vergnügtesten Stunden waren immer die, wenn ihn der Großwesir nachmittags besuchte; da sprachen sie dann oft von ihrem Storchenabenteuer, und wenn der Kalif recht heiter war, ließ er sich herab, den Großwesir nachzuahmen, wie er als Storch aussah. Er stieg dann ernsthaft, mit steifen Füßen im Zimmer auf und ab, klapperte, wedelte mit den Armen, wie mit Flügeln und zeigte, wie jener sich vergeblich nach Osten geneigt und Mu – Mu – dazu gerufen habe. Für die Frau Kalifin und ihre Kinder war diese Vorstellung allemal eine große Freude; wenn aber der Kalif gar zu lange klapperte und nickte und Mu – Mu – schrie, dann drohte ihm lächelnd der Wesir: er wolle das, was vor der Türe der Prinzessin Nachteule verhandelt worden sei, der Frau Kalifin mitteilen.
*
Als Selim Baruch seine Geschichte geendet hatte, bezeugten sich die Kaufleute sehr zufrieden damit. »Wahrhaftig, der Nachmittag ist uns vergangen, ohne dass wir merkten wie!« sagte einer derselben, indem er die Decke des Zeltes zurückschlug. »Der Abendwind wehet kühl, und wir könnten noch eine gute Strecke Weges zurücklegen.« Seine Gefährten waren damit einverstanden, die Zelte wurden abgebrochen, und die Karawane machte sich in der nämlichen Ordnung, in welcher sie herangezogen war, auf den Weg.
Sie ritten beinahe die ganze Nacht hindurch, denn es war schwül am Tage, die Nacht aber war erquicklich und sternhell. Sie kamen endlich an einem bequemen Lagerplatz an, schlugen die Zelte auf und legten sich zur Ruhe. Für den Fremden aber sorgten die Kaufleute, wie wenn er ihr wertester Gastfreund wäre. Der eine gab ihm Polster, der andere Decken, ein dritter gab ihm Sklaven, kurz, er wurde so gut bedient, als ob er zu Hause wäre. Die heißeren Stunden des Tages waren schon heraufgekommen, als sie sich wieder erhoben, und sie beschlossen einmütig, hier den Abend abzuwarten. Nachdem sie miteinander gespeist hatten, rückten sie wieder näher zusammen, und der junge Kaufmann wandte sich an den ältesten und sprach: »Selim Baruch hat uns gestern einen vergnügten Nachmittag bereitet, wie wäre es, Achmet, wenn Ihr uns auch etwas erzähltet. Sei es nun aus Eurem langen Leben, das wohl viele Abenteuer aufzuweisen hat, oder sei es auch ein hübsches Märchen.« Achmet schwieg auf diese Anrede eine Zeit lang, wie wenn er bei sich im Zweifel wäre, ob er dies oder jenes sagen sollte, oder nicht; endlich fing er an zu sprechen:
»Liebe Freunde! ihr habt euch auf dieser unserer Reise als treue Gesellen erprobt, und auch Selim verdient mein Vertrauen; daher will ich euch etwas aus meinem Leben mitteilen, das ich sonst ungern und nicht jedem erzähle:
Die Geschichte von dem Gespensterschiff.«
Die Geschichte von dem Gespensterschiff
Mein Vater hatte einen kleinen Laden in Balsora; er war weder arm noch reich und war einer von jenen Leuten, die nicht gerne etwas wagen, aus Furcht das wenige zu verlieren, das sie haben. Er erzog mich schlicht und recht, und brachte es bald so weit, dass ich ihm an die Hand gehen konnte. Gerade als ich achtzehn Jahr alt war, als er die erste größere Spekulation machte, starb er, wahrscheinlich aus Gram, tausend Goldstücke dem Meere anvertraut zu haben. Ich musste ihn bald nachher wegen seines Todes glücklich preisen, denn wenige Wochen hernach, lief die Nachricht ein, dass das Schiff, dem mein Vater seine Güter mitgegeben hatte, versunken sei. Meinen jugendlichen Mut konnte aber dieser Unfall nicht beugen. Ich machte alles vollends zu Geld, was mein Vater hinterlassen hatte, und zog aus, um in der Fremde mein Glück zu probieren, nur von einem alten Diener meines Vaters begleitet, der sich aus alter Anhänglichkeit nicht von mir und meinem Schicksal trennen wollte.
Im Hafen von Balsora schifften wir uns mit günstigem Winde ein. Das Schiff, auf dem ich mich eingemietet hatte, war nach Indien bestimmt. Wir waren schon fünfzehn Tage auf der gewöhnlichen Straße gefahren, als uns der Kapitän einen Sturm verkündete. Er machte ein bedenkliches Gesicht, denn es schien, er kenne in dieser Gegend das Fahrwasser nicht genug, um einem Sturm mit Ruhe begegnen zu können. Er ließ alle Segel einziehen, und wir trieben ganz langsam hin. Die Nacht war angebrochen, war hell und kalt, und der Kapitän glaubte schon, sich in den Anzeichen des Sturmes getäuscht zu haben. Auf einmal schwebte ein Schiff, das wir vorher nicht gesehen hatten, dicht an dem unsrigen vorbei. Wildes Jauchzen und Geschrei erscholl aus dem Verdeck herüber, worüber ich mich zu dieser angstvollen Stunde, vor einem Sturm, nicht wenig wunderte. Aber der Kapitän an meiner Seite wurde blass, wie der Tod. »Mein Schiff ist verloren«, rief er, »dort segelt der Tod!«
Ehe ich ihn noch über diesen sonderbaren Ausruf befragen konnte, stürzten schon heulend und schreiend die Matrosen herein: »Habt ihr ihn gesehn?« schrien sie, »jetzt ist’s mit uns vorbei.«
Der Kapitän aber ließ Trostsprüche aus dem Koran vorlesen, und setzte sich selbst ans Steuerruder. Aber vergebens! Zusehends brauste der Sturm auf, und ehe eine Stunde verging, krachte das Schiff und blieb sitzen. Die Boote wurden ausgesetzt, und kaum hatten sich die letzten Matrosen gerettet, so versank das Schiff vor unsern Augen, und als ein Bettler fuhr ich in die See hinaus. Aber der Jammer hatte noch kein Ende. Fürchterlicher tobte der Sturm, das Boot war nicht mehr zu regieren. Ich hatte meinen alten Diener fest umschlungen und wir versprachen uns, nie voneinander zu weichen. Endlich brach der Tag an; aber mit dem ersten Blick der Morgenröte fasste der Wind das Boot, in welchem wir saßen, und stürzte es um. Ich habe keinen meiner Schiffsleute mehr gesehen. Der Sturz hatte mich betäubt; und als ich aufwachte, befand ich mich in den Armen meines alten treuen Dieners, der sich auf das umgeschlagene Boot gerettet, und mich nachgezogen hatte. Der Sturm hatte sich gelegt. Von unserem Schiff war nichts mehr zu sehen, wohl aber entdeckten wir, nicht weit von uns, ein anderes Schiff, auf das die Wellen uns hintrieben. Als wir näher hinzukamen, erkannte ich das Schiff als dasselbe, das in der Nacht an uns vorbeifuhr, und welches den Kapitän so sehr in Schrecken gesetzt hatte. Ich empfand ein sonderbares Grauen vor diesem Schiffe. Die Äußerung des Kapitäns, die sich so furchtbar bestätigt hatte, das öde Aussehen des Schiffes, auf dem sich, so nahe wir auch herankamen, so laut wir schrien, niemand zeigte, erschreckten mich. Doch es war unser einziges Rettungsmittel, darum priesen wir den Propheten, der uns so wundervoll erhalten hatte.
Am Vorderteil des Schiffes hing ein langes Tau herab. Mit Händen und Füßen ruderten wir darauf zu, um es zu erfassen. Endlich glückte es. Noch einmal erhob ich meine Stimme, aber immer blieb es still auf dem Schiff. Da klimmten wir an dem Tau hinauf, ich als der Jüngste voran. Aber Entsetzen! Welches Schauspiel stellte sich meinem Auge dar, als ich das Verdeck betrat. Der Boden war mit Blut gerötet, 20–30 Leichname in türkischen Kleidern lagen auf dem Boden, am mittleren Mastbaum stand ein Mann, reich gekleidet, den Säbel in der Hand, aber das Gesicht war blass und verzerrt, durch die Stirne ging ein großer Nagel, der ihn an den Mastbaum heftete, auch er war tot. Schrecken fesselte meine Schritte, ich wagte kaum zu atmen. Endlich war auch mein Begleiter heraufgekommen. Auch ihn überraschte der Anblick des Verdeckes, das gar nichts Lebendiges, sondern nur so viele schreckliche Tote zeigte. Wir wagten es endlich, nachdem wir in der Seelenangst zum Propheten gefleht hatten, weiter vorzuschreiten. Bei jedem Schritte sahen wir uns um, ob nicht etwas Neues, noch Schrecklicheres sich darbiete; aber alles blieb, wie es war; weit und breit nichts Lebendiges, als wir und das Weltmeer. Nicht einmal laut zu sprechen wagten wir, aus Furcht, der tote, am Mast angespießte Kapitano, möchte seine starre Augen nach uns hindrehen, oder einer der Getöteten möchte seinen Kopf umwenden. Endlich waren wir bis an eine Treppe gekommen, die in den Schiffsraum führte. Unwillkürlich machten wir dort halt und sahen einander an, denn keiner wagte es recht, seine Gedanken zu äußern.
»O Herr«, sprach mein treuer Diener, »hier ist etwas Schreckliches geschehen. Doch, wenn auch das Schiff da unten voll Mörder steckt, so will ich mich ihnen doch lieber auf Gnade und Ungnade ergeben, als längere Zeit unter diesen Toten zubringen.« Ich dachte wie er, wir fassten ein Herz und stiegen voll Erwartung hinunter. Totenstille war aber auch hier, und nur unsere Schritte hallten auf der Treppe. Wir standen an der Türe der Kajüte. Ich legte mein Ohr an die Türe und lauschte, es war nichts zu hören. Ich machte auf. Das Gemach bot einen unordentlichen Anblick dar. Kleider, Waffen und anderes Geräte lag untereinander. Nichts in Ordnung. Die Mannschaft, oder wenigstens der Kapitano, musste vor kurzem gezecht haben, denn es lag alles noch umher. Wir gingen weiter von Raum zu Raum, von Gemach zu Gemach, überall fanden wir herrliche Vorräte in Seide, Perlen, Zucker usw. Ich war vor Freude über diesen Anblick außer mir, denn da niemand auf dem Schiff war, glaubte ich, alles mir zueignen zu dürfen, Ibrahim aber machte mich aufmerksam darauf, dass wir wahrscheinlich noch sehr weit vom Land seien, wohin wir allein und ohne menschliche Hilfe nicht kommen können.
Wir labten uns an den Speisen und Getränken, die wir in reichlichem Maß vorfanden, und stiegen endlich wieder aufs Verdeck. Aber hier schauderte uns immer die Haut, ob dem schrecklichen Anblick der Leichen. Wir beschlossen, uns davon zu befreien und sie über Bord zu werfen; aber wie schauerlich ward uns zumut, als wir fanden, dass sich keiner aus seiner Lage bewegen ließ. Wie festgebannt lagen sie am Boden, und man hätte den Boden des Verdecks ausheben müssen, um sie zu entfernen, und dazu gebrach es uns an Werkzeugen. Auch der Kapitano ließ sich nicht von seinem Mast losmachen, nicht einmal seinen Säbel konnten wir der starren Hand entwinden. Wir brachten den Tag in trauriger Betrachtung unserer Lage zu, und als es Nacht zu werden anfing, erlaubt ich dem alten Ibrahim, sich schlafen zu legen, ich selbst aber wollte auf dem Verdeck wachen, um nach Rettung auszuspähen. Als aber der Mond heraufkam und ich nach den Gestirnen berechnete, dass es wohl um die eilfte Stunde sei, überfiel mich ein so unwiderstehlicher Schlaf, dass ich unwillkürlich hinter ein Fass, das auf dem Verdeck stand, zurückfiel. Doch war es mehr Betäubung als Schlaf, denn ich hörte deutlich die See an der Seite des Schiffes anschlagen, und die Segel vom Winde knarren und pfeifen. Auf einmal glaubte ich Stimmen und Männertritte auf dem Verdeck zu hören. Ich wollte mich aufrichten, um danach zu schauen; aber eine unsichtbare Gewalt hielt meine Glieder gefesselt, nicht einmal die Augen konnte ich aufschlagen. Aber immer deutlicher wurden die Stimmen, es war mir, als wenn ein fröhliches Schiffsvolk auf dem Verdeck sich umhertriebe; mitunter glaubte ich, die kräftige Stimme eines Befehlenden zu hören, auch hörte ich Taue und Segel deutlich auf- und abziehen. Nach und nach aber schwanden mir die Sinne, ich verfiel in einen tieferen Schlaf, in dem ich nur noch ein Geräusch von Waffen zu hören glaubte, und erwachte erst, als die Sonne schon hoch stand und mir aufs Gesicht brannte. Verwundert schaute ich mich um, Sturm, Schiff, die Toten und was ich in dieser Nacht gehört hatte, kam mir wie ein Traum vor, aber als ich aufblickte, fand ich alles wie gestern. Unbeweglich lagen die Toten, unbeweglich war der Kapitano an den Mastbaum geheftet. Ich lachte über meinen Traum und stand auf, um meinen Alten zu suchen.
Dieser saß ganz nachdenklich in der Kajüte. »O Herr!« rief er aus, als ich zu ihm hereintrat, »ich wollte lieber im tiefsten Grund des Meeres liegen als in diesem verhexten Schiff noch eine Nacht zubringen.« Ich fragte ihn nach der Ursache seines Kummers, und er antwortete mir: »Als ich einige Stunden geschlafen hatte, wachte ich auf und vernahm, wie man über meinem Haupt hin und her lief. Ich dachte zuerst Ihr wäret es, aber es waren wenigstens zwanzig, die oben umherliefen, auch hörte ich rufen und schreien. Endlich kamen schwere Tritte die Treppe herab. Da wusste ich nichts mehr von mir, nur hie und da kehrte auf einige Augenblicke meine Besinnung zurück, und da sah ich dann denselben Mann, der oben am Mast angenagelt ist, an jenem Tisch dort sitzen, singend und trinkend, aber der, der in einem roten Scharlachkleid nicht weit von ihm am Boden liegt, saß neben ihm und half ihm trinken.« Also erzählte mir mein alter Diener.
Ihr könnt es mir glauben, meine Freunde, dass mir gar nicht wohl zumut war; denn es war keine Täuschung, ich hatte ja auch die Toten gar wohl gehöret. In solcher Gesellschaft zu schiffen, war mir gräulich. Mein Ibrahim aber versank wieder in tiefes Nachdenken. »Jetzt hab ich’s«, rief er endlich aus; es fiel ihm nämlich ein Sprüchlein ein, das ihn sein Großvater, ein erfahrener, weitgereister Mann gelehrt hatte, und das gegen jeden Geister- und Zauberspuk helfen sollte; auch behauptete er jenen unnatürlichen Schlaf, der uns befiel, in der nächsten Nacht verhindern zu können, wenn wir nämlich recht eifrig Sprüche aus dem Koran beteten. Der Vorschlag des alten Mannes gefiel mir wohl. In banger Erwartung sahen wir die Nacht herankommen. Neben der Kajüte war ein kleines Kämmerchen, dorthin beschlossen wir uns zurückzuziehen. Wir bohrten mehrere Löcher in die Türe, hinlänglich groß, um durch sie die ganze Kajüte zu überschauen; dann verschlossen wir die Türe, so gut es ging, von innen, und Ibrahim schrieb den Namen des Propheten in alle vier Ecken. So erwarteten wir die Schrecken der Nacht. Es mochte wieder ungefähr eilf Uhr sein, als es mich gewaltig zu schläfern anfing. Mein Gefährte riet mir daher, einige Sprüche des Korans zu beten, was mir auch half. Mit einem Male schien es oben lebhaft zu werden, die Taue knarrten, Schritte gingen über das Verdeck und mehrere Stimmen waren deutlich zu unterscheiden. Mehrere Minuten hatten wir so in gespannter Erwartung gesessen, da hörten wir etwas die Treppe der Kajüte herabkommen. Als dies der Alte hörte, fing er an, seinen Spruch, den ihn sein Großvater gegen Spuk und Zauberei gelehrt hatte, herzusagen:
»Kommt ihr herab aus der Luft, Steigt ihr aus tiefem Meer, Schlieft ihr in dunkler Gruft Stammt ihr vom Feuer her: Allah ist euer Herr und Meister Ihm sind gehorsam alle Geister.«
Ich muss gestehen, ich glaubte gar nicht recht an diesen Spruch und mir stieg das Haar zu Berg, als die Türe aufflog. Herein trat jener große, stattliche Mann, den ich am Mastbaum angenagelt gesehen hatte. Der Nagel ging ihm auch jetzt mitten durchs Hirn, das Schwert aber hatte er in die Scheide gesteckt, hinter ihm trat noch ein anderer herein, weniger kostbar gekleidet; auch ihn hatte ich oben liegen sehen. Der Kapitano, denn dies war er unverkennbar, hatte ein bleiches Gesicht, einen großen schwarzen Bart, wildrollende Augen, mit denen er sich im ganzen Gemach umsah. Ich konnte ihn ganz deutlich sehen, als er an unserer Türe vorüberging; er aber schien gar nicht auf die Türe zu achten, die uns verbarg. Beide setzten sich an den Tisch, der in der Mitte der Kajüte stand, und sprachen laut und fast schreiend miteinander in einer unbekannten Sprache. Sie wurden immer lauter und eifriger, bis endlich der Kapitano mit geballter Faust auf den Tisch hineinschlug, dass das Zimmer dröhnte. Mit wildem Gelächter sprang der andere auf und winkte dem Kapitano, ihm zu folgen. Dieser stand auf, riss seinen Säbel aus der Scheide und beide verließen das Gemach. Wir atmeten freier als sie weg waren; aber unsere Angst hatte noch lange kein Ende. Immer lauter und lauter ward es auf dem Verdeck. Man hörte eilends hin und her laufen und schreien, lachen und heulen. Endlich ging ein wahrhaft höllischer Lärm los, sodass wir glaubten, das Verdeck mit allen Segeln komme zu uns herab, Waffengeklirr und Geschrei – auf einmal aber tiefe Stille. Als wir es nach vielen Stunden wagten hinaufzugehen, trafen wir alles wie sonst; nicht einer lag anders als früher, alle waren steif wie Holz.
So waren wir mehrere Tage auf dem Schiffe, es ging immer nach Osten, wohin zu, nach meiner Berechnung, Land liegen musste, aber wenn es auch bei Tag viele Meilen zurückgelegt hatte, bei Nacht schien es immer wieder zurückzukehren, denn wir befanden uns immer wieder am nämlichen Fleck, wenn die Sonne aufging. Wir konnten uns dies nicht anders erklären, als dass die Toten jede Nacht mit vollem Winde zurücksegelten. Um nun dies zu verhüten, zogen wir, ehe es Nacht wurde, alle Segel ein und wandten dasselbe Mittel an, wie bei der Türe in der Kajüte; wir schrieben den Namen des Propheten auf Pergament und auch das Sprüchlein des Großvaters dazu, und banden es um die eingezogenen Segel. Ängstlich warteten wir in unserem Kämmerchen den Erfolg ab. Der Spuk schien diesmal noch ärger zu toben, aber siehe, am anderen Morgen waren die Segel noch aufgerollt, wie wir sie verlassen hatten. Wir spannten den Tag über nur so viele Segel auf, als nötig waren, das Schiff sanft fortzutreiben, und so legten wir in fünf Tagen eine gute Strecke zurück.
Endlich am Morgen des sechsten Tages, entdeckten wir in geringer Ferne Land, und wir dankten Allah und seinem Propheten, für unsere wunderbare Rettung. Diesen Tag und die folgende Nacht trieben wir an einer Küste hin, und am siebenten Morgen glaubten wir in geringer Entfernung eine Stadt zu entdecken; wir ließen mit vieler Mühe einen Anker in die See, der alsobald Grund fasste, setzten ein kleines Boot, das auf dem Verdeck stand, aus, und ruderten mit aller Macht der Stadt zu. Nach einer halben Stunde liefen wir in einen Fluss ein, der sich in die See ergoss, und stiegen ans Ufer. Im Stadttor erkundigten wir uns, wie die Stadt heiße, und erfuhren, dass es eine indische Stadt sei, nicht weit von der Gegend, wohin ich zuerst zu schiffen willens war. Wir begaben uns in eine Karawanserei und erfrischten uns von unserer abenteuerlichen Reise. Ich forschte daselbst auch nach einem weisen und verständigen Mann, indem ich dem Wirt zu verstehen gab, dass ich einen solchen haben möchte, der sich ein wenig auf Zauberei verstehe. Er führte mich in eine abgelegene Straße, an ein unscheinbares Haus, pochte an und man ließ mich eintreten, mit der Weisung, ich solle nur nach Muley fragen.
In dem Hause kam mir ein altes Männlein mit grauem Bart und langer Nase entgegen, und fragte nach meinem Begehr. Ich sagte ihm, ich suche den weisen Muley und er antwortete mir, er seie es selbst. Ich fragte ihn nun um Rat, was ich mit den Toten machen solle, und wie ich es angreifen müsse, um sie aus dem Schiff zu bringen? Er antwortete mir: die Leute des Schiffes seien wahrscheinlich wegen irgendeines Frevels auf das Meer verzaubert; er glaube, der Zauber werde sich lösen, wenn man sie ans Land bringe; dies könne aber nicht geschehen, als wenn man die Bretter, auf denen sie liegen, losmache. Mir gehöre, von Gott und Rechts wegen, das Schiff samt allen Gütern, weil ich es gleichsam gefunden habe; doch solle ich alles sehr geheimhalten, und ihm ein kleines Geschenk von meinem Überfluss machen, er wolle dafür mit seinen Sklaven mir behilflich sein, die Toten wegzuschaffen. Ich versprach ihn reichlich zu belohnen, und wir machten uns mit fünf Sklaven, die mit Sägen und Beilen versehen waren, auf den Weg. Unterwegs konnte der Zauberer Muley unseren glücklichen Einfall, die Segel mit den Sprüchen des Korans zu umwinden, nicht genug loben. Er sagte, es sei dies das einzige Mittel gewesen, uns zu retten.
Es war noch ziemlich früh am Tage, als wir beim Schiff ankamen. Wir machten uns alle sogleich ans Werk, und in einer Stunde lagen schon vier in dem Nachen. Einige der Sklaven mussten sie ans Land rudern, um sie dort zu verscharren. Sie erzählten als sie zurückkamen, die Toten haben ihnen die Mühe des Begrabens erspart, indem sie, sowie man sie auf die Erde gelegt habe, in Staub zerfallen seien. Wir fuhren fort, die Toten abzusägen, und bis vor Abend waren alle ans Land gebracht. Es war endlich keiner mehr am Bord als der, welcher am Mast angenagelt war. Umsonst suchten wir den Nagel aus dem Holz zu ziehen, keine Gewalt vermochte ihn auch nur ein Haar breit zu verrücken. Ich wusste nicht, was anzufangen war, man konnte doch nicht den Mastbaum abhauen, um ihn ans Land zu führen. Doch aus dieser Verlegenheit half Muley. Er ließ schnell einen Sklaven ans Land rudern, um einen Topf mit Erde zu bringen. Als dieser herbeigeholt war, sprach der Zauberer geheimnisvolle Worte darüber aus, und schüttete die Erde auf das Haupt des Toten. Sogleich schlug dieser die Augen auf, holte tief Atem, und die Wunde des Nagels in seiner Stirne, fing an zu bluten. Wir zogen den Nagel jetzt leicht heraus, und der Verwundete fiel einem der Sklaven in die Arme.