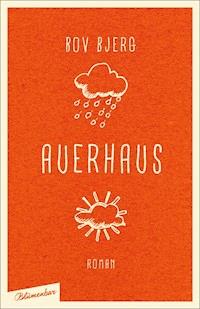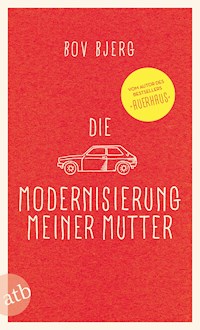
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
The Best of Bov. Gerade als seine Mutter den Führerschein macht, lässt der Gemeinderat eine Fußgängerampel aufstellen, mit fatalen Folgen für Mensch und Tier. Und ausgerechnet während des Urlaubs mit seiner Freundin in einem amerikanischen Nationalpark zieht ein heftiger Sturm auf. Und mitten im Zug auf halber Strecke zum Satireabend nach Frankfurt stürzen die Zwillingstürme ein. Egal ob Mütter oder Söhne, Lokaljournalisten oder Bankdirektoren, Münzsammler oder Apotheker - die Figuren in Bov Bjergs Geschichten haben eins gemeinsam: Für ihren Lebensweg gibt es keinen Verkehrsfunk. Schwäbische Alb, Berlin, Amerika. Das sind ihre Koordinaten. Aber was unterwegs passiert, damit müssen sie irgendwie allein fertig werden ... Mit großer Einfühlsamkeit spürt Bov Bjerg den kleinen und großen Schicksalsschlägen des Lebens nach und sorgt mit seinem besonderen Humor dafür, dass man am Ende trotzdem lacht. „Seine Geschichten zu lesen ist ganz einfach immer wieder ein sehr großes Vergnügen.“ Horst Evers. Die in diesem E-Book veröffentlichten Geschichten waren bis auf eine in dem E-Book "Ohne Brille kann ich recht und links nicht unterscheiden" enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Das Best of Bov.
Das Beste aus 20 Jahren vom Shootingstar der deutschen Literatur: Geschichten über die schwäbische Heimat, das Berliner Exil und das ferne Amerika. Komisch und melancholisch. Vielschichtig und pointiert. Für den literarischen Genuss und den großen Lesespaß.
Gerade als seine Mutter den Führerschein macht, lässt der Gemeinderat eine Fußgängerampel aufstellen, mit fatalen Folgen für Mensch und Tier. Und ausgerechnet während des Urlaubs mit seiner Freundin in einem amerikanischen Nationalpark zieht ein heftiger Sturm auf. Und mitten im Zug auf halber Strecke zum Satireabend nach Frankfurt stürzen die Zwillingstürme ein. Egal ob Mütter oder Söhne, Lokaljournalisten oder Bankdirektoren, Münzsammler oder Apotheker - die Figuren in Bov Bjergs Geschichten haben eins gemeinsam: Für ihren Lebensweg gibt es keinen Verkehrsfunk. Schwäbische Alb, Berlin, Amerika. Das sind ihre Koordinaten. Aber was unterwegs passiert, damit müssen sie irgendwie allein fertig werden.
Mit großer Einfühlsamkeit spürt Bov Bjerg den kleinen und großen Schicksalsschlägen des Lebens nach und sorgt mit seinem besonderen Humor dafür, dass man am Ende trotzdem lacht.
»Seine Geschichten zu lesen ist ganz einfach immer wieder ein sehr großes Vergnügen.« Horst Evers
Bov Bjerg
Die Modernisierung meiner Mutter
Geschichten
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Erste Ausfahrt Mehrzweckhalle
Schinkennudeln
Die Modernisierung meiner Mutter (I)
Recherche: Fulda und Wurst
Die Modernisierung meiner Mutter (II)
Kasperle und Polizist
Rolf, der Bremser
Der Onkel ist dann nach Amerika
Der eine, der andere
Im Kreisel
Geänderte Verkehrsführung
Das schmutzige Schweinsnäschen
Beschissene Jobs, Folge 24: Gott
Zwei Minuten Revolution (eins nach bis drei nach halb drei)
Gemeinsam altern
Paternoster
120 Stück pro Stunde
Vorderhaus Parterre
Herzkrank
Alle Richtungen
11.9.,20 Uhr, Frankfurt am Main
Fünf Männer
Wissenswertes über Göttingen
Howyadoin
Die beste Geschichte
Über Bov Bjerg
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Erste Ausfahrt Mehrzweckhalle
Schinkennudeln
Schinkennudeln waren immer mein Lieblingsessen, aber einmal habe ich davon gekotzt. – Es begann in einem kühlen Raum: Herrn Hofers wachsgelbes Gesicht lag in einem weißen Kissen, die Augen hatte er geschlossen, die Hände auf dem Bauch verschränkt und mit einem Rosenkranz verschnürt. Dass Herr Hofer jetzt tot war, bedeutete nichts Gutes, und dass es der Krebs, der den Bauch unter diesen verschnürten Händen so durcheinandergebracht hatte, ohne seinen Wirt wohl auch nicht mehr lange machen würde, war kein rechter Trost.
Herrn Hofers Kaufladen an der katholischen Kirche, der sich damals sogar gegen den ersten Supermarkt im Ort hatte behaupten können, indem er Leberkäs- und Mohrenkopfwecken für ein Zehnerle anbot, blieb geschlossen. Mutter hatte keine Arbeit mehr, und ohne Herrn Hofers Zeitschriftenregal und seine kleine Bücherabteilung war auch ich plötzlich ohne Beschäftigung. Seit ich lesen konnte, hatte ich meine Nachmittage in Herrn Hofers Hinterzimmer verbracht, Comics, Schneiderbücher und immer wieder stapelweise Comics verschlungen, unterbrochen nur von den freundlichen Besuchen des taubstummen Herrn Wagner, von dem ich nie genau wusste, ob er nun junge alleinerziehende Mütter oder kleine blasse Knaben bevorzugte. Ja, ich wusste nicht einmal, was mir lieber gewesen wäre. Von Herrn Wagner selbst war darüber nichts zu erfahren. Zwar war er grundsätzlich in der Lage, von den Lippen abzulesen, solange man die Laute nur deutlich formulierte. Doch wenn eine Äußerung geeignet war, seine undurchdringliche Freundlichkeit zu erschüttern, dann konnte man beim Sprechen noch so grimassieren, es war ihm einfach nicht deutlich genug. In seiner Jackentasche trug Herr Wagner ständig eine Tüte Nimm-Zwei-Bonbons, er gab mir immer ein gelbes, obwohl er genau wusste, dass ich die orangen viel lieber mochte. Dann sah ich ihn beleidigt an, er gab mir noch ein gelbes, und kichernd tauschten wir die beiden gelben Bonbons gegen ein oranges.
Es wurde Sommer, der Zettel an der Ladentür: Wegen Krankheit geschlossen, vergilbte, und Mutter fand keine Arbeit. Herrn Wagner sah ich nur noch gelegentlich, morgens auf dem Weg zur Schule oder am Wochenende auf dem Sportplatz, wenn er am Spielfeldrand stand und die D-Jugend mit gurgelnden Geräuschen anfeuerte.
Eines Tages war Herr Wagner verschwunden, und seltsamerweise begann meine Mutter, sich gerade da für ihn zu interessieren.
Ob ich mich denn noch an Herrn Wagner erinnere.
»Ja.«
Ob er mich denn einmal …
»Nein, ich weiß nicht, was du meinst.«
Ob er mich denn einmal angefasst habe.
»Ja.«
Sie schrie auf, und plötzlich benutzte sie Begriffe, die ich zwar kannte, aber dass meine Mutter sie auch kannte, damit hatte ich nicht gerechnet. Neben Schimpfwörtern der allerwüstesten Art handelte es sich vor allem um sämtliche Bezeichnungen für die männlichen Geschlechtsorgane, gekoppelt mit verschiedenen Verben des Entfernens.
»Ich hab ihn aber auch angefasst.«
Sie tobte durch den Flur, kündigte an, sie werde schon herausbekommen, wo Herr Wagner, den nur noch als Schwein zu bezeichnen sie inzwischen offensichtlich mit sich übereingekommen war, wo dieses Schwein säße, das werde sie schon herausbekommen, und dann!
»Öfters?«
»Ja, öfters.«
Das werde sie schon herausbekommen, und wenn sie bis nach Stuttgart fahren müsse oder bis nach Ulm, man könne ja nicht davon ausgehen, dass ein Schwein dieses Kalibers in unserer Kreisstadt sicher verwahrt sei. Sie rannte in die Garage – »im Kühlschrank steht noch Bohnensuppe, wartet nicht auf mich mit dem Essen« –, kam mit dem Fahrrad wieder herausgeschossen und atmete erst wieder tief und hörbar ein, als ich sie fragte, was denn so schlimm daran war, wenn ich Herrn Wagner zur Begrüßung und zum Abschied die Hand gab.
Der Sommer ging vorbei und ich ging jetzt auf die Oberschule in der Stadt, Mutter fand für kurze Zeit eine neue Anstellung auf der anderen Seite der katholischen Kirche.
Es war der sonderbarste Broterwerb, dem sie je nachgegangen war. Sie putzte und kochte. Nicht frühmorgens in Büros oder Ämtern. Nicht in Kantinen oder Gastwirtschaften. Nein, sie putzte und kochte für das Lateinlehrer-Ehepaar Glinka und ihre beiden Söhne Ekbert und Bente. Ekbert war der beste Schüler auf dem besten Gymnasium der Kreisstadt, Bente war etwas zurückgeblieben und brachte vom gleichen Gymnasium nur Zweien nach Hause. Außerdem war er in psychiatrischer Behandlung, hieß es, weil:
»Der Wagner.«
»Was, den Glinka-Bente hat er auch?«
»Ja, auch den Glinka-Bente.«
Frau Glinka war eine große, schlanke Frau. Sie sah aus wie die Flamingos im Stuttgarter Zoo. Jeden Sonntag saß sie allein in der Kirchenbank, ganz ohne Familie. Dabei war sie noch gar nicht so alt wie die zerknitterten Kopftuchwitwen in der ersten Reihe. In der Gemeinde erzählte man sich Unglaubliches: Frau Glinka sei früher evangelisch gewesen. Genausogut hätte man mir erzählen können, sie sei früher ein Mann gewesen. Katholisch war man von Geburt an oder man war es eben nicht. Alle rätselten, was sie wohl dazu getrieben hatte, freiwillig katholisch zu werden. Ich hatte auch eine Vermutung, aber die behielt ich für mich. Es hing mit ihrem Äußeren zusammen. Frau Glinka war so hoch und dünn wie der Turm der katholischen Kirche, ein schlichter Nachkriegsbau. Der Turm der evangelischen Kirche aber, der war kurz und dick. Und so war Frau Glinka eben katholisch geworden, weil sie in unseren Kirchturm besser hineinpasste.
Trotzdem blieb da ein Rätsel um diese hagere Frau, die einmal evangelisch gewesen war, die zu Hause nicht selbst kochte und putzte, und die zu allem Überfluss auch noch Latein unterrichtete, eine Sprache, von der Holger, der Streber, vor kurzem erklärt hatte, dass es »ja eine tote Sprache« sei. Eine tote Sprache? Tot wie Herr Hofer mit dem Wachsgesicht und den rosenkranzgefesselten Händen? Gruselig.
Das Haus der Glinkas lag versteckt hinter hohen Sträuchern. Ich klingelte am Gartentor, dann summte es, und ich konnte das Tor aufdrücken. Nochmal klingeln an der Haustür, Mutter öffnete.
Sie sah ganz normal aus. Gar nicht wie die Dienstboten, die ich aus Das Haus am Eaton Place kannte. Kein Häubchen, keine Rüschenschürze, kein Staubwedel, mit dem sie herumfuhrwerkte. »Na, habt ihr was gelernt?«, sagte sie, beugte sich herunter und flüsterte: »Und vergiss nachher nicht, danke zu sagen.«
Bente führte mich durch das Haus. »Das Wohnzimmer.« Glinkas hatten keine Tapeten an den Wänden, sondern Bücherregale. Wo noch Platz war, hingen Bilder. Ich konnte nicht erkennen, was sie darstellen sollten. In der Mitte des riesigen Zimmers ein sehr dicker Teppich, ganz weit hinten ein Klavier. »Das ist kein Klavier«, druckste Bente, »das ist ein Flügel.« Aber wo war der Fernseher? Ein Wohnzimmer ohne Fernseher? Absurd. Andererseits: Wo Evangelische katholisch wurden, da war vieles möglich. Bente setzte sich ans Klavier und spielte mit gespreizten Fingern, theatralisch, die Stirn fast auf den Tasten, bis Frau Glinka im Wohnzimmer stand: »Bente, ich bitte dich. Du weißt, es ist Mittagsstunde.« Grüß Gott, sagte ich. »Grüß Gott«, antwortete Frau Glinka mit gespitztem Mund. Aber der Ekbert habe doch gestern Mittag auch, sagte Bente. »Quod licet jovi, non licet bovi«, sagte Frau Glinka. »Wir essen gleich.«
Ich half meiner Mutter, den Tisch zu decken, Bente saß maulig am Klavier, dann ging er in den Flur und schlug auf den schweren Gong.
Vor dem Essen wurde gebetet, und nach dem Essen wurde gebetet. Das Essen schmeckte so lecker wie zu Hause. Logisch. Nur, dass es bei Glinkas Suppe gab und Nachtisch, und Servietten aus dickem weißen Stoff. Nach jedem Gang musste man warten, bis alle fertig waren. Nach dem Essen wurden die Familienangelegenheiten besprochen, wann Ekbert was, wohin Herr Glinka warum. Mutter und ich saßen schweigend daneben. Aufgestanden wurde erst, wenn Frau Glinka auf ihrem Stuhl zurückrutschte und gedehnt sagte: »Sooo …«
»Wagner hat dich gefickt«, sagte ich an der Haustür zu Bente.
»Wer sagt denn so was«, sagte Bente.
»Alle«, sagte ich.
»Stimmt gar nicht. Ich hab ihm einen runtergeholt. Na und?«
»Ach, und deshalb bist du jetzt verrückt und musst dauernd zum Irrenarzt? Glaub’ ich nicht.«
»Wart’s ab«, sagte Bente, »wenn du ein paar Mal hier zum Mittagessen warst, dann wirst du schon noch sehen, dass man nicht unbedingt das Glied von Wagner braucht, um verrückt zu werden.«
Er sagte wirklich Glied, dieses seltsame Wort aus dem Biobuch.
Frau Glinka war in der Gemeinde nicht sehr beliebt. Allgemein wurde ihr Übertritt zum Katholizismus als Beweis ihrer protestantischen Einstellung zur Religion gewertet. Außerdem konnte sie einfach nicht Theorie und Praxis des katholischen Regelwerks auseinanderhalten.
So war Frau Glinka wahrscheinlich die einzige Frau unter siebzig, die jeden Samstagabend zur Beichte ging, um am Sonntagvormittag ganz sicher frei von Todsünde die Kommunion zu empfangen. – Blieb die Nacht dazwischen. Selbst für die gläubigsten Traditionskatholiken ein höchstens theoretisches Problem – gebeichtet war gebeichtet. Fertig. Aus. Nicht für Frau Glinka. Dass sie auch die Samstagnacht sehr tugendhaft erlebte, dafür sprach, dass sie trotz ihrer strikten Papsttreue nicht wieder schwanger wurde, während der kleine Bierbauch ihres Mannes von Wochenende zu Wochenende immer weiter anschwoll, wodurch der schweigsame Herr Glinka dem evangelischen Kirchturm im Dorf immer ähnlicher wurde.
»Ach«, sagte meine Mutter wie nebenbei, als ich mit der einen Hand das Marmeladenbrot in den Mund stopfte und mit der anderen schon nach dem Schulranzen angelte, »ach, heute Mittag gibt’s übrigens Schinkennudeln.« Und dann sagte sie einen Satz, den ich sofort wieder vergaß: »Nach einem Rezept von Frau Glinka.«
In der großen Pause verschenkte ich die Hälfte meines Salamibrotes, damit ich am Mittag mehr Schinkennudeln essen konnte. Der Vormittag ging und ging nicht vorbei. This is Mac. He is waiting for the big blue bus. He is waiting for Schinkennudeln. Big and fettig and gebraten in the pan. Yes? No, teacher, I listen not. Yes, I am sorry. I am thinking of Schinkennudeln. Yes, bacon. – Ham? Ach so.
Ich klingelte am Gartentor, es summte, ich drückte das Tor auf. Ich klingelte an der Haustür, Mutter öffnete.
»Habt ihr was gelernt. Vergiss nachher nicht, danke zu sagen. Na, du hast es aber eilig heute.«
»Wo sind denn die Schinkennudeln?«
»Im Ofen.«
Ich wurde nicht misstrauisch. Ich deckte den Tisch, und ich wurde nicht einmal misstrauisch, als meine Mutter fürsorglich flüsterte: »Iss heut ruhig mal zwei Teller Suppe. Es gibt Bohnensuppe.«
Das war hart. Bohnensuppe war mein zweites Lieblingsessen, gleich nach Schinkennudeln. Wie sollte ich an einem einzigen Mittag angemessene Portionen von beiden Lieblingsessen schaffen? Ich wurde nicht misstrauisch. Mutter wedelte warnend mit Zaunpfählen, aber ich war blind.
Bente schlug im Flur auf den Gong. Und segne, was du uns bescheret hast, Amen. Jetzt musste ich mich entscheiden: Bohnensuppe oder Schinkennudeln.
»Halt, danke, das reicht!«
Ich aß die Bohnensuppe, eine halbe Kelle nur, und wartete. Mein Magen knurrte, ich freute mich, dass darin noch so viel Platz war und stellte mir vor, wie viele Portionen Schinkennudeln ich gleich essen konnte. I am waiting for bacon-noodles.
Aber Mutter tat sich noch einmal Bohnensuppe auf, Bente und Ekbert genauso, Herr Glinka ebenfalls, und ich wurde einfach nicht misstrauisch. Frau Glinka stichelte gegen die Leibesfülle ihres Mannes, lächelte wie gemeißelt zu mir herüber und sagte: »Wir warten auf die Schinkennudeln, nicht?« Da wurde ich misstrauisch. Zu spät.
Die Schinkennudeln schmeckten nicht. Ich hatte einen Riesenhunger, und die Schinkennudeln schmeckten nicht.
Eine trockene Auflaufmasse, die sauer roch und nach Muskatnuss. Ein Klotz, der von einer mürben Joghurtpampe zusammengehalten wurde. Nudeln, die überstanden, waren dunkelbraun mumifiziert. Die Schinkenstreifen faserig und zäh. Bente ging in die Küche und kam mit einer großen Flasche Ketchup wieder.
Ich aß. Gabel für Gabel. Ohne Ketchup. Langsam kauen. Gut einspeicheln. Schlucken. Nur nichts anmerken lassen. Ich verstand die Welt nicht mehr. Ich schaute Bente fragend an. Er lenkte meinen Blick zu Frau Glinka. Ich schaute meine Mutter fragend an. Sie schaute zu Frau Glinka. Ekbert und Herrn Glinka, wen ich auch ansah mit fragenden Augen – in denen man wahrscheinlich »Why?« lesen konnte, Augen, in denen ein Soldat die Arme hochriss und tödlich getroffen zusammensank, verzweifelte, anklagende Augen –, wen ich mit diesen Augen auch ansah, alle schauten sie zu Frau Glinka. Und mir ging ein Licht auf. Meine Mutter, beste Köchin der Welt und allerbeste Schinkennudelbraterin des ganzen Universums, hatte diese Schinkennudeln nach einem von Frau Glinka herbeiphantasierten »Rezept« zubereitet. Zwiebeln, Schinken, Nudeln: Herrgott, seit wann brauchte man für Schinkennudeln ein Rezept?
»Du nimmst noch eine schöne Portion, nicht?«, befahl Frau Glinka. Ich nickte. Und aß. Hatte ich den ersten Teller noch gegessen, weil ich so großen Hunger hatte und weil’s doch nun mal Schinkennudeln waren, so aß ich den zweiten Teller aus Höflichkeit Frau Glinka gegenüber.
Höf-lich blei-ben, kaute ich, höf-lich blei-ben.
Ich würde sie besiegen, indem ich höflich blieb. Ich war zwar nur der Sohn der Hausangestellten, aber ich kannte meine Roots, auch meine kulinarischen, und ich war stolz wie Kunta Kinte. Und das da, das waren keine regulären Schinkennudeln, das waren Klavierspielerschinkennudeln, Lateinlehrerschinkennudeln, und meine Mutter war – offensichtlich gegen ihre bessere Einsicht – dazu gezwungen worden, diese Muskatnussjoghurtsoßenkonvertitenschinkennudeln zuzubereiten.
Höf-lich blei-ben.
Diese Frau war dem religiösen Wahn verfallen. Sie wollte uns da mit hineinziehen. Uns vergiften. Uns da mit hineinziehen, indem sie uns vergiftete.
Höf-lich blei-ben.
Ich würde uns alle retten. Ich nahm die dritte Portion.
Alle retten. Indem ich höflich blieb. Indem ich weiteraß. Indem ich diese vertrocknete, pietistische Schuldbewusstseinsjoghurtmasse in mich hineinstopfte. Ich aß einfach Frau Glinkas Waffe auf. Mir wurde ein bisschen schlecht. Die vierte Portion.
Höf-lich blei-ben.
Etwas Saures stieg die Speiseröhre hoch, viel saurer als der Joghurt. Ich schickte einen Bissen Schinkennudeln entgegen.
Höf-lich blei-ben.