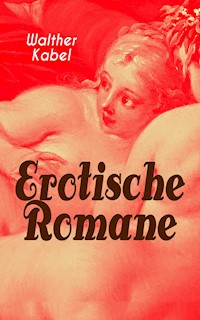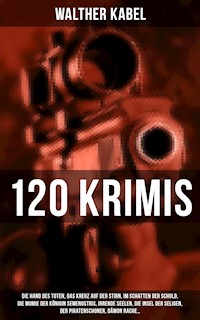Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Die Mumie der Königin Semenostris" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "Sie war schön wie der aufgehende Tag. Ihre Nase, leicht gebogen und schmal, wetteiferte in der edlen Form mit dem zierlichen Lippenpaar und den Augen, die dunkel und feurig wie schwarze Edelsteine schienen. Eine hohe Stirn, die von Geist und Charakter zeugte, war gekrönt von einer Fülle glänzenden, dunklen Haares. Ihr Gang, schwebend und leicht gleich dem der windschnellen Gazelle, drückte das Selbstbewußtsein und die Würde der geborenen Herrscherin aus." Walther Kabel (1878-1935) war ein deutscher Unterhaltungsschriftsteller. Er gilt als einer der meistgelesenen deutschen Volks-Schriftsteller der 1920er Jahre, der über 15 Jahre jede Woche eine neue Story veröffentlichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Mumie der Königin Semenostris
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Im alten Ägypten bestand zu einer Zeit, die weit vor dem Beginn der heutigen Zeitrechnung liegt, der Brauch, daß die Leichen der Angehörigen aus dem Königshause der Pharaonen, sowie die der Oberpriester und Vornehmen des Landes einbalsamiert wurden, um die Körper vor der Verwesung zu schützen und die Gesichtszüge gut zu erhalten. Die Einbalsamierer, die diese Prozedur vornahmen, bildeten eine besondere Kaste und hielten die Geheimnisse ihrer Kunst – denn eine solche war diese Art Leichenkonservierung tatsächlich – streng geheim. In den Pyramiden am Nil und in der Gräberstadt von Memphis hat man eine ganze Anzahl derartiger Mumien, Leichen, die infolge sachgemäßer Behandlung die Jahrtausende überdauert hatten, gefunden. Die schönsten und besterhaltenen von ihnen wurden, oft für Unsummen, an Museen aller Länder verkauft. Der heutzutage so hochentwickelten medizinischen Wissenschaft ist es indes nicht gelungen, die Mittel zu entdecken, mit denen die Ägypter die Leichen so vortrefflich vor der Verwesung zu schützen wußten. Die meisten Versuche, die man in dieser Richtung anstellte, schlugen fehl.
Über Ägypten herrschte nun um das Jahr 2400 v. Christus die jungfräuliche Königin Semenostris, die Tochter des Königs Mereure aus der sechsten Dynastie. Alte Hieroglyphen und Bilderschriften besagen über Semenostris folgendes:
Sie war schön wie der aufgehende Tag. Ihre Nase, leicht gebogen und schmal, wetteiferte in der edlen Form mit dem zierlichen Lippenpaar und den Augen, die dunkel und feurig wie schwarze Edelsteine schienen. Eine hohe Stirn, die von Geist und Charakter zeugte, war gekrönt von einer Fülle glänzenden, dunklen Haares. Ihr Gang, schwebend und leicht gleich dem der windschnellen Gazelle, drückte das Selbstbewußtsein und die Würde der geborenen Herrscherin aus. Die Haltung ihres edelgeformten Körpers war ohne Stolz und doch von jener vornehmen Ruhe, die nie angelernt werden kann. Das größte Wunder an dieser einzigen Königin bildeten ihre Hände – schmal und fein, wie nur der Kunstsinn eines großen Bildhauers oder aber eine gütige Laune der Natur sie zu schaffen vermag. –
Und doch zehrte an Semenostris Lebensmark eine heimtückische Krankheit. Im vierten Jahre ihrer Regierung begann sie schnell dahinzusiechen, ihre bis dahin zart geröteten Wangen nahmen die Farbe des Elfenbeins an, und an einem Morgen starb sie in den Armen dessen, den sie sich zum Gemahl erkoren und der sie dann nur eine kurze Spanne Zeit überlebte.
Ihr schöner Körper wurde den geschickten Händen der Einbalsamierer anvertraut und soll von diesen durch allerlei Künste zu nochmaligem kurzem Leben erweckt und später einbalsamiert worden sein. Semenostris ward in der zweiten Pyramiden von Gizeh unter großen Feierlichkeiten beigesetzt.
Soweit die Hieroglyphen. Vergebens hat man lange Zeit nach der Mumie der Semenostris gesucht. Nachgrabungen wurden angestellt, die Unsummen verschlangen. Wollte man doch gerade diese Mumie an das Tageslicht schaffen, da die Gelehrten hofften, daß man in ihr dann eine der überaus seltenen Tophar-Mumien besitzen würde, von denen bisher nur drei gefunden sind.
Die Tophar-Mumien sind nämlich ein Denkmal eines der grauenhaftesten Gebräuche, die die Weltgeschichte kennt. Wie in Indien sich noch heute trotz aller Verbote der englischen Regierung die Witwen eingeborener Fürsten zugleich mit der Leiche des Gatten auf einem Scheiterhaufen lebend verbrennen lassen, so galt es in Ägypten als ein Zeichen der allerhöchsten Treue, wenn sich die Witwe – lebend! – einbalsamieren und dann neben dem Gemahl bestatten ließ. Die Tophar-Bräute, wie die ägyptischen Dichter solche Frauen, die sich freiwillig solcher Prozedur unterwarfen, poetisch benannten, wurden unter feierlichen Zeremonien in das Haus der Einbalsamierer geleitet und von diesen hauptsächlich durch Einspritzen besonderer Flüssigkeiten in die Adern langsam zur Tophar-Mumie umgewandelt, ein Verfahren, bei dem die Leiche nicht wie bei den anderen Mumien vertrocknete, sondern frisch wie im Leben blieb und auch ihre natürliche Farbe bewahrte.
Der Schriftsteller Herodot, der Vater der Geschichte, gibt in seinen Schriften die Methode, wie die Tophar-Bräute vom Leben zum Tode geführt wurden, nur höchst unvollkommen an. Immerhin kann man aus diesen Andeutungen die Hauptsachen dieses Verfahrens, welches einen der eigentümlichsten Gebräuche uralter Volkssitten darstellt, entnehmen.
Die Gelehrten sind nun infolge weiterer Hieroglyphen-Inschrift zu der Überzeugung gelangt, daß die Königin Semenostris, als sie ihren Tod herannahen fühlte, einen Schlaftrunk genommen und vorher bestimmt hatte, sie wolle, um sich für ihren Geliebten in alter Schönheit zu erhalten, die Tophar-Prozedur an sich vornehmen lassen.
Inwiefern die vorstehenden Ausführungen mit dem in der Jetztzeit spielenden Roman ‚Die Mumie der Königin Semenostris’ zusammen hängen, wird der Leser bei einigem Scharfsinn bald ergründen können.
1. Kapitel. Harry Timpsear und Melitta Winkler
„Wahrhaftig, da ist dieser gräßliche Mensch ja schon wieder!“
Melitta Winkler suchte gerade in der Handschuhabteilung des Warenhauses Wertheim einige Paare für sich und ihre Tante Antonie aus, als sie des Fremden ansichtig wurde, der sich nun schon seit zwei Stunden hartnäckig in ihrer Nähe aufhielt und sie mit Blicken musterte, die ihr gründlich mißfielen.
Schnell wandte sie den Kopf nach der andere Seite, nahm den Kassenzettel von der Verkäuferin entgegen und hastete, so gut es bei dem Gedränge möglich war, nach der nächsten Zahlstelle. Dann suchte sie, ihre Pakete sorgsam festhaltend, den Fahrstuhl auf und schlüpfte hinein. Im zweiten Stock stieg sie aus und begab sich zu Fuß über die breite Freitreppe nach dem Erfrischungsraum, um sich dort nach den gehabten Anstrengungen etwas zu stärken
‚Jetzt wird der aufdringliche Mensch mich wohl endlich aus den Augen verloren haben,‘ dachte sie aufatmend, ließ sich einige belegte Brötchen und eine Tasse Kakao geben und setzte sich an einen leeren Tisch, der etwas abseits in der Fensterecke stand.
Mit geringem Appetit begann sie dem bescheidenen Mal, das ihr das versäumte Mittagessen ersetzen sollte, zuzusprechen. Immer deutlicher fühlte sie, wie sehr der Aufenthalt in dem Riesenbau des Kaufhauses mit seinem unaufhörlichen Menschengewoge ihre schwachen Kräfte erschöpft hatte. Des öfteren schloß sie, heimgesucht von einer ohnmachtähnlichen Anwandlung, für einen Moment die Augen und freute sich nur darauf, wenn sie erst im Zuge sitzen und ihrer jetzigen Heimat entgegenfahren würde. Für ihre empfindlichen Nerven war das Getriebe der Riesenstadt Berlin nun einmal nichts. Sie fühlte sich am wohlsten in dem kleinen Städtchen, in dem sie im Hause von Verwandten nach dem Tode ihrer Eltern Zuflucht gefunden hatte, und wo jetzt sicher ein treues Männerherz sie mit heißer Sehnsucht erwartete.
Ein glückliches Lächeln flog über ihr bleiches edelgeformtes Antlitz, in dem ein paar dunkle, lebhafte Augen so deutlich von einem lebensfrohen, feurigen Temperament sprachen.
Doch das Lächeln stiller Seligkeit verschwand urplötzlich wieder. Melitta Winklers Stirn krauste sich leicht vor Unmut und Empörung. Blitzschnell hatte sie den Kopf über ihre Tasse gebeugt. Vielleicht daß der, der eben langsam, wie suchend, durch die Tischreihen schritt, sie nicht bemerkte.
Die Hoffnung war trügerisch gewesen.
Neben ihr erklang eine bescheidene Stimme, die das Deutsche mit dem leichten, scharfen Akzent des Ausländers sprach:
„Gnädiges Fräulein, gestatten Sie, daß ein alter Mann sich einen Augenblick zu Ihnen setzt?“
Melitta schaute auf. Vor ihr stand der Fremde, der sie nun schon die ganze Zeit über hier im Warenhause verfolgt hatte.
Unwillkürlich sah sie mit einem gewissen neugierigen Interesse den Menschen genauer an.
Es war ein älterer, gutgekleideter Herr mit einem rötlichblonden Vollbart, der ein kluges, freundliches Gesicht umrahmte. Hinter den Gläsern einer goldenen Brille verbargen sich zwei Augen, deren Lider halb geschlossen waren und von der Pupille nur einen schmalen Streifen sehen ließen. –
‚Im ganzen eine recht sympathische Erscheinung,‘ dachte das junge Mädchen. Und, verführt von einer leicht zu begreifenden Wißbegierde, aus welchem Grunde der Fremde wohl so viel Teilnahme für sie bezeigte, erwiderte Melitta nicht gerade ablehnenden Tones:
„Es sind zwar noch eine ganze Menge anderer Tische frei; aber wenn Sie durchaus hier Platz nehmen wollen, habe ich nichts dagegen.“
Abermals lüftete der Unbekannte den Hut und ließ sich dann, ein leises ‚Danke!’ murmelnd, ihr gegenüber auf einem der Hocker nieder.
Das junge Mädchen verzehrte hastig sein letztes Brötchen, fest entschlossen, möglichst schnell aufzubrechen und nach dem Schlesischen Bahnhof zu fahren, von wo in einer Stunde ihr Zug abging.
Inzwischen hatte der Fremde seine Tischgenossin unauffällig nochmals betrachtet. Ein zufriedenes Lächeln huschte um seinen Mund, und seine Augen öffneten sich für einen Moment wie vor Freude zu ihrer ganzen Größe. Es waren seltsame Augen; die Farbe ein unbestimmtes helles Grüngrau, ihr Glanz fast krankhaft, ihr Ausdruck blitzschnell wechselnd – wohl ebenso schnell, wie die Gedanken ihres Besitzers von Empfindung zu Empfindung eilten. Triumph, Grausamkeit, freudige Hoffnung, Ängstlichkeit – alles dies vermochte ein scharfer Beobachter trotz der kurzen Zeit, die die schützenden Lider sie freigaben, darin zu lesen.
Aber Melitta Winkler bemerkte davon nichts. Eifrig gruben sich ihre tadellosen Zähne in das Brötchen. Sie blickte nicht auf. Mochte der Fremde nur da vor ihr sitzen. Er störte sie nicht. Denn Angst brauchte sie doch hier inmitten der zahlreichen Menschen wahrhaftig nicht vor ihm zu haben!
„Gnädiges Fräulein,“ begann der Unbekannte plötzlich, indem er sich etwas über den Tisch beugte, „ich fürchte fast, daß Sie mein Interesse, welches ich für Ihre Person bezeigte und daß Ihnen kaum entgangen sein dürfte, falsch ausgelegt haben. Bereits als Sie mir soeben gestatteten, an Ihrem Tische hier Platz zu nehmen, wußte ich, daß ich mich geirrt, daß eine Ähnlichkeit mich getäuscht hatte. Ich war bis dahin nämlich ungewiß, ob ich nicht in Ihnen eine Newyorker Freundin vor mir sah. Ihr tadelloses Deutsch belehrte mich eines besseren. Die Dame, mit der ich Sie verwechselte, radebrecht das Deutsche nur höchst unvollkommen, während Sie fraglos den Vorzug genießen, Deutschland als Ihr Vaterland bezeichnen zu dürfen!“
Das klang alles so harmlos, so höflich und so zurückhaltend, daß Melitta nicht zögerte, dem Herrn auf diese Erklärung seines sonderbaren Benehmens eine Antwort zu geben.
„Und um dieses festzustellen, sind Sie mir zwei ganze Stunden von Verkaufsstand zu Verkaufsstand gefolgt?“ meinte sie mit einem leisem Lächeln.
„Allerdings.“ entgegnete er ehrlich. „Ich bin ziemlich kurzsichtig und fürchtete, daß mich eine nur entfernte Ähnlichkeit narren könnte, wollte mir auch nicht dort im Gedränge der Käufer Gewißheit verschaffen, wo – “
Er stockte und schaute sie mit einem gewinnenden Lächeln an.
„Kurz und gut,“ fuhr er dann fort, „Sie sehen, gnädiges Fräulein, ich bin keiner von jenen aufdringlichen Herren, die Abenteuer suchen und irgend einen Vorwand dazu benutzen, um Bekanntschaften zu schließen. Ich habe mich geirrt, und damit ist die Sache erledigt. Trotzdem fühle ich mich verpflichtet, Ihnen dem gesellschaftlichen Brauche gemäß meinen Namen zu nennen.“
Er erhob sich halb, verbeugte sich und sagte mit seiner leisen und doch klaren Stimme:
„Doktor Harry Timpsear aus Newyork, Privatgelehrter.“
Wie es kam, wußte Melitta nachher selbst nicht zu sagen; aber nach wenigen Minuten befand sie sich bereits in einer angeregten Unterhaltung mit dem Amerikaner, der ihr mit seiner stets gleichbleibenden vornehmen Zurückhaltung und der Situation angemessenen Höflichkeit recht gut gefiel.
Nur eines störte sie etwas: daß Doktor Timpsear hin und wieder aus seinen halb geschlossenen Augen ihr Gesicht und ebenso ihre selten schöngeformten Hände mit Blicken musterte, wie ein Kunstkenner ein Gemälde zu betrachten pflegt – mit kühler Sachlichkeit jede Einzelheiten zerlegend und kritisch mit den übrigen Bestandteilen vergleichend.
So verstrich ihr eine halbe Stunde wie im Fluge. Von allem möglichen hatte der weitgereiste Gelehrte ihr erzählt und – es dabei doch verstanden, freilich ohne das die arglose junge Dame etwas merkte, alles das aus ihr durch eingestreute Fragen herauszuholen, was man bei einer so kurzen Bekanntschaft sonst kaum zu erfahren pflegt: ihren Wohnort, ihre Zukunftshoffnungen und anderes mehr.
Jetzt schaute Melitta beinahe erschreckt auf ihre Uhr, sprang auf, raffte ihre Pakete zusammen und verabschiedete sich.
„Ich muß mich sehr beeilen, Herr Doktor. Um halb drei geht mein Zug. Leben Sie wohl.“
Freimütig reichte sie ihm die Hand.
„Es war mir eine Freude, mit Ihnen hier einige Zeit plaudern zu dürfen,“ erklärte Timpsear, indem er ihr ihren Schirm reichte, der zu Boden gefallen war. „Wir werden uns ja nie wiedersehen, gnädiges Fräulein. Trotzdem werde ich stets gern an diese kleine Episode zurückdenken. Alles Gute für die Zukunft!“
Eine freundliche Verbeugung folgte, dann verließ Melitta Winkler das Warenhaus, rief eine Autodroschke herbei und fuhr zum Schlesischen Bahnhof.
Doktor Timpsear aber hatte, kaum daß sie verschwunden war, sein Notizbuch vorgekommen und trug in dasselbe genau alles das ein, was er aus dem jungen Mädchen herausgelockt hatte.
Dann schob er das Büchlein wieder in die Tasche und nickte zufrieden vor sich hin.
„Die zweite!“ murmelte er, ganz in seine Gedanken vertieft. „Selbst die Hände, diese entzückenden Hände, sind vorhanden – dies ist die wahre Schönheit – die andere – pah – ein Notbehelf – “
Gleich darauf verließ auch er das riesige Gebäude, fragte auf der Straße einen Schutzmann, wie er am schnellsten nach der Grotiusallee käme, und bestieg dann einen Omnibus, der gerade in nächster Nähe an der Schwelle des Bürgersteiges hielt.
Die Fahrt dauerte gut drei Viertelstunden.
An der Ecke der Grotiusallee, hoch oben im Norden Berlins, hielt der Omnibus, und Doktor Timpsear setzte seinen Weg zu Fuß fort. An einer endlos langen Mauer schritt er entlang, bis er an ein kleines Holzpförtchen gelangte, neben dem ein Schild mit der Aufschrift: ‚Gottfried Häusler, Totengräber’ hing. Über dem Schildchen war ein verrosteter Klingelzug sichtbar. Timpsear zog kräftig und wartete. Nach einer geraumen Weile erklangen hinter der Mauer schlurfende Schritte. Die Pforte wurde geöffnet, und ein Mann in erdbeschmutzter Kleidung, mit einem hageren Raubvogelgesicht, begrüßte den Amerikaner wie einen alten Bekannten, aber mit kriechender Unterwürfigkeit. Beide verschwanden dann in einem Häuschen, das mit der Rückwand an der Mauer lehnte und von gärtnerischen Anlagen umgeben war. Die hohe Mauer aber schloß nichts anderes ein, als den Kirchhof der amerikanischen und englischen Kolonie der Reichshauptstadt.
In dem kleinen Vorderzimmer des Häuschen, einem behaglich eingerichteten Raum, hatte Doktor Timpsear auf dem altmodischen Sofa Platz genommen, der Totengräber war vor ihm in abwartender Haltung stehen geblieben.
„Nun Häusler, haben Sie sich die Sache überlegt?“ fragte der Amerikaner kurz.
Der Totengräber schaute sich ängstlich um.
„Leise, Herr – sprechen Sie leise. Meine Frau darf nichts von unserem Geschäft ahnen. – Sie ist so ängstlich.“
„Wenn Sie schon von ‚Geschäft’ sprechen, so muß ich annehmen, daß Sie einverstanden sind,“ flüsterte Timpsear zurück.
Der Mann nickte eifrig.
„Werde mir doch nicht den schönen Verdienst entgehen lassen!“ meinte er schlau lächelnd. „Mein Gehilfe ist eingeweiht und macht mit. Ohne den hätte ich nichts unternehmen können. Ein Mann ist zu wenig für diese Art von – Arbeit.“
Der Amerikaner schüttelte unmutig den Kopf.
„War das wirklich nötig? – Ich sagte Ihnen doch, daß die Sache unter uns beiden abgemacht werden sollte! – Ist der Mensch denn zuverlässig?“
„Für den lege ich meine Hand ins Feuer, Herr! Keine Sorge, der verrät nichts!“
Harry Timpsear holte jetzt sein Notizbuch hervor und schaute hinein. Es war die Seite, die er heute bei Wertheim mit allerlei Bemerkungen über Melitta Winkler angelegt hatte.
„Wissen Sie in der Umgebung von Berlin Bescheid, Häusler?“ fragte er dann.
Der Totengräber bejahte. „Ich bin geborener Spreeathener,“ meinte er nicht ohne Stolz.