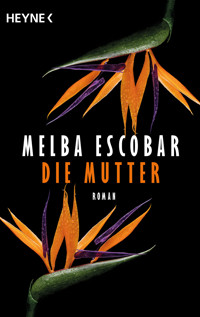
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einem Einkaufszentrum in Bogotá explodiert ein Sprengsatz und Cecilias Sohn, der Soziologie-Student Pedro, verschwindet. Kurz vorher muss er sich dort aufgehalten haben. In den Stunden, die dem mutmaßlichen Anschlag folgen, sieht sich Cecilia wieder mit ihrer Vergangenheit konfrontiert: mit ihrer großen Liebe, Pedros Vater, seinem gewaltsamen Tod und der quälenden Frage, ob es möglich ist, sich politisch „herauszuhalten“ in dem von inneren Kämpfen zerrissenen Land. War Pedro an dem Anschlag beteiligt, Pedro, für den Cecilia sich immer nur ein Leben in Frieden und Freiheit gewünscht hat?
Die packende Geschichte einer mutigen Frau, die sich den Gespenstern der Vergangenheit und den Widrigkeiten des Schicksals entgegenstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
DASBUCH
Am Morgen des Attentats hatte Pedro für uns beide Frühstück gemacht. Es dürfte noch keine zehn Uhr gewesen sein, als er den Tisch abräumte. Er sagte, er gehe für Juana ein Geschenk kaufen. An der Tür hatte er mir noch eine Kusshand zugeworfen. Er hatte gute Laune. Vom Fenster aus sah ich ihn weggehen. Ich hatte ihm vorgeschlagen, uns um vier Uhr im Einkaufszentrum zu treffen, falls er dann noch dort sein sollte. Denn ich wollte ihm Manuel vorstellen. Ich ahnte, dass sie sich mögen würden. In letzter Zeit hatte er sein Haar bis auf die Schultern wachsen lassen. Er trug eine Hornbrille, die ihm wunderbar stand, die er aber nicht brauchte, soweit ich wusste. Eine Modeerscheinung, dachte ich. Wenn wir jung sind, bemühen wir uns redlich, anders zu sein, nur um Jahre später das anzustreben, was wir mit allen anderen gemein haben.
DIEAUTORIN
Melba Escobar, geboren 1976 in Kolumbien, schreibt regelmäßig für die Zeitungen El País und El Espectador. Neben ihrer Tätigkeit als Journalistin hat sie bislang fünf Romane und zwei Sachbücher verfasst. »Die Kosmetikerin« wurde als bester Roman 2016 mit dem kolumbianischen Premio Nacional de Novela ausgezeichnet. Zudem arbeitet Melba Escobar an mehreren Literaturprojekten für Kinder mit. Sie lebt mit ihrer Familie in Bogotá.
MELBA ESCOBAR
DIE MUTTER
Aus dem Spanischen von Sybille Martin
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe La mujer que hablaba sola erschien erstmals 2019 bei Editorial Planeta Colombiana, Bogotá
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 08/2023
Copyright © 2019 by Melba Escobar
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München,
unter Verwendung von Motiven von © Getty Images (Stefano Marelli)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN: 978-3-641-28421-3V001
www.heyne.de
Für Patricia Afanador
Wer ich war, heute früh beim Aufstehen, das weiß ich schon, aber ich muss seither wohl mehrere Male vertauscht worden sein.
Alice im Wunderland LEWISCARROLL
Mich überkommt ein Gefühl der Erleichterung, als würde sich das, was es im Leben zu verwirklichen gilt, mit der Ankündigung meiner Heirat auf magische Weise erfüllen.
Catalina ELISAMUJICA
Und zum Weibe sprach er:
Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst;
unter Mühen sollst du Kinder gebären.
Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein.
MOSE 3,16
1
Wie oft habe ich Mama gebeten, mir die Augen zu schminken. Und wie oft habe ich es selbst versucht, wie eine erwachsene Frau vor dem Spiegel, hoch konzentriert und mit zittrigen Fingern. Jetzt ist diese schlichte, mechanische Handlung wieder eine ungeschickte. Der Lidstrich verschmiert, die Hand verkrampft. Es war außerdem zu spät dafür, mich zu fragen, warum ich heiraten wollte, voller Zweifel, lustlos und mit dem Kind eines anderen im Bauch. Jetzt lautete die Frage, warum ich mir die Augen schminkte, aber vor allem, warum es mir so schwerfiel, es anständig hinzubekommen. Mein Kopf dröhnt. Die Ungewissheit treibt mich zu dir, sie wirft mich geradezu in die Erinnerung an dich. Letzte Nacht habe ich schlecht geschlafen, obwohl ich eigentlich sagen sollte, dass ich gar nicht geschlafen habe. Ich lege mich ins Bett und sehe uns beide an unserem Hochzeitstag. Ich bin festgefroren in diesem Augenblick, vor fast zwanzig Jahren. Du warst verliebt in die Frau, die du dir auf der Projektionsfläche meines Körpers ausgemalt hast. Ich werfe dir das nicht vor. Vielleicht liegt es daran, dass man alt wird, wenn man entdeckt, mehr als ein Körper zu sein. Die Wut, die Impulsivität, der Egoismus, all das war überlagert von einer »Milchreishaut«, wie du zu sagen pflegtest. Ich habe festgestellt, und zwar zu spät, dass man einen Mann, der keinen Drang verspürt, dir zwischen die Beine zu schauen, nicht heiraten darf. Es gab keine Leidenschaft zwischen uns, es gab sie nie. Eher ein vermeintliches Feuer, das die Wut überlagerte. Schlechter Sex, fehlender Sex, Blut in den Augen, in den Adern. Vierundzwanzig Jahre. Alles falsch. Ich betrachtete dich, wie man ein kleines Kind ansieht, wie eine Orchidee, wie einen Welpen. All das Herzblut stammte von dir, und obwohl es eine Menge war, reichte es nicht.
Du hattest so viel Energie. Und du hast selten die Kleidung gewechselt. Du brauchtest wenig zum Leben. Kaffee, Comics. Wir mussten uns die Liebe erfinden, um alles kompliziert zu machen. Erfinden ist vielleicht übertrieben. Du hast mich mit launischem Ingrimm begehrt, und ich ließ dich dankbar gewähren. Ich war kein kleines Mädchen mehr. Die langen wilden Locken waren verschwunden. »Du bist nicht dafür geboren, zu heiraten oder Kinder zu kriegen«, sagte Tante Cecilia, wenn sie mir über das krause Haar strich. Mit ihr teilte ich den Namen und die Erinnerung an eine göttliche Kindheit. Es genügte, dass mein Haar nach und nach glatter wurde, um das Schlimmste zu prophezeien:
»Du wirst nicht entkommen«, behauptete sie feierlich.
»Wovor entkommen?«
»Vor einem Leben, das nichts für dich ist.«
»Sieht es so schlimm aus?«, fragte ich, während Tante Cecilia mit gerunzelter Stirn in mein Glas starrte.
»So schlimm, dass ich es dir besser nicht erzähle.«
Ich dürfte zwölf Jahre alt gewesen sein, als ich zu Mama sagte:
»Ich werde nicht heiraten. Die Ehe ist ein Kreuz.«
Zu den weißen Lichtern, der Hitze, dem Lärm, dem Gedränge und dem Schwindel jenes Augenblicks muss man sich eine hagere, große Mulattin wie meine Tante vorstellen, die mir erklärte, dass ich nicht für die Ehe bestimmt sei. Tante Cecilia starb, ich näherte mich dem verwirrenden Erwachsenenalter. Es war, als hätten die Regeln der magischen Welt, die sie für mich eingerichtet hatte, keine Gültigkeit mehr.
Dann kamst du, gerade zum richtigen Zeitpunkt, mit deinem Versprechen der ewigen Liebe. Wir erfanden uns gegenseitig, als wären wir Schauspieler. Welche Leichtfertigkeit, welch dringendes Bedürfnis nach Utopien, die hastig aus den verfügbaren Materialien gezimmert wurden. Ich fürchte, wir haben uns niemals richtig kennengelernt. So etwas passiert uns allen, aber besonders den Männern. Für diese Erkenntnis brauchte ich Jahre. Bei ihnen entsteht die Liebe durch den Blick. Wenn die himmlischen Qualitäten, die der geliebten Frau angedichtet werden, sich später als falsch erweisen, schauen sie woanders hin, sind erschrocken oder behaupten, betrogen worden zu sein.
Es ist nämlich so, dass Pedro, unser Sohn, nicht da ist. Ich weiß nicht, ob ich ihn je wiedersehen werde. Ich weiß nicht, ob er schuldig ist oder nicht. Wir haben das Jahr zweitausendneunzehn, aber in meinem Kopf kehre ich immer wieder zu unserer Hochzeitsnacht vor knapp zwanzig Jahren zurück. Ich bin wieder diese junge Frau, der alles im Leben zu groß ist, selbst das Hochzeitskleid. Im Spiegel betrachte ich meine Krähenfüße. Ich werde langsam alt. Kann ein Toter Vater sein? Er kann, das habe ich dank dir festgestellt. Du bist ein postumer Vater. Das habe ich noch nie aufgeschrieben. Gesagt schon, und zwar oft. Bei Geburtstagen zum Beispiel.
»Und Pedros Vater kommt nicht?«
»Nein. Der Junge ist ein postumes Kind.«
Ich gebe zu, dass ich das sagte, um zu nerven. Denn ich fand diese Frage ziemlich unverschämt. Und der Vater kommt nicht? Sind wir etwa die Heilige Familie? Und wenn ich eine alleinerziehende Mutter wäre? Und wenn ich eine Frau hätte? Ich sah die Irritation in ihren Gesichtern. Wie sie dachten, postum soll also heißen, dass er danach … gestorben ist, klar, natürlich. Dein postumer Sohn wird verdächtigt, »mutmaßlich« an einem Attentat beteiligt zu sein. Pedro Gil, ein mutmaßlicher Mörder. Ja, mein Schatz, er trägt deinen Namen. Mehr noch, er ist dein Abbild, nur größer und dünner und mit meinem Kinn (einem Männerkinn). Kannst du dich daran erinnern, dass du mich Kolibri genannt hast? Du sagtest, dass ich täglich das Achtfache meines Gewichts essen würde (ebenfalls wie ein Mann). Und wie ich gegessen habe. Ich hatte ständig Hunger. Ich war unersättlich, so unersättlich, wie du mich lieber im Bett gehabt hättest. Ich finde mich immer noch attraktiv, Rayo, ich glaube, das würdest du mir bestätigen. Und obwohl ich nicht mehr täglich das Achtfache meines Gewichts esse, habe ich zehn Kilo zugenommen. Ich versuche erfolglos, mich zu entspannen. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich mich als junge Frau, die wie Prinzessin Leia gekleidet ist.
Die von früher rauchte, die von heute nicht mehr. Die von früher trug langes Haar, die von heute nicht mehr. Die von früher hatte dauernd Hunger, die von heute nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du mich wiedererkennen würdest, wenn du mich sehen könntest. Ich war immer auf der Suche nach Bestätigung. Die von früher wollte sich die Welt einverleiben, die von heute will nicht von der Welt einverleibt werden. An jenem Tag hatte ich eher das Gefühl, eine Braut zu spielen, statt eine zu sein. Meine Beine sahen aus wie die eines kleinen Mädchens mit runden Knien, das gerade das geblümte Kleid ausgezogen hat. Unversehens war ich wieder eine Jugendliche, die sich zum Ausgehen schminkte, während Papa spöttisch zu mir sagte: »Du siehst aus wie eine Kakerlake in der Bäckerei.« Da stand ich nun, abermals mit geliehenen Stöckelschuhen, zugekleistert wie eine Geisha, aber ich war kein kleines Mädchen mehr, das Hochzeit spielt. Sie fand wirklich statt.
In jener Nacht regnete es leicht. Viele Passanten genossen die Tropfen im Gesicht, nur wenige hatten den Regenschirm aufgespannt. Bogotá im Jahr zweitausend. Schmutzige, nasse Straßen, die Leute hasteten vorüber, als wäre ihnen ein imaginärer Räuber auf den Fersen. Ich überlegte, ob ich runtergehen und laufen sollte, wusste aber nicht, wohin. Wann war eine Heirat eigentlich eine gute Idee gewesen?, fragte ich mich, während ich den Fremden voller Neid hinterherschaute und mein Herz heftig pochte vor Verlangen, nach draußen zu eilen. Zu meiner Beruhigung redete ich mir ein, dass mindestens die Hälfte aller Menschen ihr Leben mit einer Beschäftigung oder einer Person verbringen, die sie nicht mögen. Dich mochte ich. Vielleicht auf andere Weise, aber ich mochte dich. Meine Arbeit verabscheute ich. Ich wollte nicht heiraten. Ich war im Begriff, mich der Mehrheit der Leute anzuschließen, daran würde ich nicht sterben.
In der Schule, in der ich als Lehrerin arbeitete, hatte ich zwei Jungs dabei erwischt, wie sie obszöne Bilder von mir in ihr Heft malten. Ansonsten zündelten sie gern im Klassenzimmer. Unvermittelt blieb ich vor dem Lokal stehen, in dem die Hochzeit stattfinden sollte. Die Bar war schön, und auch wir waren schön in unserem typisch jugendlichen Glauben, einzigartig zu sein. Zur Filmmusik von Krieg der Sterne trat ich langsam ein. Das war deine Idee gewesen, ebenso wie die Wegwerfkameras, mit denen jeder Gast seine eigenen Hochzeitsfotos machen konnte, und die Vasen mit seltsamen Figuren darauf, die wir en gros gekauft und selbst gefüllt hatten. Die drei Aquarien mit den schillernden tropischen Fischen, eine Art vorweggenommenes Bild der Gefangenschaft, waren eine Überraschung. Du hattest sie kurz vor meinem Eintreffen aufgestellt. Du warst stolz. Stolz und verschwitzt. Bei ihrem Anblick zog sich mein Herz zusammen. Ich hastete regelrecht durch diesen improvisierten Brauteinzug. Und wollte plötzlich, dass alles zu Ende wäre. Ich setzte mich neben dich. Der Standesbeamte sprach von Fortpflanzung. Mir war speiübel. Im Hintergrund waren die Stimmen der annähernd achtzig Gäste aus dem ersten Stock zu hören. Sie klangen zunehmend ungeduldig. Dann hob das Gemurmel an, und es wurde gedrängelt, um das Brautpaar zu sehen. Nichts war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Auch ohne eine klare Vorstellung vom Ablauf wusste ich, dass es so nicht sein sollte. Nach gut fünf Minuten drehte ich mich um und stieß einen Schrei aus: »Pssst! Ruhe!« Dann konzentrierte ich mich wieder auf die Zeremonie. Du schienst keineswegs verärgert; man könnte eher sagen, du warst zufrieden. Für einen Moment wirkten wir wie ein normales Paar, das heiratet. Du hast mit geröteten Augen gelächelt. In den Nächten davor hattest du sehr viel getrunken, in deinem Kopf muss es ordentlich gehämmert haben. Ich starrte auf deine verbundene Hand, mit der du fünf Tage zuvor den Spiegel in tausend Scherben zerschlagen hattest. »Wenn wir verheiratet sind, lässt du das Ding da in deinem Bauch wegmachen, oder du verschwindest«, hattest du gesagt. Ich nickte damals, so wie ich es jetzt tue. Ich dachte an einen Kaktus. Ich dachte, ich wäre ein Kaktus. Mit Übelkeit kämpfend unterschrieb ich die Heiratsurkunde. Jetzt waren wir verheiratet. Dann kam der Kuss, gefolgt von Beifall und begeisterten Hochrufen. Als es vorbei war, lief ich hinaus und schaffte es gerade noch rechtzeitig auf die Toilette.
2
Am Samstag, dem siebzehnten Juni, explodierte in einer Damentoilette im Einkaufszentrum Plaza Norte ein Sprengsatz. Eine Frau starb, weitere neun Frauen wurden verletzt. Pedro hatte mir gesagt, dass er ins Plaza Norte gehen wolle, um für Juana ein Geschenk zu kaufen. Dieser Name hatte sich in ein Wort mit fünf Buchstaben verwandelt, hinter dem mein Sohn sich verflüchtigte, die Erklärung dafür, dass ich Pedro in den letzten Monaten so wenig gesehen hatte. Wenige Wochen nach dem Beginn seines Studiums an der Universidad Nacional hörte ich ihn zum ersten Mal von ihr sprechen. Er erwähnte sie beiläufig, als wäre die Sache nicht weiter wichtig. Schon dem Klang seiner Stimme konnte ich diese bemühte Beiläufigkeit entnehmen. Wir führten nur noch kurze Gespräche. In seiner Kindheit sprachen wir viel miteinander. Wenn ich heute daran denke, waren es weniger Gespräche, sondern eher eine Art Fragespiel, denn Pedro fragte mich tausend Dinge, und ich antwortete, so gut ich konnte. »Wohin gehen die Toten?« Ich ahnte, dass er mich damit indirekt nach dir fragte. »Wozu haben wir Finger- und Fußnägel?« Meine Antworten schienen ihn zu enttäuschen. Er stellte dieselben Fragen auf andere Weise, doch sie zerschellten immer wieder an der Enttäuschung. Er war noch ein Kind, als ich ihn bezüglich deines Todes anlog. Er dürfte noch keine fünf Jahre alt gewesen sein, als er fragte:
»Mama, ist Papa noch immer mein Papa, auch wenn er tot ist?«
Meine Antwort folgte schnell, wie immer, wenn ich nicht darüber nachdenke, was ich sage.
»Natürlich, mein Schatz, er bleibt immer dein Papa.«
Darauf folgte die Frage, woran du gestorben bist. Komisch, ich hatte nie über eine Antwort auf diese naheliegende Frage nachgedacht. Aber wie so oft verwandelt sich etwas Improvisiertes in etwas Definitives. Hätte Pedro die Wahrheit erfahren, wäre die Geschichte eine andere. Trotzdem kam mir die Lüge ganz automatisch über die Lippen. Vielleicht wollte ich ihm eine weniger düstere Erinnerung an seinen Papa mitgeben, den er nie kennengelernt hatte, denn ich sagte ihm, du seist an Krebs erkrankt, als ich schwanger war. Dass du gekämpft hättest wie ein Löwe, denn ich bin davon überzeugt, das hättest du, wenn das Schicksal dir eine solche Krankheit beschert hätte. Ich sagte ihm, dass der Arzt dir noch zwei Monate gegeben hätte, du aber noch sechs gelebt hättest. Lange genug, um bei seiner Geburt am neunten Dezember zweitausendeins dabei zu sein. Er wollte alles über dich erfahren, er fragte, und ich antwortete, indem ich in jede Geschichte heroische Details einflocht. Als er fünfzehn war, erzählte ich ihm, dass du im Freud-Garten der Universität Joints geraucht hast, jener Park, der auch »Airport« genannt wird, weil dort die »Flüge« starten und landen. Wenige Tage später stank Pedro nach Marihuana, als er nach Hause kam. Ich hätte mir denken können, dass alles, was er über seinen Vater erfuhr, einen gewissen Nachahmungseifer bei ihm auslösen würde. Irgendwann erzählte ich ihm, dass du ein Plakat von Che Guevara hattest. Er bat mich, es zu suchen. Aber der Besitz eines Posters eines lateinamerikanischen Revolutionshelden ist nicht das Gleiche, wie Steine auf Busse zu werfen, Automaten zu demolieren, einen Jugendlichen zu knebeln, eine Kartoffelbombe zu werfen oder eine Damentoilette voller Frauen in die Luft zu jagen. Das Plakat, das früher in deinem Zimmer hing, hängt jetzt in seinem. Juana hat Pedro nicht mehr erwähnt. Deshalb verspürte ich an dem Morgen, als er sagte, er wolle ein Geschenk für sie kaufen gehen, Erleichterung. Mein Junge war viel allein und ich erleichtert darüber, dass er eine Freundin hatte.
»Wie hast du geschlafen?«
»Sehr gut«, sagte ich.
Am nächsten Tag war Vatertag. Ein weiterer der vielen Vatertage, an denen wir versuchten, an etwas anderes zu denken. Du warst verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Von dir war nur ein Onkel geblieben, der einzige Überlebende, der nicht von einem Sattelschlepper niedergewalzt wurde. Alfonso lebte in einem Haus an der Lagune, wo wir ihn manchmal besucht hatten. Pedro besuchte ihn öfter. Er ging beschwingt, pflegte schweigsam zurückzukehren und makabre Geschichten von einem Land zu erzählen, über das sein Onkel alles zu wissen schien. In seiner Jugend war Alfonso in der Bewegung 19. April aktiv, einer Guerilla-Gruppe, die hauptsächlich aus Studenten bestand und gegenüber der ländlichen Guerilla wie FARC und Nationale Befreiungsarmee eher urbanen Ursprungs war. Es waren andere Zeiten. Von den Siebzigern bis zu den Achtzigern genoss die revolutionäre Linke mit den Tupamaros in Uruguay, den Sandinisten in Nicaragua, den Montoneros in Argentinien und der FMLN in El Salvador ihre kurzen Blütezeiten. Damals war die Revolution der gemeinsame Traum einer ganzen Generation der Südhalbkugel.
Wenn ich mich richtig erinnere, war dein Vater eher ein »ideologischer« Unterstützer, und nach deinen Erzählungen zu urteilen hat er nie in den Bergen zur Waffe gegriffen. Dein Onkel Alfonso hingegen schon. Er hat mitgekämpft, ist schließlich ausgestiegen und hat sich mit einem Bein weniger in die Berge zu den Bauern zurückgezogen, wo ihn bis heute niemand getötet hat.
»Geht’s Onkel Alfonso gut?«
»Interessiert dich das wirklich? Er baut Kartoffeln an, liest Durkheim und stinkt nach Pisse.«
»Ist er glücklich?«, fragte ich.
»Der Onkel wirkt glücklich, aber ich glaube kaum, dass du verstehst, wie man unter solchen Bedingungen glücklich sein kann …«
»Du nennst ihn gern Onkel.«
»Er ist mein Onkel.«
»Er freut sich bestimmt, dass du ihn besuchst.«
»Ähnelt er meinem Vater?«
»Er ist dein Großonkel und siebzig Jahre alt. Dein Vater wäre jetzt fünfundvierzig.«
»Das meine ich nicht. Ähneln sie sich?«
»Vielleicht.«
»Worin?«
»Zum Beispiel in dieser Marotte, sich nicht die Zähne zu putzen.«
»Dann habe ich das also auch im Blut? Dass ich Zahnpasta hasse?«
»Ganz bestimmt«, sagte ich. »Sie ähneln sich darin und in der romantischen Vorstellung, die Welt retten zu können.«
»Glaubst du an eine bessere Welt, Mama?«
»Wie sagen doch gleich die Comedians Les Luthiers: Es gibt eine bessere Welt, aber sie ist sauteuer.«
Er starrte mich an – so ernst ähnelte er dir am meisten – und sagte nichts mehr. Als er noch ein Kind war, erzählte ich ihm, dass für Tante Cecilia der Mensch mit einer gewissen Anzahl an Wörtern zur Welt kommt. Tausendeinhundert Danke, fünfzig Entschuldige, zweihundert Ich liebe dich und so weiter. Diese Geschichte beeindruckte Pedro. Er sprach wenig. Er war ein Wortkrämer. In der Phase, als er begann, sparsam mit Wörtern umzugehen, erwarb ich ein kleines Kupferkästchen, füllte es mit Asche aus dem Kamin und stellte es ehrfürchtig ins Bücherregal zu den Comics von Mike Mignola, die du mir hinterlassen hast. Du bist nach einer kurzen Zeremonie auf dem Friedhof Jardines de Paz eingeäschert worden. Ich war nicht dabei. Ich war in Trauer versunken. Und ich vermute, dass Alfonso die echte Asche bekommen hat, er wird sie in der Lagune ausgestreut haben, ist auch egal. In diesem kleinen Kästchen haben wir unsere eigene. Tatsächlich hat mir diese falsche Asche, Kaminfeuerreste aus kalten Nächten in Bogotá, Trost gespendet. Nachdem ich oft genug behauptet hatte, es sei deine Asche, habe ich es irgendwann selbst geglaubt. Jetzt gerade habe ich sie auf dem Nachttisch stehen, damit sie mir Gesellschaft leistet, wenn ich eingemummelt im Bett liege. Es war einfach, die Lüge über deinen Tod aufrechtzuerhalten. Deinen Onkel Alfonso hatte ich gebeten, nicht mit Pedro darüber zu reden. Doch aus einem seltsamen Grund raubte mir das Thema auch nicht den Schlaf. Ich glaubte, eines Tages würde unser Sohn schon erfahren, wie sein Vater wirklich gestorben ist, und dass ich es nicht verhindern könnte. Allerdings hätte ich mir nie vorstellen können, dass eine Notlüge zum Auslöser einer Tragödie werden kann.
Ich sah in der Schwangerschaft mit Pedro eine letzte Chance für meine Erlösung. Er wäre unser gemeinsamer Sohn, wie du es wolltest, auch wenn du nicht mehr da warst. Ich würde mich nicht beklagen, weder über Schlafmangel noch über Rückenschmerzen oder geschwollene Brüste, auch nicht darüber, nicht mehr ins Kino zu gehen oder lesen zu können, sondern jeden Centavo für die Zukunft des Kindes zu sparen. In siebzehn Jahren wurde ich zu einer langmütigen Frau. Pedro weinte als Baby so viel, dass er mich manchmal mit seiner Traurigkeit ansteckte. Ich nahm ihn zu mir in unser Ehebett. Es war nicht meine Absicht gewesen, aber Pedro gewöhnte sich daran, mich weinen zu sehen, auch an das Wissen, mein Gefährte zu sein. Der Junge wuchs schweigsam heran, hatte wenige Freunde, den Kopf voller Comics, und es gab keine Gäste in dieser großen Wohnung in der 18. Straße, in der wir in seinen Kindertagen noch lebten. Er lernte von Anfang an leicht und schnell. Noch vor seinem vierten Geburtstag konnte er lesen, mit sieben löste er Kreuzworträtsel mit dreihundert Begriffen, er gierte nach Leben und war ständig bemüht, sich selbst zu übertreffen, was so weit ging, dass er mit sechzehn Jahren Abitur machte. Mein genialer Sohn, mein einsamer Gefährte. Vielleicht weigerte ich mich aus Naivität oder aus Egoismus zu erkennen, wie abgeschottet er lebte, denn ich empfand es als großes Glück, derart viel Zeit mit meinem Sohn verbringen zu können. Sonntags mit ihm ins Kino zu gehen oder den Morgen im Pyjama mit Kreuzworträtseln und Mensch-ärgere-dich-nicht zu verbringen, schien normal zu sein, wie es gleichsam normal war, dass nie das Telefon klingelte oder Pedro kein Handy haben wollte in einem Alter, in dem seine Klassenkameraden es nicht mehr aus der Hand legten. Das sagte mir eine Psychiaterin, die ich vielleicht viel zu spät aufsuchte: »Familienangehörige sind oft unfähig, anormales Verhalten an denen zu erkennen, die sie am meisten lieben.« Tatsächlich konnte ich nichts Anormales an Pedros Verhalten erkennen. War es anormal, dass er so viel Zeit mit mir verbrachte? Dass er nicht an Schulausflügen teilnehmen wollte? Wie sollte eine Mutter nicht vor Liebe vergehen für ihren sensiblen Sohn, der an einem Samstagabend die gemeinsame Stille dem nächtlichen Ausgehen mit Gleichaltrigen vorzieht?
Erst als mein Haar glatter und meine Hüften breiter wurden, gelang es mir, die Wahrsagerin aus meiner Kindheit, die tief in mir schlummerte, zu ersticken. Dem freien Willen die Möglichkeit zu verwehren, so zu leben, wie er es bestimmt hatte, würde unsere Strafe sein.
»Sag mal, mein Junge, was treibst du eigentlich, wenn du weggehst und völlig verschlammt zurückkommst? Einen Ausflug? Wo warst du?«
»Wir üben in den Osthügeln schießen und diskutieren darüber, wie wir das System zerstören können, Ma.«
Ich lachte. Pedro hatte schon immer einen großen Sinn für Humor.
»Du kannst schießen?«, spielte ich mit.
»Aber hallo, Mama, ich habe sogar ein Alias.«
»Und welches?«
»Sehr erfreut, Mateo.« Er streckte mir die Hand entgegen.
»Besser Mateo als Chupeta, Popeye oder Guacho.«
»Nein, verwechsle das nicht mit den Paramilitärs.«
»Guacho gehörte zur Guerilla, Pedrito. Ach, verzeih, Comandante Mateo.«
»Comandante Mateo ist ein Soldat des Friedens«, stellte er klar und stand auf.
»Aber das ist doch Schnee von gestern, Comandante, denn Santos hat den Friedensvertrag mit der FARC bereits unterschrieben.«
»Der Frieden der Reichen ist nicht der Frieden des Volkes, Genossin. Wahre Kämpfer sind immer im Krieg.«
Aus irgendeinem Grund lachte ich diesmal nicht. Irgendwie klangen seine Worte authentisch, fast wütend. Pedro war schlanker geworden. Er war attraktiv, männlich. Er wirkte selbstbewusst. Als wüsste er, was er tut. Einen Moment war ich irritiert.
»Wenn das mit der Soziologie nicht klappt, kannst du immer noch Schauspieler werden, du spielst die Rolle gut.«
Doch eigentlich hatte ich an Pedro etwas entdeckt, das ich nicht sehen wollte. Eine andere Persönlichkeit schimmerte durch. Mein Herz schlug wie ein aufgebrachter Vogel heftig mit den Flügeln. Ich begann die Pflanzen zu gießen. Pedro redete weiter, wirkte aber nicht mehr wie ein Schauspieler, sondern eher wie sein Alias Mateo. Oder erinnere ich das jetzt so, nach dem, was geschehen ist? Kann es sein, dass die Wahrheit ein kaputter Spiegel ist, in dem wir nichts anderes als eine verzerrte Version erkennen, weil die jüngsten Ereignisse immer die Vergangenheit verändern?
»Onkel Alfonsos Generation hat alles gegeben. Der Alte stand um fünf Uhr früh auf und packte die Ausrüstung zusammen, er hielt Wache und politische Vorträge, er kochte und sprach mit den Bauern. Wusstest du, dass die meisten Guerilleros Analphabeten waren?«
»Wundert mich nicht«, sagte ich verstört.
»Die Guerilla hat den Menschen das Schreiben und Lesen beigebracht, was unser Staat übrigens nicht geschafft hat. Onkel Alfonso hatte keine Frau. Er wurde schwer verwundet, er litt monatelang, die Wunde infizierte sich, und er hat sein Bein verloren. Glaubst du nicht, dass das ein Grund zum Kämpfen ist?«
»Was?«
»Bereit zu sein, alles aufzugeben, alles für die Leute zu opfern.«
»Und du, findest du es nicht ein bisschen vermessen, dass er in diesem Erlöserwahn mit seinen Kumpanen in die Berge zieht, um die Welt zu retten? Findest du es außerdem nicht schäbig gegenüber denjenigen, die es innerhalb der etablierten Ordnung besser machen wollen und niemanden umbringen?«
»Wie wer?«
»Wie mein Vater, dein Großvater Pedro zum Beispiel.«
»Großvater ist ein Oligarch.«
»Irr dich mal nicht. Dein Großvater wurde in einem Dorf geboren, im Schoß einer einfachen Familie, er hat bloß was aus sich gemacht und sich an die Spielregeln gehalten. Auf diesem Weg ist er vorangekommen.«
»Das klingt nach Lehrbuch. Die Kleinbürger wollen ihren frisch erworbenen Wohlstand nicht verlieren und werden somit zu den schlimmsten Feinden des Wandels«, sagte Pedro.
»Also bitte, Bürschchen! Was schlägst du dann vor? Den Krieg in die Städte zu tragen?«
»Gar keine schlechte Idee.«
Und was tat ich? Ich atmete tief durch. Im Laufe des Gesprächs begann ich zu begreifen, in was sich mein Sohn – unser Sohn, Rayo – verwandelte. Vielleicht scherzte er nur, vielleicht bin ich verrückt und paranoid, eine paranoide Verrückte, die Selbstgespräche führt und vielleicht nie die Wahrheit erfahren wird. Warum habe ich ihm damals nicht gesagt, dass du von der Guerilla getötet wurdest, die er so leidenschaftlich verteidigte? Vielleicht habe ich nichts gesagt, weil ich seit deinem Tod ohnmächtig, betäubt und verwirrt bin, während der Lärm da draußen mir keine Verschnaufpause gönnt.
»Sprich nicht schlecht über deinen Großvater, mein Sohn. Er hat als Kind viel entbehren müssen, es ist ganz normal, dass er das als Erwachsener kompensieren wollte. Die Familie deines Vaters hingegen war wirklich reich!«
»Kompensieren nennst du das?«, erwiderte Pedro grinsend. »Dein Vater schiebt in seinen Hawaiihemden und seinen polierten Mokassins in Boca Ratón den Golfwagen über den Rasen.«
Wir beide lachten verschwörerisch auf. Mein Vater passte ziemlich gut in das Profil dessen, was man geringschätzig einen Neureichen zu nennen pflegt. Der Kontrast zwischen diesem ernsthaften Jungen, der mir einen Vortrag hielt wie ein Pamphlet, und dem anderen, der über den schlechten Geschmack seines Großvaters spottete, war verwirrend. Pedro war nicht länger nur eine Person. Oder doch, er war dieser gute Junge und zugleich ein Revolutionär, der seinen Großvater verachtete, weil er sein ganzes Leben lang gearbeitet und genug verdient hatte, um jetzt einen Golfwagen hinter sich herziehen zu können. Ich finde das völlig normal. Ein Gespräch wie jedes andere. Gab es in seinem Vortrag ein Alarmsignal? Vor gut zwanzig Jahren hätte ich mit meinem Vater exakt dasselbe Gespräch führen können. Es ist gewiss nicht ungewöhnlich, als junger Mensch das Establishment zu bekämpfen, wie aus dem Lehrbuch, würde Pedro sagen. Am Ende hatte der Junge in allem recht, oder in fast allem. Hatte er damals gesagt, dass es für ihn eine Erleichterung sei, Steine zu werfen? »Du solltest es mal versuchen«, höre ich ihn sagen. Jetzt spricht Pedro mit mir. Jetzt, da er weg ist, erzählt er mir plötzlich alles.
Damals sprach Pedro nicht nur in meinem Kopf. Er war da, er war real. Damals waren wir eine Mutter und ihr Sohn, die nach dem Essen lange zusammensaßen. Oder gab es etwa einen einzigen Grund zu glauben, dass Pedro alias Mateo am Ende der Rebellion beschuldigt und als gefährlicher Subversiver verfolgt wird? Oder, genauer gesagt: Verdächtigt solch schwerer Delikte wie Terrorismus, Mord, Urkundenfälschung, Bau von Sprengkörpern und Besitz von illegalen Feuerwaffen.
3
Als unser Hochzeitsfest langsam ausklang, schlenderte ich mit sechs Wodka intus durch die obere Etage des Lokals. Ich sah die im Licht schillernden Fische und die wie menschenfressende Raubtiere wirkenden Blumen. Wir hatten acht Meter Industrieplane gekauft und sie auf der Treppe in den ersten Stock verlegt, eine Stufe nach der anderen, indem wir die Plane mit Draht befestigten, was uns Stunden gekostet hatte und dazu dienen sollte, dass sich kein Absatz im Gitter verfing. Im Garten und auf der Terrasse hatten wir Fackeln aufgestellt. Wir hatten warmes Licht gewählt und die Tische im ersten Stock decken lassen. Schon bald wäre alles vorbei. Zurück blieben der Geruch nach Zigaretten und Alkohol, viele Kippen sowie ein schaler Nachgeschmack um drei Uhr nachts, wenn man zu viel getrunken und geraucht hatte.
Als wir im Hotel, in dem wir die Nacht verbrachten, auf den Fahrstuhl warteten, hast du versucht, mich zu küssen, aber du hast das Gleichgewicht verloren und bist mit der Stirn auf meiner Nase gelandet. Ein feiner Blutfaden tropfte auf meine Oberlippe. Im Spiegel sah ich ihn kaum, ich sah nur Prinzessin Leias verrutschte Schleifen. Da war ich nun, ohne da zu sein, wie jemand, der einem Drehbuch folgt, an dem nichts verändert werden darf. Im fünfundzwanzigsten Stock schloss ich die Augen. Im sechsundzwanzigsten wolltest du mich wie ein Film-Bräutigam in der Hochzeitsnacht über die Schwelle tragen. Dein Körper schwankte heftig hin und her. Der Flur war breit und so grell erleuchtet, dass er sich für ein Verhör geeignet hätte. Ich hatte Angst zu fallen und bat dich, mich runterzulassen, aber du hast es nicht getan. Also musste ich springen, es war kein gewagter Sprung, denn wir waren fast gleich groß. Wenn du zornig warst oder dich sehr angestrengt hast, bildete sich auf deiner linken Wange ein roter Fleck. Ich streifte meine Schuhe ab und stellte sie vor die Tür. Die Haarklemmen begannen mich zu quälen. Barfuß ging ich zu dem Tischchen mit der weißen Decke und den ebenfalls weiß überzogenen Stühlen, deren Lehnen mit weißen Seidenschleifen verziert waren. Auf dem Bett thronten aus Handtüchern gefaltete Schwäne, umringt von Blütenblättern, die vom langen Warten welk geworden waren. Acht Freunde hatten uns gemeinsam die Hochzeitsnacht im Hotel geschenkt. ›Verdammte Knauser‹, dachte ich. ›Sie hätten auch zwei Nächte spendieren können.‹ Auf dem Tisch stand ein Eiskübel mit einer Flasche Sekt. Das Eis war schon vor Stunden geschmolzen. Daneben eine Obstschale mit Weintrauben, Kirschen und Mandarinen. Als ich mir endlich sämtliche Klemmen aus dem Haar entfernt hatte, zog ich die Vorhänge auf. Unter mir bildete die Weihnachtsbeleuchtung der 7. Straße einen rot-grünen Fluss. Ich dachte, wie seltsam, dass auf dieser Seite der Erdhalbkugel, auf der es nicht einmal Jahreszeiten gibt, alles mit Schneemännern, Rentieren und alpinen Weihnachtsbäumen geschmückt wird. Derart hell erleuchtet wirkte Bogotá geradezu freundlich.





























