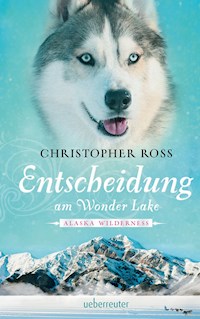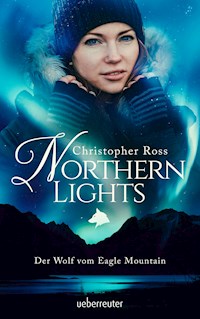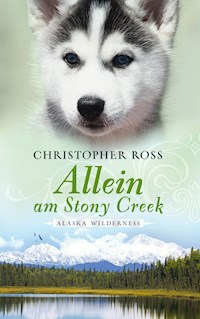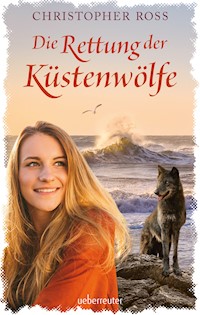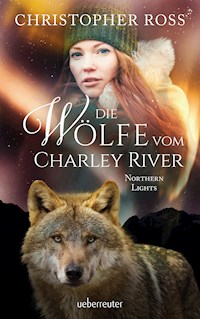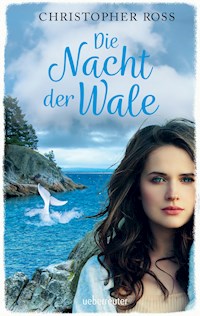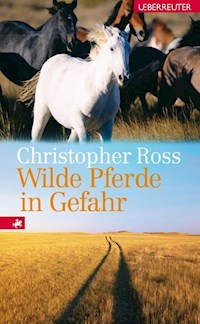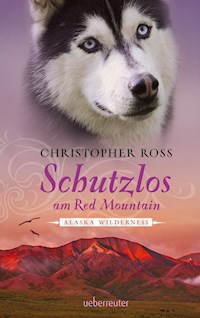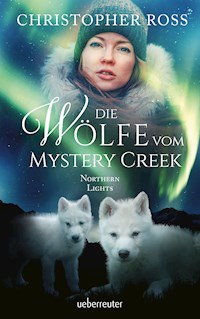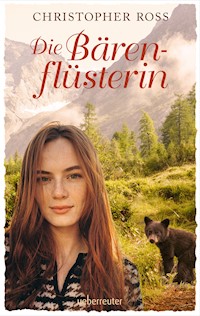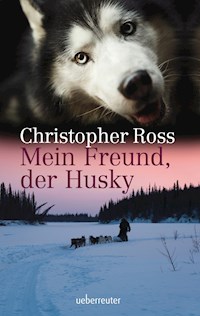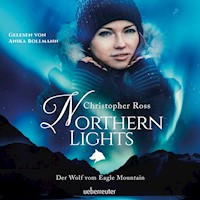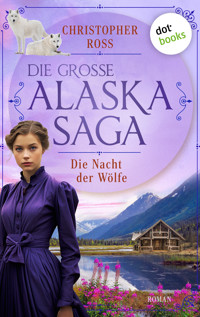
9,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Liebe führt sie in die abenteuerlichen Weiten Nordamerikas Die White Mountains, Ende des 19. Jahrhunderts: Als Clarissas Mann Alex von einer Reise in die wilde Bergwelt nicht zurückkehrt, droht ihr gesamtes Glück zu zerbrechen. Alex wird für Tod erklärt, doch Clarissa ist fest überzeugt, dass er als erfahrener Fallensteller in der Wildnis überleben kann wie niemand sonst. Doch dann hört sie Gerüchte, dass sich in der Gegend jener Mann aufhält, der noch immer nach Rache an ihr zürnt: Frank Whittler, der reiche Unternehmersohn, dem Clarissa die Stirn geboten hat. Kann das Zufall sein? Entschlossen macht sich Clarissa auf die Suche nach ihrem geliebten Mann. Dafür muss sie bis an den Rand der Arktis reisen – und immer wieder begegnet sie dabei einem Geisterwolf. Doch ist er ihr Schutztier oder ein Unglücksbote? Diese große Nordamerika-Saga in sechs Bänden, die unabhängig lesbar sind, erschien vorab bereits als »Clarissa«-Reihe und wird ebenso Fans von Anne Jacobs wie auch der »Yellowstone«-Serie begeistern!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die White Mountains, Ende des 19. Jahrhunderts: Als Clarissas Mann Alex von einer Reise in die wilde Bergwelt nicht zurückkehrt, droht ihr gesamtes Glück zu zerbrechen. Alex wird für Tod erklärt, doch Clarissa ist fest überzeugt, dass er als erfahrener Fallensteller in der Wildnis überleben kann wie niemand sonst. Doch dann hört sie Gerüchte, dass sich in der Gegend jener Mann aufhält, der noch immer nach Rache an ihr zürnt: Frank Whittler, der reiche Unternehmersohn, dem Clarissa die Stirn geboten hat. Kann das Zufall sein? Entschlossen macht sich Clarissa auf die Suche nach ihrem geliebten Mann. Dafür muss sie bis an den Rand der Arktis reisen – und immer wieder begegnet sie dabei einem Geisterwolf. Doch ist er ihr Schutztier oder ein Unglücksbote?
Über den Autor:
Christopher Ross gilt als Meister des romantischen Abenteuerromans. Es ist das Pseudonym des Autors Thomas Jeier, der in Frankfurt am Main aufwuchs, heute in München und »on the road« in den USA und Kanada lebt. Seit seiner Jugend zieht es ihn nach Nordamerika, immer auf der Suche nach interessanten Begegnungen und neuen Abenteuern, die er in seinen Romanen verarbeitet, mit den bevorzugten Schauplätzen Kanada und Alaska. Seine über 200 Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet.
Christopher Ross veröffentlichte bei dotbooks seine große Alaska-Saga mit den Romanen »Im Herzen die Wildnis«, »Wo der Himmel brennt«, »Die Nacht der Wölfe«, »Allein durch die Wildnis«, »Gefangen im ewigen Eis« und »Das Leuchten am Horizont«.
Die Website des Autors: www.jeier.de/
Der Autor auf Facebook: www.facebook.com/thomas.jeier
***
eBook-Neuausgabe Januar 2025
Copyright © der Originalausgabe 2013 by Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung zweier Motive von PieBase / flownaksala / Adobe Stock sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-597-9
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Christopher Ross
Die Nacht der Wölfe
Roman
dotbooks.
Kapitel 1
Clarissa trat ans Fenster ihrer Blockhütte und blickte besorgt in den wirbelnden Schnee hinaus. Alex war seit dem frühen Morgen unterwegs und hätte längst zurück sein müssen. Jetzt war es kurz vor Mitternacht, und weder auf der verschneiten Wagenstraße noch auf dem Fluss konnte sie irgendeine Bewegung erkennen.
»Wenn Barnette mir einen guten Preis für die Felle macht, reicht es vielleicht für eine Bärenfalle«, hatte er beim Frühstück überlegt. »Mit dem Grizzly, der sich seit einigen Tagen hier herumtreibt, ist nicht gut Kirschen essen. Der hat mit Winterschlaf wenig im Sinn und könnte uns gefährlich werden.«
Wie jedes Mal, wenn ihr Mann zu dem Handelsposten am Chena River fuhr, hatte er ihr versprochen, eine Tafel der leckeren Schokolade mitzubringen, die der Händler neuerdings aus den Vereinigten Staaten importierte und viel zu teuer verkaufte. Der Gedanke an die süße Köstlichkeit zauberte ein flüchtiges Lächeln auf ihr Gesicht, das aber gleich wieder verschwand.
Normalerweise kehrte Alex am frühen Abend zurück, wenn er allein nach Fairbanks fuhr. So hieß die kleine Stadt, die sich seit den Goldfunden um den Handelsposten gebildet hatte. Mehr als ein paar Gläser Bier, und wenn es hochkam mal einen Whiskey, trank er nie. Seitdem sie geheiratet hatten, war er drei- oder viermal betrunken gewesen, nicht öfter, obwohl er wirklich schwere Zeiten durchgemacht hatte und sie ihm nicht einmal böse gewesen wäre. Sie erschauderte immer noch, wenn sie daran dachte, wie englische Seeleute ihn vor drei Jahren auf ihr Schiff verschleppt und bis ins ferne China entführt hatten. Wie ein Sklave hatte er geschuftet, an Bord des Dampfschiffes auf hoher See und später in einem Warenlager in Shanghai, bevor es ihm gelungen war, auf ein amerikanisches Schiff zu fliehen und zu ihr zurückzukehren.
Das unbeschreibliche Glücksgefühl, das sie empfunden hatte, als sie nach über einem Jahr wieder in seine Arme sinken durfte, würde sie niemals vergessen. Ein Gottesgeschenk hatte sie seine Rückkehr genannt, die Antwort auf ihre verzweifelten Gebete. Ihre Freundin Dolly in Dawson City war weniger überschwänglich gewesen: »Ach was, ich wusste immer, dass er zurückkommt. So grausam, dass er uns beiden den Mann nimmt, kann Gott nicht sein.«
Dollys Mann war von einem Verbrecher in der Goldgräberstadt Skaguay beraubt und ermordet worden, gleich nach ihrer Ankunft in Alaska.
Clarissa ging zum Ofen und warf zwei Holzscheite ins Feuer. Im flackernden Schein der Öllampe auf dem Tisch schenkte sie heißen Tee in ihren Becher und rührte zwei Teelöffel Zucker hinein. Sie mochte ihn gern süß, vor allem, wenn sie nervös war. Mit dem Becher in der Hand kehrte sie ans Fenster zurück. Das Schneetreiben war inzwischen so stark, dass sie kaum noch etwas sah, selbst der vereiste Nebenfluss des Chena River war nicht mehr zu erkennen. Die wirbelnden Flocken brachten sie zum Blinzeln, und als sie zurücktrat, um besser sehen zu können, erkannte sie nur den Schein der Lampe und ihr Spiegelbild im vereisten Fenster. Das blasse Gesicht mit den dunklen Augen und den leicht hervorstehenden Wangenknochen erinnerte an eine Indianerin, ihre dunklen Haare hatte sie zu einem unordentlichen Knoten gebunden. Sie trug einen dunklen Rock und eine Strickjacke über ihrer Bluse und wie immer, wenn sie im Haus war, die bestickten Mokassins, die sie einer alten Indianerin abgekauft hatte.
Alex sprach wenig über seine Zeit bei den Engländern und in China. Mehr als »Das war kein Zuckerschlecken!« oder »Ich weiß schon, warum ich kein Seemann geworden bin!« war ihm nicht zu entlocken. Wie hart der unfreiwillige Aufenthalt an Bord des Schiffes und die Arbeit in dem Lagerhaus wirklich gewesen sein musste, glaubte sie lediglich an den Narben auf seinem Rücken zu erkennen. »Ach, das war nichts«, wiegelte er ab. Sie vermutete, dass ihn seine Entführer ausgepeitscht hatten. Es hieß, dass die Kapitäne der englischen Handelsschiffe ihre Seeleute wie afrikanische Sklaven behandelten.
Von draußen drang das Heulen der zurückgebliebenen Huskys herein. Billy, ihr ehemaliger Leithund, Buffalo und die sanfte Cloud, beide schon zu alt für das Gespann, und Emmett, der junge sibirische Husky, den sie einem Indianer aus den White Mountains abgekauft hatte. Der ehemalige Häuptling hatte einen Narren an ihr gefressen und die Hoffnung geäußert, die weiße Frau würde seinen Emmett zum Leithund ausbilden und das Alaska Frontier Race mit ihm gewinnen, ein legendäres Hundeschlittenrennen mit hohen Geldpreisen.
Clarissa hatte seinen Wunsch als Scherz aufgefasst und ihm die Hälfte des Preisgeldes versprochen, inzwischen aber längst erkannt, dass Emmett tatsächlich sehr begabt war und sich außergewöhnlich intelligent benahm. Alex und sie hatten ihn bereits mehrmals als Leithund eingesetzt und waren äußerst zufrieden mit ihm. Smoky wurde langsam zu alt für die harte Arbeit.
Ein Wolf antwortete den Huskys. Sein Heulen klang so schaurig und nahe, dass Clarissa erschrak und einen Augenblick innehielt. Wölfe wagten sich nur selten so nah an die menschlichen Siedlungen heran. Nur wenn sie in ihrem Revier keine Beute mehr fanden, wurden sie mutiger. Das Wolfsrudel, das nördlich des Flusses jagte, hatte selbst Alex nur selten zu Gesicht bekommen.
Als das Heulen verstummte, trank Clarissa erleichtert von ihrem Tee. Der Zucker beruhigte sie, aber noch viel lieber hätte sie von der Schokolade gekostet, die Alex ihr versprochen hatte. Wo blieb er nur? War ihm etwas passiert? War was mit den Hunden? Hatte sich einer der Huskys verletzt? Vor einem halben Jahr, als Chilco sich die Pfoten am rauen Flusseis aufgeschnitten hatte, war er schon mal so spät gekommen und hatte sich tausend Mal entschuldigt, weil er wusste, wie sehr sie sich um ihn sorgte. Ach was, sagte sie sich, du benimmst dich schon wie eine nervöse Städterin. Du weißt doch selbst, auf welche Hindernisse man in der Wildnis treffen kann. Er wird schon seine Gründe für seine späte Rückkehr haben.
Selbst wenn er einen befreundeten Fallensteller getroffen hatte und mit ihm versumpft war – was machte das schon?
Sie trank noch einen Schluck und stellte den Becher auf den Tisch. Obwohl das Feuer im Ofen kräftig brannte, legte sie zwei Holzscheite nach und erfreute sich an der Wärme und dem vertrauten Prasseln. Sie fühlte sich wohl in ihrem neuen Zuhause. Andere Frauen, vor allem die gesitteten Ladys aus Vancouver, wären beim Anblick der einfachen Blockhütte sicher erschrocken, doch für sie gab es nichts Schöneres, als inmitten der Wildnis einen geschützten Platz zu haben, an dem sie mit Alex allein sein konnte. Die Hütte war nicht besonders groß. Auf dem Bett lag eine bunte Patchworkdecke, die sie im letzten Winter angefertigt hatte, und ein wuchtiger Schrank, den Alex wie die meisten anderen Möbel selbst gezimmert hatte, trennte den Schlafraum vom Wohnraum, der gleichzeitig als Küche diente. Es gab einen Tisch mit vier Stühlen, einen Küchenschrank, in dem auch die Vorräte untergebracht waren, eine Kommode und einen großen Eisenherd, der mit dem Raddampfer über den Yukon River gekommen war. Sie hatten ein halbes Vermögen für das Monstrum bezahlt. In der Mitte des Raumes ragte ein alter Kanonenofen empor, daneben lag etwas Brennholz. In einigen Kisten vor der Rückwand waren Werkzeuge, Geschirre, Lederriemen und anderer Krimskrams untergebracht, in Eimern und Behältern lagerten Wasser und Hundefutter. Das Stroh in der Ecke war für Smoky reserviert, ihren Leithund, der als einziger Husky ins Haus durfte, aber meist draußen bei den anderen schlief.
Sie holte ein altes Buffalo-Bill-Heft aus der Kommode und setzte sich an den Tisch. Im Schein der Öllampe versuchte sie zu lesen. Sie mochte die haarsträubenden Abenteuer des legendären Westmanns und freute sich jedes Mal, wenn er mit bloßen Händen auf einen Grizzly losging oder im Alleingang einen ganzen Indianerstamm besiegte. Natürlich hatte der echte Buffalo Bill diese Abenteuer nie erlebt, angeblich zog er mit einem Wildwestzirkus durch die Lande, aber Clarissa mochte seine Geschichten, weil sie darin in eine vollkommen andere Welt abtauchen konnte. Dass es ihr diesmal nicht gelang und sie das Heft schon nach wenigen Minuten missmutig zur Seite legte, lag an ihrer Unruhe. Obwohl Alex auch mal einige Tage wegblieb, wenn er seine Fallen abfuhr und kontrollierte oder mit dem Hundeschlitten nach neuen Trails suchte, war sie diesmal seltsam besorgt, als würde sich mit seinem Wegbleiben ein neuer dramatischer Einschnitt in ihrem gemeinsamen Leben ankündigen. Woher diese Ahnung kam, vermochte sie nicht zu sagen. »Du machst dich noch verrückt«, flüsterte sie.
Dabei schien der Mann, der während der vergangenen Jahre versucht hatte, ihnen das Leben zur Hölle zu machen und es beinahe geschafft hätte, sie ins Gefängnis zu bringen, ganz andere Sorgen zu haben. Wie einige andere »hohe Tiere« der Canadian Pacific Railway waren auch die Whittlers in einen Bestechungsskandal verwickelt und mussten hohe Geldstrafen bezahlen. Ihre Posten bei der Eisenbahn hatten sie verloren. Wenn die Gerüchte stimmten, lebten sie inzwischen in einem Vorort von Vancouver und hielten sich mühsam mit ihrem Ersparten über Wasser. Kein Vergleich zu dem ausschweifenden Leben, das sie geführt hatten, als Clarissa bei ihnen angestellt gewesen war. Über Frank Whittler, den arroganten Sohn der Familie, der versucht hatte, sie zu vergewaltigen, und sie jahrelang verleumdet und erbarmungslos gejagt hatte, weil er nicht bei ihr gelandet war, ging sogar das Gerücht, dass er sich mit zwielichtigen Elementen aus der Unterwelt zusammengetan hatte.
Draußen heulten wieder die Huskys. Clarissa nahm an, dass sie ebenso wie sie Alex und vor allem die anderen Huskys vermissten. Sie stand auf, zog ihren Anorak an, schlüpfte in ihre gefütterten Stiefel und verließ die Blockhütte.
Böiger Wind wehte ihr Schneeflocken ins Gesicht und machte deutlich, dass es bereits November war und die Kälte mit jedem Tag zunahm. Sie war wesentlich frostigere Temperaturen gewöhnt und machte sich nicht viel daraus. Sie blieb sogar stehen, wandte ihr Gesicht dem eisigen Wind zu und blickte forschend in das heftige Schneetreiben. Sehnsüchtig wartete sie darauf, dass das Scharren von Schlittenkufen durch die Nacht drang und Alex endlich auf die Lichtung fuhr. Doch nichts geschah, und sie ging enttäuscht zu den Hunden.
Billy, ihr ehemaliger Leithund, hatte seine besten Jahre bereits hinter sich und lag eingerollt im Schnee, ebenso wie Cloud, die ebenfalls schon zu alt für den Schlitten war und am tiefsten von allen Hunden schlief. Nicht mal das Gebrüll eines Grizzlys hätte sie aus ihrem Tiefschlaf reißen können. Anders Buffalo, der es seit einigen Monaten eher gemütlich angehen ließ, aber die Augen geöffnet hatte und leise winselte, und Emmett, der als Einziger aufgesprungen war und den unsichtbaren Mond anheulte. Wie ein wachsamer Wolf stand er im Schnee, jede Sehne seines Körpers angespannt, die Ohren aufgestellt, als wäre er jeden Augenblick auf das Auftauchen eines Feindes gefasst.
»Emmett! Was gibt’s denn?«, begrüßte sie den jungen Husky. »Kannst du auch nicht schlafen? Alex müsste längst zurück sein, nicht wahr?« Sie beugte sich zu dem Hund hinab und kraulte ihn hinter den Ohren, eine Liebkosung, die er besonders mochte. »Oder ist der Wolf noch in der Nähe? Du willst mir doch nicht untreu werden? Schön hiergeblieben, wir beide haben noch einiges vor. Wir wollen das nächste Alaska Frontier Race gewinnen, verstehst du?«
Emmett drehte den Kopf und rieb ihn an ihren bloßen Händen. Er gab ihr auf diese Weise zu verstehen, dass er gar nicht daran dachte, sie zu verlassen und mit seinem wilden Bruder in die Wildnis durchzubrennen. Er schien genau zu wissen, dass ihm das Vergnügen, mit seinen Artgenossen im Gespann zu laufen und einen Schlitten durch die verschneite Landschaft zu ziehen, nur bei den Menschen zuteil wurde. Er war der geborene Schlittenhund. Allein sein Anblick in dem trüben Licht, das der Schnee reflektierte, wie sich sein Fell über den kräftigen Muskeln spannte, wenn er sich bewegte, seine rasche Drehung, als sie vor die Tür getreten war, und die wilde Entschlossenheit, die sich in seinen blauen Augen spiegelte, gab ihr zu verstehen, dass sie mit Emmett einen der besten und schnellsten Huskys des ganzen Landes in ihrem Team hatte. Er war der geborene Sieger und würde das Alaska Frontier Race für sie gewinnen, wenn sie lange genug mit ihm trainierte und ihn daran gewöhnte, mit anderen Huskys im Team zu laufen und ihren Befehlen zu gehorchen.
»Witterst du Alex schon?«, fragte sie. »Ist er schon unterwegs?«
Emmett schmiegte sich erneut an sie, drängte sich zwischen ihren Beinen hindurch und brachte sie beinahe mit der leichten Kette zu Fall, an die er gebunden war. »Immer mit der Ruhe, Emmett!«, rief sie lachend. »Ist ja gut!«
Sie befreite sich von der Kette und nahm ihn in den Arm, kraulte ihn noch mal zwischen den Ohren und streichelte auch die anderen Huskys, bevor sie aufstand und sie noch einmal beruhigte. »Kein Grund, sich aufzuregen! Alex hat bestimmt einen Grund, warum er so spät kommt.« Sie lächelte. »Und wenn nicht, ziehe ich ihm die Ohren lang, darauf könnt ihr euch verlassen!«
Sie ließ die Huskys allein und kehrte zum Haus zurück. Vor der Tür blieb sie noch einmal stehen. Zufrieden stellte sie fest, dass sich Emmett wieder in den Schnee gerollt hatte und auf ein weiteres Jaulkonzert verzichtete. Anscheinend hatte er sie nur aus dem Haus gelockt, um sich zwischen den Ohren kraulen zu lassen. Er gehörte zu den Hunden, die ständig verwöhnt werden wollten und schon mal streikten, wenn sie nicht die nötige Aufmerksamkeit erfuhren.
Jetzt war nur noch das Rauschen des Windes zu hören. Alles war still und einsam, als gäbe es im weiten Umkreis keinen anderen Menschen. Wer es nicht wusste, hätte niemals vermutet, dass keine zehn Meilen entfernt eine aufstrebende Stadt aus dem Boden wuchs.
Bisher waren es nur ein paar schäbige Häuser, die sich um Bar- nettes Handelsposten gruppierten, und die vielen Zelte der Männer und Frauen, die in der Hoffnung auf einen weiteren Goldrausch gekommen waren. Am 22. Juli 1902 hatte ein gewisser Felix Pedro, ein italienischer Einwanderer, der eigentlich Felice Pedroni hieß, einen riesigen Nugget aus einem Nebenfluss des Chena River geholt, und einige Leute behaupteten schon, in dieser Gegend gäbe es noch größere Goldvorkommen als am Klondike River im Yukon-Territorium, und Fairbanks würde eine noch bedeutendere Stadt als Dawson City.
Clarissa und ihr Mann hofften, dass es nicht so war. Sie hatten den Yukon hinter sich gelassen, um in der Wildnis von Alaska ein abgeschiedenes Leben führen zu können, und hatten keine Lust, noch einmal vor den goldhungrigen Horden fliehen zu müssen. Nirgendwo ging es turbulenter und gesetzloser zu als in einer Goldgräberstadt, einer Boom Town, das hatte Clarissa vor allem in Skaguay erlebt und beinahe mit ihrem Leben bezahlt. Nichts führte zu mehr Verbrechen als die Gier der Menschen nach Gold und Silber. Eine Sucht, der Clarissa und Alex nie verfallen waren. »Mit Gold kann man sich das Glück nicht kaufen«, sagte Alex.
Aus dem Wald drangen die vertrauten Anfeuerungsrufe eines Mannes. »Giddy-up! Vorwärts! Wollt ihr wohl laufen, ihr faulen Biester?« Das Scharren von Schlittenkufen auf dem gefrorenen Schnee begleitete seine Worte.
Giddy-up – so trieb nur ein Mann seine Huskys an. Ein Anfeuerungsruf, den Alex von einem texanischen Cowboy aufgeschnappt hatte, der seiner Liebsten nach Kanada gefolgt war. Wenn die Huskys ihn hörten, wussten sie, dass Alex es ernst meinte und dass er es wirklich eilig hatte. »Giddy-up! Go! Go!«
»Alex!«, flüsterte Clarissa dankbar. Sie beobachtete, wie sich der Schatten ihres Mannes aus dem dichten Flockenwirbel schälte und er den Schlitten über die Lichtung lenkte. Selbst aus weiter Entfernung und in einer Nacht wie dieser erkannte sie ihn auf Anhieb, seine kräftige Gestalt mit den breiten Schultern, seine unnachahmliche Art, wie er den Schlitten steuerte, auf die Hunde einwirkte und jede Bodenwelle und Kurve mit den Knien abfederte.
Vor der Blockhütte hielt er den Schlitten an. Er sprang vom Trittbrett und klopfte den Schnee von seinem Anorak aus Karibufell. Verwundert zog er die Augenbrauen hoch, als er seine Frau ohne Fellmütze und Handschuhe vor der Blockhütte stehen sah. Er ging langsam und ein wenig irritiert auf sie zu.
»Alex ... Endlich bist du wieder zu Hause!« Sie lief ihm entgegen und sank erleichtert in seine Arme. Wie jedes Mal, wenn er sie umarmte, spürte sie, wie wohlige Wärme ihren Körper durchflutete, und obwohl sie kaum fühlte, wie er seine bärtige Wange an ihre drückte, lächelte sie dankbar. »Ich hatte Angst um dich, Alex! Ich dachte, es wäre irgendwas Schreckliches passiert.«
Normalerweise hätte er mit einem Scherz wie »Unkraut vergeht nicht!« geantwortet und sie noch vor der Tür geküsst, aber diesmal wirkte er ungewöhnlich ernst, und als sie sich von ihm löste und in seine Augen blickte, entdeckte sie Sorge und auch ein wenig Angst. »Lass uns ins Haus gehen«, sagte er. »Wie ich dich kenne, hast du heißen Tee auf dem Herd stehen.«
»Und die Hunde? Was ist mit den Hunden?« Clarissa blickte ihn verwundert an. Normalerweise hätte sich Alex wie jeder gute Musher zuerst um sein Hundegespann gekümmert, selbst wenn er stundenlang in der Wildnis unterwegs gewesen und todmüde war, doch diesmal steuerte er sofort das Haus an. Sie folgte ihm zögernd. »Du willst gleich weiter, nicht wahr?«
Er antwortete erst, als sie in der Hütte waren und er die Tür geschlossen hatte. »Du hast recht ... sobald der Deputy und seine Männer hier sind, muss ich weiter. Ich gehöre zu seinem Aufgebot. Wir verfolgen drei Bankräuber.«
Kapitel 2
Clarissa brauchte eine Weile, um die Nachricht zu verdauen. Während sie darüber nachdachte, schenkte sie Tee ein und reichte ihm den Becher. »Der US Deputy Marshal? Die Polizei? Und warum sollst du ihm helfen, drei Bankräuber zu fangen? Hat er denn nicht genug Leute? Du bist Fallensteller und kein Marshal. Wie kommt er darauf, dich als Gehilfen zu verpflichten?«
»Ich habe mich freiwillig gemeldet, Clarissa.« Er ließ seine Worte eine Weile in der Luft hängen. »Die Bankräuber haben eine Bank in Anchorage überfallen und sollen nach Norden geflohen sein. Der Marshal vermutet, dass sie sich am Yukon versteckt halten. Außer mir sind noch zwei weitere Fallensteller, zwei Deputys und ein indianischer Fährtensucher dabei ... Wir kennen uns in der Wildnis aus, Clarissa. Ohne uns würde man sie niemals aufspüren.«
»Und ich? Was mache ich hier ohne dich?«
Er trank einen Schluck, bevor er antwortete: »Einer der drei Bankräuber ist Frank Whittler. Der Kassierer, der ihm den Safe öffnen musste, hat ihn erkannt ... trotz der Maske, die er trug. Das kommt davon, wenn man lange in der Öffentlichkeit steht und sich plötzlich entschließt, Verbrecher zu werden.«
»Frank Whittler?«, wiederholte sie ungläubig. »Derselbe Frank Whittler, der mich in Vancouver bedrängt und jahrelang versucht hat, mir ein Verbrechen anzuhängen, das ich nicht begangen habe? Der gemeine Kerl, der schuld daran ist, dass sie dich nach China entführt haben?« Sie musste sich mit einer Hand am Tisch abstützen, so sehr schockierte sie die Nachricht. »Ich dachte, Whittler wäre in den Bestechungsskandal verwickelt und säße im Gefängnis.«
»Das dachten wir alle.« Alex nahm seine Mütze vom Kopf und legte sie auf den Tisch. »Aber er entkam noch vor der Verhandlung und wurde häufig mit zwei zwielichtigen Burschen aus der Unterwelt gesehen. Charlie Whipple und Hank Morgan, zwei Diebe und vielleicht sogar Mörder. Wahrscheinlich waren sie bei dem Bankraub dabei. Bei dem Überfall wurde ein Kunde angeschossen, und die Chancen, dass er überlebt, stehen ziemlich schlecht. Falls er stirbt, erwartet die drei Männer der Strick.« Er stellte den Becher hin und musterte sie ernst. »Jetzt weißt du, warum ich mich freiwillig gemeldet habe.«
Sie nickte kaum merklich.
»Frank Whittler ... ihr müsst ihn festnehmen, bevor er herausbekommt, dass wir hier draußen leben, und uns noch mal gefährlich werden kann.« Sie starrte eine Weile ins Leere und verdrängte die Vorstellung, Frank Whittler könnte sie in ihrer Blockhütte überraschen. »Bist du sicher, dass sie am Yukon River sind? Was mache ich, wenn die Bankräuber hier auftauchen, und du bist nicht da? Whittler würde mich töten!«
»Der Indianer hat ihre Spuren gefunden«, erwiderte Alex, »sie haben einen großen Bogen um Fairbanks geschlagen und können nur im Norden sein. Sie haben ungefähr zwei Tage Vorsprung. Dennoch ...« Man sah ihm an, dass er selbst nicht glücklich über die Lösung war. »Du hast den Lee-Enfield. Trag ihn immer bei dir, solange ich weg bin. Auch wenn du die Hunde fütterst. Oder zieh in das neue Hotel in Fairbanks, dort wärst du noch sicherer.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich komme schon zurecht. Solange Emmett bei mir ist, hab ich keine Angst. Er würde mich sofort warnen, wenn Whittler und seine Männer in der Nähe wären. Ich bin keine ängstliche Stadtfrau mehr.«
»Ich weiß, Clarissa ... ich weiß. Sonst würde ich auch niemals wagen, dich allein zu lassen. Du würdest diesem Whittler schon heimleuchten.« Zum ersten Mal seit seiner Rückkehr lächelte er. »Da fällt mir ein ... Ich hab dir was mitgebracht.« Er zog eine Tafel Schokolade und ein Buffalo-Bill-Heft unter seinem Anorak hervor und reichte ihr beides. »Hat Barnette einige Mühe gekostet, an das Heft zu kommen, aber irgendwie hat er es geschafft ... Ich hatte ihm gedroht, ein Loch ins Eis zu schlagen und ihn zum Baden in den Chena River zu jagen, falls er es nicht besorgen würde. Und du liest das wirklich?«
Clarissa freute sich wie ein Kind. »Was bleibt mir denn anderes übrig, wenn mein Mann auf Verbrecherjagd geht? Soll ich vielleicht über einen arroganten Gentleman aus Vancouver lesen, der sich mit einer dieser eingebildeten Ladys aus den Villen im West End einlässt? Dann lieber ein Westmann wie Buffalo Bill, der beim Anblick eines Indianers nicht ohnmächtig wird.«
Draußen bellte Emmett, und gleich darauf hörte man laute Männerstimmen und das aufgeregte Jaulen anderer Huskys. »Der Marshal und seine Männer«, erkannte Alex. »Höchste Zeit, Proviant zusammenzupacken.« Er nahm eine Schachtel mit Patronen aus der Schublade und schob sie ihr hin. »Pack alles in einen Beutel ... und vergiss die Kekse nicht ... Wir haben doch noch Kekse?« Und als sie nickte, fügte er hinzu: »Ich kümmere mich um das Hundefutter.«
Während sie packten, klopften der Marshal und seine Männer an die Tür und traten in die Blockhütte ein. Mit ihnen drang ein Schwall eisiger Luft in den Raum.
»Hallo, Alex! Ma’am ...«, begrüßte sie der Marshal, »ich bin US Deputy Marshal Chester Novak aus Anchorage. Die Männer gehören zu meinem Aufgebot.« Er war ein schneidiger Mann mit kantigen Gesichtszügen, der sich wie ein Offizier benahm und es gewohnt zu sein schien, Befehle zu erteilen. »Ihr Mann hat Ihnen sicher schon erzählt, hinter wem wir her sind.«
»Das hat er, Marshal.« Sie grüßte die Männer mit einem Kopfnicken, den indianischen Fährtenleser, der neben der Tür stehen geblieben war, die beiden Fallensteller, die sie von einer kurzen Begegnung im Handelsposten kannte, und die beiden Hilfspolizisten aus Anchorage, die sich so viele Meilen abseits der Stadt etwas unwohl zu fühlen schienen. Alle trugen gefütterte Mäntel oder Jacken, Handschuhe, Pelzmützen und feste Stiefel. »Möchten Sie Tee?«
»Nein, danke, Ma’am. Wir haben es eilig. Sind Sie so weit, Alex?«
Alex erschien mit dem Hundefutter und griff nach dem Proviantbeutel. Lächelnd registrierte er die Tüte mit den Schokokeksen zwischen den Biskuits, dem Käse und dem Speck. Seine Wasserflasche war mit heißem Tee gefüllt.
»Ich bin so weit, Marshal. Gehen Sie schon mal vor ... Ich komme gleich nach.«
Der Marshal hatte eine bissige Erwiderung auf der Zunge; er befürchtete wohl, dass Alex sich zu ausgiebig von seiner Frau verabschieden würde, sagte aber nichts. Zusammen mit den anderen Männern verließ er die Blockhütte.
Nachdem die Tür ins Schloss gefallen war, schlang Clarissa ihre Arme um Alex Hals und küsste ihn innig. Inzwischen waren seine Lippen warm, und sie spürte die tiefe Hingabe, die sie miteinander verband. Seit der ungewollten und langen Trennung vor drei Jahren war ihre Liebe noch stärker und leidenschaftlicher geworden, und der Gedanke, nur für ein paar Tage von ihm getrennt zu sein, machte ihr mehr zu schaffen als sie sich eingestehen wollte. »Wie lange werdet ihr brauchen?«, fragte sie hoffnungsvoll. »Ein paar Tage?«
»Nicht lange«, erwiderte er, und beide ahnten, dass es wahrscheinlich gelogen war. »Der Marshal hat versprochen, uns einen Lohn zu bezahlen, und bestimmt keine Lust, zu tief in die Tasche zu greifen. Kommst du zurecht?«
»Das weißt du doch. Ich liebe dich.«
»Ich liebe dich auch. Bis in ein paar Tagen.«
Sie küssten sich wieder.
»Pass gut auf dich auf, Alex! Hörst du?«
»Keine Angst«, versprach er, »diesmal bringen wir diesen Mistkerl endgültig hinter Gitter, und dann haben wir nichts mehr von ihm zu befürchten.«
Von draußen rief der Marshal ungeduldig: »Hey, Alex! Wir müssen weiter!«
»Ich komme, Marshal!«
Sie küssten sich ein letztes Mal, dann löste sich Alex von ihr und verließ die Blockhütte. Clarissa blieb in der offenen Tür stehen und blickte den Männern nach, bis sie mit ihren Schlitten im dichten Schneetreiben verschwunden waren. Schon nach wenigen Minuten lag die Lichtung wieder einsam vor ihr.
Clarissa schloss die Tür und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. Sie hätte am liebsten laut losgeheult, unterdrückte ihre Tränen jedoch und presste beide Fäuste fest gegen ihre Wangen, bis der Schmerz nachließ. Sie wusste am besten, wie gefährlich Frank Whittler werden konnte, noch dazu mit zwei Komplizen aus der Unterwelt, und dass nicht mal ein Aufgebot aus einem Marshal und mehreren Männern genügte, ihn in die Enge zu treiben und zu besiegen. »Lässt uns dieses Scheusal denn nie in Ruhe?«, flüsterte sie.
Sie schenkte sich den Rest des Tees in ihren Becher und setzte sich an den Tisch. Nach dem Abschied von Alex war sie viel zu aufgewühlt, um jetzt zu schlafen. Sie gönnte sich einen Riegel Schokolade, ohne ihn richtig zu genießen und sich danach besser zu fühlen, begann die erste Geschichte in ihrem neuen Buffalo-Bill-Heft zu lesen und legte es entnervt zur Seite, als ständig die Buchstaben vor ihren Augen verschwammen und sie sich nicht konzentrieren konnte. Sie packte es weg, löschte die Lampe und ging ins Bett.
Früh am nächsten Morgen wurde Clarissa durch das Geheul ihrer Huskys geweckt. Sie schreckte hoch, lief barfuß ins Wohnzimmer und blickte aus dem Fenster. Im Dezember ging die Sonne erst nach zehn Uhr morgens auf, aber die Einheimischen erkannten an der Farbe des Himmels, wie spät es ungefähr war, und an diesem Morgen war bereits ein heller Streifen am östlichen Horizont zu erkennen.
»Das fängt ja gut an«, erschrak sie. Sie zündete die Petroleumlampe auf dem Tisch an, wusch sich in der Schüssel auf der Kommode und zog sich in Windeseile an, ihre »Winterkleidung«, wie sie die Wollhosen und den Pullover nannte, nicht gerade die Kleidung einer Lady, aber praktisch, wenn man einen Schlitten steuerte oder mit den Hunden im Schnee herumtollte. Ihr dunkelblauer Anorak mit der pelzbesetzten Kapuze hing ihr ein wenig locker um die Schultern, nachdem sie während der letzten Wochen etwas abgenommen hatte. Sie hatte Alex beim Auslegen der Fallen und beim Holzfällen geholfen und war jeden Abend todmüde ins Bett gefallen. Ihre Haare band sie zu einem Knoten und stülpte ihre Pelzmütze darüber.
»Ich weiß, ich bin spät dran«, entschuldigte sie sich bei Emmett und den anderen Huskys, als sie mit dem Futter nach draußen trat. »Ihr seid mir doch nicht böse? Ich hab verschlafen.« Sie stapfte an der Hüttenwand entlang zu den Hunden, die bereits ungeduldig warteten. »Dafür gibts heute auch was ganz Besonderes: leckeren Lachseintopf. Hey ... nicht so stürmisch, Emmett! Du wirfst mich ja um!«
Wie jeder Leithund, auch wenn er Smoky noch nicht offiziell abgelöst hatte, bekam Emmett sein Futter zuerst. Clarissa schüttete ihm besonders viel von dem Lachseintopf in seine Schüssel und verdünnte ihn mit etwas Wasser aus dem Eimer, den sie ebenfalls nach draußen gebracht hatte. Ihre Huskys fraßen nur einmal am Tag, dann aber ausgiebig, und mussten vor allem genügend Flüssigkeit aufnehmen. Nach mehreren Jahren in der Wildnis kannte sich Clarissa mit Huskys aus. Sie kraulte Emmett zwischen den Ohren und sagte ihm mehrmals, was für ein toller Bursche er war, bevor sie zu den anderen Hunden ging und auch sie mit Futter versorgte.
»Wenn wir das Alaska Frontier Race gewinnen wollen, müssen wir langsam anfangen zu trainieren«, sagte sie zu Emmett. »Glaub ja nicht, dass du den ganzen Winter vor der Hütte faulenzen kannst.« Sie gab ihm einen Nachschlag. »Wie wär’s, wenn wir heute was für unsere Ausdauer tun? Solange Alex mit dem Schlitten unterwegs ist, könnten wir durch den Tiefschnee tollen.« Sie sah das Aufleuchten seiner Augen und die Enttäuschung bei den anderen Hunden, die deutlich zu spüren schienen, wenn man sie links liegen ließ. »Okay, okay, ihr dürft alle mit! Aber beklagt euch nicht, wenn Emmett und ich schneller sind. In einer halben Stunde brechen wir auf, abgemacht?«
Clarissa ging ins Haus zurück und nützte die Zeit, um ihren Lee-Enfield-Revolver zu überprüfen und neue Patronen ins Magazin zu füllen. Sie mochte keine Waffen und berührte den kalten Stahl nur mit Widerwillen, lebte aber lange genug in der Wildnis, um zu wissen, dass man dort ohne Waffe nicht auskam. Alex hatte ihr beigebracht, mit dem Gewehr und dem Revolver zu schießen, und vor ein paar Wochen hatte sie sogar ein Zielschießen gegen Alex und zwei andere Fallensteller gewonnen.
Auf einen Menschen würde sie niemals schießen, das war ihr längst klar geworden, es sei denn, ein Verbrecher wie Frank Whittler ginge mit einer Waffe auf sie los, aber außer ihm und seinen Kumpanen streunte noch ein gefährlicher Grizzly durch die Gegend, und vor allem brauchte sie die Waffe zum Schutz gegen aufgebrachte Elche, die sich gern mit Huskys anlegten und ihnen sehr gefährlich werden konnten.
Sie verstaute die Waffe in ihrer Anoraktasche, warf ein paar Holzscheite in den Ofen, damit er noch glühte, wenn sie von ihrem Ausflug zurückkehrte, und schnallte sich einen Rucksack mit etwas Proviant und einer Wasserflasche mit heißem Tee auf den Rücken. Ihre Schneeschuhe, durch eine Rohhautschnur miteinander verbunden, hängte sie über die Schultern. Die tellerartigen Schuhe mit den gekreuzten Lederriemen hatte sie selbst angefertigt.
Die Huskys zerrten bereits ungeduldig an ihren Ketten, als sie zu ihnen kam. »So, meine Lieben, jetzt kann es endlich losgehen!« Sie befreite die Hunde von ihren Fesseln und wurde beinahe von dem ungestümen Buffalo über den Haufen gerannt, der es gar nicht erwarten konnte und sofort losrannte. »Hey, nicht so stürmisch, Buffalo!«, rief sie.
Billy und Cloud, beide schon in reiferen Jahren, ließen es langsamer angehen, und Emmett bewegte sich nicht von der Stelle und war erst zufrieden, als Clarissa ihn zwischen den Ohren kraulte. Die Liebkosung war längst zum Ritual zwischen ihnen geworden.
Clarissa folgte dem Trail nach Westen, sie brauchte auf dem festgestampften Schnee noch keine Schneeschuhe und kam relativ schnell vorwärts. Auch ihr tat das Training gut, nicht nur für das Rennen, an dem sie teilnehmen wollte, auch den Alltag in der Wildnis meisterte man nur, wenn man körperlich in Form war und genügend Ausdauer besaß. Die Huskys rannten hin und her, vor allem Emmett, der eine wahre Pferdelunge besaß und niemals müde zu werden schien. Mal liefen sie vor und mal hinter ihr, bellten aufgeregt und waren ganz in ihrem Element. Für einen Husky gab es nichts Schöneres, als im Schnee zu tollen und um die Wette zu laufen, und selbst Buffalo, Cloud und Billy waren noch stark genug, um es mit jedem Stadthund aufzunehmen, obwohl sie keinen Schlitten mehr zogen und längst ihren Ruhestand genossen.
Oberhalb einer weiten Senke, die steil nach Süden abfiel und dem Verlauf des Nebenflusses folgte, an dem ihre Hütte lag, schnallte sie ihre Schneeschuhe an. Der helle Streifen am östlichen Horizont war noch breiter geworden, und die ersten Sonnenstrahlen brachten die schneebedeckten Berggipfel und Hänge zum Glitzern.
Das Schneetreiben hatte aufgehört. Am Himmel standen nur noch wenige Wolken, und der Wind war so schwach, dass man sein Rauschen in den Bäumen kaum hörte. Solche Tage waren selten im Hohen Norden, und Clarissas Miene blieb nur ernst, weil Alex nicht bei ihr war.
Vielleicht dauerte es ja wirklich nur ein paar Tage, bis er zurückkam. Der Marshal war ein fähiger Mann, und der indianische Fährtenleser würde bestimmt nicht lange brauchen, um die Verbrecher aufzuspüren. Zu siebt sollten der Marshal und sein Aufgebot in der Lage sein, selbst so gefährliche Männer wie Frank Whittler und seine Kumpane zu überwältigen. In drei oder vier Tagen, spätestens aber in einer Woche würden sie mit den gefesselten Männern auftauchen, und Frank Whittler würde endgültig aus ihrem Leben verschwinden. Dann hatten sie endlich Ruhe vor dem rachsüchtigen Millionärssohn. Er spukte schon viel zu lange um sie herum und hatte jede Menge Schaden angerichtet.
»Emmett! Billy! Cloud! Buffalo! Hierher!«, rief sie den Huskys zu. »Ab in den Tiefschnee, oder habt ihr gedacht, ihr könntet euch auf dem Trail ausruhen? Nur keine Müdigkeit vortäuschen! Runter zum Fluss ... im Laufschritt!«
Die Huskys ließen sich nicht zwei Mal bitten. Noch vor ihr sprangen sie in den tiefen Schnee abseits des Trails und rannten in weiten Sprüngen zum Fluss hinab. Unter ihren Pfoten wirbelte der Schnee in dünnen Schleiern durch die Luft und glitzerte wie silberner Konfettiregen in der aufgehenden Sonne. Emmett sprang am höchsten. Vor jedem Sprung stemmte er seine Hinterläufe tief in den Schnee und katapultierte sich wie ein Geschoss durch die Luft. Buffalo hielt einigermaßen mit, schlaffte aber nach einigen Sprüngen ab und ließ es langsamer angehen. Cloud und Billy blieben weit zurück, hatten aber riesigen Spaß und gruben s ich nach Herzenslust durch den Schnee. Sie bellten vor Vergnügen, als jagten sie ein Kaninchen, und wollten wohl beweisen, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehörten.
Clarissa beobachtete sie zufrieden. Huskys waren einmalige Geschöpfe, zumeist schlank und voller Energie, viel kräftiger, als es ihre sehnigen Körper vermuten ließen, von unterschiedlichem Charakter, aber immer darauf bedacht, das Beste aus sich herauszuholen, und erst zufrieden, wenn sie Höchstleistung brachten. Es machte Spaß, ihnen zuzusehen, ihren kraftvollen und eleganten Bewegungen, ihre Freude an der Bewegung zu spüren. Hinter so viel Energie musste der Mensch zurückstehen, auch Clarissa, die auf ihren Schneeschuhen wesentlich langsamer vorankam und mächtig arbeiten musste, um in dem tiefen Schnee auf Kurs zu bleiben. Wenn sie das Alaska Frontier Race gewinnen oder zumindest einen der vorderen Plätze erreichen wollte, musste sie noch öfter trainieren, um auch auf Schneeschuhen konkurrenzfähig zu sein, wenn sie in den Ausläufern der verschneiten White Mountains gezwungen war, vom Trittbrett zu springen und den Schlitten anzuschieben.
Auf halber Strecke zum Fluss blieb sie verwirrt stehen. Die Husky hatten plötzlich aufgehört, im Schnee herumzutollen, und blickten zu dem langgestreckten Hügelkamm im Osten empor. Irgendetwas hatte ihre Aufmerksamkeit geweckt. Cloud und Billy standen mit angelegten Ohren im Schnee, das Hinterteil gesenkt, was nur bedeuten konnte, dass sie sich unwohl fühlten. Buffalo knurrte missmutig, dachte aber gar nicht daran, sich angriffslustig wie noch vor einigen Monaten zu zeigen, als er beinahe auf einen Elch losgegangen wäre, und nur Emmett wich nicht zurück, sondern brummte, knurrte und bellte laut und ließ dann ein langgezogenes Heulen ertönen, das wie ein dumpfes Echo über die Senke hallte und irgendwo im Schnee verhallte. Diesmal wartete er vergeblich auf eine Antwort. Außer dem leicht auffrischenden Wind war nichts zu hören.
Clarissa griff unwillkürlich nach ihrem Revolver. Von der Sonne geblendet, die sich in diesem Augenblick über den Hügelrand schob und den Schnee erglühen ließ, blickte sie zu dem Hügelkamm im Osten. Ein Schatten huschte durch den Schnee, noch kraftvoller und energiegeladener als Emmett, ein sehniger Wolf, wie es den Anschein hatte, der aber schon nach wenigen Sekunden wieder verschwand und sich im Sonnenlicht aufzulösen schien. Sie nahm die Hand von der Waffe.
»Bones!«, flüsterte sie.
Kapitel 3
Noch am späten Nachmittag, als sie die Senke längst verlassen hatten und über einen steilen Hang zum Trail zurückstiegen, verharrten die Huskys öfter im Schnee und blickten nervös in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Auch Clarissa hatte noch das Bild des hageren Wolfs vor sich, wie er durch das morgendliche Sonnenlicht lief und gleich darauf hinter dem Hügelkamm verschwand. Nur für den Bruchteil einer Sekunde hatte sie ihn gesehen, und doch war sie sicher, ihn erkannt zu haben, denn so bewegte sich nur Bones, der geheimnisvolle Wolf, der ihr schon ein paar Mal das Leben gerettet hatte.
Auf der Flucht vor Frank Whittler und seinen Männern hatte sie ihm den blutenden Vorderlauf verbunden, eine leichtsinnige Tat, über deren Auswirkungen sie sich keine Gedanken gemacht hatte. Als der Wolf auf die Lichtung gehumpelt war, hatte sie nicht lange überlegt. Sie war auf das verletzte Tier zugegangen und hatte ihn versorgt, ohne darüber nachzudenken, wie gefährlich gerade ein angeschossener Wolf einem Menschen werden konnte. Ihre Bekannten in Vancouver hätten sie wahrscheinlich für verrückt erklärt, wenn sie davon erfahren hätten, selbst Alex hatte sie davor gewarnt, sich noch einmal auf diese Weise in Gefahr zu bringen. Jeder Wolf war gefährlich, auch wenn er einen noch so treuherzig anblickte.
Doch Bones, wie sie ihn wegen seines ausgezehrten Körpers nannte, war kein gewöhnlicher Wolf Er zog weder in einem Rudel durch die Wälder, noch hielt er sich in einem bestimmten Revier auf. Er sah immer gleich aus und alterte nicht. Ein Geisterwolf, behaupteten die Indianer, bei denen sie sich einige Monate vor ihren Verfolgern versteckt hatte. Ein übernatürliches Wesen, das seiner Retterin folgte, egal, wohin sie ging und welche Entfernungen es zurücklegen musste. Vom westlichen Kanada bis ins ferne Alaska hatte es ihn gezogen, beinahe zweitausend Meilen, eine schier unglaubliche Entfernung für einen Wolf, es sei denn, er war tatsächlich ein magisches Fabelwesen. Selbst sie zweifelte an seiner Existenz und hielt sich inzwischen sogar bei Alex bedeckt, wenn sie glaubte, ihm begegnet zu sein, doch Tatsache war, dass ein ausgezehrter, leicht humpelnder Wolf ihr mehrmals das Leben gerettet hatte und auch jetzt wieder aufgetaucht war. Was wollte er ihr dieses Mal mitteilen?
Auch ihre Huskys waren froh, als sie endlich den Trail erreichten, zögerten jedoch, als sie zwei Hundeschlitten vor der Blockhütte entdeckten. Clarissa dachte sofort an Frank Whittler und seine beiden Kumpane und schob ihre Rechte in die Tasche mit dem Revolver. Gleich darauf entspannte sie sich aber wieder, als sie den Indianer, der bei den Schlitten stand, und die Hunde erkannte. »Hey, Jimmy!«, rief sie dem Indianer zu. »Was will denn der Doc bei mir?«
Seine Antwort ging im lauten Gezeter der Hunde unter. Sie rannten angriffslustig auf die beiden Gespanne zu, bellten und schimpften sich die Seele aus dem Leib und gaben erst Ruhe, als Clarissa sie mit einem scharfen Warnruf zur Ordnung rief. »Easy, Emmett!«, warnte sie ihren Leithund. »Du weißt, was passieren kann, wenn du dich mit anderen Hunden balgst. Wenn du was abbekommst, können wir uns das Rennen sparen.« Sie scheuchte ihn davon. Buffalo, Billy, Cloud, das gilt auch für euch. Ihr seid keine Welpen mehr!«
Der Vernunft von Emmett war es zu verdanken, dass sich ihre Huskys zurückhielten und widerspruchslos an die Ketten legen ließen. Sie kraulte ihren Leithund dankbar zwischen den Ohren und ging zur Tür. Der Indianer stand neben den Schlitten und nickte, als sie an ihm vorbeiging. Sie wusste, dass er sich ungern in geschlossenen Räumen aufhielt, und verzichtete darauf, ihn in die Hütte zu bitten. »Ich bringe dir Tee«, versprach sie. »Mit viel Zucker.«
Im Haus warteten Doc Boone und eine junge Frau. Der Arzt, ein weißhaariger Mann in den Fünfzigern, stand mit gerötetem Gesicht vor dem Ofen und hielt beide Hände über die Platte. Anscheinend hatte er Holz nachgelegt. Die junge Frau saß mit gefalteten Händen am Tisch und blickte betreten zu Boden. »Ah, Mrs Carmack!«, grüßte der Doktor. »Entschuldigen Sie, dass wir Sie auf diese Weise überfallen, aber die Sache ist sehr dringend, und ich bin auf Ihre Hilfe angewiesen.« Er begleitete seine Worte mit einem Lächeln und deutete auf die junge Frau. »Das ist Schwester Betty-Sue, meine neue Krankenschwester. Sie haben sicher gehört, dass ich ein Krankenhaus in Fairbanks eröffnet habe. Nichts Besonderes, nur ein paar Betten, aber ...« Er suchte nach den passenden Worten. »Aber wir haben sehr viel zu tun, Mrs Carmack, und das ist auch der Grund, warum ich heute Nachmittag bei Ihnen auftauche.«
Clarissa zog ihren Anorak, die Pelzmütze und ihre Handschuhe aus und blickte ihn fragend an. Sie legte die Sachen über einen Stuhl. »Sie wollen, dass ich bei Ihnen im Krankenhaus aushelfe? Aber ich habe nicht die nötige Ausbildung, Doc Boone, und ich kann hier auch nicht weg. Die Hunde ...«
»Nein, darum geht es nicht«, unterbrach sie der Doktor. »Wie Sie vielleicht wissen, bin ich mit meiner Praxis auch für die kleinen Siedlungen in den Bergen zuständig, und mit der Regierung habe ich vereinbart, meine medizinischen Dienste in den Indianerdörfern unseres Bezirks anzubieten. Alle paar Wochen muss ich die Runde drehen. Bisher bin ich immer selbst gefahren, aber seitdem Gold gefunden wurde, wächst die Stadt, und ich kann mich vor Patienten kaum noch retten, deshalb habe ich eine Krankenschwester aus den Staaten kommen lassen.« Er blickte die junge Frau an, ein wenig zweifelnd, wie Clarissa zu erkennen glaubte. »Leider kann Schwester Betty-Sue keinen Hundeschlitten fahren, deshalb wollte ich ...« Er schien nicht zu wissen, wie er die Frage am besten formulieren sollte. »Nun, eigentlich wollte ich einen Indianer bitten, ihren Schlitten zu steuern, aber die Schwester hatte bisher nie mit Indianern zu tun, und da dachte ich ... Könnten Sie den Schlitten auf ihrer ersten Tour steuern?« Er sah, dass sie zögerte, und fügte schnell hinzu: »Nur auf der ersten Tour. Schwester Betty-Sue würde sich sehr freuen, eine erfahrene Frau als Begleiterin zu haben, und da Sie sich in dieser Gegend auskennen und eine erfahrene Musherin sind, dachte ich ... Ich zahle Ihnen einen Wochenlohn!«
Clarissa war nicht gerade erpicht darauf, mit einer verwöhnten jungen Frau, die wahrscheinlich noch nie in der Wildnis gewesen war, durch die Wälder zu fahren, und auch der mögliche Verdienst lockte sie wenig, doch eine solche Tour war vielleicht besser, als zu Hause herumzusitzen und nervös auf die Rückkehr ihres Mannes zu warten. »Wann sollen wir losfahren?«
»Dann wären Sie einverstanden?« Die Miene des Doktors hellte sich auf. »Am besten gleich ... Wir sind nämlich schon überfällig, und wenn ich meinen Bericht zu spät an die Regierung schicke, handele ich mir eine Menge Ärger ein. Wenn Sie innerhalb der nächsten Stunde aufbrechen, sind Sie am frühen Abend in Fox und können morgen und übermorgen die Dörfer nördlich des Chena Rivers abfahren. Einen Beutel mit Proviant hat Schwester Betty-Sue dabei, auch Tee und Wasser, und für einen Schlafplatz ist überall gesorgt. Nach Ihren Huskys würde Jimmy sehen. Einverstanden, Ma’am?«
»Und wenn nicht?«
»Dann müssten die armen Goldgräber und Indianer in den entlegenen Dörfern leider auf medizinische Hilfe verzichten. Aber ich verlasse mich auf Sie, Ma’am. Ich kenne Sie nicht näher, aber so ziemlich jeder, den ich gefragt habe, hat Sie empfohlen. Sie wären die einzige Frau, die es schaffen würde.«
Clarissa fühlte sich geschmeichelt, zeigte es aber nicht. Sie deutete ein Lächeln an. »Nun, wenn das so ist, kann ich wohl schlecht nein sagen, oder?«
Dieser Meinung war auch Doc Boone. Er bedankte sich überschwänglich bei ihr und lehnte den Tee und die Schokokekse ab, die sie ihm anbot. Offenbar wollte er so schnell wie möglich aus dem Haus kommen, falls sie es sich doch noch anders überlegte. Mit einer übertriebenen Verbeugung verließ er die Hütte, und schon wenig später hörte sie ihn und den Indianer auf einem der beiden Schlitten davonfahren. Den anderen hatte er für sie und Schwester Betty-Sue zurückgelassen. Durchs Fenster beobachtete sie, dass der Doktor in Decken gewickelt auf der Ladefläche saß und der Indianer den Schlitten steuerte.
»Na, dann wollen wir mal«, sagte sie zu der Schwester. »Betty-Sue, nicht wahr? Ich bin Clarissa.« Sie reichte der jungen Frau die Hand. Betty-Sue wirkte zart und zerbrechlich, ihre Haut war so weiß, als wäre sie nur selten an der frischen Luft, und in ihren Augen stand die Angst vor dem Ungewissen, das sie in der Wildnis erwartete. »Ich hab Sie noch nie in Fairbanks gesehen.«
»Ich bin erst seit ein paar Tagen hier«, erwiderte sie. Ihre Stimme war kräftiger, als Clarissa befürchtet hatte. »Ich komme aus San Francisco. Dort habe ich als OP-Schwester in einer großen Klinik gearbeitet. Widrige Umstände ...« Sie brachte ein Lächeln zustande, das sie noch verletzlicher aussehen ließ. »Nun, ich will ehrlich sein ... Eine unglückliche Affäre mit einem unserer Ärzte zwang mich, den Arbeitsplatz zu wechseln. Er war verheiratet, wissen Sie? Als seine Frau uns zusammen in einem Restaurant erwischte, machte sie uns eine große Szene und reichte schon am nächsten Tag die Scheidung ein.«
Clarissa war bereits dabei, frische Unterwäsche in ihrem Proviantbeutel zu verstauen, und blickte sie durch die offene Schlafzimmertür an. Eine Affäre hatte sie der unscheinbaren Frau gar nicht zugetraut. »Dann wäre der Weg doch frei gewesen«, sagte sie. »Oder ... Er wollte Sie wohl nicht heiraten?«
»Er hat sich nicht einmal von mir verabschiedet.« Sie wischte sich verstohlen einige Tränen aus den Augen. »Am nächsten Tag war er verschwunden, und ich war die böse Frau, die ihm den Kopf verdreht hatte. Nirgendwo in Kalifornien hätte ich noch eine Stellung bekommen. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich beim Civil Service zu melden. Eigentlich wollte ich nach Hawaii, dort lebt eine Freundin, aber die einzige freie Stelle gab es hier oben.«
»Und jetzt sind Sie in Alaska.« Clarissa schüttelte ungläubig den Kopf. Wie konnte man ein so zartes Geschöpf nur in die Wildnis schicken und dann noch in eine Goldgräbersiedlung wie Fairbanks, wo die Männer große Reden schwangen und man als Krankenschwester sicher keinen leichten Stand hatte. Sie konnte sich bildhaft vorstellen, was passierte, wenn ihr ein Goldgräber seinen nackten Hintern für eine Spritze entgegenstreckte. »Nehmen Sie’s leicht, Betty-Sue. Alaska ist ein wunderschönes Land, und an die Kälte und den Schnee werden Sie sich schon noch gewöhnen, und solange Sie keine Affäre mit einem verheirateten Goldgräber anfangen, kann Ihnen nichts passieren.«
»Sie machen sich lustig über mich!«
»Entschuldigung ... aber keine Angst. Die meisten Goldgräber, die wir in den Dörfern treffen, sind auch nicht besser dran. Da sind sogar Leute aus Chicago und New York dabei. Haben einfach alles liegen und stehen lassen und sind zu uns nach Fairbanks gekommen ... weil sie hoffen, dass wir hier einen genauso großen Goldrausch bekommen wir vor ein paar Jahren am Klondike.«
Betty-Sue stand auf und griff nach ihrer Mütze. »Ich werde Ihnen nicht zur Last fallen, Clarissa. Ich weiß ... ich bin vielleicht nicht für dieses wilde Land geschaffen, aber ich bin eine gute Krankenschwester, und meine Patienten werden keinen Grund zur Klage haben. Das Einzige, wovor ich etwas Angst habe, ist das Zähneziehen ... darauf bin ich, ehrlich gesagt, nicht vorbereitet.«
»Sie müssen Zähne ziehen?«, fragte Clarissa verwundert.
»Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, die Schmerzen zu behandeln, und solange kein Zahnarzt in Fairbanks eine Praxis eröffnet ... « Sie schlüpfte in ihre gefütterten Handschuhe und blickte nachdenklich aus dem Fenster. Ihre Miene wirkte besorgt. »Diese Indianer ... Sind sie nicht gefährlich?«
»Schon lange nicht mehr«, erwiderte Clarissa lächelnd. »Mit den Sioux oder Comanchen, wie man sie aus Magazinen kennt, haben unsere Chena wenig zu tun. Sie haben sich längst mit ihrem Schicksal abgefunden, leben von der Jagd und dem Fischfang und tauschen ihre Felle in den Handelsposten gegen Lebensmittel ein. Ich will nicht sagen, dass es ihnen besonders gut geht, aber Hunger müssen wenige leiden. Es sind gute Menschen, Betty-Sue.«
Nachdem auch Clarissa in ihren Anorak geschlüpft war und die Mütze und die Handschuhe übergestülpt hatte, verließen sie die Hütte. Clarissa verabschiedete sich von Emmett und den anderen Huskys und blieb eine ganze Weile neben ihrem Leithund sitzen. Er konnte nicht verstehen, dass sie mit einem anderen Gespann auf den Trail fuhr, und knurrte sogar leise. »Ich verstehe ja, dass du wütend bist, Emmett, und ich würde dich wirklich gerne mitnehmen. Aber diese Krankenfahrten werden im Auftrag der Regierung durchgeführt, und ich muss mich leider an die Vorschriften halten, auch wenn du ein dreimal so guter Leithund bist. Das verstehst du doch, oder? Sobald ich zurückkomme, bin ich nur noch für dich da, das verspreche ich dir. Dann trainieren wir für das Rennen.« Sie kraulte ihn wieder und küsste ihn auf die Stirn. »Und für euch bin ich natürlich auch da«, sagte sie zu Billy, Buffalo und Cloud. Keine Angst, der Indianer versorgt euch, solange ich weg bin.«
Betty-Sue saß bereits in Decken gepackt auf der Ladefläche, als Clarissa zum Schlitten zurückkehrte. Auch mit dem Leithund des Doktors wechselte sie einige Worte. Sie wusste, dass er Buster hieß und die Angewohnheit hatte, immer langsamer zu werden, wenn man ihn nicht antrieb. »Hallo, Buster!«, begrüßte sie ihn. »Wir werden schon miteinander auskommen, was meinst du? Du bist die Runde doch sicher schon öfter gelaufen, oder? Also, keine Angst! Wenn das Wetter hält, wird schon alles glattgehen. Bist du bereit?«
Buster blickte sie aus seinen blauen Augen an und gab ihr mit einem leisen Jaulen zu verstehen, dass sie nichts zu befürchten hatte. Die Miene der Schwester ließ anderes vermuten. Sie saß etwas verkrampft auf der Ladefläche und klammerte sich mit beiden Händen an den Schlitten, als befürchtete sie, schon in der ersten Kurve in den Schnee zu stürzen. »Keine Angst!«, beruhigte Clarissa sie. »Der Trail nach Fox gehört zu den leichteren Strecken.«
Am Ufer des schmalen Flusses, an dem ihre Hütte lag, fuhren sie nach Süden. Der Schnee war fest und griffig und wie geschaffen für die Huskys, die auf diesem Trail besonders guten Halt fanden. Clarissa tat sich etwas schwerer, musste sich erst an das etwas träge Gespann und vor allem an den altersschwachen Schlitten gewöhnen, der einen wenig stabilen Eindruck machte und in jeder Kurve ächzte und knarrte. Sie fuhren über den zugefrorenen Chena River nach Westen, bevor sie wieder nach Norden auf einen festgestampften Jagdtrail abbogen. Betty-Sue stieß einen leisen Schrei aus, als Clarissa den Schlitten mit lautem »Vorwärts!« über die steile Uferböschung trieb.
Oberhalb des Ufers legten sie eine kurze Rast ein, auch wegen der Hunde, die lange nicht so gut trainiert waren wie ihr eigenes Gespann. Sie kramte die Feldflasche mit dem heißen Tee aus dem Proviantbeutel, nahm einen Schluck und reichte sie Betty-Sue. Die Sonne war bereits untergegangen, und geheimnisvolles Zwielicht lag über dem Land. Die Stille über dem vereisten Fluss und den Wäldern am Ufer war so intensiv, dass man sie zu hören glaubte. Die Kälte war erträglich, solange der Wind nicht wehte, er machte nur Betty-Sue zu schaffen, die ihren Schal bis über die Nase gezogen hatte und dennoch fror.
»Wie kommen Sie in diesem Land nur zurecht?«, fragte Betty-Sue. »Wie kann man als Frau hier leben? In San Francisco haben sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als sie erfuhren, dass ich nach Alaska gehe.«
Die Frage hatte Clarissa schon öfter gehört. Viele Menschen glaubten, Alaska wäre so wild und gefährlich und so eiskalt, dass dort nur Indianer und einige Fallensteller leben konnten. Sogar die Politiker hatten es lange Zeit abgeschrieben, und Fairbanks war nur entstanden, weil die Gier nach Gold so groß war, dass selbst Männer von der Ostküste in die Wildnis kamen. »Alaska ist nicht so menschenfeindlich, wie Sie vielleicht denken«, sagte sie. »Wenn Sie sich erst einmal an die Kälte gewöhnt haben, und das geht schnell, glauben Sie mir, werden Sie auch die Schönheit dieses Landes schätzen lernen.« Sie blickte über den Chena River und die Wälder hinweg. »Sehen Sie sich doch um! Diese Weite, diese Stille, diese klare Luft ... So muss die Welt am Schöpfungstag ausgesehen haben, sag ich immer. Von Menschen unberührt.«
»Aber hier gibt es wilde Tiere. Bären und Wölfe ...«
»Die haben mehr Angst vor den Menschen als wir vor ihnen.« Sie zog die Tüte mit den Keksen aus dem Proviantbeutel und ließ sie zugreifen. »Bären haben mit uns Menschen wenig im Sinn, es sei denn, man gerät zwischen eine Mutter und ihre Jungen.« Oder scheucht einen gefährlichen Grizzly auf, fügte sie in Gedanken hinzu, hütete sich aber, etwas zu sagen. »Und die Wölfe tauchen hier nur auf, wenn sie in den Bergen keine Beute mehr finden.«
Betty-Sue wirkte nicht gerade überzeugt. Etwas irritiert knabberte sie an ihrem Keks. »Aber es ist so ... einsam hier. Vermissen Sie denn nichts?«
»Was denn? Restaurants? Kaufhäuser? Das Getue der reichen Familien in Vancouver, für die ich gearbeitet habe?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein ... Ich habe einen Mann, den ich über alles liebe, ein gemütliches Heim, meine Huskys, und ich darf in diesem wundervollen Land leben. Was will ich mehr?«
»Ich weiß nicht ...« Betty-Sue nahm einen Schluck aus der Feldflasche und blickte auf den verschneiten Wald. »Ich hätte Angst hier draußen. Nicht nur vor wilden Tieren, vor allem wegen der Einsamkeit. Das Land ist so ... leer.«
Clarissa lächelte still. »Mich zieht diese Einsamkeit an. In einer Stadt wie San Francisco würde ich wahrscheinlich keine drei Tage durchhalten. Vielleicht mag ich diese einsame Gegend, weil ich aus einer Fischerfamilie komme und die Weite des Meeres gewohnt bin. Waren Sie mal auf dem Meer, Betty-Sue?« Sie erwartete keine Antwort und fuhr fort: »Nur das Boot und ringsherum nur Wasser bis zum fernen Horizont? Ich war oft mit meinem Vater draußen und fand dieses Gefühl irgendwie ...« Ihr fiel kein passendes Wort ein. »... berauschend. Hier in Alaska geht es mir nicht anders. Wollen wir?«
Betty-Sue reichte ihr die Feldflasche zurück, sie verstaute sie im Proviantbeutel und stieg aufs Trittbrett. »Heya ... heya!«, feuerte sie die Hunde an. »Genug gefaulenzt! Jetzt zeigt endlich mal, was ihr könnt! Vorwärts, Buster!«
Sie lenkte den Schlitten auf den schmalen Trail, ging leicht in die Hocke, als einige Zweige im Weg hingen, und trieb die Hunde in den Wald hinein.
Kapitel 4
Fox war noch schäbiger, als Clarissa es von ihrem letzten Besuch in Erinnerung hatte. Ein paar Holzhäuser säumten die kaum geräumte Hauptstraße, darunter zwei Saloons und eine Kirche, die wegen des fehlenden Turms aber kaum als solche zu erkennen war, und abseits der Straße am Ufer des zugefrorenen Fox Creek erhoben sich mehrere Bruchbuden und Zelte. Selbst aus den Zelten ragten die Schlote der unvermeidlichen Kanonenöfen, ohne deren Wärme man in den notdürftig errichteten Unterkünften kaum überlebte.
Vor den beiden Saloons hingen leuchtende Laternen, als Clarissa auf der Hauptstraße den Schlitten bremste. Wegen der Kälte war kaum jemand auf der Straße, lediglich zwei Männer, die ihnen neugierige Blicke zuwarfen und anschließend in einer der Kneipen verschwanden, und ein Betrunkener, der mit einer halb gefüllten Whiskeyflasche zu den Zelten wankte. Aus beiden Saloons drang das Klimpern von Klavieren, deren schräge Töne sich zu einem kaum erträglichen Klanggemisch vereinten und mit dem Heulen der zahlreichen Huskys, die bei den Zelten im Schnee lagerten, konkurrierten. Es war noch früh am Abend, und düsteres Zwielicht hing über der kleinen Siedlung.
Clarissa bemerkte den entsetzten Blick der jungen Schwester und konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Dagegen ist Fairbanks eine attraktive Großstadt, was? So sehen diese Dörfer alle aus. Lohnt sich nicht, was Dauerhaftes aufzubauen. Sobald kein Gold mehr da ist, ziehen die Männer weiter.«
Betty-Sue stieg vom Schlitten und zog ihren Schal vom Gesicht. Man sah ihr an, dass sie am liebsten wieder umgekehrt und an Bord des nächsten Schiffes nach San Francisco gegangen wäre. »Und wo sollen wir wohnen?«
Die Antwort brachte ein korpulenter Mann im offenen Pelzmantel und einer Wollmütze, die sein gerötetes Gesicht noch runder erscheinen ließen. Er kam aus einem der Häuser und hielt eine brennende Sturmlampe in der Hand. »Ah, wenn mich meine Augen nicht täuschen, sind das Doc Boones Hunde«, sagte er. »Wir haben Sie schon erwartet, Doc. Wir haben einige Fälle von ...« Er unterbrach sich mitten im Satz und blickte erstaunt zwischen den Frauen hin und her. »Mrs Carmack, die Frau des Fallenstellers, wenn ich mich richtig erinnere. Was hat das zu bedeuten? Wollen Sie mir etwa sagen, dass Doc Boone verhindert ist? Joe Blake hat sich ein Bein gebrochen. Wir haben es notdürftig geschient, aber der Doc muss es sich unbedingt ansehen. Wir können Joe nicht mit dem Schlitten nach Fairbanks bringen, dazu ist er viel zu schwach. Und der alte Zebulon hat Zahnschmerzen ...« Er merkte wohl selbst, dass er sich in endlosen Aufzählungen verlor. »Also ... Was ist mit dem Doc?«
»Kein Grund, nervös zu werden, Mister ...«
»Rudy Shockley. Ich bin der Bürgermeister hier.«
»Und das ist Betty-Sue Anderson, eine erfahrene Krankenschwester aus San Francisco, die ab sofort den Außendienst für Doc Boone übernehmen wird. Sie hat als OP-Schwester in einem großen Krankenhaus gearbeitet.«
Shockley hörte nur mit halbem Ohr hin. »Eine Krankenschwester? Doc Boone schickt uns eine Schwester?«
Es klang ungläubig und auch ein wenig schockiert. »Glauben Sie denn, eine Frau kann einen Beinbruch behandeln?«
»Ich habe eine umfassende Ausbildung hinter mir, Bürgermeister«, meldete sich Betty-Sue zu Wort. Es klang fast ein wenig trotzig. »Und im Operationssaal des Golden Gate Memorial hatte ich es oft mit schwierigen Fällen zu tun. Ärzte haben wenig Zeit, da bleibt viel Arbeit an uns Schwestern hängen.«
»Aber ... aber Sie sind noch so jung ...«
Jetzt lächelte sogar Betty-Sue, trotz der Kälte, die auch zwischen den Häusern herrschte. »Das sagen alle, Bürgermeister. Aber ich bin bereits sechsundzwanzig und arbeite seit über acht Jahren mit Ärzten zusammen. Meine Zeugnisse liegen in Fairbanks, aber wenn Sie wollen, bringe ich Sie das nächste Mal mit. Der Civil Service schickt nur gut ausgebildete Schwestern in die Territorien. Dort weiß man, dass hier viele Aufgaben von uns Schwestern wahrgenommen werden.«