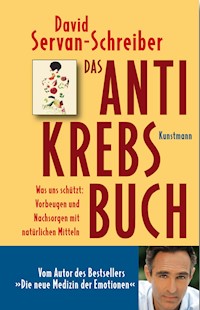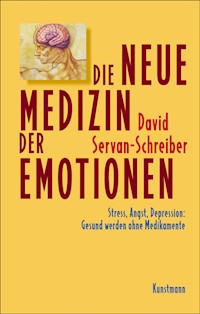
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
In den letzten Jahren hat sich in den Neurowissenschaften eine radikale Umwälzung vollzogen. Die neuen Erkenntnisse über das Zusammenspiel von Körper und Geist in eine "Medizin der Emotionen" zu überführen, ist das Ziel des Neurologen und Psychiaters David Servan-Schreiber. Stress, Angst und Depression sind heilbar - und zwar ohne Medikamente und jahrelange Psychotherapie. Im Inneren des Gehirns befindet sich ein "emotionales Gehirn", das alle Funktionen kontrolliert, die unser psychisches Wohlbefinden beeinflussen, und einen Großteil der Körperfunktionen wie Herz, Blutdruck, Hormone, das Verdauungs- und Immunsystem dazu. Ist das System im Gleichklang, wachsen uns ungeahnte Kräfte zu; gerät es aus der Balance, sind Stress, Ängste und Depressionen die Folge. Durch bestimmte Methoden, die auf den Körper einwirken, lassen sich die Mechanismen der Selbstheilung nutzen, über die das emotionale Gehirn verfügt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Ähnliche
DAVID SERVAN-SCHREIBER
DIE NEUE MEDIZINDER EMOTIONEN
STRESS, ANGST, DEPRESSION:GESUND WERDEN OHNE MEDIKAMENTE
Aus dem Französischen vonInge Leipold und Ursel Schäfer
Verlag Antje Kunstmann
HINWEIS
Dieses Buch ist kein medizinisches Lehrbuch. Die Informationen sollen Ihnen ermöglichen, verantwortungsbewusste Entscheidungen in Gesundheitsfragen zu treffen. Das Buch ist jedoch kein Ersatz für eine eventuelle Behandlung, die Ihnen Ihr Arzt verordnet hat. Wenn Sie vermuten, dass Sie an einer gesundheitlichen Störung leiden, sollten Sie deshalb kompetente ärztliche Hilfe suchen.
Die Nennung bestimmter Firmen und Organisationen in diesem Buch bedeutet keine Empfehlung des Verlags, umgekehrt bedeutet ihre Nennung auch nicht, dass sie dieses Buch empfehlen.
INHALT
Vorbemerkung
1. Eine neue Medizin der Emotionen
2. Das Unbehagen in der Neurobiologie: Die schwierige Hochzeit zweier Gehirne
3. Herz und Vernunft
4. Kohärenz im täglichen Leben
5. Selbstheilung nach traumatischen Erfahrungen: Die neuro-emotionale Integration durch Augenbewegungen (EMDR)
6. EMDR in der Praxis
7. Die Lichtenergie: Wie man seine biologische Uhr richtig einstellt
8. Die Steuerung des Qi: Akupunktur wirkt unmittelbar auf das emotionale Gehirn
9. Die Revolution der Omega-3-Fettsäuren: Die Ernährung des emotionalen Gehirns
10. Xanax oder Adidas?
11. Liebe ist ein biologisches Bedürfnis
12. Emotionale Kommunikation
13. Mit dem Herzen zuhören
14. Die Verbindung zu anderen
15. Wo anfangen?
Danksagung
Anmerkungen
Bibliographie
Hilfreiche Adressen
VORBEMERKUNG
Viel verdanken die in diesem Buch vorgestellten Ideen den Arbeiten von Antonio Damasio, Daniel Goleman, Tom Lewis, Dean Ornish, Boris Cyrulnik, Judith Hermann, Bessel Van der Kolk, Joseph LeDoux, Mihaly Csikszentmihalyi, Scott Shannon und zahlreichen anderen Medizinern und Forschern. Wir haben an denselben Konferenzen teilgenommen, kannten dieselben Kollegen und haben dieselbe medizinische Literatur gelesen. Entsprechend zahlreich sind die Übereinstimmungen, Bezugnahmen und Vorstellungen in ihren Büchern und dem meinen. Ich komme nach ihnen, und so konnte ich von ihrer Art und Weise, wissenschaftliches Arbeiten darzustellen, profitieren. Ihnen danke ich an dieser Stelle für alles, was dies Buch möglicherweise an Gutem enthält. Was den Teil meiner Ideen betrifft, mit dem sie vielleicht nicht unbedingt einverstanden wären, so habe ich diese natürlich ausschließlich selbst zu verantworten.
Sämtliche klinischen Fälle, die ich auf den folgenden Seiten anführe, beruhen auf meiner eigenen Erfahrung (abgesehen von einigen wenigen, die Psychiatrie-Kollegen in der medizinischen Fachliteratur beschrieben haben und die als solche gekennzeichnet sind). Aus nahe liegenden Gründen wurden alle Namen sowie alle Angaben, die einen Rückschluss auf die jeweiligen Personen erlauben, geändert. An einigen Stellen habe ich mich aus stilistischen Gründen und der Klarheit meiner Ausführungen wegen dafür entschieden, klinische Befunde verschiedener Patienten zusammenzufassen.
1 EINE NEUE MEDIZIN DER EMOTIONEN
Alles zu bezweifeln oder alles zu glauben, dassind zwei gleichermaßen bequeme Lösungen,denn beide entheben sie uns des Nachdenkens.Henri Poincaré, »La science et l’hypothèse«
JEDES LEBEN IST EINZIGARTIG – und jedes Leben ist schwierig. Oft ertappen wir uns dabei, wie wir andere um ihres beneiden: »Wenn ich doch nur so schön wäre wie Marilyn Monroe«, »Hätte ich nur das Talent einer Marguerite Duras«, »Könnte ich nur so ein abenteuerliches Leben führen wie Hemingway« … Es stimmt schon: Wir hätten dann nicht die gleichen Probleme, jedenfalls nicht unsere. Dafür aber andere: die ihren.
Die berühmteste Frau mit dem größten Sexappeal, Marilyn Monroe, die sogar der Präsident ihres Landes begehrte, ertränkte ihre Verzweiflung in Alkohol und starb an einer Überdosis Barbiturate. Kurt Cobain, der Sänger der Gruppe Nirvana, der von einem Tag auf den anderen weltberühmt geworden war, nahm sich das Leben, als er noch keine dreißig war. Auch Hemingway beging Selbstmord; selbst ihm ersparten ein Nobelpreis und ein außergewöhnliches Leben nicht ein tief verwurzeltes Gefühl existenzieller Leere. Und Marguerite Duras, ungemein begabt, ergreifend, von ihren Liebhabern vergöttert, zerstörte ihr Leben durch Alkohol. Weder Begabung noch Ruhm, weder Macht noch Geld, auch nicht, von Frauen oder Männern verehrt zu werden – nichts von alldem macht das Leben grundlegend einfacher.
Und doch gibt es glückliche Menschen, die ein harmonisches Leben führen. Meistens haben sie das Gefühl, das Leben sei großzügig mit ihnen umgegangen. Sie wissen ihre Umgebung und die kleinen Freuden des Alltags zu schätzen: Essen, Schlafen, die Freuden der Natur, die Schönheit der Stadt. Sie sind kreativ und gestalten gern, ob es sich nun um Gegenstände, Projekte oder Beziehungen handelt. Diese Leute gehören keiner Sekte, keiner besonderen Religion an, und man kann sie in jeder Weltgegend antreffen. Einige sind reich, andere nicht; einige sind verheiratet, andere leben allein; etliche haben besondere Begabungen, andere sind völlig durchschnittlich. Sie alle haben Niederlagen erlebt, Enttäuschungen, schwierige Phasen. Dem entgeht niemand. Doch im Großen und Ganzen scheinen sie besser mit Schwierigkeiten umgehen zu können; beinahe möchte man sagen: Sie haben eine besondere Begabung, Widriges an sich abprallen zu lassen, ihrem Leben einen Sinn zu geben, als unterhielten sie eine engere Beziehung zu sich selber, zu ihren Mitmenschen und zu dem, was sie aus ihrem Leben machen wollen.
Wie lässt sich dieser Zustand erreichen? Nachdem ich zwanzig Jahre damit verbracht hatte, Medizin zu studieren und zu praktizieren, vor allem in großen Universitätskliniken der westlichen Welt, aber auch bei tibetischen Ärzten und indianischen Schamanen, habe ich einige wesentliche Einsichten gewonnen, die sich sowohl für meine Patienten wie auch für mich als hilfreich erwiesen haben. Zu meiner großen Überraschung waren es nicht die Methoden, die man mir an der Universität beigebracht hat: Es handelte sich weder um Medikamente noch um Psychoanalyse.
DER WENDEPUNKT
Nichts hatte mich auf diese Entdeckung vorbereitet. Meine Laufbahn als Mediziner hatte ich auf dem Umweg über Wissenschaft und Forschung begonnen. Nach Abschluss meines Studiums kehrte ich der Welt der medizinischen Praxis für fünf Jahre den Rücken und beschäftigte mich mit der Frage, wie die neuronalen Netze Gedanken und Gefühle hervorbringen. Auf dem Gebiet der neurokognitiven Wissenschaften promovierte ich unter der Ägide der Professoren Herbert Simon – einer der ganz wenigen Psychologen, der je einen Nobelpreis erhielt – und James McClelland, einer der Begründer der Theorie der Neuronengeflechte. Die wichtigsten Ergebnisse meiner Doktorarbeit wurden in Science veröffentlicht, der Fachzeitschrift, in der jeder Wissenschaftler seine Arbeiten gern abgedruckt sehen möchte.
Nach dieser streng wissenschaftlichen Ausbildung fiel es mir schwer, in die klinische Praxis zurückzukehren, um meine Facharztausbildung auf dem Gebiet der Psychiatrie abzuschließen. Die Ärzte, bei denen ich mein Metier erlernen sollte, schienen mir in ihrem Vorgehen zu ungenau, zu empirisch. Weit mehr als an der wissenschaftlichen Begründung dessen, was sie lehrten, waren sie an der Praxis interessiert. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, nur Routineverfahren zu lernen und wie man Rezepte ausstellt (bei der und der Krankheit macht man diese und jene Untersuchung, verschreibt die Medikamente A, B und C in dieser oder jener Dosierung so und so lange…) Meiner Ansicht nach war dies alles weit vom Geist des ständigen Hinterfragens und der mathematischen Genauigkeit entfernt, der mir mittlerweile vertraut war. Zur Beruhigung sagte ich mir immer wieder vor, dass ich die Behandlung von Kranken schließlich in der am strengsten forschungsorientierten Psychiatrieabteilung der Vereinigten Staaten erlernte. Innerhalb der medizinischen Fakultät der Universität Pittsburgh erhielt unsere Abteilung von der Regierung mehr Forschungsmittel als alle anderen, einschließlich des renommierten Fachbereichs für Herz- und Lebertransplantation an unserem Krankenhaus. Mit einer gewissen Arroganz betrachteten wir uns als »klinische Wissenschaftler« und nicht als einfache Psychiater.
Wenig später erhielt ich vom National Institute of Health und verschiedenen privaten Stiftungen finanzielle Mittel, die es mir ermöglichten, ein Forschungslabor für Geisteskrankheiten einzurichten. Viel versprechender hätte die Zukunft gar nicht aussehen können: Ich war mir sicher, meinen Hunger nach Fakten und Wissen stillen zu können. Doch in kurzer Zeit sollten einige Erlebnisse meine Sicht der Medizin völlig verändern und mein berufliches Leben umkrempeln.
Da war zunächst eine Reise nach Indien, um in Dharamsala, dem Wohnsitz des Dalai-Lama, mit tibetischen Flüchtlingen zu arbeiten. Dort sah ich die traditionelle tibetische Medizin am Werk, die »einen Verlust des seelischen Gleichgewichts« durch langes Abtasten des Pulses an beiden Handgelenken und eine Untersuchung der Zunge und des Urins diagnostiziert. Die praktischen Ärzte dort arbeiteten nur mit Akupunktur und pflanzlichen Mitteln. Dennoch hatten sie offensichtlich bei einer ganzen Reihe chronischer Krankheiten genauso viel Erfolg wie die abendländische Medizin. Zwei gewichtige Unterschiede gab es allerdings: Die Behandlungen hatten weniger Nebenwirkungen und kamen weit billiger. Als ich meine Tätigkeit als Psychiater überdachte, schien es mir, dass auch meine Patienten vor allem an chronischen Krankheiten litten: Depression, Angstgefühle und Beklemmungen, manisch-depressive Störungen, Stress … Zum ersten Mal begann ich mich zu fragen, warum man mir in meiner Studienzeit diese Verachtung der traditionellen Medizin eingebläut hatte. Gründete dies auf Tatsachen – wie ich immer geglaubt hatte – oder einfach auf Ignoranz? Die Erfolge der westlichen Medizin bei akuten Krankheiten wie Lungenentzündung, Blinddarmentzündung und Brüchen sind unerreicht. Doch bei der Behandlung chronischer Krankheiten, einschließlich Angstzuständen und Depressionen, ist sie alles andere als vorbildlich…
Dann zwang mich ein anderes Erlebnis eher persönlicher Art, mich meinen Vorurteilen zu stellen. Bei einem Besuch in Paris berichtete mir eine Freundin aus Kindertagen, sie habe eine depressive Phase überstanden, die so schlimm war, dass ihre Ehe daran zerbrach. Sie hatte die von ihrem Arzt vorgeschlagenen Medikamente abgelehnt und sich an eine Art Heilpraktikerin gewandt, die sie mittels einer Entspannungstechnik behandelte, die der Hypnose nahe kommt und es ermöglicht, alte, verdrängte Gefühle erneut zu durchleben. Nach einigen Monaten ging es ihr »besser denn je«. Nicht nur war sie ihre Depression los – endlich hatte sie sich von der Last der dreißig Jahre befreit, in denen es ihr nicht gelungen war, den Tod ihres Vater, als sie sechs Jahre alt gewesen war, zu betrauern. Plötzlich legte sie eine Energie, eine Leichtigkeit und Zielstrebigkeit an den Tag, wie ich sie bislang bei ihr nicht gekannt hatte. Ich freute mich für sie, war aber gleichzeitig entsetzt und enttäuscht. In all den Jahren, in denen ich das Gehirn, das Denken und die Gefühle untersucht hatte, um mich auf wissenschaftliche Psychologie, Neurowissenschaften, Psychiatrie und Psychotherapie zu spezialisieren, hatte ich nicht ein einziges Mal derart spektakuläre Heilerfolge erzielt. Und nicht ein einziges Mal war von dieser Art Therapie die Rede gewesen. Schlimmer noch: Die wissenschaftliche Welt, in der ich mich bewegte, entmutigte jegliches Interesse an derlei »ketzerischen« Methoden. Sie galten als Scharlatanerie und waren daher der Aufmerksamkeit wirklicher Ärzte nicht wert, noch viel weniger ihrer wissenschaftlichen Neugierde.
Dennoch, meine Freundin hatte innerhalb weniger Monate unbestreitbar mehr erreicht, als sie von einer medikamentösen oder konventionell-psychotherapeutischen Behandlung hätte erwarten können. In der Tat, hätte sie mich in meiner Eigenschaft als Psychiater aufgesucht, hätte ich ihre Chancen auf eine derartige Veränderung eher als gering eingestuft. Für mich war dies eine große Enttäuschung, doch gleichzeitig ein Ruf zur Ordnung. Wenn ich nach so vielen Studien- und Praktikumsjahren nicht fähig war, jemandem zu helfen, an dem mir so viel lag, wozu war dann dieses ganze Wissen gut? Im Lauf der nächsten Monate und Jahre lernte ich, zahlreichen anderen Behandlungsmethoden aufgeschlossener gegenüberzustehen, und zu meiner großen Überraschung erwiesen sie sich nicht nur als naturgemäßer und sanfter, sondern oft auch als wirksamer.
Jeder der sieben Ansätze, nach denen ich derzeit in meiner Praxis vorgehe, nutzt auf seine Art die Mechanismen der Selbstheilung, die im Geist und im menschlichen Gehirn angelegt sind. Diese sieben Vorgehensweisen wurden streng wissenschaftlichen Beurteilungen unterworfen, die ihre Wirksamkeit bewiesen, und waren Gegenstand zahlreicher Publikationen in internationalen wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Dennoch gehören sie immer noch nicht zum medizinischen Rüstzeug der westlichen Welt, nicht einmal auf dem Gebiet der Psychiatrie und Psychotherapie. Hauptgrund für diese Verzögerung ist die Tatsache, dass man die Mechanismen, auf denen ihre Wirksamkeit beruht, immer noch nicht so recht versteht. Für eine Medizin, die sich als wissenschaftlich versteht, ist dies ein gewichtiger, vielleicht sogar legitimer Hinderungsgrund. Gleichwohl nimmt die Nachfrage nach natürlichen und doch wirksamen Behandlungsmethoden stetig zu. Und dafür gibt es gute Gründe.
BILANZ
Die Bedeutung, die mit Stress verbundenen seelischen Störungen in der westlichen Gesellschaft zukommt – darunter Depressionen und Angstzustände –, ist allgemein bekannt. Die Zahlen sind alarmierend:
• Klinische Untersuchungen legen den Schluss nahe, dass hinter 50 bis 75 Prozent aller Arztbesuche vor allem Stress steht1I und dieser in Bezug auf die Sterblichkeit einen größeren Risikofaktor darstellt als Rauchen.2
• Tatsächlich zielt von den Medikamenten, die in den westlichen Ländern am häufigsten eingesetzt werden, die Mehrzahl auf die Behandlung von Störungen ab, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Stress stehen: Antidepressiva, Beruhigungs- und Schlafmittel, Antacida bei Sodbrennen und Magengeschwüren, Mittel gegen Bluthochdruck und solche gegen einen zu hohen Cholesterinspiegel.3
• Laut einem Bericht des Observatoire national du médicament stehen die Franzosen seit etlichen Jahren weltweit mit an der Spitze, was die Einnahme von Antidepressiva und Tranquilizern betrifft.4 Einer von sieben Franzosen schluckt regelmäßig ein Psychopharmakon; damit steht Frankreich an der Spitze aller westlichen Länder. Der Verbrauch ist hier sogar um 40 Prozent höher als in den USA. Der Einsatz von Antidepressiva hat sich bei uns im Lauf der letzten zehn Jahre verdoppelt.5 Zudem zählen die Franzosen zu den größten Alkoholkonsumenten der Welt; nun ist aber Alkohol ebenfalls eine Methode, um mit Problemen von Stress und Depression zurechtzukommen.
Während diese Probleme also stetig zunehmen, stellen die Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks, die unter ihnen leiden, die Eckpfeiler der traditionellen medizinischen Behandlung von Gefühlen in Frage: die Psychoanalyse einerseits, die Verschreibung von Medikamenten andererseits. Laut einer Harvard-Studie aus dem Jahre 1997 bevorzugt die Mehrheit der Amerikaner so genannte alternative und komplementäre Methoden gegenüber Medikamenten oder einer traditionellen Analyse, um ihre Leiden zu lindern.6
Die Psychoanalyse verliert an Boden. Nachdem sie dreißig Jahre lang die Psychiatrie dominiert hatte, verliert sie in der Öffentlichkeit wie auch bei Spezialisten immer mehr an Glaubwürdigkeit, da sie es versäumt hat, einen Beweis ihrer Wirksamkeit zu erbringen.7 Jeder von uns kennt jemanden, der aus einer analytischen Behandlung großen Nutzen gezogen hat, doch wir kennen auch viele andere, die sich seit Jahren auf ihrer Couch hin und her wälzen. Da keine wissenschaftlichen und quantifizierbaren Kriterien existieren, ist es sehr schwierig, einem Patienten, der unter einer Depression oder Angstanfällen leidet, mit Genauigkeit zu sagen, wie hoch die Chancen sind, dass sich sein Zustand durch eine Psychoanalyse bessert. Da konventionelle Psychoanalytiker oft erklären, eine Behandlung könne mehr als ein halbes Jahr, wenn nicht sogar Jahre dauern, und da sie oft mehr kostet als ein neues Auto, versteht man die Zurückhaltung potenzieller Patienten. Zwar werden die grundlegenden Prinzipien dieser »Redekur« nicht wirklich in Frage gestellt, aber schließlich ist es ganz normal, dass jeder in einer solchen Situation nach Alternativen fragt.
Der andere Weg, der bei weitem am häufigsten eingeschlagen wird, ist der der neuen, als biologisch bezeichneten Psychiatrie: Sie arbeitet hauptsächlich mit Psychopharmaka, etwa Fluctin (Prozac), Zyprexa, Zoloft, Seroxat, Adumbran, Tavil, Tavor, Hypnotex und so weiter. In den Medien wie auch in der Welt der Literatur bleibt die Psychoanalyse das vorherrschende Bezugssystem, da sie ein auf alle menschlichen Phänomene anwendbares Interpretationsraster liefert, ob man nun davon überzeugt ist oder nicht. In der tagtäglichen medizinischen Praxis jedoch dominieren Psychopharmaka, wie der Bericht des Observatoire national du médicament zeigt, nahezu uneingeschränkt. Der Reflex, zum Rezeptblock zu greifen, ist mittlerweile derart verbreitet, dass eine Patientin, die bei ihrem Arzt in Tränen ausbricht, beinahe mit Sicherheit ein Antidepressivum verschrieben bekommt.
Psychopharmaka können unglaublich hilfreich und wirksam sein. Gelegentlich so wirksam, dass manche Autoren wie Peter Kramer in seinem Bestseller »Glück auf Rezept« eher von einer Umwandlung der Persönlichkeit als von einer schlichten Linderung der Symptome sprechen.8 Wie alle praktizierenden Ärzte meiner Generation setze auch ich sie häufig ein. Doch im Gegensatz zu Antibiotika, die Infektionen heilen, wirken, wie immer mehr Untersuchungen beweisen, psychiatrische Medikamente nicht mehr, sobald man die Behandlung damit abbricht. Aus diesem Grund wird die Mehrheit der Patienten, die solche Medikamente einnehmen, länger als ein Jahr behandelt, und eine große Zahl erleidet nach Absetzen der Medikamente einen Rückfall.9 So hat beispielsweise eine an der Universität Harvard durchgeführte Untersuchung einer auf die Behandlung mit Psychopharmaka spezialisierten Arbeitsgruppe gezeigt, dass die Hälfte der Patienten nach Absetzen eines Antidepressivums innerhalb eines Jahres erneut entsprechende Symptome aufwiesen.10 Die Medikamente, selbst die wirksamsten, sind also bei weitem kein Allheil- oder Wundermittel für die emotionale Gesundheit. Im Grunde wissen die Patienten dies sehr wohl und nehmen sie daher bei Problemen, die Teil des Lebens eines jeden sind – ob es sich nun um einen Trauerfall oder um Stress in der Arbeit handelt –, oft nur widerwillig ein.
Abbildung 1: Das limbische Gehirn – Tief im Inneren des Gehirns befindet sich das emotionale Gehirn. Die so genannten limbischen Bereiche sind bei allen Säugetieren gleich und bestehen aus Nervengewebe, das sich von dem der für Sprache und Denken verantwortlichen Hirnrinde unterscheidet. Das limbische System ist für Gefühle und Überlebensreaktionen zuständig. Ganz zuunterst befindet sich der »Mandelkern«, die Amygdala, von der alle Angstreaktionen ausgehen.
EIN ANDERER ANSATZ
Nun bildet sich heute jedoch auf dem gesamten Erdball allmählich eine neue Medizin der Emotionen heraus: eine Medizin ohne Psychoanalyse und ohne Valium. So beschäftigen wir uns in der Shadyside-Klinik der Universität Pittsburgh seit fünf Jahren mit der Frage, wie man Depressionen, Angstzustände und Stress mit Hilfe einer Reihe von Methoden lindern kann, die eher auf den Körper als auf die Sprache zielen. In vorliegendem Buch beschreibe ich die verschiedenen Strategien dieses Programms, warum wir uns für sie entschieden haben und wie wir sie einsetzen.
Die Grundprinzipien lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
• Im Inneren des Gehirns befindet sich ein emotionales Gehirn, wahrhaft ein »Gehirn im Gehirn«. Es verfügt über eine andere Struktur, eine andere Zellenanordnung, und selbst seine biochemischen Eigenschaften unterscheiden sich von denen des übrigen »Neokortex« – das heißt, des am höchsten »entwickelten« Bereichs des Gehirns, der Großhirnrinde, in der die Sprache und das Denken angesiedelt sind. In der Tat funktioniert das emotionale Gehirn oft unabhängig vom Neokortex. Sprache sowie Wahrnehmung und Erkennung haben nur begrenzten Einfluss darauf: Man kann einem Gefühl nicht befehlen, stärker zu werden oder zu verschwinden, so wie man seinem Verstand befehlen kann, zu sprechen oder still zu sein.
• Das emotionale Gehirn kontrolliert seinerseits alles, was das psychische Wohlbefinden regelt, sowie einen Großteil der Körperphysiologie: die Herzfunktion, den Blutdruck, die Hormone, das Verdauungs- und sogar das Immunsystem.
• Probleme, die das Gefühlsleben betreffen, sind die Folge von Funktionsstörungen des emotionalen Gehirns, von denen viele ihren Ursprung in schmerzlichen Erlebnissen der Vergangenheit haben. Sie beziehen sich in keiner Weise auf die Gegenwart, haben sich jedoch dem emotionalen Gehirn unauslöschlich eingeprägt. Eben diese Erlebnisse kontrollieren oft weiterhin unser Empfinden und Verhalten, gelegentlich noch Jahrzehnte später.
• Hauptaufgabe des Psychotherapeuten ist es, das emotionale Gehirn auf eine Weise »umzuprogrammieren«, dass es sich an die Gegenwart anpasst, anstatt auf Situationen der Vergangenheit zu reagieren. Zu diesem Zweck ist es oft wirksamer, Methoden anzuwenden, die über den Körper gehen und das emotionale Gehirn unmittelbar beeinflussen, als sich auf die Sprache und die Vernunft zu verlassen, für die es kaum empfänglich ist.
• Das emotionale Gehirn verfügt über natürliche Mechanismen der Selbstheilung: die angeborene Fähigkeit, wieder zu Harmonie und Wohlbehagen zu finden; sie sind anderen Mechanismen der Selbstheilung des Körpers vergleichbar, etwa der Vernarbung einer Wunde oder der Überwindung einer Infektion. Verfahren, die auf den Körper einwirken, nutzen diese Mechanismen.
Die Behandlungsmethoden, die ich auf den folgenden Seiten darstelle, wenden sich unmittelbar an das emotionale Gehirn. Die Sprache umgehen sie nahezu ganz. Ihre Wirkungen erzielen sie eher über den Körper als über das Denken. Es gibt zahlreiche derartige Verfahren. In meiner klinischen Praxis bevorzuge ich solche, die durch strenge und glaubwürdige Untersuchungen wissenschaftlich überprüft wurden.
Jedes der nun folgenden Kapitel stellt also einen solchen Ansatz vor, veranschaulicht durch Berichte von Patienten, deren Leben sich durch diese Erfahrung verändert hat. Ebenso werde ich mich bemühen zu zeigen, wie jedes dieser Verfahren wissenschaftlich überprüft und seine heilsamen Auswirkungen bestätigt wurden. Einige wurden erst in jüngster Zeit entwickelt; sie bedienen sich der Spitzentechnologien, etwa des vor allem unter der amerikanischen Abkürzung EMDR bekannten Verfahrens zur »Desensibilisierung und Wiederherstellung mittels der Augenbewegungen« oder der Regulierung des Herzrhythmus, oder der »Synchronisierung chronobiologischer Rhythmen mittels Sonnenaufgangssimulation«. Andere Methoden wie Akupunktur, richtige Ernährung, emotionale Kommunikation sowie Techniken der sozialen Integration sind aus jahrtausendealten medizinischen Traditionen hervorgegangen. Doch was auch immer ihr Ursprung ist, alles beginnt bei den Gefühlen. Daher ist es nötig, zunächst einmal genauer zu erklären, auf welche Weise sie funktionieren.
I Anmerkungen und bibliographische Hinweise sind am Ende des Buches kapitelweise aufgeführt.
2 DAS UNBEHAGEN IN DER NEUROBIOLOGIE: DIE SCHWIERIGE HOCHZEIT ZWEIER GEHIRNE
Wir sollten uns davor hüten, den Intellektzu unserem Gott zu machen;Gewiss, er hat starke Muskeln, jedoch keine Persönlichkeit.Er darf nicht herrschen; nur dienen.
Albert Einstein
OHNE GEFÜHLE HAT DAS LEBEN KEINEN SINN. Was gibt denn unserer Existenz die Würze, wenn nicht die Liebe, die Schönheit, die Gerechtigkeit, die Wahrheit, die Würde, die Ehre und die Befriedigung, die sie uns schenken? Diese Empfindungen und die damit verbundenen Emotionen sind so etwas wie ein Kompass, der uns bei jedem Schritt die Richtung weist. Wir streben stets nach immer mehr Liebe, immer mehr Schönheit, immer mehr Gerechtigkeit und versuchen uns von ihrem jeweiligen Gegenpol zu entfernen. Der Gefühle beraubt, verlieren wir die wichtigsten Orientierungspunkte und sind nicht mehr fähig, entsprechend dem, was uns wirklich am Herzen liegt, Entscheidungen zu treffen.
Bestimmte Geisteskrankheiten äußern sich in einem solchen Kontaktverlust. Davon betroffene Patienten sind sozusagen in ein emotionales Niemandsland verbannt. Wie beispielsweise Peter, ein junger Kanadier griechischer Abstammung, der in der Notaufnahme meines Krankenhauses landete, als ich noch Assistenzarzt war.
Peter hörte seit einiger Zeit Stimmen. Sie sagten ihm, er sei eine lächerliche Figur, unfähig, und er täte besser daran zu sterben. Allmählich waren die Stimmen allgegenwärtig und das Verhalten Peters immer merkwürdiger geworden. Er wusch sich nicht mehr, weigerte sich zu essen und schloss sich manchmal etliche Tage hintereinander in seinem Zimmer ein. Seine allein stehende Mutter, mit der er zusammenlebte, kam fast um vor Sorgen, wusste aber nicht so recht, was tun. Außerdem war ihr Sohn – stets der Klassenbeste und im ersten Semester Philosophie ein brillanter Student – immer schon ein wenig exzentrisch gewesen.
Eines Tages hatte Peter, auf irgendetwas – was, wusste keiner – wütend, seine Mutter beschimpft und geschlagen. Sie hatte die Polizei rufen müssen, und so war Peter schließlich in der Notaufnahme des Krankenhauses gelandet. Unter der Einwirkung von Medikamenten hatte Peter sich weitgehend beruhigt. Die Stimmen waren nach einigen Tage praktisch verschwunden; er erklärte, er habe sie jetzt »unter Kontrolle«. Aber normal war er trotzdem nicht wieder geworden.
Nach einer mehrwöchigen Behandlung – antipsychotische Medikamente müssen über längere Zeit hinweg eingenommen werden – war seine Mutter fast genauso beunruhigt wie am ersten Tag. »Er empfindet überhaupt nichts mehr, Herr Doktor«, erklärte sie mit beinahe flehentlicher Stimme. »Sehen Sie ihn sich nur an. Er interessiert sich für nichts mehr, tut nichts mehr. Raucht nur noch den ganzen Tag.«
Während sie sich mit mir unterhielt, beobachtete ich Peter. Sein Anblick war Mitleid erregend. Leicht gekrümmt, mit starrem Gesicht und leerem Blick, rannte er mit großen Schritten durch den Gang der Ambulanz. Der einst so herausragende Student reagierte kaum mehr auf Signale aus der Außenwelt oder auf Menschen. Genau dieser Zustand der Gefühlsverarmung bei Patienten wie Peter löst in ihrem Umfeld oft Mitleid und Besorgnis aus. Seine Halluzinationen und Wahnvorstellungen – durch die Medikamente unterdrückt – waren jedoch weit gefährlicher für ihn und seine Mutter als diese Nebenwirkungen. Denn: keine Gefühle, kein Leben.I
Seinen Gefühlen uneingeschränkt freien Lauf zu lassen garantiert jedoch auch kein traumhaftes Leben. Sie müssen – und dafür sind die Denkfunktionen zuständig – unbedingt mittels rationaler Analyse den jeweiligen Umständen angepasst werden, denn jede unbedachte Entscheidung kann das komplizierte Gleichgewicht unserer Beziehungen zu anderen in Gefahr bringen. Ohne Konzentration, Überlegung und Planung werden wir nach dem Zufallsprinzip zwischen Vergnügen und Frustration hin und her gerissen. Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, unser Leben im Griff zu behalten, verliert es sehr schnell seinen Sinn.
DIE EMOTIONALE INTELLIGENZ
Am besten wird dieses Gleichgewicht zwischen Gefühl und Vernunft durch den Begriff der »emotionalen Intelligenz« definiert. Geprägt wurde er von Forschern der Universität Yale/New Hampshire1; seine Sternstunde erlebte er beim Erscheinen des Buches von Daniel Goleman, Wissenschaftsjournalist der New York Times, das weltweit für Aufsehen sorgte und die Diskussion über die Frage »Was ist Intelligenz« erneut entfachte.2 Die emotionale Intelligenz ist eine ebenso einfache wie wichtige Vorstellung. In ihrer ursprünglichen und allgemeinsten Definition durch den französischen Psychologen Alfred Binet, der Anfang des 20. Jahrhunderts den »Intelligenzquotienten« erfand, bedeutet Intelligenz die Gesamtheit der geistigen Fähigkeiten, die es erlauben, den künftigen Erfolg einer Person vorherzusagen. Im Prinzip müsste man also, je »intelligenter« man ist, das heißt, je höher der eigene IQ ist, desto mehr »Erfolg« haben. Um diese Voraussage zu überprüfen, entwickelte Binet ein als »Intelligenztest« berühmt gewordenes Verfahren. Dieser Test richtet sich hauptsächlich auf die Fähigkeiten zu Abstraktion und Flexibilität beim Umgang mit logischer Information. Allerdings stellte man fest: Das Verhältnis zwischen dem IQ einer Person und ihrem »Erfolg« im umfassenderen Sinn (gesellschaftliche Stellung, Verdienst, ob verheiratet oder nicht, Kinder oder nicht und so weiter) berücksichtigt er kaum. Laut diversen Untersuchungen lassen sich nur 20 Prozent dieses Erfolgs dem IQ zuschreiben. Dies legt folgenden Schluss nahe: Zu 80 Prozent beruht Erfolg auf anderen, ganz offensichtlich wichtigeren Faktoren als der abstrakten und logischen Intelligenz.
Schon Jung und Piaget hatten die Ansicht vertreten, dass es verschiedene Arten von Intelligenz gibt. Nicht zu leugnen ist, dass bestimmte Menschen – wie Mozart – auf dem Gebiet der Musik, andere – beispielsweise Rodin – was die Formgestaltung betrifft, und eine dritte Kategorie für die Bewegung ihres Körpers im Raum – man denke an Nurejew oder Michael Jordan – über eine bemerkenswerte Intelligenz verfügen. Die Forscher in Yale/New Hampshire entdeckten eine zusätzliche Form der Intelligenz: Sie gehört zum Verständnis und Umgang mit unseren Emotionen. Genau diese Form von Intelligenz, die »emotionale Intelligenz«, kann offenbar besser als jede andere den Erfolg im Leben erklären. Und sie ist weitgehend unabhängig vom Intelligenzquotienten.
1. Die Fähigkeit, seinen eigenen Gefühlszustand und den anderer zu erkennen;
2. die Fähigkeit, den natürlichen Ablauf von Gefühlen zu verstehen (ganz so wie ein Läufer oder ein Springer sich auf einem Schachbrett entsprechend den jeweiligen Regeln fortbewegen, verläuft beispielsweise bei Angst oder Zorn die Entwicklung in der Zeit unterschiedlich);
3. die Fähigkeit, über seine eigenen Gefühle und die anderer vernünftig nachzudenken und zu urteilen;
4. die Fähigkeit, mit seinen eigenen Gefühlen und denen anderer richtig umzugehen.3
Diese vier Fähigkeiten bilden die Grundlage von Selbstbeherrschung und gesellschaftlichem Erfolg. Sie liegen Selbsterkenntnis, Zurückhaltung, Mitfühlen, Kooperationsbereitschaft und der Fähigkeit zur Konfliktlösung zu Grunde. All dies erscheint elementar. Und jeder Einzelne ist überzeugt, alle vier Bereiche hervorragend zu beherrschen. Dies ist jedoch keineswegs der Fall.
Beispielsweise erinnere ich mich an eine junge, brillante Forscherin an der medizinischen Fakultät in Pittsburgh. Sie hatte eingewilligt, an einem Experiment zur Lokalisierung von Gefühlen im Gehirn teilzunehmen, das ich in meinem Labor durchführen wollte. Bei dieser Untersuchung unterzogen sich mehrere Personen einer Kernspintomographie und wurden zu diesem Zweck in einen entsprechenden Apparat geschoben; man führte ihnen Filmausschnitte mit sehr schrillen Bildern vor, die oft Gewalttätigkeiten zeigten. An dieses Experiment erinnere ich mich lebhaft, da ich selber einen ausgesprochenen Widerwillen gegen derlei Filme empfand, einfach weil ich sie immer wieder ansehen musste. Die junge Frau wurde also in den Scanner geschoben; von Beginn des Experiments an sah ich, wie ihr Herzrhythmus und der Arteriendruck schlagartig anstiegen; dies wies auf eine starke emotionale Belastung hin. Ich fand das beunruhigend, und zwar so sehr, dass ich ihr vorschlug, das Experiment abzubrechen. Erstaunt erklärte sie, es gehe ihr sehr gut, sie empfinde gar nichts, die Bilder machten keinerlei Eindruck auf sie; sie verstehe nicht, warum ich einen Abbruch vorschlage!
Wie ich in der Folgezeit erfuhr, hatte die junge Frau sehr wenig Freunde und lebte nur für ihre Arbeit. Meiner Gruppe war sie unsympathisch, auch wenn keiner wirklich wusste, warum eigentlich. Weil sie zu oft nur von sich selber sprach und den Menschen in ihrer Umgebung gleichgültig gegenüberstand? Ihrerseits verstand sie überhaupt nicht, warum ihr keine höhere Wertschätzung entgegengebracht wurde. In meinen Augen ist und bleibt sie das Paradebeispiel für einen Menschen, bei dem der IQ sehr hoch, der »EQ« jedoch erbärmlich niedrig ist. Ihr Hauptmangel war offenbar, dass sie sich in keiner Weise ihrer Gefühle bewusst und daher für die Gefühle anderer »taub« war. Hinsichtlich ihrer Karriere sah ich ziemlich schwarz. Selbst in den wissenschaftlichsten Disziplinen muss man im Team arbeiten, Bündnisse schließen, seinen Mitarbeitern die richtigen Vorgaben liefern und so weiter. Gleichgültig, auf welchem Gebiet man tätig ist, immer hat man es auch mit anderen Menschen zu tun. Das ist unvermeidlich. Und auf lange Sicht entscheidet unsere Begabung für diese Art von Beziehungen über unseren Erfolg.
Besonders gut veranschaulicht das Verhalten von Kleinkindern, wie schwierig es sein kann, verschiedene Gefühlszustände zu unterscheiden. Meistens weiß ein kleines Kind nicht genau, warum es weint, ob ihm zu heiß ist, ob es Hunger hat, ob es traurig ist oder einfach weil es nach einem langen, mit Spielen verbrachten Tag müde ist. Es weint, ohne genau zu wissen, warum, und weiß auch nicht, was es machen muss, um sich besser zu fühlen. In einer solchen Situation fühlt ein Erwachsener, dessen emotionale Intelligenz unterentwickelt ist, sich leicht überfordert, weil er das Gefühl des Kindes nicht identifizieren, folglich auch nicht auf sein Bedürfnis reagieren kann. Andere Personen, die über eine höher entwickelte emotionale Intelligenz verfügen, wissen hingegen, was zu tun ist, um ein Kind ohne große Schwierigkeiten zu beruhigen. So wird oft Françoise Dolto beschrieben, die sich darauf verstand, mit einer einzigen Geste oder einem einzigen Wort ein Kind zu beruhigen, das seit Tagen weinte: eine Virtuosin der emotionalen Intelligenz.
Bei Erwachsenen ist eine solche Unfähigkeit, klar zwischen verschiedenen Gefühlszuständen zu unterscheiden, gar nicht so selten. Ich habe sie bei einigen Assistenzärzten in meinem Krankenhaus in den USA festgestellt. Sie standen unter Stress, weil ihre Arbeitstage schier endlos waren, waren erschöpft vom Nachtdienst, der jeden vierten Tag fällig war, und kompensierten das durch viel zu viel Essen. Wenn also ihr Körper ihnen signalisierte, »Ich brauche eine Pause und ein wenig Schlaf«, dann hörten sie nur, »Ich brauche«, und reagierten auf diesen Wunsch mit dem einzigen, das sofort verfügbar ist: dem Fastfood, das in jedem amerikanischen Krankenhaus rund um die Uhr zu kriegen ist. In einer solchen Situation eine emotionale Intelligenz an den Tag zu legen bedeutet, die von der Forschergruppe in Yale beschriebenen vier Fähigkeiten einzusetzen: zunächst den jeweiligen Zustand zu identifizieren (Müdigkeit, nicht Hunger), den Ablauf zu kennen (das kommt und geht den lieben langen Tag so, wenn man zu viel von seinem Organismus fordert; ein wenig später wird es einem zweifelsohne besser gehen), nachzudenken (es bringt überhaupt nichts, wenn ich jetzt noch ein Eis esse; im Gegenteil, das wäre nur eine zusätzliche Belastung für meinen Organismus, und darüber hinaus hätte ich ein schlechtes Gewissen) und schließlich auf angemessene Weise auf die Situation zu reagieren (indem man lernt, wie man den Müdigkeitsanfall vorbeigehen lässt, oder indem man eine »Meditationspause«, vielleicht sogar eine Siesta von zwanzig Minuten einlegt; dafür findet man immer die notwendige Zeit, und es gibt einem mehr neue Kraft als der x-te Kaffee oder eine halbe Tafel Schokolade).
Dieser Fall mag trivial erscheinen, aber die Situation ist eben deswegen interessant, weil sie zwar schrecklich banal, gleichzeitig aber äußerst schwer zu meistern ist. Die meisten Spezialisten für Ernährung und Fettleibigkeit sind sich in einem Punkt einig: Einer der Hauptgründe für eine Gewichtszunahme ist in einer Gesellschaft, in der Stress allgegenwärtig ist und viel zu oft mit Essen darauf reagiert wird, dass man nur schlecht mit seinen Gefühlen zurechtkommt. Diejenigen, die gelernt haben, mit Stress umzugehen, haben normalerweise keine Gewichtsprobleme, denn sie haben auch gelernt, auf ihren Körper zu hören, ihre Gefühle zu erkennen und intelligent darauf zu reagieren.
Golemans These lautet, dass der richtige Umgang mit der emotionalen Intelligenz ein besseres Unterpfand für Erfolg im Leben ist als der IQ. Im Rahmen einer der bemerkenswertesten Untersuchungen zu der Frage, was eine Voraussage von Erfolg ermöglicht, beobachteten Psychologen nahezu hundert Harvard-Studenten seit den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts.4 Ihre intellektuellen Leistungen in Alter von zwanzig Jahren ermöglichten in keinster Weise eine Voraussage, wie hoch ihr zukünftiges Gehalt sein werde, welche Leistungsfähigkeit sie später an den Tag legen und in welchem Maße sie von ihren Kollegen anerkannt würden. Bei denjenigen, die an der Universität die besten Noten gehabt hatten, war das Familienleben keineswegs am harmonischsten, und sie hatten durchaus nicht die meisten Freunde. Ganz im Gegenteil: Eine Studie zu Kindern in einem armen Vorort von Boston legt den Schluss nahe, dass der »Gefühlsquotient« eine große Rolle spielt – am besten sagte nicht der IQ ihren Erfolg als Erwachsene voraus, sondern ihre Fähigkeit, im Verlauf einer schwierigen Kindheit ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten, angemessen auf ihre Benachteiligung zu reagieren und mit den anderen zusammenzuarbeiten.5
JENSEITS VON FREUD UND DARWIN:DIE DRITTE REVOLUTION IN DER PSYCHOLOGIE
Zwei große Theorien beherrschten die Psychologie des 20. Jahrhunderts: die Darwinsche und die von Freud. Es dauerte fast hundert Jahre, bis ihre Zusammenführung jetzt zu einer völlig neuen Betrachtungsweise der emotionalen Balance führt.
In den Augen Darwins schreitet die Evolution einer Spezies durch die sukzessive Hinzufügung neuer Strukturen und Funktionen voran. Jeder Organismus hat daher die körperlichen Merkmale seiner Vorfahren und zusätzlich einige andere. Da die Trennung der Entwicklungslinien des Menschen und der Menschenaffen im Rahmen der Evolution der Spezies erst sehr spät erfolgte, ist der Mensch in gewisser Hinsicht die »verbesserte Ausgabe eines Menschenaffen«II. Der Menschenaffe seinerseits hat zahlreiche Eigenschaften mit allen anderen Säugetieren gemein, die einen gemeinsamen Vorfahren haben, und so geht es die ganze lange Kette der Evolution hinunter.
Wie bei archäologischen Grabungen lässt sich diese sukzessive Evolution in Anatomie und Physiologie des menschlichen Gehirns schichtenweise nachvollziehen. Die tief liegenden Strukturen des Gehirns sind mit denen der Menschenaffen, bestimmte, nämlich die am tiefsten liegenden, sogar mit denen von Reptilien identisch. Im Gegensatz dazu sind die Strukturen aus der jüngsten Evolutionsphase, etwa der präfrontale Kortex (hinter der Stirn) nur beim Menschen derart hoch entwickelt. Aus diesem Grund unterscheidet die vorgewölbte Stirn das Gesicht des Homo sapiens so klar und deutlich von dem seiner den Menschenaffen am nächsten verwandten Vorfahren. Was Darwin verkündete, war dermaßen revolutionär und beunruhigend, dass die entsprechenden Schlussfolgerungen erst gegen Mitte des 20. Jahrhunderts wirklich akzeptiert wurden: Wir sind dazu verdammt, mit einem Gehirn im Inneren unseres Gehirns zu leben, das dem der in der Evolutionsreihe unter uns stehenden Tiere entspricht.
Freud seinerseits betonte die Existenz eines Teilbereichs des psychischen Lebens, den er als »das Unbewusste« bezeichnete und folgendermaßen definierte: das, was sich nicht nur der bewussten Beachtung, sondern darüber hinaus auch der Vernunft entzieht. Von der Ausbildung her Neurologe, konnte Freud sich nie dazu entschließen, die Vorstellung zu akzeptieren, dass seine Theorien sich möglicherweise nicht in Begriffen von Gehirnstrukturen und -funktionen erklären ließen. Da er nicht über dasselbe Wissen hinsichtlich der Anatomie des Gehirns (seiner Architektur) und vor allem seiner Physiologie (seiner Funktionsweise) verfügte wie wir heutzutage, war es ihm unmöglich, auf diesem Weg weiterzukommen. Sein Versuch, die beiden Bereiche miteinander in Einklang zu bringen – sein berühmter »Entwurf für eine wissenschaftliche Psychologie« –, endete mit einem Misserfolg. So unzufrieden war er damit, dass er sich weigerte, ihn zu seinen Lebzeiten zu veröffentlichen. Dennoch dachte er ständig daran. Ich erinnere mich an eine Begegnung mit Dr. Wortis, einem berühmten Psychiater, den Freud analysiert hatte. Er war fünfundachtzig, aber im Rahmen der wichtigsten Zeitschrift der biologischen Psychiatrie, Biological Psychiatry, die er begründet hatte, immer noch sehr aktiv. Er erzählte mir, wie Freud, dem er Anfang der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts in Wien einen Besuch abstattete, ihn mit seiner Hartnäckigkeit überrascht hatte: »Geben Sie sich nicht damit zufrieden, sich die heutige Ausformulierung der Psychoanalyse anzueignen. Die ist bereits überholt. Ihre Generation wird erleben, dass sich eine Synthese zwischen Psychologie und Biologie herstellt. Das ist es, worauf Sie sich konzentrieren sollten.« Während die ganze Welt allmählich seine Theorien und seine »Redekur« entdeckte suchte Freud, immer ein Pionier, schon ganz woanders…
Ende des 20. Jahrhunderts lieferte Antonio Damasio, ein Amerikaner portugiesischer Herkunft und ein großer Arzt und Forscher, eine neurologische Erklärung der beständigen Spannung zwischen dem primitiven und dem rationalen Gehirn – zwischen den Leidenschaften und der Vernunft –, und zwar in Begriffen, mit denen Freud bestimmt einverstanden gewesen wäre. Damasio ging noch weiter und zeigte darüber hinaus, inwiefern Gefühle für die Vernunft schlicht unentbehrlich sind.
DIE ZWEI GEHIRNE:DAS KOGNITIVE UND DAS EMOTIONALE
In den Augen Damasios ist das psychische Leben das Ergebnis eines fortwährenden Versuchs einer Symbiose zwischen den beiden Gehirnen. Auf der einen Seite ein kognitives Gehirn: bewusst, rational und der Außenwelt zugewandt. Andererseits ein emotionales Gehirn: unbewusst, zuvörderst aufs Überleben bedacht und vor allem: in engem Kontakt mit dem Körper. Diese beiden Gehirne sind relativ unabhängig voneinander und beeinflussen jedes auf sehr unterschiedliche Weise unsere Lebenserfahrung sowie unser Verhalten. Wie Darwin vorausgesagt hatte, umfasst das Gehirn zwei große Teilbereiche: Im Innersten, ganz in der Mitte, befindet sich das uralte Gehirn, das uns und allen Säugetieren, in gewissen Teilen auch den Reptilien, gemeinsam ist. Dies ist die erste Schicht, die im Verlauf der Evolution abgelagert wurde. Der große französische Neurologe des 19. Jahrhunderts, Paul Broca, der sie als Erster beschrieb, gab ihr den Namen »limbisches« Gehirn.6 Um dieses limbische Gehirn herum hat sich im Verlauf von Jahrmillionen der Evolution eine jüngere Schicht gebildet, das »neue« Gehirn oder der »Neokortex«, was im Lateinischen »neue Rinde« oder »neue Schale« oder »neue Umhüllung« bedeutet (siehe Abbildung 2 im Bildteil).
Das limbische Gehirn kontrolliert die Gefühle und die Körperphysiologie
Das limbische Gehirn besteht aus den am tiefsten liegenden Schichten des menschlichen Gehirns. Es handelt sich in der Tat um »ein Gehirn im Gehirn«. Ein in meinem Labor für neurokognitive Wissenschaft an der Universität Pittsburgh aufgenommenes Foto veranschaulicht dies (siehe Abbildung 3 im Bildteil). Injiziert man Freiwilligen eine Substanz, die unmittelbar den tief liegenden, für die Angst zuständigen Bereich des Gehirns stimuliert, sieht man, wie das emotionale Gehirn aktiv wird – beinahe wie eine aufleuchtende Glühlampe –, während sich darum herum im Neokortex keinerlei Aktivität feststellen lässt.
Im Verlauf der Untersuchung, auf die diese Illustration zurückgeht, ließ ich mir als Erster die Substanz injizieren, die das emotionale Gehirn direkt aktiviert. Sehr gut erinnere ich mich an die seltsame Empfindung, die ich danach hatte: Ich verspürte entsetzliche Angst, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben, warum. Es war eine Erfahrung »reiner« Angst, einer Angst, die sich mit nichts Bestimmtem verband. In der Folge beschrieben zahlreiche Teilnehmer an dem Experiment das gleiche merkwürdige Gefühl intensiver, »aufwallender« Angst, das glücklicherweise nur einige Minuten anhielt.7
Die Organisation des emotionalen Gehirns ist weit einfacher als die des Neokortex. Im Unterschied zu dem, was in Letzterem abläuft, ist die Mehrzahl der Bereiche des limbischen Gehirns nicht in regelmäßigen Neuronenschichten angeordnet, die eine Verarbeitung von Information ermöglichen; vielmehr sind die Nervenzellen hier miteinander verschmolzen. Infolge dieser weit rudimentäreren Struktur ist die Informationsverarbeitung durch das emotionale Gehirn viel primitiver als die im Neokortex. Doch sie läuft schneller ab und ist in höherem Maße für elementare Überlebensreaktionen geeignet. Aus diesem Grund kann beispielsweise im Halbschatten eines Waldes ein Stück Holz, das auf dem Boden liegt und einer Schlange gleicht, eine Angstreaktion auslösen. Noch ehe das übrige Gehirn die Analyse abschließen und zu dem Schluss kommen kann, dass es sich um etwas Harmloses handelt, hat das emotionale Gehirn, ausgehend von sehr bruchstückhaften und oft sogar falschen Informationen, bereits die Überlebensreaktion ausgelöst, die ihm am geeignetsten erschien.8
Selbst das Gewebe des emotionalen Gehirns unterscheidet sich von dem des Neokortex. Wenn ein Virus – etwa ein Herpes- oder ein Tollwutvirus – das Gehirn angreift, wird lediglich das tief liegende Gehirn infiziert, nicht aber der Neokortex. Aus diesem Grund macht Tollwut sich als Erstes durch ein ausgesprochen anormales emotionales Verhalten bemerkbar.
Das limbische Gehirn ist ein Kommandoposten, der fortwährend Informationen aus verschiedenen Körperbereichen erhält und darauf entsprechend reagiert, indem es das physiologische Gleichgewicht kontrolliert: Die Atmung, der Herzrhythmus, der Blutdruck, der Appetit, der Schlaf, die Libido, die Ausschüttung von Hormonen und selbst das Immunsystem unterliegen seinen Befehlen. Aufgabe des limbischen Gehirns ist es offenbar, die verschiedenen Funktionen im Gleichgewicht zu halten, in jenem Zustand also, den der Vater der modernen Physiologie, der Ende des 19. Jahrhunderts wirkende französische Gelehrte Claude Bernard, als Homöostase bezeichnete: das dynamische Gleichgewicht, das uns am Leben hält.
Aus diesem Blickwinkel sind unsere Emotionen nichts anderes als das bewusste Erleben eines großen Zusammenspiels physiologischer Reaktionen, die die Aktivität der biologischen Systeme des Körpers überwachen und ständig den Notwendigkeiten der inneren und äußeren Umgebung anpassen.9 Das emotionale Gehirn kennt daher den Körper viel besser als das kognitive Gehirn. Aus diesem Grund kommt man oft leichter über den Körper als über die Sprache an die Gefühle heran.
Marianne beispielsweise machte seit zwei Jahren eine konventionelle freudsche Psychoanalyse. Sie legte sich auf die Couch und tat ihr Bestes, um zu Themen, die ihr zu schaffen machten, »frei zu assoziieren«; hauptsächlich ging es um ihre gefühlsmäßige Abhängigkeit von Männern. Immer hatte sie das Gefühl, sie lebe nur dann wirklich und voll und ganz, wenn ein Mann ihr immer wieder sagte, dass er sie liebe; Trennungen ertrug sie nur schlecht, selbst die kürzesten; sie hinterließen in ihr ein diffuses Angstgefühl, wie bei einem kleinen Mädchen. Nach zwei Jahren Analyse verstand Marianne ihr Problem sehr genau. In allen Einzelheiten konnte sie die schwierige Beziehung zu ihrer Mutter beschreiben, die sie oft anonymen Pflegemüttern anvertraut hatte; sie sagte sich, das erkläre doch mit Sicherheit ihr ständiges Gefühl des Ausgeliefertseins. Mit ihrem an einer Eliteuniversität geschulten Verstand hatte sie sich die Analyse ihrer Symptome und die Art und Weise, wie sie diese in ihrer Beziehung zu ihrem Analytiker – von dem sie natürlich ungemein abhängig geworden war – noch einmal durchlebte, bewusst gemacht. Sie hatte große Fortschritte erzielt, fühlte sich viel freier, auch wenn es ihr im Rahmen der Analyse nie gelungen war, den Schmerz und die Traurigkeit ihrer Kindheit noch einmal zu durchleben. Da sie ständig auf ihre Gedanken und die Sprache fixiert war, hatte sie, wie ihr jetzt klar wurde, auf der Couch nie geweint. Zu ihrer großen Überraschung hatte sie ausgerechnet bei einer Masseurin und im Rahmen einer eine Woche dauernden Thalassotherapie plötzlich zu ihren Gefühlen zurückgefunden. Dabei lag sie auf dem Rücken, und die Masseurin behandelte behutsam den Bauch. Als sie nahe an einen ganz bestimmten Punkt unterhalb des Nabels kam, spürte Marianne, wie ein Schluchzer in ihr aufstieg. Die Masseurin bemerkte dies und forderte sie auf, einfach darauf zu achten, was sie jetzt spürte; dann massierte sie mit kreisenden Bewegungen genau an dieser Stelle weiter. Einige Sekunden später wurde Marianne am ganzen Körper von heftigen Schluchzern geschüttelt. Sie lag wieder im Alter von sieben Jahren nach einer Blinddarmoperation auf einem Untersuchungstisch in einem Krankenhaus, allein, weil ihre Mutter nicht aus dem Urlaub zurückgekommen war, um sich um sie zu kümmern. Dieses Gefühl, das sie lange in ihrem Kopf gesucht hatte, war stets da gewesen, versteckt in ihrem Körper.
Auf Grund seiner engen Beziehung zum Körper ist es oft leichter, über den Körper auf das emotionale Gehirn einzuwirken als über die Sprache. Sicher, Medikamente greifen unmittelbar in das Funktionieren der Nervenzellen ein, doch man kann auch rein körperliche physiologische Rhythmen aktivieren, etwa die Augenbewegungen, wenn man träumt, die natürlichen Schwankungen der Herzfrequenz, den Schlafzyklus und sein Verhältnis zum Tag-/Nachtrhythmus, oder man arbeitet mit Gymnastik und Bewegung, mit Akupunktur und Ernährung. Wie wir noch sehen werden, haben Gefühlsbeziehungen und sogar die Beziehung zu anderen Menschen – eben weil wir in einer Gemeinschaft leben – eine starke physische Komponente: Man erlebt sie körperlich. Dieser Zugang zum emotionalen Gehirn ist direkter und oft wirksamer als jener über das Denken und die Sprache.
Die Großhirnrinde reguliert Wahrnehmung, Sprache und Denken
Die gefältelte Oberfläche des Neokortex, der »neuen Rinde«, gibt dem Gehirn sein charakteristisches Aussehen. Zugleich umhüllt er das emotionale Gehirn; er befindet sich an der Oberfläche, da er unter evolutionärem Blickwinkel die jüngste Schicht ist. Er besteht aus sechs Neuronenlagen, wie in einem Mikroprozessor vollkommen regelmäßig angeordnet und auf die optimale Verarbeitung von Information ausgerichtet.
Und genau diese Strukturiertheit verleiht dem Gehirn seine außergewöhnliche Fähigkeit, Information zu verarbeiten. Während man sich heute noch abmüht, Computer so zu programmieren, dass sie bei allen Lichtverhältnissen und unter allen Blickwinkeln ein menschliches Gesicht erkennen, gelingt dies dem Neokortex ohne jede Schwierigkeit, und zwar innerhalb weniger Millisekunden. Beim Hören ermöglichen es ihm seine vielfältigen Fähigkeiten zur Klangverarbeitung, schon vor der Geburt zwischen der Muttersprache und jeder Fremdsprache zu unterscheiden!10
Beim Menschen ist der Bereich des Neokortex, der sich hinter der Stirn und oberhalb der Augen befindet und als »präfrontaler Kortex« bezeichnet wird, besonders hoch entwickelt. Während das emotionale Gehirn bei allen Spezies etwa gleich groß ist (selbstverständlich in Relation zur Körpergröße), nimmt der präfrontale Kortex beim Menschen verhältnismäßig weit mehr Platz im Gehirn ein als bei allen anderen Lebewesen.
Über den präfrontalen Kortex steuert der Neokortex Achtsamkeit, Konzentration, Hemmung oder Unterdrückung von Impulsen und Instinkten sowie die sozialen Beziehungen und sogar, wie Damasio gezeigt hat, das moralische Verhalten. Vor allem bestimmt er, ausgehend von »Symbolen«, die nur im Geist vorhanden sind – das heißt, man hat die Information nicht vor Augen oder in Händen –, die Planung der Zukunft. Achtsamkeit, Konzentration, Überlegung, moralisches Verhalten: Der Neokortex, unser kognitives Gehirn, stellt eine wesentliche Komponente unseres Menschseins dar.
WENN DIE BEIDEN GEHIRNE NICHTMITEINANDER ZURECHTKOMMEN
Die beiden Gehirne, das emotionale und das kognitive, nehmen die von der Außenwelt kommende Information nahezu gleichzeitig auf. Danach können sie entweder gut zusammenarbeiten oder aber einander die Kontrolle über Denken, Gefühle und Verhalten streitig machen. Das Resultat dieser Interaktion – Kooperation oder Konkurrenz – bedingt, was wir fühlen, und bestimmt unser Verhältnis zur Welt und zu anderen Menschen. Die verschiedenen Formen von Rivalität zwischen beiden Gehirnen machen uns unglücklich. Ergänzen sich hingegen emotionales und kognitives Gehirn und gibt das eine die Richtung vor, wie wir unser Leben gestalten wollen (das emotionale), während das andere uns dazu bringt, so klug wie möglich in eben dieser Richtung vorwärts zu gehen (das kognitive), verspüren wir eine innere Harmonie – »Ich bin genau da, wo ich in meinem Leben sein möchte«–, die jeglichem dauerhaften Wohlbefinden zu Grunde liegt.
Emotionale Kurzschlusshandlungen
Die Evolution setzte Prioritäten. Evolution ist vor allem eine Frage des Überlebens und der Weitergabe unserer Gene von einer Generation an die nächste. Zu welcher Vielschichtigkeit das Gehirn sich im Lauf mehrerer Jahrmillionen auch entwickelt hat, wie erstaunlich seine Fähigkeiten zur Konzentration, Abstraktion, Selbstreflexion auch sind: Hätten diese verhindert, dass wir einen Tiger oder einen Feind wahrnehmen, oder dazu geführt, dass wir einen geeigneten Sexualpartner einfach übersehen und damit eine Gelegenheit verpassen, uns zu reproduzieren, dann wäre unsere Spezies schon längst ausgestorben. Glücklicherweise ist das emotionale Gehirn immer wachsam. Seine Aufgabe ist es, aus dem Hintergrund die Umgebung zu überwachen. Sobald es eine Gefahr oder aber eine außergewöhnlich gute Gelegenheit (vom Blickpunkt des Überlebens aus) entdeckt – einen möglichen Partner, ein Territorium, irgendetwas Nützliches –, löst es augenblicklich einen Alarm aus, der binnen weniger Millisekunden sämtliche Vorgänge im kognitiven Gehirn storniert und seine Tätigkeit unterbricht. Das ermöglicht es dem Gehirn als Ganzem, sich unverzüglich auf das zu konzentrieren, was für das Überleben von wesentlicher Bedeutung ist. Beim Auto fahren lässt dieser Mechanismus uns unbewusst einen Lastwagen, der auf uns zu kommt, wahrnehmen, selbst wenn wir uns gerade angeregt mit unserem Beifahrer unterhalten. Das emotionale Gehirn erkennt die Gefahr und bündelt unsere Aufmerksamkeit, bis diese vorüber ist. Es ist auch dafür verantwortlich, wenn das Gespräch zwischen zwei Männern auf der Terrasse eines Cafés plötzlich stockt, weil ein verführerischer Minirock durch ihr Gesichtsfeld tänzelt. Und es lässt Eltern in einem Park verstummen, wenn sie aus den Augenwinkeln bemerken, wie ein unbekannter Hund sich ihrem Kind nähert.