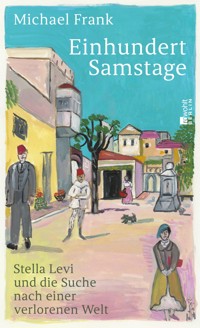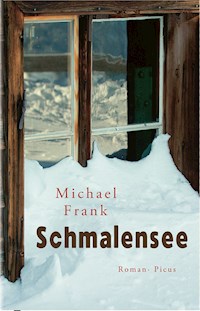Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Odenwald-Saga handelt von dem frühberenteten Karl Pardonner, der in dem fiktiven Dorf Lindental im Odenwald lebt. Dort schlägt er sich mit privaten Gärtner- und Handwerkerarbeiten durchs Leben. Pardonner ist bei weiten Teilen der Bevölkerung gut gelitten, auch wenn er ein "Roter" ist, der nur in den seltensten Fällen seine große Klappe halten kann, gerade wenn es um Politik geht. Dieses Manko macht er durch geschicktes Arbeiten, soziales Verhalten, honorige Preise, seine Sangeskunst und sein umgängliches Wesen wieder wett. Gram ist ihm nur die politische Konkurrenz, die er bisweilen heftig attackiert. Auch am evangelischen Pfarrer Wohlleben, einem seiner Arbeitgeber, reibt er sich gerne, im Gegensatz zu dem Gemeindeältesten der Lindentaler Freikirche Hans Bermond, den er im Stillen verehrt. In der Odenwald-Saga begleiten wir den roten Pardonner Karl durch den Heiligabend 2022 von morgens 3 Uhr 30 bis kurz nach Mitternacht, der einiges an Überraschungen für ihn parat halten wird – guten und schlechten. In dieser Zeit trifft er auf eine Menge Einheimische, aber auch Darmstädter, da er in Darmstadt seine Christtagsfreude einzukaufen gedenkt. Dass dieser Tag ganz anders verlaufen wird als von Pardonner vorgesehen, fällt nicht allzu sehr ins Gewicht, da es letzten Endes ein großer, ein historischer Tag für ihn werden wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 849
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE ODENWALD - SAGA
ALS DER ODENWÄLDER PARDONNER KARL IN
DARMSTADT CHRISTAGSFREUDE HOLEN GING.
Ein satirisch-politischer Heimatroman aus unserer Zeit.
Von J. Michael Frank
Silke gewidmet
Die Odenwald-Saga verdankt ihre Entstehung der Bibel, Arthur Schopenhauer, Ortegas „Der Aufstand der Massen“, David Prechts „Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens“ sowie dem Odenwald und seiner Bevölkerung.
Te h’ominem esse mem’to!
IN MEMORIAN H.K. t 2017
Einige der Protagonisten der Odenwald-Saga in kunterbunter Reihenfolge.
Nicola Brude Leiterin der Antiwindkraft-Bewegung „Gegenwind“
Hans Bermond Gemeindevorsteher der Freikirche Lindentals
Dr. Leemann philosophierender Hausarzt
Albrecht Pfennigreiter Großbauer und Original, CDU-Mitglied
Alma Geheimnisvolle Dorfschönheit und Heilerin
Bickel Gastwirt des „Löwen“ und Original
Nicklas Wunderlicher Holzmagnat Lindentals, SPD-Mitglied
Anna Lantelme alte, nörgelnde Hausfrau und Witwe mit gutem Herz
Fischer-Kleejs Dorftrottel und Genie
Susanna Hildenbrand Leiterin des Corona-Widerstandes
Jakob Barthalot Waldenser, Gärtner, Imker,
Paul Bak Rentner, AfD - Sympathisant
Der schöne Heinz reicher Müßiggänger und zynischer Dorfflaneur
Pardonner Karl Frührentner, bekennender Roter
„Ritschi“ Reeg verhinderter Revolutionär
Ewald Blüm Autohausbesitzer, Schulkumpel Pardonners
Wohlleben linksliberaler Dorfpfarrer
Wilhelm Arras mittelloser Rentner
Hidde-Kid Dorfasozialer, Schläger
Waldemar Wipfler SPD-Ortsgruppenleiter
Helga von Stein Hausfrau, typisch besserwisserische Deutsche
Schorsch Schubkegel Granitwerkbesitzer, Original
Einführung:
Die Odenwald-Saga handelt von dem frühberenteten Karl Pardonner, der in dem fiktiven Dorf Lindental im Odenwald lebt. Dort schlägt er sich mit privaten Gärtner- und Handwerkerarbeiten durchs Leben.
Pardonner ist bei weiten Teilen der Bevölkerung gut gelitten, auch wenn er ein „Roter“ ist, der nur in den seltensten Fällen seine große Klappe halten kann, gerade wenn es um Politik geht. Dieses Manko macht er durch geschicktes Arbeiten, soziales Verhalten, honorige Preise, seine Sangeskunst und sein umgängliches Wesen wieder wett. Gram ist ihm nur die politische Konkurrenz, die er bisweilen heftig attackiert. Auch am evangelischen Pfarrer Wohlleben, einem seiner Arbeitgeber, reibt er sich gerne, im Gegensatz zu dem Gemeindeältesten der Lindentaler Freikirche Hans Bermond, den er im Stillen verehrt.
In der Odenwald-Saga begleiten wir den roten Pardonner Karl durch den Heiligabend 2022 von morgens 3 Uhr 30 bis kurz nach Mitternacht, der einiges an Überraschungen für ihn parat halten wird – guten und schlechten. In dieser Zeit trifft er auf eine Menge Einheimische, aber auch Darmstädter, da er in Darmstadt seine Christtagsfreude einzukaufen gedenkt.
Dass dieser Tag ganz anders verlaufen wird als von Pardonner vorgesehen, fällt nicht allzu sehr ins Gewicht, da es letzten Endes ein großer, ein historischer Tag für ihn werden wird.
Mit viel Liebe zum Odenwald und aufrichtiger Sympathie für die Odenwälder lebt Pardonner ein unscheinbares, naturverbundenes, fast freies Leben, sofern sich das Wort „Freiheit“ im heroischen, digitalisierten 21.Jahrhundert noch gebrauchen lässt.
Die Odenwald-Saga lässt die Odenwälder zu Wort kommen, die von den neuen innenpolitischen Entwicklungen und dem Ukraine-Krieg geplagt sind – manche mehr, manche weniger – die genauso sprechen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, die einen zum Lachen und zum Nachdenken anregen – und manchmal auch zum Weinen.
Die Odenwald-Saga ist ein einziger Streifzug durch den Odenwald, aber auch ein Querschnitt eines Deutschlands, seiner Regionen und Menschen, die am Rand einer völlig neuen Entwicklung stehen, die ihre Zukunft unsicher und ungewiss macht.
Die Odenwald-Saga ist in einem schnoddrigen, ironischen Grundton gehalten – ein Spottroman eben – mit lebensechten Dialogen, in denen die heutigen Probleme der Menschen zur Sprache gebracht und verstanden werden, ihren Sorgen, Ängsten, Nöten und Ärger - und all ihren Freuden. Sie hält der Zeit den Spiegel vor und sagt ihren Lesern, dass vorherrschende Meinungen noch lange keine Wahrheiten zu sein brauchen.
1. KAPITEL
Pardonner ist schlechter Laune. Sein uralter Wecker hat ihn mitten aus einer weißen Winterlandschaft gescheppert, mit einem schnarrend-rasselnden Alarmsignal, wie auf einem alten U-Boot. Er weiß, er hat geträumt. Es dauert einige lange Sekunden bis der Wecker sich beruhigt, weil Pardonners Hand noch keine Orientierung hat. Als der Wecker endlich still und er richtig wach ist, merkt er, dass er sich den ganzen Rücken nassgeschwitzt hat. Das verdankt er seinem Traum. Von wegen „Morgenstunde hat Gold im Munde“. Ein Bonmot für Fantasten. Jetzt braucht Pardonner den von Napoleon so gerühmten Zwei-Uhr-Morgens-Mut, auch wenn es stramm auf vier Uhr zugeht. In diesem Zeitraum galt eine Indisponiertheit wie Morgentraurigkeit in den Klöstern als Sünde, da sie bösen Mächten den Weg erschloss. Die hätten Pardonner heute gerade noch gefehlt.
Pardonner tastet sich im Dunkeln in die Küche. Nicht weil ihm der Strom ausgegangen oder, dank der Russen, zu teuer geworden oder Verdunklung befohlen ist und Notstandsverordnungen greifen, gar der Ausnahmezustand ausgerufen wurde – der herrscht nur in der Regierung – sondern weil er feste Angewohnheiten in sein Leben etabliert hat. Die Preise für Strom, Heizung und Wasser interessieren ihn seit drei Jahren nicht mehr, seit er diese Kosten in einer internen Vereinbarung mit seinem Vermieter gegen ausufernde Garten- und Hausmeisterarbeiten eingetauscht hatte.
Pardonners Laune bessert sich kaum, als er barfuß auf den scharfgezackten Rand eines Kronkorkens tritt, den so ein Strolch einfach auf den Küchenboden geworfen hat. Er knipst das Licht an und setzt sich an den Küchentisch. Er schiebt ein aufgeschlagenes Buch beiseite, einen mords Schinken von fast einem halben Quadratmeter Durchmesser.
„Tragödie und Hoffnung“, das in den USA anfangs nur mit geschwärzten Seiten erscheinen durfte – kein Wunder.
Eine leere Flasche Schmucker glotzt ihn an. Pardonner mag früh morgens keine leeren Bierflaschen, schon gar nicht, wenn er spät vom „Löwen“ nach Hause gekommen ist. Also räumt er sie in die Spüle – eine unerhörte Belästigung für einen unausgeschlafenen, leicht verkaterten Mann, den ein dezentes Schädelweh an seine gestrigen Sünden erinnert. An dutzenden Theken ist Pardonner wetterfest geworden und ein kleiner Kater ist nur ein dezenter Hinweis darauf, Hochprozentiges zu schnell konsumiert zu haben.
Wenn du morgens weder in deinem Bett liegenbleiben noch aufstehen willst, dann könntest du einen Scheißtag erwischt haben, sagt sich Pardonner. Schon Goethe erkannte: Die Begleitmusik des morgendlichen Erwachenssind unangenehme Gedanken. Hm. Wie so oft in seinem Leben stellt sich für Pardonner die Frage: Wie soll man sich nach kurzer, schlecht verbrachter Nacht frisch, fromm, fröhlich, frei, in das hektische, moderne Weltgetriebe stürzen?
Also, der Traum. Eigentlich sind es zwei Träume, aber der erste Traum ist gegen den letzten völlig belanglos. Dieser Traum ist nicht einfach zerfleddert, sondern steht wie festgenagelt vor ihm, während der andere in Auflösung begriffen ist.
„Karl Pardonner, genannt ‚Che‘ oder der rote Pardonner!“, hatte ihn eine Stimme angebrüllt, aber da waren nur eine gewaltige Stimme und ein gewaltiges Licht, viel gewaltiger als Albrecht Pfennigreiters gleißend helle Halogenscheinwerfer, wenn er um Mitternacht, einer alten Familientradition Folge leistend, auf seinem Hof die Zeremonie des Mistaufladens beginnt.
„Zum Donner, Roter Pardonner!“, brüllte erneut diese Stimme.
Geht schon gut los, dachte Pardonner. Wie einst bei Kowalski, meinem Mathelehrer.
„Jawollll!“, brüllte Pardonner zurück, nahm Haltung an und schmetterte die Hacken zusammen, dass sein dritter Lendenwirbel vibrierte, so wie er es vor vielen Jahren bei der Bundeswehr in Friedenszeiten gelernt hatte. Damals waren die Kriege noch gemütlich kalt gewesen, man bekam seinen Sold und hatte seine Ruhe; aber inzwischen sind sie bedenklich heiß geworden – und mit der Ruhe ist es vorbei.
Ihm war längst klar geworden, dass er keinen Geringeren als Gott vor sich hatte – ein Unding im 21. Jahrhundert! Und dieser Gott zählte zu Pardonners Überraschung energisch auf, was er schon längst vergessen glaubte.
„Ehebruch, Entheiligung des Sonntags, Vater und Mutter nicht geehrt, seinen Nächsten nicht wie sich selbst geliebt, gelogen, krankhafte Spottlust, Fluchen, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Beamtenbeleidigung, Körperverletzung, rote Grillen, rote Umtriebe, Tagträumereien, Einzelgängertum, extremes Verhalten, Schwarz-Weiß-Denken, Lieblosigkeit,…“
In gesteigerter Lautstärke rollte diese schreckliche Stimme wie Geschützdonner über ihn hinweg – so musste es in Stalingrad gewesen sein oder beim Endkampf um Berlin. Pardonner verlor sein Zeitgefühl, aber er schätzte die Dauer dieses Prozederes auf mindestens eine Viertelstunde.
„Wie dir bekannt sein dürfte, roter Pardonner, wird jedermann gemäß seines Erdendaseins von mir abgeurteilt.“
Erstens war dies Pardonner vollkommen unbekannt, obwohl er beinahe sein Abitur gemacht und mindestens dreitausend Bücher im Laufe seines Lebens gelesen hatte – es mussten die verkehrten Bücher gewesen sein – und zweitens wusste er jetzt, dass im Himmel nicht gegendert wird. „Jedermann“, hatte Gott zu ihm gesagt, was Pardonner einigermaßen beruhigte. Auch fiel ihm ein, dass er niemals etwas gestohlen hatte, und gelogen hatte er nur unfreiwillig unter Druck, und er hatte in seinem ganzen Leben niemals versucht, jemanden zu übervorteilen oder zu betrügen, was sich strafmildernd auswirken musste. Im Übrigen beschloss er, seine Klappe zu halten und blitzschnell alles zu vergessen, was in seinem Leben geschehen war, weil der Verlust des Gedächtnisses oftmals der Ausweg aus großen Schwierigkeiten ist. Das Leben ist eine Satire, nicht mehr und nicht weniger, das hat er schon immer gewusst.
„Ich verurteile dich, gemäß deiner Neigung, zu einem einsamen Fußmarsch durch eine winterliche Landschaft. Kapiert?“
Pardonner war hochzufrieden über dieses erstaunlich milde Urteil, das überhaupt nicht zu dieser angsteinflößenden Stimme passen wollte – also doch ein lieber Herrgott, wie die alte Anna Lantelme immer sagte.
Er freute sich einerseits auf die Wanderung, die ihm bevorstand, andererseits ärgerte er sich darüber, so viele Gedanken über Seelenheil und Ewigkeit gewälzt zu haben, über Himmel und Hölle, ein strafbares Verbrechen für jeden Roten, der das gerahmte Bildnis Leo Trotzkis in seinem Wohnzimmer an der Wand hängen hat.
„Kapiert?“, ertönte die Stimme wie ein Nebelhorn eines 100 000 BRT-Frachters direkt an seinem Ohr, und Pardonner, der immer noch in Habachthaltung stand, brüllte „Jawolll!“, wie vor seinem alten Spieß, diesem König aller hasenschartigen Arschlöcher, dessen Unzufriedenheit mit Pardonners Wehrtüchtigkeit in den Sätzen gipfelte: „Pardonner, Sie Schlumpf, Sie! Ich scheiß` Sie in die Ostsee! Sie Hornvieh schießen ja lauter Fahrkarten! Weshalb sind Sie Wichtel nicht zur Bahn gegangen?“
Was man sich von ungebildeten Leuten so alles sagen lassen musste.
Im Schießen war Pardonner eine Niete (Wer schießt schon gerne auf Menschen?) Aber niemand baute das G3 mit Verschluss (drei Teile) fixer auseinander und wieder zusammen als Pardonner, was sein Spieß wiederum versöhnlicher stimmte. Sein Bett ordentlich zu bauen, war das Einzige, was Pardonner wirklich bei der Bundewehr gelernt hatte. Nun ja.
Pardonner spürte, dass er gnädig entlassen war, machte eine zackige Kehrtwendung und marschierte los, und glaubte, in seinem Rücken ein unangenehmes Lachen zu hören. Pardonner marschierte durch endlos weiße Täler und über verschneite Höhen, bergauf und bergab, weißer Dampf quoll aus Nase und Mund, der Schnee knirschte unter seinen Stiefeln.
Und Pardonner sang. Er ist ein ausschweifender Sänger. Kein Liedgut ist vor ihm sicher. Er beherrscht sogar das klassische Fach. Gibt er den Bajazzo zum Besten, wird es tragisch. Sein ganzes Liedgut, das sich in seinem Leben angesammelt hatte, breitete er jetzt aus. „Es hängt ein Pferdehalfter an derWand“, „Junge, komm bald wieder“, den ganzen alten Schmand. Dann: „Schwarzbraun ist die Haselnuss, schwarzbraun bin auch ich“. Das hatte er während seiner Zeit bei der Bundeswehr gelernt. Das „Odenwaldlied“, das sang er im Dialekt, damit es Gott seine Seele erschloss.
Er durchquerte eine winterliche Postkartenlandschaft nach der anderen, durch herrlich verschneite Wälder, wie er es schon immer liebte, vorbei am spiegelnden Eis eines Sees. Es war ein Marsch unter tiefblauem Winterhimmel und die Sonne so golden, dass sie fast kitschig wirkte. Nicht eine einzige Schneeflocke segelte durch die Luft. Alles war fix und fertig geliefert. Aber seltsamerweise war nirgendwo eine Spur von Mensch oder Tier: keine Bussarde in den Lüften, die sich mit Krähen hackten, wie er es vom Odenwald her gewohnt war, kein Rauschen des Windes auf einem Plateau, alles lag still und tot, nur der Schnee knirschte unter seinen Stiefeln. Es mussten gute Stiefel sein, da hatte Gott sich nicht lumpen lassen – wahrhaftig ein barmherziger Herrgott, keine Schmerzen an den Fersen und an den Zehen, nicht solche Scheißdinger von Knobelbecher wie bei der Bundeswehr, auf Maß angefertigte Stiefel, obgleich niemand an ihm Maß genommen hatte.
In der Tat eine herrliche Schneelandschaft, wie sie sich 1941 der deutschen Wehrmacht und ihren Begleitverbänden dargeboten haben musste. Man konnte damals Schneeburgen bauen, Schneemänner und Schneefrauen und richtige Schneeballschlachten veranstalten, und nebenher wurde noch ein bisschen bombardiert, exekutiert und geschossen – ein herrliches Leben für die deutschen Soldaten. Viele träumten bis an ihr Lebensende davon.
Pardonner marschierte tagelang, wochenlang, monatelang, ohne einem einzigen lebendigen Wesen zu begegnen. Seine Stimme war inzwischen eingerostet und er krächzte wie ein Rabe, wenn er zu sich selber sprach. Er sang schon lange nicht mehr. Nicht einmal die Spur eines Rehes kreuzte seinen Weg, was man in einem verschneiten Wald am ehesten hätte erwarten können: kein Windkraftrad, das im Stillstand drohend in den Himmel ragte. Entweder, die Leute brauchten hier keinen Strom, oder es gab hier einfach keine Leute, die Strom verbrauchten, oder hinter den Hügeln verborgen lag ein Atomkraftwerk. Also schien man doch mit der Zeit zu gehen, die komischerweise für Pardonner still zu stehen schien. Keine Ansiedlung, kein Weiler, kein einziges Gehöft, aus dem Rauch in einer langen Fahne senkrecht in den Himmel stieg.
So marschierte er ohne Hunger- und Durstgefühle. Nicht einmal nach Tabak gierte es ihm, und seine Lendenwirbel meldeten sich kein einziges Mal, worauf er vorher noch hoch gewettet hätte. Und so marschierte Pardonner einhundert, zweihundert Jahre lang, und da wusste er endlich, dass er in einer Hölle gelandet war, die er sich vermutlich selbst geschaffen hatte, die von Gott präsentierte Rechnung für Spottlust, Tagträumereien, Einzelgängertum, extremes Schwarz-Weiß-Denken, Eigensinn und Lieblosigkeit und sein Fußmarsch ewig währen würde.
Da hämmerte Pardonners Wecker gerade noch rechtzeitig los, bevor er mit Gott zu hadern und zu lamentieren beginnen konnte: „Lebenslang? Für was bitteschön? Bist du verrückt geworden? Ich habe fast nie gelogen, stets pünktlich meine Miete bezahlt und für all das Geld, das ich als Arbeiter gespendet habe, hätte ich mir einen halben VW-UP dafür kaufen können oder einen ganzen Rolls Royce“, und er war unendlich froh darüber, nicht in einer arktischen Hölle, sondern in seinem Odenwälder Fuchsbau in Lindental aufgewacht zu sein. Aber dennoch war er schlechter Laune. Da war er mehrere hundert Jahre lang marschiert, bis er etwas kapiert hatte. Kaum zu fassen! Andererseits: Die Menschheit kapiert nie!
Unter normalen Umständen träumt ein Roter weder von ewiger Strafe noch von göttlichem Gericht. Weder Marx noch Engels hatten darüber berichtet. Selbst in den Büchern Frau Sahra Wagenknechts steht darüber nichts vermeldet. Dies alles hat doch Zeit, bis man merkt, dass es ernst werden könnte, also der Moment, wo Katholiken einen Priester zwecks Absolution aufzusuchen pflegen. Aber da Pardonner noch evangelisch ist, müsste er deswegen Rat beim Ortspfarrer Wohlleben einholen – ausgerechnet Wohlleben, der mit der Heilsgewissheit der Bibel genauso große Schwierigkeiten hat wie mit der AfD und Putin. Sein leichtfertiger Umgang mit göttlichen Strafen ist mit einem guten Schuss protestantischer Ignoranz verklausuliert in seine Predigten eingegossen.
Manchmal hat Pardonner das Gefühl, dass Wohlleben am liebsten dem Gott der Bibel eins mit der Keule hinter die Ohren geben würde, weil Wohlleben doch linksliberal denkt und es sich bei Gott um einen notorischen, reaktionären Faschisten handeln muss. Es ist doch so, dass der Begriff „Theologe“ gewisse Vorstellungen weckt. Die Bezeichnung „Chirurg“ würde heutzutage besser zu ihm passen. Dabei haben die Leute an Gott doch Interesse – viel mehr als an Marx oder Engels – leider. Viele glauben an ein höheres Wesen, und dies nicht erst, wenn sie krank sind und sich auf ihre letzte Reise vorbereiten müssen. Das ist Fakt.
Ausgerechnet der rote Gregor Gysi sagte einmal sinngemäß: „Wenn ich in eine Kirche gehe, will ich etwas über Sünde, Vergebung, Himmel und Hölle hören und kein Blablabla.“
In diesem Sinne dürfte er bei Wohlleben nur schwer auf seine Kosten kommen. Wohlleben, ein Meister theologischer Verrenkungen und Spitzfindigkeiten, wenn es darum geht, seine fünfzehn Minuten lange Predigt halbwegs in Einklang mit der Bibel zu bringen. Es bedarf eines guten Gehörs, das herauszufischen, was er nicht ausdrücklich sagt, aber von ganzem Herzen glaubt, wenn es um den heiligen dreieinigen Gott geht, wie ihn die Bibel beschreibt. Aber noch wurde von keiner Flammenschrift im Altarraum der Kirche das „Mene-mene-tekel-u-parsin“ an die Wand gezaubert, dieses berüchtigte „Gewogen und für zu leicht befunden“, in dem die geballte Verachtung des lebendigen Gottes für überhebliche Menschenkinder mitschwingt. Und doch nimmt es nicht Wunder, dass der Kirchturm der Lazerus-Kirche wie ein gewaltiger Stinkefinger gen Himmel zeigt, kommt es Pardonner vor.
Für Wohlleben sind die Evangelien nicht mehr als christliche Schnurren. Er betreibt seinen Glauben wie so viele als Gewerbe und gründet seinen Unterhalt darauf. Er lebt nicht für seinen christlichen Glauben, sondern von ihm. Heutzutage eine ganz normale Sache. Seltsam, wenn es anders wäre.
Da es sich übrigens bei Jesus Christus bei modernen Evangelischen um den ersten historisch nachgewiesenen Verschwörungstheoretiker überhaupt handeln dürfte, der auf Gottessohnschaft pochte und auch noch seine Wiederkunft ankündigte, dürfte Wohlleben eines Tages, sofern die biblischen Prophezeiungen zutreffend sind, mit einem Mühlstein um den Hals im Meer enden, zusammen mit seinem Kirchenpräsidenten, der, dank seiner genialen Politik, vom einstigen Kirchenlichtlein inzwischen zum Armleuchter mutierte.
In der „Guten Nachricht“ steht unter Matthäus 18.6: „Wer auch nur einen einfachen Menschen, der mir vertraut, an mir irre werden lässt, der käme noch gut weg, wenn man ihn mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer werfen würde.“
Das könnte Ärger setzen.
Ob die Damen und Herren Kirchenpräsidenten in einem Frömmigkeitsanfall auch einmal einen Blick in die Bibel riskieren? Eine verzwickte Sache die Bibel, wenn man glaubt, sie verstanden zu haben.
Überhaupt, weshalb ist noch keiner auf den Gedanken gekommen, die evangelische Kirche im Zeitalter der Transformation in eine CgmbH umzuwandeln? In eine christliche Gesellschaft mit beschränkten Hirnen? Pardonner lacht. Natürlich steht Wohlleben nicht für die gesamte Pfarrerschaft der evangelischen Kirche. Es gibt altgediente Pfarrer, die es mit Wohlleben keine fünf Minuten an demselben Tisch aushalten könnten, wenn Wohlleben die schweren Geschütze seiner grünen Theologie auffährt und die Bibel seziert, als wäre sie von einer Räude befallen.
Der nächste Kirchentag der Evangelischen soll übrigens in Nürnberg stattfinden, ein gut gewählter Ort, findet Pardonner. Immerhin hat sich die Evangelische Kirche dort zwölf Jahre lang sauwohl gefühlt.
Aber das sind momentan Pardonners geringste Sorgen. Sein Nachdenken wird von einem leichten Schädelweh beschwert. Ein Grummeln hinter der Stirn, ordentliche Wellenbrecher, die vom Großhirn ausgehend hinter den Augen auslaufen. Sein gestriger Aufenthalt in Schorsch Bickels „Löwen“ hat Spuren hinterlassen. Immerhin hat er gestern Abend tüchtig zum Erhalt des „Löwen“ beigetragen. Jedes anständige Dorf braucht ein anständiges Wirtshaus, sonst ist es kein anständiges Dorf.
Über Pardonners im Großen und Ganzen eher unbeschwertem Leben liegt ein Schatten, der sich nicht so einfach wegtrinken lässt. Ein gewichtiger Grund vor einem großen, christlichen Fest in der Stadt inkognito eine Kirche aufzusuchen, außerhalb öffentlicher Zeremonien, versteht sich. Nur gut, dass er gestern Abend den Wecker gestellt hatte, was er als Frühberenteter so gut wie nie tut. Aber heute ist Heiligabend im Jahre 2022 des Herrn, und es gibt noch vieles zu erledigen, bis er sich am späten Nachmittag in seinem Sessel neben dem Wohnzimmerofen zur Ruhe begeben und auf die große Geburtstagsfeier des Weltenretters einstimmen kann. Heute muss er den Wettlauf mit der Zeit ausnahmsweise gewinnen. Pünktlichkeit ist nicht gerade Pardonners Metier. Er ist der festen Überzeugung, sie verwässert die Lebensqualität.
Pardonner beginnt zu frieren. Das verschwitzte Shirt klebt kalt auf seinem Rücken. Und natürlich fühlt sich Pardonner müde nach nur fünf Stunden Schlaf. Er gähnt ausgiebig. Aber er kennt es nicht anders. Bei sechs Stunden macht er sich ein Kreuz in den Kalender. Er schläft nicht den tiefen Schlaf des Gerechten, sondern den Schlaf des Erschöpften. Ihm fehlen unterm Strich so an die zwei Jahre Schlaf. Damit hat er seine Lebenszeit faktisch verlängert und zugleich verkürzt, weil sich Schlafmangel in einer verkürzten Lebenszeit niederschlägt – sagen die Mediziner. Immerhin: Mindestens jedes achte Krankenkassenmitglied leidet unter Schlafstörungen. Endlich fühlt sich Pardonner von Schichten der Bevölkerung nicht mehr isoliert, auch wenn er wieder einmal typischerweise einer Minderheit angehört, und es tröstet ihn wenig, dass der Schlaf des Ungerechten tief und wonnig, und durch nichts zu stören ist.
Emanuel Kant bestand auf maximal sieben Stunden Schlaf, weil zu viel Schlaf der Denktätigkeit nicht förderlich ist. Seine Bediensteten waren verpflichtet, ihn nach Ablauf dieser Frist, unter allen Umständen aufzuwecken, ein Problem, das Pardonner in diesem Leben wohl nicht haben wird.
Ein Blick zur Küchenuhr mit dem weißen Porzellanteller, die schon jahrelang zufrieden über seiner Spüle hängt: Viertel vor vier. Tack, tack, tack, schon wieder drei Sekunden älter. In Pardonners Wohnung herrscht Ordnung nach einem gewissen System, das die Sorglosigkeit im Haushalt eines alleinlebenden Mannes nicht ganz verbergen kann. Kontrollierte Unordnung ist seine Devise. Neben der Küchentür lehnt ein alter Veteran von Besen, die gefüllte Kehrschaufel zu seinen wild abstehenden, struppigen Borsten, den er gestern Abend, beschwingt nach seinem Besuch im „Löwen“, in Ermangelung einer weiblichen Alternative, als Tanzpartnermissbraucht hatte.
Auf der Abtropffläche der Spüle liegt ein Wust aus Taschenmessern, Feuerzeugen und Taschentüchern garniert mit Tabakkrümeln, Bleistiftstummeln, einer kleinen Rolle Kupferdraht sowie einem lose zusammengeknüllten Stück Kordel, allesamt lebenswichtige Utensilien für einen richtigen Mann, die er nach seiner gestrigen Heimkehr aus seinen Hosentaschen verbannte. Neben der Spüle harren drei geleerte Weinfaschen ihrer Entsorgung. Eine Kiste mit gespaltenem Brennholz bildet ein Hindernis auf dem Weg in sein Wohnzimmer. Damit wird er heute Abend seinen Zimmerofen anheizen.
Pardonners Kopf umsummt eine Fliege.
„Zieh‘ Leine Engelchen. Als Stubenfliege hast du übrigens längst tot zu sein. Wir haben Winter. Wie alt wird eigentlich eine Stubenfliege? Du sprichst nicht mit jedem? Schön. Hier bei mir kannst du hundert Jahre alt werden. Aber geh‘ mir nicht auf den Wecker.“
Die Fliege setzt sich gehorsam auf die Küchenuhr.
„Siehst du, wir verstehen uns doch.“
Pardonner ist es gewohnt, mit sich selbst zu sprechen, was auch seine Vorteile mit sich bringt. Man erntet keinen Widerspruch.
Neben der Küchenuhr, in steter Blickrichtung, ein gerahmtes Foto des Odenwaldes. Die dick bereifte Tromm im Herbstnebel der aufgehenden Sonne. Pardonner hat das Foto selbst geschossen und auf das Format 60 x 40 vergrößern lassen. Er liebt den Herbst und er liebt den Odenwald. Pardonner kennt den Taunus, den Spessart, die deutschen Mittelgebirge bis hin zu den Alpen, und überall ist es schön, und nicht selten ist es dort landschaftlich reizvoller als im Odenwald. Aber eine bestimmte Schwingung, das Wohl und Wehe, löst nur der Odenwald in ihm aus, mit seinen vielen Burgen und Schlössern, seinen Mythen, Märchen und Sagen, und wenn ein Tourist die Rüstung des Schwedenkönigs Gustav Adolf sucht, wird er sie im Schlossmuseum von Erbach finden. Mit Adam Karillon und Professor Lippmann hat der Odenwald gleich zwei Büchner-Preisträger (aber keine Denkmäler, die an sie erinnern). Und natürlich gibt es nur im herbstlichen Odenwald in Reichelsheim, dem Herz des märchenhaften Odenwaldes, einmal jährlich die Märchen- und Sagentage. Genau dort gehören sie auch hin.
Ja, der Odenwald. Überall Basiliken, Klöster und Kirchen, die alten Mühlen, mit den an den Hauswänden lehnenden alten Mühlsteinen. 1695 ist das älteste eingemeißelte Datum, das Pardonner je auf einem verwitterten Mühlstein entzifferte. Die jahrhundertealten Sandsteinbrunnen natürlich, die ausgelatschten Sandsteintreppen vor den alten Bauernhäusern, auf denen Generationen von Odenwälder ihre Spuren hinterlassen haben. Darüberhinweg sind Kriegsteilnehmer- und Heimkehrer dreier Kriege geschritten und viele von ihnen haben ihre Heimat nie wiedergesehen. Auf ihnen hinunter hat man die Alten zu ihrer letzten Ruhe getragen - heutzutage stirbt man klinisch steril im Krankenhaus – jede Stufe ein kleines Mahnmal für die Endlichkeit des Menschenlebens.
Wer eine Ader für dichtbelaubte Wälder und verschwiegene Täler in sich verspürt, den wird der Odenwald in seinen Bann schlagen, und manchmal ist Pardonner, die Wälder raunen im Sommerwind über längst vergangene Zeiten, wo die Menschen anders, aber auch nicht besser waren. Mensch bleibt eben Mensch.
Es gibt ein aufgemaltes Familienwappen mit Schild und Ritterhelm an der Hausfassade eines ehemaligen Bauernhauses in Beerfurth mit dem Namen Arras und der Jahreszahl 938. Das sind hunderte von Jahren Odenwald. Das sind hunderte von Jahren gute und schlechte Zeiten, in denen die schlechten Zeiten überwogen. Ab und an die kleinen Freuden eines schweren Lebens: eine Bauernhochzeit, viel später die Kerbe, ein Stammhalter wurde geboren. Viel öfter das Leid, Missernten, Hunger, Seuchen, marodierende Kriegsvölker, Zwangsrekrutierungen, Kontributionen, Misshandlungen, erduldetes Unrecht, der rote Hahn auf dem Dach, Fürsten- und Obrigkeitswillkür, und doch hat dieses schwere Schicksal es nicht geschafft, die Arras‘ aus dem Odenwald zu vertreiben. Sie sind geblieben. Zu welcher Zeit sie im Odenwald Stellung bezogen, ist ungewiss. Tatsache ist, dass ein hemdsärmeliger Schmied namens Arras seinem Herrn bei Alf an der Mosel in einem kriegerischen Konflikt tüchtig aus der Bredouille half und deshalb als Dank zum Ritter geschlagen wurde. Treue und Standhaftigkeit sind Tugenden – von denen der moderne Mensch aus guten Gründen nicht allzu viel wissen will.
„In Not sei stark“, lautet der Spruch unter dem Wappen, und so kommt es nicht von ungefähr, dass Pardonner beim Vorbeifahren Familie, Vorfahren und Wappen mit einem Schwenk seiner Hand stets Gruß und Reverenz erweist.
Dieser alte, sagenhafte Odenwald ist für Pardonner der Quell warmer, heimatlicher Gefühle, der nirgendwo sonst für ihn sprudelt. Genau so muss es den Arras‘ ergangen sein. Genau dies müssen sie heute noch fühlen und spüren.
Steingeröll und Felsenmeer, alte Hügelgräber aus vorgeschichtlicher Zeit mit ihren baumbestandenen Kuppen, die Heuneburg bei Lichtenberg, auf der einst alemannische Kleinkönige residierten. Ihre Sagen haben sich in den Wäldern des Odenwaldes bis auf den heutigen Tag erhalten. Sie flüstern sie im Wind einander zu, das Nibelungenlied natürlich. Wald und immer nur Wald, den der römische Geschichtsschreiber Marcellinus einst als „durch seine Dunkelheit fürchterlich“ beschrieb.
Der Odenwald schlägt eine Saite in Pardonner an und bringt sie zum Schwingen wie eine schöne Frau, obgleich der Odenwald herb erscheint, wie eine Schönheit, die ihre Reize zu verbergen weiß. Der Odenwald hat Besseres zu bieten als von Touristen überquellende Landschaften: Ruhe, Stille, Bescheidenheit, Gleichmaß und innere Einkehr wie auf dem Matterhorn. Und im Herbst schweigen die Wälder nirgendwo schöner als im Odenwald. Man muss ihnen nur zuhören können. Und heute noch kannst du in der Odenwälder Erde Schätze aus längst vergangenen Zeiten finden. Der Schnellerts gab nach Jahrhunderten einen vergoldeten, bronzenen Steigbügel und ein vergoldetes Rosettenkreuz frei, das ehemalsam Zaumzeug eines Pferdes befestigt war.
Es soll Menschen geben, die behaupten, dass man im Odenwald lebendig eingesargt ist. Vermutlich sind es dieselben, die glauben, dass die Deutschen eine funktionsfähige, vernünftige Regierung haben. Insofern fällt deren Meinung nicht allzu sehr ins Gewicht. Im Odenwald triffst du noch eher auf gelebten Individualismus als in der Stadt, und wenn es nur ein von wildem Wein zugewuchertes, bewohntes Haus wie in Groß-Bieberau ist, hinter dem sich Fenster und Türen nur noch erahnen lassen.
Pardonner hat sich vom Odenwald prägen lassen. Beileibe war er nicht vom ersten Tage an mit ihm per Du. Aber er hat sich die Schönheiten des Odenwaldes erschlossen, das Meditative seiner Wälder, ihre grenzenlose Stille – und heute möchte er nirgendwo anders leben.
Die Stille. Ein geistiges Schwergewicht sagte einmal: „Der Denkende lebt mit dem Auge im ewigen Frieden, mit dem Ohr im ewigen Krieg.“ Und er setzte hinzu: „Ganz zivilisiert werden wir erst sein, wenn die Ohren nicht mehr vogelfrei sein werden.“
Dies sollte man jedem Schänder der Stille auf seinen Grabstein meißeln.
Viele Menschen wollen in der Stille leben, und wenn sie dann in der Stille sind, fällt ihnen nichts Besseres ein, als Krach und Lärm zu veranstalten. Das ist im Odenwald nicht anders als im Harz, im Taunus oder im Hunsrück.
Aber Pardonner weiß, manchmal kann ein Leben auch quälend sein, selbst im Odenwald. Den Bedrückten und Geplagten helfen dann auch all die stillen, prachtvollen Wälder nicht und kein wilder Wein vor der Haustür. Dann müssen sie sich selber retten, den Harnisch gürten und gegen ihre Gespenster kämpfen.
Es sind nur Gespenster, und das Leben ist es wert, gelebt zu werden, auch wenn du jeden Tag auf mindestens ein Rindvieh triffst – das ist im Odenwald nicht anders als anderswo. Aber selbst ohne Rindviecher ist der schwerste Kampf immer der Kampf gegen sich selbst. Vierundzwanzig Stunden am Tag bist du dir rettungslos ausgeliefert – auch Pardonner hat damit seine Erfahrungen. Und die Zeit läuft, die Uhr tickt – für jeden.
Im Modautaler Ortsteil Lützelbach, dem Dorf auf dem Berg, steht eine Warnung am Giebel eines alten Häuschens: „Heute sind wir wie Röslein rot, morgen krank, bald gar wohl tot.“ Wie wahr! Jeder trägt sein eigenes Schicksal durch dieses Leben, das ein Ende nehmen muss, und für manche wäre es besser dieses Schicksal bereits zu kennen.
Pardonner stutzt, hebt lauschend den Kopf. Er glaubt, ein undefinierbares Geräusch zu hören, das von einem Vibrieren begleitet wird. Halluzinationen, sagt sich Pardonner, vermutlich auf Bickels fünfzigprozentigen „Bärentöter“ zurückzuführen.
Er entzündet einen roten Kerzenstumpen, der in einer Untertasse auf der Tischmitte steht. Dies ist kein Tribut an Weihnachten, sondern profane Alltäglichkeit. Er liebt einfach das Flackern der Kerze und den Stearingeruch, das Nachglimmen des Dochtes, wenn er die Kerze wieder ausgeblasen hat. An der Wand sein Kalender, vollgestopft mit Terminen, die mit dem 21. Dezember plötzlich abreißen. Urlaub!
Auf der Küchenanrichte ein Berg von Geschenken, der sein Telefon belagert. Er wird sie heute Abend in aller Ruhe auspacken. Eine schöne Bescherung! Vermutlich ist ausgerechnet er der Lindentaler, der als bekennender Roter die meisten Geschenke abgestaubt hat. Bienenwachskerzen, Flaschen in jeder Form und Größe, in Papier eingeschlagen mit bunten Schleifen oder unverhüllt, vier Sixpacks, Schmucker und Eichbaum – er hat bei den Einheimischen einen Namen. Dazu Pakete und Schachteln in Weihnachtspapier verborgen, zwei in Netze verpackte Schinken, geräucherte Würste, Kalender, schöne und weniger schöne, Christstollen, deren drei, Kuverts natürlich, die erfahrungsgemäß Geldscheine oder Gutscheine zu fast gleichen Teilen enthalten: für Bickels „Löwen“ und Merdans „Alanya“. Es ist bekannt, wo er manchmal seine Freizeit verbringt. Sechs Gutscheine waren es im letzten Jahr gewesen. Gute Leute, die Odenwälder, und anhänglich dazu, wenn sie erst einmal Vertrauengefasst haben. Seine rote Ideologie und Trotzkis Doktrin fallen kaum noch ins Gewicht, seine Stänkereien, wie seine politischen Gegner es nennen. Man muss die Odenwälder „zu nehmen“ wissen. Manchmal sind sie wie kleine Kinder, mal lieb, mal drollig, mal vertrauensvoll, mal skeptisch, mal böse, mal zornig. Es bedarf streng abgestimmter Verhaltensweisen, um mit ihnen richtig umzugehen.
Die Odenwälder mögen es, wenn er während der Arbeit singt. Wenn er „Drei Lilien“ schmettert oder „Bella Ciao, das „Odenwaldlied“, die Nationalhymne der Odenwälder, während der Schweiß beim Heckenstutzen wie ein Gießbach an ihm hinabstürzt. „Von der Stirne muss rinnen der Schweiß“, hat Schiller einst in der „Glocke“ gedichtet, eine Mahnung, die kaum noch Früchte trägt. Pardonner arbeitet gerne in der Natur, mit Freude und Lust. Ohne Mühsal keine echte Freude. Das sind die Odenwälder nicht mehr gewohnt. Welcher Deutscher arbeitet heute noch gerne? Selbst zum Faulenzen fehlt ihm die rechte Lust.
Auf einer Hausfassade des Höhendorfes Böllstein steht ein Spruch aufgepinselt: „Ohne Arbeit früh bis spät wird dir nichts geraten/der Neider sieht das Blumenbeet aber nicht den Spaten.“
Dazu gäbe es einiges anzumerken, aber im Kern trifft dieser Spruch die Sache richtig.
Ein letzter Blick auf Pardonners Gabentisch. Seine Miene hellt sich auf. Er beschließt, den Rest schlechter Laune samt Halluzinationen und Traum mit eiskaltem Wasser wegzuduschen. Ein Skandal dieses Gottesurteil. Lebenslang für fast nichts. Darüber könnte er sich glattweg aufregen. Er hat noch nicht einmal richtig im Gefängnis gesessen. Hin und wieder ein, zwei Nächte oder so, längst verjährte, uralte Kamellen. Der andere Traum war nahezu bedeutungslos gewesen, wenn auch mit einem interessanten surrealistischen Einschlag. Es ging um seinen Bruder Ernst, der in einer Seifenkiste eine abschüssige, gepflasterte Straße hinunterrumpelte. Aus einem Auspuff zog er, wie an einer langen Schnur, Seifenblasen hinter sich her, sofern sich Pardonner an diesen Traum überhaupt noch richtig erinnern kann.
Pardonner erhebt sich, schlappt ins Bad, tritt mit der Ferse des linken Fußes auf den scharfgezackten Rand des Kronkorkens. Er flucht und kickt ihn unter die Spüle, wo er bis zur nächsten Zeitenwende liegen bleiben wird.
Heiß duscht Pardonner an, kalt jedoch ist die beste Medizin, aber wie stets zögert er diesen fragwürdigen Akt der Selbstkasteiung über Gebühr hinaus, und er denkt an seinen Bruder. Viel fällt ihm nicht zu ihm ein. Als Spediteur jongliert er durch Deutschland vierzig Laster – er, der kleine Streber von dazumal, der als Kind leidenschaftlich gerne mit einer Strickliesel hantierte (woran er heute nicht mehr erinnert werden möchte) und der ihn nach dem Tode ihrer Mutter beim Erben beschissen hatte, da er als scharf kalkulierender Geschäftsmann Pardonners laxe Einstellung in Gelddingen genau kannte und seine tiefe Abneigung gegenüber Rechtsverdrehern, an die er sich hilfesuchend hätte wenden müssen. Damals hatte Pardonner seinen Bruder ein kleines bisschen verflucht, gerade so, dass er sich Hoffnung auf ein winziges Unglück seines Bruders machen konnte: dass ihm die Frau davonläuft, das Haus abbrennt oder seine Firma Pleite geht.
Ernst wohnt zwar nur knapp zehn Kilometer von Lindental entfernt, mit Anschluss an die neu ausgebaute Bundesstraße, was für ihn und seine Spedition nicht ganz unwichtig ist. Allerdings sehen sie sich im Schnitt nur alle zwei Jahre einmal, meist bei Beerdigungen. So gut hat es das Schicksal mit Pardonner doch noch gemeint. Er kennt seinen Bruder jetzt 55 lange Jahre. In diesem Zeitraum hat Ernst nicht einen einzigen Satz gesagt, den es sich aufzuschreiben gelohnt hätte, mit Ausnahme eines einzigen Mals, als er Uli Hoeneß als Dreikäsehoch „Du scheiß Arschloch!“ titulierte, nachdem der 1976 bei der EM den entscheidenden Elfmeter haushoch über den Querbalken in den Prager Himmel gedroschen hatte und er Pardonner das einzige Mal in seinem Leben aus der Seele sprach.
Ernst ist felsenfest davon überzeugt, dass er die Dinge denkt, wie sie sind, und dass die Dinge sind, wie er denkt. Vielleicht wäre er besser Staatssekretär geworden.
Tja, Brüder haben ein Geblüte, aber selten ein Gemüte. Wie wahr!
Jetzt hält Pardonner die Luft an, der Countdown läuft, drei, zwei, eins, dann dreht er entschlossen den Regler nach rechts und die beste Medizin der Welt stürzt eiskalt auf ihn herab.
„Uuuuaaah, aaaaahhh!“, brüllt Pardonner wie am Spieß, fast so laut wie die Innenministerin, wenn ihr die neueste Kriminalitätsstatistik Deutschlands vorgelegt wird. Das eiskalte Wasser ist wie ein Schock. Sein rotes Herz, das ihm in letzter Zeit so schwer geworden ist, krampft sich zusammen. Das Eiswasser raubt Pardonner Besinnung und Atem. Dann denkt er nur noch im Stenostil. „Puuuuhhhh! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Mann oh Mann! Saukalt! Lecks am Arsch! Aaaaahhh!“
Und er brüllt wie ein Wahnsinniger, so laut wie ein Fanfarenstoß: „Die Harte‘ kumme in de Garte‘.“
Gefühlte zwei Minuten muss er aushalten, bis er sich selbst erlöst. Mit einem brettharten Handtuch rubbelt er das Leben in seine ausgekühlten Glieder zurück. Und jetzt ist Pardonner obenauf. Flugs angezogen. Solange er keine Beinkleider trägt, fühlt er sich nur als halber Mann. Also schnell in seine Hosen geschlüpft und schon trällert er ein Lied in den frühen Heiligabendmorgen.
„Oh Donna Clara, ich hab‘ dich Tanzen gesehen, oh Donna Clara, du warst wunderschön!“ – ein Lied, mit dem er seine Exfrau zur Verzweiflung trieb, was er weidlich ausnutzte, als seine Ehe in den letzten Zügen lag.
Pardonner ist ein großer Sänger vor dem Herrn. Wenn er aus Leibeskräften so laut und so falsch wie nur irgend möglich während der Arbeit singt, lachen die Leute und sagen kopfschüttelnd: „Hört euch nur den Kall an. Der muss doch krank im Kopf sein.“ Wenn Pardonner still seiner Arbeit nachgeht - selten genug kommt dies vor - weil seine Gedanken ihn wieder einmal niederdrücken, sagen dieselben Leute: „Hört ihr etwas? Der Kall singt überhaupt nicht. Ist er krank?“
Pardonner erfindet auch Lieder. Manchmal singt er sie nur ein einziges Mal. Danach entfallen ihm Text und Melodie, da ein Großteil seiner kompositorischen Arbeit aus Schmucker und Bärentöter bestand.
„…duuuh warst wunnnderschööööhn!“
Müdigkeit, Kater und schlechte Laune sind schlagartig weggeduscht. Schon seit fünfundzwanzig Jahren ist Pardonner nicht mehr krank gewesen. Weder Schnupfen, Erkältung noch Grippe oder gar Corona beschwerten sein Leben, zum Schaden der deutschen Pharmaindustrie, die das Loch, das Pardonner in ihre Kasse gerissen hatte, vermutlich durch Corona wieder halbwegs stopfte. Der Gesundheitsminister würde staunen, wie einfach die Geschichte mit dem Immunsystem in Wirklichkeit ist: Dazu jeden Tag eine Cebiontablette, pausenlose Bewegung bei jedem Wetter im Freien, und du bist bei Viruskrankheiten nach einer Umstellungszeit von drei, vier Jahren dein Leben lang aus dem Schneider.
Ja, der Herr Lauterbach, dessen geniale Fähigkeiten als Virologe die Medien in glänzender Weise überzeugten. Er hat sogar mit links den Nobelpreisträger der Medizin Luc Montserrat wiederlegt! Dies war vorher noch keinem gelungen. Schon die alten Römer und Griechen bewunderten das medizinische Wissen Herrn Lauterbachs, samt der durchschlagenden Fachkenntnisse Herrn Wielers, und bereits die ausgestorbenen Sumerer sangen das hohe Lied der Heilkunst auf Herrn Lauterbach, wie die Printmedien in Sonderausgaben berichteten.
Ja, die Deutschen, ein wahrhaft innovatives Volk. Sie haben sogar die Feuerwehr vor dem Feuer erfunden, aber heute hinken sie in allem hinterher. Von der Einbahnstraße in die Sackgasse. Es fehlt an allem. An Geld, das bekommen andere, an Ideen und an klugen Köpfen. Heutzutage will man clever sein, also mit wenig Arbeit viel Geld verdienen und sich möglichst nicht die Hände beschmutzen (was dann aber leider allzu oft geschieht).
Die Finanzabteilungen in den Konzernen werden massiv ausgebaut, aber gleichzeitig Entwicklung und Forschung zurückgefahren. Dreißig zu eins ist das Verhältnis seit 1990, schreibt die Wagenknecht. Kein Wunder, dass Russlands Wirtschaft trotz Sanktionen zulegt, die deutsche aber schrumpft. Und dabei wird es bleiben. Kein Wunder, dass die chinesische Regierung laut Umfragen bei ihrer Bevölkerung überwiegend gut angeschrieben ist, aber im Odenwald von vier Einheimischen drei diese Bundesregierung zum Teufel wünschen. Probleme werden vor sich hergeschoben, aber nicht gelöst. Der simple Antrag des alten Simermachers für eine Baugenehmigung eines gemauerten Taubenschlags wandert seit achtzehn Monaten durch die Behörden. Rossini schrieb den „Barbier von Sevilla“ in gerade mal vierzehn Tagen.
Und – es gibt kein stoisches Element mehr in dieser Gesellschaft. Nur wie in einer auseinanderdriftenden Ehe Hektik, Vorwürfe und Aufgeregtheiten,als hätten sich Regierung und Bevölkerung auseinandergelebt. Längst haben die Deutschen Reih und Glied verlassen. Wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen laufen sie durcheinander, provozieren sich, schlagen mit den Flügeln und hacken aufeinander ein – ein Verhalten, das in der Natur an sich liegt. Sich mit Sittlichkeit, Geschick und Anstand in der Geschichte zu behaupten, muss einer Gesellschaft abgehen, deren Staat und oberste Gewalt am Kollabieren sind. Dies sagt Ortega und dies sagt der rote Pardonner. Darauf legt er sich fest. Die sittliche Entartung ist in vielen Bereichen sichtbar geworden. Gebot Nummer Eins: Abkassieren! Abkassieren ohne Ende und ohne Scham! Auch dies prophezeite Ortega. Er wird nicht nur gelesen, er wird auch gehört. Wie ein Echo dringt seine Stimme aus der Vergangenheit.
„Schaut in die Bücherschränke eurer Volksvertreter und ihr wisst, wie es um eure Zukunft bestellt sein wird.“
Aber wie sieht die Gegenwart aus?
Aus dem einst stolzen Adler der Deutschen ist ein Mittelding von Aas- und Pleitegeier geworden. Dies ist die Lage! Und noch etwas sticht Pardonner jeden Tag ins Auge. Wer ist heutzutage noch heiter? Dicke Fressen, wohindu auch schaust. Vielen scheint Lebensfreude eine Krankheit zu sein, an der man zu ersticken droht, kommt es Pardonner mitunter vor. In Lindental sind nur Hans Bermond, der Gründer der Freikirche, und der unbestrittene Dorftrottel, Fischer-Kleejs, heiteren Gemüts. Dazu der Waldenser Jakob Barthalot und Alma, die Heilerin. Sicher, gute Laune haben viele. Für einen Tag oder zwei. Helga von Stein, seine Vermieterin, singt den ganzen Tag, bevor sie in den Urlaub fliegt. Kaum zurück, zieht sie wieder eine dicke Fresse, weil ihre Möbel wegen der fehlenden Scharniere aus China nicht geliefert wurden. Lachhaft! Kindergarten!
Den Deutschen sind einfach die Ideen ausgegangen, mit denen sie die Welt beeindruckten (und gegen sich aufgebracht hatten). Die berühmte Madame de Stael schrieb einmal, zum Ärger Napoleon Bonapartes, die beeindruckenden Sätze: „Ein Franzose hat selbst dann noch etwas zu sagen, wenn er keine Ideen hat. Ein Deutscher hat davon noch immer mehr, als er auszudrücken versteht.“
Damit ist es endgültig vorbei. Die einzige Idee, die der Deutsche noch hat, ist, über den großen Teich nach Amerika zu schielen.
Die Zerstörung der Kultur, der Dichtung, der Poesie wird mit politischer Dekadenz, moralischem Verfall und nackter Gewinnsucht quittiert. Asche so hoch wie die Tromm! Und noch etwas ist Pardonner aufgefallen: Viele Deutsche sind von einer Veränderungsmüdigkeit befallen, bevor diese Veränderungen überhaupt erst richtig Fahrt aufgenommen haben. Und noch schlimmer: Die mentale Erstarrung der Deutschen ist zu einem anhaltenden Dauerkrampf geworden. Man hat sich angewöhnt, in einem emotionalen Vakuum zu leben.
Nachdem sich Pardonner die Zähne geputzt und sich rasiert hat, wirft er dem Badezimmerspiegel noch eine schnelle Kusshand zu. Jetzt kann er kommen, der Heiligabend 2022. Was heute auch geschehen mag, er ist gerüstet. Mit einer eiskalten Dusche treibt man den Teufel samt sieben Dämonen aus – ein Tipp, den er an Hans Bermond den Täufer weitergeben wird, der mit seiner Freikirche hier in Lindental sein Unwesen treibt. Pardonner hält den Täufer für das Flaggschiff der im Sinken begriffenen christlichen Flotte, was Hans Bermond mit einem Schmunzeln als übertrieben abtut.
2. KAPITEL
Nachdem Karl, der rote Pardonner, bereits seine Visitenkarte abgegeben hat, erlaubt sich der Autor, unüblicherweise, die Geschichte kurz zu unterbrechen und den „Held“ der Odenwald-Saga den Lesern kurz vorzustellen (umgekehrt wäre es vermutlich weitaus schwieriger).
Karl, der rote Pardonner, Anfang November 1964 in Mannheims Neckarstadt geboren. Demzufolge ist er laut eingeweihten Odenwälder Kreisen ein echtes „Monnemer Bloomaul“, also einer, der seine große Klappe nicht halten kann. Nachdem eine vermögende Großtante den großartigen Einfall hatte, ihr Leben im Odenwald mit einem Hirnschlag abrupt zu beenden, eine Todesursache, die heutzutage bei Ministern und Kirchenpräsidenten vollkommen auszuschließen ist, erstellten die Pardonners auf einem ererbten Grundstück im Odenwald ein Eigenheim, das Karl zusammen mit Eltern und Bruder bezog. Nach einem turbulenten Eheleben ruhen seine Eltern jetzt friedlich vereint in der steinigen Odenwälder Erde. Allzu viel wusste Pardonner nicht, mit ihnen anzufangen, was auf Gegenseitigkeit beruhte.
Als Odenwälder Neubürger musste sich der junge Karl erst einmal mit einer ihm völlig unverständlichen Sprache herumschlagen - ein frühes Migrantenschicksal eben. Aus vertrauten Bäh, also Beinen, wurden Boa, aus weschde, also weißt du, waaste, ein Meeschder, ein Meister, wurde mit einem Mal zum Moaster und so weiter. Auf einmal waren eine Decke zum Kuscheln ein Kolder und eine Bütt eine Brenk. Wenn ein Odenwälder spricht, was erschwerend hinzukommt, denkt man, er handele tief in seiner Kehle mit Kohlen – eine ungewöhnliche Sprachmelodie für ein ungeübtes Ohr. Ist er aufgeregt oder verärgert, bellt er wie ein Kettenhund, könnte man meinen. Im Odenwald, das werden wir noch erleben, bellen Zwei- und Vierbeiner oftmals um die Wette.
Nach mittlerweile achtundvierzig im Odenwald verbrachten Jahren beherrscht Pardonner die Sprache der Odenwälder, die je nach Lage der Ortschaft ihre Besonderheiten aufweist, bis zur Perfektion, auch wenn er sie nur in den seltensten Fällen aufblitzen lässt: „Wonn de Gaul mit ‘m durschgehjt“, wie die Odenwälder sagen. Der Gaul geht mit Pardonner beispielsweise dann durch, wenn ein desorientierter Vierbeiner in die Gartenanlage der Lazerus-Gemeinde scheißt, die er als Frühberenteter gegen schmales Salär beackert. Dann schreit er: „Scher disch zum Deifel, du verdommter, dreckischer Flintrieme“, ein Fluch, der eher dem Besitzer als dem unwissenden Hund gilt.
Als Roter hat Pardonner längst Heimatgefühle im Odenwald entwickelt. Er liebt den Odenwald, der von Städtern oftmals als „Arsch der Welt“ abgekanzelt wird oder gar als „Odenwaldhölle“, der peinliche Ausrutscher einer trostlosen, verrammelten, weiblichen Journalistenseele, und entschuldigt seine Liebe damit, dass selbst der große rote Leo Trotzki seine Heimat Russland geliebt habe. Zudem liebt Pardonner die kernigen Odenwälder Originale, auch wenn er sie manchmal am liebsten auf den Mond schießen würde.
Im Laufe der Jahre hat das Naturell der Odenwälder auf Pardonner abgefärbt. Seine oftmals überschwänglichen Verhaltensweisen mischen sich jetzt mit der Natur eines störrischen Esels. Pardonner kann höflich und zuvorkommend sein, aber wenn er nicht will, dann will er eben nicht. Seine Höflichkeit nimmt manchmal beleidigende Züge an, bei seinen Wortgefechten mit dem SPD-Ortsgruppenleiter Waldemar Wipfler zum Beispiel. Unterschreibt Pardonner Briefe an Ämter mit „vorzüglicher Hochachtung“, weiß jeder Eingeweihte, dass er es mit einem pensionsberechtigten Vollidioten zu tun hat.
Wie kann heutzutage aus einem vernünftigen Menschen noch ein Roter werden, könnte jetzt ein Einwand lauten. Erstens hat Pardonner in seinem Leben niemals behauptet, dass er vernünftig ist. Zweitens gibt es zahlreiche angeblich vernünftige Menschen, die sogar Grüne geworden sind. Insofern fällt das Rote nicht allzu sehr ins Gewicht. Zum Roten ist Pardonner deshalb geworden, weil ein alter Schuster namens Willi Neuer unter dem Dach ihres Mietshauses in Mannheims Neckarstadt, in Unterhemd und mit einem blauen Schurz begleitet, auf Teufel komm raus hämmerte und klopfte. Willi war ein ausgewiesener Kommunist, der mit dem Rotfrontkämpfer-Bund in Mannheim die Nazis bekämpft hatte. In der Ära Hitler wurde er zweimal ins Zuchthaus gesteckt. Einmal wegen eines Witzes, den er über den Führer gerissen hatte. Übrigens war Willi von seinem Wohnungsnachbarn angezeigt worden. In einem Bombenhagel kam dieser zwei Jahre später ums Leben, als Mannheim flächendeckend bombardiert wurde. Seitdem wusste Willi, dass Wünsche auch wahr werden können. Zu Pardonners Umgang mit Willi hatten Pardonners Eltern wenig einzuwenden. Er war ein schwieriges Kind mit einem „Dickkopf“, der sich gewaschen hatte. Sie waren froh darüber, wenn sie vor ihrem Sohn ihre Ruhe hatten.
Bei Willi wurde Pardonner nicht nur nach aller Kommunistenkunst indoktriniert, sondern auch stramm erzogen. Bereits als Achtjähriger durfte er an Willis Bierflasche nippen und ab und zu an dessen selbstgedrehten Zigaretten ziehen, die Willi stets im Mundwinkel kleben hatte (zusammen mit ein paar Schusternägeln), was weitreichende Folgen für Pardonner zeitigte. Entgegen seiner Kommunistenehre hatte Willi hinter seinen beiden Schusterleisten den Farbdruck zweier Heiligen hängen, Crispinus und Crispianus, die Patrone der Schusterinnung, weil sie umsonst für die Armen Schuhe aus gestohlenem Leder angefertigt hatten – eine Geschichte, die dem kleinen Pardonner ungemein gut gefiel.
Von Willi hat Pardonner mit Blick auf dieses Heiligenbild erstmals das verächtlich ausgesprochene Wortkürzel „Sie Ei Ehj“vernommen, mit dessen Hilfe weltweit das Leder der Armen gestohlen wird, damit die US-Amerikaner nicht barfuß laufen müssen. Mittlerweile weiß Pardonner, dass es richtig ausgesprochen CIA heißt, ein Verein, der für Umstürze und Terror aller Art in der Welt verantwortlich zeichnet und der zahlreichen belasteten Nazis mit neuen Papieren nach dem 2. Weltkrieg zum Untertauchen verholfen hat. Unter anderem Klaus Barbie, dem Schlächter von Lyon, mit ein paar hunderttausend jüdischen Frauen und Kindern auf dem Gewissen. Nun denn!
Im Odenwald heimisch geworden, verließ er als guter Schüler zur Überraschung aller die Schule, was noch näher beleuchtet werden wird. Er begann seine Karriere als Steinfräser und Steinbrucharbeiter im Granitwerk der raubeinigen Familie Schubkegel, nur unterbrochen von einem fünfzehnmonatigen Intermezzo bei der Bundeswehr. Er weiß also am eigenen Leib, was echte Maloche ist – im Gegensatz zum momentanen Wirtschaftsminister, der nach eigenem Bekunden noch nie länger als fünf Minuten geduscht hat, ein Grund mehr, weshalb er Pardonner stinkt.
Pardonner heiratete die einzige Frau seines Lebens, mit der er sich überhaupt nicht verstand, und wird natürlich, wie so viele Paare, geschieden, nachdem er zwei Kinder in die Welt gesetzt und so gut wie möglich bis zum Teenageralter erzogen hat. Mit größter Umsicht hat er bei seinen Kindern die Erziehungsfehler seiner Eltern vermieden – dafür aber andere genauso schwerwiegende gemacht.
Nach seiner Scheidung zieht Pardonner auf einen abseits gelegenen ehemaligen Bauernhof, dem er mittlerweile gärtnerische und handwerkliche Pflege angedeihen lässt, was sich an seiner Warmmiete stark bemerkbar macht. Energie- und Heizkosten entfallen vollständig – ein Traum für jeden Mieter. Dafür befehdet er sich aber unentwegt mit seiner Vermieterin, die in einer Art Hassliebe an ihm hängt.
Pardonner malocht bei Schubkegel weiter, trainiert nebenher eisern für seine 50 km Distanzläufe, raucht und trinkt im seligen Gedenken an Willi, weil er ein unbekümmerter Roter ist. Dann wird er eines Tages, nach 35 Jahren Maloche, auf Krücken hinkend, mit einem Wirbelsäulenschaden von den Medizinern aufs Abstellgleis geschoben und mit 55 Jahren zum Frührentner erklärt. Was für die heutigen Mediziner unheilbar war, brachte eine mit göttlicher Energie arbeitende Heilerin in ein paar Sitzungen lässig wieder in Ordnung, was Pardonner seitdem einen respektvolleren Ton gegenüber Heilerinnen und Gott anschlagen lässt. Pardonner malocht nicht mehr, arbeitet stattdessen zu günstigen Tarifen als Handwerker und Gärtner für Lindentaler, bei denen er wohl gelitten ist. Pardonner hat sich niemals darum bemüht, Leuten zu gefallen. Und doch mögen ihn die meisten, zumindest auf eine bestimmte Weise – eine Art von Lebenskunst.
Der Vielleser Pardonner verzichtet auf sämtliche moderne Kommunikationsmittel, ist demzufolge weder vernetzt noch verkabelt, lebt sogar ohne TV, also in einem Dauerfunkloch, so sein Freund Reeg. Für diese Tatsache wird Pardonner belächelt, bemitleidet und beneidet, oftmals von derselben Person in einem einzigen Atemzug. Briefe schreibt Pardonner noch per Hand oder mit Hilfe einer uralten Triumph-Schreibmaschine. Sie ist groß und schwer wie eine Heuballenpresse und tackert wie ein MG.
Die Verbindung mit der Außenwelt hält er mit einem Uralttelefon aufrecht. Es hat ausgerechnet die Farbe Grün und ist mit einer durchlöcherten Wählscheibe ausgestattet, in die man den Zeigefinger hineinstecken und im Uhrzeigersinn drehen muss. Sollte der Betreffende bei einem Unfall den rechten Zeigefinger verlieren, kann er selbstverständlich nicht mehr wählen und infolgedessen nie mehr telefonieren, ist also faktisch zu Lebzeiten bereits ein toter Mann. Dieses Dinosauriertelefon dürfte für einen Jugendlichen von heute nicht mehr beherrschbar sein, genauso wie Pardonners Wecker übrigens, dessen Stellschraube den durchschnittlichen Mitteleuropäer vor unlösbare Probleme stellen würde.
Dies ist der Stand der Dinge, nachdem Pardonner frisch geduscht und wohlgemut diesen Heiligabend angeht, der voller Turbulenzen und Überraschungen stecken wird.
3. KAPITEL
Pardonner isst sein Müsli mit heißer Milch aus einem Suppenteller, trinkt starken, schwarzen, ungesüßten Kaffee dazu. Wirft ab und zu einen Blick in den aufgeklappten Schinken Carroll Quingleys „Tragödie und Hoffnung“.
Er kommentiert wortlos mit entstellter Gesichtsmimik. Pardonner liest Bücher nach altmodischer Weise, von vorne nach hinten. Viele lesen inzwischen quer, weil ihnen die notwendige Zeit dazu fehlt. Politiker und Medienleute lesen stets nur die letzte Seite – den Rest glauben sie bereits zu wissen. Abrupt klappt Pardonner mit einem dumpfen Knall das Buch zu. Heute ist Heiligabend und er will sich nicht unnötig ärgern.
Mit einem Gongschlag wird er vom Bayerischen Rundfunk des ARD-Nachtkonzerts in die rechte Stimmung für die Vier-Uhr-Nachrichten versetzt. Die beste Motivation für ein Stoßgebet und das Zitieren Kants berühmter drei Fragen: Was soll ich wissen? Was soll ich hoffen? Was soll ich tun?
Die Botschaften aus dem Bundeskanzleramt werden wie stets in appetitanregenden Portionen mundgerecht serviert. Los geht’s!
Die Nachrichten: Ukraine, Ukraine, Ukraine – ein echtes Weihnachtswunder, wenn dem nicht so gewesen wäre. Seltsam, für den Frieden wird überall dort gekämpft, wo es Kriege gibt. Überhaupt: Weshalb nicht bald Kriegsanleihen zeichnen? Weshalb keinen Solidaritätszuschlag? Weshalb nicht die Wehrpflicht wieder einführen? Wehrkunde in den Schulen. Das wäre doch ein Gag. Gelobt sei, was hart macht! Hart wie Krupp-Stahl, zäh wie Leder, flink wie Windhunde. Es lebe die Kriegstüchtigkeit! Bringt endlich preußischen Schwung in diese Hammelherde. Helau!
Einwenden muss Pardonner allerdings, dass russische Militärs sich noch nie durch gesunden Menschenverstand ausgezeichnet haben, durch Fingerspitzengefühl. Sie lieben das überschaubar Grobe. Mit Finessen der Kriegführung geben sie sich erst gar nicht ab. Und Clausewitz lehrte, dass nur die ersten zwei Wochen eines Krieges halbwegs berechenbar sind. Was danach folgt, wissen die Götter. Also muss man sich keine großen Gedanken um die Zukunft machen.
„Ein Krieg muss politisch gewonnen sein, bevor man ihn militärisch beginnt.“ Clausewitz. Der russischen Führung lässt sich einiges unterstellen, nur nicht, dass sie Clausewitz gelesen hat.
Pardonners Vater hatte es schon immer gewusst: Russen und Juden taugen nix! Sie haben noch nie etwas getaugt und werden niemals etwas taugen. Allesamt Unruhestifter, diese Bagage! Seit Anbeginn. Sein Vater hatte immer Recht. In dieser Hinsicht ähnelte er stark Pardonners Bruder Ernst. Es gab fast kein Thema, das sie nicht mit einem Fehlurteil bereichert hatten. Und doch haben beide Karrieren gemacht. Seltsame Sache!
Nach seiner Erbschaft driftete Pardonners Vater von der SPD zur CDU ab. Dort fühlte er seine Interessen jetzt besser aufgehoben. Und als er sich zum stellvertretenden Betriebsleiter aufgeschwungen hatte, hatten ihn seine guten politischen Geister völlig verlassen. Helmut Kohl war mit einem Male für ihn ein Gigant.
Die beste Idee seines Vaters war, ihn mit dem Vornamen Karl zu belegen. Dafür ist Pardonner ihm dankbar bis ans Ende seiner Tage.
Die Amis kamen bei seinem Vater günstiger als die Juden und Russen weg. Die hatten sein Kaliber. „Hire und Fire“ wäre sein Geschäftsmodellgewesen, wenn es diese nichtsnutzigen Gewerkschaften nicht gegeben hätte.
Aber so schlecht können die Russen nun auch wieder nicht sein, denkt Pardonner. Nach wie vor arbeiten die Amis mit ihnen in der Raumfahrt zusammen. Sie fliegen sogar zusammen in einer Rakete zur Raumfahrtstation Sojus und leben dort, ohne sich die Augen auszukratzen oder sich gegenseitig in den Schwitzkasten zu nehmen. Sieh einer an! Dazu weiterhin nukleare Zusammenarbeit etlicher EU-Staaten mit Russland. Uran wird weiterhin, trotz Sanktionen, aus Russland importiert, russisches Erdöl über Indien in den Westen. Und ausgerechnet ein russischer Investor soll den maroden Flughafen Kassel-Kalten retten. Manchmal denkt Pardonner, aus Deutschland ist eine einzige offene Psychiatrie geworden. Unklar ist lediglich, wer Arzt und wer Patient ist.
Und wieder Ukraine. Selenski lehnt Waffenruhe an Weihnachten ab. Das geflügelte Wort „Wer die Amis zum Freund hat, braucht keine Feinde mehr“ sollte sich Herr Selenski gut merken. Der Schlächter Saddam Hussein hat es am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, ein Freund der Amis zu sein.
Endlich etwas Erfreuliches. Ab fünfunddreißig Prozent Migrantenanteil nimmt die Leistung einer Schulklasse drastisch ab. Kaum zu glauben, jetzt sitzen die Verschwörungstheoretiker bereits beim Bayerischen Rundfunk.
Jetzt spricht der Herr Finanzminister. Der Herr Lindner, das Kontrafagott dieser Regierung! Nun, es hat Tradition bei den Christen, dass ein Judas die Kasse verwaltet. Der Finanzminister schwört die Deutschen darauf ein, dass sie k o l l e k t i v ärmer werden. Ob davon auch Lindners Klientel, die Multimillionäre, betroffen sind, die während der seligen Corona-Zeiten ihr Vermögen verdoppelten?
Gestern Corona, heute Ukraine und morgen?
Pardonner seufzt. Wenn die Deutschen doch Jakobiner an der Basis hätten! Dann könnte er wieder hoffen. Aber der Deutsche ist nun mal zum Untertanen prädestiniert und nicht zum freien Bürger.
Um einen Politiker richtig zu beurteilen, muss man sich nur die Frage stellen, ob man mit ihm ein Handschlaggeschäft abschließen würde. Pardonner kennt etliche Odenwälder, mit denen er dies ohne großes Zögern tun würde – aber keinen einzigen Politiker, vom toten Herbert Wehner abgesehen. Auch Wehner war gegen Irrtum nicht gefeit, aber er war ehrlich. Ein ehrlicher Kotzbrocken, wie du ihn heute in der Politik nicht mehr findest – und genau die sind Pardonner am liebsten.
In der Politik kommt es heute nun mal stets auf Mehrheiten und nicht auf Wahrheiten an. Stets wird die Wahrheit das erste Opfer der Politik. „Was ist Wahrheit?“, fragte Pilatus bereits vor 2000 Jahren spöttisch. Geändert hat sich nichts.
Pardonner weiß, dass er vieles nicht weiß. Insofern steht er mit „Hamlet“ auf einer Stufe (manchmal, wenn etwas wieder nicht in seinen Kopf gehen will, hält er sich für dümmer als Bohnenstroh). Vor allem kann er nicht wissen, was sich alles in der Zukunft abspielen wird. Er bekämpft die neue künstliche Intelligenz, wann immer es ihm möglich ist, und er agitiert dagegen. Aber vielleicht erweisen sich ausgerechnet K.I. und die Digitalisierung für die Menschheit als Segen? Vielleicht werden damit alle Probleme gelöst? Möglich, aber Pardonner glaubt nicht daran. Es ist mehr als eine Ahnung, die ihm sagt, dass K.I. in einer gefesselten Gesellschaft enden wird. Der Verfassungsschutz schreit nach K.I., der BND, die Bundeswehr, die Staatsanwaltschaften, die Polente sowieso und alle nutzen K.I. bereits. Ein wichtiger Fingerzeig, wohin die Reise gehen wird. Natürlich schreien die Schulen nach K.I. mit ihren total verstöpselten, abgestumpften Insassen. Man fühlt sich mittlerweile veranlasst, zu glauben, ohne K.I. findet keine Zukunft statt. Digitalisierung, Automatisierung, Fortschritt: Vielleicht dreht sich mit Hilfe von K.I. der Globus eines Tages schneller? Und dann?
K.I. mag mit Intelligenz etwas zu tun haben, aber niemals etwas mit Verstand oder Vernunft. Zudem wollen Oxforder Wissenschaftler herausgefunden haben, dass bis in zehn Jahren fast 50 Prozent aller Arbeitsplätze in den USA vernichtet sein werden, sagt die Wagenknecht. Gerade durch Automatisierung, Computer und K.I. In Deutschland wird dies natürlich alles ganz anders sein.
Pardonner lacht, verschluckt sich, holt tief Luft, hustet.
Um der Gegenwart einen Sinn zu verleihen, sollte man in der Vergangenheit bewandert sein. Aber alle Blicke sind nur noch in die Zukunft gerichtet. Gestern gibt es nicht mehr – und heute ist bereits Morgen.
Das eigentliche Ziel der K.I. ist die totale Kontrolle über den Menschen. Punktum! Geradezu lachhaft der FDP-Slogan „Digitalisierung first. Bedenken second“. Der bekannte Philosoph und Publizist Richard David Precht vermutet, dass die FDP überhaupt nicht weiß, was sich hinter K.I. verbirgt. Insofern ist es verständlich, dass das Gesamtgewicht der Darmbakterien eines Spitzenpolitikers ungleich höher als das Gewicht seines Hirnes ist. Dies sagt Precht nicht, aber er denkt es vermutlich.
Wer glaubt, dass er selbstbestimmt ist, muss automatisch an eine Größe wie Fichte glauben. Im Prinzip ist die Demokratie der damaligen freien Welt auf der Philosophie deutscher Denker aufgebaut. Der Begriff der Freiheit ist eng mit moralischen Pflichten verwoben.
„Nur derjenige ist wirklich frei, der alles um sich herum freimachen will“, sagt Fichte.
Die deutsche Wirklichkeit sieht allerdings anders aus. Immer mehr wird überwacht und die Freiheit beschnitten. Die Freiheit stirbt scheibchenweise, auf diese Weise fällt es den meisten nicht auf. Was nützt es der Freiheit, wenn der Führerschein mit siebzehn und das Wahlrecht ab sechzehn Jahren eingeführt werden, aber gleichzeitig das Finanzamt jede Kontobewegung von dir überprüfen kann und du rund um die Uhr überwachbar geworden bist und dein neuer Personalausweis mit deinem Fingerabdruck versehen sein muss? Der Bürger wird im Vorfeld bereits als zukünftiger Staatsfeind gehandelt.
Aber den Deutschen fällt nichts Besseres ein, als über ihr Schicksal und ihre Identität ein fremdes Volk bestimmen zu lassen – die Amerikaner. Als freie Nation ist Deutschland mausetot, auch wenn es noch Schrauben produziert, Bier braut und ab und zu eine Fußballweltmeisterschaft gewinnt. Selbst der CDUler Willi Wimmer, ehemaliger Staatssekretär im Verteidigungsministerium, beklagt, man höre und staune, dass Deutschland den letzten Rest von Selbstständigkeit an die USA verliert.
Als bereits vor Jahren der mit Pardonner befreundete irische Pub-Besitzer Howard amerikanischen GIs Hausverbot erteilte, weil sie immer nur Stunk machten, erhielt er zwei Tage später von seinem Herrn Oberbürgermeister einen freundlichen Anruf, bitte sofort das Verbot zurückzunehmen, ansonsten würde man Howard seine Lizenz entziehen müssen. Der US-Standortkommandant hatte sich zu Wort gemeldet. Howard fiel aus allen irischen Wolken und landete in der deutschen Wirklichkeit. Eine wahre Geschichte, die Pardonner zu gerne der Frau Innenministerin bei einem gemütlichen Umtrunk mit einem Kasten Schmucker erzählen möchte.
Pardonner konzentriert sich wieder. Manchmal sind Pardonners Gedanken wie Papierschiffchen auf einem trägen Strom – sie sind ihm am liebsten – einanderes Mal stürzen sie auf ihn ein wie ein tosender Wasserfall.
Der Finanzminister ist von dem Nachrichtensprecher abgehakt. Jetzt hat er es mit Frau Ricarda Lang, der die Durchschnittsrente in Deutschland völlig unbekannt war, bis sie von einem Journalisten zu ihrem Erstaunen danach befragt wurde. Über Frau Lang hört Pardonner geflissentlich hinweg. Immerhin, akademischer Starrsinn lässt sich ihr nicht nachsagen, und sie verfügt über das beachtliche Talent, das Weltgetriebe in einem einzigen langen Satz zu erklären.
Und weiter geht es mit Papst Franziskus. Er ruft an Weihnachten zum weltweiten Frieden auf, eine Nachricht, die selbst hartgesottene Radio-Moderatoren nicht erschüttern kann. Also wird sie gesendet. Was Papst Franziskus in einem Interview im Mai dieses Jahres sagte, wurde natürlich von den Medien verschwiegen. „Wir sehen nicht das ganze Drama dieses Ukraine-Krieges, der vielleicht in gewisser Weise entweder provoziert oder nicht verhindert wurde!“
Und er fügte hinzu: „Und ich registriere das Interesse am Testen und Verkaufen von Waffen!“
Wahrscheinlich hat der Papst damit Frau Strack-Zimmermann persönlich gemeint, mit ihren hervorragenden Beziehungen zur Waffenindustrie, die momentan noch Verteidigungsministerin spielen darf und nach dem Ende ihrer politischen Karriere wohl als kleines Dankeschön im Aufsichtsrat einer Waffenschmiede landen wird (ein Beratervertrag wäre auch ganz nett).
„Nur Eisen kann uns retten und erlösen kann nur Blut“, zitiert Pardonner in das monotone Geplätscher des Nachrichtensprechers hinein.
Natürlich liegt Papst Franziskus mit seiner Analyse vollkommen richtig. Jahrelang hat die Ukraine mit dem Westen an der Kriegsschraube tüchtig mitgedreht, aber jetzt – alles Engel. Und Putin hat die Rolle des Satanas zu spielen.
Pardonner ärgert sich und wie immer, wenn dies der Fall ist, schießt ihm das Blut in den Kopf und er kann an seinen Schläfen das Getrommel seines Herzschlages fühlen.