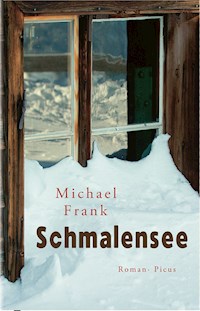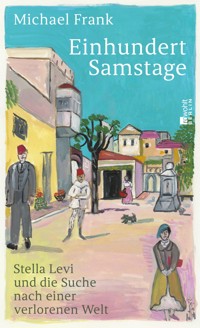
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als Michael Frank die heute hundertjährige Stella Levi zufällig kennenlernt, nimmt eine große Geschichte ihren Anfang. Sie lädt ihn in ihr New Yorker Apartment ein, und bald wird aus den Besuchen ein Ritual: An hundert Samstagen erzählt Levi dem Schriftsteller ihr Leben. Gemeinsam suchen und erkunden die beiden eine fast märchenhafte, verlorene Welt. Levi, geboren 1923, wuchs auf im jüdischen Viertel La Juderia auf der Mittelmeerinsel Rhodos – eine Kindheit und Jugend zwischen sephardischer Tradition und Moderne, inmitten einer Vielfalt von Kulturen und Sprachen zwischen Orient und Okzident. Stella eifert der Schwester Felicie nach, die Freud und Henri Bergson liest; sie selbst träumt vom Studium in Italien. Schließlich aber werden diese Welt und die Familie grausam zerrissen, und Stella Levi erzählt auch davon: Im Herbst 1943 besetzen die Deutschen die Insel, für Levi der Anfang eines Leidenswegs, der sie bis nach Auschwitz führt. Sie überlebt – und beginnt ein ganz neues Leben in den USA. Stella Levis Geschichte ist ein faszinierendes historisches Zeugnis. Sie erzählt von einer einzigartigen Welt, die zerstört wurde – und setzt ihr zugleich ein Denkmal, das die Vielfalt und Fülle des Lebens zeigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Michael Frank
Einhundert Samstage
Stella Levi und die Suche nach einer verlorenen Welt
Über dieses Buch
Als Michael Frank die heute hundertjährige Stella Levi zufällig kennenlernt, nimmt eine große Geschichte ihren Anfang. Sie lädt ihn in ihr New Yorker Apartment ein, und bald wird aus den Besuchen ein Ritual: An hundert Samstagen erzählt Levi dem Schriftsteller ihr Leben. Gemeinsam suchen und erkunden die beiden eine fast märchenhafte, verlorene Welt. Levi, geboren 1923, wuchs auf im jüdischen Viertel La Juderia auf der Mittelmeerinsel Rhodos – eine Kindheit und Jugend zwischen sephardischer Tradition und Moderne, inmitten einer Vielfalt von Kulturen und Sprachen zwischen Orient und Okzident. Stella eifert der Schwester Felicie nach, die Freud und Henri Bergson liest; sie selbst träumt vom Studium in Italien. Schließlich aber werden diese Welt und die Familie grausam zerrissen, und Stella Levi erzählt auch davon: Im Herbst 1943 besetzen die Deutschen die Insel, für Levi der Anfang eines Leidenswegs, der sie bis nach Auschwitz führt. Sie überlebt – und beginnt ein ganz neues Leben in den USA.
Stella Levis Geschichte ist ein faszinierendes historisches Zeugnis. Sie erzählt von einer einzigartigen Welt, die zerstört wurde – und setzt ihr zugleich ein Denkmal, das die Vielfalt und Fülle des Lebens zeigt.
Vita
Michael Frank, Schriftsteller und Publizist, hat unter anderem für die «New York Times», den «Atlantic» und «Time Magazine» geschrieben. Für seine Familienerinnerungen «The Mighty Franks» (2017) erhielt er den JQ Wingate Prize, 2019 erschien sein Debütroman «What Is Missing». 2015 lernte Frank die damals über neunzig Jahre alte Stella Levi kennen. Geboren 1923, wuchs Levi in einer Gemeinschaft sephardischer Juden auf Rhodos auf. 1944 wurde sie nach Auschwitz deportiert; sie überlebte. Ihr Weg führte sie über Italien in die USA. Levi ist Vorstandsmitglied des Centro Primo Levi in New York. «Einhundert Samstage» wurde vom «Wall Street Journal» zu einem der zehn besten Bücher des Jahres 2022 gewählt. Es wurde mit dem National Jewish Book Award, dem Natan Notable Book Award und der Sophie Brody Medal ausgezeichnet.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel «One Hundred Saturdays: Stella Levi and the Search for a Lost World» bei Avid Reader Press, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Copyright © 2022 by Michael Frank
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München,
nach dem Original von Simon & Schuster Inc.
Coverabbildung Maira Kalman
ISBN 978-3-644-01686-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Das Meer ist ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Dank
Ausgewählte Bibliografie
Bildnachweis
Tafelteil
für
Stella,
natürlich,
und in Erinnerung an meine Großmütter
Sylvia Shapiro Ravetch
und
Harriet Frank Sr.,
allesamt Geschichtenerzählerinnen
«Die ungeheure Welt, die ich im Kopf habe …»
Kafka
Das Meer ist nicht weindunkel, sondern von einem so bodenlosen und durchsichtigen Blau, dass es wehtut hinzusehen, so wie es wehtun kann, einem anderen Menschen in die Augen zu sehen. Ich betrachte dieses bodenlose, durchsichtige Blau und höre einer zweiundneunzig Jahre alten Frau zu, die mir erzählt, was an dieser Küste, hier an dieser Stelle, fast auf den Tag genau vor einundsiebzig Jahren geschah.
23. Juli 1944: ein Sonntag. Die Deutschen wählten absichtlich einen Sonntag, erzählt sie mir, denn am Sonntag waren alle Geschäfte geschlossen. Und sie lösten die Luftschutzsirenen aus, obwohl an diesem Tag keine Flugzeuge in Sicht waren und keine Bomben vom Himmel fielen, weil die Sirenen dafür sorgten, dass alle in ihren Häusern blieben – alle anderen. In den sechs, vielleicht auch mehr Stunden, die sie – über 1700 Menschen – brauchten, um zum Hafen hinunterzugehen, gab es nicht einen Zivilisten, der bewusst Zeuge wurde, Einspruch erhob oder kam, um sich zu verabschieden.
Es war wie ein Leichenzug von Menschen, sagt sie, die um sich selbst trauern.
Hier, wo wir stehen, wurde die gesamte jüdische Gemeinde der Insel Rhodos – ihre Gemeinde, auf ihrer Insel, dem Ort, den sie für ihren eigenen kleinen Fleck Land hielt – auf drei Schiffe verladen, die diese über 1700 Menschen zum Hafen von Piräus brachten, von dort ins Gefängnis von Chaidari und von dort zu den Zügen, die sie zwei Wochen später nach Auschwitz transportierten – zeitlich und geografisch bemessen die insgesamt längste und in vielerlei Hinsicht eine der absurdesten, wenn nicht die absurdeste aller Deportationen.
«Wir waren Alte, junge Frauen und Kinder», sagt sie. «Die meisten von uns hatten die Insel in ihrem Leben noch nie verlassen, auch ich nicht. Es wäre einfacher gewesen, man hätte uns hier umgebracht, damit wir wenigstens bei unseren eigenen Leuten begraben werden.»
Jetzt blickt die Zweiundneunzigjährige – Stella Levi – aufs Wasser, zum Horizont. Sie betrachtet die saubere, scharfe Linie, die Wasser von Himmel trennt, ein Blau vom anderen. Dann wendet sie sich wieder mir zu. Ihr Gesicht ist düster, ihre in die Ferne gerichteten Augen sehen, was ich mir nicht vorstellen kann.
Einen Moment lang schweigt sie, ehe sie sagt: «Vielleicht kann man an einem bestimmten Punkt nicht mehr leibhaftig zurückkehren. Vielleicht geht es dann nur noch in Gedanken.»
Stella ist nicht zum ersten, aber vermutlich zum letzten Mal in die Juderia von Rhodos gekommen, um eine Verbindung herzustellen – oder es zumindest zu versuchen – mit dem Viertel, in dem sie zur Welt kam und aufwuchs wie ihre Eltern, Großeltern und viele Generationen zuvor seit dem späten fünfzehnten Jahrhundert, als sephardische Juden aus Spanien verbannt wurden und sich über Europa und den Mittelmeerraum zerstreuten. Weil sie hier ist, bin auch ich hier, obwohl ich sie noch nicht annähernd so gut kenne wie heute. Als ich während eines Aufenthalts in Rom erfuhr, dass sie eine Rückkehr nach Rhodos plante, buchte ich ein Ticket und lud mich mehr oder minder selbst ein. Später wird sie mir erzählen, dass dies einer der Gründe für ihren Entschluss war, mir ihre Geschichte anzuvertrauen. Später werde ich verstehen, dass ich sie auch begleitete, um ihr Vertrauen zu gewinnen.
Wir beide waren uns erst ein paar Monate zuvor in der Casa Italiana begegnet, dem Sitz der Abteilung für italienische Studien der NYU in Greenwich Village, wo ich an einem Abend im Februar 2015 zu spät zu einem Vortrag kam und mich hastig auf einen Stuhl setzte, den einzigen freien Platz an einem langen rechteckigen Holztisch. Während ich noch verschnaufte, schwebte eine Frage über meine Schulter, gestellt mit einem starken italienischen Akzent: «Wo kommen Sie denn her, dass Sie es so eilig haben?»
Die fragende Frau war älter, elegant. Ihre Züge waren energisch, ihr braun getöntes Haar umrahmte makellos frisiert ihr Gesicht. Sie trug einen dunklen Rock, eine Strickweste und Ringe mit Steinen an den langen Fingern.
Ich erklärte ihr, dass ich aus einem Französischkurs kam. Sie nickte gedankenvoll.
Ich war, wie sie, in die Casa Italiana gekommen, um mir einen Vortrag über die Beziehung zwischen Museen, Gedenkkultur und dem Hitlerfaschismus anzuhören. Die Redner sprachen über Gedenkstätten, die Probleme im Zusammenhang mit der Kennzeichnung der realen Schauplätze, an denen abscheuliche Ereignisse stattgefunden haben, oder mit der Erinnerung an diese abscheulichen Ereignisse an Orten, die nichts damit zu tun hatten.
Sie hatte noch eine zweite Frage: «Darf ich fragen, warum Sie Französisch lernen?»
Ihre braunen Augen waren stechend und äußerst neugierig. Ich spürte, dass sie eine präzise oder zumindest interessante Antwort erwartete. Aber ich hatte nur eine ganz gewöhnliche Antwort parat. Ich erklärte, dass Französisch die erste Fremdsprache war, die ich gelernt hatte, beginnend in der Mittelstufe, und dass ich, nachdem ich jahrelang mehr Italienisch gesprochen hatte, mein Französisch wieder etwas aufzufrischen versuchte. Ich wolle mich nicht blamieren, wenn ich auf Reisen war, sagte ich. Und dass ich eines Tages Proust in seiner eigenen Sprache lesen wolle.
Irgendwie befürchtete ich, dass dies alles nach Baguette-Croissant-Béret klang – im Sinne von: Ich wäre gern in der Lage, in einem Pariser Geschäft nach solchen Sachen zu fragen.
Sie nickte wieder. «Wollen Sie wissen, wie hilfreich die französische Sprache in meinem Leben war?»
Nachdem sie festgestellt hatte, dass ich Italienisch sprach, wechselte sie die Sprache wie ich nun auch. «Certamente.»
«Als ich nach Auschwitz kam», sagte sie, «wussten sie nicht, was sie mit uns anfangen sollten. Juden, die kein Jiddisch sprechen? Was sind das denn für Juden? Judäo-Spanisch sprechende sephardische italienische Juden von der Insel Rhodos, versuchte ich zu erklären, ohne Erfolg. Sie fragten, ob wir Deutsch sprächen. Nein. Polnisch? Nein. Französisch? ‹Ja›, sagte ich. ‹Französisch spreche ich …›»
Sie verstummte. «Ich sprach Französisch, etwas Französisch, weil meine Schwestern die Alliance Israélite Universelle besucht hatten. Was sie lernten, gaben sie zu Hause weiter. Außerdem hatte ich die Sprache später in der Schule, so wie viele Mädchen auf Rhodos. Weil wir Französisch sprachen, steckten sie uns in Auschwitz zu den Französinnen und Belgierinnen, die Französisch und Jiddisch sprachen, dazu ein wenig Deutsch, genug, um zu übersetzen und zu kommunizieren. Und sie verstanden. Weil sie verstanden, was vor sich ging, gelang es ihnen zu überleben – und folglich auch uns.»
Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. «C’est comme ça que le français m’a servi dans ma vie.»
Am folgenden Morgen erhielt ich einen Anruf von Natalia Indrimi, der Direktorin des Centro Primo Levi, einer in New York ansässigen Organisation, die sich mit der Erforschung der italienisch-jüdischen Vergangenheit befasste und auf deren Initiative der Vortrag stattgefunden hatte. Ich kannte Natalia, weil ich sie um Hilfe bei der Recherche für eine während der Kriegsjahre in Italien spielende Geschichte gebeten hatte, ein Thema, das mich interessierte, seit ich in meinen Zwanzigern einige Zeit dort gelebt hatte.
Stella Levi, sagte Natalia, die Frau, neben der ich am Abend zuvor gesessen hatte, habe sich über unsere Begegnung gefreut. Als ich sagte, das beruhe auf Gegenseitigkeit, erklärte sie mir, Stella habe für einen Vortrag an einem der kommenden Abende im Centro Primo Levi etwas über ihre Kindheit und Jugend in Rhodos geschrieben, und da sie sich ihres geschriebenen Englischs unsicher sei, wolle sie mich fragen, ob ich mich mit ihr treffen würde, um ihr bei der Überarbeitung der wenigen Seiten zu helfen.
Als ich zwei Tage später unter einer grünen Markise am University Place vorbeiging, ahnte ich nicht, dass dies der erste von einhundert Samstagen war, die ich in den folgenden sechs Jahren in der Gesellschaft einer Frau verbringen würde, die mit der Zeit für mich eine Scheherazade, eine Zeugin, eine Beschwörerin und eine Zeitreisende wurde, die ich auf ihrer Reise begleiten durfte.
Vielleicht kann man nur in Gedanken zurückgehen?
Vielleicht.
1
«Ich denke schon länger darüber nach, ob es vielleicht Zeit wäre, wieder zu einem Psychiater zu gehen.»
Mit diesem Satz – es ist nicht der erste, aber fast – empfängt Stella mich in ihrer Wohnung.
«Ich weiß nicht, ob ein Psychiater überhaupt etwas mit mir anfangen könnte», fügt sie hinzu. «Als ich in den 1950ern nach New York zog, war ich bei drei verschiedenen. Auch damals wussten sie nicht, was sie mit mir anfangen sollten.»
Ich trete in ihre kleine Diele. Stella nickt in Richtung eines Stuhls, auf den ich meine Jacke lege.
«Sie konnten mit keinem etwas anfangen, der aus den Lagern zurückkam. Wie auch, sie waren schließlich nicht dort gewesen. Das änderte sich auch nicht, als ich ihnen davon erzählte oder es zumindest versuchte. Aber vielleicht war ich auch diejenige, die nicht bereit war.»
Stella setzt sich in ihren Sessel und zeigt auf das danebenstehende Sofa. Sie trägt eine schicke legere Hose, eine weiße Bluse und wieder eine Strickweste.
Ich nehme Platz.
«Was meinen Sie?», fragt sie. «Ist das eine gute Idee?»
Ich denke: Psychotherapie – am späten Ende des Lebens? Mit Sicherheit würde es einige Nachforschungen und Versuche erfordern, um die richtige Person zu finden. Und wie sollte eine solche Person sein? Was müsste sie erlebt, studiert oder gelesen haben, um jemanden mit Stellas Hintergrund verstehen, geschweige denn ihr helfen zu können?
Sie wartet meine Antwort nicht ab. «Ich bin mir nicht sicher. Seit einiger Zeit fühle ich mich nicht wohl in meiner Haut. Mein Gefühl sagt mir, dass ich reden muss.»
Sie sieht mich unverwandt an, eine zweiundneunzigjährige Frau mit einer Frage, einem Bedürfnis. Da sind wir: von Angesicht zu Angesicht an einem ruhigen Samstagnachmittag in ihrer Wohnung in Greenwich Village bei unserem ersten richtigen Treffen.
«Sind die Lager … etwas, über das Sie jetzt sprechen möchten?», frage ich.
In ihren Augen blitzt etwas auf, nicht ganz Ärger, aber fast. «Ich dachte, Sie sind hergekommen, um sich ein paar Seiten anzusehen, die ich über Rhodos geschrieben habe.»
«Bin ich auch», erwidere ich vorsichtig.
Sie bedenkt mich mit einem Blick, den ich als misstrauisch deute, und öffnet eine Mappe. Wie sich zeigt, ist es die falsche, denn sie springt auf und eilt zu ihrem Schreibtisch, der in einer Ecke des Wohnzimmers steht – und aufspringen ist das richtige Wort; es scheint, als ob sich eine fest gewickelte Spule löst und sie in die Luft katapultiert.
Ich habe noch nie eine Neunzigjährige gesehen, die sich so bewegt. Und auch keine Achtzigjährige, wenn ich’s mir recht überlege.
Ein paar Sekunden später drückt sie mir mehrere maschinengeschriebene Seiten in die Hand. Sie erwartet, und daran besteht kein Zweifel, dass ich sie unter ihrem Blick lese und mich dazu äußere, während ich auf diesem Sofa sitze. Ich komme mir vor wie in einer Prüfung.
Sorgfältig lese ich sie, wohl wissend, dass sie mich die ganze Zeit nicht aus den Augen lässt. Auf diesen Seiten offenbart Stella einen Schnappschuss, mehrere Schnappschüsse, von ihrer Jugend in der Juderia. Sie beschreibt einen exotischen Brauch, die sogenannte enserradura, etwas, das eine ältere Frau an einer meist unverheirateten, nervösen oder depressiven jungen Frau ausführte: Man wurde sieben oder acht Tage zusammen mit dieser Frau im Haus eingesperrt, eine Art Heilerin, die mit traditionellen Heilmitteln und Kuren arbeitete – auch Stellas Großmutter mütterlicherseits war eine. Für eine Woche mit dieser Heilerin abgeschottet, durfte man nur Wasser und eine dünne Brühe zu sich nehmen. Während der enserradura wurden die Häuser zu beiden Seiten geräumt, damit vollkommene Stille und Ruhe herrschte, wenn die Heilerin am Bett der jungen Frau mit einer Handvoll mumya saß, der angeblichen Asche jüdischer Heiliger aus dem Heiligen Land. Mit mumya in der Hand umkreiste die Heilerin das Gesicht der jungen Frau und sprach dabei ein Gebet. Sie betete und kreiste, bis beide gähnten, und am folgenden Morgen machte sie dann weiter. Nach sieben oder acht Tagen galt die junge Frau als geheilt. Sie stand auf und ging ins türkische Bad, um sich zu waschen und alle schlechten Gefühle entschlossen fortzuschicken.
Ich beende die Lektüre über diesen Brauch, diese enserradura, und blicke zu Stella, die im zweiten Jahrzehnt des einundzwanzigsten Jahrhunderts in ihrem Wohnzimmer sitzt, die Wände gestrichen in abwechselnd sattem Ockergelb und pompejanischem Rot, in den Regalen Bücher in fünf verschiedenen Sprachen, auf dem Boden dicke, dämpfende türkische Teppiche, des Weiteren Computer, Fernseher und diverse Geräte. «Ich schätze mal, Sie mussten sich als junges Mädchen nie einer enserradura unterziehen.»
«Ach ja? Wie kommen Sie darauf?»
«Intuition.»
Sie fokussiert ihre stechenden, klaren Augen auf mich, ehe sie sagt: «Natürlich nicht. So ein Mädchen war ich nicht. Und auch keine meiner Schwestern. Meine Schwester Felicie – die Intellektuelle in der Familie – sagte sogar oft: ‹Über solche Dinge dürfen wir nicht mal sprechen. Die Moderne hat Einzug gehalten – die westliche Welt steht an unserer Schwelle. Freud, Thomas Mann.›» Sie verstummt. «Heute kann ich darüber sprechen. Inzwischen habe ich eingesehen, dass die Welt, in die ich geboren wurde, sogar … ich weiß nicht … interessant gewesen sein könnte.»
«Damals sahen Sie das anders?»
«Damals wollte ich frei sein. Ich wollte ein Leben, ein größeres Leben, als es sich mir in dieser kleinen Gemeinde auf dieser kleinen Insel mitten im Nichts bot.»
Sie lehnt sich zurück und zeigt auf die Seiten, die ich eben gelesen habe. «Und? Was denken Sie?»
«Ganz ehrlich, ich bin nicht sicher, ob Sie meine Hilfe brauchen.»
«Das Englisch ist nicht perfekt», sagt sie.
«Das Englisch ist nicht fehlerlos, aber die Geschichten … über Ihre Tante Tia Rachel zum Beispiel, die auf ihrer Terrasse das Regenwasser auffängt, um ihrer Tochter die Haare zu waschen. Die mit Schüsseln und Töpfen draußen steht, während sich der Himmel öffnet und es in Strömen gießt, und Ihr Onkel, der sagt –»
«Esta en ganeden – sie ist im Paradies.»
Als ich verwirrt wirke, fügt Stella hinzu: «Es war ihr eine Freude, das Regenwasser zu sammeln.» Sie winkt mit der Hand. «Ich möchte, dass Sie in Ordnung bringen, was ich geschrieben habe. Machen Sie das?»
Ja, antworte ich. Einverstanden.
2
In der folgenden Woche friemele ich an Stellas Text herum und schicke ihn per E-Mail zurück. In ihrer Antwort schreibt sie, sie habe das Gefühl, alles sei immer noch falsch. Das stimmt nicht, aber ich werde noch merken, dass sich Stella nicht leicht zufriedengibt. Oder genauer gesagt, es fällt Stella nicht leicht, mit sich zufrieden zu sein.
Am folgenden Samstag kehre ich zurück, und wir gehen meine Änderungsvorschläge durch. Das Ganze dauert vielleicht zehn, fünfzehn Minuten. Danach schiebt sie die Seiten in die Mappe zurück, sieht die Mappe melancholisch an und seufzt.
Schweigend sitzen wir da.
Ich beschließe, ihr zu erzählen, was mir in der vergangenen Woche durch den Kopf ging. Wenn sie bereit sei, sage ich, würde ich gern weiterhin am Samstag kommen. Ich möchte sie zu ihrem Leben in Rhodos, in den Lagern und nach den Lagern befragen.
«Vielleicht über alles andere», sagt sie, «aber nicht die Lager.»
«Wieso nicht die Lager?»
«Weil ich nicht so jemand sein will.»
Ich frage sie, was sie damit meint. Sie beschreibt den Typus von Überlebenden, die ihre Erlebnisse so oft geschildert haben, dass sie verkümmert und fern erscheinen – mechanisch. Sie versteht nicht, warum Leute das tun. Sie wollte nie eine auf dem Podium stehende Überlebende, eine Erzählerin des Holocaust sein, erstarrt, ohne neue Ideen oder Perspektiven, eine, die nur dieses eine Ereignis in einem langen, vielschichtigen Leben derart in den Mittelpunkt rückt.
Ich verstehe, versichere ich ihr. Aber trotzdem – wie wäre es, wenn sie mir über ihr Leben in Rhodos davor erzählt, im Stil der Seiten, die sie mir zu lesen gegeben hatte? Wie wäre es, wenn sie diese Lebensweise, diese Menschen, diese Welt erhalten könnte?
«Von uns sind nur noch eine Handvoll übrig», sagt sie nachdenklich.
«Ein Grund mehr», sage ich. «Denn wenn Sie … gehen, geht die Geschichte dieses Ortes und dieser Leben mit Ihnen.»
«Glauben Sie, ich weiß das nicht?» In etwas milderem Ton fügt sie hinzu: «Ich habe so vieles nicht erzählt. Alles, was – schwierig war.»
«Haben Sie Kinder?», frage ich.
«Einen Sohn, ja. John.»
«Haben Sie John von dem Schwierigen erzählt?»
«Nicht viel.»
«Warum das?», frage ich.
«Ich wollte ihn nicht belasten.»
«Und Ihren Enkelkindern, falls Sie welche haben?»
«Drei: Randy, Rita und Lewis.» Sie hält inne. «Ihnen habe ich ein bisschen was erzählt, aber …»
«Aber?»
«Ich nehme an, ich war nicht bereit.»
«Wie bei den Psychiatern?»
Sie nickt nicht. Aber sie schüttelt auch nicht den Kopf.
«Sind Sie jetzt bereit?»
«Vielleicht nächstes Mal», sagt sie und steht auf.
3
Am folgenden Samstag nehmen wir wieder unsere Plätze ein: sie in ihrem Sessel, ich auf dem Sofa neben einer weißen Porzellanlampe mit einem Blumen- und Blätterrelief.
Wir tauschen Höflichkeiten aus und sitzen dann eine Weile betreten schweigend da.
«Sollten Sie mich nicht etwas fragen, um mich in Schwung zu bringen? Wo ich zum Beispiel geboren bin, meine erste Erinnerung, etwas in der Art?»
Ihr Blick: misstrauisch und provozierend zugleich.
«Erzählen Sie mir doch, wann Sie zum ersten Mal gemerkt haben, dass Sie anders sind.»
«Wie kommen Sie darauf, dass ich anders war?», fragt sie, und jetzt funkeln ihre Augen.
Sie war vierzehn, seit ein, zwei Monaten. Die Idee kam ihr mitten in der Nacht – sie hatte keine Ahnung, warum. Vermutlich, weil sie ihre nächstältere Schwester Renée beobachtet hatte, die sechzehn geworden war und anfing, stundenlang im Wohnzimmer oder in ihrem kortijo zu sitzen, dem für die besseren Häuser in der Juderia typischen von Mauern umgebenen Hof, und plötzlich wie eine ältere Frau neben ihrer Mutter nähte, stickte und sich vorbereitete – auf den Mann, den sie noch nicht kannte und nicht selbst auswählen würde. Nachthemden, Taschentücher, Tischwäsche. Bettlaken, Kissenbezüge. Stella verabscheute jegliche Handarbeiten. In ihren Augen war es ein lächerlicher Zeitvertreib für ein Mädchen, sich auf diesen Phantommann oder -jungen vorzubereiten, den jemand (ihre Mutter, eine andere Mutter, ein Onkel, eine Heiratsvermittlerin) aus den verfügbaren Kandidaten herauspickte und ihr wie einen Hauptgewinn präsentieren würde. Sie hatte eine andere Idee. Eines Abends holte sie vor dem Zubettgehen einen alten Koffer hinten aus einem Schrank, wischte eine dünne Staubschicht ab und breitete ihn auf dem Boden aus. Dann packte sie ihn sorgfältig mit Kleidern, Schuhen, leeren Notizbüchern, Stiften und einem Mantel, stellte ihn neben die Tür und ging schlafen.
Am nächsten Morgen entdeckte ihre Mutter den Koffer und fragte, ob sie vorhabe, irgendwohin zu gehen.
«Natürlich», antwortete sie. «An die Universität in Italien.»
«Natürlich, an die Universität in Italien», wiederholte Miriam, ihre Mutter. Miriam hatte nur die Grundschule besucht, und mit einer Ausnahme war keine ihrer Töchter über die Mittelstufe hinausgekommen. Aber sie lachte nicht und regte sich nicht auf. Sie sagte nicht: Mit achtzehn werden dir diese Kleider zu klein sein. Sie sagte nicht: Du wärst das erste Mädchen in der Juderia, das so etwas macht. Sie nickte nur in Richtung des Koffers und ließ die Sache auf sich beruhen.
Vielleicht war es leicht, das Nesthäkchen der Familie in Ruhe zu lassen, zumal es noch ältere Mädchen gab, drei an der Zahl, um die es sich zu kümmern und für die es zu planen galt, sprich, die noch unter die Haube gebracht und im Leben etabliert werden mussten.
Bei Renée, die Stella altersmäßig am nächsten war, wurde dieser Vorfall ein Witz: Stella und ihr gepackter Koffer, Stella, die mit vierzehn vorhatte, an die Universität in Italien zu gehen. Doch nicht für Stella. Ihr Koffer stand monatelang bereit und wurde gelegentlich von ihr umgepackt. Die Witze blieben, während die Monate zu Jahren wurden. Genau wie der Koffer.
4
Aber woher kam die Idee, mit vierzehn zu packen, um zur Universität zu gehen?
Vermutlich durch ihre Schwester Felicie, wobei Stella unschlüssig ist, ob ihretwegen oder trotz ihr.
Sie waren sieben Geschwister – Morris, Selma, Felicie, Sara, Victor, Renée und Stella. Aber da Morris Rhodos schon vor Stellas und Renées Geburt verließ und Selma fortging, als Stella gerade sechs war, war Felicie für den Großteil von Stellas Kindheit das älteste Geschwisterkind im Haus, und sie war noch dazu ein sehr ungewöhnliches.
Stella stahl sich oft aus dem Bett, um Felicie zuzuhören, die mit ihrem Freund Robert Cohen bis spät in die Nacht aufblieb und immer nur redete. Robert war offenbar nicht Felicies fester Freund. Erstens passten seine Socken nicht zusammen, und dann saßen sich die beiden mit großem Abstand gegenüber und schienen sich nicht zu berühren. Aber sie redeten (und redeten … und redeten), tauschten Gedanken aus und erwähnten Namen, die Stella kaum kannte: Henri Bergson. Tolstoi. Proust. Außerdem verhielt Felicie sich nicht wie andere Mädchen in der Juderia oder gar in der Familie; sie war nicht wie Selma (soweit Stella sich an Selma erinnerte) oder Sara, die ihrer Mutter beim Kochen half. Sie saß in ihrem Zimmer und las den ganzen Tag bis in die Nacht. Auch zum Abendessen kam sie nicht, wenn sie gerufen wurde. Sie las so viel, dass sie am Hinterkopf eine kahle Stelle bekam, für die Dr. Hasson eine spezielle pomata anrühren musste.
Felicie war nicht für die moderne Welt geschaffen; sie gehörte auch nicht nach Rhodos. Sie besaß den Grips einer europäischen Intellektuellen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts im Körper einer jungen Frau, die im Nahen Osten aufgewachsen war; sie hatte eine andere Mentalität, ein völlig anderes Wesen. Felicie interessierte sich nicht für Kleider. Sie machte sich nicht die Mühe, die wenigen verbliebenen Haare am Hinterkopf zu kämmen. Als die Familie für ein Foto außerhalb der von mittelalterlichen Mauern umgebenen Altstadt posierte, drehte sie dem Fotografen als Einzige unter den Kindern den Rücken zu.
Was war los mit ihr? Stimmte etwas nicht mit ihr?
5
Felicie war das erste Mitglied der Familie, das die Juderia nach der Mittelstufe verließ, um bei den suore, den Nonnen der scuola femminile, der italienischen Oberschule für Mädchen, zu lernen, und ermutigte Stella, ihrem Beispiel zu folgen. Felicie war eine so herausragende Schülerin, dass Stella noch Jahre später, als sie ihr in die Schule folgte, von der madre superiora am ersten Tag mit den Worten begrüßt wurde: «Vediamo un pò se sarai brava come Felicie» – wir werden sehen, ob du eine ebenso gute Schülerin wie Felicie bist.
Felicie setzte den Maßstab. Und zwar nicht nur in der Schule. Sie und ihre gleichgesinnten Freunde nahmen Stella zu einer Besichtigung des Monte Smith mit, wo italienische Archäologen die Akropolis mit ihren Tempeln, dem Stadion und dem Theater ausgruben, das angeblich als legendäre Schule der griechischen Rhetorik gedient hatte. Sie besuchte auch griechisch-orthodoxe Kirchen und befasste sich gern mit Moscheen – jedenfalls von außen. Durch Felicie begriff Stella, dass sie von etwas Bedeutendem abstammten, das einen weiteren Horizont hatte als die Juderia mit ihrem Strand und Kay Ancha, dem großen Platz mit den verschiedenen Läden. Felicie war die erste junge Frau, von der Stella hörte, sie habe keine Lust, ihre Aussteuer vorzubereiten. Sie dachte überhaupt nicht ans Heiraten, hatte keinen Freund (und auch keine Freundin) und stellte Autoritäten, Vorschriften und Ansichten infrage.
Felicie erklärte ihren eigenen Eltern die Natur des Menschen. Als Sara länger als gewöhnlich unterwegs war und Miriam besorgt an der Tür wartete, während Stella zusah und sich angstvoll fragte, was bei ihrer Rückkehr passieren würde, setzte sich Felicie mit ihrer Mutter und ihrem Vater hin und lieferte einen kurzen Diskurs über menschliche Freiheit und Glück, in dem sie gleichzeitig rechtfertigte, weshalb es völlig in Ordnung war, wenn eine junge Frau ihrem freien Willen folgte und nach Hause kam, wann sie wollte.
Beim Belauschen der spätabendlichen Gespräche von Felicie und Robert Cohen hörte Stella auch zum ersten Mal, dass sich jemand kritisch über das faschistische Regime äußerte, unter dem sie alle aufwuchsen, auch wenn sie damals kaum verstand, was das hieß. Sie wusste nur, dass die Gespräche ihrer älteren Schwester ihre Eltern irgendwie beunruhigten und, hätte jemand mitgehört, sie alle in Gefahr hätten bringen können. «Nur gut», sagte Miriam, «dass sie sich nur abends unterhalten.»
Felicie, die weise Tochter, die Leserin, die kluge, politisch interessierte Schülerin: Sie schrieb einen brillanten Essay über Verbrechen und Strafe nach Auffassung der alten Griechen. Das bewog David Amato, einen der wenigen Männer aus der Gemeinde, die zum Studieren ins Ausland gereist waren, zu dem Vorschlag, Felicie solle nach Paris gehen und an der Sorbonne studieren, um Lehrerin zu werden, der naheliegende (und quasi einzige) Weg für eine schlaue junge Frau, die keine Lust hatte, zu heiraten, in einem Geschäft oder einem Büro zu arbeiten oder ein Handwerk auszuüben.
Miriam hatte eine Cousine, die in Paris lebte. Felicie sprach fließend Französisch. Sie wäre dort nicht allein gewesen – jemand würde ihr einen Teller Suppe hinstellen und ihr Gesellschaft leisten, während sie studierte –, doch Felicie lehnte ab. Sagte spontan und unmissverständlich Nein.
Stella traf der fehlende Mut ihrer Schwester schwer: «In ihrem Denken war Felicie ein offenherziger Freigeist, aber nicht in ihrer Seele. Es hätte ihr Leben verändert, vielleicht unser aller Leben, wer weiß. Doch stattdessen zog meine Schwester den Vorschlag noch nicht einmal in Betracht. Sie hatte Angst davor, in der Welt da draußen zu leben.»
6
Wenn Felicie ein unvollkommenes Vorbild war, dann war Renée das Anti-Vorbild. Die 1921 geborene und somit um zwei Jahre ältere Renée war ein modisches Mädchen, pingelig, was Kleidung, Schuhe und Haare anging. Stella achtete wenig auf ihr Äußeres (aber mehr als die schlicht gekleidete Felicie). Renée war eine signorina, eine richtige junge Dame, die nie ein Wort wie das leicht vulgäre pasticcio (Schweinerei) in den Mund nahm; Stella sagte, was ihr in den Sinn kam. Die zögerliche, zarte Renée war Asthmatikerin und wurde von ihrer besorgten Mutter oft verhätschelt. Stella war robust, eine Langstreckenschwimmerin, die im aufgetragenen Badeanzug der letzten Saison zum Strand ging, während Renée das neueste Modell haben musste. Stella war eine furchtlose Taucherin, hatte haufenweise Freundinnen. Sie war neugierig, ehrgeizig und mutig. Renée war wählerischer und anspruchsvoller, in jeder Hinsicht das besonnene Gegenteil.
«Aber wissen Sie», sagt Stella, «nach all den Jahren bin ich mir nicht sicher, ob Renée immer so zart und vorsichtig war oder ob meine Mutter sie nur so behandelte und sie deshalb so wurde. Später stellte ich fest, dass sie in ihrem tiefsten Inneren stark war, aber sie galt nun mal als die zerbrechliche, die ständig ermahnt wurde, einen Pullover anzuziehen oder nicht ins Wasser zu gehen, wenn es zu kalt war. So ist das in Familien. Eine ist so, dann muss die Nächste anders sein …»
Ich frage Stella, was sie daraus schloss.
«Die Freiheit zu wählen, was ich sein wollte», sagt sie.
7
Mit fünfzehn begann Renée zusammen mit Miriam, an ihrer Aussteuer zu arbeiten. Nachdem die älteren Mädchen aus dem Haus waren, hatte Miriam nichts mehr zu tun – und eine Aussteuer für Felicie kam schließlich nicht infrage. Sie nähte Renée ein wunderschönes camicia da notte aus Satin; sie bestickte Tischwäsche und die Kanten von Handtüchern. Wie bestellt wurde Renée sechzehn und hatte un flirt mit dem Sohn des Bankiers Alhadeff; in der Gemeinde wurde darüber getuschelt, und Miriam hörte davon. Als Sprössling des weit weniger vermögenden Zweigs einer Bankiersfamilie hatte Miriam ein scharfes Gespür für die lokale soziale Hierarchie. «Erhebe dich nicht über deinen Stand», ermahnte sie Renée. «Daraus wird nichts.» Und sie behielt recht.
Aber wenn Renée nicht den Sohn des Bankiers heiraten konnte, wen sollte sie dann heiraten?
Mit Sicherheit niemanden in der Familie, auch wenn Cousins und Cousinen in der Juderia mitunter heirateten. Stellas Großmutter mütterlicherseits, Sara Notrica, die Heilerin, war ein solcher Fall. Sie war mit Mosche, ihrem Cousin ersten Grades, verheiratet gewesen, und ihr Urteil zu dieser Konstellation lautete: «Heirate nie einen Verwandten, niemals.»
Die Mädchen hörten das ständig, während sie aufwuchsen. Es war eine Warnung, ein Fluch. Als ein Cousin, der im Kongo lebte, ein absolut seriöser junger Mann, um Renées Hand anhielt, sagte sie, sie könne diesen Gedanken noch nicht einmal in Erwägung ziehen.
Mosche Notrica starb vor Stellas Geburt, aber sie wuchs mit dem Wissen auf, dass ihre Cousin-Großeltern getrennt lebten – in der damaligen Zeit und an diesem Ort –, und das beeindruckte sie. Ebenso wie die Tatsache, dass ihre Großmutter Sara in einem Haus lebte, das ihr reicher Bankiersbruder Giuseppe Notrica ihr überlassen hatte, ein angesehener Philanthrop in der Gemeinde, der keine eigenen Kinder hatte und es sich zur Aufgabe machte, das Leben junger Menschen zu verbessern (er unterstützte die Schule, baute Häuser, mit deren Miete er Bücher und Kleidung für arme Schüler kaufte, und gründete die Fondazione Notrica, ein soziales und kulturelles Zentrum, in dem Vorlesungen, Tanzabende und andere Veranstaltungen für die ortsansässige Jugend stattfanden). Schon früh wusste Stella instinktiv, dass ihre Familie, zumindest mütterlicherseits, einer bestimmten Klasse von Menschen angehörte, aber eben doch nicht ganz. «Man weiß nie, in welche Richtung sich das Rad des Schicksals dreht», erklärte Miriam ihren Töchtern nachdrücklich. «Man tut gut daran, andere nicht um ihren Besitz zu beneiden oder ihnen deswegen zu grollen.»
Miriam hegte vielleicht keinen offenen Groll, aber ihr Verhalten erzählte eine etwas nuanciertere Geschichte. Als sie in das Haus ihrer Schwiegermutter gegenüber der Synagoge, der Kahal Shalom, zog, verschönerte sie es mit einem Teil ihrer Mitgiftmöbel: einem Buffet, einem hübschen Tisch und Stühlen, vergoldeten schmiedeeisernen Bettgestellen, die für das vorhandene Ambiente zu fein und zu elegant wirkten. An den Wohnzimmerwänden ließ sie Marmor anbringen – einen Streifen schwarz-weißer Steine, sogenannte sheshikos, wie in den besseren Häusern in Rhodos üblich; außerdem einen Kristalllüster; dazu kam ein Eingangsbereich mit einem ansprechenden Tor. «Mein Vater meckerte, weil er nicht gern Geld ausgab», erzählt Stella, «aber er hatte eine Notrica geheiratet … Im Übrigen gab er meiner Mutter ohnehin, was sie wollte.»
Er hatte eine Notrica geheiratet, sprich, eine junge Frau, die vom Geld kam, aber selbst nicht zwingend welches hatte. Die Notricas, die Menasces, die Alhadeffs – oder die Zweige der Familien mit Geld – hatten sich außerhalb der Juderia niedergelassen, in einem Viertel, das als Marasch bekannt war (türkisch für «außerhalb der Stadtmauern») und in weiten Teilen ursprünglich ein bescheidenes griechisches Viertel war, das die Italiener mit modernen Häusern wiederaufgebaut hatten, ausgestattet mit Badezimmern und supermodernen Küchen, in denen Haushälterinnen in gestärkten Uniformen das Regiment führten und nicht Mütter oder Großmütter. Stella ging mit einigen der Mädchen aus dem Marasch zur Schule, war aber trotz der vorgeblichen Philosophie ihrer Mutter, die sie verstand und versuchte zu verinnerlichen, nicht immun gegen gewisse unvermeidliche Vergleiche und die Gefühle, die sie auslösten, besonders nach dem Besuch der Synagoge oder an Feiertagen. «Unsere wohlhabenderen Verwandten schauten nach dem Gottesdienst bei uns vorbei und tranken einen Schluck Wein oder kosteten Mammas selbst gemachtes Marzipan, aber sie blieben nie zum Essen. Eigentlich eine Banalität, aber Kinder sind sehr empfänglich für solche Unterschiede, mich haben sie geprägt. Auf eine Weise, die ich erst später im Leben verstand, nachdem ich viel zu lange Wert auf Kleidung, Äußerlichkeiten und Materielles gelegt hatte …»
Als Sara Notrica starb, fuhr an sieben Morgen ein Chauffeur in einem glänzenden schwarzen Auto durch die engen Straßen der Juderia und setzte ihren wohlhabenden Bruder Chaim vor dem Haus der Levis ab, damit er mit dem Rest der Familie trauern und beten konnte. Am Abend holte der Chauffeur ihn wieder ab und brachte ihn, so schien es, nicht nur schnell wieder in ein anderes Viertel, sondern in eine andere Welt.
Auch das prägte Stella. Auch das vergaß sie nie.
8
Nicht dass die Levis in finanziellen Schwierigkeiten steckten, zumindest nicht in den Vorkriegsjahren. Stellas Vater war einer der erfolgreicheren Rhodeslis (so bezeichneten sich die Gemeindemitglieder auf Judäo-Spanisch) und führte als Holz- und Kohlenlieferant das Geschäft seines Vaters weiter. Er hatte ein Monopol auf Regierungsverträge für den Verkauf von Kohle, mit einem Territorium, das sich auf zwölf Inseln erstreckte, und betrieb mit einem türkischen Partner die äußerst wichtige Zollwaage am Hafen. Jahrzehntelang florierte das Geschäft und ermöglichte der Familie ein gutes oder zumindest recht gutes Leben, nicht wie das der reichen Bankiersonkel, aber mit genügend Mitteln, um die Dienste einer Haushälterin, einer Wäscherin und einer Frau in Anspruch zu nehmen, die kam, um fideos zu machen, Signora Rachel di Dalva, die Stella mit der Aufgabe betraute, die fadendünnen Nudeln zum Trocknen über das Geländer der Terrasse zu hängen. Außerdem teilten sie sich mit einer anderen Familie eine festlich bemalte und aus zwei Räumen bestehende cabina am Strand, wo die jüngeren Kinder ihre Sommer fröhlich und frei in der Sonne verbrachten.
Dennoch waren die Levis stark in der Juderia verwurzelt, was Stella absolut nicht bedauert, zumindest nicht heute (anders war es, als sie sechzehn, achtzehn, zwanzig war und gegen so manche Einschränkungen aufbegehrte, die das Leben in einer so eng verbundenen Gemeinde mit sich brachte). Während Stellas Kindheit und Jugend auf Rhodos gelang es den Juden, Griechen, Türken und schließlich auch den Italienern – trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe, Religionen, Sprachen und Kulturen –, sich die Insel in relativer Harmonie zu teilen, wie sie es jahrhundertelang getan hatten. Dennoch war es äußerst wichtig, wo man lebte, und es wurde für Stella zunehmend wichtiger, wenn sie die bleibenden Themen ihres langen und abwechslungsreichen Lebens rückblickend betrachtete: «Wer außerhalb der Juderia wohnte, gehörte nicht wirklich dazu, denn man konnte nicht wirklich zu den Italienern, Griechen oder Türken gehören.»
Wer in der Juderia blieb, lebte unter den alten Frauen, die nachmittags draußen saßen und Geschichten erzählten, immer in Reichweite der Synagoge, wo man in Notfällen eine Öllampe anzünden oder beten konnte. Speisen brachte man zum Backen zum Gemeindeofen, und während man wartete, bis sie fertig waren, vertrieb man sich die Zeit und plauderte mit den Freundinnen. Gebadet wurde nicht zu Hause, weil es dort weder Bäder noch Duschen gab, sondern einmal in der Woche vor dem Schabbat im türkischen Bad. Man sang und lernte die spanischen romansas; man sog die Sprichwörter auf (ein Gelehrter allein zählte zwölftausend) und lebte danach, als wären sie Moleküle in der Luft oder Blut in den Venen; man lernte, die herzhaften Gerichte und Süßspeisen der Großmütter zuzubereiten; man ging vorsichtig über das unebene Kopfsteinpflaster; und beim Einschlafen atmete man den Duft der Höfe, diese intensive, unvergessliche Mischung aus Jasmin und Rosmarin, Lavendel und Rosen und Weinraute.
«Keins der Mädchen, die außerhalb lebten, könnte Ihnen etwas von alldem erzählen», sagt Stella. «Ich kann es.»
9
Eines Abends, als sie elf oder zwölf war, lauschte Stella wieder bis spätnachts einem Gespräch zwischen Felicie und Robert Cohen. Diesmal ging es um Gott, aber worum im Einzelnen, konnte sie nicht sagen – bis am nächsten Morgen beim Frühstück ihr Vater, der offenbar auch zugehört hatte, zu Felicie sagte: «Wolltet ihr, du und Robert, damit sagen, dass der Mensch Gott erfunden hat? Habe ich das richtig verstanden?» Felicie holte tief Luft und antwortete: «Ja, Papa, so sehe ich es, und so sehen es heutzutage viele von uns.»
Der Mensch hatte Gott erfunden? Stella rechnete mit einem Erdbeben, einem Sturm. Stattdessen neigte Yehuda den Kopf. Er war nicht verärgert, sondern verblüfft und neugierig. Verwirrt. Dieser Mann, der wie die meisten Menschen in der Juderia sein Leben nach dem jüdischen religiösen Kalender ausrichtete, der nie einen Ruf zum Gebet, einen Feiertag oder ein Ritual verpasste, der stets seine Zizit trug, wenn er zur Arbeit ging, allerdings verborgen unter seinem Hemd, und der seine Schabbatnachmittage nach dem Gebet mit dem Studium des Talmud verbrachte, hörte lediglich zu, was Felicie zu sagen hatte. Er respektierte ihren Intellekt; er war überzeugt, dass sie etwas wusste, etwas sah oder verstand, das ihm entging – «Entweder das, oder er wollte keinen Streit provozieren.»
Für Stella war es das erste Mal, dass sie jemanden ihre Religion anzweifeln (oder hinterfragen oder reflektieren) hörte. Die Levis lebten gegenüber der Kahal-Shalom-Synagoge. Bei jeder kleinen Sorge und jeder beunruhigenden oder schlechten Nachricht schickte Miriam die Mädchen flugs über die Straße, um ein Gebet zu sprechen oder eine Öllampe anzuzünden, oder sie eilte selbst dorthin. Die Synagoge war ihr Anker; das Judentum bestimmte ihre Zeit, ihr Weltbild, ihr Bewusstsein – aber musste das so sein?
10
Wie üblich wurde auch in diesem Herbst am Vorabend von Jom Kippur eines der Rituale begangen, die Stella überhaupt nicht mochte, die Kapparot-Zeremonie, bei der die Familienangehörigen still dastanden, während ein lebendiges, kreischendes Huhn über den Kopf einer Person geschwenkt wird, in dem Glauben, seine (oder ihre) Sünden würden dabei auf das Huhn übertragen. Währenddessen wurde eine bekannte, in der Juderia oft und unterschiedlich beschworene Wendung rezitiert: «kon el nombre de Avraam, Yishak, i Yakov» – im Namen Abrahams, Isaaks und Jakobs –, und dann schlachtete der Schächter das Huhn, das anschließend an die Armen verteilt wurde.
Als kleines Mädchen hatte Stella manchmal Glück: Weil ihre Familie so groß war, gingen mitunter die Hühner aus, bevor sie an der Reihe war. Aber nicht in diesem Jahr. Sie schloss die Augen und biss die Zähne zusammen … und nach kurzer Zeit war das Übel vorbei.
Nach dem Kapparot durfte Felicie, die Ungläubige, zu Hause bleiben – sie machte es sich an diesem, dem heiligsten Tag des Jahres zur Aufgabe, wenigstens die Bibel oder biblische Kommentierungen zu lesen –, während der Rest der Familie über die Straße in die Synagoge ging.
Stella nahm ihren Platz oben bei den anderen Frauen ein. Ungefähr in der Mitte des Gottesdienstes blickte sie nach unten, als mehrere Männer, darunter ihr Nachbar und guter Freund Nisso Cohen, aufstanden und zum Toraschrein gingen. Bevor sie auf die davorstehende Plattform stiegen, streiften sie, wie es Sitte war, ihre Schuhe ab, da sie Kohanim waren, und im selben Moment hörte Stella das Wort Adonai, gesungen mit einer lauten durchdringenden Stimme, die ihr einen Schauder durch den Körper jagte. Sie hatte kurz das Gefühl, als sei sie nicht mehr auf ihrem Platz verankert, sondern schwebe schwerelos dahin, anwesend und gleichzeitig auch nicht. «Ich hatte keine Ahnung, was das war oder bedeutete, ich hatte noch nie zuvor so etwas gespürt. Erst eine Ewigkeit später fühlte ich etwas Ähnliches, als der Neffe meiner Freundin Fanny Levy Haschisch von seiner Hochzeitsreise in Mexiko mitbrachte, ich ein paarmal zog, und voilà, der gleiche Schauder, das gleiche Schweben.» Dadurch erkannte sie etwas, das sie damals als Mädchen weder benennen noch identifizieren konnte: nämlich dass das menschliche Gehirn, diese schwammige Masse aus Fett und Protein, eine überaus machtvolle, mysteriöse Kontrolle über ihr Bewusstsein hatte und ein Gefühl von etwas Höherem oder Größerem, etwas Jenseitigem vermitteln konnte.