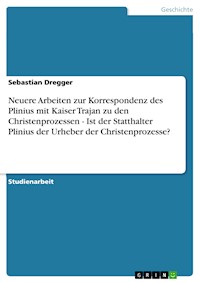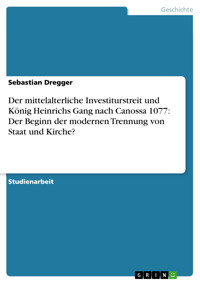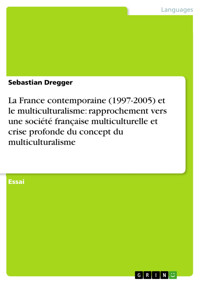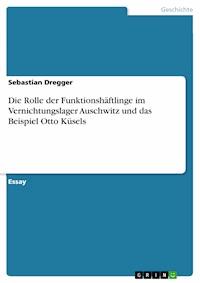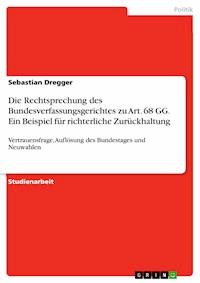
Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu Art. 68 GG. Ein Beispiel für richterliche Zurückhaltung E-Book
Sebastian Dregger
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Politik - Politisches System Deutschlands, Note: gut, Universität Trier, Veranstaltung: Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland im Spiegel der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, Sprache: Deutsch, Abstract: Wie erklaert es sich, dass das Bundesverfassungsgericht bei den umstrittenen Vertrauensfragen 1982 und 2005 in seinen Urteilen ganz den Erwartungen des Bundeskanzlers, des Bundestages und des Bundespraesidenten folgte, obwohl der Fall der unechten fingierten Vertraunsfrage im Rahmen des Artikels 68 GG in der weit ueberwiegenden Verfassungslehre als verfassungswidrig abgelehnt wird? Schliesslich ging es dem Bundeskanzler und den ihm in dieser Angelegenheit verbuendeten politischen Kraeften offensichtlich nur darum, durch eine inszenierte Abstimmungsniederlage im Bundestag im Rahmen der Vertrauensfrage, einen Vorwand zu schaffen, um so den Bundestag vom Bundespraesidenten ausfloesen zu lassen und um so Neuwahlen herbeifuehren zu koennen. Um diesen bemerkenswerten Sachverhallt gerade vor dem Hintergrund einer aeusserst machtvollen Verfassungsgerichtsbarkeit, die fuer das politische System der Bundesrepublik kennzeichnend ist, aufzuklaeren, legt die Arbeit den Schwerpunkt auf zwei Faktoren, die die aussergewoehnliche richterliche Zurueckhaltung (judicial restraint) in diesem Fall erklaeren; naemlich einerseits der hohe verfassungsrechtliche Rang der Vertrauensfrage als Klagegegenstand. Dieser kennzeichnet sich dadurch, dass der Vertraunsfrage die direkte Willensbekundung dreier oberster Verfassungsorgane zugrunde liegt, ueber die sich das Bundesverfassungsgericht nicht einfach hinwegsetzen kann, wenn es nicht eine Staatskrise provozieren will. Um wieviel mehr Spielraum verfuegt das Gericht etwa, wenn es sich beim jeweiligen Klagegegenstand nur um einen Verwaltungsakt oder ein letztinstanzliches Gerichtsurteil handelt. Daneber gilt es als zweiten besonderen Faktor die Tatsache zu bedenken, dass die drei an der Vertrauensfrage direkt beteiligten Verfassungsorgane nicht untereiander zerstritten waren, sondern vielmehr 1982 wie auch 2005 einen einheitlichen festen Willen bei der Beurteilung des Artikels 68 kundtaten, was in Verfassungsstreitfragen die Ausnahme ist, wenn man etwa an die Kopftuchdebatte denkt, was aber zusaetzlich den Spielraum des Gerichtes erheblich einschraenkte. Ist man sich dieser Faktoren, zuzueglich der Prezedenzwirkung des Urteiles von 1983, bewusst, so kann man die billigenden Entscheidungen des BVerfG einerseits als pragmatisch betrachten; sie verdeutlichen aber auch angesicht der beschriebenen Faktoren die faktischen und realpolitischen Grenzen jeder Art der Verfassungsgerichtsbarkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Page 1
Page 3
Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu Art.68 GG (Vertrauensfrage, Auflösung des Bundestages, Neuwahlen) - Ein Beispiel für das Zustandekommen von richterlicher Zurückhaltung (judicial restraint)
I. Einleitung
A. Hinführung zum Thema
Wenn man sich mit den beiden Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes zu der Anwendung des Artikels 68 des Grundgesetzes beschäftigt, dann fällt auf, dass das Karlsruher Gericht sowohl Helmut Kohls Anliegen 19821als auch Gerhard Schröders Vorhaben 20052, über eine verlorene Vertrauensfrage im Bundestag Neuwahlen herbeizuführen, ausdrücklich und höchstrichterlich billigte. Dies ist deshalb bemerkenswert, weil die beiden Vertrauensfragen der Kanzler Kohl und Schröder sich einer Praxis bedienten, die innerhalb der Staatsrechtswissenschaft auf große Ablehnung stieß und darüber hinaus auch in der überregionalen deutschen Presse kritisch bis ablehnend diskutiert wurde. Schließlich ging es den beiden Kanzlern mit ihrer Vertrauensfrage nicht darum, das Vertrauen ihrer Regierungsfraktionen und damit der Mehrheit des deutschen Bundestages ausgesprochen zu bekommen - sie wollten beide vielmehr bewusst die Abstimmung über ihren Antrag zur Vertrauensfrage verlieren, um auf dieser Grundlage den Bundespräsidenten bitten zu können, den Bundestag aufzulösen und Neuwahlen anzusetzen, was in beiden Fällen der Bundespräsident auch tat.
B. Fragestellung und Vorgehensweise
In der Hausarbeit soll deshalb der Frage nachgegangen werden, warum das Bundesverfassungsgericht in seinen Urteilen zur Vertrauensfrage diese Anwendung des Artikels 68 billigte und nicht vielmehr für verfassungswidrig erklärte, obwohl dies die weitverbreitete Ansicht innerhalb der Staatsrechtwissenschaft3ist und doch die Aufgabe des
1Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 16.2.1983 (BVerfG 1),
http://www.bverfg.de/entscheidungen/es19830216_2bve000183.html,Leitsätze.
2Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 25.8.2005 (BVerfG 2),
http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20050825_2bve000405.html,Leitsätze.
3Bonner Kommentar, Artikel 68, Sept. 2006, Fußnote 165, Rn 75.