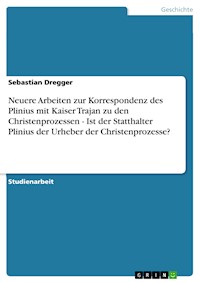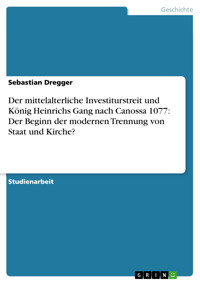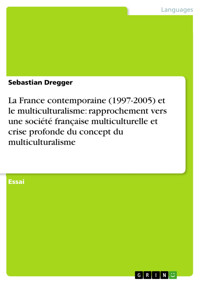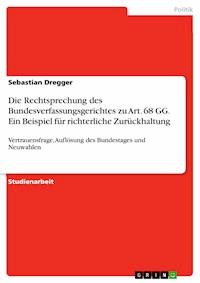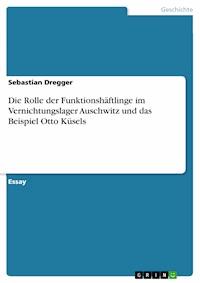Grundrechtsdogmatische Analyse der Kopftuchentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes E-Book
Sebastian Dregger
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Jura - Öffentliches Recht / Staatsrecht / Grundrechte, Note: 13 Punkte (gut), Universität Trier, Veranstaltung: Seminar: Aktuelle Entwicklungen des Religionsrechtes, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel der Arbeit ist die grundrechtsdogmatische Einordnung eines Kopftuches, getragen von einer Lehrerin im Unterricht auf der Grundlage des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 24.9.2003. Besonders problematisch ist dabei die Vieldeutigkeit des Kopftuches und die Frage, welche der verschiedenen moeglichen Bedeutungsgehalte des Kleidungsstueckes im juristischen Streitfalle als massgeblich erachtet wird - gerade in der Abwaegung mit kollidierenden Rechtspositionen. Die Arbeit verdeutlicht, dass es letztlich drei verschiedene Bedeutungsebenen des Kopftuches gibt: eine religioese, eine politische und eine geschlechtsspezifische. Jede dieser Bedeutungsebenen kann negativ, im Sinne von nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, aber auch positiv, im Sinne von mit dem Grundgesetz vereinbar, interpretiert werden. Welche der moeglichen Bedeutungsebenen des Kopftuches letztlich als juristisch massgeblich bewertet wird, haengt von den konkreten Details und Umstaenden des Einzelfalles ab. Ist man sich dieser verschiedenen Bedeutungsgehalte sowie der Tatsache bewusst, dass sich jede dieser Bedeutungsgehalte verfassungskonform sowie verfassungswiedrig interpretieren laesst, so wird erst verstaendlich, warum die Karlsruher Richter zu keinem wirklichen Konsens bei der grundrechtlichen Bewertung des Falles gelangt sind; vielmehr widerspricht die abweichende Meinung dreier Richter fundamental der Ansicht der Mehrheitsentscheidung in allen zentralen Streitpunkten des Falles.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Page 1
Universität Trier WS 2004/05 FB 5 - Rechtswissenschaft
Page 3
A. Einleitung
Die Frage, ob eine muslimische Lehrerin in einer deutschen Schule aus religiösen Gründen ein Kopftuch tragen kann, wird bereits seit einiger Zeit in den juristischen Fachzeitschriften heftig diskutiert1. Am 24.9.2003 hat das Bundesverfassungsgericht sich mit dieser Problematik beschäftigt. Seiner Entscheidung liegt der Fall von Fereshda Ludin zugrunde, einer muslimischen Lehramtsanwärterin. Diese bestand aus religiösen Gründen darauf, vor ihren Schülern nur mit Kopftuch zu unterrichten. Daraufhin wurde ihr von der örtlichen Schulbehörde die Eignung als Lehrerin wegen eines Verstoßes gegen die Mäßigungs- und Neutralitätspflicht des Beamten im Dienst abgesprochen. Frau Ludin sah sich aufgrund dieser Entscheidung in ihren Grundrechten aus Art.4 Abs.1 u.2 und Art.33 Abs.3 GG verletzt und klagte gegen den Bescheid des Oberschulamtes Stuttgart über mehrere Instanzen bis vor das Bundesverfassungsgericht2. Die Karlsruher Richter gaben Frau Ludin in ihrem Anliegen Recht. Ihrem Tenor zufolge kann einer Lehrerin nur dann das Tragen eines Kopftuches im Unterricht verboten werden, wenn dazu eine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage vorliegt. Da dies im Land Baden- Württemberg nicht der Fall sei, könne momentan der Beschwerdeführerin das Kopftuchtragen nicht von der dortigen Schulbehörde untersagt werden. Allerdings stehe es dem Gesetzgeber frei, eine solche gesetzliche Grundlage zu schaffen3. Indes ist es dem Gericht mit dieser Entscheidung nicht gelungen, den Kopftuchstreit zu schlichten. Im Gegenteil. Schon das Urteil selbst ist uneinheitlich. Neben der Mehrheitsentscheidung, dem eigentlichen Kopftuchurteil, gibt es eine abweichende Meinung dreier Richter4, die der Mehrheitsentscheidung in ihren wesentlichen
1Etwa Böckenförde, NJW 2001, 732; Michael, JZ 2003, 256; Debus, NVwZ 2001, 1355; Goerlich, NJW 1999, 2929; Janz/Rademacher, NVwZ 1999, 706; Alan/Steuten, ZRP 1999, 209; Hillgruber, JZ 1999, 544.
2Zur Vorgeschichte des Falles Ludin: vgl.: BVerfG, Mehrheitsvotum,www.bverfg.de/entscheidungen/rs20030924_2bvr143602.html, Rn 1 -15.
3BVerfG, aaO, Leitsätze.
4Dazu gehören die Richter Jentsch, Di Fabio, Mellinghoff.