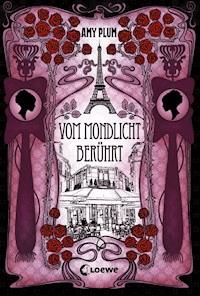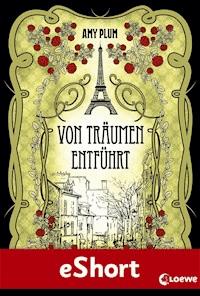Die Revenant-Trilogie (Band 1-3) - Von der Nacht verzaubert/Vom Mondlicht berührt/Von den Sternen geküsst E-Book
Amy Plum
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Revenant-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Alle drei Bände der traumhaften Romantic-Fantasy-Reihe inklusive einer Kurzgeschichte von der Bestsellerautorin Amy Plum in einem E-Book ! Eine außergewöhnliche Liebesgeschichte vor der romantischen Kulisse von Paris für Leserinnen ab 13 Jahren. Als Kate Merciers Eltern bei einem tragischen Unfall sterben, zieht sie zusammen mit ihrer Schwester Georgia zu den Großeltern nach Paris. Dort verliebt sie sich in Vincent, der ihr dabei hilft, ihre schmerzvollen Erinnerungen hinter sich zu lassen. Doch dann erfährt sie, dass Vincent ein Revenant ist, ein ruheloser Geist, der sein Leben opfert, um das anderer Menschen zu retten - und er ist in einen jahrhundertealten Kampf verstrickt. Schnell begreift Kate, dass ihr Leben niemals wieder sicher sein wird, wenn sie ihrem Herzen folgt. Die drei Einzelbände der Trilogie heißen "Von der Nacht verzaubert", "Vom Mondlicht berührt" und "Von den Sternen geküsst". Das eShort ist unter dem Titel "Von Träumen entführt" erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1536
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Prolog
Als ich die Statue im Brunnen das erste Mal gesehen hatte, wusste ich noch nicht, wer – oder besser was – Vincent war. Während ich nun die himmlische Schönheit der beiden miteinander verbundenen Körper auf mich wirken ließ – der gut aussehende Engel, dessen harte, dunkle Züge auf die Frau gerichtet waren, die in seinen ausgestreckten Armen lag und aus purem Licht und Milde geschaffen schien –, entging mir die Symbolik nicht. Das Gesicht des Engels spiegelte Verzweiflung wider. Doch da war noch etwas anderes. Besessenheit. Aber auch Zärtlichkeit. Als würde er von ihr erwarten, dass sie ihn rettet, nicht umgekehrt. Plötzlich kam mir in den Sinn, wie Vincent mich nannte: mon ange. Mein Engel. Ein Schauer überlief mich, aber nicht, weil es kalt war.
Jeanne hatte gesagt, mich kennenzulernen hätte Vincent verwandelt. Ich hätte ihm »neues Leben« geschenkt. Aber erwartete er von mir, dass ich seine Seele rettete?
Die meisten Sechzehnjährigen träumen davon, in einer fremden Stadt im Ausland zu leben. Doch der Umzug von Brooklyn nach Paris nach dem Tod meiner Eltern war alles andere als ein Traum, der in Erfüllung ging. Das Wort Albtraum trifft es schon eher.
Ganz ehrlich: Ich hätte überall sein können und es wäre total egal gewesen – denn ich nahm meine Umgebung überhaupt nicht wahr. Ich lebte in der Vergangenheit, klammerte mich verzweifelt an jeden Erinnerungsfitzel meines früheren Lebens, von dem ich dachte, dass es immer so weitergehen würde.
Nur zehn Tage nachdem ich meine Führerscheinprüfung bestanden hatte, kamen meine Eltern bei einem Autounfall ums Leben. Eine Woche später, am ersten Weihnachtstag, entschied meine Schwester Georgia, dass wir beide Amerika verlassen würden, um bei den Eltern meines Vaters in Frankreich zu leben. Ich war noch viel zu erschüttert, als dass ich mich dagegen hätte auflehnen können.
Wir zogen im Januar um. Niemand erwartete von uns, dass wir sofort wieder zur Schule gingen und so brachten wir einfach einen Tag nach dem anderen hinter uns, jede auf ihre eigene verzweifelte Art. Meine Schwester unterdrückte ihre Trauer fieberhaft, indem sie jeden Abend mit ihren Freunden ausging, die sie schon während unserer jährlichen Sommerurlaube dort gefunden hatte. Ich hingegen verwandelte mich in ein menschenscheues Häufchen Elend.
An guten Tagen schaffte ich es, die Wohnung zu verlassen und ein Stückchen die Straße entlangzugehen, bis ich panisch zurückrannte, um in unserem neuen Zuhause Schutz vor dem Himmel zu suchen, der mich zu erdrücken drohte. An anderen Tagen wachte ich so kraftlos auf, dass ich es kaum schaffte, mich zum Frühstückstisch und zurück zu meinem Bett zu schleppen, wo ich dann den Rest des Tages verbrachte, völlig gelähmt von meiner Trauer.
Schließlich entschieden unsere Großeltern, dass wir für ein halbes Jahr in ihr Landhaus umziehen würden. »Ein Tapetenwechsel«, wie Mamie hinzufügte, woraufhin ich nur anmerkte, dass kein Tapetenwechsel so extrem sein könnte wie ein Umzug von New York nach Paris.
Doch Mamie behielt wie immer recht. Es tat uns unermesslich gut, den Frühling auf dem Land zu verbringen, und obwohl wir Ende Juni noch immer Schatten unserer früheren Selbst waren, funktionierten wir zumindest wieder insoweit, um nach Paris und ins wahre Leben zurückkehren zu können – sofern man das Leben jemals wieder »wahr« nennen konnte. Wenigstens fand mein Neuanfang an einem Ort statt, den ich liebte.
Nirgendwo sonst ist es schöner als im Juni in Paris. Obwohl ich jeden Sommer hier verbracht habe, seit ich ein kleines Kind war, wurde ich jedes Mal wieder high, wenn ich durch die sommerlichen Straßen ging. An keinem anderen Ort dieser Welt ist das Licht so wie hier. Es ist einfach märchenhaft. In diesem zauberhaften Glanz könnte jederzeit alles Mögliche passieren und man wäre nicht mal überrascht.
Doch diesmal war es anders. Die Stadt war zwar so wie immer, aber ich hatte mich verändert. Selbst die schillernde Atmosphäre von Paris konnte die Finsternis, die fest an mir klebte, nicht vertreiben. Paris hat einen wunderschönen Spitznamen: Stadt des Lichts. Nun, für mich war sie die Stadt des Nichts geworden.
Die meiste Zeit des Sommers verbrachte ich allein. Meine Tage folgten schnell dem immer gleichen Trott: Ich wachte in Papys und Mamies dunkler, mit Antiquitäten vollgestopfter Wohnung auf und verschanzte mich dann in einem dieser winzigen, dunklen Pariser Programmkinos, die rund um die Uhr Schwarz-Weiß-Klassiker zeigten, oder ich besuchte eins meiner Lieblingsmuseen. Dann ging ich nach Hause und las für den Rest des Tages, aß zu Abend, legte mich ins Bett und starrte an die Decke. Selten schlief ich, und wenn mir vor lauter Müdigkeit doch mal die Augen zufielen, dann folgten ein paar albtraumgeplagte Stunden Schlaf. Aufwachen. Von vorn.
Die einzige Unterbrechung dieser einsamen Routine erfolgte in E-Mail-Form. »Und, wie ist das Leben so in Frankreich?«, war immer die erste Frage meiner alten Freunde aus Brooklyn.
Was sollte ich denn darauf antworten? Deprimierend? Leer? Ich will meine Eltern zurück? Da erfand ich lieber was. Ich schrieb ihnen, dass ich richtig froh darüber war, in Paris zu wohnen. Wie praktisch es war, dass Georgia und ich fließend Französisch sprachen, weil wir so viele neue Leute kennenlernten. Dass ich es gar nicht erwarten konnte, endlich wieder in die Schule zu gehen.
Dabei war es nicht meine Absicht, sie mit diesen Geschichten zu beeindrucken. Ich wusste, dass sie sich Sorgen um mich machten, deshalb wollte ich ihnen nur versichern, dass es mir gut ging. Doch immer, wenn ich so eine Mail abgeschickt hatte und sie danach noch einmal las, merkte ich, wie unendlich breit die Kluft zwischen diesem für sie erfundenen und meinem wirklichen Leben war. Und das deprimierte mich dann nur noch mehr.
Schließlich wurde mir bewusst, dass ich keine Lust mehr hatte, überhaupt noch mit irgendjemandem zu reden. Eines Abends, nachdem meine Finger fünfzehn Minuten auf den Tasten geruht hatten, während ich verzweifelt überlegte, was ich meiner Freundin Claudia Tolles schreiben könnte, schloss ich das Nachrichtenfeld und löschte nach einem tiefen Atemzug für immer und ewig meine E-Mail-Adresse. Googlemail fragte, ob ich mir sicher sei. »Und wie«, sagte ich, als ich auf den roten Button klickte. Eine Last fiel von mir ab. Ich verstaute den Laptop in der Schreibtischschublade und holte ihn erst wieder hervor, als die Schule anfing.
Anfangs versuchten Mamie und Georgia noch, mich dazu zu bewegen, wenigstens hin und wieder mal vor die Tür zu gehen. Meine Schwester fragte, ob ich sie und ihre Freunde zu einer Strandbar am Fluss begleiten wolle. Oder zu Konzerten oder in Klubs, wo sie die Wochenenden durchtanzten. Aber irgendwann gaben sie auf.
»Wie kannst du nur tanzen gehen, nach allem, was passiert ist?«, fragte ich Georgia einmal, als sie auf dem Fußboden in ihrem Zimmer saß und sich vor einem vergoldeten Rokokospiegel schminkte, den sie von der Wand genommen und gegen ein Bücherregal gelehnt hatte.
Meine Schwester war furchtbar schön. Ihre rotblonden Haare waren zu einem kurzen Pixie-Cut geschnitten, den nur jemand mit ihren hohen Wangenknochen tragen konnte. Kleine Sommersprossen zierten ihre weiche Pfirsichhaut. Genau wie ich war sie groß gewachsen, aber im Gegensatz zu mir hatte sie eine fantastische Figur – für ihre Rundungen würde ich sterben. Sie sah nicht aus wie fast achtzehn, sondern wie einundzwanzig.
Georgia warf mir einen kurzen Blick zu. »Weil ich nur so vergessen kann«, sagte sie, während sie ihre Wimpern nachtuschte. »Weil ich mich nur dann lebendig fühle. Ich bin genauso traurig wie du, Katie-Bean. Aber anders werde ich damit nicht fertig.«
Ich wusste, dass das stimmte. In den Nächten, in denen sie nicht ausging, hörte ich sie in ihrem Zimmer schluchzen, als wäre ihr Herz gebrochen.
»Und dir tut es auch nicht gut, Trübsal zu blasen«, fuhr sie mit sanfter Stimme fort. »Du solltest unter Menschen gehen. Um dich abzulenken. Sieh dich mal an«, sagte sie, legte ihre Wimperntusche beiseite und zog mich zu sich. Sie drehte meinen Kopf so, dass mein Gesicht neben ihrem im Spiegel auftauchte.
Wer uns zusammen sieht, käme nie auf die Idee, dass wir Geschwister sind. Meine langen braunen Haare hingen an diesem Tag schlaff herunter. Meine Haut, die dank der Gene meiner Mutter niemals Farbe annimmt, war noch blasser als gewöhnlich. Meine graublauen Augen waren ganz anders als die sinnlichen »Schlafzimmeraugen« meiner Schwester. »Mandelaugen« hatte meine Mutter sie zu meinem großen Kummer immer genannt. Ich hätte lieber Augen, bei denen man an heiße Nächte denkt, als welche, die an eine Nuss erinnern.
»Du bist wunderhübsch«, stellte Georgia fest. Meine Schwester, mein einziger Fan.
»Sag das den Verehrern, die draußen Schlange stehen.« Ich verzog das Gesicht und setzte mich zurück aufs Bett.
»Na, wenn man die ganze Zeit allein unterwegs ist, findet man auch keinen Verehrer. Wenn du nicht mal was anderes machst, als ständig nur in Museen und Kinos rumzuhängen, siehst du bald aus wie eine deiner Romanheldinnen aus dem achtzehnten Jahrhundert, die von Tuberkulose oder Wassersucht oder so was dahingerafft worden sind.« Sie blickte mir in die Augen. »Hör zu, ich werde dich nie wieder fragen, ob du mit mir ausgehst, wenn du mir nur einen einzigen Wunsch erfüllst.«
»Man nennt mich ja bekanntlich auch ›Die gute Fee‹«, sagte ich und versuchte zu grinsen.
»Schnapp dir deine verdammten Bücher und setz dich damit in ein Café. Ins Sonnenlicht. Meinetwegen auch ins Mondlicht, mir egal. Hauptsache, du verlässt das Haus und es kommt mal wieder ein bisschen gute alte, schmutzige Stadtluft in deine schwindsüchtigen Lungen. Triff mal wieder ein paar Menschen, verdammt noch mal.«
»Aber ich treffe doch Menschen …«, fing ich an.
»Leonardo da Vinci und Quentin Tarantino zählen nicht«, unterbrach sie mich.
Ich sagte nichts mehr.
Georgia stand auf und hängte sich ihre kleine schicke Handtasche über die Schulter. »Nicht du bist tot«, sagte sie, »sondern Mama und Papa. Und sie würden sich wünschen, dass du lebst.«
»Wo gehst du denn hin?« Mamie streckte verwundert ihren Kopf aus der Küche, als sie hörte, wie ich die Wohnungstür öffnete.
»Georgia findet, meine Lungen brauchen mal wieder ein bisschen schmutzige Pariser Stadtluft«, antwortete ich und schnappte mir meine Tasche.
»Da hat sie völlig recht«, sagte sie und kam zu mir. Ihre Stirn reichte mir kaum bis ans Kinn, aber durch ihre perfekte Haltung und ihre sieben Zentimeter hohen Absätze wirkte sie viel größer. Obwohl sie in ein paar Jahren siebzig werden würde, ließ ihr jugendliches Auftreten sie mindestens zehn Jahre jünger aussehen.
Sie studierte Kunst, als sie meinen Großvater, einen erfolgreichen Antiquitätenhändler, kennenlernte, der von ihr so maßlos beeindruckt war, als wäre sie eine seiner kostbaren antiken Statuen. Noch heute restaurierte sie alte Gemälde in ihrem Atelier mit Glasdach, das ganz oben in unserem Apartmenthaus lag.
»Allez, fille!«, sagte sie, während sie in all ihrer Herrlichkeit vor mir stand. »Dann los. Die Stadt dürstet sicher nach einer Aufheiterung durch die kleine Katya.«
Ich gab meiner Großmutter einen Kuss auf ihre weiche, nach Rosen duftende Wange, nahm meinen Schlüssel vom Flurtisch und verließ die Wohnung durch die schwere Holztür. Die marmorne Wendeltreppe führte mich hinunter zur Straße.
Paris ist in zwanzig Stadtteile unterteilt, die Arrondissements, die von eins bis zwanzig durchnummeriert sind. Unseres, das siebte, ist ein altes Viertel, in dem die wohlhabenderen Einwohner von Paris leben. Wer im trendigsten Stadtteil wohnen will, würde nicht in das siebte ziehen. Aber weil die Wohnung meiner Großeltern in Fußnähe zum Boulevard Saint-Germain liegt, an dem sich Cafés und Geschäfte nur so drängen, und von wo aus man in nur fünfzehn Minuten am Ufer der Seine ist, hatte ich wirklich keinen Grund, mich zu beklagen.
Ich trat in den hellen Sonnenschein und umrundete den Park direkt gegenüber vom Haus. In diesem Park stehen viele steinalte Bäume und vereinzelt ein paar grüne Holzbänke. Wenn man daran vorbeigeht, hat man für ein paar Sekunden das Gefühl, dass Paris ein kleines Dorf ist und nicht Frankreichs Hauptstadt.
Mein Weg führte mich die Rue du Bac entlang, die rechts und links von Geschäften gesäumt wird, in denen man teure Klamotten, Wohnaccessoires oder Antiquitäten kaufen kann. Ich wurde nicht mal langsamer, als ich an Papys Café vorüberging. In dieses Café hatte er uns mitgenommen, seit wir kleine Kinder waren. Wir saßen dort und tranken Tee mit Pfefferminzgeschmack, während Papy mit allem plauderte, das sich bewegte. Das Letzte, was ich wollte, war, neben ein paar seiner Freunde oder gar gegenüber von ihm auf der Terrasse zu stranden. Ich musste mir ein eigenes Café suchen.
Mir schwebten zwei nahe gelegene Lokale vor. Das erste lag an einer Straßenecke, die Ausstattung war dunkel gehalten und eine Reihe von Tischen, die auf dem Bürgersteig standen, flankierte das Gebäude. Dort war es vermutlich ruhiger als in dem anderen Lokal. Ich betrat es und sofort fielen mir lauter alte Männer auf, die auf hohen Stühlen an der Bar saßen, jeder ein Glas Rotwein vor sich. Ihre Köpfe drehten sich langsam in meine Richtung, um den Neuankömmling zu mustern, doch mein Anblick erschreckte sie offensichtlich dermaßen, als hätte ich in einem gelben Hühnerkostüm gesteckt. Warum hängt draußen denn kein Schild mit der Aufschrift »Zutritt nur für alte Männer«, fragte ich mich und machte mich schleunigst auf den Weg zu Option zwei: Ein überquellendes Café ein Stückchen weiter die Rue hinunter.
Das Café Sainte-Lucie wirkte sehr geräumig, weil durch die großen Fenster viel Sonnenlicht hineinfallen konnte. Auf der sonnigen Terrasse standen sicher fünfundzwanzig Tische, die normalerweise alle belegt waren. Während ich auf einen freien Tisch in der äußersten Ecke zusteuerte, wusste ich, dies war mein Café. Ich hatte sofort das Gefühl, hierher zu gehören. Ich stellte meine Tasche unter den Tisch und setzte mich mit dem Rücken zum Gebäude, damit ich sowohl die gesamte Terrasse als auch die Straße und den Bürgersteig im Blick hatte.
Ich bestellte eine Limonade und kramte dann eine Taschenbuchausgabe von Zeit der Unschuld hervor. Es war eines der Bücher, die ich bis zum Schulanfang im September gelesen haben musste. Umgeben vom Geruch starken Kaffees, versank ich in der Welt des Romans.
»Noch eine Limonade?« Eine französische Stimme schwebte durch meine Gedanken und riss mich abrupt aus den Straßen eines New York des neunzehnten Jahrhunderts zurück in ein Pariser Café. Ein Kellner stand neben mir, hielt ein rundes Tablett über seiner Schulter und sah aus wie ein verstimmter Grashüpfer.
»Oh, natürlich. Ähm … Obwohl, diesmal lieber einen Tee«, sagte ich. Seine Nachfrage konnte nur bedeuten, dass ich schon eine Stunde lang gelesen haben musste. In französischen Cafés gilt eine unausgesprochene Regel: Man kann so lange an einem Tisch sitzen bleiben, wie man will, wenn man nur jede Stunde ein Getränk bestellt. Man mietet sozusagen seinen Tisch.
Ich ließ meinen Blick kurz über die Terrasse gleiten, bevor ich mich wieder meinem Buch widmete. Wenig später schaute ich aber noch einmal auf, weil ich das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Als ich den Kopf hob, sah ich einen jungen Typen, der mich anstarrte. Die Welt hörte auf sich zu drehen, als sich unsere Blicke trafen.
Mich beschlich das merkwürdige Gefühl, dass ich ihn kannte. Das ging mir manchmal bei Fremden so; dann fühlte es sich an, als hätte ich schon Stunden, Wochen oder sogar Jahre mit ihnen verbracht. Allerdings war das bisher immer ein sehr einseitiges Phänomen gewesen – in der Regel hatte mich mein Gegenüber noch nicht mal wahrgenommen.
Diesmal war es allerdings anders. Ich hätte schwören können, dass es ihm genauso ging wie mir.
So eindringlich, wie er mir in die Augen sah und meinen Blick festhielt, musste er mich schon eine ganze Weile angestarrt haben. Er sah atemberaubend aus, hatte ziemlich lange schwarze Haare, die sich von seiner breiten Stirn nach hinten wellten. Seine olivfarbene Haut legte die Schlussfolgerung nahe, dass er entweder viel Zeit in der Sonne verbrachte oder von einem sonnigen Ort stammte, der weiter südlich lag. Seine Augen waren so blau wie das Meer und von dichten schwarzen Wimpern umrandet. Mein Herz flatterte in meiner Brust und meine Lungen fühlten sich an, als hätte jemand sämtliche Luft herausgepresst. Ich konnte einfach nicht wegschauen.
Ein paar Sekunden vergingen, bevor er sich wieder an seine beiden Freunde wandte, die laut lachten. Alle drei waren jung, schön und hatten eine Wahnsinnsausstrahlung – kein Wunder also, dass die Besucherinnen im Café von ihnen fasziniert waren. Sofern den Jungs das bewusst war, ließen sie es sich nicht anmerken.
Der Typ, der neben ihm saß, war auffallend hübsch, groß wie ein Baum, hatte kurze Haare und schokoladenfarbene Haut. Während ich ihn musterte, sah er zu mir und grinste mich wissend an, so als würde er total verstehen, dass ich keine andere Wahl hatte, als ihn so anzustarren. Das riss mich aus meinem voyeuristischen Trancezustand und meine Augen fanden für ein paar Sekunden zurück zu meinem Buch. Als ich dann noch mal aufschaute, hatte er sich wieder abgewendet.
Der dritte saß mit dem Rücken zu mir. Er war drahtig, hatte einen leichten Sonnenbrand, Koteletten, lockige braune Haare und erzählte lebhaft etwas, über das seine beiden Begleiter sich offenbar wahnsinnig amüsierten.
Ich sah mir den ersten noch einmal genauer an. Obwohl er sicher ein paar Jahre älter war als ich, schätzte ich ihn auf unter zwanzig. Die Art, wie er lässig auf seinem Stuhl saß, war typisch französisch, doch etwas Kühles, Hartes umspielte seine Gesichtszüge und ließ eine Ahnung in mir aufsteigen, dass diese lässige Pose nur Fassade war. Er sah nicht bösartig aus. Er wirkte eher irgendwie … gefährlich.
Obwohl er mich sehr neugierig machte, strich ich das Bild dieses schwarzhaarigen Fremden gleich wieder aus meinen Gedanken, weil ich mir sicher war, dass die Kombination aus perfektem Aussehen und Gefahr sicher Schwierigkeiten bedeutete. Ich nahm mein Buch zur Hand und schenkte meine volle Aufmerksamkeit nun wieder den vertrauenswürdigeren Reizen eines Newland Archer. Als der Kellner mit meinem Tee kam, konnte ich es mir jedoch nicht verkneifen, noch einmal zu dem anderen Tisch hinüberzuschauen. Dummerweise konnte ich mich irgendwie nicht mehr auf den Text konzentrieren.
Als die drei eine halbe Stunde später das Café verließen, zogen sie unwillkürlich die Blicke aller Frauen auf sich. Die Wirkung wäre sicher nicht anders gewesen, wenn sich eine Gruppe von Armani-Unterwäschemodels vor der Terrasse die Klamotten vom Leib gerissen hätte.
Die ältere Frau vom Nebentisch lehnte sich zu ihrer Begleiterin hinüber und sagte: »Ist dir plötzlich auch so heiß?« Ihre Freundin kicherte zustimmend, fächelte sich mit der eingeschweißten Speisekarte Luft zu und blickte ungeniert den Jungs hinterher. Ich schüttelte angewidert den Kopf – unmöglich, dass diesen Typen nicht bewusst war, wie viele gierige Blicke sich ihnen wie Pfeile in den Rücken bohrten, während sie sich langsam entfernten.
Wie um meine Theorie zu bestätigen, drehte sich der hübsche Schwarzhaarige plötzlich zu mir um, und als er sah, dass ich ihm nachschaute, lächelte er eingebildet. Röte schoss mir ins Gesicht und ich versteckte mich schnell hinter meinem Buch, weil ich ihm nicht auch noch die Genugtuung gönnen wollte, mich rot werden zu sehen.
Ich versuchte noch ein paar Minuten lang, die nächsten Sätze des Romans zu verstehen, ehe ich aufgab. Meine Konzentration war dahin, also zahlte ich für meine Getränke, ließ ein Trinkgeld auf dem Tisch liegen und machte mich auf den Weg zurück in die Rue du Bac.
Ohne Eltern zu leben, wurde keineswegs leichter.
Ich hatte das Gefühl, von einer Eisschicht umhüllt zu sein. Auch innen drin war ich ganz kalt. Aber ich klammerte mich regelrecht an diese Kälte: Wer wusste denn, was passieren würde, wenn das Eis taute und ich tatsächlich wieder etwas fühlen konnte? Wahrscheinlich würde ich mich erneut in diese nichtsnutzige Heulsuse verwandeln, die ich in den ersten Monaten nach dem Tod meiner Eltern gewesen war.
Mein Vater fehlte mir ganz fürchterlich. Es war unerträglich, dass er aus meinem Leben verschwunden war. Dieser attraktive Franzose, den jeder sofort ins Herz geschlossen hatte, der auch nur einen kurzen Moment in seine lachenden grünen Augen sah. Wenn er mich betrachtete und unverhohlene Bewunderung auf seinem Gesicht glühte, wusste ich: Ich würde immer einen Fan auf dieser Welt haben, der mir vom Spielfeldrand zujubelte, egal, welche Dummheit ich auch anstellte.
Der Tod meiner Mutter tat so entsetzlich weh, als wäre sie eins meiner Organe gewesen, das man mir mit einem Skalpell entfernt hatte. Sie war meine Seelenverwandte, genau das Wort hatte sie stets benutzt. Natürlich haben wir uns nicht immer gut verstanden. Aber jetzt nach ihrem Tod musste ich lernen, mit diesem großen, brennenden Loch zu leben, das ihr Verlust in mich gerissen hatte.
Wenn ich mich wenigstens nachts für ein paar Stunden aus der Wirklichkeit hätte stehlen können, wäre die Zeit im wachen Zustand vielleicht erträglicher gewesen. Aber der Schlaf war mein ganz persönlicher Albtraum. Meist lag ich im Bett, bis mich seine samtig-weichen Finger langsam erfassten und ich nur noch Endlich! denken konnte. Aber schon eine halbe Stunde später war ich wieder wach.
Eines Nachts war ich mit meiner Weisheit am Ende, lag mit dem Kopf auf dem Kissen, die Augen offen und starrte an die Decke. Mein Wecker zeigte ein Uhr. Mit dem Gedanken an die lange Nacht, die noch vor mir lag, krabbelte ich aus dem Bett, fischte nach den Klamotten, die ich am Tag getragen hatte, und zog sie mir über. Als ich in den Flur trat, sah ich Licht unter Georgias Tür hindurchschimmern. Ich klopfte an und öffnete sie.
»Hallo«, flüsterte Georgia. Sie lag komplett angezogen auf dem Bett, mit dem Kopf am Fußende. »Bin gerade erst nach Hause gekommen«, fügte sie hinzu.
»Du kannst auch nicht schlafen«, sagte ich. Es war keine Frage, sondern eine Feststellung. Wir kannten einander einfach zu gut. »Hast du Lust, ein bisschen mit mir spazieren zu gehen?«, fragte ich. »Ich hab keine Lust, wieder stundenlang wach zu liegen. Es ist erst Juli und ich hab schon alle Bücher gelesen, die ich besitze. Zweimal sogar.«
»Bist du verrückt?«, fragte Georgia und drehte sich auf den Bauch. »Es ist mitten in der Nacht.«
»Genau genommen fängt die Nacht gerade an, es ist erst ein Uhr. Da sind noch immer jede Menge Leute unterwegs. Und außerdem ist Paris die sicherste …«
»… Stadt der Welt«, beendete Georgia den Satz. »Das ist Papys Lieblingsspruch. Er sollte beim Tourismusverband anheuern. Also gut, warum nicht? Ist ja nicht so, als würde ich in nächster Zeit einschlafen.«
Wir schlichen auf Zehenspitzen zur Wohnungstür, öffneten sie geräuschlos und schlossen sie mit einem leisen Klicken. Unten vor der Haustür blieben wir kurz stehen, zogen unsere Schuhe an und traten dann hinaus auf die Straße.
Der Vollmond stand am Pariser Nachthimmel und tauchte die Straßen in ein silbernes Licht. Ohne uns abzusprechen, schlugen wir beide den Weg zum Fluss ein. Seit wir als Kinder unsere Sommer hier verbrachten, hatte der Fluss im Mittelpunkt unserer Aktivitäten gestanden, und so fanden unsere Füße den Weg von selbst.
An der Seine angekommen, gingen wir die Steinstufen hinunter zur Uferpromenade, die Paris über mehrere Kilometer säumt, und schlenderten in östlicher Richtung über das grobe Kopfsteinpflaster. Am anderen Ufer thronte das massive Gebäude des Louvre.
Außer uns war niemand unterwegs, weder auf der Promenade noch oben auf der Straße. Abgesehen von kleinen Wellen, die gegen die Uferbefestigung plätscherten, und dem einen oder anderen vorbeifahrenden Auto war kein Geräusch zu hören. Wir waren eine Weile schweigend nebeneinander hergelaufen, als Georgia plötzlich stehen blieb und nach meinem Arm griff.
»Sieh mal«, flüsterte sie erschrocken und zeigte auf die Pont du Carrousel, die Brücke, die unseren Weg vielleicht fünfzehn Meter vor uns kreuzte. Ein Mädchen, vermutlich in unserem Alter, balancierte auf der breiten steinernen Brüstung, gefährlich nah am Rand. »Mein Gott, die will sich umbringen«, hauchte Georgia.
Meine Gedanken überschlugen sich, während ich überlegte, wie tief sie fallen würde. »Die Brücke ist nicht hoch genug, ein Sprung wird sie nicht umbringen.«
»Das kommt darauf an, wie tief das Wasser ist. Oder was darunterliegt. Sie steht noch ziemlich nah am Ufer.«
Wir waren zu weit weg, um ihren Gesichtsausdruck sehen zu können, aber sie hatte ihre Arme um sich geschlungen und blickte in die kalten, dunklen Wellen hinunter.
Noch während wir wie gebannt auf das Mädchen starrten, wurde unsere Aufmerksamkeit auf den Tunnel unter der Brücke gelenkt. Schon bei Tag war er total unheimlich und wenn es kalt war, schliefen dort oft Obdachlose. Bisher war ich noch nie jemandem begegnet, wenn ich so schnell ich konnte durch die faulig riechende Passage lief, um auf der anderen Seite wieder in die Sonne zu treten. Aber die dreckigen Matratzen und provisorischen Trennwände aus Karton ließen keinen Zweifel daran, dass dieser Tunnel für ein paar bedauernswerte Seelen zu den Topimmobilien von Paris zählte. Und heute drangen aus dieser fremdartigen Dunkelheit Geräusche von Handgreiflichkeiten.
In dem Moment lenkte eine Bewegung unseren Blick zurück zur Brücke. Das Mädchen stand noch immer unbeweglich dort, aber ein Mann näherte sich ihr. Er ging langsam und vorsichtig, als wolle er sie nicht erschrecken. Er hob einen Arm und bot dem Mädchen eine Hand an. Trotz der Entfernung drang seine Stimme leise an mein Ohr – er wollte sie überreden, von der Brüstung zu klettern.
Das Mädchen wirbelte herum, um ihn anzusehen. Der Mann hielt ihr jetzt auch noch seine andere Hand hin und, beide Arme nach ihr ausgestreckt, flehte er sie an, von der Brückenkante wegzutreten. Sie schüttelte den Kopf. Er machte noch einen Schritt auf sie zu. Sie schlang ihre Arme fester um sich und sprang.
Eigentlich war es kein Sprung, sie ließ sich eher fallen. Als würde sie ihren Körper der Schwerkraft opfern, damit diese damit anstellte, was sie wollte. Sie fiel vornüber, ihr Kopf traf wenige Sekunden später auf die Wasseroberfläche.
Etwas zog an meinem Arm, es war Georgia. Wir klammerten uns aneinander, während wir diesem gruseligen Szenario zusahen. »Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott«, skandierte Georgia atemlos.
Ich starrte auf die mondbeleuchtete Wasseroberfläche und wartete auf ein Zeichen des Mädchens, als ich aus den Augenwinkeln eine Bewegung auf der Brücke wahrnahm. Jetzt war der Mann auf die Brüstung geklettert, breitete seine Arme aus, sodass seine Silhouette an ein Kreuz erinnerte, und sprang kraftvoll ab. Die Zeit stand still, während er wie ein riesiger Greifvogel zwischen der Brücke und der schwarzen Wasseroberfläche schwebte.
Für den Bruchteil einer Sekunde fiel das Licht einer nahe gelegenen Straßenlaterne auf sein Gesicht. Ich kannte ihn. Es war der Schwarzhaarige aus dem Café Sainte-Lucie.
Was um alles in der Welt trieb ihn bloß dazu, auf ein Mädchen einzureden, um sie von ihrem Selbstmord abzubringen? Kannte er sie? Oder war er einfach nur ein Passant, der genügend Verantwortungsgefühl besaß?
Sein Körper tauchte elegant ins Wasser ein und verschwand.
Ein Schrei drang aus dem Tunnel unter der Brücke und plötzlich konnten wir die Umrisse von Personen ausmachen, die in der Finsternis kauerten. »Was zur …!«, rief Georgia, wurde jedoch von einem kurzen Aufblitzen, das von einem metallischen Klirren begleitet war, unterbrochen, während sich zwei Figuren aus der Dunkelheit lösten. Schwerter. Sie kämpften mit Schwertern.
Georgia und mir fiel im gleichen Moment ein, dass wir Beine hatten, also rannten wir zurück zu der Steintreppe, die wir vorhin heruntergekommen waren. Bevor wir sie erreichten, tauchte ein Mann aus der Dunkelheit auf. Ich kam nicht einmal dazu zu schreien, da hatte er mich schon bei den Schultern gefasst, um zu verhindern, dass ich ihn umrannte. Georgia blieb wie angewurzelt stehen.
»Guten Abend, meine Damen«, erklang eine sanfte Baritonstimme.
Meine Augen brauchten einen Moment, ehe sie sich von ihrem eigentlichen Ziel – der Treppe – auf die Person umgestellt hatten, die mir den Weg dorthin versperrte. »Loslassen«, brachte ich trotz aller Panik hervor und sofort folgte er dieser Aufforderung. Ich machte einen Schritt zurück und sah mich einem weiteren bekannten Gesicht gegenüber. Seine Haare waren unter einer schwarzen Mütze verborgen, trotzdem hätte ich ihn überall erkannt. Es war der muskulöse Freund des Jungen, der gerade in die Seine gesprungen war.
»Sie sollten sich um diese Uhrzeit besser nicht mehr allein hier aufhalten«, sagte er.
»Dahinten passiert irgendwas«, keuchte Georgia. »Sieht ganz nach einem Kampf aus oder so …«
»Ein Polizeieinsatz«, erklärte er, trat hinter uns und schob uns sanft, aber bestimmt vor sich her zur Treppe.
»Ein Polizeieinsatz mit Schwertern?«, fragte ich ungläubig, während wir die Stufen hinaufeilten.
»Verfeindete Banden«, sagte er knapp, schon wieder kehrtmachend. »An Ihrer Stelle würde ich mich so schnell und so weit wie möglich von hier entfernen«, rief er noch über die Schulter, immer zwei Stufen auf einmal nehmend. Er rannte zurück zum Tunnel und im gleichen Moment tauchten zwei Köpfe in Ufernähe aus dem Wasser auf. Erleichterung durchfuhr mich, als ich sah, dass beide lebten.
Der Typ, der uns weggeführt hatte, war gerade rechtzeitig bei ihnen, um dem Mädchen an Land zu helfen.
Ein Schmerzensschrei zerriss die Nacht und Georgia packte mich am Arm. »Komm, lass uns von hier verschwinden.«
»Warte.« Ich zögerte. »Sollten wir nicht irgendwas unternehmen?«
»Was denn?«
»Die Polizei rufen.«
»Das ist doch die Polizei«, sagte sie unsicher.
»Ja, ganz klar. Für mich sehen die nicht gerade wie Polizisten aus. Ich könnte schwören, dass ich zwei von ihnen aus unserem Viertel kenne.« Wir sahen uns einen Moment lang hilflos an und versuchten zu verstehen, was gerade geschehen war.
»Na, vielleicht wird unser Stadtteil von einem Spezialsondereinsatzkommando observiert«, meinte Georgia. »Du weißt doch, Catherine Deneuve wohnt bei uns in der Straße.«
»Klar. Catherine Deneuve hat ein eigenes SEK-Team, das aus lauter superattraktiven Typen besteht, die für sie das Viertel vor Promi-Stalkern schützen und die mit Schwertern bewaffnet sind.«
Wir konnten uns nicht beherrschen und brachen in schallendes Gelächter aus.
»Wir dürfen darüber nicht lachen. Das ist eine ziemlich ernste Sache!«, kicherte Georgia und wischte sich eine verirrte Träne von der Wange.
»Ich weiß«, schniefte ich und versuchte, mich zusammenzureißen.
Das Mädchen und ihr Retter waren verschwunden und die Kampfgeräusche klangen nun weiter entfernt. »Jetzt ist es eh vorbei«, sagte Georgia. »Wir könnten nichts mehr tun, selbst wenn wir wollten.«
Wir steuerten auf den Zebrastreifen zu, als zwei Personen hinter uns die Treppe heraufsprinteten. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sie direkt auf uns zustürmten und griff nach Georgias Arm, um sie aus dem Weg zu ziehen. Sie rannten an uns vorbei, streiften uns fast – zwei große, schwarz gekleidete Männer mit tief ins Gesicht gezogenen Mützen. Ein Stück Metall blitzte unter dem langen Mantel des einen hervor. Sie sprangen in ein Auto und starteten dröhnend den Motor. Bevor sie verschwanden, fuhren sie im Schneckentempo an meiner Schwester und mir vorbei. Ich spürte, wie sie uns durch die abgedunkelten Scheiben anstarrten.
»Was glotzt ihr so?«, schrie Georgia und dann endlich gaben sie Gas. Wir blieben kurz wie benommen stehen. Als die Ampel auf Grün wechselte, hakte sich Georgia bei mir unter und wir überquerten gemeinsam die Straße.
»Was für ein schräger Abend«, sagte sie irgendwann und brach damit unser Schweigen.
»Du untertreibst maßlos«, entgegnete ich. »Was meinst du, sollen wir Mamie und Papy davon erzählen?«
»Wie bitte?« Georgia lachte. »Willst du Papy die Illusion rauben, Paris sei sicher? Die beiden würden uns nie wieder vor die Tür lassen.«
Als ich am nächsten Morgen das Haus verließ, schien die Sonne. In der Sicherheit des Tageslichts wirkten die Geschehnisse der letzten Nacht völlig surreal. Nichts von dem, was wir gesehen hatten, wurde in den Nachrichten erwähnt, aber Georgia und mich ließ das Ganze so schnell nicht los.
Wir sprachen noch häufig darüber, doch uns fiel einfach keine vernünftige Erklärung ein. Unsere Lösungsansätze umfassten alle möglichen Szenarien. Alles – von einem sehr lebhaften Auftritt fanatischer Dungeons & Dragons-Rollenspieler bis hin zu einem dramatischen (und Lachanfall verursachenden) Zwischenfall unter zeitreisenden Rittern und Burgfräuleins – war mit dabei.
Obwohl ich mich weiter zum Lesen ins Café Sainte-Lucie setzte, war die mysteriöse Gruppe dieser umwerfend gut aussehenden jungen Männer noch nicht wieder aufgetaucht. Nach ein paar Wochen kannte ich sowohl alle Kellner als auch die Besitzer. Viele der Stammgäste waren jetzt bekannte Gesichter: Kleine alte Damen, die ihre winzigen Yorkshireterrier in Handtaschen mitbrachten und sie von ihren Tellern fütterten. Geschäftsleute in teuren Anzügen, die pausenlos in ihre Mobiltelefone sprachen und jeder schönen Frau hinterherglotzten, die am Café vorüberging. Pärchen jeden Alters, die unter den Tischen Händchen hielten.
Eines schönen Samstagnachmittags saß ich wieder an meinem Stammplatz in der äußersten linken Ecke der Terrasse und las Wer die Nachtigall stört. Obwohl ich das Buch schon zweimal gelesen hatte, rührten mich immer noch ein paar Stellen zu Tränen. So auch jetzt.
Ich versuchte es mit dem alten Fingernageltrick. Man bohrt sich die Fingernägel in die Handfläche, und wenn es doll genug wehtut, muss man nicht in der Öffentlichkeit losheulen. Nur leider funktionierte es diesmal nicht. Ich war mir sicher, dass meine Augen rot und glasig wurden. Das hat mir gerade noch gefehlt – jetzt heule ich vor den Augen meiner Cafébekanntschaften, die ich gerade erst kennengelernt habe, dachte ich, während ich kurz nach rechts und links linste, ob es jemand bemerkt hatte.
Und da sah ich ihn. Er saß ein paar Tische entfernt und schaute mich so intensiv an wie beim ersten Mal. Der Junge mit den schwarzen Haaren. Der Vorfall am Fluss, sein Sprung, um jemandem das Leben zu retten – all das schien wie ein Traum. Da saß er nun, im hellen Tageslicht, und trank Kaffee mit einem Kumpel.
Warum? Fast hätte ich es laut gesagt. Warum musste mich beim Lesen das große Heulen überkommen, während dieser Franzose, dieser göttliche Franzose, der zu schön war, um wahr zu sein, mich aus nicht mal zehn Metern Entfernung anstarrte?
Ich klappte mein Buch zu und legte etwas Geld auf den Tisch. Aber genau in dem Moment, in dem ich mich auf den Weg zum Ausgang machte, standen die älteren Damen vom Nebentisch auf und fingen an, in ihren unzähligen Einkaufstaschen zu wühlen. Ich trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen, bis sich eine von ihnen zu mir umdrehte. »Tut mir leid, Liebes, wir brauchen noch einen Moment. Warum gehst du nicht einfach um uns herum?« Mit diesen Worten schob sie mich praktisch schon zu dem Tisch, an dem die beiden Jungs saßen.
Ich war kaum einen Schritt an ihnen vorbei, als ich eine leise Stimme hinter mir hörte.
»Entschuldige, hast du nicht was vergessen?«, fragte jemand auf Französisch.
Ich drehte mich um. Er stand nur wenige Zentimeter von mir entfernt. Von Nahem war er noch viel attraktiver, doch auf seinen Zügen lag dieselbe Härte, die mir beim ersten Mal schon aufgefallen war. Ich ignorierte den plötzlichen Stich in meiner Brust.
»Deine Tasche«, sagte er und hielt sie mir an zwei Fingern vor die Nase.
»Ähm«, sagte ich, völlig aus dem Konzept gebracht, weil er so verdammt nah stand. Als ich sah, wie sich sein Mund spöttisch verzog, riss ich mich zusammen. Der hält mich für einen absoluten Volltrottel, weil ich meine Tasche vergessen habe. »Wie aufmerksam«, sagte ich förmlich und streckte die Hand nach meiner Tasche aus, um wenigstens ein Mindestmaß an Selbstvertrauen zum Ausdruck zu bringen.
Er zog seinen Arm zurück, sodass ich ins Leere griff. »Wie jetzt?«, fragte er amüsiert. »Warum bist du sauer auf mich? Ich hab sie schließlich nicht geklaut.«
»Nein, natürlich nicht«, schnaufte ich abwartend.
»Also …«, sagte er.
»Also … Wenn es für dich in Ordnung wäre, würde ich meine Tasche dann jetzt mitnehmen«, sagte ich, streckte noch einmal meine Hand aus und bekam diesmal die Riemen zu fassen. Aber er ließ nicht los.
»Wie wär’s mit einem kleinen Handel?«, bot er mir an, während ein Lächeln seinen Mund umspielte. »Ich geb dir deine Tasche, wenn du mir deinen Namen verrätst.«
Ich starrte ihn ungläubig an und zog dann ruckartig an meiner Tasche – gerade als er losließ. Ihr Inhalt entleerte sich komplett auf den Bürgersteig. Fassungslos schüttelte ich den Kopf. »Super. Vielen Dank auch!«
So elegant wie eben möglich kniete ich mich hin und stopfte Lippenstift, Wimperntusche, Portemonnaie, Telefon und eine gefühlte Million Stifte und Papierschnipsel dahin zurück, wo sie hergekommen waren. Als ich aufschaute, musterte er mein Buch.
»Wer die Nachtigall stört. Auf Englisch!«, bemerkte er und klang überrascht. Und dann sagte er in einem mit leichtem Akzent versehenen, aber sonst makellosen Englisch: »Tolles Buch. Hast du mal den Film gesehen … Kate?«
Mir fiel die Kinnlade runter. »Wie … Woher weißt du, wie ich heiße?«, war alles, was ich hervorbrachte.
Er zeigte mir seine andere Hand, in der er meinen Führerschein hielt – den ein außerordentlich schlechtes Passfoto von mir zierte. Ich fühlte mich dermaßen gedemütigt, dass ich ihm nicht mal mehr in die Augen sehen konnte, obwohl ich spürte, wie sein Blick auf mir brannte.
»Hör mal«, sagte er und lehnte sich leicht vor. »Es tut mir wirklich leid. Das wollte ich nicht.«
»Jetzt hör endlich auf, mit deinen Fremdsprachenkenntnissen rumzuprahlen, Vincent. Hilf dem Mädchen auf die Füße und lass sie gehen«, hörte ich eine andere Stimme auf Französisch sagen. Ich drehte mich zu dem Freund meines Peinigers um, der mir gerade meine Haarbürste entgegenstreckte – es war der Typ mit den Locken und dem Dreitagebart. Ein leicht amüsierter Ausdruck lag auf seinem Gesicht.
Die Hand ignorierend, die »Vincent« mir hinhielt, um mir aufzuhelfen, kam ich auf die Beine und klopfte meine Klamotten ab. »Bitte schön«, sagte er und gab mir mein Buch.
Ich nahm es mit einem ziemlich verlegenen Nicken entgegen. »Danke«, sagte ich knapp und versuchte, nicht zu rennen, als ich so schnell wie möglich das Café verließ und auf die Straße trat. Während ich darauf wartete, dass die Ampel Grün wurde, machte ich den Fehler, einen flüchtigen Blick zurückzuwerfen. Beide starrten in meine Richtung. Vincents Begleiter sagte etwas zu ihm und schüttelte den Kopf. Ich kann mir lebhaft vorstellen, was die zwei gerade über mich sagen, dachte ich und stöhnte.
Mein Gesicht wurde so rot wie die Ampel. Als sie endlich umschaltete, überquerte ich die Straße, ohne mich noch einmal umzusehen.
In den nächsten Tagen tauchte Vincents Gesicht überall auf. Im Lebensmittelgeschäft an der Ecke, auf der Treppe zur Metro, auf der Terrasse jedes einzelnen Cafés, an dem ich vorüberging. Natürlich nur auf den ersten Blick, beim zweiten Blick stellte ich fest, dass er es nie wirklich war. Zu meinem großen Ärger konnte ich nicht aufhören, an ihn zu denken. Noch ärgerlicher war nur, dass sich meine Gefühle zu gleichen Teilen aus selbstschützender Vorsicht und unerschrockener Schwärmerei zusammensetzten.
Aber, um ehrlich zu sein, war ich ganz dankbar für die Zerstreuung. Endlich beschäftigte mich etwas anderes als tödliche Autounfälle und die Frage danach, was ich mit dem Rest meines Lebens anfangen würde. Vor dem Unfall war ich mir einigermaßen sicher gewesen, was ich wollte, doch nun lag meine Zukunft wie ein gigantisches Fragezeichen vor mir. Irgendwann kam mir der Gedanke, dass meine Begeisterung für den »geheimnisvollen Fremden« vielleicht einfach nur eine Taktik meines Verstands war, um mir eine Verschnaufpause von all der Verwirrung und Trauer zu verschaffen. Wenn das wirklich so war, entschied ich, würde es mir auch nichts ausmachen.
Seit dem Zwischenfall mit Vincent im Café Sainte-Lucie war fast eine Woche vergangen. Obwohl ich es mir zur Angewohnheit gemacht hatte, täglich dort zu lesen, waren weder er noch einer seiner Freunde in der Zwischenzeit dort aufgetaucht. Ich saß wie immer an dem Tisch in der hinteren Ecke, den ich mittlerweile zu meinem persönlichen Platz erkoren hatte, und war auf den letzten Seiten eines weiteren Wharton-Romans von der Lektüreliste angelangt (mein zukünftiger Englischlehrer war offensichtlich ein großer Fan von ihr), als mir zwei Jugendliche am anderen Ende der Terrasse auffielen. Das Mädchen hatte kurze blonde Haare und ein schüchternes Lachen. Die vertraute Art, mit der sie sich zu dem Jungen lehnte, der neben ihr saß, deutete darauf hin, dass sie ein Paar waren. Doch als ich meinen prüfenden Blick über ihn gleiten ließ, erkannte ich eine große Ähnlichkeit zwischen den beiden, obwohl sein Haar rotblond war. Und auf einmal war ich mir sicher, dass die beiden Geschwister waren.
Plötzlich hob das Mädchen eine Hand, unterbrach damit ihren Bruder und sah sich auf der Terrasse um, als würde sie jemanden suchen. Ihr Blick blieb an mir hängen. Einen Augenblick zögerte sie, dann winkte sie mich energisch zu sich. Ich zeigte mit fragendem Ausdruck auf mich. Sie nickte und gestikulierte heftig.
Ich stand auf, machte ein paar zögerliche Schritte in ihre Richtung und fragte mich, was sie wohl von mir wollte. Sie wirkte sehr beunruhigt und bedeutete mir, mich zu beeilen.
Kaum dass ich meine kleine, sichere Ecke verlassen hatte und um den Tisch getreten war, hörte ich ein lautes Krachen hinter mir und flog der Länge nach auf den Boden. Mein Knie brannte und als ich meinen Kopf hob, sah ich Blut auf dem Boden.
»Mon Dieu!«, schrie einer der Kellner und bahnte sich einen Weg über die umgestürzten Tische und Stühle, um mir aufzuhelfen. Vor lauter Schock und Schmerz standen mir Tränen in den Augen.
Er zog ein Tuch aus seiner Schürze und tupfte damit das Blut von meinem Gesicht. »Da ist nur eine kleine Platzwunde an Ihrer Schläfe, machen Sie sich keine Sorgen.« Ich warf einen Blick auf mein brennendes Bein. Meine Jeans war aufgeschlitzt und mein komplettes Knie aufgeschürft.
Als ich überprüfte, ob ich noch weitere Verletzungen hatte, bemerkte ich, dass es auf der Terrasse totenstill geworden war. Doch statt auf mir, ruhten die Blicke der erschrockenen Cafébesucher auf irgendetwas hinter mir.
Der Kellner hatte aufgehört, meine Schläfe abzutupfen, um über meine Schulter zu schauen, und seine Augen weiteten sich vor Schreck. Ich folgte seinem Blick und sah, dass sich ein riesiger Brocken aus der mit Verzierungen überzogenen Fassade gelöst und meinen Tisch zerstört hatte. Meine Handtasche lag daneben, aber meine Ausgabe von Das Haus der Freude war von der Spitze des gewaltigen Brockens durchbohrt worden, genau da, wo ich gesessen hatte.
Wenn ich nicht aufgestanden wäre, dann wäre ich jetzt tot, dachte ich. Mein Herz schlug so schnell, dass mir der ganze Brustkorb wehtat. Schnell sah ich zu dem Tisch, an dem die Geschwister gesessen hatten. Außer einer Flasche Perrier und zwei vollen Gläsern, die inmitten von Kleingeld standen, war er leer. Meine Retter waren verschwunden.
Ich war so aufgewühlt, dass ich erst mal dort bleiben musste. Nachdem die Mitarbeiter des Cafés ihren halben Erste-Hilfe-Kasten an mir verbraucht hatten, bestand ich darauf, allein nach Hause zu gehen und schwankte los, meine Beine weich wie Gummibänder. Mamie trat gerade aus dem Haus, als ich ankam.
»Oh, meine kleine Katya«, kreischte sie, nachdem ich ihr erzählt hatte, was passiert war. Sie ließ ihre Hermès-Tasche auf den Boden fallen, um mich fest in die Arme zu nehmen. Dann hob sie unsere Sachen auf und brachte mich ins Haus. Sie steckte mich ins Bett und behandelte mich wie eine Querschnittsgelähmte – dabei hatte ihre Enkelin doch nur ein paar Schürfwunden abbekommen.
»Bist du dir ganz sicher, dass du bequem liegst, Katya? Ich kann dir noch mehr Kissen bringen, wenn du möchtest.«
»Mamie, das ist wirklich nicht nötig.«
»Tut dein Knie weh? Ich könnte noch eine andere Salbe holen. Und vielleicht solltest du das Bein hochlegen.«
»Mamie, die Leute vom Café haben mich mit allem Möglichen aus ihrem Erste-Hilfe-Kasten verarztet. Ist doch nur ein Kratzer.«
»Oh, meine kleine Maus. Wenn ich mir vorstelle, was alles hätte passieren können.« Sie drückte meinen Kopf an ihre Brust und streichelte über meine Haare, bis sich etwas in mir löste und ich anfing zu weinen.
Mamie summte tröstend und hielt mich fest, während ich heulte. »Ich weine nur, weil ich einen Schock habe«, beteuerte ich durch meine Tränen, aber die Wahrheit war, dass sie mich genau so tröstete, wie meine Mutter mich immer getröstet hatte.
Als Georgia nach Hause kam, hörte ich, wie Mamie ihr von meiner »Nahtoderfahrung« erzählte. Meine Tür öffnete sich kurz darauf und meine Schwester stürmte herein, ihr Gesicht weiß wie die Wand. Sie setzte sich stumm an mein Bett und starrte mich mit aufgerissenen Augen an.
»Mach dir keine Sorgen, Georgia. Ich hab nur eine Schürfwunde.«
»Mein Gott, Katie-Bean, wenn dir was passiert wäre … Du bist doch alles, was ich noch habe. Merk dir das.«
»Mir geht’s gut. Und mir wird schon nichts passieren. Ich halte mich künftig von Häusern fern, die auseinanderfallen. Versprochen.«
Sie rang sich ein Lächeln ab und nahm meine Hand, doch der gehetzte Ausdruck auf ihrem Gesicht blieb.
Am nächsten Tag verbot Mamie mir, das Haus zu verlassen und bestand darauf, dass ich mich ausruhte und mich »von meinen Verletzungen erholte«. Ich gehorchte, um sie bei Laune zu halten, und verbrachte den halben Tag lesend in der Badewanne, wobei ich das verletzte Bein über den Wannenrand baumeln ließ. Erst als ich im warmen Wasser saß und mich in dem Buch verlieren wollte, überwältigten mich meine Gefühle und ich fing an zu zittern wie Espenlaub. Mir war gar nicht bewusst gewesen, wie sehr mich der Beinaheunfall erschreckt hatte, bis ich zum wiederholten Male siedend heißes Wasser nachlaufen ließ, um mich zu beruhigen. Schließlich schlief ich in den kleinen Dampfschwaden, die aufstiegen, ein.
Als ich am nächsten Tag an dem Café vorbeikam, war es geschlossen und der Bürgersteig um das gesamte Gebäude herum mit rotweißem Polizeiabsperrband gesichert. Arbeiter in blauen Overalls errichteten ein Gerüst, damit Handwerker die Fassade ausbessern konnten. Ich musste mir gezwungenermaßen ein neues Café suchen, um unter freiem Himmel meine Bücher lesen zu können. Enttäuschung durchfuhr mich, als mir bewusst wurde, dass dies der einzige Ort war, an dem ich überhaupt die Chance hatte, demjenigen zu begegnen, von dem ich neuerdings wie besessen war. Wer wusste schon, wie lange ich warten musste, bis ich Vincent wiedersehen würde?
Meine Mutter hatte mich schon in Museen mitgenommen, als ich noch ganz klein war. Wenn wir in Paris waren, zogen Mama, Mamie und ich frühmorgens los, um uns »eine kleine Portion Schönheit zu genehmigen«, wie meine Mutter es nannte. Georgia, die sich schon beim ersten Gemälde langweilte, blieb lieber bei meinem Vater und Großvater, die ihre Zeit in Cafés verbrachten und mit Freunden, Geschäftspartnern und jedem anderen, der vorbeikam, plauderten. Wir drei, Mamie, Mama und ich, durchkämmten alle Museen und Galerien von Paris.
Deshalb war es keine große Überraschung, dass Georgia mich mit einem »Schon andere Pläne!« abspeiste, als ich sie ein paar Tage später fragte, ob sie mich in ein Museum begleiten wolle. »Ständig beklagst du dich, dass ich nie was mit dir unternehme, Georgia. Das war mal ein ernst gemeinter Vorschlag.«
»Ja, ungefähr so ernst gemeint, als würde ich dich zu einem Monster-Truck-Rennen einladen. Frag mich gern wieder, wenn du etwas vorhast, das wirklich interessant ist.« Um ihren guten Willen zu unterstreichen, drückte sie freundschaftlich meinen Arm, bevor sie mir ihre Zimmertür fast ins Gesicht fallen ließ. Touché.
Ich machte mich allein auf den Weg ins Marais, einen Stadtteil am anderen Ende von Paris. Ich folgte den winzigen mittelalterlichen Straßen, die sich zwischen den Häusern hindurchschlängelten, bis ich endlich mein Ziel erreicht hatte: das palastähnliche Gebäude, in dem sich das Musée Picasso befand.
Abgesehen von der Welt, in die mich Bücher entführen konnten, verlor ich mich fast genauso gern in den stillen Weiten eines Museums. Mama hatte immer gesagt, ich wäre im Grunde meines Herzens ein Wirklichkeitsflüchtling … dass mir erdachte Welten lieber wären als die echte. Es stimmte, schon von Kindesbeinen an konnte ich mich aus dieser Welt zurückziehen und in eine andere eintauchen. Und nun war ich reif für eine entspannende Dosis Kunsthypnose.
Als ich durch den gewaltigen Eingang die sterilen weißen Räume des Musée Picasso betrat, spürte ich, wie mein Herzschlag sich verlangsamte. Die Wärme und Ruhe dieses Ortes umgab mich wie eine weiche Decke. Wie gewöhnlich streifte ich herum, bis ein Gemälde meine Aufmerksamkeit auf sich zog, und dann ließ ich mich auf der Bank davor nieder.
Meine Haut saugte die Farben in sich auf. Die verschnörkelten, gewundenen Formen bildeten auf der Leinwand ab, wie es in mir aussah. Meine Atmung verlangsamte sich mehr und mehr, während meine Gedanken mich allmählich davontrugen. Die anderen Gemälde in diesem Raum, der Wachmann am Eingang, der Geruch von frischer Farbe, ja selbst die vorübergehenden Touristen verblassten zu einem einheitlichen grauen Hintergrund, der dieses eine Rechteck aus Farbe und Licht umrahmte.
Ich habe keine Ahnung, wie lange ich dort saß, bevor mein Verstand nach und nach aus diesem selbst verursachten Trancezustand zurückkehrte und ich leise Stimmen hinter mir vernahm.
»Komm mal hierher und sieh dir diese Farben an.«
Eine lange Pause. »Welche Farben?«
»Genau. Das hab ich dir doch letztens erzählt. In nur vier Jahren lässt er die hellen, kräftigen Töne eines Les Demoiselles d’Avignon hinter sich und geht zu diesen monotonen grau-braunen Puzzles über. Was für ein Angeber! Pablo musste immer der Beste sein, egal was er auch anfasste. Letztens habe ich noch zu Gaspard gesagt, was mich richtig ankotzt …«
Ich drehte mich neugierig um, wollte wissen, aus wem dieses geballte Wissen heraussprudelte, und erstarrte. Höchstens vier Meter entfernt von mir stand einer von Vincents Freunden, und zwar der mit den Locken.
Erst jetzt, als ich ihn so direkt vor mir sah, erkannte ich, wie attraktiv er war. Er hatte etwas Wildes an sich – zerzauste, ungepflegte Haare, ein leichter Stoppelbart und große, raue Hände, mit denen er leidenschaftlich gestikulierte. Vom Zustand seiner Hose, die mit Farbe beschmiert war, schloss ich darauf, dass er selbst Künstler war.
All diese Gedanken schossen mir im Bruchteil einer Sekunde durch den Kopf, denn schon im nächsten Moment hatte ich für nichts und niemand anderes mehr Augen als für den Menschen neben ihm. Den hübschen Jungen mit dem rabenschwarzen Haar. Den Jungen, der selbst noch in der hintersten Ecke meines Gehirns lauerte, seit ich ihn das erste Mal gesehen hatte. Vincent.
Warum musste ich mich ausgerechnet in den unmöglichsten, unerreichbarsten Jungen von ganz Paris verknallen? Er war viel zu schön – und unnahbar –, um mich jemals zu bemerken. Ich musste meinen Blick fast gewaltsam von ihm lösen, lehnte mich vor und legte mein Gesicht in meine Hände. Es half nichts. Vincents Bild war unauslöschlich in mein Gedächtnis gebrannt.
Was immer es war, das ihn auf bestimmte Art kühl, ja fast gefährlich wirken ließ, verstärkte mein Interesse an ihm nur noch, anstatt mich abzuschrecken. Was war bloß los mit mir? Normalerweise stand ich nicht auf die schlimmen Jungs – das war eher Georgias Spezialität. Mein Bauch krampfte sich zusammen, als ich mir überlegte, ob ich wohl den Mut hätte, zu ihm zu gehen und ihn anzusprechen.
Aber ich konnte nicht mal einen Versuch starten, denn als ich irgendwann meinen Kopf hob, waren sie verschwunden. Schnell lief ich zum nächsten Raum und lugte hinein. Er war leer. Und dann wäre ich fast tot umgefallen, weil plötzlich eine Stimme leise hinter mir »Hallo, Kate« sagte.
Vincents Gesicht tauchte gute fünfzehn Zentimeter über meinem auf. Meine Hand flog vor Schreck auf meinen Brustkorb. »Danke für den Herzinfarkt«, keuchte ich.
»Ist das eine Masche von dir, deine Tasche irgendwo liegen zu lassen, damit man einen Aufhänger für eine Unterhaltung hat?« Er grinste und nickte zu der Bank, auf der ich eben noch gesessen hatte. Darunter lag meine Tasche. »Wäre es nicht wesentlich unkomplizierter, einfach zu jemandem hinzugehen und Hallo zu sagen?«
Sein leicht spöttischer Ton verscheuchte meine Nervosität. An ihre Stelle trat eine heftige Gereiztheit, die uns beide überraschte. »Gut! Hallo«, knurrte ich, meine Kehle eng vor Wut. Ich marschierte zu der Bank, schnappte mir meine Tasche und stolzierte hinaus.
»Warte!«, rief er, lief hinter mir her und versuchte, mit mir Schritt zu halten. »So hatte ich das doch nicht gemeint. Ich wollte …«
Ich blieb stehen und starrte ihn an. Wartend.
»Es tut mir leid«, sagte er und atmete hörbar aus. »Ich war noch nie bekannt für meine Unterhaltungskünste.«
»Warum versuchst du es dann überhaupt?«, fragte ich ihn und schlug einen herausfordernden Ton an.
»Weil … Du bist – keine Ahnung – amüsant.«
»Amüsant?« Ich betonte jede einzelne Silbe und bedachte ihn mit meinem Du-spinnst-wohl-total-Blick. Meine geballten Fäuste stemmten sich wie von selbst in meine Hüften. »Erklär mir mal eins, Vincent. Hast du mich mit der ausdrücklichen Absicht angesprochen, mich zu beleidigen oder wolltest du noch etwas anderes?«
Vincent fasste sich mit der Hand an die Stirn. »Hör mal, es tut mir leid. Ich bin ein Vollidiot. Können wir … Können wir noch mal von vorn anfangen?«
»Womit von vorn anfangen?«, fragte ich zweifelnd.
Er zögerte einen Augenblick und hielt mir dann seine Hand hin. »Hallo. Ich bin Vincent.«
Meine Augen wurden schmal, während ich fieberhaft überlegte, wie ernst er das meinte. Ich nahm seine Hand und schüttelte sie etwas energischer, als ich beabsichtigt hatte. »Ich bin Kate.«
»Schön, dich kennenzulernen, Kate«, sagte Vincent leicht irritiert. Eine viersekündige Pause entstand, in der ich ihn unentwegt zornig anstarrte. »Also, kommst du oft hierher?«, murmelte er unsicher.
Ich lachte laut los, ich konnte einfach nicht anders. Er lächelte erleichtert.
»Ja, ehrlich gesagt schon. Ich steh total auf Museen, nicht nur auf Picasso.«
»Du stehst darauf?«
Vincents Englisch war so gut, man konnte schnell vergessen, dass es nicht seine Muttersprache war. »Das heißt, ich mag sie. Sehr sogar.«
»Gut, ich hab verstanden. Du magst Museen im Allgemeinen, nicht nur dieses hier. Und … Hierher kommst du nur, wenn du meditieren willst?«
Ich lächelte und rechnete es ihm innerlich hoch an, dass er sich solche Mühe gab.
»Wo ist denn dein Freund hin?«, fragte ich.
»Er ist gegangen. Jules lernt nicht gern neue Leute kennen.«
»Wie charmant.«
»Und wo kommst du her? Warte, lass mich raten. Großbritannien? Amerika?«, wechselte er das Thema.
»Amerika«, antwortete ich.
»Und das Mädchen, mit dem du manchmal unterwegs bist, ist deine …«
»Schwester«, sagte ich. »Hast du mir nachspioniert?«
»Wenn zwei hübsche Mädels in meine Nachbarschaft ziehen – was bleibt mir da anderes übrig?«
Eine Begeisterungswelle durchflutete mich bei diesen Worten. Er fand mich also hübsch. Aber er fand auch Georgia hübsch, meldete sich mein Verstand. Die Welle versandete.
»Das Museumscafé hat eine Espressomaschine. Wie wär’s, wenn wir einen Kaffee trinken, während du mir erzählst, auf was du sonst noch so stehst?« Er berührte mich am Arm. Schon brandete die Welle wieder auf.
Wir saßen an einem winzigen Tischchen vor zwei dampfenden Cappuccinos. »Nachdem ich nun einem Wildfremden schon meinen Namen und meine Nationalität preisgegeben habe, was willst du sonst noch wissen?«, fragte ich.
»Oh, keine Ahnung … Schuhgröße, Lieblingsfilm, sportliches Talent, peinlichster Moment, schieß los.«
Ich lachte. »Äh, Schuhgröße 41, Frühstück bei Tiffany, absolut gar kein sportliches Talent und viel zu viele peinliche Momente. Die kann ich gar nicht alle aufzählen, bevor das Museum schließt.«
»Das war’s? Mehr verrätst du mir nicht?«
Meine Abwehrhaltung schmolz dahin, weil er so überraschend charmant war – und ausgesprochen ungefährlich wirkte. Vincent ermutigte mich dazu, von meinem früheren Leben in Brooklyn zu erzählen. Von meinen Eltern und Georgia. Von unseren Sommern in Paris, von meinen Freunden zu Hause, zu denen ich mittlerweile keinen Kontakt mehr hatte. Von meiner grenzenlosen Liebe für die Kunst und meiner Verzweiflung, als ich feststellen musste, dass ich keinerlei Talent hatte, mich selbst kreativ zu betätigen.
Er löcherte mich weiter und ohne es eigentlich zu wollen, sprudelte es nur so aus mir heraus. Ich erzählte ihm alles, angefangen bei Bands, über Essen, Filme und Bücher – jedes erdenkliche Thema, das man sich nur vorstellen kann, kam zur Sprache. Im Gegensatz zu den Jungs, die ich von zu Hause kannte, schien ihn das tatsächlich ernsthaft zu interessieren, und zwar bis ins letzte Detail.
Dass meine Eltern tot waren, erwähnte ich nicht. Ich sprach in der Gegenwart von ihnen und erklärte ihm, dass meine Schwester und ich bei meinen Großeltern wohnen würden, weil wir in Frankreich zur Schule gehen wollten. Das war ja auch nicht komplett gelogen. Aber mir war einfach nicht danach, ihm die ganze Wahrheit zu sagen. Ich wollte kein Mitleid von ihm. Und ich wollte wie ein ganz normales Mädchen wirken, das nicht die letzten sieben Monate in einer Welt voller Trauer zugebracht hatte.
Seine Fragen kamen Schlag auf Schlag, ich bekam gar keine Gelegenheit, selbst eine zu stellen. Als wir irgendwann aufbrachen, hielt ich ihm das vor. »Jetzt liege ich vor dir wie ein offenes Buch – du weißt fast alles über mich, aber ich weiß gar nichts über dich.«
»Das ist Teil meines perfiden Plans.« Er lächelte und hinter uns schloss der Museumswärter die Tür ab. »Wie sonst könnte ich mir sicher sein, dass du dich auf ein weiteres Treffen mit mir einlässt, wenn ich schon bei unserem ersten Gespräch alle Karten auf den Tisch lege?«
»Das war nicht unser erstes Gespräch«, berichtigte ich ihn und versuchte, gelassen zu wirken angesichts der Tatsache, dass er mich um eine weitere Verabredung gebeten hatte.
»Unser erstes Gespräch, in dem ich dich nicht unbeabsichtigt beleidigt habe«, formulierte er seinen Satz neu.
Wir durchquerten den Museumspark und steuerten auf die Spiegelbecken zu, wo schreiende Kinder ausgelassen planschten und sich freuten, dass es um sechs Uhr abends noch so schön sonnig und warm war.
Vincent ging neben mir her, leicht nach vorne gebeugt, die Hände in den Taschen vergraben. Zum ersten Mal spürte ich in ihm ein Fünkchen Verletzlichkeit. Das war meine Gelegenheit. »Ich weiß nicht mal, wie alt du bist.«
»Neunzehn«, sagte er.
»Was machst du beruflich?«
»Ich studiere.«
»Ach, wirklich? Dein Freund meinte, du wärst Polizist.« Ich konnte mir einen sarkastischen Unterton nicht verkneifen.
»Wie bitte?«, stieß er hervor und blieb abrupt stehen.
»Meine Schwester und ich haben gesehen, wie du das Mädchen gerettet hast.«
Vincent sah mich verständnislos an.
»Das Mädchen, das von der Pont du Carrousel gesprungen ist, während in dem Tunnel unter der Brücke irgendwelche verfeindete Banden aufeinander losgegangen sind. Dein Freund hat uns von dort weggeführt und gesagt, dass dort ein Polizeieinsatz stattfände.«
»Oh, das hat er gesagt?«, murmelte Vincent. Sein Gesicht nahm den harten Ausdruck an, der mir schon häufiger aufgefallen war. Er schob seine Hände tiefer in die Taschen und ging weiter. Wir näherten uns der Metrostation. Ich wurde langsamer, um etwas Zeit zu schinden.
»Seid ihr verdeckte Ermittler?« Ich glaubte selbst nicht daran, gab mir aber Mühe, aufrichtig zu klingen. Sein plötzlicher Stimmungswandel hatte mich neugierig gemacht.
»So was Ähnliches.«
»Also so eine Art Sondereinsatzkommando?«
Er antwortete nicht.
»Das war wirklich mutig, dieser Sprung in die Seine.« Ich ließ nicht locker. »Hatte das Mädchen denn irgendwas mit dem Bandenstreit unter der Brücke zu tun?«, bohrte ich weiter.
»Darüber darf ich nicht sprechen«, sagte Vincent, den Beton zu seinen Füßen nicht aus den Augen lassend.
»Ja, klar. Sicher«, sagte ich gespielt unbedarft. »Bist du nicht ein bisschen zu jung für einen Polizisten?« Ich konnte das spöttische Grinsen auf meinen Lippen nicht verhindern.
»Ich hab doch gesagt, dass ich studiere«, wiederholte er und grinste mich unsicher an. Er wusste, dass ich ihm das nicht abkaufte.
»Ich verstehe schon. Also gut«, sagte ich dramatisch, »ich hab nichts gesehen. Ich hab nichts gehört.«
Vincent lachte, seine gute Laune kehrte zurück. »Kate, was machst du kommendes Wochenende?«
»Äh … Ich hab noch nichts vor«, sagte ich und verfluchte insgeheim meine Wangen dafür, dass sie langsam rot wurden.
»Wollen wir was zusammen machen?«, fragte er mit einem so umwerfenden Lächeln, dass mein Herz für einen Moment zu schlagen vergaß.
Ich nickte, denn sprechen konnte ich beim besten Willen nicht.
Weil er mein Schweigen als Zögern deutete, fügte er schnell hinzu: »Also, jetzt kein offizielles Rendezvous oder so was. Nur ein bisschen abhängen. Wir könnten … ein bisschen spazieren gehen. Zum Beispiel im Marais.«
Ich nickte noch einmal und brachte dann die folgenden Worte raus: »Das wär toll.«
»Gut, was hältst du von Samstagnachmittag? Bei Tageslicht. In der Öffentlichkeit. Eine absolut sichere Sache, selbst mit einem Typen, den du kaum kennst.« Er nahm seine Hände hoch, wie um zu beweisen, dass er nichts zu verbergen hatte.
Ich lachte. »Keine Sorge. Selbst wenn du zum SEK gehörst, hab ich keine Angst vor dir.« Kaum hatte ich den Satz ausgesprochen, wurde mir bewusst, dass ich genau das hatte: Angst. Zwar nur ein kleines bisschen, aber ich fragte mich, ob es das war, was mich zu ihm hinzog. Vielleicht hatte der Tod meiner Eltern meinen Selbsterhaltungstrieb nachhaltig gestört und nun lockte mich die Gefahr. Oder aber ich war dieser diffusen Aura von undurchdringbarer Distanziertheit verfallen, die er verströmte. Vielleicht sah ich auch eine Herausforderung in ihm. Was auch immer der Grund war, er hatte Erfolg. Ich mochte Vincent wirklich. Und ich wollte ihn wiedersehen. Tagsüber, nachts, ganz egal. Ich würde da sein.
Er hob eine Augenbraue und kicherte. »Keine Angst vor mir. Wie … amüsant.« Ich musste mitlachen, ich konnte nicht anders.
Er nickte in die entgegengesetzte Richtung und sagte: »Jules wartet sicher auf mich. Wir sehen uns dann also am Samstag. Treffen wir uns um drei vor der Metrostation Rue du Bac?«