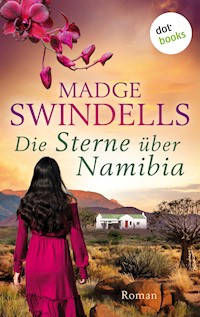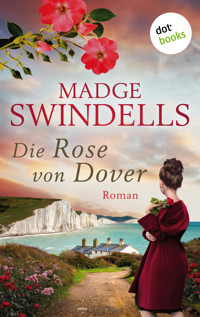
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als ihr Herz gebrochen wird, schwört sie Rache: der bewegende Roman »Die Rose von Dover« von Erfolgsautorin Madge Swindells als eBook bei dotbooks. Die Küste Dovers, wo sich Wellen an den Felsen brechen, auf denen wilder Thymian blüht … Sie sind noch so jung, als sie sich begegnen: Robert McLaren, Student und Erbe einer schottischen Whisky-Dynastie, und Marjorie, die aus einfachen Verhältnissen stammt. Als sie sich verlieben, scheint die Zeit stillzustehen – und holt sie doch unerbittlich ein: Robert muss überstürzt abreisen, um seiner Familie beizustehen, Marjorie bleibt zurück, mit gebrochenem Herzen … und schwanger! Ihre verzweifelten Versuche, mit Robert Kontakt aufzunehmen, scheitern an seiner eiskalten Mutter. Bleibt ihr nur, das Glück zu vergessen, das für kurze Zeit zum Greifen nah schien? In dieser schicksalshaften Stunde fasst Marjorie einen Plan: Sie wird ein besseres Leben für ihre Tochter erkämpfen – und sie wird alles daran setzen, so reich zu werden, dass sie eines Tages die stolzen McLarens in die Knie zwingen kann! Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Rose von Dover« von Madge Swindells ist ein Lesevergnügen für alle Fans von Danielle Steel, Barbara Taylor Bradford und Nora Roberts. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 742
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die Küste Dovers, wo sich Wellen an den Felsen brechen, auf denen wilder Thymian blüht … Sie sind noch so jung, als sie sich begegnen: Robert MacLaren, Student und Erbe einer schottischen Whisky-Dynastie, und Marjorie, die aus einfachen Verhältnissen stammt. Als sie sich verlieben, scheint die Zeit stillzustehen – und holt sie doch unerbittlich ein: Robert muss überstürzt abreisen, um seiner Familie beizustehen, Marjorie bleibt zurück, mit gebrochenem Herzen … und schwanger! Ihre verzweifelten Versuche, mit Robert Kontakt aufzunehmen, scheitern an seiner eiskalten Mutter. Bleibt ihr nur, das Glück zu vergessen, das für kurze Zeit zum Greifen nah schien? In dieser schicksalhaften Stunde fasst Marjorie einen Plan: Sie wird ein besseres Leben für ihre Tochter erkämpfen – und sie wird alles daransetzen, so reich zu werden, dass sie eines Tages die stolzen MacLarens in die Knie zwingen kann!
Über die Autorin:
Madge Swindells wuchs in England auf und zog für ihr Studium der Archäologie, Anthropologie und Wirtschaftswissenschaften nach Cape Town, Südafrika. Später gründete sie einen Verlag und brachte vier neue Zeitschriften heraus, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Bereits ihr erster Roman, »Ein Sommer in Afrika«, wurde ein internationaler Bestseller, dem viele weitere folgten.
Die Website der Autorin: www.madgeswindells.com
Bei dotbooks veröffentlichte Madge Swindells ihre großen Familien- und Schicksalsromane »Ein Sommer in Afrika«, »Die Sterne über Namibia«, »Eine Liebe auf Korsika«, »Liebe in Zeiten des Sturms«, »Das Erbe der Lady Godiva« und »Die Löwin von Johannesburg« sowie ihre Spannungsromane »Zeit der Entscheidung«, »Im Schatten der Angst«, »Gegen alle Widerstände« und »Der kalte Glanz des Bösen«.
***
eBook-Neuausgabe März 2021
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »Snakes and Ladders« bei Little, Brown and Company, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Eine Liebe in Dover« bei Bastei Lübbe.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1997 by Madge Swindells
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 by Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von shutterstock/iiiphevgeniy, Olga Ekaterincheva, Mark Bulmer, Scsetti Alfio, TTstudio, New Africa
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-389-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses E-Book entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses E-Book – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von E-Books ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Stichwort »Die Rose von Dover« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Madge Swindells
Die Rose von Dover
Roman
Aus dem Englischen von Ursula Walther
dotbooks.
Mit Dank an Jenni Swindells und Lawrie Mackintosh für ihre Hilfe bei den Recherchen und für ihre wertvollen Anregungen
sowie an meine Lektorin Hilary Hale für ihre einfühlsame, kreative Bearbeitung.
Prolog
Noch lange nachdem Marjorie Dover verlassen hatte, versetzten sie die schrillen Schreie der Möwen immer wieder zurück nach Hause. Sie saß wieder in ihrer gemütlichen Küche im Souterrain, die Blätter der Platane rauschten hoch über dem Fensterschacht im Wind und die blauen Baumwollvorhänge leuchteten vor dem geöffneten Fenster. Sie roch die auf dem Grill gebratenen Heringe und das getoastete Brot und sah ihre Mum vor sich, wie sie mit ihren kraftvollen, geröteten Händen die selbst genähte Wärmehaube über die Teekanne mit dem Weidenmuster stülpte und Erdbeermarmelade und selbst gebackenes Brot auf den Tisch brachte.
Mum war eine kleine, schmächtige, aber kraftvolle Frau mit tiefblauen Augen. Ihr Haar war grau, das Gesicht faltig, doch wenn sie lächelte, was oft vorkam, erinnerte sie an das junge Mädchen, das sie einmal gewesen war. Das lag an ihrer ungezwungenen, heiteren Ausstrahlung. Sie war zufrieden mit ihrem Mann, ihrer Tochter und ihrem Heim und hatte ihre Freude an den meisten Dingen, die sie umgaben. Doch das Leben hatte auch andere Seiten, nur machte sich Mum nicht die Mühe, diese Seiten zur Kenntnis zu nehmen. Diese Art, alles Unangenehme zu verdrängen, hatte Marjorie immer erschreckt.
Komisch, dachte Marjorie, wenn ich mich an früher erinnere, dann meistens an die Teezeit. Kurz vorher kam Dad nach Hause. Er war ein großer, stiller Mann, hatte seegrüne Augen und die sanfteste Stimme, die man sich vorstellen konnte. Er nickte ihr zu und küsste Mum auf die Wange, einen Moment später hielt er seinen Becher mit dem starken Tee in den Händen. Sein Becher war marineblau mit einem großen roten Herzen und der Aufschrift: »I love Dad.« Mum hatte ihn einmal bei einem Tagesausflug in Brighton gekauft.
Marjorie war zu stolz, um ihre Gefühle zu zeigen. Stattdessen wartete sie ab, legte jedes Wort und jeden Blick auf die Goldwaage und analysierte haargenau das Mienenspiel ihres Vaters – er liebt mich, er liebt mich nicht. Sie sehnte sich nach seiner Liebe, aber er hatte nur Augen für Mum. Das waren sie, die drei, die zu einem fragilen, ungleichen Dreieck zusammengeschweißt waren: Dad liebte Mum, Mum liebte Marjorie und Marjorie liebte Dad. Punkt.
Aber dann trat Robert in Marjories Leben und all die enttäuschten Empfindungen, die sich im Laufe ihres kurzen Lebens angestaut hatten, fanden ein Ziel.
Teil 1ROBERT Juni 1972 – Juli 1973
Kapitel 1
15. Juni 1972
In Dover gab es Stolz und die Vergangenheit, aber wenig mehr. Der Blick des Besuchers wanderte unwillkürlich zur Burg auf den Klippen, da sie riesengroß war und die Stadt beherrschte. Die massiven Festungswälle mit den im Wind flatternden Fahnen und die Türme, die nach den Wolken griffen, waren ein Mahnmal, das an den Kampf des Menschen für Freiheit und Vollkommenheit erinnerte, und die Bevölkerung hatte trotz der vielen entsetzlichen Fehlschläge diese Charakterstärke und Kampfbereitschaft nicht verloren.
Außerdem waren da noch die weißen Klippen von Dover, die eigentlich mehr grün als weiß aussahen, wenn man unter ihnen stand. Die Klippen waren bei den Einheimischen sehr beliebt, ein Zufluchtsort, an dem man das eintönige Alltagsleben vergessen und sich im Garten der Natur vergnügen konnte. Purpurrote Orchideen wuchsen dort und Schwarzwurz, wilder Thymian, Glockenblumen und wilde Petersilie.
Für den Reisenden, den sein Weg zufällig durch Dover führte (diese Stadt eignete sich für kaum mehr als zur Zwischenstation), waren die Klippen nicht mehr als schroffe, steil abfallende Kalksteinfelsen. Im Winter, wenn das Gestrüpp und das Gras von den Hängen gespült worden waren, trat der blanke Kalkstein zutage. Die steilen Felsen trotzten Wind und Wetter ebenso wie dem tosenden Meer, als wollten sie sagen: »Bis hierhin und nicht weiter.« Die Stadtbewohner waren wie diese Klippen, störrisch und entschlossen – ihre duldsame Stärke wirkte beinahe Furcht einflößend.
An all das dachte der groß gewachsene Junge, der am Kiesstrand stand und die Burg betrachtete. Er versuchte, diese Stadt zu verstehen und seine Eindrücke in Worte zu fassen, aber damit hatte er große Schwierigkeiten. Nach einer Weile schlenderte er zum Wasser und richtete den Blick auf den Kanal. Die Sonne glitzerte auf dem Wasser; funkelnder Dunst hing über dem vorbeisausenden Luftkissenboot. An diesem Junitag war kein Wölkchen am Himmel zu sehen und die Sonne stand im Zenit, dennoch spürte der Junge den beißenden Ostwind auf der Haut.
»Im Hochsommer umweht dich der Hauch des Winters«, flüsterte er – die willkommene Kraft der Inspiration stieg wie Saft in seinen Gliedern auf, doch nach ein paar Augenblicken, die ohne brauchbaren Einfall verstrichen, stopfte er sein Notizbuch in die Tasche und zog sich bis auf die Boxershorts aus.
Die unvermutete Kälte des Wassers raubte ihm den Atem und spornte ihn an, sich zu bewegen. Er stürzte sich mit dem Bauch voran in die knietiefen Fluten und kraulte kraftvoll in Richtung Wellenbrecher. Von Zeit zu Zeit hielt er inne, um sich eine Weile treiben zu lassen und Wasser zu treten, während er zurück zur Küstenlinie schaute. Wie immer stimmte ihn der Kontrast zwischen der Burg und der schmuddeligen Stadt dahinter traurig. Er fragte sich, ob diese Stadt tatsächlich ein episches Poem verdiente. Pitman, sein Englischlehrer, rechnete fest damit, dass er ein ansprechendes Gedicht für die nächste College-Zeitung schrieb.
Das Salzwasser brannte in seinen Augen und hinterließ einen bitteren Geschmack in seinem Mund, als er weiter kraulte. Ein kleines Dingi mit schlaffen Segeln fiel ihm auf; es tanzte nicht weit von der Mauer entfernt, die die Wucht der Wellen bremste, auf dem Wasser, als wäre niemand an Bord. Der junge Mann änderte seinen Kurs, schwamm so schnell er konnte darauf zu, dann stieß er sich halb aus dem Wasser, um sich auf das Dollbord zu stützen und sich an Deck zu hieven. Sein Irrtum wurde ihm im Bruchteil einer Sekunde bewusst. Ein hübsches, nacktes Mädchen, das flach im Boot lag, grapschte erschrocken nach einem Handtuch und versuchte sich zu bedecken, aber der heftige Wind machte ihre Bemühungen zunichte. Heiterkeit und Lust brachen sich gleichzeitig Bahn.
»Hoppla«, sagte er. »Verzeihung. Von dort drüben sah es aus, als würde das Boot allein auf dem Wasser treiben. Ich meine, ich konnte niemanden sehen ...«
»Schau weg, sonst ...«, schrie sie.
An ihrer Stimme erkannte er, dass sie aus der Gegend stammte. In ihm brodelte das Begehren und er war nur zu froh, sich umdrehen zu können, doch ihr Anblick ging ihm nicht aus dem Kopf. Ihre Haut war hell und makellos, das tizianrote Haar hing in langen, wirren Locken um ihr Gesicht und leuchtete im Sonnenschein, die großen Augen waren betörend. Diese Augen schimmerten wie das Meer – grün und blau zugleich – und der geschwungene Mund war zum Küssen wie geschaffen.
»Beeil dich lieber! Du bist schon viel zu nah am Wellenbrecher.«
Er hörte, wie sie erstaunt nach Luft schnappte. »Mensch! Ich bin eingeschlafen. Ich wollte ein bisschen braun werden. Du kannst dich jetzt wieder umdrehen. Ich bin salonfähig.«
Das war mehr, als er von sich behaupten konnte. Offensichtlich hatte sie nichts bemerkt, denn sie zog ungerührt den Anker an Bord.
»Geh da rüber«, rief sie ihm zu.
In der ausgebleichten Jeansshorts und dem alten grauen Pullover sah sie immer noch so verführerisch aus wie vorher und er wünschte, er hätte etwas an, was die verräterische Ausbuchtung besser verhüllt hätte. Er fand es an der Zeit, sich vorzustellen.
»Mein Name ist Robert MacLaren und ich bin in der Abschlussklasse im College von Dover.«
»Das passt«, murmelte sie. Sie kauerte im Heck, hielt die Ruderpinne fest und lächelte, als das Boot mühelos durch die Wellen glitt.
»Ein ziemlich gutes Dingi«, sagte er.
»Ein Boot für jedes Wetter. Es hat gern ein bisschen Spaß an einem so schönen Tag wie heute, aber wenn es stürmisch ist, ist es zäh und verlässlich, wie man es sich nur wünschen kann. Mein Vater hat es gebaut. Möchtest du eine kleine Spritztour machen, bevor wir zurücksegeln?« Sie deutete auf das Meer hinter dem Wellenbrecher.
»Warum nicht?«, erwiderte er.
Sie war eine großartige Seglerin, aber nur wenige Minuten später fragte er sich unwillkürlich, ob sie sich an ihm rächen wollte. Sie zog die Segelleine, bis das Boot knapp davor war, zu kentern, und die Segel fast das aufgewühlte Wasser berührten. Robert stockte der Atem bei der halsbrecherischen Geschwindigkeit. Der scharfe Wind frischte noch mehr auf. Sie rasten über kabbelige Wellen. Ihre Haare waren triefend nass, die Augen gerötet von der salzigen Gischt, der feuchte Pullover klebte an ihren vollen Brüsten und sie lächelte vor Freude und Aufregung. Sie war unglaublich hübsch und mutig. Schließlich gab sie es auf, ihm Angst einzujagen, und nahm Kurs auf den Hafen.
»Und was machst du, wenn du nicht segelst?«, wollte er wissen, als er sich wieder verständlich machen konnte. Er spürte, dass sie immer noch böse auf ihn war. »Hör mal, es tut mir leid. Es sah wirklich so aus, als wäre das Boot verlassen und würde führerlos auf die Mauer zutreiben. Was hätte ich tun sollen? Ich schwimme sofort zurück, wenn du willst.«
»Nein, ist schon in Ordnung. Ich nehm dich mit an Land. Wahrscheinlich sollte ich dir dankbar sein, aber in Wahrheit war ich sauer, weil du mich so erwischt hast. Du weißt schon ... Ich wollte nur Sonne tanken, solange ich Gelegenheit dazu habe.«
Danach schwieg sie eine Weile. Schmollte sie etwa?
»Wie wär’s mit Tee und Gebäck, damit wir das langweilige Kennenlernen so schnell wie möglich hinter uns bringen?«, schlug Robert vor, sobald sie in den Hafen kamen. »Ich sehne mich danach, alles über dich zu erfahren, was es zu erfahren gibt – wann du laufen gelernt hast, ob du deine Zähne täglich mit Zahnseide säuberst, wie oft du schon geküsst worden bist und dergleichen lebenswichtige Dinge, die jeder Junge wissen möchte, obwohl er Angst hat, danach zu fragen.« Er machte eine kurze Pause, um ihr Zeit zu geben, das zu verdauen. Dann fragte er: »Magst du Kuchen?«
»Solange es Schokoladenkuchen ist.« Wenn sie lachte, hatte sie Grübchen in den Wangen und ihr langer, sinnlicher Hals bebte. Sie trug nichts unter ihrem Pullover und die Brüste schimmerten durch die großen Maschen. »Du bist ein ganz Cooler, das muss ich schon sagen. Die Antwort ist ›nein‹. Du brauchst mir keinen Kuchen zu spendieren, um alles zu erfahren. Du kriegst die Informationen ganz umsonst.«
»Aber du kommst mit?«
»Klar. Und für den Fall, dass dich das auch interessiert: Ich heiße Marjorie Hardy«, setzte sie ruhig hinzu.
Kapitel 2
Zwei Mädchen bummelten Arm in Arm nach Hause, sie hielten Tennisschläger in den Händen und hatten die Riemen ihrer Schultaschen um die Schultern geschlungen. Neben ihnen wogte sanft und geheimnisvoll das glitzernde Meer. Es war zärtlich wie eine Frau und murmelte leise, ohne die Leidenschaft seiner unergründlichen Tiefen preiszugeben, und die Mädchen waren wie das Meer. Sie wirkten erdentrückt, als sie plaudernd durch den dämmrigen Dunstschleier wanderten.
Marjories spärliche Garderobe war ein empfindliches Thema, das sie möglichst nicht außerhalb der Familie zur Sprache brachte, aber Barbara, ihre Freundin und Nachbarin, schnitt es an und ließ nicht locker.
»Komm schon. Sag’s mir. Was ziehst du zu der Chorprobe an?«
Marjorie zuckte sichtlich zurück. »Ich dachte, wir ziehen alle unsere Schuluniform an.«
»Nein! Etwas Schlichtes, sagte die Lehrerin, vielleicht ein Kostüm mit einer sauberen weißen Bluse.«
Die Worte jagten Marjorie einen eisigen Schauer über den Rücken. Sie hatte den dunkelblauen Schulblazer, in dem sie aussah wie eine Tonne, aber was machte das schon – er war ja nur für die Schule. Außerdem gab es da noch den gelben Mantel und das grelle orangefarbene Jackett, das sie vor drei Jahren gekauft hatte. Es war viel zu kurz und in letzter Zeit musste sie den Atem anhalten, wenn sie es zuknöpfen wollte. Mum hatte ihre beiden Röcke und ihre einzige Hose mit falschen Säumen angestückelt, trotzdem war die Hose noch zu kurz und sah schlichtweg albern aus. Egal, wie wenig sie aß, ihre Brüste schienen sich immer weiterzuentwickeln – sie hatte nicht eine einzige Bluse, in der sie halbwegs respektabel aussah.
Barbara plapperte ohne Punkt und Komma, aber Marjorie hörte ihr nicht zu. Plötzlich spürte sie die Hand der Freundin auf ihrem Arm. »Hast du deine Zunge verschluckt?«, fragte Barbara besorgt.
»Tut mir leid. Was hast du gesagt? Ich war ganz in Gedanken.«
»Ich wette, du hast von dem College-Jungen geträumt, den du neulich kennengelernt hast.«
»Oh! Den hab’ ich ganz vergessen«, log sie.
In Wirklichkeit sah sie ihn beinahe ständig vor sich. Seine Haare waren blauschwarz, fest und gelockt, die dunkelbraunen Augen ausdrucksstark. Die meiste Zeit lächelte er, aber Marjorie hatte bemerkt, dass seine Stimmung hin und wieder umschlug wie der Wind. Wahrscheinlich hatte er Temperament und konnte sowohl launisch als auch leidenschaftlich sein. Seine sonnengebräunte Haut bewies, dass er sich gern im Freien aufhielt; er war groß, stark und überhaupt ein ganz besonderer Junge. Er könnte ein Zigeuner sein, sinnierte sie, oder vielleicht war er ein halber Spanier, aber er hatte einen leichten schottischen Akzent.
Bei dem gemeinsamen Tee hatte er sie eine geschlagene Stunde zum Lachen gebracht und jede Einzelheit aus ihr herausgequetscht, aber sie wusste von ihm nur, dass er sich für die englische Sprache und Literatur begeisterte. Er hatte schon jetzt einen Studienplatz in Oxford, egal wie seine Abschlussprüfungen ausfielen, und er hoffte, einmal ein großer Dichter und Schriftsteller zu werden.
»Kannst du dir deinen Lebensunterhalt mit der Schriftstellerei verdienen?«, hatte sie ihn gefragt.
»Das bezweifle ich. Wahrscheinlich werde ich mein Leben lang unterrichten müssen, um meine Muse durchzufüttern. Musen sind kostspielige Huren.«
Sie hatte noch nie jemanden wie ihn kennengelernt. Als sich Robert mit einem fröhlichen Winken von ihr vor dem Café verabschiedet hatte, schien ein Teil von ihr mit ihm gegangen zu sein. Er hatte nicht davon gesprochen, dass er sie wiedersehen wollte. Warum sollte er auch? Seither träumte sie von ihm und in der letzten Nacht war der Traum entsetzlich real gewesen. Er war nackt zu ihrem Boot geschwommen und an Bord geklettert, während sie sich gesonnt hatte. Sie beide – nackt wie die Babys und ganz nah zusammen ... Die Röte stieg ihr ins Gesicht, als sie daran dachte, was als Nächstes passiert war.
»Mann! Sieh dir deine roten Wangen an. Was ist los mit dir?«
»Mir ist nur heiß, das ist alles. Die Sonne ist heiß.«
»Ja! Ich wette, das ist sie, aber sie ist längst hinter dem Horizont verschwunden.« Barbara kicherte. »Ich schätze, du bist heiß auf ihn.« Sie brach in schallendes Gelächter aus, dann legte sie den Arm um Marjorie, um ihr zu zeigen, dass sie es nicht böse meinte.
Die beiden Mädchen kamen vor Marjories Haus an. Marjorie wünschte der Freundin rasch eine gute Nacht, schlüpfte durch das Tor und ging hinein.
»Hallo, Mum«, rief sie und hörte, wie ihre Mutter von unten aus der Küche antwortete.
Der Zeitpunkt war so gut wie jeder andere, um auf ihre spärliche Garderobe zu sprechen zu kommen, entschied sie, während sie an der Treppe zögerte. In letzter Zeit hatte sie nicht gern um etwas gebeten, da ihr Vater sich Sorgen um seinen Job machte, aber inzwischen hatte er sicher seinen Tee gehabt und trank seinen Magenbitter, um das Brot und den gebratenen Hering hinunterzuspülen. Zu dieser Tageszeit war die Welt für ihn so in Ordnung, wie sie nur sein konnte. Und zudem war Mittwoch – ein guter Tag.
Dads Leben drehte sich nur ums Fußballtoto. Die Spiele am Samstagnachmittag brachten die große Ernüchterung mit sich, weil er nicht gewonnen hatte. An den Wochenenden war er am absoluten Tiefpunkt angelangt, am Montag erging es ihm nicht viel besser, doch am Dienstag regte sich neue Hoffnung. Der Mittwoch war der Tag des Optimismus und die freudige Erwartung hielt bis zum Samstagnachmittag an. Und so ging das Woche für Woche.
Es war ein warmer Abend. Er und Mum machten später sicher einen Spaziergang zum Meer und schauten im Pub vorbei. Marjorie lief die Treppe hinunter und sah auf den ersten Blick, dass sie mit ihrer Vermutung recht gehabt hatte. Sie wollten heute noch ausgehen.
»Du bist zu spät zum Tee«, stellte Mum fest. »Ich hab’ dir ein bisschen was aufgehoben. Es ist dort unter dem Tuch.«
»Danke«, sagte Marjorie. »Ach, übrigens, Mum, ich gehe ins Dover College. Wir singen den Messias von Händel mit den Jungs aus der Abschlussklasse. Morgen Abend fangen wir mit den gemeinsamen Proben an.«
Ihre Mutter sah auf, als sie ihren scharfen Tonfall vernahm. »Und?«
»Mum, glaubst du, ich könnte mir ein neues Jackett kaufen? Mein altes ist mir zu klein. Es schneidet unter den Achseln ein und es ist viel zu kurz.«
»Eine Schnapsidee«, sagte Mum. »Als ob man Wasser mit Öl vermischen wollte. Vergaff dich bloß nicht in einen dieser College-Jungs. Reich heiratet reich, mein Kind.«
»O Mum! Ich gehe doch nur zu den Chorproben und du redest vom Heiraten!« Sie kicherte.
»Wir können es uns nicht leisten, dir was Neues zum Anziehen zu kaufen, Liebes. Wir stehen am Anfang einer Rezession. Den Schiffsbau trifft’s am schlimmsten. Dad konnte seit Wochen so gut wie keine Überstunden mehr abrechnen. Wir machen uns ernsthaft Sorgen. Aber denk dran, in ein paar Wochen verdienst du selbst genug. Dann wirst du eine unabhängige junge Dame sein. Ich an deiner Stelle würde abwarten, bis ich ein bisschen eigenes Geld in der Tasche habe.«
Marjorie versuchte ihre Angst zu verdrängen. Wovon redete Mum da – von einem Ferienjob? Sie wussten doch beide, dass sie Lehrerin werden wollte. Mum kommandierte stets und ständig alle herum. Was immer Mum in den Kram passte, wurde so hingedreht, als wäre es das Beste für die anderen.
Dad tat so, als würde er Zeitung lesen, aber Marjorie wusste, dass er genau zuhörte. »Dad«, flehte sie ihn an. »Kannst du mir nicht ein bisschen Geld geben?«
»Sie will im Chor im College singen«, erklärte ihre Mutter, als hätte Dad nichts mitbekommen.
Ihr Vater wirkte betreten. »Dein Schulblazer ist noch tadellos«, sagte er. »Wenn er für die Schule gut genug ist, dann ist er auch gut genug für die feinen Pinkel.«
Die großen grünen Augen ihres Vaters betrachteten sie und ihr Problem distanziert. Der Kontrast zwischen diesen Augen und dem kantigen, faltigen Gesicht war manchmal schockierend.
»Man hat uns gesagt, dass wir keine Schuluniform tragen sollen«, erklärte sie.
»Dann zieh dein orangefarbenes Jackett an, Kleines«, schlug Mum vor. »Es ist wirklich hübsch.«
»Es ist zu kurz und zu eng«, gab Marjorie zurück.
»Das stimmt. Es sieht komisch aus«, pflichtete Dad ihr bei.
»Meine Röcke und die Hose sind auch zu kurz und ich weiß nicht, was ich tun soll«, sagte sie den Tränen nahe.
»Ich hab’ dir gesagt, was du tun sollst. Zieh deine Schuluniform an.« Ihr Vater widmete sich wieder seiner Zeitung.
»Unsinn«, sagte Mum. »Sie kann nicht die Schuluniform tragen, wenn die anderen es nicht tun. Es ist nichts verkehrt an einem kurzen Jackett. Kurz ist modern.«
»Ja, aber nicht ein Jackett, aus dem man herausgewachsen ist«, brummte Dad.
Marjorie sprang auf – der Stuhl fiel um – und rannte hinaus. Vor der Tür blieb sie stehen und überlegte, wie sie ihre Eltern doch noch überreden konnte.
»Sie wird von Tag zu Tag plumper«, hörte sie ihren Vater murmeln.
»Oh, sie ist genau richtig. Sie wird erwachsen. Es dauert nicht mehr lange, dann ist sie aus dem Haus.«
Marjorie stolperte die Treppe hinauf und setzte sich aufs Bett. Alles tat ihr weh vor Sehnsucht und dem Bedürfnis nach Liebe.
Kapitel 3
Marjories Kammer, in die das Licht durch zwei Dachfenster fiel, war vollgepflastert mit Postern ihrer Helden. Marc Bolan, Rod Stewart, Donny Osmond und Elvis Presley hingen neben einer ängstlichen Mutter und ihrem Kind aus Hue, Südvietnam, und protestierenden amerikanischen Indianern. Im Regal stapelten sich Bücher über Kunst, Musik und Mode, einige Klassiker und Gedichtbände, die sie hauptsächlich auf Flohmärkten erstanden hatte. Auf dem Boden waren Sitzkissen verstreut und sie besaß ein eigenes Radio.
Marjorie hatte sich ein Modemagazin aus der Schulbücherei entliehen. Sie lag unter dem Fenster auf dem Boden und quälte sich selbst, indem sie die Zeitschrift durchblätterte und die Bilder betrachtete. Irgendwie musste sie doch improvisieren können, redete sie sich ein, aber die abgebildeten Models machten all ihre Hoffnungen zunichte. Diese langen, glatten Beine, diese perfekten Gesichter, diese überheblichen, selbstbewussten Mienen! Am liebsten würde sie tot umfallen, wenn sie in den Spiegel schaute. Wenn doch nur ... Trotzdem, argumentierte sie dagegen, die Frisuren der Mädchen sehen nicht nach viel aus. Nur lange, gerade, ausgefranste Strähnen. Eine solche Frisur brachte sie ohne Schwierigkeiten auch mit ihren Haaren zustande. Außerdem hatte sie einen braunen Eyeliner und einen dunkelroten Lippenstift – das musste reichen fürs Make-up. Aber was sollte sie anziehen?
Sie brütete verzweifelt über den Fotos und wünschte sich nichts sehnlicher, als zu dieser Glitzerwelt zu gehören. Ihr Blick viel auf einen Artikel: »Die Siebzigerjahre bringen den Realismus in die Mode. Fantasie wird kleingeschrieben und die moderne Frau muss der harten ökonomischen Realität ins Auge schauen.«
»Erzähl mir lieber mal was Neues«, murmelte Marjorie.
Die Verzweiflung gewann die Oberhand. Sie hatte so wenig, mit dem sie experimentieren konnte. Plötzlich entdeckte sie ein Model, das mit vor Freude erhobenen Armen einen Bürgersteig entlangrannte: Das Mädchen trug Hosen, die am Knie endeten – in der Zeitschrift nannte man solche Hosen culottes. Marjorie sah sich das Foto ganz genau an, dann sprang sie auf, um die Schneiderschere ihrer Mutter zu holen.
Wie viel Saum brauchte man für die Aufschläge? Ein gutes Stück. Ihr Herz klopfte wild, als die Schere durch den Stoff schnitt. Sie würde es mit Dad zu tun bekommen, wenn sie die Hose ruinierte. Sie nähte noch immer an den Aufschlägen, als ihre Mutter von unten rief: »Wir gehen in den Pub, Liebes.«
Mit dem Geld, das sie in diesem Pub ausgegeben haben, könnte ich mir fünfzig neue Hosen kaufen, dachte Marjorie grimmig, aber es hatte keinen Sinn, sich über Sachen zu ärgern, die ohnehin nicht zu ändern waren. Sie lief in die Küche, bügelte ihren neu entstandenen Hosenrock, dann hielt sie ihn vor sich und sah kritisch in den Spiegel. Hm – nicht schlecht.
Und jetzt das Oberteil. Die meisten Models trugen die Blusen bis zur Taille offen. Das war schön und gut für sie, da die ganze Welt von Models erwartete, alles, was sie hatten, zu zeigen, und die meisten hatten nicht viel mehr als Haut und spitze Knochen. Aber wenn sie auch ihre Bluse offen tragen könnte, würde kein Mensch merken, dass sie eigentlich viel zu eng war. Ihr nachdenklicher Blick fiel auf den schwarzen Schulbadeanzug. Sie schnappte sich ein paar Klamotten und rannte hinunter, um sich vor dem großen Spiegel ihrer Mutter auszuziehen.
Sie sah sich nicht oft nackt im Spiegel. Daher betrachtete sie sich jetzt eingehend und wurde rot, als sie ihre Brüste sah, die seit dem letzten Blick in den Spiegel viel voller und dunkler um die Brustwarzen geworden waren. War das wirklich sie? Sie schaute und schaute ... irgendwie komisch: Sie war größer und schlanker, als sie gedacht hatte. Nach einer Weile hob sie die Hände und legte sie auf die Brüste. Sie spürte, wie fest sie unter der weichen, hellen Haut waren. Was, wenn Roberts Hände ...? Bei diesem verruchten Gedanken stieg ihr die Hitze ins Gesicht, ihre Brustwarzen wurden steif und dick und sie fühlte eine eigenartige Feuchtigkeit zwischen ihren Schenkeln.
»O Robert«, flüsterte sie.
»Hör auf mit dem Quatsch«, rief sie sich laut zur Ordnung. Sie zog ihren Badeanzug und den neuen Hosenrock an, dann fädelte sie einen Gürtel in die Schlaufen und streifte ihre Schulbluse über, ohne sie zuzuknöpfen. Ausgesprochen apart, fand sie. Aber was war mit den Schuhen? Sie nahm zwei Stufen auf einmal, als sie hinauf- und mit dem einzigen Paar hochhackiger Schuhe, die sie besaß, wieder zurückrannte. Die Schuhe, die sie vor einiger Zeit für die Hochzeit ihrer Cousine bekommen hatte, waren zwar schneeweiß, aber das ließ sich mit dem Färbemittel aus der Drogerie leicht ändern ... Ihr neues Outfit hätte direkt aus dem Modemagazin stammen können.
Die Zeit verflog. Endlich war sie fertig mit allem, aber etwas fehlte doch noch. Ohrringe! Die Hälfte der Mädchen hatte durchstochene Ohrläppchen. Barbara hatte sich die Ohren vor ihrem letzten Geburtstag durchstechen lassen, später hatte sie Marjorie ihre alten Stecker geschenkt, als sie selbst ihre ersten goldenen Kreolen bekam. Marjorie holte die Stecker aus der mit Watte ausgepolsterten Streichholzschachtel, in der sie sie aufbewahrte, und hielt sie sich an die Ohren.
So weh konnte der Stich nicht tun, oder?, überlegte sie und suchte nach einer großen Sicherheitsnadel.
Es tat ziemlich weh, erkannte sie beim ersten Stich. Der Schmerz trieb ihr die Tränen in die Augen. Sie drückte fester zu, die Qual war unerträglich und sie holte Eis aus der Küche.
Als sie mit gefrorenen Ohren wieder in ihr Zimmer kam, musterte sie sich im kleinen Spiegel. »Willst du aussehen wie aus der Modezeitschrift, Marjorie Hardy, oder wie ein Schafskopf? Es ist doch nur ein Ohr, nicht mehr und nicht weniger.« Sie tauchte die Sicherheitsnadel in ein Fläschchen mit Desinfektionsmittel und machte sich erneut ans Werk. Zehn Minuten später klopfte ihr Herz heftig, ihre Augen tränten und ihr Gesicht war kreideweiß, aber die Stecker saßen fest in ihren Ohrläppchen.
Kapitel 4
Wenn ich doch nur eine Strickleiter hätte, dachte Marjorie, als sie oben an der geschwungenen Treppe stand und versuchte, all ihren Mut zusammenzunehmen, um hinunterzugehen. Die Angst, zu spät zu kommen, trieb sie schließlich an. Es musste einen Trick geben, wie man leise mit hochhackigen Schuhen solche Stufen überwinden konnte, aber Marjorie kannte ihn nicht und jeder Schritt hallte so laut durchs Haus, als würde sie Nägel in Holz schlagen. Peng, peng, peng! Verdammt! Sie bückte sich, um die Schuhe auszuziehen, doch es war zu spät.
Dad tauchte mit der Zeitung in der Hand am Fuß der Treppe auf. Er starrte sie lange an und rief schließlich: »Jesus! Mum, komm her und sieh dir das an. Wohin will sie in diesem Aufzug?«
Mum erschien und musterte sie unwillig. »Ist das nicht ein bisschen viel, Liebes?«
»Es ist genau richtig, glaub mir. Ich habe etwas aus einem Magazin kopiert.«
Ihre Mutter hielt die Luft an, als sie realisierte, dass die schwarze Hose auf Knielänge abgeschnitten war. »Na, ich muss schon sagen ...«
Die Wahrheit war, dass sie vor Dad überhaupt nichts sagen wollte, wie Marjorie merkte, und sie war ihr dankbar dafür.
»Woher hast du diesen Lippenstift?«
»Ich hab’ dafür gespart.«
»Er steht dir. Aber wieso hast du dein ganzes Haar auf die Seiten gekämmt? Sieht aus, als wolltest du etwas verstecken.«
Ihre Mutter streckte die Hand nach ihr aus. Marjorie wich zurück und als sie ans Geländer stieß, rutschten ihre Haare nach hinten.
»O, mein Gott! Was hast du mit deinen Ohren gemacht?«
»Nichts«, entgegnete Marjorie trotzig.
»Du dummes Kind! Das ist eine böse Entzündung. Es ist ganz wund. Wart, ich hole etwas. Ich finde, du siehst sehr hübsch aus.«
Tränen traten Marjorie in die Augen. Sie hatte sich darauf vorbereitet, mit Kritik fertig zu werden, nicht mit Freundlichkeit.
Kurze Zeit später, als Marjorie auf den hohen Absätzen zur Bushaltestelle stakste, brannten ihre Ohren vom Wundbenzin und den bissigen Bemerkungen ihres Vaters, ihr Augen-Make-up war vom Daumen ihrer Mutter abgemildert und die Lippenstiftschicht zur Hälfte mit einem Papiertaschentuch abgewischt worden.
***
Er war nicht da. Ein kurzer Blick durch die College-Aula genügte ihr, um das festzustellen. Die Enttäuschung war wie ein Schlag in die Magengrube.
Der Chorleiter vom College beaufsichtigte die Aufstellung: die Mädchen rechts, die Jungs links, in der ersten Reihe die Solisten, zu denen Marjorie gehörte.
Der Chorleiter machte einen beinahe ängstlichen Eindruck, als er die letzten Vorbereitungen traf. Vielleicht dachte er, dass die Mädchen nicht singen konnten. Na, der würde Augen machen! Die Hälfte der Mädchen waren echte Waliserinnen. Ihre Väter waren nach Dover gezogen, als die walisischen Minen stillgelegt wurden.
Wenige Minuten später zeigte sein Gesicht Erstaunen, dann die reinste Freude, als die Stimmen aus hundert jungen Kehlen in der Aula ertönten. Sobald Marjorie sang, vergaß sie ihre Enttäuschung und die Nervosität. Singen war eins der wenigen Dinge, die sie wirklich gut konnte. Als ihr Solo begann, schwang sich ihre klare Stimme empor. Am Ende wusste sie genau, dass sie ihre Sache gut gemacht hatte. Sie hatte ihre Musikalität von der Familie ihres Vaters geerbt, zumindest behauptete Mum das immer. Dad sang nur, wenn er betrunken war, aber sie hatte miterlebt, wie die Leute ihm gebannt lauschten und Tränen in den Augen hatten, wenn er »Danny Boy« mit seinem sanften, klaren Tenor zum Besten gab.
Der Chorleiter geriet regelrecht ins Schwitzen wegen der Leistungen seiner Jungs. Sie waren nicht besonders gut. Na ja, walisische Minenarbeiter schickten ihre Kinder eben nicht ins Dover College. Das war Pech für ihn, dachte Marjorie mit einem verstohlenen Lächeln.
Sie und der Chor brachten den Rest des Messias hinter sich und bald sprangen sie alle von der Bühne. Sie drängten sich schwatzend zur Tür und fragten sich, wo sie die Erfrischungen finden konnten, die man ihnen versprochen hatte. All die Mühe umsonst, überlegte Marjorie düster und dachte an die Höllenqualen, die sie sich selbst mit der Sicherheitsnadel angetan hatte.
»Hallo!«
Seine Stimme! Sie wirbelte herum und schnappte nach Luft. Da stand er, fast einsneunzig groß, und lächelte sie an.
»Du bist gekommen«, seufzte sie, aber ihre Augen verrieten noch viel mehr. Sie wandte sich ab – zu spät. Er ergriff ihren Arm und zog sie an sich.
»Lass uns von hier verschwinden«, flüsterte er. »Ich könnte was zu trinken gebrauchen. Ich warte schon seit Stunden. Was hast du gesagt? Ja? Hier gibt’s nur olles Gebäck und schwachen Tee.«
Sie konnte nicht viel dazu sagen – ihr hatte es regelrecht die Sprache verschlagen. Sie kam sich vor wie in der Achterbahn auf dem Jahrmarkt. Ihr Blut strömte in die falsche Richtung, ihr stockte der Atem und ihre Füße gehorchten nicht mehr, zumindest nicht ihr. Sie tapste Robert benommen hinterher.
Als sie auf den schwarzen Ledersitz in seinem Wagen sank, wurde ihr bewusst, dass sie sich von Barbara nicht einmal verabschiedet hatte.
»Ich darf nicht zu spät nach Hause kommen, sonst krieg’ ich was zu hören von meinem Dad«, stammelte sie.
»Ich hatte gehofft, dass du zu dem Chor gehörst.« Er lächelte wieder und ihr Magen verkrampfte sich. »Ich hab’ mir die Beine in den Bauch gestanden, weil ich dir unbedingt etwas sagen wollte.« Mit einem Mal wirkte er sehr ernst. »Wenn ich ein wirklich gutes Gemälde sehe oder T.S. Eliot lese oder einen schönen Sonnenuntergang miterlebe, dann bekomme ich eine Gänsehaut. Es ist wie eine Allergie auf alles Großartige. Fühl mal meinen Arm.«
Sie strich vorsichtig mit einem Finger über seine Haut und schauderte, als sie die schwarzen Härchen spürte, die seinen Arm bedeckten.
»Ich habe deinetwegen und wegen deiner Stimme eine Gänsehaut. Du hast wundervoll gesungen, und du bist sehr schön.«
»Oh, jetzt hör aber auf«, entgegnete sie verlegen.
»Willst du damit sagen, du weißt das nicht?«
»Was?«
»Wie schön du bist.«
Seine Hand tastete sich näher und ergriff ihre. Von da an war ihr kaum noch bewusst, worüber sie sprachen oder wohin sie fuhren. Das einzig Wirkliche waren seine Finger, die ihre Hand drückten, und das Unwetter, das in ihrem Magen tobte und blitzte. Irgendwann merkte sie, dass sie in einem Pub am Fluss saß. Es war ein vornehmes Lokal und jemand spielte Klavier. Sie trank ein Ingwerbier und verliebte sich noch einmal bis über beide Ohren, als er mit seinem schottischen Akzent von seiner Kindheit erzählte und Robbie Burns aus dem Gedächtnis zitierte.
Um Punkt Mitternacht stellte er sein Auto vor ihrem Haus ab.
»Wie wär’s mit Sonntag? Hast du Zeit? Wir könnten aufs Land fahren. Kannst du reiten?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Willst du, dass ich es dir beibringe?«
»O ja«, hauchte sie verträumt.
»Gut. Ich hole dich so gegen elf Uhr ab.«
»Bis dann«, rief sie begeistert und überlegte fieberhaft, was sie anziehen sollte. Schließlich hatte sie alles, was sie besaß, schon heute gezeigt.
Der Prinz und seine Kutsche fuhren davon und ließen sie zitternd und mit einem sehnsüchtigen Bedauern an der Türschwelle zurück. Schließlich stolperte sie ins Haus. Ihre Mutter erwartete sie bereits, warf einen kurzen Blick auf sie und stöhnte: »O Gott!«
Kapitel 5
Als Robert am Sonntagvormittag zu Marjories Haus fuhr, bewegten ihn gemischte Gefühle, was den bevorstehenden Ausflug betraf. Er war schon fast so weit, wieder zum College zurückzufahren, aber schließlich rang er sich doch dazu durch, die Verabredung einzuhalten. Es war nicht so sehr Marjories Schönheit, die ihn anzog, sondern etwas Tieferliegendes. Da war etwas an ihr, was er selbst gern gehabt hätte. Etwas, was sie hatte und was ihm fehlte, aber er konnte nicht genau definieren, was das war.
Er dachte an ihren Mut. Es war überwältigend gewesen, wie bravourös sie mit dem kleinen Boot in der heftigen Windbö zurechtgekommen war. Er vermutete, dass sie mit weit Schlimmerem fertig wurde und lächelnd aus den größten Schwierigkeiten hervorging. Sie war wie die blauen Glockenblumen auf den Klippen, die Kälte und Stürme, Schnee und Eis aushielten, von achtlosen Füßen zertrampelt wurden, sich von mageren Erdkrumen ernähren mussten und trotz allem überlebten und die Welt mit ihrer zarten Schönheit erfreuten. Marjorie hatte auch ihre Wurzeln tief im britischen Boden und sie war genauso unverwüstlich und schön. Er erahnte ihre moralische Stärke und Anständigkeit. Etwas in ihren Augen sagte ihm: Die meisten Dinge erledige ich mit links, und auch wenn’s schlimm kommt, haut mich nichts um. Sie würde nie zaudern, nicht für eine Minute.
Robert fühlte, dass ihm nichts von dieser Kraft gegeben war. Er war mit Reichtum und Luxus in einer vornehmen Familie aufgewachsen. Seine Persönlichkeit war schwächer als ihre und er könnte nie die Härten und Nöte erdulden, über die sie nur lachen und an die sie keinen zweiten Gedanken verschwenden würde. Sie zog ihre Kraft aus der Erde und aus ihrem Frohsinn und er sehnte sich danach, so zäh und voller Lebensfreude zu sein wie sie.
Als er sich dem Haus näherte, überkam ihn plötzlich Panik. Es war wie der letzte Augenblick vor dem Tiefseetauchen oder dem Absprung mit dem Fallschirm. Er war kurz davor, sich im freien Fall in Unbekanntes zu stürzen. Er beschleunigte und fuhr an dem Haus vorbei, um sich einen Aufschub zu gewähren. Er konnte sofort zu seinen wohlhabenden Freunden und seinem privilegierten Leben zurückkehren. Und doch ... Er wusste, dass er Marjorie und ihre Welt besser kennenlernen musste, um ein Mann zu werden. Nach einer Weile bremste er ab, wendete und parkte am Straßenrand. Ein halbes Dutzend Nachbarn kamen aus ihren Häusern und ein Mädchen, das ihm vage bekannt vorkam, rief »Hallo«.
Es war ein sonniger Morgen und die Vordertür stand offen. Robert schlich an dem Gartenzwerg vorbei und versuchte so zu tun, als wäre das groteske Ding nicht da. Dann musste er so tun, als wären die Stores an den Fenstern und die große grüne Fußmatte mit dem Erdbeermuster, das undefinierbare Ungetüm aus Walnussholz, das im Flur stand, die billigen Nippessachen und die Plastikblumen nicht da. O Gott! Wie furchtbar!
Eine Frau, die nicht die geringste Ähnlichkeit mit Marjorie hatte, eilte auf sein Klopfen herbei. »Hallo, Sie müssen Robert sein. Ich bin Mrs Hardy, Marjories Mutter. Kommen Sie rein. Sie ist bestimmt gleich fertig. Kommen Sie doch mit in den Garten, Robert.« Sie machte einen zerbrechlichen Eindruck und ihr Gesicht war blass und runzlig. Sie hatte dunkle Augenbrauen, blaue Augen und kurz geschnittenes graues Haar und einen kleinen Mund, der eigenartig jugendlich wirkte, aber ihr Lächeln erschien ihm steif und gezwungen.
Sie führte ihn durch ein kleines Wohnzimmer, das aussah, als würde es nur selten benutzt, in den Garten. Dort saß ihr Mann in Hosenträgern und Weste unter einer Platane. Er wienerte seine Schuhe und sah nicht einmal auf, als sie ihn als Mr Hardy vorstellte. Robert spürte die unterdrückte Energie und eine gewisse Unzufriedenheit in diesem Mann. Er war klein und untersetzt und hatte ein wettergegerbtes Gesicht.
»Guten Tag, wie geht es Ihnen, Sir? Mein Name ist Robert MacLaren. Ich habe Ihre Tochter zu einer Fahrt aufs Land eingeladen. Vielleicht reiten wir ein bisschen. Es ist ein sehr schöner Tag, finden Sie nicht auch?«
»Wenn Sie es sagen«, erwiderte Mr Hardy schwerfällig statt einer Begrüßung und setzte im selben Tonfall hinzu: »Ich denke, Sie verschwenden Zeit mit Leuten aus dieser Gegend. Meine Tochter ist streng erzogen worden. Sie war bis jetzt noch nie mit einem Jungen aus. Sie ist ein gutes Mädchen und Sie müssen ihr Respekt entgegenbringen, sonst bekommen Sie es mit mir zu tun, Robert.«
Plötzlich hob er den Blick und die Botschaft in den erschreckend grünen Augen war eindeutig. Es war eine unverhohlene Drohung.
O Gott! Wie furchtbar! Die grobe Warnung passte zu dem Gartenzwerg und den Plastikblumen.
»Sir.« Robert räusperte sich. »Ich habe den größten Respekt vor Ihrer Tochter.« Er überlegte, wie er das Thema wechseln konnte, und schaute sich verzweifelt um. Dabei entdeckte er ein sehr großes braunes Kaninchen in einem Gehege neben der Hintertür. Es war ein niedliches, flauschiges Tier mit Hängeohren, zuckender Nase und treuherzigen Augen. Robert kraulte mit einem Finger die pelzige Wange.
»Ein schönes Kaninchen«, meinte er.
»Sein Name ist Frank. Ein Belgischer Riese. Sie haben ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen als andere Rassen. Wir mästen ihn fürs Sonntagsessen nächste Woche. Mrs Hardy macht eine großartige Kaninchenpastete.«
»Oh!« Robert sank auf den nächsten Stuhl.
Mr Hardy polierte mit gesenktem Kopf seine Schuhe, plauderte über das Wetter, das Getreide und die Rosen, die dieses Jahr besonders gut gediehen. Sein Akzent verwirrte Robert. Mr Hardy sprach jedes einzelne Wort sorgfältig aus, hatte aber eine leichte irische Färbung, doch da war noch etwas anderes – vielleicht ein schottischer Beiklang?
Im nächsten Moment stürmte Marjorie mit den bezaubernden Grübchen in den geröteten Wangen und funkelnden Augen in den Garten. Sie trug ihre abgeschnittene Hose, eine türkisfarbene Weste und einen Schal, der zu ihren Augen passte. Das kastanienrote Haar glänzte in der Sonne und auf ihrer Nase waren neue Sommersprossen entstanden.
»Die sind neu«, sagte Robert und sprang auf.
»Nein, sie gehören Mum.«
»Die Sommersprossen?«
Sie kicherte.
»Das letzte Mal, als ich dich sah, waren sie noch nicht da.«
»Als ob du dich daran erinnern könntest.«
»Aber ich erinnere mich ganz genau!«
»Ich habe in unserem Schrebergarten gearbeitet. Wenn du willst, zeige ich ihn dir einmal. Komm, sonst vertrödeln wir hier noch den ganzen schönen Tag.«
Kapitel 6
Sobald sie vom Haus aus nicht mehr gesehen werden konnten, nahm Robert Marjories Hand. Beide saßen schweigend im Wagen. Es war warm und kaum eine Wolke am Himmel zu sehen. Felder, kleine Wäldchen und Dörfer huschten an ihnen vorbei. Auf den Wiesen wuchsen Klatschmohn und violetter Fingerhut; Ringelblumen und Löwenzahn zauberten Farbtupfer in die Felder und in den Hecken blühte der Weißdorn.
»Du machst bald deinen Schulabschluss«, ergriff Robert schließlich das Wort.
»Ja, und ich habe Angst davor.«
»Was machst du danach?«
Sie wandte sich stirnrunzelnd ab. Er sah, wie sie sich auf die Lippe biss, und ahnte, dass sie sich Sorgen um ihre Zukunft machte. »Mir wurde ein College-Platz in Bristol angeboten – wahrscheinlich ist das abhängig von meinen Noten im Abschlusszeugnis, aber ich glaube, die sind ganz in Ordnung. Das Problem ist nur, dass Mum in letzter Zeit Andeutungen macht, ich sollte mir bald meinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Ich weiß nicht, wieso sie so was sagt. Wir haben letztes Jahr ausführlich darüber gesprochen. Jetzt warte ich erst mal mein Zeugnis ab, und dann ...« Sie brach ab. »Aber erzähl mir lieber was von dir«, fuhr sie eilends fort und er merkte, dass sie das Thema nicht weiterverfolgen wollte. »Du hast noch nie von deinem Zuhause gesprochen. Warum hast du dir ausgerechnet das Dover College ausgesucht? Eine komische Wahl für einen angehenden Dichter.«
Er lachte. »Ja, wahrscheinlich. Ich bin der dritte Sohn in der Familie. Der älteste übernimmt den Familienbetrieb. Der zweite studiert Jura und der dritte, das bin, ich, geht zur Navy. Das ist Familientradition bei uns. Aber ich werde nicht zur Navy gehen. Ich möchte schreiben. Als ich die Grundschule verließ, wusste ich das noch nicht, deshalb erschien mir die Navy damals eine gute Idee zu sein. Inzwischen hab’ ich mich verändert. Das tun wir doch alle irgendwie, oder?« Er drückte ihre Hand. »Versprich mir, dass du dich nie veränderst. Ich wünsche mir, dass du bis in alle Ewigkeiten so bleibst, wie du jetzt bist.« Wie ungehobelt, so was zu sagen, aber er meinte es ehrlich. Er sah, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg.
»Nimm die Wünsche in die eine Hand und spuck in die andere, dann wart ab, welche sich zuerst füllt. Das sagt meine Mum immer.«
Die rauen Worte rückten ihre ganze traurige Familiengeschichte in den Mittelpunkt. Plötzlich verspürte er Widerwillen und ließ ihre Hand los, dabei fragte er sich, ob sie mehr wie ihre Eltern war, als es zunächst den Anschein gehabt hatte. Mit einem Mal war es sehr wichtig für ihn, das herauszufinden.
»Marjorie«, begann er nach langem Schweigen. »Hat es dir jemals etwas ausgemacht, ein Haustier zu halten – ich meine so ein lahmes und süßes Tier wie den armen Frank – und es dann aufzuessen?«
»Oh!« Wenn sie rot wurde, schien ihr ganzer Körper davon betroffen zu sein. Robert wäre fast von der Straße abgekommen, als er beobachtete, wie die weiße Haut über ihren Brüsten einen rosigen Schimmer annahm.
»Die Wahrheit ist, ich gebe mir die größte Mühe, sie mir gar nicht anzusehen«, stammelte sie. »Als ich klein war, hatte ich ein eigenes, ganz besonderes Kaninchen. Es war weiß und hatte einen schwarzen Fleck über einem Auge, deshalb nannte ich es Nelson. Ich liebte Nelson, aber als ich eines Tages von der Schule nach Hause kam, hing er von oben bis unten aufgeschlitzt an den Hinterpfoten in der Tür zum Garten. Seither sehe ich mir keins unserer Kaninchen mehr an. Auf diese Weise tut es nicht so weh, wenn sie geschlachtet werden, verstehst du?«
Ein Teil von Robert bedauerte dieses süße Mädchen, das so göttlich sang und einmal ein Kaninchen geliebt hatte, der andere Teil quälte sich noch immer und sehnte sich danach, sich ein für alle Mal Klarheit zu verschaffen. »Hast du das Kaninchen gegessen? Ich meine dein Kaninchen?«
»Oh, hör auf damit, Robert«, protestierte sie ungehalten. »Worauf willst du hinaus? Du piesackst mich – das ist nicht fair. Und meinen Eltern gegenüber bist du auch nicht fair. Dad hält die Kaninchen in unserem Schrebergarten. Alles dort ist für uns zum Essen da – Kohl, Zwiebeln, Salat und jede Menge anderes. Es hilft uns zurechtzukommen. Wir haben nie genug Geld, musst du wissen. Meine Familie ist nicht reich. Dad bringt immer ein Kaninchen mit nach Hause, damit wir es ordentlich füttern können.« Sie hielt inne und biss sich auf die Lippe. »Was ist daran falsch? Du bist kein Vegetarier, nehme ich an. Ich wette, du gehst auf die Jagd und siehst zu, wie die Hundemeute diese armen kleinen Füchse in Stücke reißt, hab’ ich recht?«
Sie hatte recht und er spürte, wie seine Wangen heiß wurden. Was sollte er dazu sagen?
»Aber die Antwort auf deine Frage ist ›nein‹, Robert. Mir ist damals der Appetit gründlich vergangen. Und zwar für einige Tage, aber Dad meinte, es wäre die beste Pastete gewesen, die Mum seit Langem zubereitet hatte. Weißt du was? Ich habe Mum insgeheim mehr Vorwürfe gemacht als Dad, weil sie so gute Sachen gekocht und zugelassen hat, dass Dad mein Kaninchen schlachtet. Verstehst du – sie hat alles gewusst und mich verstanden, Dad hatte keine Ahnung, deshalb war er sozusagen unschuldig.«
»Du bist kein bisschen wie sie«, behauptete er – es tat ihm leid, dass ihre Mutter sie so verraten hatte.
»Wie? Was meinst du damit? Glaubst du, du mit deinem hochtrabenden Gerede und deinem versnobten Akzent hättest das Recht, sie zu kritisieren? Wage es bloß nicht, auf meine Eltern herabzuschauen, sonst hast du mich die längste Zeit gesehen.«
»Tut mir leid«, entschuldigte er sich verlegen.
Er gab sich die größte Mühe, die Gedanken an ihre schrecklichen Eltern abzuschütteln. Eine ganze Zeit wechselten sie kein Wort miteinander und als er die Hand nach ihrer ausstreckte, zuckte sie zurück. Er bremste ab, lenkte den Wagen auf den Randstreifen, dann blieb er ganz stehen und sah sie an. Sie funkelte ihn aus großen, feindseligen Augen an und presste die Lippen fest zusammen.
»Es gibt kein Gesetz, das mir vorschreibt, den Vater des Mädchens zu mögen, in das ich mich verknallt hab’, oder? Ist es denn so schrecklich für dich, wenn er mir nicht sympathisch ist? Dafür mag ich dich umso mehr.«
Er zog sie fest an sich und die Hitze ihres Körpers traf ihn wie ein Schock. Das plötzliche Begehren blendete alles andere aus. Er war ganz benommen, unfähig, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen – er spürte nur noch das lodernde Feuer, das sie in ihm entfacht hatte. Seine Haut glühte und seine Lippen brannten vor Sehnsucht, die ihren zu berühren. Er hob ihr Kinn und spürte die weiche, klebrige Süße ihrer Lippen, als sie mit seinen verschmolzen. Er schauderte und hätte beinahe laut gestöhnt vor Lust.
Schließlich richtete er sich auf, aber sie klammerte sich an ihn. »Oh«, seufzte er. »Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe nie zuvor so gefühlt. Lass uns aussteigen und einen Spaziergang machen.«
Sie blieb unsicher neben dem Wagen stehen, aber er nahm ihre Hand und zog sie die grasbewachsene Böschung hinunter. Arm in Arm wanderten sie ungeschickt und mit steifen Beinen den Bach entlang – beide sehnten sich nach sexueller Erfüllung, spürten, wie das Blut heiß durch ihre Adern pulsierte, und dachten nur an eines: Wo können wir uns vor unerwünschten Blicken verstecken?
Robert half ihr durch eine Lücke in der Weißdornhecke und sie kamen auf ein im leichten Wind wogendes Gerstenfeld. Am Rand blieb er stehen, zog seine Jacke aus und legte sie ins Gras.
»Wir können uns hersetzen, wenn du willst.«
Zögernd ließ sie sich nieder. »Ich dachte, wir wollen reiten. Wir sind nicht sehr weit gekommen, was?« Sie klang gereizt.
»Wir reiten noch. Bald. Ich konnte so nicht weiterfahren, verstehst du?« Er versuchte, ihr alles zu erklären. »Es war wie ein Waldbrand. Ein Funke, und alles gerät außer Kontrolle. Hast du das genauso wie ich gespürt?«
»Ich spüre das jedes Mal, wenn ich an dich denke. Ich träume jede Nacht von dir.« Sie sah ihn vertrauensvoll an.
Da war er wieder, dieser unglaubliche Mut. Man braucht Mumm, um so ehrlich zu sein, dachte er. »Ich auch«, gab er zu. »Aber da im Auto – das war etwas anderes. Erschreckend! Hast du schon mal?«
»Nein.«
»Ich auch nicht.«
»Du darfst nicht glauben, dass ich es jemals will. Ich mache es nie«, behauptete sie in drollig altjüngferlicher Art.
»Ich bin nicht mit dir hergefahren, um dich zu verführen«, beteuerte er. »Ich bin selbst vollkommen überrascht worden.«
Er zog ihr Top ein paar Zentimeter hoch, presste die Lippen auf ihre Haut und kitzelte sie mit der Zunge. Er war sich nicht sicher, ob sie Einwände erheben würde, aber sie wand sich wohlig und kicherte. Irgendwie kam er sich mit einem Mal viel älter vor als sie. Sie war ein Kind. Er musste auf sie aufpassen und sie beschützen. Es war die reinste Qual, von ihr zu lassen und sich aufzusetzen.
»Ich habe mich ein bisschen abgekühlt. Lass uns fahren.«
Sie lächelte und versuchte, ihn wieder an sich zu ziehen.
»Komm schon. Du möchtest doch reiten lernen, oder etwa nicht? Wenn ich dich noch einmal küsse, kommen wir nie zum Reiterhof. Ich würde höchstens losrasen und dich so schnell wie möglich zurückbringen.«
Bis zu diesem Tag hatte er von Mädchen nur eines erwartet – dass sie sich mit ihm verabredeten. Er hatte keine Schwestern und nie viel mit Mädchen zu tun gehabt, aber Marjorie war wirklich großartig. Sie lernte ohne Probleme die Grundbegriffe der Reiterei und als das Pferd mit ihr davongaloppierte und sie in einen Teich abwarf, lachte sie nur und kletterte sofort wieder in den Sattel. Ihr Haar trocknete in der Sonne und er lieh ihr seinen Pullover. Es machte Spaß, mit ihr zusammen zu sein.
Kapitel 7
Es war Samstagabend und Robert verspätete sich. Sie wollten tanzen gehen. Marjorie hatte Angst, dass der Rock, den sie sich von Barbara geliehen hatte und der daher zu kurz war, nicht gut genug sein könnte. Sie war eine halbe Stunde im Flur auf und ab gegangen, bevor ihr Vater sie in einer Ecke festhielt. Er redete selten mehr als zwanzig Worte mit ihr, aber heute hatte er eine Menge mehr zu sagen.
Anfang der Woche hatte er die Nachricht erhalten, vor der er sich schon seit Langem gefürchtet hatte: Die Werft war gezwungen, die meisten Mitarbeiter, ihn eingeschlossen, zu entlassen. Er war zu alt, um darauf hoffen zu können, irgendwo anders eine Arbeit zu finden, deshalb musste er sich wohl oder übel mit einem Dasein als Frührentner mit einer unzureichenden Pension abfinden. Diese neue Lage hatte all seinen Zorn und die ein Leben lang angestaute Bitterkeit an die Oberfläche gebracht.
»Du hast Robert in den letzten drei Wochen jeden Abend gesehen«, wiederholte er zum x-ten Mal. »Du bringst dich in Schwierigkeiten, mein Mädchen. Reich heiratet reich. Du kannst dein Leben darauf verwetten, dass er sich eine Frau aus seinen Kreisen sucht und dass sie genauso wohlhabend ist wie er, aber erst bricht er dir das Herz. Ich habe mich ein bisschen umgehört. Wie’s scheint, stammt er aus einer alten schottischen Familie – einer adeligen Familie. Die wollen mit Leuten wie uns bestimmt keine Verbindung eingehen, selbst wenn er vielleicht sogar daran denkt. Ich wette, Robert hat bis jetzt noch kein Sterbenswort übers Heiraten verloren.«
»Wieso sollte er? Wir sind nur gute Freunde«, versicherte auch sie ihm zum x-ten Mal an diesem Abend.
»Da du es sagst, glaube ich dir, aber wie lange kann das so weitergehen? Hör auf, dich wie ein Dummkopf zu benehmen. Mach Schluss mit ihm, solange noch Zeit ist.«
Ein tiefes, unerwartetes Schluchzen machte die Antwort zunichte, die sie sich ausgedacht hatte. »Die Freundschaft mit Robert ist das einzig Kostbare in meinem Leben«, brachte sie mühsam hervor.
»Wie du willst«, versetzte er grimmig. »Aber komm ja nicht heulend zu mir, wenn er abhaut und dich nach alter Familientradition sitzen lässt. Dann bist du ganz auf dich allein gestellt.« Er stapfte hinunter in die Küche.
»Oh, hör auf, Dad«, brummte sie leise. »Du und dein Klassenhass – du bist ein solcher Miesepeter, dass ich mich frage, wie du überhaupt morgens aus dem Bett kommst.«
Es stimmte, dass sie sich nach diesem ganz besonderen Sonntagsausflug jeden Abend getroffen hatten. Sie hatten so viel Spaß und beide waren entschlossen, ihr Begehren und ihre Leidenschaft zu unterdrücken.
Zuerst waren sie in alle Kinos und Konzerte gegangen, die es in der Stadt gab, und hatten sich Abend für Abend mit zu viel Essen vollgestopft. Aber dann waren sie übereingekommen, dass es viel schöner war, am Meer spazieren zu gehen oder auf einer Bank zu sitzen und zu reden, doch am Samstag war Tanztag, auch darin waren sie sich einig. Und dies war wahrscheinlich für lange Zeit ihr letzter gemeinsamer Samstagabend, da Ende der nächsten Woche die Ferien im College anfingen. Wo blieb er nur?
Eine Stunde später überlegte sie, dass sein Auto eine Panne haben könnte. Zu Mitternacht marterte sie sich mit dem Gedanken an einen Unfall. Sie überlegte sogar, ob sie im Krankenhaus anrufen und nachfragen sollte. Um zwei Uhr nachts kam sie zu dem entsetzlichen Schluss, dass er sie schlichtweg versetzt hatte. Sie verbrachte eine lange, schlaflose Nacht und grübelte über die möglichen Ursachen seines Fernbleibens nach.
Die folgende Woche verstrich quälend langsam und schließlich musste sich Marjorie eingestehen, dass Robert ohne Abschied nach Hause in die Ferien gefahren war. Immer und immer wieder ging sie alle Einzelheiten ihres letzten Zusammentreffens durch, aber sie kam einfach nicht darauf, was sie falsch gemacht haben könnte. Tiefe Schatten lagen unter ihren Augen, sie wanderte lustlos umher und hatte kaum noch Appetit. Sie konnte nicht verstehen, dass der Robert, den sie kannte, und der Kerl, der sie so schnöde im Stich gelassen hatte, ein und dieselbe Person waren. Mit einem Mal kam sie sich minderwertig vor.
***
Das Ende des Schuljahrs rückte näher und Marjorie musste einem anderen Problem ins Auge sehen, ihrer Zukunft, sie hatte jedoch viel zu viel Angst, um das Thema bei ihren Eltern zur Sprache zu bringen. Aber dann gab ihr Dad die Gelegenheit dazu, als sie in der Küche las und Mum einen Apfelpudding machte.
»Hast du dein Zeugnis schon?«
Seine sanfte Stimme kaschierte die Aggressionen, die sich jederzeit Bahn brechen konnten. Seit seiner Entlassung war er besonders oft gereizt und beruhigte sich eigentlich nur, wenn er, wie jetzt, sein erstes Bier trank. Das machte ihr Mut.
»Miss Allington glaubt, dass ich nur Einser und Zweier kriege und man hat mir schon jetzt eine Zusage aus Bristol geschickt. Du weißt aber, dass ich möglicherweise auch in Oxbridge ein Stipendium bekommen könnte.« Sie wusste selbst, dass sie nicht sehr überzeugend klang, aber es gelang ihr nicht, ihre Nervosität vollkommen zu verbergen.
Dad schob sein Glas beiseite und stand auf. »Du bist achtzehn Jahre alt«, grollte er. »Ich habe in deinem Alter schon längst selbst mein Geld verdient. Ein gutes Abschlusszeugnis – mehr gibt es für Leute wie uns nicht, Marjorie. Genau genommen war das schon mehr, als wir uns eigentlich leisten können. Wir sind nicht reich, besonders jetzt nicht, wenn wir von meiner mageren Rente leben müssen. Es ist höchste Zeit, dass du etwas für deinen Unterhalt beisteuerst. Trotz der Rezession gibt es eine Menge guter Jobs für junge Leute. Dafür musst du dankbar sein. Alf hatte eine Anzeige in der Zeitung – er sucht ein Mädchen für die Kasse in seinem Metzgerladen. Er bezahlt anständig.«
Marjories Wangen brannten vor Zorn, aber sie behielt die Fassung und unterdrückte den Drang, offen zu rebellieren. Miss Allington hatte ihr gesagt, dass sie ganz oben auf der Liste als eine der besten Schülerinnen in Englisch und modernen Sprachen stand und wahrscheinlich einen Preis bekommen würde, aber das kümmerte Dad kein bisschen. Hatte ihn überhaupt je etwas, was sie betraf, interessiert? Wenn es nach ihm ginge, könnte sie für den Rest ihres Lebens an einer Kasse sitzen und Tag für Tag zerstückelte Kadaver, Lungen, Nieren und diese schrecklich glotzenden Schweinsköpfe anstarren. Vor ihrem geistigen Auge sah sie den Metzgerladen, in dem sie letzte Woche Fleisch hatte durchdrehen lassen, und konnte sich ein entsetztes Ächzen nicht verkneifen.
»Da haben wir’s wieder mal«, murrte Dad. Er nahm sein Bierglas und war bereit, die Flucht zu ergreifen, aber bevor er ging, wandte er sich an seine Frau. »Und du bist schuld daran«, nörgelte er. »Du hast sie verwöhnt und ihr Flausen in den Kopf gesetzt. Sie wird sich einen anständigen Job suchen, und damit basta. Man sollte meinen, sie würde sich wünschen, für sich selbst sorgen zu können. Ich konnte es als Junge kaum erwarten.«
»Warum gehst du nicht in den Pub und spielst ein wenig Dart?« Marjories Mutter griff in die Dose, in der sie ihr Haushaltsgeld aufbewahrte. Sie würde alles tun, um einem Streit aus dem Weg zu gehen, selbst wenn sie dafür ihr mühsam zusammengehaltenes Geld opfern musste.
Dad steckte die Münzen in die Tasche und ging ohne ein weiteres Wort. Marjorie sah ihm nach – sie ahnte, dass er nur so wütend war, weil er ein schlechtes Gewissen hatte. Sollte er doch! Sie schob ihren Teller weg.
»Ich hatte immer gehofft, dass du es einmal besser hast als ich«, sagte Mum. »Als ich fünfzehn war ...«
Marjorie schaltete ab – sie hatte keine Lust, sich zum hundertsten Mal die Geschichte vom Pech ihres Großvaters anzuhören, das Mum letzten Endes dazu gezwungen hatte, als Hausmädchen zu arbeiten, bis sie Dad kennengelernt hatte. Tibby, der fette rote Kater, hob die Vorderpfoten und krallte sich an Marjories Knie. Er wollte seine Ration vom Hering. Marjorie pickte ein Stück von ihrem Teller und gab es ihm.
»Himmel, Kind, wir können uns jetzt nur noch einmal die Woche Hering leisten. Musst du den Kater damit füttern? Du hast ihm beigebracht, so zu betteln«, schimpfte Mum.
Marjorie nahm all ihren Mut zusammen und wandte sich erneut an ihre Mutter. »Hör mal, Mum, ich weiß, du hast immer erwartet, dass ich ... na ja ... dass ich etwas zum Lebensunterhalt beitrage ...«
»Das ist in anderen Familien nicht anders, Marjorie«, erwiderte ihre Mutter streng. »Wir haben dich großgezogen so gut wir konnten, dir alles, was du brauchst ...« Sie brachte wieder dieselbe alte Leier und Marjorie ließ sie ausreden, dann versuchte sie es noch einmal.
»Ja, Mum, das stimmt, aber es geht schließlich um mich. Es ist doch klar, dass ich mehr Geld verdienen kann, wenn ich eine ordentliche Ausbildung habe – in nur einem Jahr könnte ich einen richtigen Beruf erlernen. Ich meine, ich würde euch nichts kosten. Ich war gestern im Polytechnikum und habe mich erkundigt – dort muss man kein Schulgeld zahlen, alles ist umsonst. Ich brauche nicht viel zum Leben, ich kann überallhin zu Fuß gehen. Ich esse nicht viel, das weißt du.«