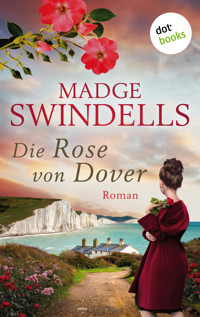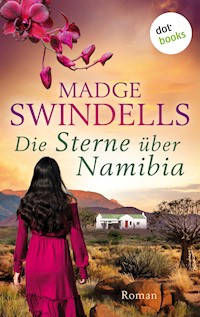
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ist Liebe stärker als der Hass? Die mitreißende Familiensaga »Die Sterne über Namibia« von Erfolgsautorin Madge Swindells jetzt als eBook bei dotbooks. »Sie denken, Sie haben nur ein paar Papiere gefunden, aber es ist das bestgehütete Geheimnis unserer Familie …« Drei Frauen haben ein Leben lang für ihr Glück gekämpft, an der Atlantikküste Afrikas, in den Weiten der Kalahari und in England – stehen sie nun vor den Scherben ihrer Träume? Marika, die berühmte Designerin, deren Herz seit einem grausamen Verrat vor vielen Jahren gebrochen ist; Sylvia, ihre Tochter, eine aufstrebende Schauspielerin, die ohne Vater aufwachsen musste; Bertha, Marikas liebevolle Adoptivmutter, die alles tun würde, um ihre Lieben zu beschützen. Sie alle haben zu lange die Augen verschlossen vor dem, was vor langer Zeit geschah. Nun müssen sie entscheiden, was ihnen wichtiger ist: eine vermeintliche Wahrheit, mit der sie sich schon lange arrangiert haben – oder die Erinnerung an eine Liebe, die voller Dornen war … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die Frauensaga »Die Sterne über Namibia« von Madge Swindells ist ein Lesevergnügen für alle Fans von Danielle Steel, Barbara Taylor Bradford und Nora Roberts. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
»Sie denken, Sie haben nur ein paar Papiere gefunden, aber es ist das bestgehütete Geheimnis unserer Familie …« Drei Frauen haben ein Leben lang für ihr Glück gekämpft, an der Atlantikküste Afrikas, in den Weiten der Kalahari und in England – stehen sie nun vor den Scherben ihrer Träume? Marika, die berühmte Designerin, deren Herz seit einem grausamen Verrat vor vielen Jahren gebrochen ist; Sylvia, ihre Tochter, eine aufstrebende Schauspielerin, die ohne Vater aufwachsen musste; Bertha, Marikas liebevolle Adoptivmutter, die alles tun würde, um ihre Lieben zu beschützen. Sie alle haben zu lange die Augen verschlossen vor dem, was vor langer Zeit geschah. Nun müssen sie entscheiden, was ihnen wichtiger ist: eine vermeintliche Wahrheit, mit der sie sich schon lange arrangiert haben – oder die Erinnerung an eine Liebe, die voller Dornen war …
Über die Autorin:
Madge Swindells wuchs in England auf und zog für ihr Studium der Archäologie, Anthropologie und Wirtschaftswissenschaften nach Cape Town, Südafrika. Später gründete sie einen Verlag und brachte vier neue Zeitschriften heraus, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Bereits ihr erster Roman, »Ein Sommer in Afrika«, wurde ein internationaler Bestseller, dem viele weitere folgten.
Die Website der Autorin: www.madgeswindells.com
Bei dotbooks veröffentlichte Madge Swindells ihre großen Familien- und Schicksalsromane »Ein Sommer in Afrika«, »Eine Liebe auf Korsika«, »Die Rose von Dover«, »Liebe in Zeiten des Sturms«, »Das Erbe der Lady Godiva« und »Die Löwin von Johannesburg« sowie ihre Spannungsromane »Zeit der Entscheidung«, »Im Schatten der Angst«, »Gegen alle Widerstände« und »Der kalte Glanz des Bösen«.
***
eBook-Neuausgabe November 2020
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1985 unter dem Originaltitel »Song of the Wind« bei Macdonald, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1987 unter dem Titel »Die Zeit der Stürme« bei Bastei Lübbe.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1985 by Madge Swindells
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1987 Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von Bildmotiven von shutterstock/Creative Family, BLab, Oleg Znamenskiy, Artist, Sarawut Konganantdech, worananphoto, Annuitti, MSPT
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-427-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Sterne über Namibia« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Madge Swindells
Die Sterne über Namibia
Roman
Aus dem Englischen von Wolfgang Crass
dotbooks.
Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.
Römer 12, Vers 19
Kapitel 1
Johannesburg, 25. Februar 1969
Es war Mitternacht. Am Horizont zogen sich düster und bedrohlich wie die Phalanx eines Dämonenheers riesige Gewitterwolken zusammen; Blitze, Speerspitzen gleich, zuckten vom Himmel herab, und der Donner rollte wie das Stampfen einer aufmarschierenden Armee. Die Geräusche der Sommernacht schienen immer näher zu kommen: das pulsierende Sirren der Zikaden, die Paarungsrufe der Ochsenfrösche, und dann und wann der Schrei eines Raubvogels.
Den Schatten suchend, bewegte sich auf leisen Sohlen ein Mann an den hohen Zäunen entlang, die den Villen von Parktown Schutz gaben. Jeder spürte, daß die Nacht sein Zuhause war. Die Schwarzen, die ihm begegneten, hielten auf Distanz, denn es war eine gewisse Furchtlosigkeit, ja eine Bedrohlichkeit an ihm.
Er sah sich um, überquerte die Straße und setzte sich auf eine Mauer, von der aus sich ein weiter Blick über die Stadt bot. Unter ihm leuchteten die Lichter von Johannesburg gelb, rot und blau. Die Straßen, breit, neu und kompromißlos gerade von Norden nach Süden und von Osten nach Westen verlaufend, ließen starre Rechtecke entstehen, die von hier oben wie bunte Aufkleber auf einem Reißbrett aussahen. Auch die riesigen Abraumhalden südlich der Stadt glänzten, wie von Ausschlag bedeckt, in vielfarbigem Neonlicht. Er selbst befand sich in einem der teureren Wohngebiete der Stadt, die sich nach Norden erstreckten. Hier gab es schöne Alleen, und in den Privatgärten glitzerten hellerleuchtete Swimmingpools. Ein anspruchsvolles, sauberes Volk hatte in Afrika geordnete Verhältnisse geschaffen.
Nichts als Schminke. Der Mann lächelte grimmig. Zu oft schon hatte er es erlebt, in Zaire, in Uganda ... Zum Schluß gewann doch die Barbarei.
Er stellte fest, daß sein Herz laut pochte, und zählte stirnrunzelnd seinen Puls. Vierundachtzig! Einen Moment lang war er beunruhigt; ein perfekt durchtrainierter Körper und ausgezeichnete Reflexe waren für seine Arbeit unerläßlich. Dann erst wurde ihm wieder bewußt, wie hoch er hier war: In zweitausend Meter Höhe konnte man schon einmal außer Atem geraten.
Hinter ihm auf einem Hügel stand Xhabbo, das Haus des Bergbau-Magnaten Günter Grieff. Die alte, stilvolle Villa, ein Überbleibsel aus der Pionierzeit der Minen, stand auf einem sechs Morgen großen Grundstück inmitten weiter Rasenflächen und eines alten Baumbestandes.
Der Name des Mannes war Kramer, auch wenn sein Paß einen anderen nannte. Er war erst seit wenigen Stunden in Johannesburg, aber er kannte den Tagesablauf in Xhabbo so genau wie seinen eigenen.
So wußte er zum Beispiel, daß der Hausmeister, der Jim Hackett hieß, gerade seinen letzten Kontrollgang hinter sich hatte. Er hatte die beiden Zulus überprüft, die als Wachtposten am Vorder- und Hintereingang standen, und war dann zu seinem Häuschen an der Toreinfahrt zurückgekehrt. Dort würde er bis zum nächsten Morgen bleiben. Die Wachtposten hatten es sich inzwischen bestimmt auf der Veranda vor dem Haus bequem gemacht, würfelten und hatten den ersten Krug Wein schon geleert.
Kramer fühlte eine gewisse Unruhe in sich, obwohl das, was er hier zu tun hatte, ein Kinderspiel war. Grieff saß in Paris im Gefängnis und hatte einen Prozeß durchzustehen, in dem es um sein Leben ging. Seine Frau saß Tag für Tag im Zuschauerraum. Der Prozeß hatte Aufsehen erregt: Grieff war schließlich der reichste Mann Afrikas, der Besitzer des Kwammang-a, eines der größten Diamanten der Welt. Er sah gut aus, war ein Draufgänger – zusammen mit seinen Tauchern hatte er an der gefährlichen Skelettküste nach Diamanten gesucht –, flog seinen eigenen Jet, fuhr mit seinem eigenen Wagen Rennen, war ein qualifizierter Geologe und verschwand dann und wann monatelang im afrikanischen Busch, um dort zu schürfen und neue Stücke für seine Sammlung primitiver afrikanischer Kunst aufzuspüren.
Die Zeitungen berichteten schon seit Wochen über kaum etwas anderes. Der Skandal des Jahres! Der Prozeß sorgte dafür, daß tagtäglich jeder Haushalt in England und im übrigen Europa, den Vereinigten Staaten und in Südafrika mit den intimsten Details über das Leben der vornehmen Gesellschaftskreise versorgt wurde. Man sah sich bestätigt: Reichtum und Ruchlosigkeit gingen tatsächlich Hand in Hand. Die öffentliche Kritik an Günter Grieff war vernichtend. Sie traf auch seine Frau Claire. Wahrscheinlich hätte sie als tragische Gestalt und gebrochene Ehefrau bei Presse und Öffentlichkeit Mitgefühl gefunden, wenn das Verbrechen ihres Mannes nicht gar so entsetzlich gewesen wäre.
Es war inzwischen ein Uhr morgens. Die Stunde seit Mitternacht war nur langsam vorübergegangen. Kramer musterte nachdenklich die Gewitterwolken, die sich drohend im Südosten auftürmten, während auf der anderen Seite der Mond am klaren Himmel leuchtete. Am Horizont zuckten an mehreren Stellen gleichzeitig Blitze auf, und aus weiter Ferne rollte ununterbrochen der Donner. Es würde ein furchtbares Gewitter werden, und es kam mit Riesenschritten näher. Es würde den Hausmeister aus dem Schlaf reißen, und die Wachtposten zu ihrem Standort zurückscheuchen. Vielleicht würde sogar das ganze Dach abgedeckt werden. Er hatte solche Gewitter öfter erlebt. Er mußte früher einsteigen, als er vorgehabt hatte.
Kramer eilte über den Rasen. Die Tür zum Sicherungskasten war nicht abgeschlossen. Er öffnete sie und schaltete die Hauptsicherung aus. Dann zog er sich in den Schatten des Hauses zurück.
Einer der Wachtposten kam langsam, seinen Stock in der Hand, den Pfad entlang. Das helle Mondlicht warf seinen Schatten riesig und grotesk geformt an die Außenmauer der Villa. Kramer sah, daß der Mann alt war, und konnte seine milchigen Augen und seinen weißen Bart erkennen. Als der Wächter an den Fenstern und der Tür rüttelte, winselte sein Hund unruhig. Die Gestalt entfernte sich wieder, und kurz darauf wurde das Würfelspiel fortgesetzt. Die Würfel klapperten auf einer Holzplatte, ein unterdrückter Fluch war zu hören, und eine Flasche wurde auf den Boden geknallt.
Es war Zeit anzufangen.
Kramer brauchte nur Sekunden, um die Hintertür aufzubekommen. Er huschte lautlos durch die Räume, ließ dann und wann den Strahl seiner Taschenlampe kurz nach links oder rechts zucken und schätzte wie ein Computer automatisch die Gegenstände, die dabei beleuchtet wurden: seltene Bücher und Landkarten, chinesische und persische Teppiche, Gemälde, Silbergegenstände, geschliffenes Glas, und an den Wänden zwischen afrikanischen Landschafts- und Tierbildern einige bekannte Meisterwerke.
Wolken schoben sich vor den Mond, und es wurde dunkel im Haus. Die Zikaden verstummten. Die Ochsenfrösche flohen in den Fischweiher. Dann plötzlich zuckte ein naher Blitz, und der Donner krachte.
Kramer nahm es kaum zur Kenntnis. Er fand den Safe dort, wo er sich üblicherweise befand: im Arbeitszimmer, hinter einem großen Ölgemälde in die Wand eingelassen. Schwitzend gab er die Zahlenkombination ein, dann richtete er sich auf, holte tief Luft und öffnete mit einem Ruck die Tür.
Die Enttäuschung hätte kaum größer sein können. Er fand ein Dutzend Krügerrands aus Gold, die nicht mehr als ein paar tausend Dollar wert waren, einen Schuhkarton voller kleiner ungeschliffener Diamanten, die wie Glasstückchen aussahen, einige Grundstücksurkunden und Aktienzertifikate sowie ein Bündel Hundert-Dollar-Scheine. Er verstaute alles mit Ausnahme der Urkunden in seiner mit Waschleder gefütterten Aktentasche, wo aber war der Kwammang-a?
Vom hinteren Teil des Arbeitszimmers führte eine Tür zu einem kleinen Nebenzimmer. Als Kramer hineinging, erfüllte ein Blitz den Raum mit einem surrealistischen Licht, und in diesem Bruchteil einer Sekunde glotzten ihn von den Wänden tausend Augen bösartig an. Dann erschütterte der Donner das Haus wie ein schwerer Schlag. Kramer ließ den Strahl seiner Taschenlampe über Masken und Statuen wandern, über Fruchtbarkeitspuppen, Totenmasken und stilisierte Gesichter, angefertigt, um primitiven Menschen Angst einzujagen, Idoma-Figurinen, Knono-Masken, Kyuy-Schlangenköpfe. Das Zimmer war vollgestopft mit Grieffs Sammlung afrikanischer Kunst. Bestimmt eine Menge wert, dachte Kramer, aber er hatte keine Ahnung, wieviel. Verärgert verzog er das Gesicht.
Es dauerte bis vier Uhr früh, bis Kramer den Safe von Claire Grieff gefunden hatte, der geschickt in die Decke ihres holzverkleideten Kleiderschranks eingebaut war. Darin fanden sich Diamanten, Halsbänder, Ohrringe und Broschen, die mit Rubinen, Smaragden und Saphiren besetzt waren, sowie ein smaragdbesetzter Gürtel in Form einer silbernen Schlange mit Augen aus Rubinen. Die Schmuckstücke, eine erlesene Kollektion aus allen Teilen der Welt, hatten ein Vermögen gekostet. Der Kwammang-a aber war nicht dabei. Kramer war wütend und enttäuscht.
Zwischen dem Schmuck fand er noch ein Bündel Papiere, die er auch im Schein seiner Taschenlampe durchsah. Letzter Wille von Claire Grieff, geb. McGuire, las er da. Ich, Claire Grieff, erkläre hiermit ...
Als er die bereits brüchigen und vergilbten alten Dokumente durchgelesen hatte, stieß er einen leisen Fluch aus. Verdammte Scheiße! Er konnte froh sein, nie geheiratet zu haben. Hier, in diesem Zimmer waren die Beweise eingeschlossen, die Günter Grieff die Freiheit geben konnten.
Als er sich nach einem geeigneten Behälter umsah, fiel sein Blick auf eine gerahmte Fotografie der Grieffs. Im Hintergrund war nur Wüste zu sehen. Günter Grieff hatte den Arm um seine Frau gelegt und lächelte stolz in die Kamera.
Der Flug von London hierher hat sich also doch gelohnt, dachte Kramer bei sich, während er die Papiere in seiner Tasche verstaute.
Kapitel 2
Es war einer jener grauen Londoner Nachmittage, die auf sehr kalte Nächte folgen. Bald würde es anfangen zu schneien. In die Cafeteria von Charing Cross Station fiel kaum Tageslicht. Es war muffig hier, und die Luft roch nach der Klimaanlage, nach Staub und alten Schuhen.
Zwischen den herumhastenden Pendlern, die schnell eine Tasse Tee tranken oder ein Sandwich herunterschlangen, saß bewegungslos, wachsam und gespannt Kramer. Wie ein Raubtier betrachtete er die Eintretenden – so, als wollte er sich aus einer Tierherde sein Opfer aussuchen.
Eine Frau kam herein, plötzlich verebbte das Stimmengewirr, und verstohlene Blicke richteten sich auf sie. Sie galten weniger ihrer auffallend extravaganten Kleidung oder ihrem offenbar teuren Schmuck als vielmehr wohl einer gewissen Arroganz in ihren Bewegungen, die sie aus der Masse heraushob. Es war eine kleine, sehr schlanke Frau, etwas zu zierlich für ihre üppige rote Haarpracht.
Sie ging zu einem der freien Tische, musterte kurz die Gäste an den Nachbartischen, wandte den Blick dann aber rasch wieder ab und setzte sich.
Mitte vierzig, dachte Kramer bei sich. Ihre Haut war von der Sonne faltig und sommersprossig, aber sie hatte trotzdem etwas Jugendliches an sich. Ihre Augen waren blaßblau – kluge Augen; und ihr Mund war ein schmaler, scharlachroter Strich.
Ehrgeizig, skrupellos und hart, konstatierte Kramer, während er Claire Grieff nachdenklich weiter beobachtete. Allerdings vermißte er das stolze Lächeln, das er zwei Nächte zuvor auf der Fotografie gesehen hatte. Sie sah mißtrauisch und trotzig aus. Als sie an diesem Morgen das Treffen vereinbart hatten, war die Angst in ihrer Stimme unverkennbar gewesen.
Kramer wartete noch eine Weile ab. Soll sie doch schwitzen, dachte er. Automatisch, ohne sich dessen selbst richtig bewußt zu werden, schätzte er ab, wieviel ihr Schmuck wohl wert war: der Diamantring vielleicht zehn, die Smaragdbrosche drei – nein, nur zwei, weil die Steine zu klein waren und der Wert vor allem in der künstlerischen Verarbeitung lag. Aber die müßte geändert werden.
Einige Minuten später ließ sie ihren Blick prüfend auf ihm ruhen, sie zog eine Augenbraue leicht hoch, ihre grellroten Lippen kräuselten sich ein wenig, und ein tiefrot lackierter Fingernagel winkte ihn heran.
Er erhob sich widerwillig. Blöde Ziege! Hat sie mir doch tatsächlich den Spaß verdorben!
»Kaffee?« fragte sie. Ihre Stimme war tief und befehlsgewohnt, eine Stimme, wie sie sich nur die ganz Reichen erwerben.
Er nickte und setzte sich neben sie.
Claire fühlte sich sicherer, nachdem sie nun in direkten Kontakt mit ihm getreten war. Sie spürte die Brutalität, die in diesem Mann schlummerte, die mühsam verborgene Feindseligkeit. Ein verbitterter Mann, dachte sie, der schon lange seine Sinnlichkeit und seine Gefühle erstickt hat. Sie hatte solche Männer wie ihn schon früher kennengelernt, in Afrika – Männer, die das Töten zum Beruf gemacht hatten, weil sie die Achtung vor dem Leben verloren hatten. Er hatte etwas an sich, das ihr einen eiskalten Schauer den Rücken hinunterlaufen ließ, und dennoch hatte ihre nagende Angst nun etwas nachgelassen. Ein Agent war er nicht – dessen war sie sich sicher. Das war ein ehemaliger Söldner, der zum Verbrecher geworden war. Überdeutlich sah man es ihm an.
Der Kaffee kam. Claire spielte mit dem Löffel, während sie sich wortlos gegenübersaßen und die Stärken und Schwächen des anderen abzuschätzen versuchten.
»Wie ich sehe, sind Sie in Johannesburg ja schön braun geworden.« Claires blaue Augen blitzten.
Kramer zuckte die Achseln. Er war nicht hier, um seine Zeit zu verschwenden. »Kommen wir zur Sache«, sagte er rauh. »Ich habe etwas zu verkaufen. Und Sie sind interessiert daran. Machen Sie mir ein Angebot.« Seine Augen verengten sich verächtlich.
Claire spürte, wie Wut in ihr hochstieg. Für wen hielt er sie eigentlich? »Leben Sie gut davon, anderen Leuten ihr Eigentum zu stehlen und es ihnen dann wieder zum Kauf anzubieten?« fragte sie kühl.
Er lehnte sich zurück, neigte seinen Kopf zur Seite und taxierte sie, ohne ein Wort zu sagen. Dann zog er ein Notizbuch und einen Stift heraus, kritzelte eine Nummer auf eine Seite, riß sie heraus und gab sie ihr. »Wenn Sie mir ein Angebot machen wollen, schicken Sie es mir an dieses Postfach. Sie haben vierundzwanzig Stunden Zeit.« Er stand auf. »Danke für den Kaffee.«
Man sah Claire an, wie erschreckt sie war. »Nein, warten Sie.«
»Es gibt nichts mehr zu sagen«, antwortete er ruhig. »Sie haben vierundzwanzig Stunden. So einfach ist das. Ich melde mich bei Ihnen.«
Sie rang nach Luft. »Ich verhandle im Auftrag meines Mannes«, log sie. »Sie sollten sich lieber anhören, was ich zu sagen habe.«
Kramer beobachtete sie gespannt. Sie war nervös, sie log schlecht, und sie hatte Angst.
»Haben Sie noch jemand anderem dieses Angebot gemacht?« flüsterte sie schließlich.
»Nein.« Wie erleichtert sie aussah! »Aber ich habe noch ein paar Verabredungen«, log er. »Ich werde das höchste Gebot annehmen.«
Die Erleichterung in ihrem Gesicht war dahin, Wut trat an ihre Stelle. »Sie widerlicher Erpresser!«
Er zuckte mit den Achseln, stand auf und ging auf die Eingangstür zu. Einen Augenblick später spürte er ihre Hand auf seinem Arm.
Ihr Gesicht hatte sich zu einer häßlichen Fratze verzerrt, und ihre Hände zitterten, als sie seinen Zettel in kleine Stücke riß. »Sagen Sie mir Ihren Preis sofort«, bedrängte sie ihn. »Sonst bekommen Sie vielleicht gar nichts.«
»Sie machen einen sehr erregten Eindruck, Mrs. Grieff«, sagte er ruhig. »Die Leute drehen sich schon nach Ihnen um. Ich würde Ihnen nicht raten, mir nach draußen zu folgen – zumindest nicht, bis Sie den Kaffee bezahlt haben.«
Claire setzte sich wieder und suchte mit zitternden Fingern in ihrer Handtasche nach Kleingeld. Tränen der Angst, der Wut und der Machtlosigkeit zogen sich eine unregelmäßige Bahn durch ihr Make-up.
Der Schnee fiel immer dichter, die tiefhängenden Wolken bezogen von dem Lichtermeer London einen unheimlichen Schimmer und der Nordwind wurde stärker. Großer Gott, war das kalt!
Er eilte durch die Straßen. Er mußte nachdenken. Der Schnee blieb leuchtend weiß auf Hecken und Vordächern liegen und sammelte sich in den Ecken; man sah kaum noch dreißig Meter weit.
Er begann, durch den Schneesturm zu rennen, um so das Gefühl von Verwundbarkeit und Ungedecktheit abzuschütteln, das er seit seiner Zeit als Söldner nicht mehr erlebt hatte. Dann verlangsamte er plötzlich seine Schritte und lauschte: Jemand kam hinter ihm her, deutlich hörte er die Gummisohlen auf dem frisch gefallenen Schnee, nur wenige Meter entfernt. Jetzt ein leises Knirschen, so, als wäre jemand auf einen Stein getreten, dann ein kurzes Stolpern. Kramer starrte angestrengt in das Schneetreiben. Die Nacht war voller weißer Gestalten und undurchdringlicher Schatten, aber er konnte nichts entdecken, was nach einem lebenden Wesen aussah.
Trotzdem bestand kein Zweifel, daß er verfolgt wurde. Er ärgerte sich über sich selbst, weil er es erst jetzt gemerkt hatte, und stellte sich in den nächstbesten Hauseingang.
Sein Verfolger rannte jetzt und kam schnell näher. Er machte gar keinen Versuch, sich verborgen zu halten. An der Straßenecke stockte der Mann und stieß einen Fluch aus, weil er nicht wußte, welche Richtung.
Dann öffnete sich die Tür.
Kramer konnte das Erstaunen kaum verbergen. Die Frau, die da in der Tür stand, war unbestreitbar eine Schönheit. Ihre Haut war weiß und makellos. Ihr marineblaues Kleid fiel ihr in Falten von den Schultern und erinnerte an ein Gewand aus der griechischen Antike. Ihr goldenes Haar hing in Locken bis auf ihre freien Schultern herab. Und ihre bernsteinfarbenen Augen leuchteten einladend.
»Guten Tag«, sagte sie. »Das ist also der berühmte Mr. Jones.« Sie lachte so, als teilten sie beide ein intimes Geheimnis. Dann ging sie auf ihn zu, blieb ein wenig zu nahe bei ihm stehen und blickte in sein Gesicht. Sie registrierte seine ebenmäßigen, doch harten Gesichtszüge, seine kalten Augen, seine sonnengebräunte Haut. »Ich habe so einen Mann wie Sie schon lange nicht mehr gesehen«, sagte sie schließlich. »Es ist noch nicht lange her, daß Sie Afrika verlassen haben, nicht wahr? Wenn ich raten müßte: ehemaliger Söldner.«
»Sie brauchen nicht zu raten«, sagte er verlegen und wich einen Schritt zurück, als sie ihm eine Hand auf den Arm legte. Sie will die Papiere unbedingt haben, schoß es ihm durch den Kopf, und sie würde so ziemlich alles dafür tun, um sie zu bekommen.
»Sie wissen doch sicher, wer ich bin«, sagte sie leise.
Natürlich wußte er, wer sie war. Der Skandal und der Prozeß hatten sie berühmt gemacht. Marika Magos – die Pelzkönigin, wie sie in den Zeitungen genannt wurde. Sie sah noch viel, viel bezaubernder aus, als die Zeitungsbilder es zeigen konnten.
»Sie waren ja wirklich sehr fleißig, Mr. Kramer.«
Woher zum Teufel wußte sie, wer er war? Kramer konnte seine Überraschung nicht verhehlen.
Sie lachte über sein Unbehagen. »Sie dürfen sich nicht aufregen, wenn jemand das gleiche Spiel wie Sie selbst spielt«, sagte sie mit sanfter Stimme. Sie ließ sich mit einer katzenartigen Bewegung auf die Couch gleiten, legte ihre weit geöffneten Arme auf die Rücklehne und schlug die Beine übereinander. »Lassen Sie uns etwas zusammen trinken. Würden Sie uns einen Drink eingießen?«
Kramer war wie gebannt von dieser Frau. Er konnte seinen Blick kaum von ihr losreißen, und er verschüttete Whisky auf die Bar. »Ich möchte wissen, was Sie wollen«, sagte er barsch. Er beobachtete sie genau. Sie war nicht von der Sorte, die mit jedem gleich ins Bett ging, und trotzdem war unverkennbar, daß sie sich ihm anbot. Von diffizilen Verführungskünsten konnte dabei keine Rede sein, von Leidenschaft schon gar nicht. Dafür aber war bei ihr mehr nur ein Hauch von Verzweiflung zu verspüren.
»Ich will die Papiere ... Ich muß sie haben.« Ihre Stimme zitterte vor Erregung. »Außerdem ...«, sie sah ihn flehentlich an. »Außerdem will ich, daß Sie sich um meinen Mann kümmern.«
»Ich bin kein Killer«, sagte er, trank sein Glas aus und griff nach seiner Windjacke.
»Ich habe ja nicht gesagt, Sie sollen ihn umbringen. Nur
Angst sollen Sie ihm einjagen – eine höllische Angst.«
»Tut mir leid. Ich will nur die Papiere verkaufen.«
»Eine Million Pfund. Denken Sie darüber nach. Sie könnten sich zur Ruhe setzen, Mr. Kramer.«
»Oder ums Leben kommen«, erwiderte er.
»Was man Ihnen auch anbietet – ich biete mehr, viel mehr«, sagte sie verzweifelt. »Ich bin eine sehr reiche Frau. Nennen Sie Ihren Preis. Sie können haben was Sie wollen.«
Aber nicht den Kwammang-a, dachte er. »Keine Chance«, sagte er und ging abrupt hinaus.
Kapitel 3
Er ging zügig durch die beißende Kälte. Nur ab und zu blieb er stehen, um sich nach einem vorbeifahrenden Taxi umzusehen. Aber Taxis schienen in Hampstead selten zu sein. Er war schon fast zu Hause, als er endlich eines erwischte.
Das Schneetreiben war inzwischen noch schlimmer geworden. Als er aus dem Taxi stieg, konnte er kaum noch etwas erkennen. Vor der Haustür stolperte er über etwas, das er zunächst für einen großen Sack hielt, den ihm jemand dorthin gelegt hatte. Als er sich darüber beugte, rutschte der Körper zur Seite und blieb, den Rücken nach unten, auf der Fußmatte liegen.
Ein verschwollener Mund öffnete sich langsam und gab dabei eigenartige, qualvoll quäkende Töne von sich. Kramers erste Empfindung war Ekel: vor dem Blut, vor der Hilflosigkeit und der Entwürdigung dieser jungen Frau, deren Gesicht – so viel war immerhin noch zu erkennen – auffallend hübsch war. Dann aber wurde das Ekelgefühl von Mitleid verdrängt. Er schloß die Tür auf, hob die Frau auf, trug sie in sein Wohnzimmer und legte sie hin.
Erst als er jetzt aufsah, bemerkte er das Chaos, das ihn umgab. Seine Wohnungseinrichtung war auseinandergenommen worden, Stück für Stück, von Experten offensichtlich.
Er zwang sich, seine Aufmerksamkeit wieder dem Mädchen zuzuwenden. Wer zum Teufel war sie? Wer hatte sie so zugerichtet? Ihr Atem ging kräftig, aber unregelmäßig, ihre Pulsfrequenz war zu hoch. Eine Gesichtshälfte war angeschwollen, und zwei blaue Augen kündigten sich an. Schlimmer war jedoch, daß die Frau stark unterkühlt war.
Er rannte nach oben, um eine Decke und ein Kissen zu holen. Als er wiederkam, gab das Mädchen wieder diese quäkenden Töne von sich und rollte mit den Augen. Er holte ein Glas und flößte ihr Brandy ein. Dann untersuchte er ihre Arme und Beine, aber es schien nichts gebrochen zu sein; allem Anschein nach handelte es sich nur um Prellungen.
Nach einer Weile stöhnte sie leise und öffnete die Augen. »Sind Sie Kramer?« fragte sie.
Kramer zuckte zusammen. Wie hatte auch sie es geschafft, seinen Namen herauszubekommen – und seine Adresse? Obwohl sie so furchtbar zugerichtet war, erkannte er sie nun. Dieses Gesicht war jeden Abend im Fernsehen zu bewundern. Sylvia Shaw, dieser gutaussehende Publikumsliebling, ist 9000 Dollar pro Tag wert, hatte er kürzlich in einem Magazin gelesen.
»Ich bin überfallen worden«, stammelte sie. »Ich wollte Ihnen mein ganzes Geld bringen. Ich habe es heute nachmittag von der Bank geholt. Und jetzt ist es weg.« Sie schluchzte. »Ich muß die Papiere haben.«
Kindisches Weinen, laut und fordernd, als wollte sie Hilfe herbeiflehen. Kramer ignorierte sie und ging in eine Ecke des Zimmers, wo ein Stapel verstaubter Magazine und Zeitungen lag, die er flüchtig durchsah. »Wer wußte davon?« fragte er sie über die Schulter.
»Wovon?«
»Daß Sie mit dem Geld herkommen wollten.« Er drehte sich um und beobachtete sie aufmerksam. »Und wieso sind Sie eigentlich hierhergekommen? Woher wissen Sie, wer ich bin?«
Sie preßte verstockt den Mund zusammen, und wieder stiegen ihr Tränen in die Augen.
»Na schön«, sagte er. »Sind Sie das?« Er hielt ein amerikanisches Nachrichtenmagazin hoch. Das Gesicht auf dem Titelblatt war unbestreitbar schön: große veilchenblaue Augen, in denen Wärme und Mitgefühl leuchteten; lange blonde Haare, die das Gesicht umschwebten, als wäre dieses Wesen gerade von einer anderen Welt über den Wolken, deren Bewohner allesamt überirdisch schön waren, zur Erde herabgestiegen. »Unglaublich«, murmelte er in sich hinein.
»Ja, das bin ich«, flüsterte sie. »Sie müssen mir die Papiere verkaufen. Sie können es ja selbst nachlesen, wieviel ich verdiene. Was Sie auch wollen, ich werde es Ihnen zahlen. Nennen Sie mir nur Ihren Preis. So verstehen Sie doch: Es geht um Leben und Tod!«
»Ja«, sagte er bedächtig. »Das ist so ziemlich das einzige, was ich verstehe.«
Sylvia wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und blickte ihm in die Augen. »Ist es wahr, daß Claire die Papiere bekommen hat?«
»Ich habe mit ihr nur verhandelt ...«
»Mein Gott, lügen Sie mich nicht an!«
Sie ist noch sehr jung, dachte er. Höchstens Anfang Zwanzig. Und sie hat einen Dickkopf. Ein Mädchen, das sich vielleicht überreden läßt, das man aber nicht einschüchtern kann. Er selbst hatte nie Kinder gehabt. Hätte ich welche, dachte er, dann wären sie jetzt vielleicht ungefähr so alt wie Sylvia. Er fühlte sich von ihrer Verzweiflung seltsam gerührt. Hoffentlich bin ich nicht dabei, wenn sie sich zum erstenmal im Spiegel sieht, schoß es ihm plötzlich durch den Kopf.
»Herrgott noch mal«, platzte sie heraus, »sagen Sie mir einfach, wieviel.«
Mehr, als sie hatte. »Ich werde Ihr Angebot weitergeben.«
Mit einem hoffnungslosen Ausdruck im Gesicht wandte sie sich ab. Dann stieß sie die Decke zur Seite, stützte sich an der Rückenlehne der Couch ab und stand unsicher auf.
»Als Sie kamen, waren sie hier, nicht wahr?« Er deutete auf das verwüstete Zimmer. »Sie haben die Leute gestört.«
»Ja, das habe ich wohl.«
»Haben Sie irgendwas von ihnen erkennen können?«
»Sie hatten Strümpfe über den Gesichtern. Schrecklich!« Sie schüttelte sich. »Wo finde ich einen Spiegel?« Sie begann, mit dem Zeigefinger über ihr Gesicht zu fahren. »Autsch!« Sie bewegte vorsichtig ihren Kopf.
»Wenn ich Sie wäre, würde ich keinen Spiegel suchen.«
»Sehe ich so schlimm aus?«
Er nickte. »Die Verletzungen sind aber nur oberflächlich. In zehn Tagen sehen Sie wieder wie neu aus. Möchten Sie etwas trinken?«
»Bitte.«
Kramer goß ihr noch etwas Brandy ein. Während sie daran nippte, musterte er sie nachdenklich. In Grieffs Leben mangelte es nicht an Frauen. Eine von ihnen hatte den Diamanten. Vielleicht ist sie sogar diejenige, dachte er, aber wahrscheinlich nicht. Doch sie konnte ihm etwas anderes geben, daß er brauchte: Informationen. Allerdings fühlte er sich genauso unsicher wie damals in Zaire, als er anhand der falschen Landkarte mit dem Fallschirm abgesprungen – und prompt im Gefängnis gelandet war.
»Hören Sie«, sagte er, »wenn ich wüßte, was hier eigentlich vor sich geht, könnte ich vielleicht über Ihr Angebot entscheiden.« Er hatte wohl nicht überzeugend genug gelogen, denn er bemerkte Zweifel und Verärgerung in ihrem Gesicht. Verlegen drehte er sich um und goß sich noch einen Drink ein.
»Also gut.« Sie zögerte. »Ich weiß eigentlich auch nicht alles. Es gibt nur eine Person ...« Sie stockte und befühlte wieder ihr Gesicht.
»Hören Sie auf damit.«
Sie ließ ihre Hand sinken. »Wenn ich Ihr Telefon benutzen darf, spreche ich mit ihr.«
»Nur zu«, brummte er.
Er zog die Vorhänge zurück und starrte hinaus in den Schneesturm. Hecken und Rinnsteine waren jetzt schon von einer dicken Schneeschicht bedeckt, und die Häuser in der Umgebung sahen aus wie auf einer Weihnachtskarte. Plötzlich fluchte er laut. Er haßte England, er haßte diese Enge und übertriebene Sauberkeit, diese schmalen Straßen, auf denen er Platzangst bekam, und diese ordentlichen Häuser, haßte diese Bäume, die von Hecken eingerahmten Felder, die scharf gezogenen Grenzen. Einen Schneesturm in Finnland oder Kanada, ja, den hätte er ertragen, vielleicht sogar genießen können – ein Schneesturm in England aber war unerträglich: Der sowieso schon viel zu kleine Spielraum, der einem blieb, um sich frei zu bewegen, wurde nun von diesem gottverdammten, erstickenden, blendenden Schnee ausgefüllt.
Er hörte eine Stimme hinter sich. »Großmama? Bist du das, Boba? Tut mir leid, daß ich dich aufgeweckt habe, meine Liebste.«
Scheißdreck! Warum gab er ihr nicht einfach die Papiere und machte, daß er von hier fortkam? Aber dann würde er vielleicht nie den Kwammang-a in die Finger bekommen.
Einen Augenblick später spürte er, wie sie seinen Arm berührte. »Kommen Sie mit«, sagte sie.
Bertha Factor stand auf dem Namensschild. Es befand sich in einem kleinen Kasten über der Mezuza, der kleinen Schriftrolle, die manchmal als Glücksbringer vor jüdischen Wohnungen hängt. Er war verblüfft. Fanden denn die Überraschungen heute gar kein Ende?
Sylvia, die einen Schlüssel zu der Haustür hatte, schloß auf und führte ihn durch einen Gang ins Wohnzimmer. Es war alles da: die Menora, der siebenarmige Leuchter auf der Konsole, die silbernen Kandelaber, die schweren Spitzen, die handgestickte Tischdecke, der üppige Leuchter an der Decke.
Die Frau, zu der Sylvia ihn gebracht hatte, paßte genau zu diesem Haus: eine Jüdin aus der Mittelschicht, respektabel und solide. Sie saß in einem Schaukelstuhl, würdevoll trotz ihrer fülligen Figur. Um die Sechzig, überlegte sich Kramer. Eine gewitzte, intelligente und energische Frau.
Sie wurde blaß und rang nach Luft, als sie Sylvias Gesicht sah. »Um Gottes willen, Babella!« Sie erhob sich verblüffend schnell, eilte durch das Zimmer und schloß das Mädchen in die Arme.
»O Boba!« Sylvia legte ihr Gesicht an die Schulter der Frau und klammerte sich einige Minuten lang zitternd an ihr fest.
»Mein Name ist Bertha Factor«, sagte die Großmutter schließlich und sah mit ihren kohlschwarzen Augen Kramer an. »Was ist mit Sylvia passiert?«
»Boba, ich bin überfallen worden. Sie haben mir mein ganzes Geld abgenommen. Ich hatte es von der Bank geholt, verstehst du? Mir geht es gut. Du brauchst dir wegen mir keine Sorgen zu machen.«
»Jetzt hört euch das Kind an! Das ganze Gesicht zerschunden – und da sagt sie, ich soll mir keine Sorgen machen. So weit ist es schon gekommen ...«
»Boba, das ist der Mann, von dem ich dir erzählt habe«, unterbrach Sylvia sie. »Der Mann mit den Papieren, Mr. Kramer.«
Kramer stellte fest, daß er unwillkürlich dem Blick dieser Augen, die so hart wie Achate geworden waren, auswich.
Bertha wandte sich ab, führte ihre Enkelin zu einem Sessel, holte ihr schnell Aspirin und ein Glas Wasser und überschüttete sie schließlich mit Fragen. Dabei ignorierte sie Kramer, der sich immer unwohler fühlte.
Erst als sie alle bei einer Tasse Kaffee saßen und Bertha sicher sein konnte, alles Menschenmögliche für das Wohlergehen ihrer Enkelin getan zu haben, sprach sie ihn wieder an. »Also, Mr. Kramer, Sie sind hier in eine Familientragödie hineingestolpert, und zwar in die Tragödie einer Familie, die aus ebenso einflußreichen wie hartnäckigen Menschen besteht. Diese Menschen sind sogar hartnäckiger als Sie, Mr. Kramer, und sie sind schlauer. Aber ihre Gefühle sind mit ihnen durchgegangen.« Einen Moment lang taxierte sie ihn mit ihren klugen Augen, musterte die starken, sonnengebräunten Hände, die hagere Gestalt und die verschleierten Augen, die manchmal fast unmerklich ihre Deckung aufgaben. »Ich bezweifle, daß Sie diese Menschen verstehen würden. Ehrlich gesagt, gelingt selbst mir das nicht einmal immer, obwohl es sich schließlich um meine Familie handelt.«
Kramers Augen weiteten sich.
»Ich sehe, Sie sind überrascht«, sagte Bertha. »Unglaublich, nicht wahr? Trotzdem ist es die Wahrheit ...«
»Boba!« unterbrach Sylvia sie mit schriller Stimme. »Laß das doch bitte jetzt! Du verschwendest nur Zeit. Wir müssen ihm die Papiere abkaufen.«
»Er ist nicht gekommen, weil er Geld haben will, Babella.« Bertha lehnte sich zurück und beobachtete ihn feindselig. »Nein, Mr. Kramer ist hergekommen, weil er sich seiner Sache nicht sicher ist. Er will nur herausbekommen, wer für ihn der beste Geschäftspartner ist. Ist es nicht so, Mr. Kramer?«
Kramer räusperte sich und stellte seine Tasse ab. Veilchenblaue Augen beobachteten ihn mit einem Ausdruck, der ihm so gar nicht behagte.
»Ich glaube, daß Sie mir die Papiere verkaufen werden, wenn ich Ihnen unsere Geschichte erzählt habe«, fuhr Bertha fort. »Es ist eine lange Geschichte. Sie reicht zurück bis Walvis Bay im Jahre 1940.« Sie drehte sich zu ihrer Enkelin um und runzelte die Stirn. »Weine nicht, Sylvia. Wir werden diesem Mr. Kramer hier erzählen, was er wissen will, und dann werden wir beraten, wie es weitergehen soll.«
Sylvia nickte wortlos.
»Das war eine schreckliche Zeit. Im März 1939 war Hitler-Deutschland in der Tschechoslowakei eingefallen. So viele Menschen versuchten zu fliehen. Nur wenigen ist es gelungen, und zu ihnen gehörte Marika. Sie hatte das Glück in einen Zug voller jüdischer Kinder gesteckt zu werden, die auf der Flucht waren und zu Pflegeeltern in Afrika geschickt wurden. Oder war es gar kein Glück – sondern Schicksal? Ich weiß es nicht. Wenn man so alt ist wie ich, Mr. Kramer, fängt man langsam an, eine Ordnung in den Dingen zu erkennen. Auch Sie sind Teil einer Ordnung und haben Ihre Rolle zu spielen.«
Kramer stellte seine Tasse auf das Tablett und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Er hätte sich gewünscht, daß das Feuer nicht so warm, die Luft nicht so schlecht und er selbst nicht so müde gewesen wäre. Er hatte einen schweren Tag hinter sich. Zuerst Claire, dann Marika Magos, und nun auch noch diese unglaublich schöne junge Frau, die man in seiner eigenen Wohnung verprügelt hatte. Er hatte Mühe, sich auf die Worte der alten Dame zu konzentrieren. Er war so müde. Wenn sie doch nur endlich zur Sache käme!
Kapitel 4
Walvis Bay, 25. Januar 1940
Der Nebel hing schwer über den Hafenanlagen und ließ den ganzen Ort noch abweisender aussehen, als er ohnehin wirkte. Die Häuser schimmerten in verschiedenen Grautönen, die mit dem Grau des Meeres verschmolzen, so, als wollte die Natur den plumpen Versuch der Menschen vergessen machen, hier, wo die Küste am abschreckendsten war, festen Fuß zu fassen.
Dem enttäuschten Blick des Mädchens blieb, als das Frachtschiff um den Kai fuhr, nichts verborgen. Unfreundlich und abweisend lag vor ihm die Stadt – oder Ort, an dem nicht einmal ein Baum wuchs. Das Mädchen sah die langgestreckten Lagerhäuser, den Hafen mit den Walfängern und den Fischerbooten, dahinter ein paar Wohnhäuser und andere Gebäude – und sonst nichts als Sanddünen, die sich unter einem grauen Himmel in alle Richtungen erstreckten.
Das also war Afrika! Tausendmal hatte sie sich diesen Teil der Welt vorgestellt, aber selbst in ihren schlimmsten Alpträumen hatte es nicht so furchterregend ausgesehen wir hier. Während das Schiff anlegte, ging die Sonne auf, riesig, gnadenlos und blutrot, der Nebel verschwand, und die Siedlung in ihrer ganzen primitiven Trostlosigkeit lag mit einemmal entblößt da. Marika schloß die Augen und hielt sich die Ohren zu, aber sie konnte dem Geschrei der Möwen, dem Donnern der Brandung und dem Heulen der Schiffssirene nicht entfliehen.
Sie spürte eine Hand auf ihrer Schulter und sah in die besorgten Augen der freiwilligen Helferin, die sie zusammen mit fünfzehn anderen Flüchtlingskindern über die Schweiz in ihre neue Heimat gebracht hatte.
»Schau! Da wartet jemand auf dich«, sagte die Frau mit sanfter Stimme auf deutsch.
Marika drehte sich brüsk um. Sie haßte die deutsche Sprache, und sie reagierte grundsätzlich nicht darauf, wenn sie darin angesprochen wurde. Sie klammerte sich an der Reling fest, schloß wieder die Augen und versuchte, das Bild der Frau auszulöschen, die seit mindestens einer Stunde, seitdem das Schiff eingelaufen war, regungslos am Kai stand.
Sie ist so häßlich wie die Stadt, in der sie wohnt, überlegte sich Marika. Eine gedrungene Frau in einem blauen Safari-Anzug mit rotem, fleckigem Gesicht und viel zu kurz geschnittenem schwarzem Haar.
Das Frachtschiff war schon seit sieben Tagen überfällig, und an jedem dieser Tage hatte die Frau morgens hier im Nebel gestanden, angestrengt auf das Meer hinausgestarrt und dafür gebetet, daß das Schiff den deutschen U-Booten entkommt und ihre kleine Tochter sicher hierherbringt. Die Frau hieß Bertha Factor. Zusammen mit ihrem Mann Irwin führte sie den einzigen Import- und Exportladen in Walvis Bay.
An diesem Morgen spürte Bertha weder den Sand, der ihr beißend ins Gesicht wehte, noch die Sonne, die, obwohl es erst neun Uhr war, schon unangenehm brannte – denn irgendwo auf diesem Schiff dort war ihre Pflegetochter.
Ihre Tochter! Damit wurde ein Traum Wahrheit, den sie fünfzehn Jahre lang geträumt und eigentlich schon fast aufgegeben hatte. Und so sprudelten nun die seit Jahren unterdrückten Mutterinstinkte in ihr über, so, wie manchmal in einem ausgetrockneten Flußbett unerwartet eine Quelle durchbricht.
Bis in die kleinste Einzelheit hatte sie sich ihre Tochter ausgemalt. Klein würde sie sein, ein bißchen mollig, dunkelhaarig – nicht ganz genau wie sie, aber eine gewisse Ähnlichkeit würde auf jeden Fall da sein. Bertha war eine äußerlich sehr schlichte Frau, und mit ihren fünfunddreißig Jahren sah sie aus wie fünfzig. Ihre Haut war von der stechenden Sonne und dem Sand gegerbt, und ihre Hände – tüchtige, starke Hände – waren rot und schwielig. In ihren dunklen Augen konnte man Mitgefühl und Intelligenz erkennen. Wer zu ihr kam, weil er ihrer Hilfe bedurfte – ganz gleich, ob es ein Schwarzer oder ein Weißer war, und selbst ein betrunkener Seemann wurde nicht ausgenommen –, der konnte auf sie zählen.
Richtig hübsch gewesen war sie auch als Mädchen nicht. Irwin Factor hatte sie nicht wegen ihres Aussehens zur Frau gewählt, sondern wegen ihrer Tüchtigkeit und Willenskraft. Sie hatten sich auf einem Passagierschiff kennengelernt; er war nach einem Besuch bei seiner Familie in Holland auf dem Rückweg gewesen nach Walvis Bay, und sie, eine Londonerin, hatte nach Kapstadt gewollt. Dieses Ziel hatte sie freilich nie erreicht: Die beiden hatten noch auf dem Schiff geheiratet und waren zusammen in Walvis Bay an Land gegangen.
Für Bertha war diese Verbindung nicht auf Leidenschaft gegründet gewesen, sondern auf Vertrauen und Freundschaft. Die Liebe wird mit den Jahren schon kommen, hatte sie gehofft – und sie hatte recht behalten. Eine andere Hoffnung aber wurde enttäuscht: die Hoffnung auf ein erfülltes Leben als Mutter – denn Kinder wollten nicht kommen. Sie hatte gebangt und gebetet und schließlich versucht, mit ihrer Enttäuschung, die von einem Monat zum anderen wuchs, fertigzuwerden.
Eines Tages hatte sie in ihrer Verzweiflung einen Rabbi in Johannesburg aufgesucht, um sich wegen einer Adoption zu erkundigen. Er hatte ihr freundlich erklärt, daß kaum einmal jüdische Babys zur Adoption freigegeben werden, daß sie nach dem Gesetz jedoch nur ein Kind ihrer eigenen Religionszugehörigkeit adoptieren dürfe. Wenn sie natürlich Katholikin werden wollte ... Bertha sah nach dem Besuch bei dem Rabbi älter aus, und ihr Gesicht war trauriger denn je.
Dann kam der Krieg, und zu dem Strandgut von Menschen, die hierher verschlagen wurden, gehörte auch eine Zugladung jüdischer Kinder aus der Tschechoslowakei, die dringend Pflegeeltern brauchten. Ob Bertha nicht einem von ihnen ein Heim bieten könne, fragte man in dem offiziellen Brief vom jüdischen Verwaltungsrat.
Ob sie das konnte? Großer Gott, und ob sie das konnte! Sie hatte einen lauten Freudenschrei ausgestoßen und damit die Fischer in ihrem Laden erschreckt, die sie sonst als ruhige und ausgeglichene Frau kannten.
Die einzigen Informationen, die Bertha seither noch bekommen hatte, waren, daß das Kind Marika Magos hieße und irgendwann im Januar mit dem Frachtschiff Tristan Belle ankommen würde – wenn alles gut ging.
Und nun hatte die Tristan Belle endlich angelegt, und eine Frau in mittleren Jahren kam mit besorgtem Gesicht den Landungssteg herunter.
Bertha trat auf sie zu. »Sie ist doch hier, oder? Ich meine, haben Sie sie mitgebracht?« Ihre Stimme zitterte.
»Sie sind bestimmt Mrs. Factor«, sagte die Frau mit sorgenvoller Miene und stellte sich vor. »Ja, Marika ist dabei, aber ich fürchte, sie ist ein bißchen schwierig.« Die Kinder taten ihr alle leid. Walvis Bay schien der unwohnlichste Ort auf der ganzen Welt zu sein. Und Marika war bei weitem der schwierigste ihrer Schützlinge. Sie eilte den Landungssteg wieder hinauf und kam mit einem Mädchen zurück, das sie an der Hand hinter sich her zerrte.
»Das kann sie doch nicht sein«, murmelte Bertha Irwin, der hinzugetreten war, ungläubig zu. Der Anblick seiner hageren Gestalt mit den langen Beinen, der beginnenden Glatze und den humorvollen Augen hinter der Hornbrille beruhigte sie für einen Moment. Sie tastete nach seiner Hand. »Bitte ... nicht die dort«, flüsterte sie.
Das große dünne Kind klammerte sich am Geländer fest und weigerte sich weiterzugehen. Es stieß einen Schwall unverständlicher Worte aus, der mit einem hohen, durchdringenden Schrei endete. Dann riß es sich los und trat der Frau mit voller Wucht ans Schienbein.
Bertha las in den Augen des Mädchens Angst und das Gefühl der Erniedrigung. »Das kann sie nicht sein«, wiederholte sie fassungslos. »Sie ist doch so groß und sieht so ... so eigenartig aus.«
Der Kopf des Mädchens war kahl geschoren worden, und das nachsprießende Haar bildete nun eine knappe goldene Mütze, die eng an dem spitz zulaufenden Schädel anlag. Auch das Gesicht war lang und spitz – ein viel zu erwachsenes Gesicht mit hohen Backenknochen, weißer Haut, bernsteinfarbenen Augen, die wie enge Schlitze wirkten, und einem Mund, der zu groß schien. Das Auffälligste aber: Das Mädchen war geradezu abnorm mager. Dürre Beine und Arme ragten aus viel zu engen Kleidern.
Bertha fühlte sich unwillkürlich an eine Gazelle erinnert, die sie irgendwann einmal mit dem Auto angefahren hatten. Nie hatte sie die wilden und zugleich tieftraurigen Augen der Kreatur vergessen können. Dieses Mädchen dort oben auf dem Landungssteg war ebenso wild und ebenso traurig wie diese Gazelle.
Ein plötzlicher Windstoß wirbelte Sand auf. Marika warf die Hände vors Gesicht und rieb sich die Augen. Abscheu und Verzweiflung hatten sie erfaßt. Sie spürte, wie sie von jemandem hochgehoben und von dem Schiff getragen wurde. Sie war sicher, daß ein weiteres schreckliches Kapitel in ihrer Existenz begonnen hatte.
Kapitel 5
Bertha eilte hinter Irwin her, der sich das Kind über die Schulter geworfen hatte, und beobachtete das Gesicht des Mädchens. Eine Mischung aus Zorn und Trauer war in ihm zu erkennen. Ab und zu trat Marika Irwin mit ihren langen, knochigen Beinen in den Bauch.
»Herrgott, was habe ich nur getan!« murmelte Bertha und beeilte sich, Irwins langen Schritten zu folgen.
Dann fiel ihr wieder ein, wie sie sich selbst gefühlt hatte, als sie vor fünfzehn Jahren in Walvis Bay an Land gegangen war. Der Sand hatte sie fast in den Wahnsinn getrieben. Mit der Hitze wurde sie fertig, auch mit dem Mangel an Luxus und Unterhaltung, aber der Sand – großer Gott! Sie haßte ihn noch genauso wie am ersten Tag. Er war immer da, er verstopfte die Abflüsse, bedeckte die Möbel, verursachte alle möglichen Augenkrankheiten, knirschte bei jedem Essen zwischen den Zähnen und wurde schließlich mit den Exkrementen ausgeschieden.
Der größte Teil des Budgets der kleinen Stadt wurde für den Kampf gegen den Sand ausgegeben. Niemand beschwerte sich darüber – schließlich hätte es auch nichts genutzt. Walvis Bay war von der ältesten, natürlichsten Wüste der Erde umgeben, die sich von dem Fluß Orange im Süden zweitausend Kilometer weit bis zur angolanischen Küste im Norden erstreckte, und seine Dünen waren die höchsten der Welt.
Die Factors bewohnten ein zweistöckiges Holzhaus, das wegen der wiederkehrenden katastrophalen Überschwemmungen – vor fünf Jahren hatte sie das Hochwasser fast in den Bankrott getrieben – auf hohen Pfählen stand und das, einfach wie es gebaut war, eigentlich eher wie ein Schuppen aussah. Zur Wohnung kam man nur durch den Laden, dessen Eingangstür über eine Holztreppe zu erreichen war. Diese düstere Höhle war bis zum Bersten gefüllt mit Treibstoffkanistern, Fischerei-Zubehör, Haushaltsartikeln, Babynahrung, Schiffsproviant, Stoffballen, Säcken mit Korn und Zucker, mit getrocknetem Fisch und Früchten.
Irwin war ins Schnaufen gekommen, als er das Kind durch den Laden und die Treppe hinauf ins Obergeschoß getragen und dabei unaufhörlich irgendwelchen Unsinn vor sich hin geplappert hatte. Vor Marikas Zimmer machte er schließlich eine dramatische Pause, schmetterte ein »Tam, ta-ta-tam-tam, tam-tam« und stieß die Tür auf.
Grinsende Zwerge, Mickymausfiguren, Elfen und alle möglichen Stofftiere standen auf jedem verfügbaren Platz des Zimmers. Warum muß Bertha nur immer so übertreiben? dachte er respektlos. Ein Alptraum! Aber woher sollte Bertha auch wissen, daß das Kind schon so alt sein würde? Er wußte, daß Bertha enttäuscht war. Aber er wußte auch, daß sie das niemals zugeben würde.
Inzwischen war er nahe daran, unter seiner Last zusammenzubrechen. »Herrje!« Er legte Marika vorsichtig auf das Bett, schob ihr einen Teddybär in die Arme und lehnte sich keuchend an eine Wand.
»Gefällt dir das Zimmer?« fragte Bertha ängstlich.
Marika konnte sie nicht verstehen, aber Berthas Gesichtsausdruck sagte ihr genug. Sie warf den Bär in eine Ecke, schloß die Augen, um dieses grauenhafte Zimmer und vor allem die beiden furchtbaren Menschen mit ihren krampfhaften Bemühungen, ihr zu gefallen, nicht mehr sehen zu müssen, und vergrub ihr Gesicht in dem Bett.
Die Factors sahen sich hilflos an und richteten ihre Blicke dann wieder auf das Kind. Obwohl Marika verschwitzt roch und ihre Kleider in der Hitze fest an ihr klebten, zog sie ihren abgeschabten Mantel fester um sich.
Mein Gott, wie dürr sie ist, dachte Bertha. Ein Wunder, daß sie noch am Leben ist. Sie braucht ordentliches Essen und viel Liebe. Bertha setzte sich auf die Bettkante und versuchte, dem Kind den alten Mantel auszuziehen, aber Marika schlug heftig um sich. Bertha stand auf und biß sich auf die Lippe.
»Komm«, sagte Irwin, »laß sie ein Weilchen in Ruhe. Sie hat Angst, und es ist alles so fremd für sie.«
Sie gingen auf Zehenspitzen hinaus, schlossen die Tür und gingen in den Laden hinunter.
Doch Bertha hatte Bedenken. »Sie jetzt allein lassen? Ich meine, wir sollten das nicht tun – sie ist doch gerade erst angekommen.«
»Gib ihr Zeit, damit sie sich akklimatisieren kann.«
Bertha drehte sich mißtrauisch um. Irwin war alles andere als ein harter Mann, aber jetzt hatte er seine Lippen eigensinnig zusammengepreßt. »Hört euch nur diesen Experten für Kindererziehung an«, sagte sie und eilte mit einem Glas Limonade zu Marika zurück.
Das Mädchen riß ihr das Glas aus der Hand und warf es an die Wand. Es zerschellte klirrend und spritzte freundliche Zwerge und ein Poster mit dem Titel Tee bei den Teddybären voll.
»Da schau her«, sagte Irwin, als Bertha mit zerknirschtem Gesicht zurückkam. Er blätterte gerade die Papiere in dem Ordner durch, den die Begleiterin des Transports ihnen gegeben hatte. »Sie hat am Sonntag Geburtstag. Am 29. Januar. Sie wird zwölf.« Er sah traurig auf. »Hier steht, daß sie nur Tschechisch und Deutsch versteht. Wie gut kannst du Deutsch?«
»Ungefähr so gut wie Tschechisch«, gab Bertha zu. »Und du?«
»Deutsch kann ich ein bißchen«, sagte er.
Ein Fischer kam herein und wollte Schleppnetze kaufen, und eine Weile war Irwin draußen im Schuppen beschäftigt, wo die sperrigeren Waren aufbewahrt wurden.
Bertha rieb sich die Tränen der Enttäuschung aus den Augen und ging in die Küche. Nur noch vier Tage bis zu ihrem Geburtstag, und noch so viel zu tun, dachte sie. Denn was wäre ein Geburtstag ohne einen richtigen Geburtstagskuchen mit Kerzen. »Na schön, dann ist sie eben nicht ganz so, wie ich sie mir vorgestellt hatte«, murmelte sie in sich hinein. »Sie ist anders – besser.« Sie knetete den Zucker in die Butter. »Oje, wie wütend sie sein kann! Aber wer wäre nicht manchmal wütend. Sie hat halt lernen müssen, sich zur Wehr zu setzen, das arme Mädchen.« Sie gab die getrockneten Früchte zu. »Eigentlich ist sie gar kein richtiges Kind mehr. Trotzdem braucht sie Liebe und Fürsorge, und ich werde sie ihr geben. Ich habe ja weiß Gott nach einem Kind gefleht, für das ich sorgen kann.« Den Rührlöffel in der Hand, ließ sie ihren Ärger an dem Kuchenteig aus. »Sie wird mich nie als ihre Mutter betrachten, und wenn der Krieg vorbei ist, wird sie wieder weggehen.« Sie machte eine Pause und wischte sich mit dem Handrücken eine Träne ab. Dann nahm sie ihren Angriff auf die Teigschüssel wieder auf. »Wäre es dir vielleicht lieber, wenn sie heimatlos wäre, Bertha Factor?« fragte sie sich selbst streng. Sie drückte den Teig in die Backform. Dann setzte sie sich an ihre Nähmaschine.
Nach einer Weile hörte sie Irwin wieder die Treppe hochkommen. »Hat der Experte für Kindererziehung schon wieder ein paar neue Erkenntnisse?« fragte sie, als er eintrat.
»Laß ihr Zeit«, lautete seine kurze Antwort.
Wieder einmal mußte Irwin feststellen, wie unberechenbar seine Frau war. Sie selbst gestattete sich, was die Kleidung angeht, nicht den geringsten Luxus. Sie hielt sich für häßlich und fand es überflüssig, teure Kleider zu tragen. Jetzt aber saß sie über die Nähmaschine gebeugt und nähte aus dem teuersten englischen Stoff, den sie auf Lager hatten, das hübscheste Kleid, das er je gesehen hatte.
Er blickte ihr über die Schulter. »Wenn du mich fragst, wird das bei dem Teddybär in der Ecke landen«, sagte er und kniff sie ins Ohr.
»Würde es dir vielleicht besser gefallen, wenn sie in Lumpen herumläuft?« gab sie scharf zurück.
Die folgende Zeit war für Bertha wie ein böser Traum. Jeder Tag brachte neue Herausforderungen und neuen Kummer. Die Kleine war bitter unglücklich, und sie war nicht bereit, sich mit ihrer neuen Umgebung abzufinden. Sie wurde immer verschlossener und gewöhnte sich an, stundenlang eingerollt wie ein Igel auf ihrem Bett zu liegen. Wenn Bertha versuchte, sie in die Arme zu nehmen und zu trösten, wurde sie weggestoßen. Manchmal ging Marika hinaus auf die Sanddünen und sah mit solchem Abscheu im Gesicht auf den Hafen herab, daß Bertha am liebsten geweint hätte. »Sie fühlt sich wie in einem Gefängnis«, vertraute sie Irwin an. Aber was konnten sie dagegen tun?
Endlich fand Bertha jemanden, der sich mit Marika verständigen konnte. Er war ein Matrose von einem russischen Trawler, der zu Reparaturarbeiten im Hafen lag. Am Tag vor Marikas Geburtstag stand er mit seiner Mütze in der Hand im Laden. Er habe gehört, daß Mrs. Factor dringend jemand suche, der Tschechisch spreche.
Zum erstenmal hörten Bertha und Irwin einen Augenzeugenbericht vom deutschen Überfall auf die Tschechoslowakei und von der grausamen Behandlung der jüdischen Bevölkerung – einen Augenzeugenbericht, der um so schrecklicher war, als er so nüchtern von einem jungen Mann vorgetragen wurde, der fast noch ein Kind war.
Bei Marika setzte die Überraschung, mit einemmal ihre eigene Sprache zu hören, eine ganze Kette ebenso deutlicher wie beunruhigender Erinnerungen frei. Sie fand sich zurückversetzt in die Zeit vor dem Einmarsch der Deutschen. Sie sah Mamas Augen vor sich, die immer so freundlich geleuchtet hatten. Ihre Mutter war eine sehr glückliche Frau gewesen. Sie war Werbegrafikerin, die beste in Prag, wie Papa immer sagte. Manchmal nahm sie Marika mit zur Arbeit und ließ sie sogar ihre Zeichnungen begutachten. »Das Kind ist begabt, das wirst du sehen«, sagte dann am Abend Mama stolz zu Papa.
Bei dem Gedanken an Papa stieg ihr ein Kloß in den Hals. Wie glücklich war sie gewesen, als er sie einmal mit in die Klinik genommen hatte! Und wie gut hatte er in seinem langen weißen Kittel ausgesehen, von dem sein glänzendes schwarzes Haar so malerisch abstach!
Als die Deutschen in ihr Land eingefallen waren, floh die Familie aus Prag zu Verwandten auf dem Land. Aber später wurde Papa von den Deutschen abgeholt. Danach hatten sich Mama und sie zu der alptraumhaften Reise zum Bahnhof von Brünn aufgemacht, wo ihre Tante einen Freund hatte, der sie in einem Güterwagen aus der Tschechoslowakei schmuggeln wollte. Sie würden nach Frankreich fahren, hatte Mama gesagt.
Sie hatte damals stundenlang geweint. Warum konnten sie nicht bei ihrer Tante mit ihren Enten und Hühnern und ihrem Hund bleiben, den sie so liebte? Marika wollte sich weigern mitzugehen, aber dann hatte sie aufgeschaut und gesehen, daß ihre Mutter weinte. So hatte sie ihr statt dessen die Hand gedrückt und ihr geholfen, die Rucksäcke zu packen. Dann aber war die schreckliche Nacht gekommen, in der sie ihre Mama verloren hatte.
Sie erinnerte sich noch genau an den letzten Teil des langen Marsches, vorbei an verlassenen Lagerhäusern und Fabriken, über ihnen nur ein schmaler Streifen des klaren Nachthimmels. Dann und wann war fernes Donnergrollen zu hören, und am Güterbahnhof, dem sie sich näherten, schepperten die Puffer von Waggons aneinander, manchmal zischte Dampf laut auf, und dann wurde es wieder still. Sie erinnerte sich noch an die Soldaten und daran, wie ihre Mutter verzweifelt in immer neue Straßen abgebogen war, um den Bahnhof unentdeckt zu erreichen. Sie kamen an einem Schrottplatz vorbei, wo unheimliche Gestalten in den Nachthimmel ragten: Riesen und Kobolde und Hexen. Aber niemand von ihnen war so böse wie die Nazis, das wußte Marika genau.
Das war alles. Als sie versuchte, sich an noch mehr zu erinnern, stieß sie auf eine Lücke, vor der sie sich fürchtete. Sie wußte nur, daß sie dann – viel später – gerannt war und daß sie Angst gehabt hatte und daß ein großes Durcheinander geherrscht hatte. Und schließlich wurde sie zusammen mit anderen Kindern in einen engen Zug gesteckt, der sie in die Schweiz brachte.
»Und dann?« fragte der Matrose sie.
Sie fuhr erschreckt auf und sah zu Bertha und Irwin und dem Matrosen hoch. Die Augen von Fremden! Wie sollte sie ihnen mehr erzählen, da ihr doch selbst alles so unklar war?
Sie floh in ihr Zimmer und verbrachte den Rest des Tages damit, die Wand anzustarren.
In dieser Nacht wälzte sich Marika unruhig im Bett herum. Es dämmerte schon fast, als sie endlich in einen ruhelosen Schlaf fiel.
Es war heiß, unerträglich heiß. Wütend heulte der Wüstenwind durch die schmalen Straßen von Brünn. Gefangen! Er spuckte Sand über die Pflastersteine, rüttelte an den Fenstern der Lagerhäuser, aber es gab kein Entkommen für ihn. Bertha hatte den Wind am Genick gepackt, und er wand sich wie ein wahnsinniger Geist aus Aladins Wunderlampe. Mit der anderen Hand hielt sie Marika fest, die sich ebenfalls zu befreien versuchte. Sie gingen zurück ... zurück ... zurück in die Tschechoslowakei und zurück in die Vergangenheit.
Das war der Schrottplatz, und der Wind trat mit seinen Hunderten von langen Beinen aus und schüttelte die Gnome und Riesen, bis sie Gnade stöhnten. Aber heute nacht gab es keine Gnade, und sie zerschellten in Stücke, die vom Sandsturm davongetragen wurden.
»In diesem Wüstenwind halten sie es keine zwei Minuten, aus«, sagte Bertha mit einer Ruhe, die einen wahnsinnig machen konnte. Sie spähten auf den Schrottplatz, und da sahen sie ein verängstigtes kleines Mädchen kauern, das vor dem Platzregen Schutz zu finden versuchte. »Nein, es ist zu spät«, sagte Bertha mit einer Stimme, die wie ein Donnerschlag klang. Der Regen hörte plötzlich auf, und die Wolken hasteten zum Horizont zurück. Marika sah, wie ihr anderes Ich wie ein verängstigtes Kaninchen zurückwich, bis es einen Türeingang erreichte, dort zu Boden sank, die Hände um die Knie schlang und auf Mama wartete.
»Nicht hier. Das ist nicht richtig«, sagte Bertha, und wieder donnerte ihre Stimme durch die Stille. Weiter ...
Jetzt schlichen sie durch die Straßen. Als sie die Ecke eines kleinen Lagerhauses erreichten, heulte ein Hund und rüttelte an seiner schweren Kette. Marika schloß fest die Augen und spürte, wie Bertha sie am Arm schüttelte.
»Hier sind wir«, sagte die Frau. »Jetzt schau, Kind, schau genau hin!«
»Nein!« schrie sie. »Ich will nicht hinschauen. Ich kann nicht. Ich will nicht, laß mich los ...«
»Wäre es dir denn lieber, wenn du es nie erfahren hättest?« Berthas Antwort dröhnte ihr wie eine Totenglocke in den Ohren.
Bertha packte sie an beiden Schultern und schüttelte sie; der Wind entkam und floh in die Wüste, zurück in die Freiheit.
»Wach auf, Marika, wach auf.« Bertha schüttelte sie noch fester.
»Ich will nicht hinschauen, ich will nicht«, schluchzte Marika und starrte zu Bertha und Irwin hoch, die sie besorgt musterten.
»Du hast es nur geträumt«, erklärte ihr Irwin stockend auf deutsch. »Hier bist du ganz sicher. Schlaf nur weiter.«
»Nein«, schluchzte Marika, »ich habe nicht nur geträumt. Es war wirklich so. Aber ich will es nicht sehen. Ich will es nicht, und ihr könnt mich nicht dazu zwingen.« Diese Worte murmelte sie auf tschechisch, und deshalb wurden sie weder von Bertha noch von Irwin verstanden. Dann grub Marika ihr Gesicht in die Kissen und lag zitternd da.
Bertha blieb stundenlang neben ihr sitzen und streichelte sie beruhigend. Erst als das Kind endlich eingeschlafen war, ging sie hinaus und legte sich erschöpft ins Bett.
Kapitel 6
Marikas Geburtstag war gekommen. Die Feier begann damit, daß Bertha die Kerzen ansteckte und Irwin den Wein segnete. Dann riefen sie: »Mazeltov, Marika!« und nahmen einen Schluck von dem süßen Portwein, den ein Schiff vom Kap mitgebracht hatte.
Zum Essen gab es zuerst Suppe mit Kneidlach, schmackhaften Klößen, dann kleine Fischkuchen und schließlich gebratenes Hähnchen mit Tzimis, einem leicht süßen Gemüse mit getrockneten Früchten. Das mochte vielleicht bei der drückenden Hitze, die herrschte, nicht gerade die beste Diät sein, aber schließlich sollte es eine würdige Feier werden.
Marika saß mürrisch und verschlossen da, starrte die gegenüberliegende Wand an und aß erst ein paar Happen, nachdem ihr Irwin lange gut zugeredet hatte.
Nach dem Essen versuchte Irwin ohne Erfolg, sie, indem er deutsch sprach, in das Gespräch einzubeziehen, während Bertha ungeniert auf englisch drauflosredete und gar nicht zu bemerken schien, daß das Mädchen sie nicht verstand. Dann schnitten sie den Kuchen an und holten die Geschenke hervor, die teils aus dem Laden stammten, teils aus der ganzen Stadt zusammengetragen waren: einen Kanarienvogel in einem Käfig, ein Paar Ballettschuhe, die eigentlich ein Kunde für seine Tochter bestellt hatte – der mußte nun eben zwei weitere Wochen warten –, eine Puppe, einige bunte Tücher und schließlich ein Necessaire mit Perlmutteinlage, das sich Bertha vor zwei Jahren selbst gekauft hatte, das ihr aber dann zu vornehm erschienen war.
Marika würdigte die Geschenke mit keinem Blick, nur den Vogel sah sie ab und zu ängstlich an.
Dann sagte Bertha zu Irwin: »Liebling, ich möchte, daß du das Marika vorliest, aber auf deutsch.« Sie zog ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus der Tasche, das vollgeschrieben war mit ihrer sauberen, klaren Schrift. »Versuch aber bitte, alles wortwörtlich zu übersetzen«, fügte sie hinzu.
Irwin sah sie mißtrauisch an. Seine Frau neigte manchmal zur Gefühlsduselei, und wenn sich die Gelegenheit dazu bot, konnte sie sogar ausgesprochen kitschig werden. Er hatte es im Gefühl, daß sich Marika durch Sentimentalitäten nicht beeindrucken lassen würde. »Bist du sicher ...«, warf er zweifelnd ein, doch Berthas Blick ließ ihn verstummen. Mit einem Achselzucken faltete er das Blatt auseinander und sagte auf deutsch: »Marika, das ist ein Brief von meiner Frau an dich. Ich werde ihn dir übersetzen, weil sie nicht Deutsch kann und du kein Englisch sprichst.« Er räusperte sich. Die Sache war ihm peinlich. Aber dann gab er sich selbst einen Stoß und begann den Brief ganz langsam und sorgfältig zu übersetzen. »Marika, ich weiß, daß du nicht gern hier bist, aber für eine Weile mußt du noch bleiben.«
Marika rührte sich nicht, sondern starrte weiter hartnäckig die Wand an.