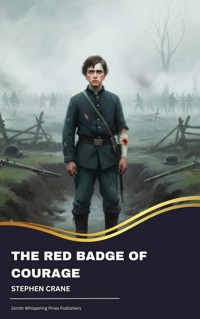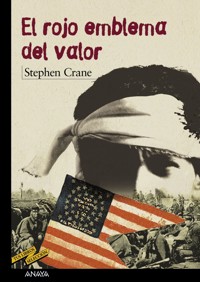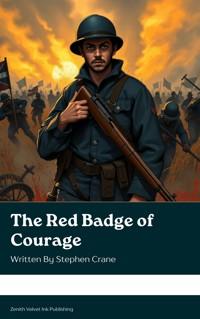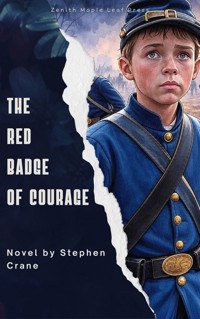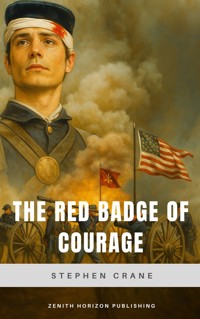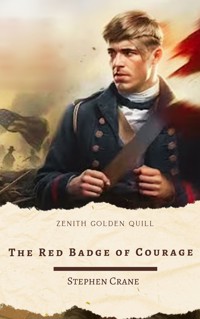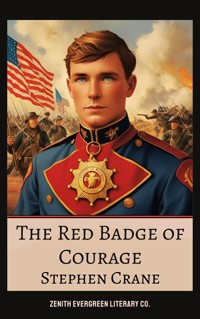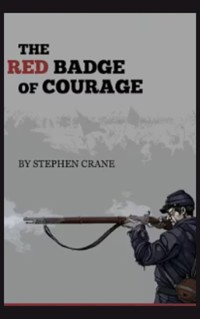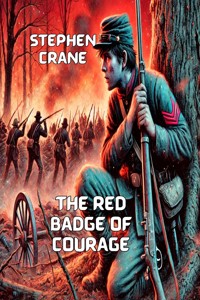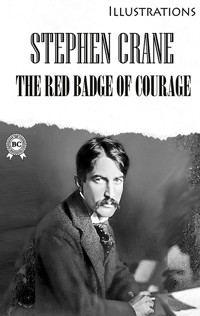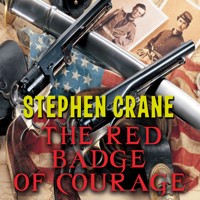Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für Ernest Hemingway eines der besten Bücher unserer Literatur Es ist ein grandioses Meisterwerk, das die Empfindungen, Sorgen und Nöte des einfachen Soldaten im amerikanischen Bürgerkrieg auslotet, Jahre bevor die Psychoanalyse Einzug in die Wissenschaften hielt. Verfasst von einem 22-jährigen Collegeabbrecher, der keine Ahnung vom Soldatenleben hatte und erst 1871, sechs Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs, geboren worden war. Cranes Stil und Dramaturgie lassen den Leser unmittelbar am Geschehen teilhaben. Als "Die rote Tapferkeitsmedaille" 1895 erschien, entwickelte sich der Roman rasch zu einem Bestseller und veränderte die Sicht auf den modernen Krieg radikal. Dieser Perspektive schlossen sich viele Autoren an, bis hin zu Erich Maria Remarque in seinem Roman "Im Westen nichts Neues".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stephen Crane • Die rote Tapferkeitsmedaille
Stephen Crane
Die rote Tapferkeitsmedaille
Übersetzt von Bernd Gockel mit einem Nachwort von Thomas Schneider und einem Crane-Portrait von Rüdiger Barth
Inhalt
Stephen Crane
Die rote Tapferkeitsmedaille
Der Veteran
Thomas F. Schneider
Am Rappahannock nichts Neues
Rüdiger Barth
Stephen Crane – ein Portrait
Die rote Tapferkeitsmedaille
1
Nur zögerlich zog sich die Kälte aus dem Boden zurück. Durch die letzten Nebelschwaden sah man eine Armee, die auf den Hügeln ihr Quartier bezogen hatte. Als sich das Braun des Morgengrauens in ein frisches Grün zu verwandeln begann, wachten auch die Soldaten auf und machten sich umgehend daran, die neuesten Gerüchte in sich aufzusaugen. Sie schauten erwartungsvoll zu den Fahrwegen am Fuß der Hügel, die gestern noch schlammigen Furchen ähnelten, inzwischen aber so weit getrocknet waren, dass man sie halbwegs passieren konnte. Ein kleiner Fluss, bernsteingelb im Schatten der Ufer, plätscherte zu ihren Füßen. In der Nacht, wenn sich das Wasser in schwermütiges Schwarz verwandelte, konnte man auf der anderen Seite das feindliche Lager erahnen. Die rot glühenden Lagerfeuer auf den Kuppen der Hügel leuchteten wie geheimnisvoll glänzende Augen, die sich durchs Dunkel bohrten.
Ein baumlanger Soldat hatte sich ein Herz gefasst und war zum Fluss hinuntergegangen, um dort sein Hemd zu waschen. Als er zurückkam, schwang er seine Kleidung wie eine Fahne. Er sprudelte eine Neuigkeit heraus, die er unterwegs von einem guten Freund aufgeschnappt hatte. Der Freund wiederum hatte sie von einem höchst verlässlichen Kavalleristen erfahren – und der seinerseits von seinem absolut glaubwürdigen Bruder, der im Hauptquartier als Offiziersbursche arbeitete.
Der Lulatsch warf sich in Pose, als sei er der offizielle Herold mit den rot-goldenen Tressen. „Morgen setzen wir uns in Bewegung“, deklamierte er lauthals und war sich gleich der allgemeinen Aufmerksamkeit sicher. Eine Handvoll Soldaten, die ihm am Aufmarschweg entgegengekommen waren, bildeten um ihn eine Menschentraube. „Wir marschieren flussaufwärts, setzen aufs andere Ufer über und greifen sie dann von hinten an.“
Es war ein meisterhaftes Manöver, das er vor seinen Zuhörern bis ins kleinste Detail ausmalte. Als er die geplanten Truppenbewegungen erschöpfend geschildert hatte, teilten sich die blau-uniformierten Männer in kleinere Gruppen auf und diskutierten die Nachricht.
Ein farbiger Fuhrmann, der zuvor, lautstark angefeuert von rund vierzig Soldaten, auf einer Kommissbrot-Kiste getanzt hatte, musste enttäuscht mitansehen, dass sich sein Publikum aufgelöst hatte. Missmutig hockte er auf seiner Kiste. Aus den bröckelnden Schornsteinen der baufälligen Hütten kringelte unschlüssig dünner Rauch.
„Das ist ’ne Lüge, ’ne hundselende Lüge“, schrie ein junger Gefreiter. Sein rosiges Gesicht war vor Zorn errötet, seine geballten Fäuste steckten tief in den Hosentaschen. Der Schreihals machte den Eindruck, als fasse er die Neuigkeit als persönliche Provokation auf. „Ich glaub nicht eine Minute lang, dass die verdammte Armee sich auch nur ’nen Zoll bewegen wird. Wir sitzen hier fest. Acht Mal in den letzten zwei Wochen sollte der Marschbefehl kommen und nix ist passiert.“ Der Lulatsch fühlte sich aufgerufen, die Glaubwürdigkeit des Gerüchts zu verteidigen, das er eigenhändig in die Welt gesetzt hatte. Er war drauf und dran, sich mit dem Schreihals zu prügeln.
Ein Korporal lenkte die Aufmerksamkeit auf sich, als er lauthals zu fluchen begann. Er hatte teure Holzdielen in seiner Hütte verlegen lassen. Zu Beginn des Frühjahrs hatte er noch Abstand davon genommen, Geld in die Verschönerung seiner Behausung zu stecken; schließlich hatte er jeden Tag mit dem Marschbefehl gerechnet. In jüngster Zeit hingegen hatte sich eher der Eindruck verfestigt, als sei ihr Lager für die Ewigkeit bestimmt.
Die meisten Anwesenden engagierten sich in hitzigen Diskussionen. Der eine erläuterte in besonders wortreicher Weise die Pläne ihres Kommandanten, andere hingegen behaupteten, die vermeintlichen Pläne seien nur Schall und Rauch. Sie schrien und zeterten und versuchten vergeblich, irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Der Lulatsch, der die Neuigkeit in Umlauf gebracht hatte, stolzierte mit stolzgeschwellter Brust umher und ließ sich immer wieder die gleiche Frage stellen: „Erzähl’s uns nochmal, Jim. Was genau weißt du?“
„Die Armee wird morgen aufbrechen.“
„Wie kommst du bloß auf so’n Mist? Wer hat dir den Blödsinn ins Ohr geflüstert?“
„Ob du’s glaubst oder nicht, ist mir völlig egal. Ich scher mich ’nen Dreck um deine Meinung.“
Die Art und Weise, wie er das sagte, war so überzeugend, dass einige Zuhörer erneut ins Grübeln kamen. Er sprach mit einer derartigen Überzeugungskraft, dass die fehlenden Beweise nicht mal mehr in die Waagschale fielen. Allein die Vorstellung, bald könne etwas passieren, sorgte für gespannte Aufregung.
Unter ihnen war auch ein junger Rekrut, der den Ausführungen des langen Soldaten ebenso aufmerksam gefolgt war wie den Kommentaren seiner Kameraden. Nachdem er alles nur Erdenkliche über Aufmärsche und Angriffsmanöver erfahren hatte, ging er zu seiner bescheidenen Behausung und kroch durch das Loch, das ihm als Tür diente. Er wollte allein sein mit sich und den Gedanken, die zuletzt seinen Kopf beschäftigt hatten.
Er legte sich auf eine breite Pritsche, die den hinteren Teil des Raumes ausfüllte. Vorne im Zimmer, gleich vorm Feuerplatz, standen ein paar leere Brotkisten, die als notdürftiges Mobiliar dienten. An der Holzwand hing ein Foto aus einer illustrierten Wochenzeitschrift. Drei Gewehre lagen auf parallel angebrachten Holzdübeln, weitere Teile seiner Ausrüstung auf allem, was irgendwie als Ablage dienen konnte. Auf einem Stapel mit aufgeschichteten Scheiten standen ein paar Blechteller. Ein zusammengefaltetes Zelt diente als Dach; wenn man es hochklappte, füllte die Sonne den Raum mit einem fahlgelben Licht. Ein kleines Fenster mit hellerem Licht warf ein schiefes, weißes Quadrat auf den mit Abfällen übersäten Fußboden. Der Rauch vom Feuerplatz scheute den Weg durch den Schornstein und machte sich lieber im Zimmer breit. Dieser brüchige Schornstein aus Lehm und Stöcken drohte unendlich oft, die ganze Einrichtung in Brand zu setzen.
Der Junge befand sich in einem Zustand zwischen Trance und Ungläubigkeit. Waren sie wirklich drauf und dran, in den Krieg zu ziehen? Vielleicht schon am morgigen Tag konnte es eine Schlacht geben und er würde dabei sein! Zeitweise musste er sich regelrecht zwingen, der neuen Realität ins Auge zu schauen. Er wollte noch immer nicht mit letzter Konsequenz dran glauben, dass er an einer der großen Entscheidungen der Menschheitsgeschichte beteiligt sein sollte.
Sicher, er hatte sein ganzes Leben lang von Schlachten geträumt – von vagen, aber stets blutigen Kämpfen, die ihn mit ihrem Getümmel und den krachenden Salven stets fasziniert hatten. Er hatte sich selbst in vielen dieser Schlachten kämpfen sehen – oder aber geträumt, wie die vom Krieg geschundenen Menschen im Schatten seines brillanten, couragierten Kommandos endlich Sicherheit und Frieden fanden. Doch wenn er sich im Wachzustand befand, waren die Schlachten nicht mehr als blutrote Tropfen in den Annalen der Geschichte. Genau wie goldene Kronen und prächtige Paläste gehörten sie zu Relikten aus einer anderen, längst abgeschlossenen Epoche. Er war sich sicher, dass es in der Vergangenheit eine Zeit der großen Kriege gegeben haben musste, glaubte aber gleichzeitig, dass diese Ära unwiderruflich vorbei war.
Noch im Elternhaus lebend, hatte er dem Krieg im eigenen Land herzlich wenig abgewinnen können. Er erschien ihm wie eine unechte Inszenierung, die mit den heroischen Kriegen der alten Griechen nicht zu vergleichen war. Schlachten wie damals, sagte er sich, würde es niemals mehr geben. Die Menschen waren klüger geworden, vielleicht auch ängstlicher. Die weltliche wie geistige Entwicklung hatte die Raubtier-Reflexe der Menschheit zunehmend eingedämmt. Vielleicht waren es ja auch finanzielle Interessen, die den ungefilterten Aggressionen inzwischen im Wege standen.
Trotzdem hatte er mehrfach den brennenden Wunsch verspürt, sich der Armee anzuschließen. Überall schwärmten die Leute atemlos von den gewaltigen Heerscharen, die durchs Land zogen. Es waren vielleicht nicht gerade die heroischen Helden, die Homer erlebt hatte, doch es gab keinen Zweifel, dass diese Schlachten noch immer ruhmreiche Herausforderungen waren. Er hatte von Gewaltmärschen gelesen, von Belagerungen und dramatischen Konfrontationen und wünschte nichts mehr, als Teil dieser dramatischen Kämpfe zu sein. Seine Fantasie hatte für ihn eindrucksvolle Schlachtszenen gemalt, die in grellen Farben und reißerischen Darstellungen geradezu schwelgten.
Doch seine Mutter hatte ihn schnell wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt. Für seinen vermeintlichen Patriotismus und die romantische Verklärung des Kriegs hatte sie überhaupt kein Verständnis. Ruhig setzte sie sich neben ihn und zählte hunderte von Gründen auf, warum er auf ihrer Farm weitaus wichtiger sei als auf dem Schlachtfeld. Die resolute Art und Weise, wie sie ihre Argumente vortrug, ließen keinen Zweifel daran, dass sie von ihrem Standpunkt fest überzeugt war. Und eines musste er seiner Mutter lassen: Wie immer waren ihre moralischen Motive über jeden Zweifel erhaben.
Und doch hatte er sich irgendwann davon überzeugt, die prallen Farben des Lebens nicht von kleinmütigen Zweifeln schmälern zu lassen. Die Nachrichten in den Zeitungen, das Gerede im Dorf, seine eigenen Fantasien – sie alle hatten ihn in einen unkontrollierbaren Zustand versetzt. Und obendrein lief es ausgezeichnet für die Soldaten der Union. Fast täglich berichteten die Zeitungen von spektakulären Siegen.
Eines Abends zu später Stunde lag er im Bett und hörte, wie der Wind das Läuten der Kirchenglocke an sein Ohr trug. Der Mensch, der am Glockenseil zog, musste außer Rand und Band sein, weil er offensichtlich den Sieg in einer wichtigen Schlacht zu vermelden hatte. Die grenzenlose Freude der Bevölkerung, die sich in dieser Weise manifestierte, hatte bei ihm eine Gänsehaut ausgelöst, die überhaupt nicht mehr verschwinden wollte. Noch in derselben Nacht war er ins Zimmer seiner Mutter gegangen und hatte gesagt: „Ma, ich lass mich verpflichten.“
„Henry, sei kein Narr“, hatte sie nur gesagt und dann eine Decke gegen ihr Gesicht gepresst. Das war alles, was in jener Nacht noch gesagt wurde.
Ohne noch weiter mit ihr zu reden, war er am nächsten Tag ins naheliegende Städtchen marschiert und hatte sich bei der Kompanie eintragen lassen, die gerade zusammengestellt wurde. Als er nach Hause kam, war seine Mutter damit beschäftigt, ihre gescheckte Kuh zu melken. Vier weitere Kühe standen in der Reihe und warteten. „Ma, ich hab mich verpflichtet“, sagte er verlegen. Für einen Moment herrschte atemlose Stille. „Sein Wille möge geschehen, Henry“, hatte sie schließlich geantwortet und weiter die Kuh gemolken.
Als er dann später im Türrahmen stand, den Tornister mit seiner Uniform über der Schulter, hatten seine erwartungsvoll glänzenden Augen jeden Anflug von Heimweh im Keim erstickt, auch wenn ihm die zwei Tränen nicht verborgen blieben, die auf den vernarbten Wangen seiner Mutter hinunterliefen.
Und trotzdem war er fast schon enttäuscht, dass seine Mutter nicht den Satz sprach, den Mütter in solchen Situationen doch eigentlich immer zu sagen pflegten: dass er hoffentlich mit seinem Schild heimkehren werde und nicht aufgebahrt auf seinem Schild. Er hatte sich im Stillen schon auf die Szene vorbereitet und ein paar gefühlvolle Sätze zurechtgelegt, doch ihre erstaunlich lebenstüchtige Ansprache sollte all seine guten Absichten zunichtemachen.
„Nu pass mal gut auf, mein Junge“, sagte sie, während sie Kartoffeln schälte. „Glaub mir nur ja nicht, du könntest ’ne ganze Rebellenarmee im Alleingang vernaschen. Du bist nur ’ne kleine Nummer und solltest besser die Klappe halten. Und tu, was man dir sagt. Ich kenn dich ja gut genug, Henry.
Acht Paar Socken hab ich dir gestrickt und auch die guten Hemden eingepackt. Mein Junge soll’s genauso warm und wohlig haben, wie’s nur irgend geht. Und wenn du Löcher drin hast, schick sie heim, dann kann ich sie stopfen.
Überleg dir immer gut, mit wem du dich einlässt. In der Armee gibt’s ’ne Menge schlimme Gestalten und der Krieg macht sie nur noch schlimmer. Die warten doch nur auf dumme Jungs wie dich, die ihr ganzes Leben daheim bei Mama verbracht haben. Diese Kerle tun doch nichts lieber, als dich zum Saufen und Fluchen zu verführen. Und im Nu bist du auf der schiefen Bahn. Schlag einen weiten Bogen um diese Leute, Henry. Und tu nichts, für das du dich schämen würdest, wenn ich davon wüsste. Stell dir einfach vor, ich würd dir immer über die Schulter schauen. Wenn du all das befolgst, haben wir vielleicht Glück und du kommst heil zurück.
Und vergiss nicht deinen Vater, Junge. Nie im Leben hat er ’nen Tropfen Alkohol angerührt und nur ganz selten beim Schwören den Herrgott als seinen Zeugen aufgerufen.
Ich weiß nicht, was ich dir sonst noch sagen soll, Henry. Nur eins noch: Denk nicht an mich, wenn’s einmal haarig werden sollte. Du darfst dich nie vor der Verantwortung drücken. Ob du nun ums Leben kommst oder selbst was Schlimmes tun musst – denk immer daran, dass du nur das tust, was richtig ist. Es gibt ’ne Menge Frauen, die heutzutage damit klarkommen müssen. Am Ende des Tages wird der Herrgott schon auf uns aufpassen.
Und vergiss nicht, die Socken und Hemden zu schicken, wenn sie Löcher haben, Junge. Ich hab dir noch ’n Glas von der Brombeerkonfitüre eingepackt, die du so gerne magst. Und nun leb wohl, Henry. Pass auf dich auf und sei ein guter Junge.“
Natürlich war er ungeduldig geworden, als er sich ihre Predigt hatte anhören müssen. Er hatte etwas anderes von ihr erwartet und wusste nicht so recht, wie er auf die Ansprache reagieren sollte. Als er sich umdrehte und ging, fühlte er fast so was wie Erleichterung.
Doch als er sich am Tor noch einmal umdrehte, sah er sie, wie sie inmitten der Kartoffelschalen kniete. Ihr braunes Gesicht, von Tränen benetzt, war zum Himmel erhoben, ihr schmächtiger Körper zitterte. Er senkte seinen Kopf und ging weiter, plötzlich belastet von dem üblen Gefühl, sich für sein Verhalten schämen zu müssen.
Von seinem Haus aus war er als Erstes zur Schule gegangen, um sich von seinen Klassenkameraden zu verabschieden. Sie hatten ihn voller Bewunderung umringt. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er sich überlegen gefühlt, was ihn unsagbar stolz machte. Er und die anderen Schüler, die sich für die blaue Uniform entschieden hatten, wurden den ganzen Nachmittag mit Vorschusslorbeeren überhäuft. Kein Zweifel: Es war eine überwältigende Erfahrung. Alle Rekruten liefen mit stolzgeschwellter Brust durch die Schule.
Ein blondes Mädchen trübte die Stimmung, als es sich über seine Kriegsbegeisterung lustig machte, doch er hatte ohnehin ein Auge auf ein anderes, dunkelhaariges Mädchen geworfen. Als sie ihn in seiner Uniform anschaute, glaubte er in ihrem Gesicht Ernst und Melancholie entdecken zu können. Beim Herausgehen, als er die Einfahrt zwischen den Eichenbäumen passierte, hatte er sich noch einmal schnell umgedreht und bemerkt, wie ihre Augen ihn vom Fenster aus verfolgten. Als sich ihre Blicke kreuzten, war sie zusammengezuckt und schaute nun durch die Baumkronen zum Himmel hinauf. Ihm blieb nicht verborgen, dass sie sich unnatürlich nervös und fahrig verhielt. Er sollte noch oft über diesen Vorfall nachdenken.
Auf der Fahrt nach Washington hatte sich seine Stimmung nur noch weiter verbessert. An fast jedem Bahnhof umringten Zivilisten die Waggons, drückten den Rekruten Essbares in die Hand oder wünschten ihnen alles Gute. Die Flut von Brot, Wurst, Kaffee, Gürkchen und Käse war so überwältigend, dass er sich bereits wie ein gefeierter Held fühlte. Als ihn die Mädchen umschwärmten und ihm die alten Männer auf die Schulter klopften, wuchs in ihm der Glaube, endlich am Ziel seiner Träume angelangt zu sein.
Langwierige Truppentransporte folgten, ständig von Zwischenstopps unterbrochen, dann lange Monate im Lager, die mit jedem Tag monotoner und stumpfsinniger wurden. Er hatte immer geglaubt, der Krieg sei eine endlose Aneinanderreihung von Kämpfen auf Leben und Tod, nur kurz unterbrochen von Schlafen und Essen. Doch tatsächlich hatte sein Regiment seit Monaten nichts anderes getan, als untätig auf dem Hügel zu hocken und in der Kälte des Winters nicht zu erfrieren.
Das Warten hatte ihm die Zeit gegeben, sich wieder mit seinen alten Theorien zu beschäftigen: Schlachten, wie sie die alten Griechen schlugen, würde es nie wieder geben; die Menschen waren intelligenter geworden, vielleicht aber auch ängstlicher; Erziehung und Religion hatten den animalischen Instinkten der Menschheit ihre Zähne gezogen. Und wenn das immer noch nicht reichte, gab es elementare finanzielle Interessen, die sich den hemmungslosen Leidenschaften in den Weg stellten.
Er hatte gelernt, sich selbst nur als unbedeutender Teil einer großen blauen Bewegung zu verstehen. Seine hauptsächliche Betätigung bestand inzwischen darin, sich um sein persönliches, alltägliches Wohlbefinden zu sorgen. Ansonsten konnte er nur Däumchen drehen und darüber grübeln, was wohl gerade in den Köpfen der Generäle vor sich ging. Darüber hinaus gab es nur Drills, noch mehr Drills und die abschließende Benotung. Wieder Drills, wieder Noten.
Die einzigen Gegner, die er je gesehen hatte, waren die feindlichen Wachen, die am anderen Ufer postiert waren. Es waren joviale, sonnengebräunte Männer, denen manchmal auch ein ungewollter Schuss rausrutschen konnte. Wenn sie anschließend vom blauen Ufer drauf angesprochen wurden, entschuldigten sie sich meist und schworen bei ihren Göttern, die Flinten seien von ganz allein losgegangen. Henry, der eines Nachts auch einmal Wache schieben musste, kam mit einem der Südstaatler ins Gespräch. Es war ein etwas runtergekommener Gesell, der aber ein gutmütiger Gernegroß war und obendrein punktgenau zwischen seine Stiefel spucken konnte. Henry schloss ihn umgehend ins Herz.
„Hey Yank“, rief es vom anderen Ufer herüber, „ich glaub, du hast das Herz am richtigen Fleck.“ Es waren Worte, vom lauen Wind über den Fluss geweht, die ihn für einen kurzen Moment am Sinn des Krieges zweifeln ließen.
Einige Veteranen hatten ihm ganz andere Geschichten aufgetischt. Sie beschrieben graue, backenbärtige Horden, die wüst fluchend vorwärtsmarschierten und dabei wild entschlossen Kautabak spuckten. Es waren im Feuer gestählte Kriegsmaschinen, die – wie anno dazumal die Hunnen – alles unter sich zermalmten, was ihnen in den Weg kam. Andere wiederum erzählten von zerlumpten, ausgehungerten Jammergestalten, die nicht mal mehr geradeaus schießen konnten. „Für ’nen Brotbeutel reiten die durch Feuer und Schwefel“, erzählte man ihm. „Fragt sich nur, wie lange ihre Gedärme das noch mitmachen.“ Hörte er solche Geschichten, stellte er sich unwillkürlich rohe, blutige Knochen vor, die durch die Löcher ihrer zerschlissenen Uniformen ragten.
Unterm Strich wollte er sich aber auf den Wahrheitsgehalt dieser Schnurren nicht verlassen. Er lernte schnell, dass die Veteranen allen möglichen Humbug auftischten, um sich bei den Rekruten wichtigzumachen. Sie schwätzten viel von Feuer, Blut und den Rauchwolken der abgefeuerten Salven, doch er konnte beim besten Willen nicht überprüfen, was gelogen war und was nicht. Sie nannten ihn auch immer nur „Frischling“ – was sie in seinen Augen nicht gerade sympathischer machte.
Immerhin lernte er nun, dass es keine entscheidende Rolle spielte, gegen welche Art von Soldaten er kämpfen würde. Dahinter versteckte sich eine zweite Frage, die ihm viel mehr auf dem Magen lag. Er legte sich auf seine Pritsche, um der Frage auf den Grund zu gehen. Wusste er wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit, dass er im Zweifelsfall nicht türmen würde?
Bisher war er nie gezwungen gewesen, sich mit dieser Frage intensiver zu beschäftigen. In seinem Leben hatte er grundlegende Dinge nie infrage gestellt und immer den Triumph am Ende des Weges vor Augen gehabt. Wie er dieses Ziel erreichen wollte, war dagegen nie von Belang gewesen. Aber nun war er mit einer Frage konfrontiert, der er so einfach nicht ausweichen konnte. Aus heiterem Himmel war ihm die Erkenntnis gekommen: Ich kann nicht ausschließen, dass ich im Zweifelsfall wirklich Reißaus nehme. Er musste sich eingestehen, dass er, was den Krieg anging, herzlich wenig über sich wusste.
Noch vor kurzem hätte er seinem Bewusstsein erlaubt, das ungeliebte Problem kurzerhand auszublenden, doch nun fühlte er instinktiv, dass er sich der Frage wohl oder übel stellen musste.
Eine wachsende Panik machte sich in ihm breit. Wenn er sich konkret einen Zweikampf vorzustellen versuchte, fand er in keiner der möglichen Varianten wirklichen Trost. Er konnte sich einfach nicht ausmalen, dass er inmitten tödlicher Bedrohungen wie ein Fels in der Brandung stehen würde. Er versuchte sich an die glorreichen Fantasien zu erinnern, die er in früheren Jahren umarmt hatte, ahnte aber, dass sie im Rahmen des nahenden Ernstfalls keinen Bestand haben würden.
Er sprang vom Bett hoch und lief aufgeregt hin und her. „Großer Gott, was ist bloß los mit mir?“, fragte er laut.
Er fühlte, dass seine bisherigen Kenntnisse der menschlichen Natur für die Bewältigung dieser Krise nicht ausreichend waren. Was immer er über sich gelernt hatte, spielte plötzlich keine Rolle mehr. Er war sich selbst eine unbekannte Größe.
Je länger er drüber nachdachte, umso mehr verstand er, dass er sich einer ernsthaften Prüfung unterziehen musste – ganz so, wie er es schon in früheren Jahren getan hatte. Er musste Informationen über sich selbst sammeln, entschloss sich aber auch, diese Gedanken zunächst unter Verschluss zu halten. Er wollte sich in den Augen der Kameraden nicht gleich lächerlich machen, sollte bei seiner Selbsterforschung noch unerquicklicher Ballast zutage gefördert werden. „Großer Gott!“, stöhnte er noch einmal auf.
Plötzlich hörte er Geräusche vom Eingang seiner Hütte. Der Lulatsch kroch erstaunlich beweglich durchs Loch, gefolgt von dem Schreihals. Sie waren natürlich am Streiten.
„Ist ja alles gut und schön“, schimpfte der Soldat beim Eintreten, „du kannst mir glauben oder nicht. Setz dich einfach nur auf deinen Hosenboden und wart’s ab. Wirst schon bald kapieren, dass ich recht hatte.“
Der Gefreite grunzte widerwillig. Für einen Moment schien er nach einer passenden Antwort zu suchen. „Du meinst wohl, du weißt alles, was in der Welt so vor sich geht“, grummelte er schließlich.
„Ich sach nich, dass ich alles weiß“, gab der Soldat bissig zurück. Er begann damit, verschiedene Gegenstände sorgsam in seinem Tornister zu verstauen.
Der Junge hatte sich gesetzt und beobachtete den Soldaten, der noch immer auf dem Boden beschäftigt war. „Dann wird’s also ’ne richtige Schlacht geben, Jim?“, fragte er ihn.
„Da kannst du Gift drauf nehmen“, war die Antwort. „Natürlich wird es die geben. Wart nur bis morgen und du wirst eine der größten Schlachten erleben, die die Welt je gesehen hat. Wart’s nur ab.“
„Wahnsinn“, sagte der Junge.
„Du wirst Kämpfe seh’n, mein Junge, Kämpfe, wie du sie noch nie gesehen hast.“ Der Soldat sprach mit der Miene des Kenners, der seinen Kameraden gerade das ABC des Krieges erklärt.
„Hach!“, kam es aus der Ecke, wo der Gefreite inzwischen Platz genommen hatte.
„Nun ja“, sagte der Junge. „Hoffen wir, dass diese Geschichte nicht genauso im Sand verläuft wie all die andern auch.“
„Da mach dir mal keine Gedanken“, antwortete der Soldat und wurde zusehends ungeduldiger. „Hat sich die Kavallerie nicht heut Morgen schon auf den Weg gemacht?“ Er starrte seine jungen Kameraden an, die zustimmend nickten. „Es heißt, dass es kaum noch einen Kavalleristen im ganzen Lager gibt. Sie reiten nach Richmond, wo die Rebellen ihr Hauptquartier haben. Ist alles aber nur eine clevere Finte. Und die Fußtruppen bekommen auch schon ihre Order. Ein Freund, der im Hauptquartier war, hat mir gerade eben erst davon erzählt. Und überall im Lager wird’s auch schon heiß diskutiert. Kannst dich davon ja selbst überzeugen.“
„Dummes Gedöns“, knurrte der Schreihals.
Henry sagte für eine Weile nichts und wandte sich dann an den langen Soldaten. „Jim?“
„Was is?“
„Was glaubst du, wie sich unser Regiment schlagen wird?“
„Och, wenn sie erst mal in Fahrt gekommen sind, werden sie schon ’nen beherzten Kampf abliefern“, sagte er bedächtig. Er tat ganz so, als sei er ein distanzierter Beobachter. „Natürlich werden sich die Veteranen erst mal über die Frischlinge lustig machen, aber ich denk, dass sie irgendwann schon die Kurve kriegen.“
„Glaubst du, dass sich der eine oder andere durch die Büsche macht?“, wollte der Junge wissen.
„Klar, ein paar werden die Beine in die Hand nehmen, aber die gibt’s in jedem Regiment, vor allem, wenn sie zum ersten Mal unter Beschuss kommen. Kann natürlich auch sein, dass die ganze Bagage türmt, wenn’s ans Eingemachte geht. Kann aber auch sein, dass sie sich keinen Zoll rühren und sogar feste auf die Pauke hauen. Kann man vorher nie wissen. In jedem Fall werden sie die ganze Rebellenarmee nicht gleich komplett verdreschen. Einige kämpfen besser als andere, einige schlechter, wenn du mich fragst. Sie nennen’s nicht ohne Grund ,Das Frischlings-Regiment‘, aber die Jungs sind nicht von schlechten Eltern und werden schon wissen, wo’s langgeht.“
„Die meisten von ihnen werden kämpfen bis zum Umfallen“, fügte er noch an. „Aber erst muss die Schießerei mal losgehen.“ Seinen letzten Worten gab er eine besondere Betonung.
„Was für ein Blödsinn“, meldete sich der Schreihals wieder zu Wort. „Du hast ja von Tuten und Blasen keine Ahnung.“
Der Lulatsch drehte sich empört um. Sie hatten einen kurzen, bösartigen Wortwechsel, bei dem sie sich wüste Beschimpfungen an den Kopf warfen.
Irgendwann wurde es Henry zu viel. „Bist du jemals selbst getürmt, Jim?“, fragte er in die Runde. Als die Worte seinen Mund verlassen hatten, lachte er laut, als habe er die Frage natürlich nur scherzhaft gemeint. Auch der Schreihals in der Ecke konnte sich ein Kichern nicht verkneifen.
Der Lulatsch machte eine abwehrende Handbewegung. „Nun ja“, sagte er ernsthaft, „in einigen Gefechten dachte ich mir, Jim Conklin, das ist zu heiß für dich. Und wenn sich die anderen Jungs aus dem Staub gemacht hätten, wär ich natürlich auch abgehauen. Und glaub mir: Ich wär sogar schneller gerannt als jeder andere. Aber wenn alle tapfer kämpfen, kämpfe ich mit. So wahr mir Gott helfe. Darauf kannste dich verlassen.“
„Hach!“ Der Schreihals konnte sich seinen Senf nicht verkneifen.
Henry hingegen war dankbar, dieses ehrliche Eingeständnis gehört zu haben. Heimlich hatte er befürchtet, dass alle Rekruten das Selbstbewusstsein in Person seien. Dass auch gestandene Veteranen seine Sorgen teilten, war für ihn eine beruhigende Erfahrung.
2
Am nächsten Morgen erfuhr der Junge, dass sein baumlanger Freund einer Ente aufgesessen war. Von denen, die seine Ankündigung vorbehaltlos geglaubt hatten, musste er sich so manche Rüge anhören; diejenigen, die ihn ohnehin für einen Schwätzer hielten, hatten für ihn allenfalls ein abschätziges Kopfschütteln übrig. Prompt legte sich der Gescholtene mit einem Mann aus Chatfield Corners an und verprügelte ihn nach Strich und Faden.
Für den Jungen hatte sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Im Gegenteil: Die Lösung seines Problems war nun noch weiter in die Zukunft verlagert worden. Der Vorfall und die neu entfachten Fragen hatten eigentlich nur zur Folge, dass er wieder ein anonymes Rädchen im Rahmen der „blauen Streitkräfte“ war.
Tagelang versuchte er, eine Antwort auf seine Fragen zu finden, musste sich aber schließlich die Aussichtslosigkeit seiner Bemühungen eingestehen. Erst wenn er mitten im Feuerhagel stehen würde, konnte er auf eine befriedigende Antwort hoffen. Er brauchte eigentlich nur seine Beine beobachten: Würden sie laufen oder im Kampf mit dem Gegner keinen Zoll zurückweichen? In seiner Hütte hingegen, allein mit seinen Gedanken, würde ihm niemand diese Fragen beantworten. So wie ein Chemiker nicht ohne seine Elemente und ihre Reaktionen leben konnte, brauchte er den Kampf, die Gefahr und den Kugelhagel, um sich selbst auf den Grund zu kommen. Was fehlte, war eigentlich nur noch die passende Gelegenheit.
In der Zwischenzeit beließ er es dabei, seine eigenen militärischen Qualitäten mit denen der Kameraden zu vergleichen. Der Lulatsch beispielsweise, den er bereits seit seiner Kindheit kannte, war für ihn immer ein Muster des gesunden Selbstvertrauens gewesen. Und doch: Wenn er sich mit dem langen Jim verglich, sah er dort eigentlich nichts, das er sich nicht selbst zugetraut hätte. Er hatte obendrein die dunkle Vermutung, dass sein Kamerad die eigenen Qualitäten stark überschätzte. Andererseits war es natürlich ebenso gut möglich, dass Jim – in Frieden und Mittelmaß aufgewachsen – erst den Krieg brauchte, um zu glänzen.
Nur allzu gerne hätte der Junge einen anderen Soldaten kennengelernt, der ähnliche Selbstzweifel hegte wie er. Ein freundschaftlicher Austausch ihrer Erfahrungen hätte ihm ungemein viel bedeutet.
Gelegentlich machte er den Versuch, einen Kameraden mit suggestiven Bemerkungen aus der Reserve zu locken. Bewusst hielt er nach Kandidaten Ausschau, die möglicherweise mit den gleichen Beklemmungen zu kämpfen hatten wie er. Doch alle Versuche schlugen fehl. Andererseits wollte er seine Selbstzweifel auch nicht an die große Glocke hängen. Er hatte die begründete Besorgnis, dass ihn ein offenes Geständnis nur in aller Öffentlichkeit bloßgestellt hätte.
Was die Beurteilung seiner Kameraden anging, schwankte er ständig zwischen zwei Extremen und die wiederum waren stark von seinem eigenen Gemütszustand abhängig: Manchmal hatte er den Eindruck, in ihnen ausnahmslos strahlende Helden zu sehen. Er vermutete auch, dass viele den Krieg als Sprungbrett nutzten, um ihre Heldenhaftigkeit noch weiter zu steigern. Er konnte sich durchaus vorstellen, dass viele von ihnen tapfer und heroisch waren, selbst wenn sie ansonsten ein eher unauffälliges Leben führten. Auch wenn er eine Menge von ihnen seit seiner Kindheit kannte, fragte er sich, ob er seine alten Freunde womöglich immer unterschätzt habe. Dann wiederum gab es Momente, in denen er derartige Theorien komplett über Bord warf und sich sicher war, dass sie innerlich genauso zitterten und bebten wie er.
Er fühlte sich deplatziert in der Gegenwart von Männern, die in einer anstehenden Schlacht nichts weiter sahen als ein aufregendes Schauspiel, dem man mit Spannung entgegensah. Doch wenn er dann die geifernde Begeisterung in ihren Gesichtern sah, fragte er sich schon, ob es in Wahrheit nicht Lügner seien.
Fällte er ein derartiges Urteil, ging er umgehend aber auch mit sich selbst hart ins Gericht. Manchmal überkamen ihn Vorwürfe, und er attestierte sich dann Verbrechen gegen die Götter der Tradition.
Es war seiner inneren Unruhe auch nicht zuträglich, dass die Generäle eine, wie er meinte, unerträgliche Unentschlossenheit an den Tag legten. Anscheinend bestand ihre einzige Funktion darin, ein idyllisches Sommercamp am Flussufer zu organisieren. Wussten diese Leute denn nicht, dass die Last auf seinen Schultern immer erdrückender wurde? Er wollte einfach eine Entscheidung, unabhängig davon, wie das Resultat aussehen würde. Manchmal wuchs die Wut auf seine Kommandanten dabei so rapide, dass er schimpfend durchs Lager lief – ganz so, als sei er ein gereizter, abgestumpfter Veteran.
Doch dann, eines Morgens, stand er plötzlich in Reih und Glied. Die Männer seines Regiments flüsterten sich neue Gerüchte zu oder wärmten die alten auf. Im Dämmerlicht des Morgengrauens erhielten ihre Uniformen einen fast schon violetten Glanz. Auf der anderen Seite des Ufers waren die roten Augen noch immer auf der Wacht. Im Osten rollte der Himmel einen gelben Teppich für die aufgehende Sonne aus. Die gigantische Gestalt eines Colonels auf einem ebenso gigantischen Pferd lieferte dazu einen Kontrast wie ein schwarzer Scherenschnitt.
Irgendwo in der Dunkelheit sah der Junge die Schatten von dämonischen Monstern und hörte Geräusche, die von trampelnden Füßen zu stammen schienen. Das Regiment hingegen bewegte sich nicht, sondern trat für eine Ewigkeit auf der Stelle. Der Junge wurde zunehmend ungeduldig.
Als er in die Runde blickte und die unheilschwangere Atmosphäre zu verarbeiten suchte, verstärkte sich seine Ahnung, dass die ferne Bedrohung im Nu über sie hereinbrechen könnte und der Abmarsch tatsächlich bevorstand. Als er zu den rot glühenden Augen auf dem anderen Ufer schaute, schienen sie ständig größer zu werden, um schließlich einer Phalanx angsteinflößender Drachen Platz zu machen. Er drehte sich zu dem Colonel um und sah, wie er seinen gigantischen Arm hob, um mit den Fingern seinen Schnurrbart zu zwiebeln.
Schließlich hörte er vom Fuße des Hügels die vertrauten Geräusche eines galoppierenden Pferdes. Es war offensichtlich der Bote, der den offiziellen Marschbefehl überbrachte. Der Junge beugte sich nach vorne, um die Szene zu verfolgen. Er atmete schwer. Das Klackern der Hufe, das lauter und lauter wurde, schien den Takt seines Herzens vorzugeben. Der Reiter, das Gewehr über der Schulter baumelnd, zügelte sein Pferd, bis er vor dem Colonel zum Halt kam. Die beiden hatten eine militärisch knappe Unterredung. Die Männer in den ersten Reihen reckten ihre Hälse.
Als der Reiter sein Pferd wieder herumriss und davongaloppierte, drehte er sich noch einmal um und rief: „Und vergessen Sie die Kiste mit den Zigarren nicht!“ Der Colonel gab eine unverständliche Antwort. Der Junge fragte sich, was wohl eine Zigarrenkiste im Krieg verloren hatte.
Im nächsten Moment setzte sich das Regiment in Bewegung und marschierte los, einem vielbeinigen Fabelwesen nicht unähnlich. Kalter Tau lag in der Luft. Das nasse Gras unter ihren Füßen raschelte wie Seide.
Auf dem Rücken des kriechenden Reptils blitzte manchmal ein Stück Stahl auf, akustisch untermalt von dem Knarren der fahrbaren Kanonen.
Während sie vorwärts stolperten, spekulierten die Männer noch immer über das Ziel des Marsches. Einmal rutschte ein Mann aus und fiel auf den Boden. Als er gerade sein Gewehr aufheben wollte, trat ihm sein Nachbar ungewollt auf die Hand. Der Mann mit den lädierten Fingern schrie laut auf, erntete von seinen Kameraden aber nur ein spöttisches Kichern.
Man hatte inzwischen einen breiteren Feldweg erreicht und marschierte nun mit verschärftem Tempo. Im Dunkel sah man die Schatten eines anderen Regiments vor sich, während die Geräusche in ihrem Rücken keinen Zweifel daran ließen, dass ihnen ein weiteres Regiment folgte.
Das flüchtige Gelb des nahenden Tages verschwand in ihrem Rücken. Als die vollen und wärmenden Sonnenstrahlen endlich die Erde berührten, sah der Junge, wie sich zwei lange, schmale und schwarze Kolonnen über die Kuppe eines Hügels wanden und im Wald dahinter verschwanden. Er fühlte sich an zwei überdimensionale Schlangen erinnert, die ihre nächtliche Höhle verlassen hatten und nun durch die Landschaft glitten. Der Fluss war nicht mehr in Sicht.
Der Lulatsch erhob seine Stimme und gratulierte sich selbst, dass er den Abmarsch perfekt und punktgenau vorausgesagt habe. Einige seiner Kameraden meldeten sich zu Wort und behaupteten im Brustton der Überzeugung, selbst diese Schlussfolgerung gezogen zu haben. Sie gingen sogar so weit, sich zu ihrem Scharfblick selbst zu beglückwünschen. Andere in der Gruppe widersprachen und argumentierten, dass der Marschplan offensichtlich völlig anders aussehe. Beide Parteien erschöpften sich in wortreichen Argumenten.
Der Junge wollte von dem ganzen Gerede nichts wissen. Während er sich im planlosen Strom der marschierenden Körper vorwärtstreiben ließ, war er einmal mehr damit beschäftigt, sich in sein ewiges Selbstgespräch zu vertiefen. Er konnte einfach nicht anders. Die Gedanken kehrten unweigerlich in seinen Kopf zurück. Er war niedergeschlagen und missmutig und warf seinen Kameraden verstohlene Blicke zu. Manchmal schaute er auch nach vorne zur Spitze des Regiments und fragte sich, ob es wohl zu einer plötzlichen Feindberührung mit anschließendem Feuerwechsel kommen könne.
Doch die langen Schlangen krochen langsam die Hügel hinauf, ohne dass ein Hauch von Pulverdampf zu sehen gewesen wäre. Zu seiner Rechten waberte zwar eine graubraune Dunstwolke, doch die löste sich gerade zügig auf. Direkt vor ihm erstrahlte der Himmel bereits in einem märchenhaften Blau.
Der Junge studierte die Gesichter seiner Kameraden, immer auf der Suche nach einem Indiz, das ihm die Existenz einer Seelenverwandtschaft signalisiert hätte. Doch auch diesmal wurde er enttäuscht. Eine undefinierbare Begeisterung, die anscheinend in der Luft lag und bei den vorausgehenden Veteranen ihren Ursprung genommen hatte, war auch auf das Rekruten-Regiment übergesprungen. Die Männer bewegten sich plötzlich mit einem ungebremsten Optimismus und hätten wohl am liebsten sogar ein Lied geschmettert. Sie sprachen von einem Sieg, als sei er bereits eine Selbstverständlichkeit.
Obendrein hatte nun auch der Lulatsch allen Grund, sich bestätigt zu fühlen: Es sah tatsächlich ganz danach aus, als würden sie den Gegner passieren, um ihn dann von hinten anzugreifen. Einige äußerten sogar Mitleid mit den am Fluss verbliebenen Truppen und beglückwünschten sich, selbst Teil eines Stoßtrupps zu sein, der diesen Namen wirklich verdiente.
Den Jungen, der sich wie ein Fremdkörper unter seinen Kameraden fühlte, machten die unbekümmerten Reden nur noch deprimierter. Die Clowns der Kompanie gaben den Ton an, das Regiment marschierte im Rhythmus des Gelächters. Der Schreihals, der seinen baumlangen Kollegen stets aufzog, brachte mit seinem bissigen Sarkasmus ganze Marschreihen aus dem Tritt. Und es dauerte nicht lang, bis alle Männer ihre eigentliche Mission glatt vergessen hatten. Ganze Brigaden grinsten um die Wette, alle Regimenter waren lauthals am Lachen.
Ein eher beleibter Soldat versuchte, eine alte Mähre zu stehlen, die vor einer Farm angebunden war. Er hatte die schlaue Idee, ihr sein Gepäck aufzuladen, um sie dann am Zügel zu führen. Er war auch fast am Ziel seiner Träume, als ein junges Mädchen mit roten Backen und blitzenden Augen aus dem Haus eilte und das Pferd an der Mähne zurückzog. Ein Gerangel folgte, doch das junge Mädchen ließ sich nicht beeindrucken und hielt ihr Pferd fest.
Das Regiment, das an der Straße gerade eine kurze Rast machte, hatte die Szene lautstark kommentiert und sich dabei eindeutig auf die Seite des Mädchens geschlagen. Die Männer waren von der Episode so fasziniert, dass sie für einen Moment den Grund ihrer Mission vergaßen. Sie verhöhnten den diebischen Gefreiten, machten sich über sein Äußeres lustig und überhäuften ihn mit ausgesuchten Schimpfworten. Für das tapfere Mädchen hingegen hatten sie nur Applaus – und sogar einen guten Rat: „Greif dir doch einfach ’nen Knüppel und verprügel den Kerl.“
Als der Kerl dann ohne Pferd bei seinem Regiment wieder eintraf, wollte das Buhen und Pfeifen gar nicht mehr aufhören. Die Soldaten machten sich einen Spaß daraus, ihren Kameraden nach Herzenslust niederzumachen. Das Mädchen hingegen, das schwer atmend vor dem Haus stand und die Soldaten bitterböse anstarrte, überschütteten sie mit Lob.
Als die Dunkelheit einsetzte, löste sich das Regiment in einzelne Gruppen auf, die auf verschiedenen Wiesen ihr Nachtlager bezogen. Während die Zelte wie exotische Pflanzen aus dem Boden schossen, bildeten die flackernden Lagerfeuer ein Geflecht aus rot-leuchtenden Blüten.
Der Junge ging dem Austausch mit seinen Kameraden möglichst aus dem Weg. Im Schutz der Dunkelheit machte er einen kleinen Spaziergang und ließ seinem Weltschmerz freien Lauf. Aus der Entfernung hatten die Feuer einen fast schon satanischen Effekt, noch verstärkt durch die schwarzen Gestalten, die vor den Flammen hin und her huschten.
Er legte sich ins Gras. Die Halme streichelten seine Wangen. Der Mond war bereits angeknipst worden und hing irgendwo da oben in einer Baumkrone. Die silbrige Stille der Nacht, die ihn wie eine Decke umhüllte, löste bei ihm eine Woge von Selbstmitleid aus. Es war ein rundum wehmütiges Gefühl, das durch die laue Brise und die nächtliche Stimmung nur noch intensiviert wurde.
Er wünschte sich sehnlichst, wieder zu Hause zu sein und die endlose Runde zu drehen, die ihn vom Haus zur Scheune, von der Scheune zum Feld, vom Feld zur Scheune und von dort wieder zurück nach Hause führte. Wie oft hatte er die gescheckte Kuh und die anderen verflucht, sodass er manchmal sogar den Melkhocker nach ihnen geworfen hatte. Und doch schienen die Kühe heute so etwas wie einen außerweltlichen Heiligenschein um ihre Köpfe zu tragen. Er hätte jedenfalls alle Messingknöpfe dieser Welt dafür gegeben, auf der Stelle zu ihnen heimkehren zu können. Irgendwie, sagte er sich, war er für das Soldatenleben einfach nicht gemacht. Und er grübelte über die emotionalen Unterschiede, die zwischen ihm und den Männern bestanden, die dort wie Kobolde ums Feuer tanzten.
Plötzlich hörte er ein Rascheln im Gras. Als er seinen Kopf drehte, sah er Wilson, den vorlauten Schreihals. Der Junge stieß ein „Oh, Wilson!“ hervor. Wilson trat näher und schaute zu ihm herunter. „Wen haben wir denn da? Bistes wirklich, Henry? Was zum Teufel treibst du hier?“
„Och, bin nur am Nachdenken“, sagte der Junge. Wilson hockte neben ihm nieder und zündete sich behutsam die Pfeife an. „Siehst ganz schön bedröppelt aus, Junge“, sagte er. „Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Was ist denn los mit dir, Teufel noch mal?“
„Och, ist nichts“, wich der Junge aus.
Der Schreihals begann einen Monolog über die anstehende Schlacht. „Diesmal haben wir sie bei den Hammelbeinen“, sagte er enthusiastisch und strahlte dabei über beide Backen. „Diesmal schnappen wir sie! Und dann, zum Donnerwetter noch mal, knüpfen wir sie uns richtig vor.“
„Wenn man ganz ehrlich sein will“, fuhr er mit nüchterner Stimme fort, „muss man schon einräumen, dass sie uns bislang ganz schön unterm Daumen hatten. Eigentlich immer. Aber diesmal – diesmal machen wir sie zur Schnecke.“
„Und ich dachte, du hättest noch unlängst über den ganzen Krieg lauthals geschimpft“, sagte der Junge reserviert.
„Nein, darum ging’s nicht“, sagte sein Gegenüber. „Ich hab nichts gegen ’nen kleinen Feldzug, wenn’s am Ende wirklich zur Sache kommt. Ich hasse nur diese ewige Hin- und Herzieherei, ohne dass irgendwas Gescheites bei rumkommt, abgesehen von blutigen Füßen und immer knapper werdenden Rationen.“
„Wenn’s nach Jim Conklin geht, dürfen wir uns ja diesmal auf ein wahres Schlachtfest freuen.“
„Sieht so aus, als solle er ausnahmsweise mal Recht behalten, auch wenn’s wohl eher ein Zufallstreffer war. Jedenfalls können wir uns auf ’ne richtige Schlacht gefasst machen – und diesmal sind wir am Drücker. Heiliger Strohsack! Wir werden sie nach Strich und Faden zur Schnecke machen.“
Er sprang auf und lief so aufgeregt hin und her, als stünde sein ganzer Körper unter Strom. Der unwiderlegbare Glaube, dass der Sieg nur noch eine Frage der Zeit sei, war ihm geradezu ins Gesicht geschrieben. Obwohl noch ein halbes Kind, sah er sich nun in der Rolle des visionären Veteranen. Seine unbestechlichen Augen hatten die Zukunft gesehen und er war gekommen, um Zeugnis von einem glorreichen Sieg abzulegen.
Der Junge schaute ihn für eine Weile fassungslos an. Als er dann endlich den Mund aufmachte, klang er verbittert und zynisch. „Oh“, höhnte er, „hier spricht wohl der große Feldherr.“
Der vorlaute Soldat paffte gedankenvoll an seiner Pfeife. „Oh, so weit würd ich nicht gehen“, antwortete er bedächtig. „Ich weiß nicht. Ich schätze, ich werde ebenso gut wie der Rest sein. Aber ich werde jedenfalls mein absolut Bestes geben.“ Er war offenkundig selbst überrascht, die Frage so würdevoll beantwortet zu haben.
„Woher weißt du denn, dass du nicht die Beine in die Hand nimmst und türmst, wenn’s erst einmal ernst wird?“
„Türmen?“, lachte der Schreihals. „ Türmen? Warum sollte ich türmen?“
„Nun“, sagte der Junge, „es gab schon viele propere Mannsbilder, die vor dem Kampf die großen Helden waren, sich dann aber ruckzuck verkrümelten.“
„Das mag ja alles stimmen, aber verkrümeln werd ich mich jedenfalls nicht. Wenn jemand darauf eine Wette einginge, würd er ’ne ganze Stange Geld verlieren.“ Zur Bestätigung seiner Worte nickte er noch einmal energisch.
„Was für’n Blödsinn“, sagte der Junge. „Willst du mir etwa erzählen, der tapferste Mann unter der Sonne zu sein?“
„Nein, bin ich nicht“, entgegnete der Schreihals, diesmal schon etwas ungehaltener. „Hab ich auch nie behauptet. Ich hab nur gesagt, dass ich meinen fairen Beitrag liefern würde. Und das werd ich auch tun. Wer bist du überhaupt, meine Tapferkeit infrage zu stellen? Ein kleiner Napoleon Bonaparte?“ Er starrte den Jungen für einen Moment wütend an und trollte sich dann.
Der Junge schrie ihm hinterher: „Deswegen brauchst du ja nicht gleich das Mimöschen zu spielen.“ Doch sein Kamerad war schon weitergegangen und drehte sich nicht mehr um.
Als er verschwunden war, fühlte sich der Junge verlassen. Seine Unfähigkeit, irgendeine Gemeinsamkeit zu finden, machte ihn nur noch deprimierter. Er schien wirklich der einzige Mensch auf der ganzen Welt zu sein, der mit diesen existenziellen Problemen zu kämpfen hatte. Und je mehr er zweifelte, desto isolierter fühlte er sich.