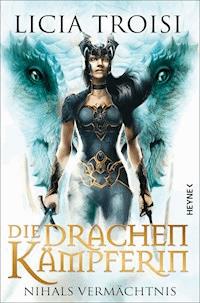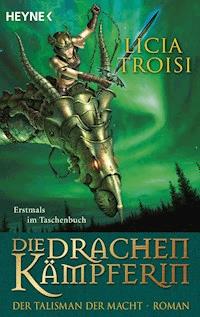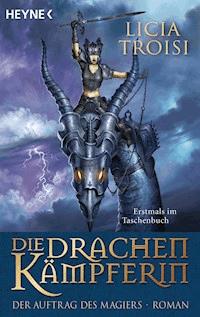Inhaltsverzeichnis
JAHRBUCH DES RATS DER WASSER
Prolog
ERSTER TEIL
Kapitel 1 – Am Rand der Aufgetauchten Welt
Kapitel 2 – Wieder in Aktion
Kapitel 3 – Die Pläne der Gilde
Kapitel 4 – Unerforschte Lande
Kapitel 5 – Salazar
Kapitel 6 – Regen
Kapitel 7 – Im Schatten silberner Blätter
Kapitel 8 – Kampf im Mondschein
ZWEITER TEIL
Kapitel 9 – Das Ende der Mission
Kapitel 10 – Reklas Gabe
Kapitel 11 – Gefangenschaft
Kapitel 12 – Der Gnom und der Knabe
Kapitel 13 – Eine einsame Wanderung
Kapitel 14 – Begegnungen
Kapitel 15 – Unter dem Land des Feuers
Kapitel 16 – Die Herren der Unerforschten Lande
Kapitel 17 – Der Dämon Hass
Kapitel 18 – Verschüttete Erinnerungen
Kapitel 19 – Die Bestie
DRITTER TEIL
Kapitel 20 – Die Rettung
Kapitel 21 – Eine alte Schuld
Kapitel 22 – Das Dorf
Kapitel 23 – Die letzte Etappe
Kapitel 24 – Der Prinz, der niemals König sein wird
Kapitel 25 – Das Ende aller Illusionen
Kapitel 26 – Das Grab im Wald
Kapitel 27 – Verrat
Kapitel 28 – Nihal
Kapitel 29 – Wiedersehen
Epilog
Register
Copyright
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Le guerre del mondo emerso – La setta degli assassinibei Arnoldo Mondadori Editore SpA, Mailand
Wash me away Clean your body of me Erase all the memories They will only bring us pain.
MUSE, Citizien Erased
JAHRBUCH DES RATS DER WASSER
Band VIII, einundvierzigstes Jahr seit der Winterschlacht Dreizehnter Bericht Verfasst von: LONERIN AUS DEM LAND DER NACHT, Schüler des Ratsmitglieds Folwar
Wie vom Rat in seiner letzten Sitzung beschlossen, brach ich zu Beginn des Jahres zu einer Mission in das Zentrum einer Sekte kaltblütiger Mörder auf, die als Gilde der Assassinen bekannt ist und deren wichtigster Tempel im Land der Nacht liegt. Der Grund hierfür waren die letzten Meldungen, die uns von unserem Kundschafter Aramon erreichten, der vor mir im Umfeld der Gilde ermittelt hatte, gaben sie doch zu der Vermutung Anlass, dass die Gilde der Assassinen ein irgendwie geartetes Abkommen mit Dohor geschlossen hatte. Dieser König des Landes der Sonne herrscht nicht nur über dieses Reich, sondern faktisch auch über das Land der Nacht, des Feuers, der Felsen und des Windes. Durch Kriege und Intrigen konnte er sie erobern und lässt sie nun von Marionettenkönigen regieren. Über die genauen Hintergründe dieses Paktes zwischen der Gilde und Dohor wissen wir allerdings immer noch viel zu wenig.
Um nun mehr über die Pläne unserer Feinde herauszufinden, schmuggelte ich mich ins Herz der Gilde ein. Dazu gab ich mich als einer jener Verzweifelten aus, die den Tempel aufsuchen, um dort Thenaar, den Schwarzen Gott, anzuflehen, dass er sie von ihrem Leid erlösen möge. Postulanten werden diese ärmsten Anhänger der Sekte genannt. Auf die Qualen, die ich durchzustehen hatte, bis ich endlich als Postulant Aufnahme fand, brauche ich an dieser Stelle nicht näher einzugehen. Jedenfalls führte man mich dann unmittelbar ins Zentrum der Gilde, einen weitläufigen unterirdischen Bau, in dem die Mitglieder dieser Sekte leben.
Meine Kenntnisse vom Aufbau dieser Katakomben sind leider auch heute noch nicht sehr erschöpfend, denn die Postulanten werden dort wie Gefangene gehalten, und daher brachten meine nächtlichen Streifzüge durch den Bau notgedrungen wenig ein. Die Assassinen, die Angehörigen der Sekte also, bewachen die Postulanten äußerst streng und lassen sie wie Sklaven schuften bis zu dem Tag, da sie dem Gott Thenaar geopfert werden.
Lange Zeit, so muss ich gestehen, führten meine Nachforschungen zu nichts, abgesehen von der Bestätigung für unsere Vermutung, dass Dohor mit der Sekte paktiert, um sich die speziellen Fähigkeiten der Sektenmitglieder, die den Meuchelmord zelebrieren, zunutze zu machen. Bis mir dann das Schicksal – oder der Zufall – eine unerwartete Hilfe zuspielte.
Als ich gerade dabei war, mich im Versammlungssaal der Gilde umzusehen, einer riesengroßen Tropfsteinhöhle mit einer furcht erregenden Thenaar-Statue und zwei schauerlichen, mit Blut gefüllten Becken darin, wurde ich von einem Mitglied der Sekte überrascht, einem jungen Mädchen von vielleicht siebzehn Jahren, das an eben jenem Ort, den ich auskundschaften wollte, herumschlich.
Sie ergriff mich und brachte mich in ihre Unterkunft, um dort Auskunft über mein Tun zu verlangen.
Ich aber spürte sofort, dass dieses Mädchen anders als die an deren Assassinen war. Sie schien mir wenig feindselig, eher besorgt, als sei sie selbst bei etwas Verbotenem ertappt worden. Es mag fahrlässig gewesen sein, doch als mich Dubhe, so ihr Name, fragte, wer ich sei und was ich dort gesucht hätte, antwortete ich ganz offen und ehrlich.
Auch im Hinblick auf das Misstrauen, das man im Rat der Wasser gegen Dubhe hegt, sollte ich hier, bevor ich fortfahre, nun kurz erzählen, wer sie ist und wie es zu der Abmachung kam, die wir in jener Nacht besiegelten.
Zwei Wege gibt es, um Mitglied der Gilde zu werden. Entweder wird man als Kind von Assassinen in sie hineingeboren oder man gerät ins Blickfeld dieser Mördersekte, weil man bereits in jungen Jahren einen Menschen getötet hat. Letztere werden Kinder des Todes genannt. Und zu diesen zählt auch Dubhe.
Ich weiß nicht genau, woher sie stammt. Sie hat einen natürlichen, allerdings auch verständlichen Widerwillen, von ihrer Vergangenheit zu erzählen, aber ihre Eltern waren wohl Bauern in einem Dorf. Als kleines Mädchen, sie war acht, tötete sie unabsichtlich bei einer Rauferei einen Spielkameraden und wurde dafür von der Dorfgemeinschaft schwer bestraft: Man trennte sie von ihren Eltern und schickte sie in die Verbannung. Während sie so ohne Halt und Ziel durch die Gegend irrte – Genaueres weiß ich nicht über diese Zeit -, muss sie irgendwann jenem Mann begegnet sein, der sie zur Meuchelmörderin ausbildete, von dem sie aber mit größter Ehrfurcht spricht. »Meister« nennt sie ihn nur.
Wohlgemerkt war sie acht, als diese Ausbildung begann. Wir haben es hier also mit einem Menschen zu tun, der zum Morden gezwungen, dem nichts anderes beigebracht wurde, als andere zu töten, ein Schicksal, das durch das in ihrem Dorf erlebte Drama noch zusätzlich erschwert wird. Ich betone dies, um zu zeigen, wie unbegründet der Argwohn des Rats ihr gegenüber ist. Doch ich schweife ab.
Für die Gilde ist Dubhe ein Kind des Todes. Wenn ich richtig informiert bin, war Dubhes Meister, bevor er sich widersetzte und aus der Sekte austrat, lange Zeit selbst Assassine, und auf diese Weise erfuhr die Gilde von ihrem Schicksal. Mittlerweile hat Dubhe seit Jahren dem Morden abgeschworen und schlägt sich mit Diebstählen und Einbrüchen durchs Leben. Alle, die dies lesen, fordere ich daher noch einmal auf, dieses Mädchen mit größter Nachsicht zu beurteilen, nicht zuletzt weil wir nur ihr allein die Aufdeckung der Pläne der Gilde verdanken. Wir haben es hier mit einer jungen Frau zu tun, die ganz allein in der Welt steht und ihr Leben nur mittels jener Fertigkeiten fristen kann, die sie in der Ausbildung zur Schattenkämpferin durch ihren Meister gelernt hat.
Durch eine List gelang es der Gilde, Dubhe an sich zu binden. Man belegte sie mit einem Fluch, der ihr über eine vergiftete Nadel eingepflanzt wurde. Zum ersten Mal bemerkte sie ihn, als sie bei einem Einbruch plötzlich einen Schwächeanfall erlitt. Passend zur abartigen Gesinnung der Mördergilde ist dieser Fluch besonders heimtückisch, ruft er doch eine Art Ungeheuer wach - »die Bestie« nennt Dubhe es -, das in ihrer Seele Unterschlupf gefunden hat. Immer wieder bricht diese Bestie seitdem hervor und verleitet das Mädchen, bestialische Grausamkeiten zu verüben. Denn die Nahrung dieses Ungeheuers sind Blut und Tod.
Man redete Dubhe ein, nur die Gilde verfüge über ein Gegenmittel, das sie retten könne, und zwang sie auf diese Weise, sich der Mördersekte anzuschließen. Das war vor einigen Monaten. In regelmäßigen Abständen wurde ihr nun bei der Gilde ein Trank verabreicht, der zwar die Auswirkungen des Fluches unter Kontrolle hielt, aber keineswegs, wie man ihr weismachte, ein echtes Heilmittel war.
Wir haben es hier also nicht mit einem Menschen zu tun, der in der Gilde geboren und zur Perversion erzogen wurde, sondern mit einem Opfer der Sekte, das gegen seinen erklärten Willen dort zu leben gezwungen war.
Ich habe den Fluch, der auf Dubhe lastet, genau geprüft. Am Oberarm, wo die tückische Nadel sie traf, erkennt man ein Symbol: ein rotes und ein schwarzes Pentagramm, die einen Kreis umschließen, der von zwei ineinander verschlungenen Schlangen, ebenfalls rot und schwarz, gebildet wird. Bekanntermaßen hinterlässt ein gewöhnlicher Fluch kein solches Mal, es sei denn, es handelt sich um ein Siegel.
Als Dubhe mir das Symbol zeigte, war mir dank meiner Magierausbildung sofort klar, dass es sich um ein Siegel handeln musste. Ich eröffnete ihr diese bittere Wahrheit und erklärte ihr, solch ein Zauber könne nur von dem Magier gebrochen werden, der ihn geschaffen hat, und es gebe keinerlei Zaubertränke, die sie heilen würden, sondern nur solche, mit denen sich die Symptome unter Kontrolle halten lassen. Mit anderen Worten, die Gilde führte sie hinters Licht.
Ein wenig Hoffnung konnte ich Dubhe allerdings machen, und so kam es zu unserer Vereinbarung: Bekanntermaßen können Siegel, die von mittelmäßigen Magiern geschaffen wurden, durch stärkere Magier gebrochen werden. Da ich glaube, dass Dubhes Siegel von dieser Art ist, versprach ich ihr, sie, wenn uns die Flucht gelänge, mit einem mächtigen Magier zusammenzubringen, der dieses Siegel vielleicht brechen könne. Als Gegenleistung stellte sie alle Nachforschungen im Bau der Gilde für mich an.
Ich schließe nun diesen Einschub und will berichten, was Dubhe herausfand.
Wie einen Messias verehrt die Gilde den Tyrannen Aster, der fast die gesamte Aufgetauchte Welt zerstört hätte, und arbeitet emsig an dessen Wiederkehr. Es gelang ihr bereits, seinen Geist zurückzuholen, der jetzt in einer Art Zwischenreich zwischen un serer Welt und dem Jenseits in einem geheimen Raum im Bau der Gilde umherschwebt. Um das Werk zu vollenden, braucht die Gilde nun noch einen Leib, dem dieser Geist eingepflanzt werden kann. Ihre Wahl fiel dabei auf den Sohn Nihals und Sennars, der beiden Helden, denen es vierzig Jahre zuvor gelungen war, den Tyrannen zu stürzen und zu vernichten. Der Grund für diese Wahl ist leicht zu erahnen. Aster ist ein Halbblut, das Kind eines Menschen und einer Halbelfe, geradeso wie der Sohn Nihals, der letzten Halbelfe der Aufgetauchten Welt, und Sennars, einem gewöhnlichen Mann aus dem Land des Meeres.
So weit, was Dubhe herausfand.
In der heutigen Sitzung hat der Rat über diese Entdeckungen beraten und schließlich einen Entschluss zum weiteren Vorgehen gefasst. Zwei Missionen wurden beschlossen. Bei der ersten geht es darum, Nihals und Sennars Sohn zu warnen und in Sicherheit zu bringen. Der Kopf unseres Widerstandes gegen Dohor, der Gnom Ido, erklärte dem Rat, dass sich der Halbelf in der Aufgetauchten Welt aufhält im Gegensatz zu seinen Eltern, die viele Jahre zuvor den Großen Fluss, den Saar, überquerten und in die Unerforschten Lande zogen. Ido selbst hat es nun übernommen, den jungen Mann zu finden und in Sicherheit zu bringen.
Die zweite Mission wurde Dubhe und mir übertragen. Als überragender Magier, der er ist, kennt Sennar wahrscheinlich das Geheimnis des Zaubers, durch den Aster wiederauferstehen soll. Aus diesem Grund werden Dubhe und ich den Saar überqueren und uns auf die Suche nach ihm machen. Dubhe hat sich für diese Aufgabe angeboten in der Hoffnung, Sennar werde einen Weg finden, sie von dem Siegel zu erlösen. Ich weiß, dass sie mir eine große Hilfe sein wird, nicht zuletzt weil unsere Flucht aus dem Bau der Gilde nicht unbemerkt geblieben ist und uns die Assassinen mit Sicherheit bereits auf den Fersen sind. Wer könnte uns besser vor deren Überfällen schützen als sie?
Damit komme ich zum Ende. Morgen werden wir aufbrechen. Mit Unruhe im Herzen schreibe ich diese letzten Zeilen. Niemand, der den Saar überquerte, ist je zurückgekommen, und die Unerforschten Lande flößen allen Furcht und Schrecken ein. Ich weiß nicht, was uns erwartet, ja, ich weiß noch nicht einmal, ob es uns überhaupt gelingen wird, die reißenden Wasser des mächtigen Stroms zu überwinden. In mir spüre ich gleichzeitig die Erregung des Entdeckers und die Angst vor dem Unbekannten. Doch stärker als die Furcht vor dem Tod ist die Sorge, dass unsere Mission scheitern könnte.
Denn unsere Mission ist wichtiger als alles andere, und nichts liegt mir mehr am Herzen als die Vernichtung der Gilde.
Prolog
Es war schon spät, als sich der letzte Gast verabschiedete. Er war betrunken und musste sich von einem Diener begleiten lassen. Sulana beobachtete, wie die beiden durch den dunklen Garten wankten, wobei ihr Gast noch etwas grölte, was sie nicht verstand. Vielleicht ein anstößiges Lied.
Sie war erschöpft. Der Zwang, sich jeden Augenblick unter Kontrolle zu haben, stets zu lächeln, wenn es verlangt war, ging irgendwann über ihre Kräfte. Bei Dohor, der seit diesem Morgen ihr Gemahl war, war das anders. Solche Auftritte schienen ihm im Blut zu liegen. Mit größter Anmut hatte er vor dem Priester ihre Hand ergriffen und sie dann durch den ganzen Tag geleitet. Nie ein unangemessenes Wort, nicht das geringste Anzeichen von Schwäche. Und Sulana hatte sich gewundert. Wie stellte er das bloß an, bei jedem Gast genau zu wissen, was er zu sagen hatte? Es war eine Kunst, die sie nicht erlernt hatte. Aber andernfalls hätten sie vielleicht gar nicht geheiratet.
Ihre Ratgeber hatten sie immer wieder bedrängt:
»Es wird Zeit, noch seid Ihr im passenden Alter.«
»Das Volk tuschelt bereits.«
»Wir brauchen einen König.«
Sieben Jahre lang hatte sie widerstanden, hatte es geschafft, ihr Reich, das Land der Sonne, allein durch Kriegs- und Friedenszeiten zu führen, hatte sich gegen Minister und Höflinge durchgesetzt. Schließlich jedoch wurde ihr klar, dass sie nicht länger konnte. Obwohl kaum älter als zwanzig Jahre, fühlte sie sich bereits alt, ihrer Kindheit beraubt. So konnte es nicht weitergehen. Entschlossenheit und Kraft waren aufgebraucht, und so hatte sie irgendwann eingewilligt. Ja, sie würde heiraten.
Dabei machte sie sich keine großen Gedanken, wer denn nun ihr künftiger Gemahl werden sollte. Sie sehnte sich bloß nach Ruhe, nach Erholung, und wenn dies nur dadurch zu erreichen war, dass ein Fremder sie umarmte, so sollte es geschehen.
Ein junger Mann, nur unbedeutend älter als sie selbst, mit strohblonden, fast weißen Haaren und strahlend blauen Augen, war es, der sie schließlich eroberte.
»Ja«, raunte Sulana leise, als er um ihre Hand anhielt. Und nur für einen kurzen Augenblick schämte sie sich ihrer Schwäche.
Man kann nicht bis in alle Ewigkeit stark sein, hatte sie sich gesagt und auf die Lippen gebissen, während ein triumphierendes Lächeln über das Gesicht ihres Bräutigams huschte.
Die Hochzeitsvorbereitungen wollten kein Ende nehmen. Bankett, Zeremonien, Anproben für ihr Brautkleid – unzählige Entscheidungen waren zu treffen, und Sulana beobachtete sich selbst, wie sie all das erledigte. Irgendwann schien es nicht mehr ihre eigene Stimme zu sein, die erschöpft Anweisungen gab und Befehle erteilte. »Ja, die Lilien in die Mitte der langen Tafel.« – »Gewiss, ich werde dem Minister baldmöglichst für sein reizendes Geschenk persönlich danken.«
Dohor war nicht bei ihr, hielt sich von ihr fern. Seit er um ihre Hand angehalten hatte, hatten sie kaum noch ein Wort miteinander gewechselt.
Wie wird er zu mir sein? Wird er liebevoll sein? Werde ich ihn lieben können?
Gewiss, es war eine Vernunftehe und nicht mehr. Dohor würde König werden und sie endlich den Frieden finden, den sie sich wünschte. Allerdings hatte sie als kleines Mädchen immer davon geträumt, mit jemandem zusammenzuleben, den sie liebte. Und so betrachtete sie doch voller Hoffnungen ihren künftigen Ehemann, der ebenfalls mit Vorbereitungen beschäftigt war. Verborgen hinter einem Brunnen in dem großen Palastgarten beobachtete sie ihn heimlich. Entschlossen und selbstsicher erschien er ihr, auch schön mit seinem schlanken, muskulösen Körper. Allerdings strahlte er auch etwas Beunruhigendes aus. Vielleicht war es sein Lächeln oder auch bestimmte Gesten, jedenfalls erschrak sie darüber und fühlte sich gleichzeitig davon angezogen. Ein Geheimnis umgab ihn, die Tatsache, dass sie füreinander Fremde waren.
Sie begann zu glauben, dass sie ihn liebte. Und wenn sie ihn liebte, würde Dohor vielleicht ihre Gefühle erwidern können.
Die Zeremonie wollte kein Ende nehmen. Höflinge, Könige, Prinzen, Krieger, Minister, die üblichen Speichellecker … Einer nach dem anderen beugte das Knie vor dem königlichen Brautpaar. Lächelnd saß Sulana auf dem Thron, ließ eine Hand sanft auf der ihres Gatten ruhen. Doch niemand schien sie wirklich anzuschauen. Die Blicke der Gäste durchdrangen sie, und sie fühlte sich unsichtbar, auch für Dohor, der ganz von seiner Rolle als König eingenommen war.
Nur Ido schien sie wirklich zu sehen. Er trat vor sie hin mit Soana am Arm, der Frau, die er liebte und mit der er zusammenlebte. Die Zauberin, vor langer Zeit schon einmal Mitglied im Rat der Magier, hatte diese Stellung wieder eingenommen, nachdem ihr Nachfolger Sennar die Aufgetauchte Welt verlassen hatte. Ido schenkte der Braut eine Blume und ein Lächeln, in dem viel Verständnis lag. Die Königin erwiderte es von Herzen, und dies zum ersten Mal, seit dieser nicht enden wollende Tag begonnen hatte.
Von ganz anderer Art war der Blick, den der Gnom ihrem Gatten zuwandte. Nicht offen feindselig, aber äußerst kühl. Zunächst schien Dohor es nicht zu bemerken.
»Unser verehrter Oberster General!«, rief er. »Erhebt Euch, erhebt Euch!«
»Danke, Majestät«, grummelte Ido.
»Ist es nicht eigenartig, dass Ihr nun vor mir niederkniet? Bis gestern war es noch umgekehrt.«
Sulana fand die Bemerkung unpassend, schrieb sie jedoch dem Wein und der Erregung anlässlich des großen Ereignisses zu.
»Tja, so schnell kann sich das Schicksal ändern«, fuhr der König fort.
Soana versteifte sich, was Sulana sofort bemerkte.
»Die besten Wünsche für Euch und Eure Gemahlin, auf eine lange, friedliche Herrschaft«, sagte die Magierin mit einem Lächeln.
»Danke, danke«, entgegnete Dohor knapp, ein wenig pikiert, und wandte sich wieder Ido zu. »Jedenfalls werde ich nicht vergessen, dass ich in erster Linie ein Drachenritter bin, der seine soldatischen Pflichten nie vernachlässigt. Ist es nicht ein großes Glück für dieses Land, nun einen kriegserfahrenen König zu haben?«
»Lebten wir in Zeiten des Krieges, wäre es dies zweifellos.«
»Eben, und niemand kann vorhersehen, wann es wieder zum Krieg kommen wird …«
»Ich danke Euch nochmals für die Ehre dieser Einladung. Lang lebe das Herrscherpaar«, erklärte Soana hastig und verneigte sich noch einmal. Mit verwirrter Miene tat Ido es ihr nach.
Während sich die beiden entfernten, spürte Sulana, dass die Hand ihres Gemahls leicht zitterte. Sie blickte ihn an, doch er reagierte nicht. Kalt und gefasst hatte er bereits wieder ein Lächeln für den nächsten Gast parat.
Sulana zog sich so hastig aus, dass die Magd, die ihr dabei half, fast ungeduldig wurde.
»So ruiniert Ihr noch Euer Brautkleid!«, stöhnte sie.
Das war Sulana gleich. Sie würde es ohnehin nie mehr tragen. Nun stand die Hochzeitsnacht bevor, und sie wusste nicht, ob sie sich freuen oder Angst haben sollte.
Mit blassem Gesicht betrat sie das Schlafgemach, das nur vom Schein einer einzigen Kerze und vom strahlenden Mond der Sommernacht erhellt wurde. Es war leer.
Sulana verharrte auf der Stelle, wandte sich um und blickte den Flur hinunter, aber auch dort war niemand. Sie rief nach der Magd. »Wo ist der König?«
»Ich weiß es nicht, Herrin, ich habe ihn nicht hinausgehen sehen.«
Wo war Dohor? Was konnte ihm wichtiger sein als seine Braut?
Stocksteif saß Sulana auf der Bettkante in der törichten Sorge, das Bettlaken zu verknittern. So wartete sie.
Es war tiefste Nacht, und von Dohor keine Spur. Was war geschehen? Sulana hielt das Warten nicht länger aus. Barfuß lief sie durch den dunklen Garten. Sie mochte das angenehme Kitzeln der Grashalme unter den Fußsohlen.
Sie seufzte und dachte an die Träume ihrer Jugend zurück, von denen nun nichts mehr übrig zu sein schien.
Da hörte sie ein Flüstern. Sie fuhr herum und verharrte. Dann ging sie ihm nach, versuchte, keinen Laut zu machen.
Wer konnte das sein? Zu dieser späten Stunde hatte im Garten niemand mehr etwas zu suchen. Einen Augenblick lang machte sie sich vor, Dohor warte hier auf sie, um sie zu überraschen. Gewiss, ein dummer Einfall, aber vielleicht lieb gemeint.
Als sie bei der Buchsbaumhecke unter der Weide einen Schatten erblickte, begann ihr Herz schneller zu schlagen. Gemurmel. Zwei Stimmen. Und zwei Gestalten.
Sie versteckte sich hinter dem Baumstamm.
»Und wieso seid Ihr nicht zur Zeremonie gekommen?«
»Menschen wie ich betreten Paläste nur zu bestimmten Anlässen, und die sind längst nicht so fröhlich wie eine Hochzeit. Wo wir auftauchen, ist der Tod nicht weit.«
Es war eine kalte, monotone Stimme mit einem kaum wahrnehmbaren amüsierten Unterton. Die andere Stimme war unverwechselbar. Es war Dohor. Sulana erkannte sein Lachen wieder.
»Sehr gut. Ich verstehe. Nun, habt Ihr mir sonst noch etwas mitzuteilen?«
»Im Augenblick nicht. Es sei denn, Euch ein Lob auszusprechen: Ihr habt Euch als ein sehr aufgeweckter, scharfsinniger junger Mann gezeigt.«
»Andernfalls stände ich wohl jetzt nicht hier.«
»Aber das ist doch bloß der Anfang, nicht wahr?«
»Gewiss.«
Erneut dieses feine Lachen, das Sulana bis zu diesem Tag noch das Herz geöffnet hatte und sie jetzt vor Kälte erstarren ließ.
»Mit Sicherheit werde ich auch in Zukunft auf Eure Dienste und die Eurer Sekte zurückgreifen.«
»Wir sind stets zu allem bereit. Unseren Preis werdet ihr natürlich nicht vergessen haben …«
»Nein, und es sollte mir nicht schwerfallen, diese Nachforschungen im Großen Land anstellen zu lassen.«
Der andere Mann verneigte sich elegant. »Schade, dass wir hier keinen Wein haben, um auf unseren Handel anzustoßen.«
»Das holen wir nach, wenn unsere Zusammenarbeit die ersten Früchte trägt.«
Sulana beobachtete, wie sich Dohor auf den Weg zurück in den Palast machte. Ihre Beine waren wie gelähmt, aber sie musste sich sputen, um noch rechtzeitig in ihr Schlafgemach zu gelangen. Das tat sie. Zum Glück kannte sie sich im Palast besser aus als ihr Gemahl.
Kurz vor ihm traf sie bei ihren Gemächern ein, schlüpfte hinein, legte sich aber nicht unter die Decke, sondern setzte sich auf das Bett, mit angezogenen Knien, die sie mit den Armen umfasste.
Schon öffnete Dohor leise die Tür. Als er sah, dass sie wach war, verharrte er überrascht auf der Schwelle. »Du schläfst noch nicht?«
»Ich habe auf dich gewartet.«
Er schloss die Tür hinter sich. »Es tut mir leid. Ich hätte dir ausrichten lassen müssen, dass ich noch zu tun habe. Aber es war wirklich nicht nötig, auf mich zu warten.«
Höflich. Aber kalt. Er stellte sich hinter den Wandschirm und zog sich um. Sulana hörte, wie er mit einem Krug Wasser hantierte, wie er sein Schwert zur Seite legte. Kein Wort für sie. Ihr hingegen lagen viele Fragen auf den Lippen.
Mit seinem Wams und seiner Uniformhose über dem Arm trat Dohor hinter dem Wandschirm hervor, nahm die Kerze neben dem Bett zur Hand und schickte sich an, sie zu löschen.
»Wo warst du?«
Dramatischer als Sulana es gewollt hatte, durchbrach die Frage die Stille.
Dohor verharrte. Drehte sich aber nicht zu ihr um. »Ich sagte bereits, ich hatte zu tun.«
»Willst du mir nicht sagen, was du zu tun hattest?«
»Das ist meine Sache«, antwortete er, während sich seine Finger dem Docht näherten.
Sulana war verwirrt, vielleicht auch ein wenig verärgert.
»Ich habe dich im Garten gesehen, im Gespräch mit einem Mann.«
Dohor fuhr herum. »Du hast mir nachspioniert?«
Im Blick seiner hellblauen Augen waren Wut, aber auch Furcht abzulesen.
»Ich kam zufällig dorthin …«
Er packte ihre Handgelenke. »Du hast uns belauscht. Wie konntest du es wagen …?«
Mit einem Mal überfiel Sulana panischer Schrecken. Allein mit einem Fremden war sie in ihrem Schlafgemach, mit einem Fremden, von dem sie nicht wusste, wozu er fähig war. Tränen traten ihr in die Augen.
»Du warst doch nicht hier, als ich kam … und ich wusste nicht, ob ich mich sorgen sollte … ich habe auf dich gewartet … und es wurde immer später … ich war enttäuscht … und deshalb … nun, schließlich ist das unsere Hochzeitsnacht …«
Sie schaute ihn an, suchte nach Verständnis in seiner Miene, doch davon keine Spur.
»Was ich tue, geht dich nichts an. Jetzt bin ich der König, und ab sofort führe ich die Staatsgeschäfte.«
Im Grund ihres Herzens war Sulana bereits alles klar. Dennoch versuchte sie es noch einmal. »Aber wir sind doch jetzt Mann und Frau … und dieser Fremde … nun, er wirkte so unheimlich …«
Dohor lächelte schief. »Mann und Frau? König und Königin trifft es eher. Du warst des Regierens müde, und ich wollte auf den Thron, mehr war da nicht. Dieser Mann ebnet mir den Weg nach oben, nach ganz oben, und das wird auch für dich kein Nachteil sein.«
Er stieß sie fort, löschte das Licht, legte sich nieder und drehte ihr den Rücken zu.
Mit weit aufgerissenen Augen blieb Sulana im Dunkeln sitzen. Da hörte sie, wie er sich noch einmal auf die andere Seite drehte.
»Und wag es ja nicht, mir Knüppel zwischen die Beine zu werfen, verstanden? Wir haben eine Abmachung, und an die wirst du dich halten.«
Mit eiskalter Ruhe sprach er diese Worte und zog dann die Bettdecke zu sich.
Lange Zeit blieb Sulana völlig reglos im Bett sitzen und ließ ihren Tränen ohne das leiseste Schluchzen freien Lauf.
Sie hatte einen Fehler gemacht. Aber erst mit der Zeit würde sie ganz verstehen, wie groß er war.
ERSTER TEIL
Der Saar, auch Großer Fluss genannt, breitet sich im Westen derAufgetauchten Welt aus und bildet dort eine schier unüberwindliche Grenze. Niemand ist in der Lage zu sagen, wie lang oder wiebreit er ist, doch es wird erzählt, an seinen breitesten Stellen lägendie Ufer sieben oder acht Meilen entfernt. Auch welche Geschöpfein seinen Wassern leben, ist nicht bekannt. Alles, was die Menschen von diesem mächtigen Strom wissen, ist sagenhaft, geheimnisvoll, denn von all denen, die sich aufmachten, ihn zu überqueren, ist noch nie jemand lebend zurückgekehrt.
UNBEKANNTER AUTOR AUS DER ZERSTÖRTEN BIBLIOTHEK DER STADT ENAWAR
1
Am Rand der Aufgetauchten Welt
Als die eigenartige Reisegesellschaft eintraf, ging die Sonne bereits unter über dem Dorf Marva und seinen nur wenigen ärmlichen Pfahlbauten inmitten des Sumpfgebiets des früheren Landes des Wassers, das heute Mark der Sümpfe heißt. Das Mädchen und der Magier waren erst seit zwei Tagen fort. Die Fremden waren zu dritt, ihre Gesichter verhüllt von den Kapuzen ihrer weiten braunen Umhänge.
Wohin sie auch kamen, folgten ihnen besorgte Blicke. Marva lag abseits aller Verkehrsstraßen, und die faulige, stehende Luft der Sümpfe sorgte dafür, dass sich nur wenige zufällige Wanderer dorthin verirrten. Noch nicht einmal eine Schenke oder gar ein Gasthaus gab es. Jahrelang war dort niemand mehr vorbeigekommen, und nun binnen drei Tagen gleich fünf Fremde: Offensichtlich war irgendetwas geschehen.
Die Neuankömmlinge schlugen den Weg zur Werkstatt des Bootsbauers ein, praktisch das einzige einträgliche Handwerk an diesem gottverlassenen Flecken.
Als sie dort eintrafen, war Bhyf gerade damit beschäftigt, ein neues Boot mit Pech zu versiegeln, wurde aber sofort auf sie aufmerksam. Durch das Rechteck der Tür sah er sie auf sich zukommen, vorneweg der Mann, der ihr Anführer zu sein schien, und hinter ihm, ihn überragend, die beiden anderen. Ihr entschlossenes, selbstgewisses Auftreten ließ ihn erschaudern. Doch als der Anführer jetzt seine Kapuze abnahm, stieß Bhyf einen Seufzer der Erleichterung aus, denn zum Vorschein kam der Kopf einer jungen Frau mit blonden Locken und einem schönen, um die Nase herum mit Sommersprossen gesprenkelten Gesicht.
»Guten Abend«, wünschte sie mit einem höflichen Lächeln.
Bhyf zog seine Arbeitshandschuhe aus und musterte sie lange. Zunächst schien es ihm ratsam, misstrauisch zu bleiben. »Womit kann ich dienen?«
»Nur mit einigen Auskünften.«
Bhyf versteifte sich. Die Kleider der Frau waren fast vollkommen verhüllt von dem verschlissenen Umhang, doch um den Kragen herum schaute etwas Schwarzes hervor.
»Was soll ich denn schon wissen …?«
»Nun, sind in letzter Zeit vielleicht ein junger Magier und ein zierliches Mädchen in Männerkleidung hier vorübergekommen?«
Bhyf nickte, wobei er die beiden Männer in ihrer Begleitung nicht aus den Augen ließ. Das einzige Hindernis, das ihn von den Fremden trennte, war das Boot, an dem er gerade arbeitete.
»Halten sie sich noch im Dorf auf?«
»Nein«, antwortete er, während er ein wenig zurückwich.
»Verstehe. Und wann sind sie fort?«
»Gestern sind sie losgerudert.«
»Mit welchem Ziel? Wisst Ihr das?«
»Wozu all diese Fragen? Ich baue hier meine Boote und kümmere mich nur um meine Angelegenheiten …«
»Wisst Ihr es nun oder nicht?« Die junge Frau schien nicht zornig, doch ihre Stimme war sehr fest.
»Ich weiß überhaupt nichts. Sie waren bei Torio unter gekommen, fragt ihn doch.«
Sie nickte und zog wieder die Kapuze über.
»Habt Dank, Ihr ward uns eine große Hilfe.«
Ohne ein weiteres Wort verließen sie die Werkstatt, und Bhyf bemerkte beunruhigt, dass ihre weiten Umhänge, ja sogar ihre Schritte kaum einen Laut machten.
Torio saß auf dem Steg vor seinem Haus und ließ die Beine baumeln. Er war ein noch recht rüstiger alter Mann mit der leicht stumpfen Miene eines Menschen, der sein Lebtag am selben Ort gewohnt hat und sich gar nicht vorstellen kann, dass es außerhalb davon eine größere Welt geben könnte. Während er seine Netze flickte, hörte er plötzlich leise Schritte, wandte sich um und sah auch schon drei schwarze Stiefelpaare, die neben ihm stehen blieben.
»Seid Ihr Torio?«
Der Alte hob den Kopf und blickte in das Lächeln einer anmutigen jungen Frau. Die beiden Männer hinter ihr trugen Kapuzen über dem Kopf, und einen Moment lang überkam ihn ein seltsames Gefühl. »Ja«, antwortete er argwöhnisch.
»Uns wurde gesagt, dass Ihr zwei Personen beherbergt habt, einen Magier und ein Mädchen in Männerkleidung. Wo sind die hin?«
Torio erstarrte. Beim Abschied hatte ihn das Mädchen eindringlich gebeten: ›Sollte jemand nach uns fragen, so wisst Ihr nichts von uns. Leugnet, dass wir hier waren oder sagt wenigstens, dass Ihr nicht wisst, wohin wir aufgebrochen sind. Auf keinen Fall dürft Ihr unser Ziel verraten.‹
»Da hat man Euch wohl einen Bären aufgebunden«, erklärte er jetzt und runzelte die Stirn, »schaut Euch doch mal um. Dieser Ort lockt keine Besucher an.« Und damit beugte er sich wieder über seine Netze als Zeichen, dass das Gespräch für ihn beendet sei.
Da ging die Frau neben ihm in die Hocke und blickte ihm fest in die Augen. »Es ist nicht ratsam, uns an der Nase herumzuführen …«
Torio fielen ihre schönen, strahlend blauen Augen auf, doch in ihrem Blick und auch in ihrer Stimme lag etwas, das ihn zutiefst beunruhigte. Seine Hände begannen zu zittern. »Bei mir war niemand … Wenn ich es Euch doch sage, seht doch …«
Er kam nicht mehr dazu, den Satz zu beenden. Die Frau hob nur die Hand, und blitzartig packten die beiden anderen den alten Fischer und stießen ihn ins Haus, schlossen die Tür und warfen ihn zu Boden, hielten ihn aber weiter an den Armen fest.
»Was zum Teufel …?«
Sofort stellte ihm die Frau den Stiefel auf den Mund und drückte zu. Sie war stark, unerwartet stark für ihre schlanke Gestalt.
»Jetzt sag schon, wo sind die beiden hin?«
Torio schwieg beharrlich. Gewiss hatte er Angst, aber nicht so stark, dass er die eindringliche, überzeugende Bitte des Mädchens beim Abschied vergessen hätte.
»Vielleicht ist dir noch nicht ganz klar, in welcher Lage du dich befindest!«, zischte die Frau jetzt mit einem gemeinen Lächeln.
Sie öffnete ihren Umhang, und starr vor Schreck erblickte Torio ein weites Wams mit einem Oberteil aus schwarzem Leder, das mit roten Knöpfen besetzt war. Auch die Beinkleider aus Wildleder waren schwarz, und die beiden Männer in ihrer Begleitung waren ebenso gekleidet. Eine Kluft, die er gut kannte und die jedermann in der Aufgetauchten Welt mit Schrecken erfüllte: die Bekleidung der Gilde, der Mördersekte.
»Offenbar weißt du, wer wir sind«, erklärte die Frau mit ihrem gemeinen Grinsen. Jedes Wohlwollen war aus ihrer Miene gewichen, und jetzt sah sie mehr wie ein böser Kobold aus.
Sie zog einen schwarzen Dolch aus dem Gürtel, dessen Heft einer Schlange nachgeformt war, beugte sich dann zu dem Alten am Boden herab und setzte ihm die Klingenspitze an die Wange.
Torio begann zu keuchen. Eigentlich verband ihn nichts mit den beiden jungen Leuten, die nur ein paar Tage bei ihm genächtigt hatten, zu kurz, um sie wirklich kennenzulernen. Aber er wusste eben, mit welchem Ziel sie unterwegs waren.
›Wir reisen im Auftrag des Rats der Wasser‹, hatten sie gesagt. Eine bedeutende Mission, daran bestand kein Zweifel für ihn. Nicht nur ihren Worten hatte er das entnommen, sondern auch den gemessenen Gesten des jungen Mannes, seiner kühlen Entschlossenheit. So bedeutend musste die Aufgabe sein, dass sie ihnen den Mut verlieh, den Saar zu überqueren. Nein, er durfte sie nicht verraten, unmöglich, das spürte er.
»Ich weiß nichts von ihnen.«
Die Miene der jungen Frau wurde sehr ernst. »Ich hätte dich für klüger gehalten.«
So jäh stach sie zu, dass Torio kaum Schmerz verspürte. Dann sah er das Blut und begann zu schreien.
»Wir wissen, dass du ihnen ein Boot gegeben hast. Wo wollten sie hin?«
Torio merkte, wie ihm die Wahrheit auf die Zunge trat, so wie das Blut, das aus seiner Wunde troff, aber es gelang ihm, sie zurückzuhalten. Es war eine Sache der Ehre, des Respekts Menschen gegenüber, die ihn um Hilfe gebeten hatten. »Das haben sie mir nicht gesagt.«
Wieder stach das Mädchen zu, in die andere Wange. Torio wurde schwarz vor Augen.
»Du bist wirklich zu dumm.«
»Nach Norden … zu den Wasserfällen …«, hauchte er.
Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Das war ein Fehler … das war wirklich ein Fehler. Glaubst du, wir merken nicht, wenn man uns belügt?«
Im Morgengrauen glitt ein lebloser Körper langsam in das sumpfige Wasser. Rekla kniete am Ufer, neben ihr ein Fläschchen mit Blut, das mit einer grünen Flüssigkeit vermischt war. Sie sprach die Gebete, die sie in den langen Nächten in Thenaars Tempel gelernt hatte, die Hände so fest gefaltet, dass ihre Fingerknöchel weiß waren.
Vergib mir, oh Herr! Nimm es an, dieses Blut, in Erwartung des Bluts der Verräterin, das ich selbst in deine Becken gießen werde.
Thenaar antwortete nicht, und sein Schweigen traf Rekla bis ins Mark.
»Was machen wir jetzt?«, fragte einer der beiden anderen Assassinen unvermittelt.
Sie fuhr herum und starrte ihn böse an.
»Siehst du nicht, dass ich bete?«
»Verzeiht, Herrin, verzeiht mir.«
Rekla murmelte ihr Gebet zu Ende und erhob sich dann. »Wir folgen ihnen, was sonst?«
»Aber Herrin, sie planen, den Saar zu überqueren, das ist ein großes Wagnis … Überlassen wir es doch dem Fluss, für ihr Ende zu sorgen. Ich habe viel gehört vom Saar und seinen Strömungen, nein, das schaffen sie nicht, die Fische werden sie fressen.«
Da packte ihn Rekla an der Gurgel. »Zwei Feinde Thenaars streifen ungehindert durch die Aufgetauchte Welt«, schrie sie, »und was schlägst du vor? Sie laufen zu lassen! Ist dir denn nicht klar, dass sie alles zerstören könnten, was wir uns in Jahrzehnten aufgebaut haben?«
Sie drückte noch fester zu.
»Wenn dein Glaube nicht stark genug ist für diese Aufgabe, wenn du so feige bist und nicht bereit, für unseren Gott dein Leben zu opfern, dann musst du eben umkehren. Ich jedenfalls werde mich nicht aufhalten lassen, weder vom Saar noch von sonst irgendetwas. Niemals.«
Sie wandte sich dem anderen Assassinen zu und blickte ihn entschlossen an.
»Wir müssen Seiner Exzellenz Bericht erstatten. Ich denke, es ist an der Zeit, dass uns Dohor seine Treue beweist, indem er uns einen Drachen zur Verfügung stellt.«
So wie ihre Köpfe mit jedem Zug ins Wasser ein- und daraus auftauchten, hob und senkte sich der Streifen Land vor ihnen. Mittlerweile war die Anstrengung übermenschlich. Aber es fehlte nicht mehr viel, jetzt nur nicht aufgeben.
Plötzlich ein Schrei, Dubhe hielt inne und drehte sich um. Nicht weit von ihr entfernt sah sie Lonerin, der aufgeregt winkte und um Hilfe flehte.
Hastig schwamm sie zurück, tauchte unter und sah Lonerins Kopf unter der Wasseroberfläche, während seine Beine hektisch strampelten. Sie legte ihm einen Arm um die Schultern und zog ihn hoch. Eine Weile rangen beide nach Luft und schwammen dann weiter, während das Brüllen hinter ihnen noch einmal anschwoll.
»Es taucht wieder auf!«, rief Lonerin und begann, noch einmal die Zauberformel zu sprechen. Aber das war gar nicht mehr nötig.
Ihre Füße berührten den schlammigen Grund des Flusses, und nach einigen weiteren Zügen konnten sie sich aufrichten. Immer niedriger wurde das Wasser, ihre Glieder schwerer, nur noch ein paar Schritte, und der Fluss lag hinter ihnen. Mit den Kräften am Ende, ließen sie sich noch ins Gras fallen, hatten keinen Blick für die Unerforschten Lande, die sie endlich erreicht hatten.
Ein lautes Brüllen hinter ihnen ließ sie noch einmal herumfahren. In einiger Entfernung vom Ufer reckte sich ein grüner Schlangenkörper aus dem Wasser des Saars, warf seinen überdimensionalen Kopf, halb Reptil, halb Pferd, hin und her und brüllte dem Himmel seine Wut über die entgangene Beute entgegen.
Von einem Fischer namens Torio, der ihnen vom Rat empfohlen worden war, hatten sie sich in Marva ein Boot geben lassen.
Dubhe war der Mann nicht eben gescheit vorgekommen, und Lonerin schien diesen Eindruck zu teilen. Doch Torio half ihnen und versorgte sie mit allem, was sie für die Reise benötigten: Fisch und Trockenfleisch, auch etwas Obst für die lange Überfahrt sowie mit einem Beutel, um das alles zu transportieren. Auch die Fläschchen mit dem für Dubhe unverzichtbaren Trank, der den Fluch unter Kontrolle halten sollte, packte Lonerin hinein.
»Der ist nach einem neuen Rezept hergestellt, das ich selbst entwickelt habe«, erklärte er, während er die Ampullen vorsichtig verstaute. »Reklas Mittel macht dich abhängig, das hier hoffentlich weniger.«
In Lonerins Augen erkannte Dubhe wieder dieses scheinbar grenzenlose Mitleid mit ihr, und für einen Moment ärgerte sie sich darüber. Doch senkte sie nur den Blick und konzentrierte sich wieder darauf, ihre Ausrüstung in das Boot zu laden.
Sie griff zu den Wurfmessern, den Pfeilen und dem Dolch, von dem sie sich niemals trennte. Es war der ihres Meisters.
Lonerin hingegen kümmerte sich um das Boot.
Dubhe blieb nicht, um ihm dabei zuzuschauen, wie er die Zauber sprach, die ihr Boot widerstandsfähiger gegen die Strömungen des Saars machen sollten. Nach den langen Jahren der Einsamkeit hatte sie sich noch nicht daran gewöhnt, einen Reisengefährten zu haben, und war, wenn möglich, lieber allein.
In einiger Entfernung setzte sie sich auf einen Steg und ließ den Blick über das flache Sumpfgebiet schweifen. Dabei dachte sie an ihr Leben, an ihren Meister. Wenn sie es genauer betrachtete, kam ihr die Errettung von dem Fluch, dessentwegen sie unterwegs war, nur wie eine Notwendigkeit, nicht aber wie ein Herzenswunsch vor. Es war einfach der Weg, der ihr vorgegeben war und von dem sie nicht abweichen konnte. Nach irgendeinem unerforschlichen Ratschluss führte eine gerade Spur von dem dramatischen Einschnitt ihrer Kindheit – als sie ihren Kameraden Gornar unbeabsichtigt getötet hatte – bis zu diesem verlassenen Dorf in den Sümpfen.
»Es ist noch niemandem gelungen, mit einem Boot den Saar zu überqueren«, hatte Torio beim Aufbruch zu ihnen gesagt.
»Dann werden wir die Ersten sein«, erwiderte Lonerin trocken, »und ich verspreche dir noch mehr: Wir werden auch heil zurückkehren.«
Er dachte nicht daran, es sich noch einmal anders zu überlegen, und Dubhe beneidete ihn um seine Zuversicht. Für sich selbst sah sie eher schwarz.
Schließlich stiegen sie in das Boot und befuhren einen kleinen Wasserlauf bis zu einem Nebenfluss des Saars, dem sie folgten, bis er irgendwann in eine Wasserfläche von immenser Weite mündete: den Großen Fluss.
Allein schon der Anblick ließ Furcht aufkommen. Diese Weite erinnerte Dubhe an das Meer, an den Ozean, wo sie eine Zeit lang mit ihrem Meister gelebt hatte. Gewiss, hier gab es keine Wellen, doch das Schauspiel war ähnlich grandios, zumal die Wasserfläche ganz weiß erschien. Denn jetzt, im späten Frühling, war die Sonne schon so stark, dass sie die ganze Weite in grellstes Licht tauchte.
Fast ehrfürchtig, so als verletzten sie geweihtes Gebiet, wagten sie sich in die Wasser des Großen Flusses vor. Aber war er nicht auch so etwas wie eine Gottheit, dieser Strom, der die Grenze zwischen der Aufgetauchten Welt und dem völlig Unbekannten bildete?
Mächtig legten sie sich in die Riemen, wobei Lonerin, der vorn saß, den Takt vorgab. Dabei folgten sie dem Licht am Bug, das der Magier hervorgezaubert hatte, eine schmale leuchtende Sichel, die unbeirrbar nach Westen, zum anderen Ufer wies.
Die Strömung war so gewaltig, dass ihre Arme bald schon so schwer wie Ambosse waren. Besonders Lonerins Kräfte ließen mehr und mehr nach, da er als Magier nie auf seine körperliche Ertüchtigung Wert gelegt hatte. Aber er ließ sich nicht unterkriegen – wie Dubhe bewundernd feststellte. Seine Entschlossenheit war wirklich beachtlich. So fuhren sie langsam, aber stetig ohne größere Schwierigkeiten dahin, und anfangs dachten beide, dass nur die immense Ausdehnung des Saars ein Hindernis darstelle. Die Wasser schienen keine Tücken zu bergen, und der Himmel über ihnen, an dem keine Vögel zu sehen waren, sodass sie fast den ganzen Tag in vollkommener Stille dahinglitten, war blau.
Irgendwann gelangten sie zu einer Insel. Kreisrund lag sie mitten im Fluss vor ihnen. Als Lonerin sie erblickte, war er begeistert, und sogar Dubhe verspürte eine eigenartige Erregung. Zwei Tage waren sie mittlerweile auf dem Großen Fluss unterwegs und vom anderen Ufer noch keine Spur.
Ohne lange zu überlegen, gingen sie an Land, glücklich, endlich wieder festen Grund unter den Füßen zu haben. Aber es war schon eine eigenartige Insel, ein so perfektes Rund, dass sie sich wunderten, und der Boden fühlte sich auch etwas seltsam an. Darüber hinaus aber war es eine ganz normale Insel, mit grünem Gras und niedrigem Buschwerk bewachsen.
An einem solchen Busch machten sie das Boot fest, legten sich nieder und schliefen bald ein. Nur Dubhes leichtem Schlaf, den sie sich von ihrer Ausbildung bei dem Meister erhalten hatte, war es zu verdanken, dass sie noch rechtzeitig aufmerksam wurden.
So fuhr sie plötzlich aus dem Schlaf hoch und merkte, dass die Erde unter ihnen seltsam bebte. Unverzüglich rüttelte sie Lonerin wach.
»Was ist denn los?«, fragte er verschlafen.
Noch konnte Dubhe ihm das nicht sagen, doch sie brauchte nur den Blick zu heben, um zu sehen, dass sich die Insel gegen den Strom bewegte. »Merkst du das nicht?«, rief sie und sprang auf.
Augenblicklich war Lonerin hellwach. Ihr erster Gedanke galt dem Boot, das aber, noch fest vertäut, ebenfalls mitgezogen wurde. Als sie hinrannten, merkten sie, dass die Insel nach vorn kippte, immer schneller wurde und gleichzeitig zu sinken begann.
Fassungslos blieb Dubhe stehen, doch Lonerins Stimme riss sie aus dem Staunen. »Verdammt! Ein Ungeheuer!«
Sie standen bereits bis zu den Knöcheln im Wasser, und kurz darauf verloren sie den festen Boden unter den Füßen und trieben mitten im Fluss.
Schwimmend erreichte Dubhe als Erste die Leine, mit der das Boot festgemacht war. Es hatte sich schon aufgebäumt, und einige Vorräte waren im Wasser gelandet, für immer verloren in den Tiefen des Flusses.
Mit einer Hand ergriff sie das Tau, während sie mit der anderen rasch ihren Dolch zog. Ein kräftiger Hieb genügte, die Leine war gekappt, und das Boot schnellte wieder hoch. Unter großer Anstrengung gelang es Dubhe, an Bord zu klettern, und kaum war sie drin, reckte sie sich vor, um dem Kameraden hineinzuhelfen.
»Hast du eine Ahnung, was hier los ist?«, fragte sie, während sie sich aufrichtete.
Lonerin schüttelte nur den Kopf. »Nein, aber da ist es wieder.«
Dubhe fuhr herum. Das Ungeheuer tauchte wieder auf, und was kurz zuvor noch eine Insel für sie war, sah jetzt nur noch wie eine groteske kreisrunde Rasenfläche auf einem überdimensionalen Körper aus. Es war der Leib einer riesenhaften Schlange, bedeckt mit grünen Schuppen, die zum Bauch hin, wo in regelmäßigen Abständen knallgelbe Flossen herausstachen, weiß wurden.
Zitternd starrte Dubhe mit offenem Mund auf das Ungeheuer.
»Die Ruder …!«, rief Lonerin, nicht weniger schockiert als sie. »Die Ruder …!«
Doch als das Mädchen nach ihnen greifen wollte, tauchte plötzlich ein riesiger Kopf aus dem Wasser auf, halb Schlangen-, halb Pferdkopf, mit einem weit aufgerissenen Maul, das den Blick auf entsetzlich lange Reißzähne freigab.
Im nächsten Augenblick würde sich dieser Schlund wieder schließen und sie verschlingen, und Dubhe dachte tatsächlich, dass es um sie geschehen sei. Unwillkürlich schloss sie die Augen, doch statt eines fürchterlichen Schmerzes durch diese Zähne, die ihr Fleisch zerrissen, gab es nur einen mächtigen Schlag.
Sie riss die Augen auf und sah, dass sich um das Boot herum eine silberne Kugel gebildet hatte. Von Lonerins Händen, der unerschrocken neben ihr stand, ging sie aus, und die Zähne des Ungeheuers steckten darin fest.
»Mach dich fertig!«, rief Lonerin, »sobald ich den Schutzschirm wegziehe, bist du an der Reihe.« Doch sie stand längst bereit.
Der Schutzschild verschwand, Dubhe führte eine Hand zur Brust, wo ihre Wurfmesser steckten, ergriff eines, schleuderte es los und traf genau. Die Klinge bohrte sich in ein Auge des Seeungeheuers. Vor Schmerz laut brüllend, wich es jäh zurück und schlug wütend um sich. Sofort begann das Boot, bedrohlich hin und her zu schwanken, und Lonerin fiel nach vorn. Dennoch gelang es ihm, eilig eine Zauberformel zu sprechen, sodass sich das Boot in die Lüfte erhob und, wie von einem magischen Wind getragen, davonglitt.
Während sie sich entfernten, sah Dubhe das gigantische Geschöpf hin und her schnellen, während sein riesiges Maul immer wieder auf der Suche nach der entgangenen Beute ins Leere schnappte.
Erst als Lonerin vollends die Kräfte verließen, griffen sie wieder zu den Rudern. Die ganze Zeit, während er das Boot durch die Lüfte hatte schweben lassen, beobachtete Dubhe schweigend und staunend, wie er alles gab, um sie beide zu retten. Nicht länger als eine halbe Stunde schaffte er es, den Zauber aufrechtzuerhalten, aber das tat ihrer Bewunderung keinen Abbruch.
Nun ruderte sie allein, so schnell sie konnte, und blickte dabei immer wieder zu Lonerin hinüber, der völlig erschöpft rücklings und mit geschlossenen Augen im Boot lag. Diese Nervenstärke angesichts solch eines gigantischen Seeungeheuers hätte sie ihm niemals zugetraut. Sogar sie selbst, die ja an Schrecken gewohnt war, hatte gewankt.
»Du warst … fantastisch«, sagte sie irgendwann zögernd. Es geschah zum ersten Mal, dass sie ihn lobte.
Lonerin lächelte, ohne die Augen zu öffnen. »Das hab ich mir bei Sennar abgeschaut. Hast du nicht von seinen Abenteuern auf See gelesen?«
Dubhe nickt heftig. Als kleines Mädchen, als sie noch in ihrem Heimatdorf Selva im Land der Sonne lebte und Gornar noch nicht tot war, hatte sie sich für Sennar begeistert und nicht genug bekommen können von seinen fantastischen Erlebnissen.
»Er hat als Erster diesen Zauber auf dem Meer angewandt, aber nicht nur bei einem kleinen Boot, sondern bei einem großen Segler, dem der Piratin Aires, und das viel länger als eine halbe Stunde.«
Ja, Dubhe konnte sich genau erinnern.
»Glaubst du, das Ungeheuer taucht noch mal auf?«, fragte Lonerin.
Zwar hatte Dubhe ihm ein Auge ausgestochen – da konnten sie sicher sein, denn sie verfehlte nie ihr Ziel -, aber tödlich war die Verwundung sicher nicht. »Keine Ahnung«, murmelte sie, »jedenfalls sollten wir uns beeilen.«
Die ganze Nacht hindurch ruderten sie und dann noch den folgenden Tag, bis sich endlich am Horizont ein schmaler grüner Streifen abzeichnete. Für beide war es wie ein Wunder.
»Land! Land!«, rief Lonerin, als der Streifen breiter wurde und dann mehr und mehr die Umrisse eines Waldes zu sehen waren.
Ihre Arme fanden neue Kraft.
Und plötzlich erhob sich eine Welle, himmelhoch, unnatürlich, und ein markerschütterndes Brüllen erfüllte die Luft.
Obwohl ihr Herz wie wahnsinnig zu schlagen begann, geriet Dubhe diesmal nicht in Panik. »Kümmere du dich um das Boot«, forderte sie Lonerin auf und überließ ihm die Ruder. Dann griff sie zu dem Bogen, den sie um die Schulter trug, zog rasch zwei Pfeile aus dem Köcher und nahm Aufstellung.
Gerade tauchte das Ungeheuer wieder aus den Fluten auf, immens und bedrohlich, und Dubhe erkannte die schwarze Höhle, wo vorher einmal sein Auge gesessen hatte. Das andere aber blitzte vor Wut und vor Schmerz.
Bei diesem Anblick befiel ein leichtes Zittern Dubhes Hand, doch sie bekam es in den Griff. Ohne zu zaudern, ließ sie den Pfeil losschnellen, der sich genau in die Stirn des Seeungeheuers bohrte. Das brüllte auf und reckte seinen enormen Leib aus dem Wasser, sodass eine neue Flutwelle das Boot erfasste und auf und ab tanzen ließ.
»Lass es fliegen!«, schrie Dubhe Lonerin zu, ohne ihr Ziel aus den Augen zu lassen, den Pfeil bereits aufgelegt.
»Ich habe keine Kraft mehr!«, rief Lonerin schwer atmend zurück.
Der Pfeil schnellte los und bohrte sich jetzt in den Hals der Bestie. Während das Blut hervorspritzte, begann das gigantische Geschöpf, wild um sich zu schlagen.
»Geschafft«, murmelte Dubhe.
Doch sie hatte sich zu früh gefreut. Noch einmal holte das Ungeheuer aus und ließ mit einem fürchterlichen Schlag die Schwanzflosse unmittelbar neben ihnen niederfahren. Dem hielt das Boot nicht mehr stand und zerbarst.
Dubhe schaffte es gerade noch, Bogen und Köcher an sich zu reißen. Dann wurde sie unter Wasser gedrückt, fuchtelte wild mit den Armen, spürte aber gleich darauf, wie sie an den Haaren gepackt und hochgezogen wurde. Keuchend blickte sie in Lonerins blasses Gesicht mit den grünen Augen und den an der Stirn klebenden schwarzen Haaren.
»Schwimm!«, forderte er sie auf, und das taten sie.
In panischem Schrecken schwammen sie, so schnell sie konnten, während ihnen die von den Zuckungen des Ungeheuers verursachten Wellen immer wieder die Sicht auf das Ufer, die ersehnte Rettung, nahmen.
Und schließlich schafften sie es beide, fanden sich nach Luft ringend und entkräftet am Strand, am Rand der Unerforschten Lande wieder.
2
Wieder in Aktion
Lieber Ido,
ich weiß, es ist viel Zeit vergangen, seit ich Dir das letzte Mal geschrieben habe, und dafür schäme ich mich. Du hättest eine bessere Behandlung verdient. In der Zwischenzeit ist sehr viel geschehen, Dramatisches hat sich zugetragen, und dies ist der Grund, wieso ich mich so lange nicht gemeldet habe. Tarik ist fort von mir.
Wie Du weißt, war das Verhältnis zwischen meinem Sohn und mir schon lange gestört, doch ich schob es auf sein Alter, denn in gewisser Weise hassen ja alle Jungen irgendwann einmal ihren Vater … Zudem hoffte ich, dass er mich im Grund doch lieben würde, dass unserer gemeinsamer Schmerz und unsere Blutsbande stärker seien als all unsere törichten Meinungsverschiedenheiten. Doch ich irrte mich. Es waren nicht die üblichen Reibereien zwischen Vater und Sohn. Er hasst mich tatsächlich, das weiß ich jetzt, er hat mir nie verziehen, was geschehen ist, und das kann ich sogar verstehen: Wie sollte er auch, da es mir selbst ja auch keine Ruhe lässt? Tatsache ist, dass wir beide nach Nihals Tod ein freudloses Leben geführt haben, nicht mehr taten, als zu überleben, zu atmen und zu essen. Es war, als sei ich selbst mit ihr gestorben, und so konnte ich ihm kein Leitbild sein, konnte ihm nicht helfen, diese klaffende Wunde in seinem Herzen zu schließen. Wie eine Pflanze, die im Dunkeln heranwächst, zog ich ihn auf, und so hat er sich immer weiter von mir entfernt. Ist es nicht tragisch, dass uns die Wahrheit so häufig erst dann klar wird, wenn es bereits zu spät ist? Nun stehe ich vor einem Scherbenhaufen, denke über mein Versagen nach, während ich hier am Tisch sitze, den Brief vor mir, und um mich herum nur der von der Finsternis eingeschlossene Wald.
Ach Ido, ich fühle mich so allein. Wäre Nihal noch da, wäre das alles nicht passiert. Wenn ich zurückdenke an die Jahre, die wir hier zusammen mit Tarik verbracht haben, spüre ich noch, wie glücklich wir waren. Und dabei hätte ich damals schon wissen können, dass Leute wie wir kein Recht auf Ruhe und Frieden haben. Nihal hat das häufig gesagt, als wir noch in der Aufgetauchten Welt zusammenlebten.
Aber ich schweife ab. Im Moment komme ich mir vor wie ein Boot, das von Strudeln hin und her geworfen wird, habe gerade heute Abend das Gefühl, den Verstand zu verlieren. Aber vielleicht erzähle ich Dir am besten alles der Reihe nach.
Es begann wie so oft. Ich weiß noch nicht einmal mehr den Grund, an dem sich der Streit entzündete. Vielleicht wollte er zur Küste hinunter, und ich verbot es ihm. Manchmal zog es ihn dorthin, ich weiß gar nicht, warum, vielleicht nur, um mich zu ärgern, denn dort leben die Elfen. Auf alle Fälle begannen wir zu streiten und uns auf übelste Weise anzugiften … Wir schlugen uns alles um die Ohren, was sich aufgestaut hatte, spuckten auf diese fünfzehn gemeinsamen Jahre. Irgendwann stürmte er in sein Zimmer und schloss sich dort ein, und ich verkroch mich in meines, habe nur noch über den Büchern gesessen.
Eine ganz Woche lang haben wir nicht miteinander geredet. Mein Gott, was bin ich für ein miserabler Vater … Aber wie hätte ich auch wissen sollen … Schließlich kam er aus seinem Zimmer und klopfte bei mir an. Er sah so ernst aus, und ich dachte bei mir, dass er erwachsener geworden, dass er, ohne dass ich es bemerkt hatte, zum Mann geworden war und dass wir uns nun vielleicht endlich besser verstehen würden. Stattdessen eröffnete er mir, er halte dieses Leben nicht mehr aus, in den Unerforschten Landen gehe er langsam zugrunde, er müsse etwas ganz Neues anfangen, und in seinem Alter habe seine Mutter schon eine klare Vorstellung davon gehabt, was sie mit ihrem Leben anfangen wolle. Er sagte, dass er fortziehen würde, wohin, wisse er noch nicht, aber mit Sicherheit weit weg von mir.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright © 2006 by Licia Troisi Copyright © 2008 der deutschen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH Redaktion: Dr. Ulrike Schimming Herstellung: Helga Schörnig
Gesetzt aus der 11,5/13,2 Punkt Weiss
eISBN : 978-3-641-03390-3V003
www.heyne.de
www.randomhouse.de