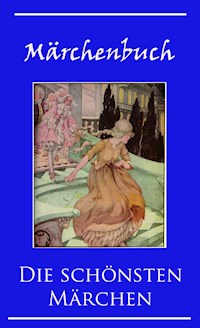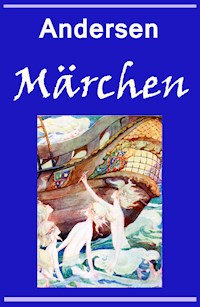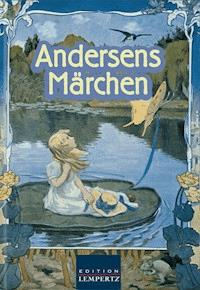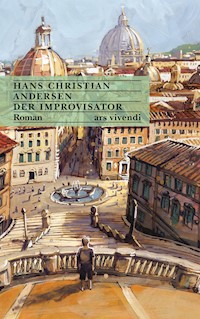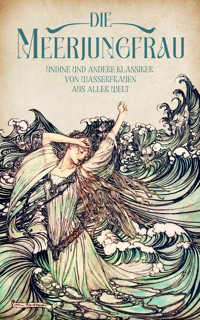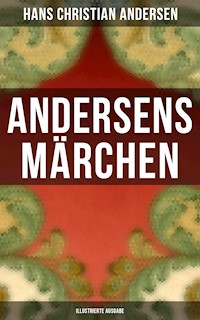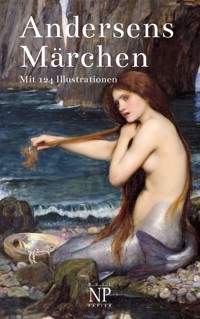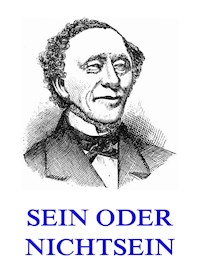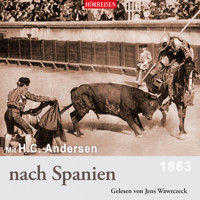3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Die Märchen von Hans Christian Andersen versetzen uns in eine märchenhafte Wirklichkeit. Sie spiegeln dabei die Schwächen der Menschen, ihre Träume und Wünsche: Der Kaiser in ›Des Kaisers neue Kleider‹ bleibt nackt, weil er sich von Betrügern bei seinem Stolz packen lässt. ›Die kleine Seejungfrau‹ gibt ihre Stimme und schließlich ihr Leben hin, um wenigstens hoffen zu können auf menschliche Liebe. Inhalt: ›Däumelinchen‹, ›Der standhafte Zinnsoldat‹, ›Der kleine Klaus und der große Klaus‹, ›Das häßliche Entlein‹ und viele andere.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Hans Christian Andersen
Die schönsten Märchen
Märchen
Fischer e-books
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon.Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
Der Tannenbaum
Draußen im Walde stand ein niedlicher, kleiner Tannenbaum; er hatte einen guten Platz, Sonne konnte er bekommen, Luft war genug da, und ringsumher wuchsen viel größere Kameraden, sowohl Tannen als Fichten. Aber dem kleinen Tannenbaum schien nichts so wichtig als das Wachsen; er achtete nicht der warmen Sonne und der frischen Luft, er kümmerte sich nicht um die Bauerkinder, die da gingen und plauderten, wenn sie herausgekommen waren, um Erdbeeren und Himbeeren zu sammeln. Oft kamen sie mit einem ganzen Topf voll oder hatten Erdbeeren auf einen Strohhalm gezogen, dann setzten sie sich neben den kleinen Tannenbaum und sagten: »Wie niedlich klein ist der!« Das mochte der Baum gar nicht hören.
Im folgenden Jahre war er ein langes Glied größer, und das Jahr darauf war er um noch eins länger, denn bei den Tannenbäumen kann man immer an den vielen Gliedern, die sie haben, sehen, wie viele Jahre sie gewachsen sind.
»O, wäre ich doch so ein großer Baum wie die andern!«, seufzte das kleine Bäumchen. »Dann könnte ich meine Zweige so weit umher ausbreiten und mit der Krone in die weite Welt hinausblicken! Die Vögel würden dann Nester zwischen meinen Zweigen bauen, und wenn der Wind weht, könnte ich so vornehm nicken, gerade wie die andern dort!«
Er hatte gar keine Freude am Sonnenschein, an den Vögeln und den roten Wolken, die morgens und abends über ihn hinsegelten.
War es nun Winter und der Schnee lag ringsumher funkelnd weiß, so kam häufig ein Hase angesprungen und setzte gerade über den kleinen Baum weg. O, das war ärgerlich! Aber zwei Winter vergingen und im dritten war das Bäumchen so groß, dass der Hase um dasselbe herumlaufen musste. »O, wachsen, wachsen, groß und alt werden, das ist doch das einzige Schöne in dieser Welt!«, dachte der Baum.
Im Herbst kamen immer Holzhauer und fällten einige der größten Bäume; das geschah jedes Jahr und dem jungen Tannenbaum, der nun ganz gut gewachsen war, schauderte dabei; denn die großen, prächtigen Bäume fielen mit Knacken und Krachen zur Erde, die Zweige wurden abgehauen, die Bäume sahen ganz nackt, lang und schmal aus; sie waren fast nicht zu erkennen. Aber dann wurden sie auf Wagen gelegt und Pferde zogen sie davon, aus dem Walde hinaus.
Wohin sollten sie? Was stand ihnen bevor?
Im Frühjahr, als die Schwalben und Störche kamen, fragte sie der Baum: »Wisst ihr nicht, wohin sie geführt wurden? Seid ihr ihnen begegnet?«
Die Schwalben wussten nichts, aber der Storch sah nachdenkend aus, nickte mit dem Kopfe und sagte: »Ja, ich glaube wohl; mir begegneten viele neue Schiffe, als ich aus Ägypten flog; auf den Schiffen waren prächtige Mastbäume; ich darf annehmen, dass sie es waren, sie hatten Tannengeruch; ich kann vielmals grüßen, sie prangen, sie prangen!«
»O, wäre ich doch auch groß genug, um über das Meer hinfahren zu können! Was ist das eigentlich, dieses Meer, und wie sieht es aus?«
»Ja, das ist weitläufig zu erklären!«, sagte der Storch und damit ging er.
»Freue dich deiner Jugend!«, sagten die Sonnenstrahlen; »freue dich deines frischen Wachstums, des jungen Lebens, das in dir ist!«
Und der Wind küsste den Baum und der Tau weinte Tränen über denselben, aber das verstand der Tannenbaum nicht.
Wenn es gegen die Weihnachtszeit war, wurden ganz junge Bäume gefällt, Bäume, die oft nicht einmal so groß oder gleichen Alters mit diesem Tannenbaume waren, der weder Rast noch Ruhe hatte, sondern immer davonwollte; diese jungen Bäume und es waren gerade die allerschönsten, behielten immer alle ihre Zweige; sie wurden auf Wagen gelegt und Pferde zogen sie von dannen zum Walde hinaus.
»Wohin sollen diese?«, fragte der Tannenbaum. »Sie sind nicht größer als ich, einer ist sogar viel kleiner; weswegen behalten sie alle ihre Zweige? Wohin fahren sie?«
»Das wissen wir! Das wissen wir!«, zwitscherten die Sperlinge. »Unten in der Stadt haben wir in die Fenster gesehen! Wir wissen, wohin sie fahren! O, sie gelangen zur größten Pracht und Herrlichkeit, die man sich denken kann! Wir haben in die Fenster gesehen und erblickt, dass sie mitten in der warmen Stube aufgepflanzt und mit den schönsten Sachen, vergoldeten Äpfeln, Honigkuchen, Spielzeug und vielen hundert Lichtern geschmückt werden.«
»Und dann?«, fragte der Tannenbaum und bebte in allen Zweigen. »Und dann? Was geschieht dann?«
»Ja, mehr haben wir nicht gesehen! Das war unvergleichlich schön!«
»Ob ich wohl bestimmt bin, diesen strahlenden Weg zu betreten?«, jubelte der Tannenbaum. »Das ist noch besser, als über das Meer zu ziehen! Wie leide ich an Sehnsucht! Wäre es doch Weihnachten! Nun bin ich hoch und entfaltet wie die andern, die im vorigen Jahre davongeführt wurden! O, wäre ich erst auf dem Wagen, wäre ich doch in der warmen Stube mit all der Pracht und Herrlichkeit! Und dann? Ja, dann kommt noch etwas Besseres, noch Schöneres, warum würden sie mich sonst so schmücken? Es muss noch etwas Größeres, Herrlicheres kommen! Aber was? O, ich leide, ich sehne mich, ich weiß selbst nicht, wie es mir ist!«
»Freue dich unser!«, sagten die Luft und das Sonnenlicht; »freue dich deiner frischen Jugend im Freien!«
Aber er freute sich durchaus nicht; er wuchs und wuchs, Winter und Sommer stand er grün; dunkelgrün stand er da, die Leute, die ihn sahen, sagten: »Das ist ein schöner Baum!«, und zur Weihnachtszeit wurde er von allen zuerst gefällt. Die Axt hieb tief durch das Mark; der Baum fiel mit einem Seufzer zu Boden, er fühlte einen Schmerz, eine Ohnmacht, er konnte gar nicht an irgendein Glück denken, er war betrübt, von der Heimat scheiden zu müssen, von dem Flecke, auf dem er emporgeschossen war; er wusste ja, dass er die lieben, alten Kameraden, die kleinen Büsche und Blumen ringsumher nie mehr sehen werde, ja vielleicht nicht einmal die Vögel. Die Abreise hatte durchaus nichts Behagliches.
Der Baum kam erst wieder zu sich selbst, als er im Hofe, mit andern Bäumen abgeladen, einen Mann sagen hörte: »Dieser hier ist prächtig! Wir brauchen nur diesen!«
Nun kamen zwei Diener im vollen Staat und trugen den Tannenbaum in einen großen, schönen Saal. Ringsherum an den Wänden hingen Bilder und bei dem großen Kachelofen standen große chinesische Vasen mit Löwen auf den Deckeln; da waren Wiegestühle, seidene Sofas, große Tische voll von Bilderbüchern und Spielzeug für hundertmal hundert Taler; wenigstens sagten das die Kinder. Der Tannenbaum wurde in ein großes, mit Sand gefülltes Fass gestellt, aber niemand konnte sehen, dass es ein Fass war, denn es wurde rund herum mit grünem Zeug behängt und stand auf einem großen, bunten Teppich. O, wie der Baum bebte! Was wird da doch vorgehen? Sowohl die Diener als die Fräulein schmückten ihn. An einen Zweig hängten sie kleine Netze, aus farbigem Papier ausgeschnitten, jedes Netz war mit Zuckerwerk gefüllt; vergoldete Äpfel und Walnüsse hingen herab, als wären sie festgewachsen, und über hundert rote, blaue und weiße kleine Lichter wurden in den Zweigen festgesteckt. Puppen, die leibhaft wie die Menschen aussahen – der Baum hatte früher nie solche gesehen –, schwebten im Grünen und hoch oben in der Spitze wurde ein Stern von Flittergold befestigt. Das war prächtig, ganz außerordentlich prächtig!
»Heute Abend«, sagten alle, »heute Abend wird es strahlen!«
»O«, dachte der Baum, »wäre es doch Abend! Würden nur die Lichter bald angezündet! Und was dann wohl geschieht? Ob da wohl Bäume aus dem Walde kommen, mich zu sehen? Ob die Sperlinge gegen die Fensterscheiben fliegen? Ob ich hier festwachse und Winter und Sommer geschmückt stehen werde?«
Ja, er wusste gut Bescheid; aber er hatte ordentlich Borkenschmerzen vor lauter Sehnsucht, und Borkenschmerzen sind für einen Baum eben so schlimm wie Kopfschmerzen für uns andere.
Nun wurden die Lichter angezündet. Welcher Glanz, welche Pracht! Der Baum bebte in allen Zweigen dabei, so dass eins der Lichter das Grüne anbrannte; es sengte ordentlich.
»Gott bewahre uns!«, schrien die Fräulein und löschten es hastig aus.
Nun durfte der Baum nicht einmal beben. O, das war ein Grauen! Ihm war bange etwas von seinem Staate zu verlieren; er war ganz betäubt von all dem Glanze. Da gingen beide Flügeltüren auf und eine Menge Kinder stürzten herein, als wollten sie den ganzen Baum umwerfen, die älteren Leute kamen bedächtig nach; die Kleinen standen ganz stumm, aber nur einen Augenblick, dann jubelten sie wieder, dass es laut schallte, sie tanzten um den Baum herum, und ein Geschenk nach dem andern wurde abgepflückt.
»Was machen sie?«, dachte der Baum. »Was soll geschehen?« Die Lichter brannten gerade bis auf die Zweige herunter, und je nachdem sie niederbrannten, wurden sie ausgelöscht, und dann erhielten die Kinder die Erlaubnis, den Baum zu plündern. O, sie stürzten auf denselben ein, dass es in allen Zweigen knackte; wäre er nicht mit der Spitze und mit dem Goldsterne an der Decke festgemacht gewesen, so wäre er umgestürzt.
Die Kinder tanzten mit ihrem prächtigen Spielzeug herum, niemand sah nach dem Baume, ausgenommen das alte Kindermädchen, welches kam und zwischen die Zweige blickte; aber es geschah nur, um zu sehen, ob nicht noch eine Feige oder ein Apfel vergessen sei.
»Eine Geschichte, eine Geschichte!«, riefen die Kinder und zogen einen kleinen, dicken Mann gegen den Baum hin, und er setzte sich gerade unter denselben, »denn so sind wir im Grünen«, sagte er, »und der Baum kann besonders Nutzen davon haben, zuzuhören! Aber ich erzähle nur eine Geschichte. Wollt ihr die von Ivede-Avede oder die von Klumpe-Dumpe hören, der die Treppen hinunterfiel und doch erhöht wurde und die Prinzessin erhielt?«
»Ivede-Avede!«, schrien einige, »Klumpe-Dumpe!«, schrien andere. Das war ein Rufen und Schreien! Nur der Tannenbaum schwieg ganz still und dachte: »Komme ich gar nicht mit, werde ich nichts dabei zu tun haben?« Er war ja mit gewesen, hatte ja geleistet, was er sollte.
Der Mann erzählte von Klumpe-Dumpe, welcher die Treppen hinunterfiel und doch erhöht wurde und die Prinzessin erhielt. Und die Kinder klatschten in die Hände und riefen: »Erzähle, erzähle!« Sie wollten auch die Geschichte von Ivede-Avede hören, aber sie bekamen nur die von Klumpe-Dumpe. Der Tannenbaum stand ganz stumm und gedankenvoll, nie hatten die Vögel im Walde dergleichen erzählt. »Klumpe-Dumpe fiel die Treppen hinunter und bekam doch die Prinzessin! Ja, ja, so geht es in der Welt zu!«, dachte der Tannenbaum und glaubte, dass es wahr sei, weil es ein so netter Mann war, der es erzählte. »Ja, ja! Vielleicht falle ich auch die Treppe hinunter und bekomme eine Prinzessin!« Und er freute sich, den nächsten Tag wieder mit Lichtern und Spielzeug Gold und Früchten aufgeputzt zu werden.
»Morgen werde ich nicht zittern!«, dachte er. »Ich will mich recht aller meiner Herrlichkeit freuen. Morgen werde ich wieder die Geschichte von Klumpe-Dumpe und vielleicht auch die von Ivede-Avede hören.« Und der Baum stand die ganze Nacht still und gedankenvoll.
Am Morgen kamen die Diener und das Mädchen herein.
»Nun beginnt der Staat aufs Neue!«, dachte der Baum; aber sie schleppten ihn zum Zimmer hinaus, die Treppe hinauf, auf den Boden und stellten ihn in einen dunkeln Winkel, wohin kein Tageslicht schien. »Was soll das bedeuten?«, dachte der Baum. »Was soll ich hier wohl machen? Was mag ich hier wohl hören sollen?« Er lehnte sich gegen die Mauer und dachte und dachte. Und er hatte Zeit genug, denn es vergingen Tage und Nächte; niemand kam herauf, und als endlich jemand kam, so geschah es, um einige große Kasten in den Winkel zu stellen; der Baum stand ganz versteckt, man musste glauben, dass er ganz vergessen war.
»Nun ist es Winter draußen!«, dachte der Baum. »Die Erde ist hart und mit Schnee bedeckt, die Menschen können mich nicht pflanzen; deshalb soll ich wohl bis zum Frühjahr hier im Schutz stehen! Wie wohl bedacht ist das! Wie die Menschen doch so gut sind! Wäre es hier nur nicht so dunkel und schrecklich einsam! Nicht einmal ein kleiner Hase! Das war doch niedlich da draußen im Walde, wenn der Schnee lag und der Hase vorbeisprang, ja selbst als er über mich hinwegsprang; aber damals mochte ich es nicht leiden. Hier oben ist es doch schrecklich einsam!«
»Pip, pip!«, sagte da eine kleine Maus und huschte hervor; und dann kam noch eine kleine. Sie beschnüffelten den Tannenbaum und dann schlüpften sie zwischen dessen Zweige.
»Es ist eine gräuliche Kälte!«, sagten die kleinen Mäuse. »Sonst ist hier gut sein; nicht wahr, du alter Tannenbaum?«
»Ich bin gar nicht alt!«, sagte der Tannenbaum; »es gibt viele, die weit älter sind denn ich!«
»Woher kommst du«, fragten die Mäuse, »und was weißt du?« Sie waren gewaltig neugierig. »Erzähle uns doch von den schönsten Orten auf Erden! Bist du dort gewesen? Bist du in der Speisekammer gewesen, wo Käse auf den Brettern liegen und Schinken unter der Decke hängen, wo man auf Talglicht tanzt, mager hineingeht und fett herauskommt?«
»Das kenne ich nicht«, sagte der Baum; »aber den Wald kenne ich, wo die Sonne scheint und die Vögel singen!« Und dann erzählte er alles aus seiner Jugend, die kleinen Mäuse hatten früher nie dergleichen gehört, und sie horchten auf und sagten: »Wie viel du gesehen hast! Wie glücklich du gewesen bist!«
»Ich?«, sagte der Tannenbaum und dachte über das, was er selbst erzählte, nach. »Ja, es waren im Grunde ganz fröhliche Zeiten!« Aber dann erzählte er vom Weihnachtsabend, wo er mit Kuchen und Lichtern geschmückt war.
»O«, sagten die kleinen Mäuse, »wie glücklich du gewesen bist, du alter Tannenbaum!«
»Ich bin gar nicht alt!«, sagte der Baum; »erst in diesem Winter bin ich vom Walde gekommen! Ich bin in meinem allerbesten Alter, ich bin nur so aufgeschossen.«
»Wie schön du erzählst!«, sagten die kleinen Mäuse, und in der nächsten Nacht kamen sie mit vier anderen kleinen Mäusen, die den Baum erzählen hören sollten, und je mehr er erzählte, desto deutlicher erinnerte er sich selbst an alles und dachte: »Es waren doch ganz fröhliche Zeiten! Aber sie können wiederkommen, können wiederkommen! Klumpe-Dumpe fiel die Treppe hinunter und erhielt doch die Prinzessin; vielleicht kann ich auch eine Prinzessin bekommen.« Und dann dachte der Tannenbaum an eine kleine niedliche Birke, die draußen im Walde wuchs; das war für den Tannenbaum eine wirkliche schöne Prinzessin.
»Wer ist Klumpe-Dumpe?«, fragten die kleinen Mäuse. Da erzählte der Tannenbaum das ganze Märchen, er konnte sich jedes einzelnen Wortes entsinnen; die kleinen Mäuse waren aus reiner Freude bereit, bis an die Spitze des Baumes zu springen. In der folgenden Nacht kamen weit mehr Mäuse und am Sonntage sogar zwei Ratten, aber die meinten, die Geschichte sei nicht hübsch, und das betrübte die kleinen Mäuse, denn nun hielten sie auch weniger davon.
»Wissen Sie nur die eine Geschichte?«, fragten die Ratten.
»Nur die eine«, antwortete der Baum; »die hörte ich an meinem glücklichsten Abend, aber damals dachte ich nicht daran, wie glücklich ich war.«
»Das ist eine höchst jämmerliche Geschichte! Kennen Sie keine von Speck und Talglicht? Keine Speisekammergeschichte?«
»Nein!«, sagte der Baum.
»Ja, dann danken wir dafür!«, erwiderten die Ratten und gingen zu den ihrigen zurück.
Die kleinen Mäuse blieben zuletzt auch weg, und da seufzte der Baum: »Es war doch ganz hübsch, als sie um mich herumsaßen, die beweglichen kleinen Mäuse, und zuhörten, wie ich erzählte! Nun ist auch das vorbei! Aber ich werde daran denken, mich zu freuen, wenn ich wieder hervorgenommen werde.«
Aber wann geschah das? Ja, es war eines Morgens, da kamen Leute und wirtschafteten auf dem Boden; die Kasten wurden weggesetzt, der Baum wurde hervorgezogen; sie warfen ihn freilich ziemlich hart gegen den Fußboden, aber ein Diener schleppte ihn gleich nach der Treppe hin, wo der Tag leuchtete.
»Nun beginnt das Leben wieder!«, dachte der Baum; er fühlte die frische Luft, die ersten Sonnenstrahlen, und nun war er draußen im Hofe. Alles ging geschwind, der Baum vergaß völlig, sich selbst zu betrachten, da war so vieles ringsumher zu sehen. Der Hof stieß an einen Garten, und alles blühte darin; die Rosen hingen frisch und duftend über das kleine Gitter hinaus, die Lindenbäume blühten, und die Schwalben flogen umher und sagten: »Quirrevirrevit, mein Mann ist kommen!« Aber es war nicht der Tannenbaum, den sie meinten.
»Nun werde ich leben!«, jubelte dieser und breitete seine Zweige weit aus; aber ach, die waren alle vertrocknet und gelb; und er lag da zwischen Unkraut und Nesseln. Der Stern von Goldpapier saß noch oben in der Spitze und glänzte im hellen Sonnenschein.
Im Hofe selbst spielten ein paar der munteren Kinder, die zur Weihnachtszeit den Baum umtanzt hatten und so froh über denselben gewesen waren. Eins der kleinsten lief hin und riss den Goldstern ab.
»Sieh, was da noch an dem hässlichen, alten Tannenbaum sitzt!«, sagte es und trat auf die Zweige, so dass sie unter seinen Stiefeln knackten.
Der Baum sah auf all die Blumenpracht und Frische im Garten, er betrachtete sich selbst und wünschte, dass er in seinem dunkeln Winkel auf dem Boden geblieben wäre; er gedachte seiner frischen Jugend im Walde, des lustigen Weihnachtsabends und der kleinen Mäuse, die so munter die Geschichte von Klumpe-Dumpe angehört hatten.
»Vorbei, vorbei!«, sagte der arme Baum. »Hätte ich mich doch gefreut, als ich es noch konnte! Vorbei, vorbei!«
Der Diener kam und hieb den Baum in kleine Stücke, ein ganzes Bund lag da; hell flackerte es auf unter dem großen Braukessel. Der Baum seufzte tief, und jeder Seufzer war einem kleinen Schusse gleich; deshalb liefen die Kinder, die da spielten, herbei und setzten sich vor das Feuer, blickten in dasselbe hinein und riefen: »Piff, paff!« Aber bei jedem Knalle, der ein tiefer Seufzer war, dachte der Baum an einen Sommerabend im Walde oder an eine Winternacht da draußen, wenn die Sterne funkelten; er dachte an den Weihnachtsabend und an Klumpe-Dumpe, das einzige Märchen, welches er gehört hatte und zu erzählen wusste – und dann war der Baum verbrannt.
Die Knaben spielten im Garten und der kleinste hatte den Goldstern auf der Brust, den der Baum an seinem glücklichsten Abend getragen; nun war der vorbei, und mit dem Baum war es auch vorbei und mit der Geschichte auch; vorbei, vorbei, und so geht es mit allen Geschichten!
Der Schweinehirt
Es war einmal ein armer Prinz; er hatte ein Königreich, welches ganz klein war, aber es war immer groß genug, um sich darauf zu verheiraten, und verheiraten wollte er sich.
Nun war es freilich etwas keck von ihm, dass er zur Tochter des Kaisers zu sagen wagte: »Willst du mich haben?« Aber er wagte es doch, denn sein Name war weit und breit berühmt; es gab hundert Prinzessinnen, die gerne ja gesagt hätten; aber ob sie es tat?
Nun, wir wollen hören.
Auf dem Grabe des Vaters des Prinzen wuchs ein Rosenstrauch, ein herrlicher Rosenstrauch; der blühte nur jedes fünfte Jahr und trug dann auch nur eine einzige Blume, aber das war eine Rose, die duftete so süß, dass man alle seine Sorgen und seinen Kummer vergaß, wenn man daran roch. Der Prinz hatte auch eine Nachtigall, die konnte singen, als ob alle schönen Melodien in ihrer Kehle säßen. Diese Rose und die Nachtigall sollte die Prinzessin haben und deshalb wurden sie beide in große silberne Behälter gesetzt und ihr zugesandt.
Der Kaiser ließ sie vor sich her in den großen Saal tragen, wo die Prinzessin war und »Es kommen Fremde« mit ihren Hofdamen spielte; als sie die großen Behälter mit den Geschenken darin erblickte, klatschte sie vor Freude in die Hände.
»Wenn es doch eine kleine Mietzekatze wäre!«, sagte sie, aber da kam der Rosenstrauch mit der herrlichen Rose hervor.
»Wie niedlich sie gemacht ist!«, sagten alle Hofdamen.
»Sie ist mehr als niedlich«, sagte der Kaiser, »sie ist schön!«
Aber die Prinzessin befühlte sie und da war sie nahe daran, zu weinen.
»Pfui, Papa!«, sagte sie; »sie ist nicht künstlich, sie ist natürlich!«
»Pfui«, sagten alle Hofdamen, »sie ist natürlich!«
»Lasst uns nun erst sehen, was in dem andern Behälter ist, ehe wir böse werden!«, meinte der Kaiser, und da kam die Nachtigall heraus, die so schön sang, dass man nicht gleich etwas Böses gegen sie vorbringen konnte.
»Superbe! Charmant!«, sagten die Hofdamen, denn sie plauderten alle französisch, eine immer ärger als die andere.
»Wie der Vogel mich an die Spieldose der seligen Kaiserin erinnert!«, sagte ein alter Kavalier; »ach ja, das ist derselbe Ton, derselbe Vortrag!«
»Ja!«, sagte der Kaiser, und dann weinte er wie ein kleines Kind.
»Es wird doch hoffentlich kein natürlicher sein?«, sagte die Prinzessin.
»Ja, es ist ein natürlicher Vogel!«, sagten die, welche ihn gebracht hatten.
»So lasst den Vogel fliegen«, sagte die Prinzessin, und sie wollte nicht gestatten, dass der Prinz komme.
Aber dieser ließ sich nicht einschüchtern. Er bemalte sich das Antlitz mit Braun und Schwarz, drückte die Mütze tief über den Kopf und klopfte an.
»Guten Tag, Kaiser!«, sagte er. »Könnte ich nicht hier auf dem Schlosse einen Dienst bekommen?«
»Jawohl!«, sagte der Kaiser. »Ich brauche jemand, der die Schweine hüten kann, denn deren haben wir viele.«
So wurde der Prinz angestellt als kaiserlicher Schweinehirt. Er bekam eine jämmerlich kleine Kammer unten bei den Schweinen, und da musste er bleiben; aber den ganzen Tag saß er und arbeitete, und als es Abend war, hatte er einen niedlichen, kleinen Topf gemacht; rings um denselben waren Schellen, und sobald der Topf kochte, klingelten sie schön und spielten die alte Melodie:
Ach, du lieber Augustin,
Alles ist weg, weg, weg!
Aber das Allerkünstlichste war, dass, wenn man den Finger in den Dampf des Topfes hielt, man sogleich riechen konnte, welche Speisen auf jedem Feuerherd in der Stadt zubereitet wurden. Das war wahrlich etwas ganz anderes als die Rose!
Nun kam die Prinzessin mit allen ihren Hofdamen daherspaziert, und als sie die Melodie hörte, blieb sie stehen und sah ganz erfreut aus; denn sie konnte auch »Ach, du lieber Augustin« spielen. Das war das Einzige, was sie konnte, aber das spielte sie mit einem Finger.
»Das ist ja das, was ich kann!«, sagte sie. »Dann muss es ein gebildeter Schweinehirt sein! Höre, gehe hinunter und frage ihn, was das Instrument kostet!«
Da musste eine der Hofdamen hineingehen, aber sie zog Holzpantoffeln an.
»Was willst du für den Topf haben?«, fragte die Hofdame.
»Ich will zehn Küsse von der Prinzessin haben!«, sagte der Schweinehirt.
»Gott bewahre uns!«, sagte die Hofdame.
»Ja, anders tue ich es nicht!«, antwortete der Schweinehirt.
»Er ist unartig!«, sagte die Prinzessin, und dann ging sie; aber als sie ein kleines Stück gegangen war, erklangen die Schellen so lieblich:
Ach, du lieber Augustin,
Alles ist weg, weg, weg!
»Höre«, sagte die Prinzessin, »frage ihn, ob er zehn Küsse von meinen Hofdamen will!«
»Ich danke schön«, sagte der Schweinehirt; »zehn Küsse von der Prinzessin oder ich behalte meinen Topf.«
»Was ist das doch für eine langweilige Geschichte!«, sagte die Prinzessin. »Aber dann müsst ihr vor mir stehen, damit es niemand sieht!«
Die Hofdamen stellten sich davor und breiteten ihre Kleider aus, und da bekam der Schweinehirt zehn Küsse, und sie erhielt den Topf.
Nun, das war eine Freude! Den ganzen Abend und den ganzen Tag musste der Topf kochen; es gab nicht einen Feuerherd in der ganzen Stadt, von dem sie nicht wussten, was darauf gekocht wurde, sowohl beim Kammerherrn wie beim Schuhflicker. Die Hofdamen tanzten und klatschten in die Hände.
»Wir wissen, wer süße Suppe und Eierkuchen essen wird, wir wissen, wer Grütze und Braten bekommt! Wie schön ist doch das!«
»Ja, aber haltet reinen Mund, denn ich bin des Kaisers Tochter!«
»Jawohl, jawohl!«, sagten alle.
Der Schweinehirt, das heißt der Prinz – aber sie wussten es ja nicht anders, als dass er ein wirklicher Schweinehirt sei – ließ die Tage nicht verstreichen, ohne etwas zu tun, und da machte er eine Knarre, wenn man diese herumschwang, erklangen alle die Walzer und Hopser, die man von Erschaffung der Welt an kannte.
»Ach, das ist superbe«, sagte die Prinzessin, indem sie vorbeiging. »Ich habe nie eine schönere Musik gehört! Höre, gehe hinein und frage ihn, was das Instrument kostet, aber ich küsse nicht wieder!«
»Er will hundert Küsse von der Prinzessin haben!«, sagte die Hofdame, welche hineingegangen war, um zu fragen.
»Ich glaube, er ist verrückt!«, sagte die Prinzessin und dann ging sie; aber als sie ein kleines Stück gegangen war, blieb sie stehen. »Man muss die Kunst aufmuntern«, sagte sie; »ich bin des Kaisers Tochter! Sage ihm, er soll wie neulich zehn Küsse haben; den Rest kann er von meinen Hofdamen nehmen!«
»Ach, aber wir tun es ungern!«, sagten die Hofdamen.
»Das ist Geschwätz«, sagte die Prinzessin, »wenn ich ihn küssen kann, dann könnt ihr es auch; bedenkt, ich gebe euch Kost und Lohn!« Da mussten die Hofdamen wieder zu ihm hineingehen.
»Hundert Küsse von der Prinzessin«, sagte er, »oder jeder behält das Seine!«
»Stellt euch davor!«, sagte sie dann, und da stellten sich alle Hofdamen davor, und nun küsste er.
»Was mag das wohl für ein Auflauf beim Schweinestall sein?«, fragte der Kaiser, welcher auf den Balkon hinausgetreten war. Er rieb sich die Augen und setzte die Brille auf. »Das sind ja die Hofdamen, die da ihr Wesen treiben; ich werde wohl zu ihnen hinuntergehen müssen!«
Potztausend, wie er sich sputete!
Sobald er in den Hof hinunterkam, ging er ganz leise, und die Hofdamen hatten so viel damit zu tun, die Küsse zu zählen, damit es ehrlich zugehen möge, dass sie den Kaiser gar nicht bemerkten. Er erhob sich auf den Zehen.
»Was ist das?«, sagte er, als er sah, dass sie sich küssten, und dann schlug er seine Tochter mit seinem Pantoffel auf den Kopf, gerade als der Schweinehirt den sechsundachtzigsten Kuss erhielt.
»Fort mit euch!«, sagte der König, denn er war böse, und sowohl die Prinzessin wie der Schweinehirt mussten sein Kaiserreich verlassen.
Da stand sie nun und weinte, der Schweinehirt schalt, und der Regen strömte hernieder.
»Ach, ich elendes Geschöpf«, sagte die Prinzessin, »hätte ich doch den schönen Prinzen genommen! Ach, wie unglücklich bin ich!«
Der Schweinehirt aber ging hinter einen Baum, wischte sich das Schwarze und Braune aus seinem Antlitz, warf die schlechten Kleider von sich und trat nun in seiner Prinzentracht hervor, so schön, dass die Prinzessin sich verneigen musste.
»Ich bin dahin gekommen, dich zu verachten!«, sagte er. »Du wolltest keinen ehrlichen Prinzen haben! Du verstandest dich nicht auf die Rose und die Nachtigall, aber den Schweinehirten konntest du für eine Spielerei küssen. Das hast du nun dafür!«
Und dann ging er in sein Königreich hinein; da konnte sie draußen singen:
Ach, du lieber Augustin,
Alles ist weg, weg, weg!
Der Sandmann[1]
Es gibt niemand in der ganzen Welt, der so viele Geschichten weiß als der Sandmann! Er kann ordentlich erzählen.
Gegen Abend, wenn die Kinder noch am Tische oder auf ihrem Schemel sitzen, kommt der Sandmann; er kommt die Treppe sachte herauf, denn er geht auf Socken; er macht ganz leise die Türen auf und husch! da spritzt er den Kindern süße Milch in die Augen hinein, und das so fein, so fein, aber immer genug, dass sie die Augen nicht offenhalten und ihn deshalb auch nicht sehen können. Er schleicht sich gerade hinter sie, bläst ihnen sachte in den Nacken und dann werden sie schwer im Kopf. Aber es tut nicht weh, denn der Sandmann meint es gut mit den Kindern; er will nur, dass sie ruhig sein sollen, und das sind sie am schnellsten, wenn man sie zu Bette gebracht hat; sie sollen still sein, damit er ihnen Geschichten erzählen kann.
Wenn die Kinder nun schlafen, setzt sich der Sandmann auf ihr Bett. Er ist gut gekleidet; sein Rock ist von Seidenzeug, aber es ist unmöglich zu sagen, von welcher Farbe, denn er glänzt grün, rot und blau, je nachdem er sich wendet. Unter jedem Arm hält er einen Regenschirm.
Den einen, mit Bildern darauf, spannt er über die guten Kinder aus, und dann träumen sie die ganze Nacht die herrlichsten Geschichten; auf dem andern ist durchaus nichts, den stellt er über die unartigen Kinder. Dann schlafen diese und haben am Morgen, wenn sie erwachen, nicht das Allergeringste geträumt.
Nun werden wir hören, wie der Sandmann an jedem Abend in einer Woche zu einem kleinen Knaben, welcher Friedrich hieß, kam und was er ihm erzählte. Es sind sieben Geschichten, denn es sind sieben Tage in der Woche.
Montag
»Höre einmal«, sagte der Sandmann am Abend, als er Friedrich zu Bette gebracht hatte, »nun werde ich aufputzen!« Da wurden alle Blumen in den Blumentöpfen zu großen Bäumen, welche ihre langen Zweige unter der Decke und längs der Wände ausstreckten, so dass die ganze Stube wie ein prächtiges Lufthaus aussah; alle Zweige waren voll Blumen, und jede Blume war noch schöner als eine Rose, duftete lieblich, und wollte man sie essen, so war sie noch süßer als Eingemachtes! Die Früchte glänzten gerade wie Gold, und Kuchen waren da, die vor lauter Rosinen platzten – es war unvergleichlich schön! Aber zu gleicher Zeit ertönte ein erschreckliches Jammern aus dem Tischkasten, wo Friedrichs Schulbücher lagen.
»Was ist das?«, sagte der Sandmann und ging nach dem Tisch und zog den Kasten auf. Es war die Tafel, in der es riss und wühlte, denn es war eine falsche Zahl in das Rechenexempel gekommen, so dass es nahe daran war, auseinanderzufallen; der Griffel hüpfte und sprang an seinem Bande, gerade als ob er ein kleiner Hund wäre, der dem Rechenexempel helfen möchte; aber er konnte es nicht. Und dann war es Friedrichs Schreibebuch, in welchem es auch jammerte; o, es war hässlich mit anzuhören! Auf jedem Blatte standen der Länge nach herunter die großen Buchstaben, ein jeder mit einem kleinen zur Seite, das war eine Vorschrift; neben diesen standen wieder einige Buchstaben, welche glaubten ebenso auszusehen, und diese hatte Friedrich geschrieben; sie lagen fast so, als ob sie über die Bleifederstriche gefallen wären, auf welchen sie stehen sollten.
»Seht, so solltet ihr euch halten«, sagte die Vorschrift. »Seht, so zur Seite, mit einem kräftigen Schwung!«
»O, wir möchten gern«, sagten Friedrichs Buchstaben, »aber wir können nicht, wir sind so jämmerlich!«
»Dann müsst ihr Kinderpulver haben!«, sagte der Sandmann.
»O nein!«, riefen sie, und da standen sie schlank, dass es eine Lust war.
»Jetzt wird keine Geschichte erzählt«, sagte der Sandmann, »nun muss ich sie exerzieren. Eins, zwei! Eins, zwei!« Und so exerzierte er die Buchstaben, und sie standen so schlank und schön, wie nur eine Vorschrift stehen kann. Aber als der Sandmann ging und Friedrich sie am Morgen besah, da waren sie ebenso elend als früher.
Dienstag
Sobald Friedrich zu Bette war, berührte der Sandmann mit seiner kleinen Zauberspritze alle Möbel in der Stube und sogleich fingen sie an zu plaudern, und allesamt sprachen sie von sich selbst, mit Ausnahme des Spucknapfes, welcher stumm dastand und sich darüber ärgerte, dass sie so eitel sein konnten, nur von sich selbst zu reden, nur an sich selbst zu denken und durchaus keine Rücksicht auf den zu nehmen, der doch so bescheiden in der Ecke stand und sich bespucken ließ.
Über der Kommode hing ein großes Gemälde in einem vergoldeten Rahmen, das war eine Landschaft; man sah darauf große alte Bäume, Blumen im Grase und einen großen Fluss, welcher um den Wald herumfloss an vielen Schlössern vorbei und weit hinausströmte in das wilde Meer.
Der Sandmann berührte mit seiner Zauberspritze das Gemälde, und da begannen die Vögel darauf zu singen, die Baumzweige bewegten sich, und die Wolken zogen weiter, man konnte ihren Schatten über die Landschaft hin erblicken.
Nun hob der Sandmann den kleinen Friedrich gegen den Rahmen empor und stellte seine Füße in das Gemälde, gerade in das hohe Gras, und da stand er, die Sonne beschien ihn durch die Zweige der Bäume. Er lief hin zum Wasser und setzte sich in ein kleines Boot, welches dort lag; es war rot und weiß angestrichen, das Segel glänzte wie Silber und sechs Schwäne, alle mit Goldkronen um den Hals und einem strahlenden blauen Stern auf dem Kopf, zogen das Boot an dem grünen Walde vorbei, wo die Bäume von Räubern und Hexen und die Blumen von den niedlichen, kleinen Elfen und von dem, was die Schmetterlinge ihnen gesagt hatten, erzählten.
Die herrlichen Fische mit Schuppen wie Silber und Gold, schwammen dem Boote nach; mitunter machten sie einen Sprung, dass es im Wasser plätscherte, und Vögel, rot und blau, klein und groß, flogen in langen Reihen hinterher, die Mücken tanzten, und die Maikäfer sagten: »Bum, bum!« Sie wollten Friedrich alle folgen, und alle hatten sie eine Geschichte zu erzählen.
Das war eine Lustfahrt! Bald waren die Wälder ganz dicht und dunkel, bald waren sie wie der herrlichste Garten mit Sonnenschein und Blumen. Da lagen große Schlösser von Glas und von Marmor; auf den Altanen standen Prinzessinnen, und alle waren es kleine Mädchen, die Friedrich gut kannte; er hatte früher mit ihnen gespielt. Sie streckten jede die Hand aus und hielten das niedlichste Zuckerherz hin, welches je eine Kuchenfrau verkaufen konnte, und Friedrich fasste die eine Seite des Zuckerherzens an, indem er vorbeifuhr, und die Prinzessin hielt recht fest, und so bekam jedes sein Stück, sie das kleinste, Friedrich das größte. Bei jedem Schlosse standen kleine Prinzen Schildwache, sie schulterten mit Säbeln und ließen Rosinen und Zinnsoldaten regnen. Das waren echte Prinzen!
Bald segelte Friedrich durch Wälder, bald durch große Säle oder mitten durch eine Stadt; er kam auch durch die, in welcher sein Kindermädchen wohnte, welches ihn getragen hatte, da er noch ein ganz kleiner Knabe war, und das ihm immer gut gewesen; und sie nickte und winkte und sang den niedlichen kleinen Vers, den sie selbst gedichtet und Friedrich gesandt hatte:
Ich denke deiner so manches Mal,
Mein teurer Friedrich, du lieber!
Ich gab dir Küsse ja ohne Zahl
Auf Stirne, Mund, Augenlider.
Ich hörte dich lallen das erste Wort,
Doch musst’ ich dir Lebewohl sagen.
Es segne der Herr dich an jedem Ort,
Du Engel, den ich getragen!
Und alle Vögel sangen mit, die Blumen tanzten auf den Stielen und die alten Bäume nickten, gerade als ob der Sandmann ihnen auch Geschichten erzählte.
Mittwoch
Draußen strömte der Regen hernieder! Friedrich konnte es im Schlaf hören und da der Sandmann ein Fenster öffnete, stand das Wasser gerade herauf bis an das Fensterbrett, es war ein ganzer See da draußen, aber das prächtigste Schiff lag dicht am Hause.
»Willst du mitsegeln, kleiner Friedrich«, sagte der Sandmann, »so kannst du diese Nacht in fremde Länder gelangen und morgen wieder hier sein!«
Da stand Friedrich plötzlich in seinen Sonntagskleidern mitten auf dem prächtigen Schiffe, sogleich wurde die Witterung schön, und sie segelten durch die Straßen, kreuzten um die Kirche, und nun war alles eine große, wilde See. Sie segelten so lange, bis kein Land mehr zu erblicken war, und sie sahen einen Flug Störche, die kamen auch von der Heimat und wollten nach den warmen Ländern; ein Storch flog immer hinter dem andern, und sie waren schon weit, weit geflogen! Einer von ihnen war so ermüdet, dass seine Flügel ihn kaum noch zu tragen vermochten; er war der allerletzte in der Reihe, und bald blieb er ein großes Stück zurück, zuletzt sank er mit ausgebreiteten Flügeln tiefer und tiefer, er machte noch ein paar Schläge mit den Schwingen, aber es half nichts; nun berührte er mit seinen Füßen das Tauwerk des Schiffes, glitt vom Segel herab und bums! da stand er auf dem Verdeck.
Da nahm ihn der Schiffsjunge und setzte ihn in das Hühnerhaus zu den Hühnern, Enten und Truthähnen; der arme Storch stand ganz befangen mitten unter ihnen.
»Sieh den!«, sagten alle Hühner.
Der kalekutische Hahn blies sich so dick auf, wie er konnte, und fragte, wer er sei. Die Enten gingen rückwärts und stießen einander: »Rapple dich, rapple dich!«
Der Storch erzählte vom warmen Afrika, von den Pyramiden und vom Strauße, der einem wilden Pferde gleich die Wüste durchlaufe; aber die Enten verstanden nicht, was er sagte, und dann stießen sie einander: »Wir sind doch darüber einverstanden, dass er dumm ist?«
»Ja, sicher ist er dumm!«, sagte der kalekutische Hahn, und dann kollerte er. Da schwieg der Storch ganz still und dachte an sein Afrika.
»Das sind ja herrlich dünne Beine, die ihr habt!«, sagte der Kalekute. »Was kostet die Elle davon?«
»Skrat, skrat, skrat!«, grinsten alle Enten, aber der Storch tat, als ob er es gar nicht höre.
»Ihr könnt immer mitlachen«, sagte der Kalekute zu ihm, »denn es war sehr witzig gesagt, oder war es euch vielleicht zu hoch? Ach, er ist nicht vielseitig, wir wollen für uns selbst bleiben!« Und dann gluckte er und die Enten schnatterten: »Gikgak! Gikgak!« Es war erschrecklich, wie sie sich selbst belustigten.
Aber Friedrich ging nach dem Hühnerhause, öffnete die Tür, rief den Storch, und er hüpfte zu ihm hinaus auf das Verdeck. Nun hatte er ja ausgeruht, und es war gleichsam, als ob er Friedrich zunickte um ihm zu danken. Darauf entfaltete er seine Schwingen und flog nach den warmen Ländern, aber die Hühner gluckten, die Enten schnatterten und der kalekutische Hahn wurde ganz feuerrot am Kopfe.
»Morgen werden wir Suppe von euch kochen!«, sagte Friedrich und dann erwachte er und lag in seinem kleinen Bette. Es war doch eine sonderbare Reise, die der Sandmann ihn diese Nacht hatte machen lassen!
Donnerstag
»Weißt du was?«, sagte der Sandmann. »Sei nur nicht furchtsam, hier wirst du eine kleine Maus sehen!« Da hielt er ihm seine Hand mit dem leichten, niedlichen Tiere entgegen. »Sie ist gekommen, um dich zur Hochzeit einzuladen. Hier sind diese Nacht zwei kleine Mäuse, die in den Stand der Ehe treten wollen. Sie wohnen unter deiner Mutter Speisekammerfußboden; das soll eine schöne Wohnung sein!«
»Aber wie kann ich durch das kleine Mauseloch im Fußboden kommen?«, fragte Friedrich.
»Lass mich nur machen«, sagte der Sandmann, »ich werde dich schon klein bekommen!« Und er berührte Friedrich mit seiner Zauberspritze, wodurch dieser sogleich kleiner und kleiner wurde; zuletzt war er keinen Finger lang. »Nun kannst du dir die Kleider des Zinnsoldaten leihen; ich denke, sie werden dir passen, und es sieht gut aus, wenn man Uniform in Gesellschaft hat!«
»Ja freilich!«, sagte Friedrich, und da war er im Augenblick wie der niedlichste Zinnsoldat angekleidet.
»Wollen Sie nicht so gut sein und sich in Ihrer Mutter Fingerhut setzen?«, sagte die kleine Maus. »Dann werde ich die Ehre haben, Sie zu ziehen!«
»Will sich das Fräulein selbst bemühen!«, sagte Friedrich, und so fuhren sie zur Mäusehochzeit.
Zuerst kamen sie unter dem Fußboden in einen langen Gang, der nicht höher war, als dass sie gerade mit dem Fingerhut dort fahren konnten; und der ganze Gang war mit faulem Holze erleuchtet.
»Riecht es hier nicht herrlich?«, sagte die Maus, die ihn zog. »Der ganze Gang ist mit Speckschwarten geschmiert worden! Es kann nichts Schöneres geben!«
Nun kamen sie in den Brautsaal hinein. Hier standen zur Rechten alle die kleinen Mäusedamen, die wisperten und zischelten, als ob sie einander zum Besten hielten; zur Linken standen alle Mäuseherren und strichen sich mit der Pfote den Schnauzbart. Aber mitten im Saal sah man das Brautpaar; sie standen in einer ausgehöhlten Käserinde und küssten sich gar erschrecklich viel vor aller Augen, denn sie waren ja Verlobte und sollten nun gleich Hochzeit halten.
Es kamen immer mehr und mehr Fremde; die eine Maus war nahe daran, die andere totzutreten, und das Brautpaar hatte sich mitten in die Tür gestellt, so dass man weder hinaus noch hinein gelangen konnte. Die ganze Stube war ebenso wie der Gang mit Speckschwarten eingeschmiert, das war die ganze Bewirtung, aber zum Nachtisch wurde eine Erbse vorgezeigt, in die eine Maus aus der Familie den Namen des Brautpaares eingebissen hatte, das heißt den ersten Buchstaben. Das war etwas ganz Außerordentliches.
Alle Mäuse sagten, dass es eine schöne Hochzeit und dass die Unterhaltung gut gewesen sei.
Dann fuhr Friedrich wieder nach Hause; er war wahrlich in vornehmer Gesellschaft gewesen, aber er hatte auch ordentlich zusammenkriechen, sich klein machen und Zinnsoldatenuniform anziehen müssen.
Freitag
»Es ist unglaublich, wie viel ältere Leute es gibt, die mich gar zu gern haben möchten!«, sagte der Sandmann; »es sind besonders die, welche etwas Böses verübt haben. ›Guter kleiner Sandmann‹, sagen sie zu mir, ›wir können die Augen nicht schließen, und so liegen wir die ganze Nacht und sehen alle unsere bösen Taten, die wie hässliche kleine Kobolde auf der Bettstelle sitzen und uns mit heißem Wasser bespritzen; möchtest du doch kommen und sie fortjagen, damit wir einen guten Schlaf bekämen‹; und dann seufzen sie tief: ›Wir möchten es wahrlich gern bezahlen. Gute Nacht, Sandmann! Das Geld liegt im Fenster.‹ Aber ich tue es nicht für Geld«, sagte der Sandmann.
»Was wollen wir nun diese Nacht vornehmen?«, fragte Friedrich.
»Ja, ich weiß nicht, ob du diese Nacht wieder Lust hast, zur Hochzeit zu kommen; es ist eine andere Art, als die gestrige war. Deiner Schwester große Puppe, die, welche wie ein Mann aussieht und Hermann genannt wird, wird sich mit der Puppe Bertha verheiraten; es ist obendrein der Puppe Geburtstag, und deshalb werden da sehr viele Geschenke kommen!«
»Ja, das kenne ich schon«, sagte Friedrich. »Immer wenn die Puppen neue Kleider gebrauchen, lässt meine Schwester sie ihren Geburtstag feiern oder Hochzeit halten; das ist sicher schon hundertmal geschehen!«
»Ja, aber in dieser Nacht ist es die hundertunderste Hochzeit und wenn hundertundeins aus ist, dann ist alles vorbei! Deswegen wird auch diese so ausgezeichnet. Sieh nur einmal!«
Friedrich sah nach dem Tische. Da stand das kleine Papphaus mit Licht in den Fenstern, und draußen davor präsentierten alle Zinnsoldaten das Gewehr. Das Brautpaar saß ganz gedankenvoll, wozu es wohl Ursache hatte, auf dem Fußboden und lehnte sich gegen den Tischfuß. Aber der Sandmann, in den schwarzen Rock der Großmutter gekleidet, traute sie. Als die Trauung vorbei war, stimmten alle Möbel in der Stube folgenden Gesang an, welcher von der Bleifeder geschrieben war; er ging nach der Melodie des Zapfenstreichs.
Das Lied ertönte wie der Wind
Dem Brautpaar Hoch! das sich verbind’t;
Sie prangen beide steif und blind,
Da sie von Handschuhleder sind,
»Hurrah! Hurrah! ob taub und blind,
Wir singen es im Wetter und Wind!«
Und nun bekamen sie Geschenke; aber sie hatten sich alle Esswaren verbeten, denn sie hatten an ihrer Liebe genug.
»Wollen wir nun eine Sommerwohnung beziehen oder auf Reisen gehen?«, fragte der Bräutigam. Die Schwalbe, die viel gereist war, und die Hofhenne, welche fünfmal Küchlein ausgebrütet hatte, wurden zu Rate gezogen. Und die Schwalbe erzählte von den herrlichen, warmen Ländern, wo die Weintrauben groß und schwer hängen, wo die Luft so mild ist und die Berge Farbe haben, wie man sie hier gar nicht an denselben kennt.
»Sie haben doch nicht unsern Grünkohl!«, sagte die Henne. »Ich war einen Sommer mit allen meinen Kücheln auf dem Lande, da war eine Sandgrube, in der wir gehen und kratzen konnten und dann hatten wir Zutritt zu einem Garten mit Grünkohl! O, wie war der grün! Ich kann mir nichts Schöneres denken!«
»Aber ein Kohlstrunk sieht gerade so aus wie der andere«, sagte die Schwalbe, »und dann ist hier oft schlechtes Wetter!«
»Ja, daran ist man gewöhnt!«
»Aber hier ist es kalt, es friert!«
»Das ist gut für den Kohl!«, sagte die Henne. »Übrigens können wir es auch warm haben. Hatten wir nicht vor Jahren einen Sommer, so heiß, dass man kaum atmen konnte? Dann haben wir nicht alle die giftigen Tiere, die sie dort haben, und wir sind von Räubern befreit! Der ist ein Bösewicht, der nicht findet, dass unser Land das schönste ist; er verdiente wahrlich nicht hier zu sein!« Und dann weinte die Henne und fuhr fort: »Ich bin auch gereist! Ich bin einmal über zwölf Meilen gefahren! Es ist durchaus kein Vergnügen beim Reisen!«
»Ja, die Henne ist eine vernünftige Frau!«, sagte die Puppe Bertha. »Ich halte nichts davon, Berge zu bereisen, denn das geht nur hinauf und dann wieder herunter! Nein, wir wollen nach der Sandgrube hinausziehen und im Kohlgarten spazieren!«
Und dabei blieb es.
Sonnabend
»Bekomme ich nun Geschichten zu hören?«, fragte der kleine Friedrich, sobald der Sandmann ihn in den Schlaf gebracht hatte.
»Diesen Abend haben wir nicht Zeit dazu«, sagte der Sandmann und spannte seinen schönsten Regenschirm über ihn auf. »Betrachte nur die Chinesen!« Der ganze Regenschirm sah aus wie eine große chinesische Schale mit blauen Bäumen und spitzen Brücken und mit kleinen Chinesen darauf, die dastanden und mit dem Kopfe nickten. »Wir müssen die ganze Welt zu morgen schön ausgeputzt haben«, sagte der Sandmann; »es ist ja morgen Sonntag. Ich will die Kirchtürme besuchen, um zu sehen, ob die kleinen Kirchkobolde die Glocken polieren, damit sie hübsch klingen; ich will hinaus auf das Feld gehen und sehen, ob die Winde den Staub von Gras und Blätter blasen, und was die größte Arbeit ist, ich will alle Sterne herunterholen, um sie zu polieren. Ich nehme sie in meine Schürze; aber erst muss ein jeder nummeriert werden, und die Löcher, worin sie da oben sitzen, müssen auch nummeriert werden, damit sie wieder auf den rechten Fleck kommen, sonst würden sie nicht festsitzen und wir würden zu viele Sternschnuppen bekommen, indem der eine nach dem andern herunterpurzeln würde!«
»Hören Sie, wissen Sie was, Herr Sandmann?«, sagte ein altes Bild, welches an der Wand hing, wo Friedrich schlief. »Ich bin Friedrichs Urgroßvater; ich danke Ihnen, dass Sie dem Knaben Geschichten erzählen, aber Sie müssen seine Begriffe nicht verdrehen. Die Sterne können nicht heruntergenommen und poliert werden! Die Sterne sind Kugeln, ebenso wie unsere Erde, und das ist gerade das Gute an ihnen.«
»Ich danke dir, du alter Urgroßvater«, sagte der Sandmann, »ich danke dir! Du bist ja das Haupt der Familie, du bist das Urhaupt, aber ich bin doch älter als du! Ich bin ein alter Heide; Römer und Griechen nannten mich den Traumgott! Ich bin in die vornehmsten Häuser gekommen und komme noch dahin; ich weiß sowohl mit Geringen wie mit Großen umzugehen! Nun kannst du erzählen!« Und da ging der Sandmann und nahm seinen Regenschirm mit.
»Nun darf man wohl seine Meinung gar nicht mehr sagen!«, brummte das Bild.
Da erwachte Friedrich.
Sonntag
»Guten Abend!«, sagte der Sandmann, Friedrich nickte und wandte das Bild des Urgroßvaters gegen die Wand um, damit es nicht, wie gestern, mitspreche.
»Nun musst du mir Geschichten erzählen: von den fünf grünen Erbsen, die in einer Schote wohnten, und von dem Hahnenfuß, der dem Hühnerfuße den Hof machte, und von der Stopfnadel, die so vornehm tat, dass sie sich einbildete eine Nähnadel zu sein!«
»Man kann auch des Guten zu viel bekommen!«, sagte der Sandmann. »Du weißt wohl, dass ich dir am liebsten etwas zeige! Ich will dir meinen Bruder zeigen. Er heißt auch Sandmann, aber er kommt zu niemand öfters als einmal und zu wem er kommt, den nimmt er mit auf sein Pferd und erzählt ihm Geschichten. Er kennt nur zwei; die eine ist so außerordentlich schön, dass niemand in der Welt sie sich denken kann, und die andere ist so hässlich und greulich – es ist gar nicht zu beschreiben!« Und dann hob der Sandmann den kleinen Friedrich zum Fenster hinauf und sagte: »Da wirst du meinen Bruder sehen, sie nennen ihn auch den Tod! Siehst du, er sieht gar nicht so schlimm aus wie in den Bilderbüchern, wo er nur ein Knochengerippe ist! Nein, das ist Silberstickerei, die er auf dem Kleide hat, die schönste Husarenuniform, ein Mantel von schwarzem Sammet fliegt hinten über das Pferd. Sieh, wie er im Galopp reitet!«
Friedrich sah, wie der Sandmann davon ritt und sowohl junge wie alte Leute auf sein Pferd nahm. Einige setzte er vorn, andere hinten auf, aber immer fragte er erst: »Wie steht es mit dem Zeugnisbuch?« – »Gut!«, sagten sie allesamt. »Ja, lasst mich selbst sehen!«, sagte er, und sie mussten ihm das Buch zeigen; alle die, welche »Sehr gut« und »Ausgezeichnet gut« hatten, kamen vorn auf das Pferd und bekamen die herrliche Geschichte zu hören; die aber, welche »Ziemlich gut« und »Mittelmäßig« hatten, mussten hinten auf und bekamen die greuliche Geschichte; sie zitterten und weinten, sie wollten vom Pferde springen, konnten es aber nicht, denn sie waren sogleich daran festgewachsen.
»Aber der Tod ist ja der prächtigste Sandmann!«, sagte Friedrich. »Vor ihm ist mir nicht bange!«
»Das soll auch nicht sein!«, sagte der Sandmann. »Sieh nur zu, dass du ein gutes Zeugnis hast!«
»Ja, das ist lehrreich!«, murmelte des Urgroßvaters Bild. »Es hilft doch, wenn man seine Meinung sagt!« Und nun war es zufrieden.
Sieh, das ist die Geschichte vom Sandmann! Nun mag er dir selbst diesen Abend mehr erzählen!
Däumelinchen
Es war einmal eine Frau, die sich sehr nach einem kleinen Kinde sehnte, aber sie wusste nicht, woher sie es nehmen sollte. Da ging sie zu einer alten Hexe und sagte zu ihr: »Ich möchte herzlich gern ein kleines Kind haben, willst du mir nicht sagen, woher ich das bekommen kann?«
»Ja, damit wollen wir schon fertig werden!«, sagte die Hexe. »Da hast du ein Gerstenkorn; das ist gar nicht von der Art, wie sie auf dem Felde des Landmanns wachsen oder wie sie die Hühner zu fressen bekommen; lege das in einen Blumentopf, so wirst du etwas zu sehen bekommen!«
»Ich danke dir!«, sagte die Frau und gab der Hexe fünf Groschen, ging dann nach Hause, pflanzte das Gerstenkorn, und sogleich wuchs da eine herrliche, große Blume; sie sah aus wie eine Tulpe, aber die Blätter schlossen sich fest zusammen, gerade als ob sie noch in der Knospe wären.
»Das ist eine niedliche Blume!«, sagte die Frau und küsste sie auf die roten und gelben Blätter, aber gerade wie sie darauf küsste, öffnete sich die Blume mit einem Knall. Es war eine wirkliche Tulpe, wie man nun sehen konnte, aber mitten in der Blume saß auf dem grünen Samengriffel ein ganz kleines Mädchen, fein und niedlich, sie war nicht über einen Daumen breit und lang, deswegen wurde sie Däumelinchen genannt.
Eine niedliche, lackierte Walnussschale bekam sie zur Wiege, blaue Veilchenblätter waren ihre Matratze und ein Rosenblatt ihr Deckbett. Da schlief sie bei Nacht, aber am Tage spielte sie auf dem Tisch, wo die Frau einen Teller hingestellt, um den sie einen ganzen Kranz von Blumen gelegt hatte, deren Stängel im Wasser standen; hier schwamm ein großes Tulpenblatt und auf diesem konnte Däumelinchen sitzen und von der einen Seite des Tellers nach der andern fahren; sie hatte zwei weiße Pferdehaare zum Rudern. Das sah ganz allerliebst aus. Sie konnte auch singen, und so fein und niedlich, wie man es nie gehört hatte.
Einmal nachts, als sie in ihrem schönen Bette lag, kam eine Kröte durch das Fenster hereingehüpft, wo eine Scheibe entzwei war. Die Kröte war hässlich, groß und nass, sie hüpfte gerade auf den Tisch herunter, wo Däumelinchen lag und unter dem roten Rosenblatt schlief.
»Das wäre eine schöne Frau für meinen Sohn!«, sagte die Kröte, und da nahm sie die Walnussschale, worin Däumelinchen schlief, und hüpfte mit ihr durch die zerbrochene Scheibe fort, in den Garten hinunter.
Da floss ein großer, breiter Fluss; aber gerade am Ufer war es sumpfig und morastig; hier wohnte die Kröte mit ihrem Sohne. Hu, der war hässlich und garstig und glich ganz seiner Mutter. »Koax, koax, brekkerekekex!« Das war alles, was er sagen konnte, als er das niedliche kleine Mädchen in der Walnussschale erblickte.
»Sprich nicht so laut, denn sonst erwacht sie!«, sagte die alte Kröte. »Sie könnte uns noch entlaufen, denn sie ist so leicht wie ein Schwanenflaum! Wir wollen sie auf eins der breiten Seerosenblätter in den Fluss hinaussetzen, das ist für sie, die so leicht und klein ist, gerade wie eine Insel; da kann sie nicht davonlaufen, während wir die Staatsstube unten unter dem Morast, wo ihr wohnen und hausen sollt, instand setzen.«
Draußen in dem Flusse wuchsen viele Seerosen mit den breiten, grünen Blättern, welche aussahen, als schwämmen sie oben auf dem Wasser; das Blatt, welches am weitesten hinauslag, war auch das allergrößte; da schwamm die alte Kröte hinaus und setzte die Walnussschale mit Däumelinchen darauf.
Das kleine Wesen erwachte früh morgens, und da sie sah, wo sie war, fing sie recht bitterlich an zu weinen; denn es war Wasser zu allen Seiten des großen, grünen Blattes, und sie konnte gar nicht an das Land kommen.
Die alte Kröte saß unten im Morast und putzte ihre Stube mit Schilf und gelben Fischblattblumen aus – es sollte da recht hübsch für die neue Schwiegertochter werden – und schwamm dann mit dem hässlichen Sohne zu dem Blatte hinaus, wo Däumelinchen stand. Sie wollten ihr hübsches Bett holen, das sollte in das Brautgemach gestellt werden, bevor sie es selbst betrat. Die alte Kröte verneigte sich tief im Wasser vor ihr und sagte: »Hier siehst du meinen Sohn; er wird dein Mann sein und ihr werdet recht prächtig unten im Morast wohnen!«
»Koax, koax, brekkerekekex!« war alles, was der Sohn sagen konnte.
Dann nahmen sie das niedliche, kleine Bett und schwammen damit fort; aber Däumelinchen saß ganz allein und weinte auf dem grünen Blatte, denn sie mochte nicht bei der garstigen Kröte wohnen oder ihren hässlichen Sohn zum Manne haben. Die kleinen Fische, welche unten im Wasser schwammen, hatten die Kröte wohl gesehen und gehört, was sie gesagt hatte; deshalb streckten sie die Köpfe hervor, sie wollten doch das kleine Mädchen sehen. Sobald sie es erblickten, fanden sie dasselbe so niedlich, dass es ihnen leidtat, dass es zur hässlichen Kröte hinunter sollte. Nein, das durfte nie geschehen! Sie versammelten sich unten im Wasser rings um den grünen Stängel, welcher das Blatt hielt, nagten mit den Zähnen den Stiel ab, und da schwamm das Blatt den Fluss hinab mit Däumelinchen davon, weit weg, wo die Kröte sie nicht erreichen konnte.
Däumelinchen segelte vor vielen Städten vorbei und die kleinen Vögel saßen in den Büschen, sahen sie und sangen: »Welch liebliches, kleines Mädchen!« Das Blatt schwamm mit ihr immer weiter und weiter fort; so reiste Däumelinchen außer Landes.
Ein niedlicher, weißer Schmetterling umflatterte sie stets und ließ sich zuletzt auf das Blatt nieder, denn Däumelinchen gefiel ihm. Diese war sehr erfreut; denn nun konnte die Kröte sie nicht erreichen, und es war so schön, wo sie fuhr; die Sonne schien auf das Wasser, dieses glänzte wie das herrlichste Gold. Sie nahm ihren Gürtel, band das eine Ende um den Schmetterling, das andere Ende des Bandes befestigte sie am Blatte; das glitt nun viel schneller davon und sie mit, denn sie stand ja auf demselben.
Da kam ein großer Maikäfer angeflogen, der erblickte sie und schlug augenblicklich seine Klauen um ihren schlanken Leib und flog mit ihr auf einen Baum; das grüne Blatt schwamm den Fluss hinab und der Schmetterling mit, denn er war an das Blatt gebunden und konnte nicht von demselben loskommen.
Wie war das arme Däumelinchen erschrocken, als der Maikäfer mit ihr auf den Baum flog! Aber hauptsächlich war sie des schönen, weißen Schmetterlings wegen betrübt, den sie an das Blatt festgebunden hatte; im Fall er sich nicht befreien konnte, musste er ja verhungern. Aber darum kümmerte sich der Maikäfer gar nicht. Er setzte sich mit ihr auf das größte, grüne Blatt des Baumes, gab ihr das Süße der Blumen zu essen und sagte, dass sie niedlich sei, obgleich sie einem Maikäfer durchaus nicht gleiche. Später kamen alle die andern Maikäfer, die im Baume wohnten, und besuchten sie; sie betrachteten Däumelinchen, und die Maikäferfräulein rümpften die Fühlhörner und sagten: »Sie hat doch nicht mehr als zwei Beine; das sieht erbärmlich aus.« – »Sie hat keine Fühlhörner!«, sagte eine andere. »Sie ist so schlank in der Mitte; pfui, sie sieht wie ein Mensch aus! Wie hässlich sie ist!«, sagten alle Maikäferinnen, und doch war Däumelinchen so niedlich. Das erkannte auch der Maikäfer, der sie geraubt hatte, aber als alle anderen sagten, sie sei hässlich, so glaubte er es zuletzt auch und wollte sie gar nicht haben; sie konnte gehen, wohin sie wollte. Sie flogen mit ihr den Baum hinab und setzten sie auf ein Gänseblümchen; da weinte sie, weil sie so hässlich sei, dass die Maikäfer sie nicht haben wollten, und doch war sie das Lieblichste, das man sich denken konnte, so fein und klar wie das schönste Rosenblatt.
Den ganzen Sommer über lebte das arme Däumelinchen ganz allein in dem großen Walde. Sie flocht sich ein Bett aus Grashalmen und hing es unter einem Klettenblatte auf, so war sie vor dem Regen geschützt; sie pflückte das Süße der Blumen zur Speise und trank vom Tau, der jeden Morgen auf den Blättern lag. So verging Sommer und Herbst. Aber nun kam der Winter, der kalte, lange Winter. Alle Vögel, die so schön vor ihr gesungen hatten, flogen davon, Bäume und Blumen verdorrten; das große Klettenblatt, unter dem sie gewohnt hatte, schrumpfte zusammen, und es blieb nichts als ein gelber, verwelkter Stängel zurück; Däumelinchen fror erschrecklich, denn ihre Kleider waren entzwei, und sie war selbst so fein und klein, sie musste erfrieren. Es fing an zu schneien, und jede Schneeflocke, die auf sie fiel, war, als wenn man auf uns eine ganze Schaufel voll wirft, denn wir sind groß, und sie war nur einen Zoll lang. Da hüllte sie sich in ein verdorrtes Blatt ein, aber das wollte nicht wärmen; sie zitterte vor Kälte.
Dicht vor dem Walde, wohin sie nun gekommen war, lag ein großes Kornfeld, aber das Korn war schon lange abgeschnitten, nur die nackten, trockenen Stoppeln standen aus der gefrorenen Erde hervor. Sie waren gerade wie ein ganzer Wald für sie zu durchwandern, und sie zitterte vor Kälte! Da gelangte sie vor die Türe der Feldmaus, die ein kleines Loch unter den Kornstoppeln hatte. Da wohnte die Feldmaus warm und gut, hatte die ganze Stube voll Korn, eine herrliche Küche und Speisekammer. Das arme Däumelinchen stellte sich in die Türe, gerade wie jedes andere arme Bettelmädchen, und bat um ein kleines Stück von einem Gerstenkorn, denn sie hatte in zwei Tagen nicht das Mindeste zu essen gehabt.
»Du kleines Wesen!«, sagte die Feldmaus, denn im Grunde war es eine gute alte Feldmaus, »komm herein in meine warme Stube und iss mit mir!«
Da ihr nun Däumelinchen gefiel, sagte sie: »Du kannst den Winter über bei mir bleiben, aber du musst meine Stube sauber und rein halten und mir Geschichten erzählen, denn die liebe ich sehr.« Däumelinchen tat, was die gute alte Feldmaus verlangte, und hatte es außerordentlich gut.
»Nun werden wir bald Besuch erhalten!«, sagte die Feldmaus. »Mein Nachbar pflegt mich wöchentlich einmal zu besuchen. Er steht sich noch besser als ich, hat große Säle und trägt einen schönen, schwarzen Samtpelz! Wenn du den zum Manne bekommen könntest, so wärest du gut versorgt; aber er kann nicht sehen. Du musst ihm die niedlichsten Geschichten erzählen, die du weißt!«
Aber darum kümmerte sich Däumelinchen nicht, sie mochte den Nachbar gar nicht haben, denn er war ein Maulwurf.
Er kam und stattete den Besuch in seinem schwarzen Samtpelz ab. Er sei reich und gelehrt, sagte die Feldmaus; seine Wohnung war auch zwanzigmal größer als die der Feldmaus. Gelehrsamkeit besaß er, aber die Sonne und die schönen Blumen mochte er gar nicht leiden, von diesen sprach er schlecht, denn er hatte sie noch nie gesehen.
Däumelinchen musste singen, und sie sang: »Maikäfer fliege!« und: »Geht der Pfaffe auf das Feld.« Da wurde der Maulwurf in sie, der schönen Stimme wegen, verliebt, aber er sagte nichts, er war ein besonnener Mann.
Er hatte sich vor kurzem einen langen Gang durch die Erde von seinem bis zu ihrem Hause gegraben; in diesem erhielten die Feldmaus und Däumelinchen die Erlaubnis, zu spazieren, soviel sie wollten. Aber er bat sie, sich nicht vor dem toten Vogel zu fürchten, der in dem Gange liege; es war ein ganzer Vogel mit Federn und Schnabel, der sicher erst kürzlich gestorben und nun begraben war, gerade da wo er seinen Gang gemacht hatte.