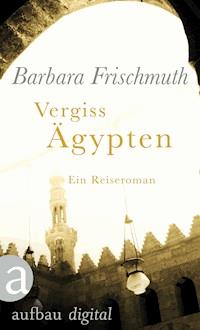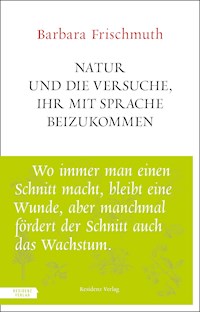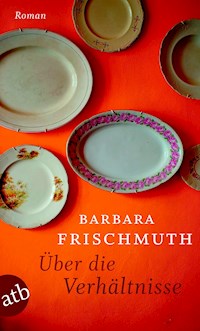8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebesgeschichte zwischen den Kulturen. Unter merkwürdigen Umständen lernt Anna, eine junge Wiener Computerspezialistin, Hikmet kennen. Doch plötzlich ist er verschwunden, und niemand will ihn gekannt haben. Bald ahnt Anna, daß seine Zugehörigkeit zu den Aleviten, einer antidogmatischen islamischen Glaubensgemeinschaft, damit zusammenhängt und daß sie selbst irgendwie schuldig ist. „Man kann ‘Die Schrift des Freundes’ als Liebesgeschichte lesen, als kritische Auseinandersetzung mit neuen Informationstechnologien, als politisches Statement zur Situation von Ausländern und Emigranten, als ethnopoetischen Reisebericht über eine fremde Kultur und schließlich auch als kryptische Reflexion über Sprache und Sprachgebrauch. Wie Barbara Frischmuth ihre Geschichten aufeinander bezieht, aus den Abschattierungen dieser Bezüge den Mehrwert der Differenzierung gewinnt, das Geschehen da und dort unaufdringlich überhöht und zeichenhaft verdichtet: das hat die seltene Qualität einer Gelassenheit, die bloß zuzuwarten scheint, bis sich die Erzählung leichthin und wie von selbst zu Ende erzählt.“ Neue Zürcher Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Eine Liebesgeschichte zwischen den Kulturen
Unter merkwürdigen Umständen lernt Anna, eine junge Wiener Computerspezialistin, Hikmet kennen. Doch plötzlich ist er verschwunden, und niemand will ihn gekannt haben. Bald ahnt Anna, daß seine Zugehörigkeit zu den Aleviten, einer antidogmatischen islamischen Glaubensgemeinschaft, damit zusammenhängt und daß sie selbst irgendwie schuldig ist.
»Man kann ›Die Schrift des Freundes‹ als Liebesgeschichte lesen, als kritische Auseinandersetzung mit neuen Informationstechnologien, als politisches Statement zur Situation von Ausländern und Emigranten, als ethnopoetischen Reisebericht über eine fremde Kultur und schließlich auch als kryptische Reflexion über Sprache und Sprachgebrauch. Wie Barbara Frischmuth ihre Geschichten aufeinander bezieht, aus den Abschattierungen dieser Bezüge den Mehrwert der Differenzierung gewinnt, das Geschehen da und dort unaufdringlich überhöht und zeichenhaft verdichtet: das hat die seltene Qualität einer Gelassenheit, die bloß zuzuwarten scheint, bis sich die Erzählung leichthin und wie von selbst zu Ende erzählt.« Neue Zürcher Zeitung
Barbara Frischmuth
Die Schrift des Freundes
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Buch lesen
Nachbemerkung
Über Barbara Frischmuth
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Der Computer ist die Antwort,
doch was war eigentlich die Frage?
Anonymus
Ich fand meinen Mond auf Erden
Was habe ich im Himmel zu suchen?
Yunus Emre
»Es war einmal, es war keinmal …« Das ist ein Traum, aus dem man nur schwer erwacht, träumt Anna Margotti und macht sich auf den Weg durch viele Fährnisse. Unbewaffnet und auf sich gestellt. Sie kann sich gehen sehen zur Station an der Ecke Unerkennbare Straße, Linie Sieben, Auf der Hut.
Nebel oder Augentrübung, die Richtung ist immer schon vorgegeben. Auch sind die Fahrgäste aus Papier, von oben bis unten beschrieben. Ein Buchstabe angelt nach ihr, fischt sie aus sich heraus, hängt sie auf zwischen Himmel und Erde. Aber noch braucht sie Boden unter den Füßen.
»Wo ich doch in die Donaustadt möchte!« Sie weiß, daß sie niemals ankommen wird. Der Zugführer gibt sich als Derwisch zu erkennen, mit einem Blick, der sie von sich abliest. Es muß eine alte Wagengarnitur sein, mit Steuerknüppel und Schlaufengriff, ein Remisenstück, das nur noch um Mitternacht ausfährt.
Die Vorstadt lichtet sich, mehr und mehr Schnee füllt die Zwischenräume, gekerbt von Vogelspuren, eine Geschichte der Überschneidungen. Und die Stationen klingen alle nach Längsthinüber. Lauter Schutzengelnamen für Hände und Füße.
»Endstation!« Rascheln und Knistern in den Bögen. Die Seiten wenden sich. Der wandernde Derwisch gähnt gewaltig und läßt seinen Mantel liegen.
»Komm mit mir, mein Kind, dann belebe ich dir die Welt mit meinem Hauch.«
Sie gehen zusammen an der Alten Donau spazieren, erwärmt bis zum Ineinanderverschmelzen. Und doch wird jedes Schaf an seinen eigenen Beinen aufgehängt.
»Anna Margotti, mein Kind, jetzt nehme ich mir dein Herz!«
Der Traum dauert schon zu lange.
Da hat der Dschinn des verborgenen Sinns sich ins eigene Fleisch gehackt, und Anna Margotti macht die Augen auf.
Nachtschlafen stellt sich Anna ihrer Arbeit. Ohne Beschäftigung keine Ermächtigung. Ihr Herz flattert noch ein wenig. Wenn sie ihre Schuhe putzt, geschieht das auch für den Chef, der eine Chefin ist. Der Glanz der Firma spiegelt sich im Oberleder. Und wie sich alles spiegelt, sogar die Welten, um die sich alles dreht, um eine wirklichere Wirklichkeit, nicht bloß Daten, Daten, Daten. Entscheidend ist der Überblick, System X, die Zukunft, die alle einander wegzunehmen versuchen, so als hätten sie sie längst auf ihren Schirmen.
»Anna, du meine Vorstellung von Hollywood«, schreibt Frantischek, der Laufknabe, auf das Papier über ihrem Schinken-Käse-Toast. »Deine Beine sind länger als der Sunset Boulevard!«
Anna zählt ihm filmentrückt das Geld in die verschwitzten Haltefinger. »In drei Jahren gehe ich mit dir aus, Frantischek, wenn du dann noch möchtest.« Bis dahin ist sie längst in ihren Wunschkörper entrückt. Oder tot. Und Frantischek wird eine Vierzehnjährige lieben.
Annas violettes Nagelballett wirft die Maschine an und bringt die Flüssigkristalle zum Flimmern.
»Weißt du, wie man Veilcheneis macht?« Teresa, die Kollegin vom anderen Terminal, hat wahrscheinlich an die vorletzte Kaiserin gedacht, die so gerne Veilcheneis aß.
»Nein, aber wie wäre es, wenn wir nach Büroschluß Eis essen gingen?«
»Laß dich umarmen, Anna, es ist natürlich noch viel zu kalt, aber es erinnert mich daran, daß es so etwas wie Frühling geben soll.«
Das Leben ist arbeitsreich und auf Erwerb eingestellt. Warm eingepackt ins weltweite Netz, kennt Anna die kalten Lüfte der Rezession nur aus der medialen Aufbereitung. Konjunkturschwächen und multiples Strukturversagen sind ihr durchaus geläufig, sie jagt sie täglich durch ihren Daten-Verteiler, aber am eigenen Berufsleib hat sie noch keinen Zusammenbruch erfahren, und sollte ihre Firma einmal ins Wanken geraten, dann wankt mit ihr ganz Europa.
Die Sicht, die sich Anna tagtäglich bietet, ist eine von oben. Was das heißt? Die Linien wirken geometrischer, das Grün umfassender. Und wenn der Lift steckenbleibt? Als Alptraum erkennbar, kehrt diese Vorstellung von Zeit zu Zeit wieder. Die Luft ist auch ziemlich trocken, trotz der drei Philodendren. Ansonsten läßt sich wenig an Klage führen. Von ihr aus betrachtet. Insgesamt allerdings? Wer die Menschheit als solche in den Blick nimmt, möchte sich das Menschsein gleich abgewöhnen.
Nach jedem Kriegsbeginn kauft Anna sich neue Schuhe. Die Welt hat ihre Freude bitter nötig, schon wegen der Gesamtatmosphäre. Vielleicht kann sie etwas von den positiven Schwingungen um den Globus jagen, als mentalen Antrieb.
»Anna«, sagt die Chefin, »lächeln Sie sich von mir aus um den Verstand, aber lächeln Sie!«
Diesen Gefallen kann sie der Chefin natürlich nicht tun, ihr Verstand ist ihr heilig. Wo käme eine Frau heutzutage auch hin? Am Lächeln alleine kann es ja wohl nicht liegen.
»Ich leide an einer Allergie gegen irreparable Fehlerzustände.« Teresa ist es ernst damit. Dabei arbeitet sie nicht einmal an dem Regierungsauftrag mit, den sie – Programmierer unter sich – euphemistisch PACIDIUS nennen. »Du lachst mich nicht etwa aus?«
Anna lacht über niemanden. Nicht einmal über Ferdy aus der Postabteilung, der von nichts anderem redet als von seiner Tonsur. »Eindeutig Franziskaner – wie komme ich dazu?«
»Dein Bauch, Ferdy, dein Bauch ist der zweite Hinweis. Es bedarf dreier Zeugnisse. Das dritte ist die hierarchische Güterverwaltung.« Teresa weiß noch so einiges aus ihrer streng katholischen Kindheit, um Ferdys Fixierung zu füttern. »Gehorsam, Ferdy, Armut und Keuschheit!«
Ferdy ist außer sich. »Allein der Gedanke!«
»Würde dir guttun, Ferdy, würde dir guttun!«
Die Chefin hat nichts gegen kleine Späße. Spaß fördert erwiesenermaßen das Betriebsklima. Sie kann nur Gekicher nicht ausstehen, diese von Tönen geschüttelte Luft. Darum schätzt sie das Lächeln von Anna, das sich nicht via Schallwellen fortsetzt.
Apropos Chefin. Natürlich nur hier und im schmalen lokalen Bereich. Die Firma ist weltweit verstrickt, da reden dann schon die Bosse. Aber gerade lokal gilt es, an Regierungsaufträge zu kommen. Das stärkt die Position und verleiht die Aura des Geheimnisträgers. Unausgesprochen, versteht sich. Sämtliche Niederlassungen funktionieren personalunaufwendig. Die Umstellung erfolgte rechtzeitig. Ausgedehnte Netze, viele Schnittstellen, äußerst intelligente Software. Eine Handvoll Spezialisten verschiedenster Herkunft, damit die Firma – was den Personalstand angeht – mentalitätsunabhängig und mobil bleibt.
Anna hat ein eiskaltes kleines Programmierungsgehirn unter der rotgelockten Kalotte. Was selbst Jussuf, der Vordenker aus dem Einzelbüro, von Zeit zu Zeit zugibt. Sie entlockt den Fenstern auch dann noch Vorschläge, wenn Jussuf, das Genie, auf der gesamten Klaviatur ausgerutscht ist.
»Die Kerle protegieren dich. Sie bevorzugen Rothaarige«, schwört Jussuf gedemütigt. »Wie soll ich da noch punkten?!«
Jussufs Sehhilfen reagieren auf Licht und Schatten. »Wenn du lächelst, Anna, spielen meine Gläser Sonnenbrille. Komm schon, strahl mich an!«
»Bin ich Potiphars Weib?« Anna kennt die Geschichten vom Zustandekommen der Welt. Und Jussuf ist Libanese, einer der Abtrünnigen. »Ich bin es leid, mich für Kleinterritorien massakrieren zu lassen, wenn ich ganze Highways bekommen kann.«
»Und was ist mit deiner Identität?« Ivo kann nicht anders, wie er auch nicht anders kann als Slibowitz trinken, wenn er abends seine serbischen Freunde trifft.
»Laß mich doch damit in Ruhe. Allen Ernstes, Ivo, die Frage ist, greifst du auch zu oder rufst du nur ab? Ich esse gerne, ich bumse gerne, ich gehe gerne ins Kino. Kann ich das nur als Libanese?«
Ivo schweigt gekränkt.
»Im Gegenteil. Als Libanese kann ich das zur Zeit eher schlecht.«
Teresa schüttelt die Faust mit der Maus. »Hast du denn keine Seele?«
Jussuf lächelt maliziös. »War das nicht eine Idee der Russen?« Er wird nie eine Glatze haben, höchstens einen Bauch.
Ivo ist Deserteur und erst seit kurzem im Brain-Trust, geradewegs aus dem Flüchtlingslager engagiert, weil er programmieren und Deutsch konnte. Seine Zellen sind noch frisch, aber der Zustand seines Landes macht ihn ablenkbar. Die Chefin probebenotet ihn noch. Er ist weniger fix als Frantischek, der als jugendlicher Autodidakt, sozusagen als Kindergenie, an Bord gekommen ist. Daß er in die Kantine geschickt wird, hat eher pädagogische Gründe. Auf diese Weise lüftet er wenigstens seine Pickel.
Anna steht also insgesamt ganz gut da in dieser von Pleiten gebeutelten Welt. Begabungsmäßig nicht unterfordert, lohnabhängig zwar, aber noch nicht hierarchiegeschädigt, darf sie sich als Mitarbeiterin mit Aufstiegschancen begründete Hoffnungen machen.
»Dein Glück!« Gigi, ihre Mutter, hat es von Anfang an gewußt. Und selbst wenn Annas Glücksvorstellung abweicht, herrscht Einigkeit zwischen ihr und den Familienmitgliedern, daß sie es schlechter hätte treffen können. Beruflich gesehen und überhaupt. Privat scheint sie dem Schicksal sommersprossenloser Rothaariger aufzusitzen, leicht entzündbar, selten erwärmt, kaum je wirklich in Brand geratend.
»Kind, erhalte dir diese Gemütslage«, beschwört Gigi sie des öfteren.
Bisher ist alles herzschonend verlaufen. Und es hat ihr auch nicht viel ausgemacht, schließlich kann sie nicht kennen, was sich nicht ereignet hat. Nur manchmal ahnt sie bereits, daß sie mit Frantischek mehr erleben würde als mit all den Ferdys, Jussufs, Ivos und Haugsdorffs zusammen.
Haugsdorff ist der, für den ihr Herz zur Zeit schlägt, ohne dabei aus dem Tritt zu geraten.
»Den hältst du dir warm.« Gigi hat sich die Vaterlosigkeit ihrer beiden Töchter nie ganz verziehen. »Glaub mir, ich kann dir in kürzester Zeit das Psychogramm eines jeden erstellen.«
»Und die Nutzanwendung?« fragt Anna gelangweilt.
»Daß ich persönlich nichts daraus machen konnte, beweist nichts. Auch Chirurgen operieren sich nicht selbst.«
Haugsdorff ist insgesamt gut erhalten, Ministerialbeamter der höchsten Dienstklasse, hat einiges hinter sich, aber kein Aids (Selbstaussage), und ist verrückt nach Biedermeier-Miniaturen seit vielen Jahren schon. Sein Geist erholt sich dabei, wie er sagt. Früh verwitwet nach einer ersten Ehe, die Kinder im Hochschulalter, ist er ein Mann, dem von seiner Sekretärin immer noch jugendliches Aufbrausen vorgeworfen wird. Zweimal die Woche Fitness-Club, kein Tennis, dafür Reiten. Riecht danach spürbar nach Pferd und am Abend gelegentlich nach Pfeife.
»Wenn du mich fragst, Heimlichgenießer.« Jussuf kennt Gott und die Welt, und mit Haugsdorff verbindet ihn sogar ein Staatsgeheimnis.
»Erlaube!« Anna erregt sich künstlich. »Was meinst du damit?«
»Braucht gut getarntes Privatleben, schon von Berufs wegen.«
»Du hast es nötig!« Teresas Stimme könnte einen Apfel in Spalten schneiden.
Jussufs Lächeln trieft entsprechend. »Und? Habe ich je einen Narren aus mir gemacht?«
»Weil du immer schon einer warst!«
»Daher mein Anspruch auf Wahrheit. Also, keine Sentimentalitäten, Anna. Dafür hast du ihn lange.«
Anna ist das zu kompliziert. Mit Haugsdorff kann sie sich jedenfalls sehen lassen. Er schreit nicht mit ihr, und sie braucht seine Hemden nicht zu bügeln. Daß er davor immer seinen Schwanz waschen geht, ist pure Rücksichtnahme. Dabei bringt er ihn wahrscheinlich hoch.
»Ich tue das alles sehr bewußt«, sagt Haugsdorff, »auch rieche ich gerne gut.«
Anna kitzelt ihn zwischen den Brusthaaren. »Solange du mich nicht dabei vergißt.« Das Ganze ist keineswegs unangenehm, auch wenn es ihr zuweilen zu ritualisiert erscheint. Anna weiß, daß sie froh sein kann, jemanden wie Haugsdorff zu kennen, und sie liebt ihn auch, manchmal mehr, manchmal weniger. Er nimmt sie zu bemerkenswerten Leuten mit, was ihre Bildung fördert, obgleich sie sich unter all den Sammlern ein wenig langweilt.
Sie selbst sammelt nichts außer Liebesbriefen, gerade weil das heute nicht mehr üblich ist. Sie hat sogar die aus ihrer Schulzeit aufgehoben, bebändert und sortiert. Und Frantischeks kulinarische Beipackzettel ruhen in einer blechernen Proviantdose, damit die Fettflecken sich nicht auf Umweltpapier oder gar handgeschöpftes Bütten durchdrücken.
»Anna, warum erlöst du mich nicht aus meinem Data-glove, damit ich mich der Realität deiner Wünsche stelle!« seufzt Frantischek.
Was aber am angenehmsten ist, Haugsdorff läßt ihr Luft. Mindestens drei bis vier Abende pro Woche. Er ist Verantwortungsträger, der seinen Schlaf braucht. Auch will er ihr seinen Anblick ersparen, wenn er besitzgeil und mit einer großen Lupe über seinen Miniaturen kniet und die Eckdaten der noch ausständigen herbetet. Vor allem, was sie kosten. Auch ihm sind Grenzen gesetzt, gewissermaßen sechsstellige. Sein altes Geld ist ins Fortkommen der Kinder investiert. Es herrscht strenge Trennung zwischen Familienbetriebskosten und persönlichem Investment.
An diesen Haugsdorff-losen Abenden fällt Anna ins ursprüngliche Milieu zurück, geht mit Jussuf und Frantischek ins Kino oder sitzt im Nachthemd in der Küche, füttert die Nachbarskatze, die übers Dach zu Besuch kommt, lutscht Gummibärchen aus reinem Fruchtsirup und läßt ihren alten Walkman dröhnen. Manchmal liest sie auch oder besucht Schwester Bonny in der Donaustadt, die das ortsübliche, nicht durch einen Job wie dem Annas verwöhnte Leben führen muß.
»Es ist wirklich zum Lachen. Ich habe drei Kinder und einen Mann, der trinkt. Fett werde ich auch zusehends, und in der Nachbarschaft stürzen sich die Leute aus dem Fenster. Also Stoff genug für drei Fernsehserien.«
Anna mag Schwester Bonny, auch wenn sie froh ist, daß die jetzt Familie hat und sich nicht mehr ausschließlich um sie kümmert. Auch trinkt ihr Schwager nur Bier und schlägt sich in seiner Freizeit mit einer Truppe herum, die die Altwiener Tradition des Stegreiftheaters wiederzubeleben versucht. So schlecht ist das alles gar nicht, und die letzte Uraufführung eines solchen Stegreifstücks, bei dem nur die Handlung vorgegeben ist – den Text erfinden die Schauspieler selber –, hat sogar Haugsdorff zum Lachen gebracht.
Am liebsten aber spielt Anna »Dame«. Einziger ernstzunehmender Gegner ist Neffe Donald, hinter dem die beiden Jüngeren sich – kiebitzend der eine, Gesichter schneidend der andere – verrenken, während Donald von Zeit zu Zeit einen genialen Zug macht, dem auch Anna nichts entgegenzusetzen weiß. Bonny behauptet, er erinnere sie in vielem an Anna als Kind. Lesen hat er übrigens auf der Tastatur des PC gelernt, vor der Schule, versteht sich.
Wenn Anna dann allein in ihrem Bett liegt und noch nicht schläft, spürt sie, daß bei so viel Ordnung etwas nicht in Ordnung sein kann.
»Genieß das Leben, Anna«, Bonnys stehender Abschiedssatz, »solange du noch kannst!« Was soll das denn heißen? Anna weiß, daß ihr Herz ein Risikofaktor ist, aber noch hat sie es gut verpackt. Nur im Traum spürt sie manchmal das Gewicht der Dinge. Und so träumt sie am liebsten gar nicht. Sie hat es bloß nicht in der Hand. Zum Glück. Denn der Rest an fremdartiger Verwirrung, der noch beim Erwachen ihr Herz klopfen läßt, gehört zu dem wenigen, das sie bei sich – strenggenommen – als Seelenleben gelten lassen kann. Jene mitunter drastischen, dann wieder unverständlichen Anspielungen auf die nicht in Anspruch genommenen tieferen Lagen ihrer Empfindungsfähigkeit beschäftigen sie oft wesentlich länger als die Frage Haugsdorffs, ob sie ihn als Liebhaber denn auch schätze und welches ihre Lieblingsstellung sei. Aber in technischen Belangen entscheidet sie immer spontan und der Tagesverfassung entsprechend.
Nicht so, wenn es um Gefühlsdinge wie ihren dreiundzwanzigsten Geburtstag geht. Haugsdorff macht mehrere Vorschläge, die ihr alle zuwenig auf ihre Person abgestimmt sind. Sie hätte gern, daß er sich für sie und nur für sie etwas einfallen ließe, was er jedoch mit der Haubenzahl von Lokalen durcheinanderbringt.
Mutter Gigi und Schwester Bonny reden vom Üblichen, dem sogenannten Familienfest, das aber gibt es jedes Jahr.
Nur Frantischek hat etwas von seiner Genialität für sie abgezweigt. Er schlägt ihr ein nächtliches Picknick in einer Rettungszille am Donaukanal vor. Die Zille müßten sie sich erst erobern, Sandler pflegten darin zu nächtigen, wenn die Temperaturen sie dabei überleben ließen, was Ende Februar nicht unbedingt gewährleistet wäre. Allein der Tatbestand der strafbaren Handlung würde dem Ganzen eine abenteuerliche Note geben, und er, Frantischek, hätte eine echte Chance, sich im Kampf gegen düstere Unholde oder die Wasserrettung zu bewähren.
»Frantischek, vielleicht komme ich auf dein Angebot zurück. Flüsse ziehen mich merkwürdig an. Wir spielen dann Wassermann und Donauweibchen. Ich denke an meine Geburt, und du öffnest die Sektflasche.«
»Ach, Anna, wenn du nur ein einziges Mal zu deinen geheimen Wünschen stehen würdest. Folge mir beim nächsten Gedankenschritt, und du wirst Oberon in mir erkennen.«
»Frantischek, du gehst doch nicht etwa ins Theater?«
Frantischeks Blick ersetzt eine ganze Vorstellung. »Spielverderberin! Was kann ich dafür? Meine Mutter ist Souffleuse am Akademietheater.«
Anna kichert ansatzweise in die Kissen. Wenn sie tatsächlich mit Frantischek den Donaukanal hinunterführe? Wie sie von Jussuf weiß, fällt in diesem Jahr ihr Geburtstag mit der Nacht der Schicksalsbestimmung zusammen, in der manche Muslime Visionen haben. Und am anderen Tag muß man strenges Fasten halten.
Nein, sagt sie sich, um diese Jahreszeit ist ans Freie nicht zu denken. Das Ende des Abenteuers wäre wohl ein Blasenkatarrh. Vergiß es, Anna. Der Natur ist dein Geburtstag schnurz. Haugsdorff wird dich um zwölf nach Hause bringen, weil er, wie sich bereits abzeichnet, anderntags Mitglied einer speziellen Delegation ist, die zu Ermittlungen sowie Erkundungen nach Übersee fliegt. Und das wird es dann auch schon gewesen sein.
Annas gelegentliche Zweifel an der Dichte ihres Gefühlslebens dürfen nicht über ihren beruflichen Ehrgeiz hinwegtäuschen. Ihr Tick sind weiterbildende Kurse, Spezialschulungen auf Firmenkosten, das Kennenlernen brandneuer Programmerstellungsmethoden. Insofern fühlt sie sich nicht nur ihrem eigenen Fortkommen, sondern auch dem der Firma verpflichtet. Ihr Wissensstand gehört halbjährlich nachjustiert. Wer weltweit alle Terminals anlaufen will, muß auch weltweit Bescheid wissen. Der Fortschritt produziert alle nasenlang ein neues Modell, dessen Nichtzurkenntnisnahme die Firma den Vorsprung kosten kann.
Also läßt Anna sich schulen, fährt in Ausbildungscenter – umgebaute Schlösser oder Klöster –, die auch noch Kurse in fernöstlicher Meditationstechnik und makrobiotischer Ernährung anbieten. Oder was immer man zusätzlich für Leib und Seele tun möchte.
»Merk dir, wer alles da war«, trägt Jussuf, der sein eigenes Netzwerk geknüpft hat, ihr vor dem Lehrwochenende verbindlich auf. »Und flirte nicht zuviel. Es sind ohnehin immer dieselben Leute!« Womit er weder ganz recht noch ganz unrecht hat. Jedenfalls mag sie die, die sie schon kennt; und die, die sie noch nicht kennt, könnten sich als interessant erweisen.
Aber in Wirklichkeit ergibt sich nichts, was über Haugsdorff hinausginge. Ihr Kopf füllt sich mit den neuesten Kniffs und Computerskandalen, während ihr Herz im morgendlichen Schwimmbecken nach den Überresten von Träumen fischt, die sich viel zu rasch aufgelöst haben.
Die Mahlzeiten sind die eigentlichen Höhepunkte. Benutzerfreundliche Zwischendecks laden zum Rückgriff auf Basistermini ein wie Essen und Trinken. Die Speisenkarten sind maschinenlesbar und die einzelnen Menüs codiert. Der Informationsfluß gerät auch bei vollem Mund nicht ins Stocken, wird höchstens ein wenig gestaut, und wie immer, wenn mehrere Vertreter derselben Branche beisammensitzen und nicht gerade arbeiten, geht es weniger um die »beständigen Ausblitzungen der Gottheit« als um selbstkommentierende Zeichenmengen in transparenten Kombinationen.
Nach der entsprechenden Masse flüssigen Geistes werden die Systemverwalter dann zu jugendlichen Hackern, die sich ihrer detektivischen Leistungen rühmen, ihrer Piratenfahrten durch die Datenmeere, während ein jeder instinktiv den Code seines weiblichen Gegenübers zu knacken versucht, ehe die Versammlung der Schulungswilligen in Pärchen und Solitäre zerfällt.
Vor dem Einschlafen bilanziert Anna, daß sie zumindest ein paar neue Witze gehört hat. Sie hat zwar keine Visionen, aber Träume, aus denen man schwer erwacht. Insofern ist für sie häufig Nacht der Schicksalsbestimmung, Kadir-Nacht also, wie Jussuf sie nennt.
Diesmal ist nicht »Dschinn des verborgenen Sinns« das Paßwort, sondern »Haare lassen«, und der wandernde Derwisch heißt überdeutlich Lullus, wie der Erfinder der ersten logischen Maschine, die der Missionierung der Muslime dienen sollte. Nachdem er ihnen wieder und wieder demonstriert hatte, daß ihre Religion ein bloßer Irrtum sei, den seine Logik korrigieren könne, steinigten sie ihn mitsamt seinem originalen Taschencomputer.
In Annas Traum ist Lullus Friseur, der die Haare auf ihrem Kopf zählt und sie zu einer binären Perücke verarbeitet, die teils eine ist und teils nicht. Ein Engel stolpert in den Frisiersalon und handelt mit Lullus die codierfähigen Namen Gottes aus, während allenthalben der Schaum steigt.
Als sie Jussuf die Teilnehmerliste überreicht, fragt er sie nach einem Kursleiter namens Dschibril, aber gerade an den kann sie sich nicht erinnern. »Ich war diesmal nicht in Systemkunde.«
Zur nächsten Schulung wird Teresa fahren, und sie verspricht, ein Auge auf diesen Dschibril zu haben. Nicht zu werfen, wie Jussuf im selben Augenblick unterstellt. »Der Mensch ist ein informationsverarbeitendes Tier, also verhalte dich demgemäß.«
Ivo muß am Wochenende versucht haben, sich zu ertränken. So wie er noch am Montag morgen riecht, ist er bloß mit knapper Not davongekommen. Aber nach einem Meditationsbier ändert sich sein Zustand schlagartig, und schneller, als die anderen sich wundern können, ist er wieder kompatibel. Nur in seinen Augen bleibt der stumpfe Schein der vorhaltenden Misere.
»Sei vernünftig, Ivo!« Anna legt ihm in einer Programmierungspause die Hand auf, was er, sich gegenlehnend, gerne duldet. »Du kannst den Krieg nicht mit der Flasche in der Hand gewinnen!«
»Soll ich ein Gewehr nehmen?«
»Bleib fit für danach!«
»Es wird kein Danach mehr geben!«
»Versau dir und uns nicht den Tag, Ivo! Es gibt immer ein Danach.«
Und Teresa hat verschwollene Augen und eine sich weitende Seele. Sie hat sich zum dritten Mal die alte russische Verfilmung von »Krieg und Frieden« angeschaut.
Nach Büroschluß geht Anna ein Kleid kaufen. Das Kleid der Kleider. Eines, das zu ihrem Geburtstag paßt, eine Seelenhülle. Die Einstimmung erfolgt stufenweise, Rolltreppe für Rolltreppe. Sie fährt stehenden Fußes empor durch die überhitzte, geruchsneutrale Kaufhausluft bis zur stockwerküberschreitenden Damenabteilung, Wäsche und Strickwaren inbegriffen.
»Möchten Sie probieren?« Die Verkäuferin lächelt auftragsgemäß.
»Etwas speziell für Rothaarige!« Anna betont sich mehr als sonst.
»Nilgrün mit einem Stich ins Türkise?«
»Undenkbar. Ich möchte mich wohlfühlen.«
»Taubenflügelgrau oder schlammfarben?«
»Wie wär’s mit Perlmutt in Richtung Mauve?«
Frage und Gegenfrage, die das Gewünschte aufs Konkrete einengen, bis es dann etwas wird zwischen Islandmoos und Weinblattschattierung.
Schon beim Probieren legt sich der Stoff um die Haut, als wolle er anwachsen. Die Verkäuferin würde es gerne selber tragen, obwohl sie eigentlich brünett ist, mit nur einem Hauch von Henna.
»Ich hoffe, Sie haben Freude daran!« Es kommt nicht oft vor, daß Rothaarige die richtigen Sachen kaufen, aber für dieses Kleid würde die Verkäuferin die Hand ins Feuer legen.
»Bei dem Preis muß mehr drin sein als das!« Anna lächelt. Sie hat es schon in der Früh gespürt, daß sie heute zuviel Geld ausgeben würde. Aber wer weiß, wohin Haugsdorff sie wieder verschleppt. Da möchte sie zumindest kleidungsmäßig am Platz sein.
Anna wird tatsächlich dreiundzwanzig. Je näher der Tag kommt, desto mehr beschäftigt sie sich damit. Nicht einmal in dem Buch »Das Mysterium der Zahl« steht etwas darüber.
Haugsdorff, der mehr als doppelt so alt ist, beginnt schon, sie aufzuziehen. »Ein Küken«, sagt er, »das zum ersten Mal die Flügel schüttelt.«
»Ich will, daß irgend etwas Aufregendes passiert.«
»Wie aufregend darf es denn sein?«
»Etwas Umwerfendes, das mich aus den Socken haut!«
»Aus welchen Socken?«
Anna boxt Haugsdorff und erklärt, daß er sie nie verstehen werde. Sie sei nicht so abgeklärt wie er, sie müsse noch etwas erleben.
Haugsdorff denkt erkennbar nach. »Möchtest du vielleicht nach Afrika? Irgendwohin auf Abenteuerurlaub? Ich meine nicht gleich, aber noch in diesem Jahr.«
Anna zögert einen Augenblick, dann schüttelt sie den Kopf, daß die Funken stieben. »Versteh mich nicht falsch, du bist ja eher die Ausnahme. Aber Leute, die sich so etwas leisten können, sind meistens gaga. Snobs oder Angeber.«
»Meinst du etwa Sammler?« Haugsdorffs persönliche Freunde sind fast alle Sammler, kein Wunder, daß in seiner Stimme ein Anflug von Beleidigtsein mitschwingt, aber das hält ihn nicht davon ab, Annas Brüste zu massieren.
Es ist nicht so, daß Haugsdorff sie entjungfert hätte, aber davor war nicht viel, außer einem Schulkollegen, der Sex auch nur aus dem Fernsehen kannte und von dem sie beim zweiten oder dritten Mal schwanger wurde. Diese Wochen des Aufruhrs der Gefühle hat Anna immer zu vergessen versucht, und es ist ihr gelungen, wenn auch nicht ein für alle Mal. Die Angst vor der Entscheidung, entweder abzutreiben oder ein Leben wie Gigi, ihre Mutter, zu führen, hat sie dazu gebracht, mit dem Essen aufzuhören, und als Gigi sich in ihrer Verzweiflung nicht mehr anders zu helfen wußte, als sie mit Bonnys Hilfe in eine Klinik zu zerren, um sie künstlich ernähren zu lassen, war der Embryo von alleine abgegangen. Da hat Anna dann wieder zu essen begonnen und darauf bestanden, daß Gigi und Bonny nichts davon erfuhren.
Danach gab es eine Weile nur mehr den PC, bis sie auf dem Umweg übers Büro Haugsdorff kennengelernt hat.
Bei Haugsdorff fühlt Anna sich sicher. Sicher vor großen Entscheidungen. Er ist, weiß Gott, ein behutsamer Liebhaber, der ihr so gut wie alles beigebracht hat, was sie wissen muß, um selbst ihren Spaß zu haben. Und eine Zeitlang ist sie ziemlich gehorsam gewesen.
Eines Nachts, sie alberten gerade ein wenig herum, und Haugsdorff tätschelte ihren Hintern, als wolle er ihn versohlen, fragte er sie, ob sie als Kind streng bestraft worden wäre, und da sie sich nicht daran erinnern konnte, je von Gigi geschlagen worden zu sein, gab sie weiter, was Teresa aus ihrer Internatszeit erzählt hatte, von unfolgsamen kleinen Mädchen, die zur Strafe auf einem Holzscheit knien mußten, und das im finsteren Abstellraum hinter dem Schlafsaal, so daß sie sich vor Angst in die Hosen ihrer Pyjamas machten.
Die Wirkung auf Haugsdorff war so offensichtlich, daß Anna im ersten Augenblick sogar erschrak. Er kam auf eine Weise, wie sie ihn noch nie zuvor hatte kommen sehen, und es dauerte Tage, bis sie begriff, daß sich ihr Verhältnis zu verschieben begann. Von da an war sie es, die ihm etwas beibrachte, etwas, von dem er bis dahin kaum etwas gewußt zu haben schien.
Annas Phantasie ist gefordert, sie denkt sich Geschichten aus und genießt es, daß Haugsdorff darauf abfährt. Seine Dankbarkeit verstärkt den Schutzschild um sie herum, es kann ihr nichts mehr geschehen.
Es sind Geschichten, in denen sie das Kind ist, das von anderen Kindern erzählt, die grausam bestraft werden, und sie selbst ist grausam, wenn sie bestimmt, wieviel Haugsdorff jedes Mal davon hören darf.
Von der vorgeschlagenen Afrikareise ausgehend, erfindet Anna etwas über Missionskinder und Nilpferdpeitschen, an die sie sich aus einem Karl-May-Band erinnert, den sie seinerzeit gelesen hat, und Haugsdorff, dem der Schweiß auf der Stirn steht, endet mit einem »Halleluja«, bevor er sich fürsorglich ihren Bedürfnissen widmet.
Danach geht Haugsdorff sich einen Drink holen. »Möchtest du auch einen Schluck Bourbon?«
Anna schüttelt sich. »Mineralwasser, bitte. Du weißt, daß ich Alkohol nicht vertrage.«
Haugsdorffs anschließende Umarmung ist noch immer feucht. »Du machst mich ganz verrückt mit deinen kleinen Geschichten, Anna.«
»Soll ich nicht?« Anna kräuselt die Lippen, als schmolle sie.
»Und wie du sollst. Nur das sollst du.« Er küßt ihr den Geschmack von seinem Bourbon auf die Zunge.
Aber Anna interessiert auch noch etwas anderes. »Und was machen wir wirklich an meinem Geburtstag?«
Haugsdorff faltet die Stirn. »Wenn du versprichst, daß es bei dem einen Mal bleibt, das heißt, unter meiner Aufsicht …«
Anna empört sich. »Du sollst mich nicht immer bevormunden!«
»… mache ich dich mit etwas bekannt, das dich aus den Socken haut, wie du sagst.«
»Und was soll das sein? Etwas Großes, etwas Kleines, etwas Dickes, etwas Dünnes? Sag schon, und ich sage dir, was mich nicht aus den Socken haut.«
»Etwas Kleines. Etwas ziemlich Kleines. Du mußt mir versprechen, daß du es nur in meiner Gegenwart nimmst.«
Anna wälzt sich zum Nachtkästchen, um ihre Uhr umzulegen. »Ist es Koks? Das habe ich schon probiert.« Das ist zwar gelogen, wie auch Haugsdorff weiß, aber Anna kann es sich lebhaft vorstellen und hat keinen Bock darauf. »Es macht mir keinen Spaß. Außerdem nehmen das auch nur so Leute.«
»Niemand darf die geringste Ahnung haben. Was ich meine, ist noch gar nicht auf dem Markt. Ein Ladykiller, keine Harte-Männer-Sache, bewußtseinserweiternd und durchaus nicht gesundheitsschädlich, dennoch riskiere ich viel, wenn ausgerechnet ich dich davon kosten lasse. Aber es ist ein besonderes Geburtstagsgeschenk, du wirst sehen.«
»Wie heißt das Zeug?« Anna fragt sich langsam in die Neugierde.
»Keine Namen, keine Aufzeichnungen, keine Wiederholungen, verstanden?! Das Ganze existiert nur an deinem Geburtstag. Ich schwöre, er wird dir in Erinnerung bleiben.«
»Und keines von diesen gräßlichen Restaurants mit Leuten, die ihre Geldtaschen verschluckt haben?«
»Nichts davon. Alles rein privat. Einmal ist für jeden das erste Mal. Du sollst mir nicht nachsagen, daß ich mir nichts für dich ausgedacht hätte.«
»Eigentlich unterscheidet sich das, woran wir arbeiten«, erklärt Jussuf, der Experte für Zuwanderer aus dem Nahen und Mittleren Osten, »nicht wesentlich von der guten alten Kristallkugel der Wahrsager, nur daß das Wünschen allein nicht mehr hilft, man muß auch noch Knöpfe und Tasten drücken. Aber was in Erscheinung treten soll, ist letztlich nicht weniger als das Ganze. Wie viele Blickwinkel – so viele Modelle. Die angesogenen Daten werden raffiniert und als reine Information die Ränge hinaufgetrieben. Wir sind zu jeder Art von Indiskretion bereit.
Nur mit dem absoluten Überblick lassen sich richtige Entscheidungen treffen. Dazu bedarf es sämtlicher Daten. Diejenigen, die die Programme erstellen, nämlich wir, müssen von allem Kenntnis haben. Das muß die Regierung in Kauf nehmen. Datenschutz ist etwas für die anderen. Also ist es geradezu unsere Pflicht, uns Hintertüren offenzulassen. Zum Glück werden Programmierer heute nicht mehr um die Ecke gebracht wie die Baumeister, die die Grabkammern der Pharaonen entwarfen, um mit ihnen auch ihr geheimes Wissen zu vernichten.
Dennoch heißt es aufpassen. Ich denke dabei nicht unmittelbar an PACIDIUS, obgleich Menschen schon aus unbedeutenderen Gründen ins Gras beißen mußten. Das Innenministerium hat ja reichlich Daten zur Verfügung gestellt, zum Beispiel die Adressen sämtlicher registrierter und vermuteter Assassinen-Kultstätten in der Hauptstadt plus Umgebung. Nicht nur die Adressen, auch wo die Leute tagsüber arbeiten, die registrierte oder vermutete Anhänger des Alten vom Berg und seines Kults sind, wen sie erpressen, mit wem sie schlafen und welche sexuellen Spezialpraktiken ihnen nachgesagt werden. Unsere Aufgabe wiederum ist es, die Daten so miteinander zu verknüpfen, daß mögliche Allianzen sichtbar werden, Vernetzungen und Verknüpfungen, mafiose Strukturen, mit einem Wort, die Daten so aufzubereiten, daß die potentiellen Eiterherde unter den Migranten sichtbar werden.«
Es ist eine von Jussufs Standardvorlesungen, und Anna hört ihm kaum mehr zu, wenn er sich so mit erhobenem Zeigefinger in der legendenreichen Beschreibung ihres profanen Berufsstandes übt.
Übrigens hat Ivo, dessen Humor zwischendurch immer wieder erwacht, PACIDIUS, an dem er zwar nicht mitarbeitet, von dem er aber weiß, in TATORT umbenannt, nach der seit über zwanzig Jahren produzierten Sonntagabend-Krimiserie, die ihre Verbrechen vorrangig im Milieu einschlägig beleumundeter Minderheiten verüben läßt. Was zur Folge hat, daß in PACIDIUS einige in den Drehbüchern zu TATORT figurierende Kultstätten und Lokale, wie das Café Museum oder das Restaurant Butterfaßl im Prater, als real inkriminierte auftauchen. Spaß muß sein. Und irgendwer trifft sich dort immer mit irgendwem.
»Was wir hier tun, dient dazu, die Welt faßbarer zu machen«, hatte die Chefin Anna erklärt, als sie sie dem PACIDIUS-Team zuteilte. »Wir können damit nicht nur den Frieden im Inneren wahren helfen, sondern vielleicht sogar Menschenleben retten.«
Wenn es darum geht, Menschenleben zu retten, erübrigt sich jede Debatte über die Eleganz von Methoden. Ebenso sinnlos wäre es gewesen, die Chefin nach weiteren Details zu fragen. Schließlich ist Haugsdorff der Verbindungsmann zum Ministerium und somit der eigentliche Auftraggeber. Und Anna vertraut Haugsdorff, zumindest diesbezüglich.
»Dem Reinen ist alles rein«, bemerkt Jussuf täglich zu Arbeitsbeginn, »also rein mit allem, was wir an Daten zur Verfügung haben.«
Und nun auch noch das! Anna muß ihre Sachen aus der Wohnung ihrer Mutter holen – sie wohnt noch nicht so lange allein –, ihre Kindersachen und was sonst noch von ihr rumliegt.
»Ich dachte, dann ist alles an seinem Platz. Wo du doch diese nette kleine Wohnung gefunden hast.«
Die nette kleine Wohnung ist Zimmer-Küche, wie gehabt. Und der Balkon ein winziger Eisenkäfig, auf dem Anna ab und zu, wie zum Trotz, frühstückt oder zu Abend ißt. Aber allemal das eigene Zimmer, die eigene Küche, und den Balkon kann ihr erst recht niemand streitig machen.
»Ich schmeiß das ganze Zeug weg, damit es dir aus dem Weg ist. Wenn ich alles mit zu mir nehme, ist wieder kein Platz.« Anna paßt das alles überhaupt nicht.
Ihre Mutter hat einen neuen Freund, und der will auch noch bei ihr einziehen.
»Wegschmeißen auf keinen Fall. Das habe ich nicht gemeint. Dann räum es lieber in unser Abteil im Keller. Du kannst doch nicht alles wegschmeißen, deine ganze Kindheit und Jugend. Barbarisch wäre das, ausgesprochen barbarisch. Das würde Oskar schon gar nicht wollen.«
Der Mensch heißt auch noch Oskar. Ist jünger als Haugsdorff und heißt Oskar.
»Hört das denn nie auf bei dir? Kaum haben Bonny und ich diesbezüglich unsere eigenen Probleme, taumelst du wieder in die alte Falle.
Man muß geradezu froh sein, daß du keine Kinder mehr kriegen kannst.«
Gigi schmollt. »Möglich wäre es vielleicht noch. Aber natürlich denken Oskar und ich nicht daran.«
»Oskar und ich, Oskar und ich«, spottet Anna. »Laß das ja nicht deine Enkel hören.«
Aber Gigi besteht auf ihren Rechten. »Heute ist das doch gar nicht mehr so. Frauen, die früh angefangen haben, bleiben länger am Ball. Ich habe mir euretwegen lange genug und viel genug entgehen lassen.«
»Ach!« Anna empört sich. »Und deine wiederholten Herzverrenkungen?«
»Kurz und schmerzlos!«
»Schmerzlos? Wenn ich an Pedro de Silva oder Erich Kovatschitsch denke. Oder gar an diesen Hans Jörg. An die ewige Telefoniererei und die Tränen.«
»Sei nicht spitz, Anna! Jedenfalls ist nie einer zu mir gezogen, solange ihr zu Hause wart.«
»Wie denn auch? Es sei denn, er hätte in der Kommode geschlafen.« Grollend setzt Anna sich an den Küchentisch. »Weiß Bonny davon?«
Bonny steht in der Familienhierarchie ganz oben. Gigi hat sie bereits mit siebzehn geboren. Schülerliebe. Während Annas Vater angeblich nur auf Kurzurlaub in der Stadt war. Er hat nicht einmal seine Adresse dagelassen. Also weiß er bis heute nichts von seiner programmierenden Tochter.
»Nein, nein! Ich bitte dich! Man muß ihr Zeit lassen, sich an den Gedanken zu gewöhnen.«
Bonny heißt Bonny, weil sie auf einem Schulausflug gezeugt wurde, während der Rest der Klasse »My bonny is over the ocean …« sang.
»Hör zu, Gigi, du bist einfach naiv. Dieser Oskar zieht also hier ein, und was dann?«
»Er liebt mich, verstehst du das nicht?«
»Abgesehen davon, hat er einen Job?«
»In Aussicht.«
»Und wenn du Pech hast, bist du nach einem Jahr auch noch die Wohnung los.«
»Mal den Teufel nur an die Wand!« Gigi glaubt jetzt erst recht an ihr Glück. Was immer ihre Töchter sagen mögen. Schließlich hat sie Oskar kennengelernt und nicht die.
»Er hat mir vor allen anderen den Vorzug gegeben.« Sie weint jetzt ein bißchen, aus Rührung über die eigenen Worte.
»Ich bitte dich, heul jetzt nicht, sonst kommen mir auch die Tränen. Du weißt doch, daß ich niemanden weinen sehen kann, schon gar nicht dich. Das hat es ja auch immer so schwierig gemacht, damals und noch immer.«
»Aber ich weine doch gar nicht.« Gigi hat sich bereits die Augenwinkel gewischt. »Gut, ich nehme ein paar von den Büchern mit, aber der Rest geht in den Keller. Soll er dort vermodern!«
Sie trinken tiefroten Hagebuttentee, und erst jetzt geht Anna auch noch dieses Licht auf, ihre Mutter wirkt tatsächlich um Jahre jünger. Dennoch faßt sie es nicht. Bei den Erfahrungen, die die Frau gemacht hat, müßte sie schon zu laufen beginnen, wenn so ein Kerl auch nur den Arm um sie legt. Nichts dergleichen. Rosige Wangen und ein Strahlen im Blick, daß die Wimperntusche zu schmelzen droht. Mit siebenundvierzig! Haugsdorff ist Anfang fünfzig. Anna weiß nicht mehr, was sie von vergangenen Jahren halten soll. Nur eines steht fest, so ein Oskar käme ihr nicht in die Wohnung. Ehemaliger Fußballprofi. Auch das noch.
»Und was macht dieser Oskar jetzt?«
»Ihm wurde ein Job als Geschäftsführer angeboten.« Gigi platzt beinah vor Begeisterung.
Anna verzichtet darauf zu fragen, in welchem Geschäft. Sie überlegt schon, wie sie es Bonny beibringt, ohne daß die mit dem ganzen Clan angerückt kommt und mit einem einzigen gezielten Schlag das späte Glück ihrer Mutter zerdeppert. Vielleicht zieht Oskar ohnehin bald wieder aus, weil er allergisch auf angebissene Butterbrote oder offene Zahnpastatuben ist.
»Rosa Riedl Schutzgespenst«, »Wo die wilden Kerle wohnen«, »Die Omama im Apfelbaum« und eine Kinderausgabe von »Tausendundeiner Nacht«. Alles andere hat Bonny längst für die eigene Brut abgeschleppt. Anna durchblättert die einigermaßen benutzten Bände, bevor sie einen Platz für sie sucht.
In ihrer ersten eigenen Wohnung. Es war schwierig genug, sie zu finden, die Instandsetzung Sache eines Altbausanierungskredits, den sie noch zwanzig Jahre abbezahlen muß. Die Miete ist erschwinglich. Anna gehört zu den wenigen Verdienerinnen ihres Jahrgangs, die sich neben der Miete noch etwas leisten können. Aber ihre Begabung hat sich schon früh gezeigt – sie war sogar eine Zeitlang netzsüchtig – und wurde, da zeitgerecht erkannt und zeitgemäß einsetzbar, auch entsprechend gefördert.
Das Innere der beiden Räume ist sienarot ausgemalt, mit weißgestrichenen Fensterrahmen. Die Einrichtung läßt noch zu wünschen übrig. Statt eines Bücherregals wurde etwas für den Leib, nämlich Kleidung, angeschafft, und so landen die Bücher doch wieder auf dem Nachtkästchen, während sie die späteren, die aus der Halbwüchsigenperiode, erst einmal in dem Pappkarton läßt. Wer um alles in der Welt sollte »Die Nebel von Avalon« noch einmal lesen?!
Anna fragt sich, ob der wandernde Derwisch, von dem sie träumt, womöglich etwas mit ihrem Vater zu tun hat. Den berüchtigten Übertreibungen Gigis zufolge war der groß, kräftig und Pilot der amerikanischen Luftwaffe. Vielleicht ist er es noch? Ihr persönlich wäre Leonard Cohen lieber. Mit dieser weltenverschlingenden Stimme! »I’m the little Jew who wrote the Bible«, träufelt es gerade aus dem alten Walkman.
Gigi hat immer darauf bestanden, daß es sich um die große Liebe gehandelt habe. Früher konnte Anna sich an ihrer Entstehungsgeschichte gar nicht satthören.
»Wir waren eine ganze Woche zusammen.« Gigis Blick wird schräg und silbern.
»Und warum hast du ihn nie nach der Adresse gefragt?«
»Weil Bruce und ich uns so sehr liebten. Bis er eines Nachts plötzlich abkommandiert wurde. Über Fernschreiber. Er war noch ganz benommen und mußte auf der Stelle fort. So haben wir beide darauf vergessen.«
Anna kann nicht lockerlassen. »Aber er hat doch deine Adresse gewußt. Warum hat er nie geschrieben?«
»Wir waren immer bloß im Hotel. Bruce und Gigi! Das war’s.«
Als Kind hat Anna die Geschichte geglaubt, mit Müh und Not. Später machte sie Gigi insgeheim den Vorwurf, nicht attraktiv genug für Vater Bruce gewesen zu sein. Nicht daß Gigi häßlich wäre, beileibe nicht. Aber wie sie sich immer noch anzieht! Im Grunde ist sie nie aus den Hippieklamotten der frühen Siebziger herausgekommen, diesem Schlabberzeug mit den unmöglichen Schuhen. Die Haare auch heute noch eine grauschwarze Kräuselwolke und dazu abwechselnd verschiedene Garnituren von Ethnoschmuck.
Kein Wunder, daß Bonny und Anna zuerst in ihre Kleidung investierten und Schuhe trugen, die Gigi die Tränen in die Augen trieben. »Ihr seid verrückt, so viel Geld auszugeben, nur um euch die Füße zu ruinieren!«
»Vielleicht haben sie Bruce nach Vietnam geschickt?« Nur Bonny konnte auf so etwas kommen. Angeblich war sie damals bei ihrer Großmutter väterlicherseits, während Gigis Woche mit Bruce. Jedenfalls kann sie sich an Bruce nicht erinnern, obgleich sie ansonsten Gigis Beziehungsregister lückenlos herbetet.
»Er war auf Urlaub hier, für genau eine Woche. Seine Großeltern waren ausgewandert, und er wollte eben sehen, wo sie herkamen. Wir gingen auch manchmal aus. Zu den Sängerknaben, dann nach Schönbrunn, in die Oper und zu den Lipizzanern.«
Bonny und Anna schütteln sich gleichzeitig. »Und du bist überall mit hin?«
Gigi zuckt die Achseln. »Die beste Gelegenheit, das auch einmal kennenzulernen. Wenn man schon in dieser Stadt lebt.«
»Und das alles in deinem Hippie-Outfit?«
Gigi lacht geradezu verschämt. »Amerikaner sind da nicht so. Und für die Oper habe ich mir extra ein Kleid gekauft, etwas Palästinensisches, ganz in Schwarz, mit Silberpailletten. Natürlich bodenlang.«
»Und sie haben dich tatsächlich reingelassen?«
»Und ob! Es war sehr elegant. Das schönste Kleid, das ich je besessen habe.« Nun, im Vergleich zu dem, was sie sonst immer trägt, mußte das nichts Besonderes bedeuten.
»Und woher kommen meine roten Haare?« Annas Lieblingsfrage. Eine, die Gigi noch immer in Verlegenheit gebracht hat.
»Bruce war dunkelblond, was weiß denn ich? Er erwähnte einmal eine rothaarige Großmutter, nämlich die, die von hier stammt. So genau weiß ich das aber nicht mehr. Wir haben uns ununterbrochen geliebt. Wann immer wir nicht gerade beim Sightseeing oder beim Essen waren.«
Und jetzt dieser Oskar. Anna versteht das noch immer nicht. Da läßt sie den Mann der Männer, Vater Bruce, ohne Adresse abfahren, um sich letztendlich mit einem Oskar zusammenzutun.
»Ich wette, Bruce ist in Vietnam gefallen«, hat Bonny früher öfter gesagt. »Sonst hätte er sich gemeldet. Ich meine, man kann über Gigi sagen, was man will, aber sie so mir nichts, dir nichts sitzenzulassen, das hat sie sich wirklich nicht verdient.«
»Vielleicht hat er sie zu schnell gekriegt?« Anna hat sich alles mögliche durch den Kopf gehen lassen.
»Wie kommst du darauf?« Bonny ist selten überrascht, aber das scheint ihr denn doch zu weit hergeholt.
»Überleg bloß, wenn er nur eine Woche hier war und sie sich ununterbrochen geliebt haben, noch dazu in einem Hotel, muß es doch ziemlich rasch zwischen ihnen geklappt haben.«
Diesbezügliche umständliche Recherchen bei Gigi ergaben, daß sie damals am Flughafen gearbeitet hatte, und Bruce war ein Koffer abhanden gekommen, der erst ausfindig gemacht und dann nachgeschickt werden mußte. In der Zwischenzeit mußte es passiert sein.
»Ich wußte, daß er mein Schicksal ist, und habe sofort eine Woche Urlaub genommen.«
Nicht sehr wahrscheinlich, die ganze Geschichte. Wer weiß, aus wieviel verschiedenen Fäden die Legende von Bruce und Gigi gestrickt ist. Als junges Mädchen war Anna jedenfalls ziemlich stolz auf die einwöchige Dauerliebe der beiden gewesen. Wenigstens hatten sie sich nie gestritten, und das konnten wohl die wenigsten von ihren Eltern sagen.
Jussuf und Frantischek haben Anna zwei Tage vor dem richtigen Datum ins Kino und danach ins Restaurant eingeladen.
»Heißt das, daß jetzt ihr beide?« Anna ist gelinde gesagt verwundert.
»Das heißt nichts«, sagt Jussuf salbungsvoll, »als daß wir offenbar die einzigen sind, die praktisch denken. Da du an deinem Geburtstag bestimmt schon etwas vorhast, haben wir beschlossen …«
Jetzt schaltet Frantischek sich dazwischen: »… dich schon heute ins Kino einzuladen. Ich zahle die Karten und Jussuf das Essen, zu dem wir anschließend gehen.«
»Und womit wollt ihr mich überraschen?«
»Simba!« Jussuf fischt sich ein Haar von der Schulter.
»Simba was?«
»Simba, König der Löwen. Wir dachten …«
Anna stöhnt und genießt. Sie ist bekannt als Fan von Zeichentrickfilmen. Im Dunkeln legt Frantischek seine verschwitzte Hand auf ihr Knie. Nach einer Weile fühlt die sich an wie draufgeklebt. Da drückt Anna ihm ihr Stofftaschentuch in die andere und flüstert: »Falls du dir die Stirn wischen möchtest.« Das versteht Frantischek, ohne an seinen Optionen für die Zukunft zweifeln zu müssen.
Jussufs Eau de toilette riecht nach Vanille, vor allem, wenn er sich über sie beugt, um Frantischek auf den bösen Löwenonkel aufmerksam zu machen.
Danach gehen sie in ein persisches Restaurant, weil es kein libanesisches in der Nähe gibt, und Jussuf bestellt, als sei er der große Emir persönlich. Alle möglichen kleinen Vorspeisen mit gebratenem Gemüse, dann Taskabap und Safranreis. Frantischek bricht altersgemäß sämtliche Rekorde, ohne daß seine Hosen auch nur einen Fingerbreit enger säßen.
»Stell dir vor, du wärst mein Sohn!« Jussuf überschlägt in Gedanken, was ihn das kosten würde. Und doch gefällt ihm die familiäre Atmosphäre, zumindest an diesem Abend und für diesen Abend.
Nach dem zweiten Glas algerischen Rotweins wird Anna, die nicht trinken kann, rührselig. »Ich komme mir so alt vor!«
Jussuf tätschelt ihre rechte Hand und Frantischek die linke. »Könnt ihr mir sagen, wozu ich auf der Welt bin?«
»Um den weltweiten Datenverkehr zu beschleunigen. Einerseits. Und andererseits steht da ein echter Ministerialrat als erster in der Schlange derer, denen deine bloße Existenz eine zweite Jugend beschert.«
Frantischek wirft sich in die Brust. »Nicht zu vergessen mich, der ich jeden deiner eventuellen Stürze mit Begeisterung auffangen würde. Du weißt, ich bin auf dich als Geist und Körper fixiert.«
»Macht euch nur lustig über mich und Haugsdorff …«
»Ist zu alt für dich, glaub es mir, Anna, während ich dir Jugend und Mutterwitz bieten würde.«
Jussuf schaut sie mit einem Kontrollblick aus getönten Gläsern an. »Eine Frau kann jemanden wie Haugsdorff schon gebrauchen. Haugsdorff ist gut und klingt gut, falls du Kinder möchtest …«
»Nicht so bald, Jussuf. Ich weiß selbst noch nicht, wer ich bin. Und im Augenblick fühle ich mich einfach leer und perspektivelos.«
Frantischek fängt seinerseits zu grübeln an. »Ich frage mich, ob ich an meinem achtzehnten Geburtstag auch solche Depressionen haben werde.«
Jussuf schüttelt den Kopf in Zeitlupe. »Was macht deine Sehnsucht, Anna?«
Anna zuckt die Achseln.
»Schaut euch bitte das Dessert an!« Frantischeks Speichelfluß beschleunigt sich, und er prüft eingehend, ob die Portionen des hauchdünn geteigten Obstkuchens auch gerecht geschnitten sind. Ohne ein Wort tauscht Anna ihren Teller gegen den seinen.
»Wenn du möchtest, kannst du auch noch die Hälfte von meinem Stück haben, ich will ohnehin nur kosten.«
»Nicht deines!« Frantischeks Entrüstung soll Jussuf zur Abgabe des seinen bewegen. »Du hast schließlich Geburtstag. Und ein Geburtstag ohne Kuchen ist wie Kino ohne Popcorn.«
Aber Jussuf empfängt die Botschaft nicht, weigert sich offenbar, auch den konkretesten Hinweis zu verstehen. Er ißt seinen Kuchen so betont selber, daß auch eine andere Strategie nichts fruchten würde. Am Ende schlägt Frantischek seine Entrüstung nieder und ißt Annas Stückrest, ohne daß der Grad seiner Sättigung zunehmen würde.
Vielleicht hat Anna dieser Bissen Süßes gefehlt, jedenfalls bessert sich ihre Laune. Und als Jussuf Ferdys neuesten Streich, nämlich das Verschwindenlassen von Poststücken zwecks Einsparung eines Ganges zum gleichnamigen Amt, zum besten gibt, und zwar in O-Ton und mit leicht arabischem Akzent, kann sie schon wieder lachen. Unhörbar im Vergleich zu Frantischek, aber zu sehen ist es.
»Ich bin gestern einem Derwisch begegnet.« Anna kommt gewissermaßen zu sich.
»Einfach so?« Frantischek hört wohl nicht recht.
»Vor dem Haus, in dem ich wohne.«
Jussufs Blick wird geradezu streng. »Woher weißt du, daß es ein Derwisch war?«
»Ich mußte die alten Bücher aus der Wohnung meiner Mutter holen. Da war ›Tausendundeine Nacht‹ darunter. Ich habe vor dem Einschlafen nachgeschaut. Es war sicher ein Derwisch.«
Frantischek gibt sich allwissend. »Kein Wunder. Wo du wohnst, ist Klein-Ankara, stimmt’s?«
Jussuf läßt nicht locker. »Hatte er einen Turban auf und einen Kaftan an? Woran hast du ihn erkannt?«
Anna weiß es selbst nicht mehr. »Nein, einen Turban bestimmt nicht. Kaftan? Wie sieht so was aus? Wenn ich mich recht erinnere, trug er einen Mantel. Einen ziemlich langen Mantel, das schon.«
Frantischek wittert wie Sherlock im Dienst. »Was um diese Jahreszeit wohl eher ein Zeichen von Intelligenz ist.«
»Wie hast du es dann gewußt?«
»Keine Ahnung!« Anna denkt merklich nach. »Ich war mir nur plötzlich sicher. Es muß an seinem Gesicht gelegen haben, daran, wie er mich anschaute.«
Sie hat die ganze Zeit nicht mehr daran gedacht. Erst jetzt, da sie davon spricht. Sie kann das Gesicht des Mannes vor sich sehen, zumindest schemenhaft.
Jussuf lächelt allwissend. »Die Heiligen erkennen einander!«
»Amen!« Frantischek meint es abschließend. Aber Jussuf ist nun ganz morgenländische Überlegenheit. »Was stellst du dir denn eigentlich unter einem Derwisch vor? Außer einem Mann mit weiten Ärmeln, hinter denen du dich verstecken kannst, und der ein bißchen für dich zaubert?«
»Frag mich nicht!« Anna kommt sich dumm vor. »Das Wort war auf einmal da. Und es hat genau zu dem Gesicht gepaßt.«
Jussuf macht einen langen Schluck. »Hoffentlich nichts Ernstes.«
Frantischek ist irritiert. »Was meinst du damit?«
»Sie könnte sich angesteckt haben. Nicht wahr, Anna? Mit einer Art Sehnsuchtsvirus. So etwas passiert.«
Frantischek kommt sich gefrotzelt vor. »Blödmann, ich bin nicht erst seit gestern auf der Welt.«
Jussufs Lächeln wird Anna unheimlich. »Und wie stellst du dir einen Derwisch vor? Du mußt doch Bescheid wissen, so wie du grinst.«
Jussuf hebt die Brauen weit über den Rand seiner Brille. »In etwa so wie mich. Viel herumgekommen, mit einem gewissen Durchblick …«
»Das kann doch nicht alles sein, Jussuf, sag die Wahrheit.«
»Religiös motiviert …«
»Du doch nicht. Erzähl das deinen kleinen Buben.«
»Reden wir von mir oder von den Derwischen?«
»Ich möchte es genau wissen.«
»Fromme, die sich einbilden, einen heißen Draht zu Ihm zu haben.«
Frantischek kann einer Unterhaltung auch dann folgen, wenn ihm der Kontext nicht unmittelbar vertraut ist. »Also zum obersten Chef?«
»Nenn Ihn, wie du willst.«
Anna geht noch einen Schritt weiter. »Wandermönche?«
»Zu christlich. Ich meine, kein Zölibat. Manche waren Dichter, andere trieben Magie oder schoren sich den Kopf und die Brauen, zumindest früher.«
»Wirkten sie Wunder?«
Jussuf kratzt sich am Kinn. »Wunder waren natürlich beim Volk sehr beliebt. Aber die obersten Ränge betrachteten sie als Gaukelspiel. Wunder ist die Menstruation des Mannes, soll der Prophet dazu gesagt haben.«
»Wie bitte?« Langsam hat Frantischek nun doch Schwierigkeiten.
»Das heißt, sie stehen zwischen den Menschen und Ihm, wie die Menstruation zwischen Mann und Frau.«
»Was du nicht sagst.« Anna fährt mit dem Finger am Rande ihres Glases entlang, bis es singt. »Und sonst?«
»Manche glaubten, sie könnten sich dereinst in Ihn zurückverwandeln, weswegen sie sich schon zu Lebzeiten so aufführten, als wären sie ein Stück von Ihm.«
»In ›Tausendundeine Nacht‹ versprechen sie kinderlosen Königinnen Söhne und Töchter. Dann geben sie ihnen einen Granatapfel zu essen.«
Jussufs Gesicht verzieht sich erkennbar. »Ein hübsches Bild, das an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrigläßt. Das könnte es sein, was bei dir zum Tragen kommt, Anna. Die Sehnsucht …«
»Ach, Jussuf, du denkst immer nur an das!«
»Endlich komme ich wieder mit.« Frantischek kaut an einem Fladenbrot, noch von der Vorspeise.
Jussuf erhebt sich. »Treibt keinen Unfug, während ich das hier erledige!« Offensichtlich bezahlt er hinter dem Vorhang wie einer, der den Restaurantbesitzer kennt.
»Willst du es dir nicht doch noch überlegen, Anna? Die Zille ist reserviert.« Frantischek trauert dem Fladenbrot nach.
»Es ist zu kalt. Verschieben wir es auf deinen Geburtstag, Frantischek. Der ist erst im Mai.«
»Wenn ich bis dahin nicht verhungert bin.«
Jussuf kommt zurück, als habe er etwas Wichtiges zu seiner Zufriedenheit erledigen können, geradezu beschwingt. »Beim Hinausgehen zeige ich euch einen.«
»Einen was?« Frantischek ist schon ganz woanders.
»Einen Derwisch!«
Im Vorraum hängt eine Serie persischer Miniaturen. »Da!« Jussuf deutet auf einen hockenden Mann, dessen Kaftan lange, weite Ärmel hat und der auf einem Saiteninstrument spielt. »Hatte dein Derwisch irgendeine erkennbare Ähnlichkeit mit diesem hier?«
Anna schüttelt den Kopf. »Aber der hier gefällt mir auch.« Sie geht so nah wie möglich an das kleine Bild mit dem noch kleineren Derwisch heran. »Höchstens im Gesicht. Ja, ich glaube, es war etwas in seinem Gesicht.«
Jussuf lächelt. »Erste Stufe der Enthüllungen: Gib acht auf deine Träume! Triff dich mit keinem Hellseher!«
Teresa hat Ivo als persönlichen Fall entdeckt, als ihren persönlichen Fall. Sie hat ihm die nächtliche Flasche entzogen und kämpft mit ihm an der Gefühlsfront. Noch glauben beide an die gute Sache. Teresa wirkt, als habe sie zuwenig geschlafen, und Ivo ist überwach, aber mit einer hohen Fehlerquote. Die Chefin hat es sofort gerochen, statt Pflaumenmaische nur noch Milchkaffeeduft. Sie will Nachsicht walten lassen, im Extremfall bis zu einer Woche. Dann aber muß die Sache ausgestanden sein.
»Anna, Sie sehen plötzlich so erwachsen aus. Ist etwas?« Die Chefin greift sich an den kunstvoll gesteckten Knoten, von wo sie es nicht weit hat, sich an die Stirn zu schlagen. »Du liebe Zeit, Sie haben ja morgen Geburtstag. Beinah hätte ich es vergessen.« Sie betrachtet Anna mit den Augen der doppelt so alten. »Ganze dreiundzwanzig! Das stimmt doch? Ich fasse es nicht.« Zum ersten Mal kann man sie selbst kichern hören.
Teresa und Ivo werfen sich einen konspirativen Blick zu, und in der nächsten Kaffeepause flüstert Teresa: »Du wirst staunen. Da kommst du nie drauf, was Ivo und ich für dich gefunden haben.«
Am Nachmittag fängt Ivo plötzlich zu schreien an, es sei nicht zum Aushalten, und sie könnten ihm alle mitsamt ihrem Gutmenschentum gestohlen bleiben, am meisten aber Teresa. Nach einer Viertelstunde hat er sich wieder im Griff und weint ein bißchen, aus Dankbarkeit, daß sie es ihm nicht übelgenommen haben.
Teresa wächst, und wenn niemand schaut, lächelt sie wie Katharina von Siena. Sie hat ihre moralischen Kräfte erst vor kurzem entdeckt. Kein Wunder, daß sie solche Lust hat, sie zu üben.
Anna erinnert sich an den Traum kurz vor dem Aufwachen. Erst als Jussuf zur Kaffeemaschine geschlendert kommt und etwas von »nächtlichen Heimsuchungen« nuschelt, fällt ihr das tätowierte Gesicht wieder ein. Oder waren es Schriftzeichen? Es gibt Träume, aus denen sich nicht viel machen läßt.
»Gut geschlafen?« Jussuf lächelt abgründig wie Beelzebub.
»Was hast du denn gedacht?« Es war ein kurzer Traum, zumindest in der Erinnerung. Und die Schrift hat sich nicht entziffern lassen.
Frantischek trägt ein T-Shirt mit einem Falken drauf. Wo er das wieder her hat?
»Noch so ein Vogel«, meint Jussuf, »der heim zu seinem Herrn will.« Alle schauen ihn an. »Heute ist mein Tag, ich spreche in Rätseln.« Gekonnt balanciert er die Kaffeetasse in sein Einzelbüro.
Der Familien-Geburtstag findet, wie immer, am Abend davor statt. Dieses Jahr ist Bonny dran, was Gigi nur recht ist. Noch hat sie Oskar vor Bonny verheimlichen können.
Bonny brät und backt schon eine Weile. »Bei sieben Personen zahlt es sich wenigstens aus.« So viel zu all den geheuchelten Vorwürfen von Anna und Gigi, warum sie sich wieder so viel Arbeit gemacht hat.
Während Gigi dann doch gleich mit Hand anlegt, nehmen die Kinder Anna als Geisel und erklären ihr die kleinen Geschenke, die sie für sie gebastelt haben. Doch der Kleinste, Tonio, fällt mitsamt seinen Windeln auf die mühsam geklebte Burg und sitzt sie platt. Das Gezeter der anderen beiden veranlaßt Bär, sie einen nach dem anderen abzuführen, was gar nichts hilft, weil der eine schon wieder da ist, während er sich mit dem anderen ins Kinderzimmer kämpft.
Anna mag ihre Neffen, aber dem Geschrei ist auch sie nicht gewachsen. Also brüllt sie sie kurz einmal nieder, was diese so verblüfft, daß sie tatsächlich eine Minute lang die Luft anhalten. Dann wird ohnehin gegessen. Und da es sich um das allgemeine Familienlieblingsessen handelt, nämlich Zander, auf den alle sich haben einigen können, bis auf Donald, der überhaupt keinen Fisch ißt, gibt sich der Clan gezähmt und kaut, solange es etwas zu kauen gibt.
Aber sie wären nicht die, die sie sind, hätte das Thema Oskar sich wirklich vermeiden lassen. Kaum hat der Nachtisch, Bonnys Spezial-Mohr-im-Hemd, den vorhersehbaren Zuspruch erfahren, fängt Gigi an herumzureden.
Anna seufzt, und Bär, der in Wirklichkeit Fridolin heißt, scheucht die Kinder ins Bett.
Bonny weiß längst Bescheid. Annas Andeutungen und Gigis Gestotter haben alles sonnenklar gemacht. Bonny weiß auch, daß ein Streit sich vermeiden ließe. Dennoch geraten sie schon nach zwei Sätzen auf die alte, erbitterte Weise aneinander, was Anna die Möglichkeit gibt, sie anzuflehen, sich wenigstens an ihrem Geburtstag nicht gegenseitig das Messer anzusetzen. »Das hat alles ohnehin keinen Sinn«, resigniert Bonny, »wenn man in deinem Alter noch immer nicht gescheiter ist!«
»Was heißt da immer ›in deinem Alter‹? Eigentlich müßte die Vorstellung dich trösten, daß du auch noch in meinem Alter die Liebe finden kannst!« Gigi will sich das Strahlen justament nicht mehr abgewöhnen.
»Mir reicht, was ich habe, vollkommen«, erwidert Bonny, und Gigi verdreht die Augen, als zweifle sie an Bonnys Glück.
»Na, dann prost, ihr Lieben!« Anna ist froh, daß Oskar vorderhand vom Tisch ist. Sie haßt länger anhaltende Verstimmungen, auch wenn sie bezüglich Oskars mit Bonny ausnahmsweise einer Meinung ist.
Es ist nach Mitternacht, als Bär Gigi und Anna in seinem Familienkleinlaster nach Hause in den dritten Bezirk bringt. »Wollt ihr noch mit raufkommen?« Gigi klingt beinah überzeugend. »Auf einen Gute-Nacht-Schluck?«
In ihrer Wohnung brennt Licht, wie mit freiem Auge zu erkennen ist. Oskar ist demnach zu Hause. Bär und Anna schauen sich einen Augenblick wankelmütig an, dann schüttelt Anna als erste den Kopf. Sie hat keine Lust, nach der abendlichen Debatte den Herrn Geschäftsführer auch noch persönlich zu treffen. Außerdem will sie tatsächlich ins Bett, der wahre Geburtstag ist schließlich erst morgen.
»Ihr seid zu streng mit ihr«, ätzt Bär auf der Fahrt durchs tiefste Erdberg.
»Nicht streng, nur besorgt.« Anna spitzt dabei die Lippen und zieht auf kindische Weise das O.
»Sie hat bisher ihr Leben alleine gemeistert. Seid froh, daß sie es auch noch genießt und euch nicht die Ohren volljammert über das, was sie versäumt hat.«
»Ja, Chef!« Anna möchte sich dazu nicht mehr grundlegend äußern. »Sag das Bonny. Sie ist diejenige, die immer in Autorität macht.«
»Soll ich dich bis zur Tür bringen?« Bär hat den Motor abgestellt, aber Anna schüttelt den Kopf.
»Du weißt zuviel, und es ist schon spät. Hast du keine Angst?«
Anna lacht. »Bei all den Eingabemasken müßten sie auch noch Jussuf haben, um die Codes zu knacken.«
»Also dann, verbring den morgigen Tag gut!«
Bär heißt zu Recht so, wie er heißt. Jeder andere hätte sich an Bonny längst wundgebissen. Er nimmt sie bloß zwischen die Tatzen, wenn sie kreischt, und drückt sie fest. Das hilft fast immer. Und für gewöhnlich bricht sich der Lärm der Kinder an seiner massigen Gestalt. In Wirklichkeit sind sie ihm alle ergeben. Nur Donald muckt gelegentlich auf. Eine Frage des Alters wahrscheinlich.
Manchmal hat Anna sich geradezu leidgesehen. Sie, die nie einen Vater hatte.
»Bär ist ein reiner Bubenvater, glaub mir«, behauptete Bonny dann. »Mit Mädchen wüßte der gar nichts anzufangen.« Bonny hat zwar mittlerweile viel Ahnung von der Familie als solcher, doch ist sie in ihren Kommentaren nicht immer zuverlässig.
In der Hausmeisterwohnung im Parterre ist noch Licht. Lachen und fremdartige Silbenhäufungen. Die türkischen Hausmeister haben Besuch. Abend für Abend wird nach Einbruch der Dunkelheit das Fasten gebrochen, einen Mondmonat lang. Neulich hat Naima Hanim, die Frau, ihr eine Schüssel mit einer Art Pudding heraufgebracht, aus dem alles mögliche zum Vorschein kam, Rosinen, Korinthen, Mandeln, Nüsse, weiße Bohnen und Pistazien. Es schmeckte nicht schlecht. O Gott, o Gott, sie muß die Schüssel zurückbringen. Einfach so? Oder soll sie ihrerseits ein Geschenk machen? Nur was? Sie kocht so gut wie nie. Vielleicht Blumen? Oder Basilikum im Topf? Es ist eine Frage des Drandenkens. Und tagsüber denkt sie nie dran.
Es ist nicht sehr warm in der Wohnung. Aber anstatt die Heizung höherzudrehen, geht Anna lieber gleich ins Bett. Morgen früh muß sie noch ihre Haare waschen, nach Büroschluß ist nicht genügend Zeit, bloß zum Umziehen wird es reichen. Dann kommt Haugsdorff sie holen. Natürlich ist sie neugierig, auch wenn sie sich von der ganzen Geschichte nicht allzuviel erwartet.
Gigi hat seinerzeit sogar mit dem Einwerfen von Aspirin gegeizt, wenn sie Grippe hatten. Die sah bloß so hippiemäßig aus. Sie schwor auf jede Menge Tee. »Alles andere ist schlecht für die Haut«, hat sie immer behauptet, »oder es vernebelt das Hirn. Und das kann sich unsereins, als Frau, erst recht nicht leisten.« Darum war sie auch so unglücklich, als Anna mit ihrem ersten eigenen PC nächtelang durchs Netz surfte und dazu nur Kaffee und Coca-Cola trank, weil sich das so gehört, viel zuwenig schlief und sich dabei auch noch eine schwere Gastritis zuzog.