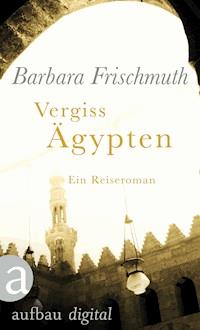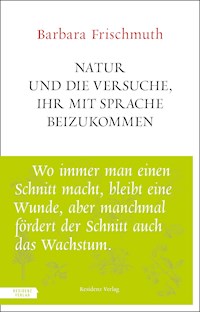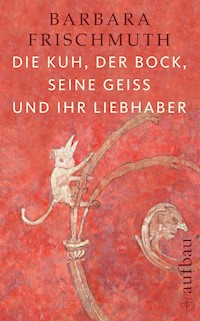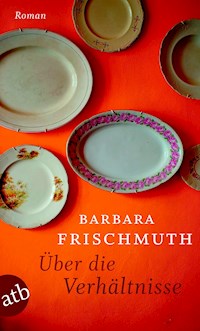8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Anna ist verschwunden, weder ihr Mann noch ihre Kinder oder Freunde können es sich erklären. Ist ihr ein Unglück geschehen, oder hat sie sich davongestohlen, um ein bißchen Leben nachzuholen? Aus den mal irritierten, mal sorgenvollen, mal ironischen Stimmen von vier Beteiligten entsteht das lebendige Bild einer Frau, die auf ihrem Glücksanspruch beharrt. Anna hat immer alles auf eine Karte gesetzt, besonders wenn es um Liebe ging. Wegen Ali, der aus seinem Land hatte fliehen müssen, brach sie sogar ihr Studium ab. Obwohl es die Familie nicht leicht hatte, schien Anna glücklich. Doch eines Tages ist sie verschwunden. Ali und die beiden Kinder warten, suchen, sind verzweifelt. Langsam jedoch richten sie sich wieder im Alltag ein, und jeder versucht, mit dem Unerklärlichen fertigzuwerden. Manchmal kommt es ihnen so vor, als hätte Annas Verschwinden einen Krater aufgerissen, aus dessen Abgrund Erinnerungen und Vermutungen auftauchen. Barbara Frischmuth überrascht wieder einmal durch die vitale Schilderung beeindruckender Frauengestalten. Raffiniert und höchst gekonnt läßt sie aus verschiedenen Stimmen ein lebendiges Bild der Verschwundenen erstehen, einem Wesen aus Eis und Glut, wie es heißt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Ähnliche
Informationen zum Buch
»Ein großer, vielstimmiger Roman.« Salzburger Nachrichten
Anna ist verschwunden, weder ihr Mann noch ihre Kinder oder Freunde können es sich erklären. Ist ihr ein Unglück geschehen, oder hat sie sich davongestohlen, um ein bißchen Leben nachzuholen?
Aus den mal irritierten, mal sorgenvollen, mal ironischen Stimmen von vier Beteiligten entsteht das lebendige Bild einer Frau, die auf ihrem Glücksanspruch beharrt.
Anna hat immer alles auf eine Karte gesetzt, besonders wenn es um Liebe ging. Wegen Ali, der aus seinem Land hatte fliehen müssen, brach sie sogar ihr Studium ab. Obwohl es die Familie nicht leicht hatte, schien Anna glücklich.
Doch eines Tages ist sie verschwunden. Ali und die beiden Kinder warten, suchen, sind verzweifelt. Langsam jedoch richten sie sich wieder im Alltag ein, und jeder versucht, mit dem Unerklärlichen fertigzuwerden. Manchmal kommt es ihnen so vor, als hätte Annas Verschwinden einen Krater aufgerissen, aus dessen Abgrund Erinnerungen und Vermutungen auftauchen.
Barbara Frischmuth überrascht wieder einmal durch die vitale Schilderung beeindruckender Frauengestalten. Raffiniert und höchst gekonnt läßt sie aus verschiedenen Stimmen ein lebendiges Bild der Verschwundenen erstehen, einem Wesen aus Eis und Glut, wie es heißt.
»Barbara Frischmuth arrangiert ein vielstimmiges Tableau, welches die fremden Nähen und intimen Befremdlichkeiten der Kulturen und Generationen ausbreitet. Ihre Beziehungschoreographie führt die Figuren verschiedener Lebensmodelle nicht ohne kriminalistische Spannungsmomente vor und geizt dabei keineswegs mit Ironie.« Neue Zürcher Zeitung
»Eine berückende Liebesgeschichte.« Salzburger Nachrichten
Barbara Frischmuth
Der Sommer, in dem Anna verschwunden war
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Emmi
Irene
Inimini
Emmi
Irene
Inimini
Irene
Emmi
Inimini
M.
Irene
M.
Emmi
Inimini
Emmi
M.
Emmi
Irene
M.
Inimini
Irene
Emmi
M.
Emmi
M.
Über Barbara Frischmuth
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
»Die Erde schmeckt nach Gier.
So zeigt sich Liebe
in ihren Bildern.«
Alfred Kolleritsch
»O kleine Stadt, ich bin dein und werde es sein, solange ich lebe, ich werde dich hassen wegen all der Verletzungen und mich nach dir sehnen, weil du mich auf der Schwelle des Lebens mit deiner naphthalinduftenden feuchten Wärme umgeben hast.«
Aleksander Tišma
Emmi
Die Sonntage waren immer am schlimmsten. Was Wunder, daß da plötzlich eine Frau im Baum hing, mit den Beinen zappelte und um Hilfe schrie.
Es war der Sonntag, an dem Inimini zum ersten Mal ihr Kopftuch trug. Ali und Omo hatten den Mund noch nicht zugekriegt, da kam diese Person und versaute Inimini den Auftritt. Dazu kreischten die Vögel, als hätte die Katze sie am Schwanz gepackt, und der Wind legte die Grashalme flach.
»Völlig daneben, die Frau«, maulte Inimini und schleppte geistesgegenwärtig eine Leiter an. Die Zapplerin fand Halt und stieg, mit dem Rücken zur Welt, Sprosse für Sprosse auf die Erde herab.
Ali und Omo stand der Mund noch immer offen. Als die Frau sich schließlich umdrehte und ihren Rock zurechtschob, merkten sie, daß es Irene war.
Inimini schien kurz daran zu denken, Irene die Hand zu küssen, wie es die Töchter von Haluk getan hätten. Um sich Mut zu machen, griff sie rasch nach dem verrutschten Kopftuch, aber das Kopftuch sprach nicht zu ihr, und so sagte sie einfach, was ihr auf der Zunge lag. »Spinnst du?« Man konnte sehen, wie sie sich dabei entspannte. »Was hast du bloß in aller Früh auf unserem Baum zu suchen?«
»Auf meinem Baum.« Durch den Nachdruck war der Sachverhalt ein für alle Male klargestellt. Irene kam langsam näher. »Ich wollte euch sehen, bevor ihr mich seht.« Sie trug das Haar in einem sanften Puderton gefärbt, der wohl die Kerben in ihrem Gesicht mildern sollte. Ansonsten wirkte sie noch recht passabel, wie Emmi von ihrem Fenster aus beobachten konnte, zumindest figurmäßig.
Ali besann sich auf seine Herkunft und ging auf Irene zu. »Willkommen, herzlich willkommen, Irene hanım!« Er legte ihr die Hände auf die Schultern und drückte seine Bartstoppeln an ihre Wangen.
Nur Omo tat, als gehe ihn das alles nichts an. Es sah ganz so aus, als wäre er dabei, sich im Schatten der Begrüßungsszene aus dem Staub zu machen, als Irenes Stimme ihn lauthals traf.
»Ist das Onur? Ich traue meinen Augen kaum.« Irene war die einzige, die Onur mit seinem richtigen Namen anredete. Für alle anderen war er Omo, schneeweiß und blitzblank, mit waschblauen Augen und bierhellem Haar, der kleine Wikinger eben.
»Komm schon!« flötete Irene, auf einmal ganz Großmutter.
Omo blieb stehen, wie in die Erde gerammt, und Irene ging um ihn herum. Zum Glück kam sie nicht auf die Idee, ihn zu küssen. Sie hätte sich dazu auf die Zehenspitzen stellen müssen, so stocksteif, wie Omo sich ihr gegenüber hielt.
»Und was jetzt?« Inimini hatte ihr Kopftuch wieder in die richtige Fasson gebracht, und Irene schien endlich zu begreifen, was sie sah. Inimini war kein Kind mehr. Sie trug einen langen Rock, dazu einen Pulli, und das Kopftuch bedeckte auch noch ihre Schultern. Sie wirkte winzig, geradezu ergreifend, und dennoch so gut wie erwachsen. Anstelle eines Busens zeichneten sich zwei Knöpfe von der Größe eines Aspirins auf ihrer Vorderseite ab, und ihre Augenbrauen verliefen in einem so makellosen Bogen, daß sie lange daran gezupft haben mußte.
Eine Nachricht nach der anderen bahnte sich den Weg durch Irenes Lidspalten in Irenes Gehirn. Sie schüttelte sich, als ließe sich so das Erkannte besser im Kopf verteilen, machte einen Schritt und antwortete, als niemand mehr mit einer Antwort gerechnet hatte: »Ich habe eigentlich an Frühstück gedacht.«
»Aber klar …« Ali war wieder völlig bei sich. »Ich stelle schon Teewasser auf.« Mit weit ausladender Geste bat er Irene ins Haus.
Irene zögerte einen Augenblick und bemerkte dann trocken, aber unmißverständlich: »Ich werde wieder hier wohnen, ihr Lieben.« Sie lächelte und kostete die Überraschung aus, die sich auf den Gesichtern von Inimini, Omo und Ali ausbreitete.
Inimini und Omo waren die Kinder von Ali baba und Anna anne. In Ali babas Sprache heißt baba Vater und anne Mutter. Ali baba verging fast vor Mitleid mit ihnen, und natürlich tat er sich auch selber leid, seit Anna anne verschwunden war. Sie hatten von da an den Haushalt untereinander aufteilen müssen und achteten darauf, daß alle drankamen.
Omo, der – warum, weiß keiner – so viel größer war als Inimini und selbst Ali baba, hatte sich als Jüngster den geringsten Teil ausbedungen, Mülleimer-Leeren und Teller in den Geschirrspüler schlichten, während Inimini, die weitaus Kleinste, am meisten zu werken hatte, die Betten überzog und auch noch die Wäsche wusch. Sie hieß übrigens Nilüfer – was angeblich Seerose bedeutet –, aber als sie am Anfang ihrer Schulzeit eine Lehrerin zur anderen sagen hörte: »Stellen Sie sich vor, das arme Kind heißt auch noch Nil-Ufer«, verzichtete sie auf ihren Blumennamen und wurde zu Inimini, der Winzigen.
Ali baba verdiente das Geld, das sie zum Leben brauchten, und gelegentlich putzte er auch die Fenster.
Der Baum, auf den Irene hatte steigen müssen, war übrigens ein Nußbaum. Emmi erinnerte sich an Zeiten, in denen sie beide, Irene und sie, auf ihn geklettert waren und mit grünen Nüssen auf die Radfahrer zielten. Da er neben dem Haus stand, konnte man von seinen Ästen aus tatsächlich zum Fenster hineinschauen.
Während Irene und sie bloß älter geworden waren, hatte der Nußbaum auch noch an Höhe zugelegt. Das hätte Irene bedenken sollen. Ein Wunder, daß sie überhaupt hinaufgekommen war. Womöglich hatte sie gedacht, Ali baba, Omo und Inimini würden über sie reden – ausgerechnet jetzt und ausgerechnet über sie –, und hätte wohl gerne erfahren, was. Aber bei allem, was sie, Emmi, wußte, und sie wußte mehr, als ihr lieb war, wäre ihnen alles andere eher in den Sinn gekommen, als über Irene zu reden. Warum auch? Nachdem sie sich so lange nicht hatte blicken lassen, nicht einmal, als Anna, ihre Tochter, verschwunden war – was nun auch schon wieder zwei Wochen her war –, hatte wohl niemand mehr so recht an Irene gedacht.
Am Nachmittag kam Omo mit zwei Koffern und mehreren Taschen vom Bahnhof. Höchstwahrscheinlich vom Bahnhof, wo hätte er sonst mit dem Zeug herkommen sollen. Den einen Koffer hatte er am Gepäcksträger seines Fahrrads festgeschnallt, den anderen zog er auf Rollen hinterher. Die Reisetaschen hingen rechts und links von der Lenkstange, und er hatte alle Hände voll zu tun, um das Gleichgewicht zu halten.
Omo war in Wirklichkeit viel kleiner als sein Körper, und so kam es öfter zu Verwechslungen. Nicht einmal Ali baba wußte wirklich Bescheid. Darum sagte Omo fast nie etwas. Er wußte, daß er sich, wenn er sprach, leicht verraten konnte. Wenn es trotzdem sein mußte, gab er Sätze von sich, die er von älteren Freunden gehört hatte, damit konnte ihm nicht viel passieren. Nur zu Inimini sagte er offenbar, was er dachte. Zumindest hatte er es neulich getan, als sie das Wort von der Wand kratzten, das jemand an die Hausmauer gesprüht hatte, nachdem Anna anne verschwunden war.
»Kann ich reinkommen?« Irene hatte die Tür schon in der Hand. »Die da drüben brauchen etwas Zeit, um sich an mich als Tatsache zu gewöhnen.« Ihr Lächeln war das alte, infernalische Irene-Lächeln, auch trug sie noch immer den Rock, in dem sie vom Nußbaum geklettert war.
Irene sah sie, Emmi, nicht gleich, da sie beinah im Dunkeln saß. »Ich möchte wissen, wie alles gekommen ist. Von denen«, Irene deutete durchs Fenster auf das Haus drüben, »denkt jeder dreimal nach, bevor er einmal etwas sagt. Das ist mir zu mühsam.«
Irene tastete sich mit zusammengekniffenen Augen in ihre Richtung, wobei Emmi, die ans Dämmerlicht gewöhnt war, Irene natürlich besser sehen konnte als Irene sie.
»Irene, du überraschst mich.« Irene zuckte zusammen, kam aber geradewegs auf sie zu. »Oh!« machte Irene, als sie vor ihr stand. Irene sah mittlerweile wohl genauso gut wie sie, und sie wußte natürlich, was Irene dachte. Mit einer Armbewegung bot sie ihr Platz an.
»Emmi, Emmi, sogar deine Stimme hat Fett angesetzt!« Irene ließ sich, ohne den Blick von ihr zu nehmen, in den Armstuhl fallen, in dem sie auch früher immer gesessen war. »Menschenskind, was ist los mit dir?«
»Nichts. Ganz und gar nichts.« Sie hatte alles in Reichweite, mußte sich nur ein wenig zur Seite recken, um den stummen Diener näher heranzuziehen.
Sie, Emmi, nahm ein Glas und fragte höflich, was es denn sein dürfe. Sie wußte, daß Irene Unicum sagen würde, und hielt die Flasche bereits in der Hand. In solchen Situationen hatte Irene immer Unicum gesagt. Irene zeigte mit dem Finger auf die grüne, kugelförmige Flasche.
»Wie üblich.« Sie schenkte ihr ein und reichte ihr das Glas.
»Und du?« fragte Irene.
»Ich esse und trinke nicht mehr in Gegenwart anderer.«
Irene nickte, als hätte sich eine ihrer Vermutungen bestätigt. Doch bevor Irene sich weiter mit ihr beschäftigen konnte, sagte Emmi scheinheilig: »Bist du auf Urlaub?«
Irene schien sich ein wenig zu erbosen. »Denkst du jetzt auch nicht mehr in Gegenwart anderer?« Sie machte eine kleine Pause. »Ich bin im Ruhestand.« Es klang nach nichts Gutem. »Und bin endgültig zurückgekommen.«
»Allein?« Schwer zu glauben. Irene, die immer einen Mann zur Hand hatte.
»Allein. Ich habe keine Lust mehr auf das ganze Drumherum.« Irene nahm einen Schluck von dem Unicum, seufzte verhalten und meinte dann vage: »Irgendwie interessiert mich das alles nicht mehr.«
Darauf würde auch sie dringend einen Schluck gebraucht haben, saß jedoch in der eigenen Falle.
»Und jetzt möchte ich herausfinden, was hier wirklich los war. Ich weiß, ich weiß …«, Irene hob die Hände wie in Abwehr, »ich hätte mich gleich darum kümmern müssen, aber das Verschwinden von Anna …«, plötzlich hatte Irene Tränen in den Augen, Tränen, die sie wohl um nichts in der Welt hätte weinen wollen, doch die Natur rächte sich, indem sie sie heftig aufschluchzen ließ.
»Ich konnte nicht früher, glaub mir, Emmi, es ging wirklich nicht, und jetzt, wo ich mich entschlossen habe, den Dingen ins Auge zu sehen …«, wieder mußte sie schluchzen, aber sie gab nicht auf, »stelle ich fest, daß ich nicht die geringste Ahnung habe.«
Sie schenkte Irenes Glas wieder voll, und die nahm es ihr aus der Hand, als wäre darin der reinste Lebenssaft, was es ja auch war. Es lief auf ein längeres Gespräch hinaus, bei dem sie, Emmi, mehrmals durch die Hölle gegangen war, so wie ihr Hals und ihre Seele austrockneten, aber sie hatte es sich nun einmal geschworen und war – o Jubel, o Preis! – standhaft geblieben.
Als Irene dann endlich ging, um vieles klüger angeblich, war sie, Emmi, dermaßen high vor lauter Selbstachtung, daß sie sich noch ganze zehn Minuten in diesem Gefühl suhlte, bevor sie den ersten einsamen Schluck nahm. Er verdunstete bereits im Nasen-Rachen-Raum, so nahe war sie am Verdursten gewesen. Wenn Emmi noch auf die Toilette wollte, blieb ihr nichts anderes übrig, als aufzuwachen. Im Schlafwandeln war sie nie besonders gut gewesen, meist schlug sie sich dabei ein Knie blutig. Sie saß noch immer auf dem Sofa, das heißt, sie lag mehr, als sie saß, da sie die Beine angezogen hatte und ihr der Kopf auf die Armlehne gerutscht war. Das Licht brannte, sie nahm einen Schluck aus dem noch halbvollen Glas. Und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum – da lag noch ein einzelner Schokokeks auf dem Teller. Sie steckte ihn rasch in den Mund, bevor sie es sich anders hätte überlegen können.
Aufs Klo zu müssen hieß, ins Badezimmer zu gehen, und ins Badezimmer zu gehen hieß, sich wohl oder übel zu waschen und auszuziehen. Da konnte sie sich gleich ins Bett legen, wenn sie sich schon die Mühe machte. Verdrossen dachte sie an alles, was noch zu geschehen hatte, aber die Natur ließ ihr keine Wahl. Und da sie schon einmal gezwungen war aufzustehen, nahm sie gleich den Teller und das Glas mit in die Küche.
Als die Prozedur vorüber war und sie endlich in ihrem Nachthemd steckte, löschte sie sogleich das Licht, um ihr ungemachtes Bett nicht zu sehen.
Bevor sie sich unter den Decken begrub, warf sie einen Blick durchs Fenster.
Das Haus drüben, das als einziges in der Straße allein und inmitten eines Gartens stand, war bereits dunkel, nur in Alis Zimmer brannte noch Licht. Er selbst saß mit untergeschlagenen Beinen auf dem Bett und zupfte an seinem Saz, einer Langhalslaute, wenn es stimmte, was sie im Wörterbuch nachgeschlagen hatte. Manchmal schrieb er auch etwas in ein Heft.
Inimini behauptete, es seien Gedichte. Na ja, wahrscheinlich etwas, was sich singen ließ. Wenn es draußen warm war und alle Fenster offenstanden, konnte sie ihn manchmal hören. Ali hatte keine üble Stimme, aber was er sang, klang eindeutig nach Jammertal. Jetzt, wo die Fenster geschlossen waren, konnte sie ihn zwar nicht hören, aber sie fühlte sich so, wie Ali für gewöhnlich klang, wenn er Musik machte.
Ihr Herz dröhnte, und sie ließ sich ins Bett fallen, so wach, wie man nur wach sein kann. Jedoch die Vorstellung, noch einmal aufzustehen und sich ein Buch oder den Walkman zu holen, war ihr so zuwider, daß sie reglos liegenblieb und versuchte, sich selber zu hypnotisieren. Schlafen, die Augen zu und schlafen! Bis morgen früh durchschlafen!
Irene schlief gewiß. Wahrscheinlich schlief sie sich Mut an, um ihr Haus wieder in Besitz zu nehmen. Oder sich wenigstens darin einzurichten zwischen denen, die schon so lange in ihm wohnten, daß sie vergessen hatten, daß es immer noch ihr Haus war. Irene hatte so viele Jahre anderswo gelebt, daß sogar Anna, ihre Tochter, der Meinung gewesen war, Irene würde zu ihren Gunsten auf das Haus verzichten. Daneben. Ganz und gar daneben.
Anna war immer mehr ihr Kind gewesen als das von Irene. Sie, Emmi, war diejenige, die sich Zeit nahm, sie spazierenzufahren. Weit, weit aus der Stadt heraus, wo sie nicht mehr alle kannten. Da glaubten die Leute dann, es wäre ihr Kind, und sie wackelte mit dem Hintern, so stolz war sie. Seht alle her, was für ein Goldkind ich in diesem mickrigen, kleinen Wagen durch die Gegend schiebe!
Die Bruckners, die Irene als Kriegswaise adoptiert hatten, hielten das Geld zusammen. Anna war das ledige Kind von Irene, und es gab nur einen Kinderwagen aus der Tauschzentrale. Emmi hätte gerne einen nigelnagelneuen gekauft, aber das wäre den Bruckners ziemlich aufgestoßen. Irene war froh, daß es überhaupt so etwas wie einen Kinderwagen gab. Im Grunde wollte sie nur weg, so weit weg wie möglich. Zuerst alleine und arbeiten, und wenn sie genug gearbeitet hätte, Anna nachholen.
Die Bruckners wollten sie nicht weglassen, arbeiten konnte Irene zu Hause auch, da blieb es wenigstens in der Familie. Und wer, bitte, sollte sich um das Kind kümmern? Aber Irene setzte sich durch, wie immer und bei allem. Und die meiste Zeit war Anna ohnehin bei Emmi.
Eines Tages war Irene dann fort, und die Bruckners mußten Personal aufnehmen, gleich zwei Mädchen anstelle von Irene, die immer eine Flinke gewesen war. Die Bruckners waren vollkommen aus dem Häuschen. Zuerst das ledige Kind, und dann auch noch abhauen.
Irene rief Emmi immer wieder an, um nach Anna zu fragen. Sie erzählte ihr, wie Anna Dreirad fahren und wie sie schwimmen lernte. Als die Bruckners sich halbwegs beruhigt hatten, kam Irene öfter zu Besuch. Aber sie hatte keine Geduld mit dem Kind. Am Telefon sagte sie immer, wie große Sehnsucht sie nach Anna habe, aber wenn sie dann da war, begann sie an ihr herumzumäkeln. Da bockte Anna und wollte die neuen Sachen gar nicht anziehen, die Irene ihr mitgebracht hatte.
Je älter Anna wurde, desto größer wurden die Gegensätze. Nur in einem schienen sie sich gleich, nämlich daß auch Anna wegwollte. Irene triumphierte, zumindest eine Weile. Sie hatte Anna zu sich geholt, um ihr zu zeigen, wie die Welt funktionierte. Aber Anna muß das meiste falsch verstanden haben. War auch bei weitem nicht so ehrgeizig wie Irene. Sie schrieb jede Woche. Emmi dies, Emmi das … Sie, Emmi, hatte alles vorausgesehen, das verschlampte Studium und daß Anna sich in jemanden verlieben würde, der ihr, ohne es zu wollen, das Leben schwermachte.
Sie hatte sie nicht zurückhalten können, damals nicht und später auch nicht. »Emmi«, sagte Anna, »ob es gut ist für mich oder nicht, ich muß.« Sie lachte und war so glücklich. Anna konnte tatsächlich glücklich sein, so sehr, daß es einem weh tat. Eine, die ihr Glück so leben konnte, würde auch ihr Unglück so leben müssen. Als Anna noch ein Kind war, veränderte sich die Farbe ihrer Augen, wenn die Stimmung umschlug. Von Blau nach Grün, erst recht wenn sie weinen mußte.
Emmi war immer hinter Anna her gewesen, sie sollte sich doch nicht verletzen. So wie damals, als sie radfahren gelernt hatte und davonfuhr, die Promenade am Fluß entlang, unsicher, wackelnd und ununterbrochen klingelnd. »Warte«, hatte sie geschrien, »wart auf mich, du weißt doch gar nicht, wo du hinfährst!« Und sie Anna dann an der Uferböschung gefunden hatte, mit aufgeschlagenen Knien, aber ansonsten heil. Nur das Fahrrad war in den Fluß gefallen.
Und wieder fuhr Anna mit dem Rad, diesmal nicht die Promenade entlang, sondern hinten am Park vorbei in Richtung Wald, zwischen den Bäumen hindurch und erst dann wieder an den Fluß. Ihre Augen waren blau, himmelblau, und ihre Haut glänzte wie immer nach dem Baden. Sie trug die Haare in einem dicken Zopf, der sie am Hals kitzelte. Sie lachte und war so glücklich, daß es weh tat. »Emmi«, rief sie, »du bist zu dick, du wirst mich nie erwischen!«
Sie keuchte hinter ihr her, aber es half nichts. Anna konnte die schwarze Wolke nicht sehen, die auf sie zukam. Oder doch? Irgend etwas muß sie gesehen haben, denn sie warf die Arme in die Luft – sie hat nie freihändig fahren können –, dennoch warf sie die Arme in die Luft: »Emmi, ich fliege, so glaub mir doch! Emmi, ich kann fliegen …« Aber im Grunde war sie es, die flog und Anna liegen sah, ganz unten, blutig und ohne Bewußtsein.
Wie schon so oft, konnte sie sich weinen hören, die glitschige Wange am durchweichten Kopfkissen, und als sie zu schlucken versuchte, erstickte sie beinah an der eigenen Spucke. »Nein«, schrie es in ihr, »niemand kann fliegen.«
Anna war weggegangen, um zu sich zu kommen. Weil ihr alles zuviel geworden war. Sie alle waren ihr zuviel geworden. Aber sie würde wiederkommen. »Amen«, rülpste der Versucher in ihr. »Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.«
Anderntags hatte Emmi nach Ali gerufen, als er unterm Fenster vorbeiging. Die Birne in der Deckenbeleuchtung war ausgebrannt, und sie konnte auf keine Leiter mehr steigen. Auch früher war sie nie schwindelfrei gewesen, doch jetzt drehte sich ihr der Kopf schon bei der ersten Sprosse.
»Sonst alles in Ordnung, Emmi hanım?« Ali ging manchmal für sie einkaufen, seit Anna nicht mehr da war. Sie hatte einen Zettel geschrieben und legte ihn zusammen mit dem Geld in einen Korb.
So konnte sie sitzen bleiben, während Ali sich die Leiter aus dem Abstellraum und die neue Birne aus dem Vorzimmerschrank holte.
»Irene ist also zurückgekommen, hätte ich nicht gedacht.« Emmi schaute ihm zu, wie er die Leiter unter der Lampe postierte.
»Ja!« Ali hatte für gewöhnlich einen sanften Blick und eine Haut wie Elfenbein. Sein Haar war tiefschwarz, voller kleiner Locken. Er schien sich immer über etwas zu wundern, auch wenn er es nicht zugeben wollte. Kaum zu glauben, daß er einmal so rebellisch gewesen sein sollte, um aus seinem Land fliehen zu müssen. Wäre da nicht – höchst selten, aber doch – dieses Fünkchen Zorn in seinen Augen gewesen, hätte sie Alis Geschichte für pure Legende gehalten.
»Sie ist Annas Mutter, wo soll sie sonst hingehen als in ihr Haus.«
»Es wird für euch alle eine Erleichterung sein, was den Haushalt betrifft, und überhaupt.«
Ali sah Emmi an, als würde sie ihn auf den Arm nehmen wollen. »Hat bisher ganz gut geklappt.« Vorsichtig schraubte er die kaputte Birne heraus und die neue hinein.
»Nichts gegen eure Planwirtschaft, aber ich denke an Inimini. In ihrem Alter hat Anna noch nicht einmal gewußt, wie man Milch heiß macht.«
Ali legte die Ohren an. »Meine Tochter ist geschickt, ist doch gut, oder?« Licht flammte auf, und Ali stieg von der Leiter, wobei er am Schluß zwei Sprossen auf einmal nahm und beinah mitsamt der Leiter, die er umklammert hielt, umgekippt wäre. Emmi suchte unwillkürlich Deckung, indem sie den Kopf einzog. Aber Ali wahrte seine Würde, klappte ruhig die Leiter zusammen, als habe der Hopser dazugehört, und stellte sie an ihren Platz zurück.
»Versteh mich nicht falsch, mein Lieber, ich habe nur manchmal den Eindruck, daß das Kind zu viel arbeitet.« Emmi richtete sich wieder auf. »Aber jetzt, wo Irene da ist …«
Alis Blick sagte, vergiß es, aber sein Mund öffnete sich zu einem mechanischen »… wird alles anders werden.«
Sie wagte kaum, sich das Leben im Haus drüben vorzustellen. So wie sie Irene kannte, würde kein Stein auf dem anderen bleiben. Irene würde ihnen zeigen, daß die Kartoffeln unten wachsen und die Kirschen oben, aber sie würde auch dafür sorgen, daß sie keinen Augenblick vergaßen, wie die Hausordnung lautete. Also versuchte sie, Ali ein wenig von Irenes Machtergreifung abzulenken.
»War das deine Idee mit dem Kopftuch?«
Gleich kam Leben in seine verhangenen Züge. »Meine Idee? Die Frau von Haluk muß ihr das eingeredet haben. Seit Anna …« Es verschlug ihm die Sprache, und Emmi schämte sich, weil sie die falsche Frage gestellt hatte. Am liebsten hätte sie ihn in die Arme genommen wie den Sohn, den sie nie geboren hatte, und ihm ins Ohr geflüstert, daß Anna eines Tages wiederkommen würde, obwohl ihr alles, obwohl sie alle ihr zuviel geworden wären, sie müßten nur Geduld haben – Geduld bringt Rosen –, Geduld und ein wenig Großherzigkeit.
Aber Ali schaute haarscharf an ihr vorbei, nagte an seiner Unterlippe, die schon ganz wund sein mußte, und nahm schweigend den Einkaufskorb mit der Liste und dem Geld vom Tisch.
Ali hatte das Licht brennen lassen, also mußte sie doch noch aufstehen. Sie ging gleich ins Bad, holte sich auch Saft aus der Küche. Auf dem Rückweg konnte sie Inimini durch den Garten flitzen sehen. Irene stand in der Küchentür, auf der Nußbaumseite, und rief nach ihr. Inimini duckte sich hinter der Brombeerhecke und fingerte an ihrem Kopftuch, sie trug es immer noch.
Im Gegensatz zu Anna, die oft Mühe hatte, Worte zu finden, es daher manchmal sein ließ und einfach nur lächelte, sagte Inimini alles mögliche, so als sei sie tausend Jahre alt und habe hundert Leben gelebt. Wahrscheinlich dachte sie sich die Sätze vorher aus und wartete dann auf eine Gelegenheit, sie loszuwerden.
»Glaubst du nicht auch, Emmi, daß das Leben wie ein unreifer Apfel ist?« Sie hatte keine Ahnung, worauf Inimini hinauswollte, schaute sie nur groß an. »Erst schmeckt er einem, und dann kriegt man Durchfall.« Aber das war noch, bevor Inimini angefangen hatte, dieses Kopftuch zu tragen.
»Und Inimini? Sie muß doch irgend etwas dazu gesagt haben. Damals.«
Emmi hätte sich gleich denken können, daß Irene es keine zwei Tage aushalten würde allein da drüben. Irene war schlank geblieben, hatte schon immer einen Hang zum Magersein. Wenn sie sich Mühe gab, konnte sie Irene als Kind vor sich sehen, mit Beinen wie eine Waldschnepfe. Sie selbst war damals schon schwerer als Irene gewesen. Die einzige Stelle, an der bei Irene etwas hängenblieb, war der Busen. Holz vor der Haustür, wie die Burschen sagten, die ihr schon nachpfiffen, als sie beide noch gemeinsam im Nußbaum saßen.
Sie hatte sich mit der Antwort Zeit gelassen. »Inimini hat ein Riesenmundwerk, aber in Wirklichkeit kriegst du nicht viel aus ihr raus. Sie sagt höchstens so verrückte Dinge wie, daß sie Zoo-Direktorin werden will oder daß Ali baba auf die Kraniche wartet, die noch hier durchziehen werden. Und das einzige Mal, wo ich sie weinen gesehen habe, war, als sie und Omo das Wort abkratzten, das jemand an die Hauswand gesprüht hatte.«
Irene war mit ihrem Manikürzeug gekommen und feilte sich nun die Nägel. Ihre Hände sagten deutlich, wie alt sie war. Verstohlen schaute Emmi auf die ihren, die ordentlich gepolstert und so gut wie faltenlos erschienen. Das hieß wohl, daß sie sich immer noch Illusionen machte. Irene las wieder einmal in ihren Gedanken. »Ein leerer Sack steht nicht, Emmi, auch wenn du so tust, als hättest du dir das Essen abgewöhnt.«
»Geschenkt.« Sie hatte keine Lust, sich von Irene etwas zu ihrer Lebenspraxis sagen zu lassen. Ihr Bauch gehörte ihr und ihr Hintern, ihre Oberschenkel und ihr Busen ebenfalls. Irene hatte keine Ahnung, was es hieß, das eigene Anschwellen bis in den Schlaf hinein zu spüren, und nichts dagegen tun zu können. Genauso wie sie keine Ahnung davon hatte, was im Haus drüben los war. Anna, ihre wunderschöne Anna, hatte sich zu Tode geliebt, und nicht einmal ihre Mutter würde etwas davon begreifen.
»Diese Ungewißheit!« Das Feilenraspeln begleitete Irenes Stimme im falschen Rhythmus. »Emmi, du hast meine Tochter besser gekannt als ich, ich bitte dich, sag mir endlich, was los war. Oder glaubst du, daß ihr etwas passiert ist?«
Emmi versuchte zum hunderttausendsten Mal das grausige Bild zum Verschwinden zu bringen, das sie nachts des öfteren aus dem Schlaf scheuchte und das wohl von niemandem, außer von ihr, gesehen wurde. Sie zuckte so heftig mit den Achseln, daß ihre Ellbogen den Tisch zum Vibrieren brachten.
»Ich weiß es nicht, niemand weiß es, solange man sie nicht gefunden hat.« Schon das Wort gefunden jagte ihr großen Schrecken ein, es roch irgendwie nach Verletzungen, nach Tod. »Auch der Gendarmerie-Major nicht, der manchmal vorbeischaut, nur um zu sagen, daß er noch immer keine Spur hat. Er sitzt bei Ali in der Küche, trinkt Tee und fragt ihn zum xtenmal, wann er damals schlafen gegangen, wann er wieder aufgestanden und warum er nicht gleich zu ihm gekommen sei, als Anna die Nacht über fortblieb. Und das Ali, der sich mehr dafür geniert, als irgendein Gendarmerie-Major sich ausmalen kann. Stell dir vor, er hätte Anna gleich am nächsten Morgen als vermißt gemeldet. Wie sie gegrinst hätten, die Freunde und Helfer. ›Ist wohl fremdgegangen, die Braut!‹ Etwas in der Art hätten sie sicher zu ihm gesagt. Dieser Gendarmerie-Major vielleicht nicht, der hat nämlich seinerzeit ein Auge auf Anna gehabt. Darum kommt er auch noch immer zu Ali. Aber wer sagt denn, daß er tatsächlich Dienst gehabt hätte, wenn Ali gleich nach der ersten Nacht Anzeige erstattet hätte. Und die anderen hätten bloß blöd gelacht.«
»Ich mache mir Sorgen um die Kleine, um Inimini.« Irene zog eine Weile den Rotz auf, bis sie sich endlich schneuzte.
Typisch Irene. Kaum hatte sie den Mut, mit ihr über Anna zu reden, über ihre, Emmis, Anna, schlug sie schon wieder einen Haken. Unbegreiflich die Frau. Da kannten sie einander nun schon seit Kindertagen, und immer noch überraschte sie Irenes Wechselschritt.
»Du bist schwanger«, hatte sie zu Irene gesagt, als sie den Wintermantel nicht mehr überm Bauch zubrachte, »wie wäre es, wenn du mit diesem Kerl einmal Klartext sprichst?«
Irene hatte sie angeschaut, als rede sie von etwas, das nichts mit ihr zu tun hatte, und zwitscherte bloß: »Weißt du, Emmi, daß Mario versprochen hat, mir einen Job und ein Zimmer zu besorgen, wenn ich erst einmal in München bin?«
Erstaunlicherweise war Irene dann wirklich nach München gegangen, und dieser Mario hatte ihr tatsächlich einen Job und ein Zimmer besorgt, in dem sie zwar nur ein paar Wochen geblieben war, aber immerhin. Danach suchte sie sich etwas Geräumigeres.
Irene hatte Schiß. So wie sie da bei ihr saß und sich schneuzte, war klar, daß sie Schiß hatte. Die kecke alte Irene hatte Schiß, mit ihr über ihre Tochter zu reden und warum sie verschwunden war. Statt dessen entdeckte sie in sich die Großmutter, die Großmutter von Omo und Inimini – es war zum Kotzen. Emmi verlagerte ihr ganzes Gewicht nach vorne und sagte mit Nachdruck: »Ihre Mutter ist weg, und niemand weiß, was mit ihr geschehen ist, das schockt jedes Kind!«
Schon versuchte Irene, ihr neuerlich zu entwischen. »Ich meine das Kopftuch.« Sie zog ein weiteres Mal auf, streckte die Hände von sich und betrachtete mit zusammengekniffenen Augen ihre Nägel.
»Was denn, sie versucht bloß, auf andere Gedanken zu kommen.«
»Glaubst du, daß Ali dahintersteckt? Ich meine, die Frau von seinem Freund läuft doch auch so herum.«
»Freund? Freund ist gut!«
Sie konnte es nicht glauben, daß Irene diesen Teil der Geschichte einfach sausen ließ, ohne sich zumindest ihr gegenüber mit großem Getöse Luft zu machen. Immerhin war das Gasthaus einmal das ihrer Zieheltern gewesen. Irene hatte selbst eine Zeitlang dort gearbeitet. Jetzt aber gehörte diese Goldene Gans Haluk und hieß mittlerweile Zypresse. Ali konnte noch von Glück reden, daß Haluk ihn weiter beschäftigte. Aus Solidarität, wie Haluk behauptete. Nachdem Haluk ein paar Jahre bei Anna und Ali in Dienst gestanden war. Wo Haluk bloß das Geld herhatte, Annas und Alis Schulden zu bezahlen? Daß Ali Pleite machen würde, war vorauszusehen. Nur Anna hatte die Augen fest zugemacht. So fest, daß nicht einmal sie, Emmi, sie hatte wach kriegen können. »Ach Emmi, was verstehst du denn vom Geschäft. Laß uns nur machen.«
Sie ließ. Was hätte sie sonst tun können? Unterrichtete fremde Kinder und studierte beim Nachhausegehen die Speisekarten der anderen Gasthäuser. Damals hatte Anna bereits die Kinder gehabt, wie hätte sie sich da noch groß ums Geschäft kümmern können. Die Bruckners hatten ihr, bevor sie starben, das Geschäft überschrieben. Irene bekam nur das Haus, schließlich war sie abgehauen und nicht, wie Anna, zurückgekommen. Ali aber schrieb nachts Gedichte und verließ sich auf Haluk.
»Irene, du kannst doch nicht übersehen haben, daß Haluk jetzt Alis Chef ist und ihn entsprechend für sich schuften läßt.«
Irene reagierte so matt, daß Emmi die Welt nicht mehr verstand. »Ali und schuften?« Irene packte ihr Manikürzeug weg. »Du lebst schon zu lange in deiner Sofa-Welt, Emmi, und glaubst, was man dir erzählt.«
Irene bildete sich wohl ein, der Augenschein trüge ausgerechnet sie nicht. Es waren jedoch schon Klügere als Irene mit Blindheit geschlagen gewesen.
Aber warum regte sie das überhaupt auf? Solange Anna verschwunden blieb, war es vollkommen lila, ob Ali schuftete oder nicht.
»Ist doch nicht normal, wenn ein intelligentes, lebhaftes Kind sich plötzlich wie eine Nonne verkleidet und so auch noch in die Schule stelzt. Oder?«
Irene machte sie wütend. Anstatt über Anna zu reden, kam sie ihr mit diesem Kopftuch. »Inimini ist kein Kind mehr. Sie wird ihre Gründe haben.«
»Kein Kind mehr?« Irene zog die Brauen hoch, und Emmi starrte auf ihre Tränensäcke, die unter einem himmelblauen Blick hingen.
»Außerdem steht es ihr«, behauptete sie, und Irenes Tränensäcke schlenkerten geradezu vor Ablehnung, »wenn du mich fragst.«
Irene fragte sie aber nicht, und in ihrem Gesicht stand geschrieben, wie sie gegen den Verdacht ankämpfte, sie, Emmi, könne sie trotz der ganzen Misere verarschen. Sie mußte Irene wieder ein wenig entgegenkommen, bevor sich der Verdacht in ihr festsetzte.
»Hast du Lust auf ein Stück Kuchen?« Bevor Irene noch etwas sagen konnte, nahm sie, Emmi, einen Anlauf, stemmte sich hoch, so richtig mit Schwung, damit sie auch gleich in Gang käme. Dabei löste sich der Furz, der sie ohnehin schon die ganze Zeit gequält hatte.
Irene starrte ihr ungläubig ins Gesicht. Sie entschuldigte sich ziemlich lässig, da fing Irene hemmungslos zu lachen an. In diesem Augenblick stieg es auch ihr den Hals herauf, und sie lachten beide, ungeheuer laut und ungeheuer hysterisch. Ihr kamen beim Lachen immer gleich die Tränen, aber auch Irene mußte sich die Augen wischen. Sie hielt sich noch immer – halb im Stehen – am Tisch fest, ihr Busen galoppierte unter der Bluse wie seinerzeit die schweren Brauereipferde in den Hof der Goldenen Gans, während Irene sich an ihren Arm klammerte, damit das Lachen sie nicht vom Stuhl kippte.
Emmi hatte wieder die Szene vor Augen, wie Irene und sie im Nußbaum gesessen waren und die Bruckner, damals höchstens halb so alt wie jetzt sie beide, aus der Küche gekommen war und sich – nicht ahnend, daß sie beide ganz in der Nähe hockten – kollernd Erleichterung verschafft hatte, wobei sie nach jedem Knall auch noch zufrieden seufzte, während sie beide im Nußbaum an ihrer Heimlichkeit beinah erstickten.
»Weißt du noch?« Ihr war klar, daß Irene an dasselbe dachte, ja denken mußte, wenn ihr Kopf noch funktionierte. Irene nickte bloß, ein neuer Lachkrampf schüttelte sie, nickte und schlug mit der einen Hand auf den Tisch, während sie ihr mit der anderen blaue Flecken kniff.
Sie konnten und konnten sich nicht beruhigen. Wann immer eine von ihnen wieder zur Vernunft zu kommen schien, kreischte die andere: »Weißt du noch?« und gab ein Stichwort, das auf weitere Erinnerungen dieser Güte anspielte.
Emmi hatte sich längst wieder hingesetzt, das war nichts, was ausgestanden werden konnte, das mußte man aussitzen. Erst als Ali mit dem Einkauf zurückkam, faßten sie sich einigermaßen, aber noch war es bei weitem nicht vorbei. Selbst das geringste Anstreifen an einem »Weißt du noch?« versetzte sie beide wieder in heftiges Gekreisch und Gelächter, bei dem auch das Tränenkrüglein aus dem Märchen sich längst gefüllt hätte.
Ali stellte den Korb auf den Küchentisch und die Flaschen in den Kühlschrank, dessen Türe laut knarzte. Schon mußten sie wieder lachen. Ali schaute ihnen befremdet zu, wie sie sich, nach Atem ringend, nach vor beugten, und konnte sich bei Gott keinen Reim darauf machen, was denn an ihrer aller mißlichen Lage so lächerlich sein sollte, daß es sie dermaßen schüttelte. Aber wann immer Irene oder sie zu einer Erklärung ansetzte, zerriß ihnen dieses mörderische Gewieher von neuem den Mund.
Alis unsicherer Blick wurde zusehends gekränkter, als wäre er unwiderruflich zu dem Schluß gekommen, sie würden über ihn lachen. Also holte er den Kassabon aus der Hosentasche und legte ihn auf den Tisch neben den Korb mit den restlichen Sachen, von denen er nicht wußte, wo sie hingehörten.
»Wechselgeld gebe ich hierher.«
Es war Emmi noch immer nicht möglich, sich bei Ali zu bedanken. Sie deutete ihm nur mit der Hand, für ihn war ohnehin klar, daß Irene und sie endgültig übergeschnappt sein mußten, also ging er seines Weges.
Es tat Emmi leid, daß er sie beide so hatte sehen müssen, aber sogar seine Art, sich kopfschüttelnd und eingeschnappt zurückzuziehen, reizte sie erneut zum Lachen, und als er endlich zur Tür hinaus war, verschluckte Irene sich mehrmals an dem Satz: »Mein Schwiegersohn hat uns verlassen.«
Emmi mochte Ali, weil Anna ihn gemocht hatte, und sie mochte ihn nicht, weil er an allem schuld war. Hätte Anna sich nicht in ihn verliebt und ihn auch noch geheiratet, dann wäre ihr nicht alles zuviel geworden, dann wären sie alle ihr nicht zuviel geworden, und sie wäre nicht von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden. Dann würde auch das Gasthaus noch ihr und nicht diesem Haluk gehören, dessen Frau und Töchter nur mit Kopftüchern aus dem Haus gingen. Sie hätte weder Omo noch Inimini geboren, und möglicherweise wäre sie jetzt hier gesessen und hätte mit ihnen gelacht, daß sich die Balken bogen.
Nur langsam gelang es Emmi und Irene, wieder normal zu atmen, und während sie sich noch die Tränen abtupften und den Hals räusperten, fragte Irene sie, was sie von Ali halte und ob es nicht doch ein großer Fehler von Anna gewesen sei, ihn zu heiraten, auch wenn er ein netter Kerl sei, aber sie hätten eben doch zu wenig an Gemeinsamem.
»Zu wenig an Gemeinsamem?« Emmi fiel ein, daß sie für Irene ein Stück Kuchen hatte holen wollen, und unternahm von neuem den Versuch, hochzukommen und sich dabei gleichsam in Richtung Küche abzustoßen. »Sie haben fünfzehn Jahre und zwei Kinder miteinander gehabt. Das ist wohl Gemeinsames genug, denkst du nicht?«
Nicht daß sie sich das, was Irene meinte, nicht oft genug selber gesagt hätte, aber aus Irenes Mund reizte es sie zum Widerspruch. Man konnte Ali alles mögliche nachsagen, aber nicht, daß er sich keine Mühe gegeben hätte. Er hatte so gut Deutsch gelernt, daß er kaum mehr mit Akzent sprach, nur die Artikel verwechselte er gelegentlich oder ließ sie ganz weg, und hin und wieder verfiel er an unpassenden Stellen in den Dialekt der Gegend, was aus seinem Mund ein wenig merkwürdig klang.
Irene aber konnte noch immer nicht begreifen, was mit Anna geschehen war, und erwartete nun von ihr, daß sie es ihr erklärte.
Irene
»Genesen? Ich weiß auch nicht, ob man davon genesen kann«, hätte Irene wohl zu Anna gesagt, wenn sie es ihr hätte erklären sollen. Nämlich von sich selbst, von der Durchlässigkeit der eigenen Haut, vom eigenen Körper, in dem sich das Bild eines anderen festgesetzt hatte. Der Abdruck dieses anderen drang in jede Zelle – Einnahme, Teilhabe, Unterwerfung. Oder wie es im Krieg hieß – Usurpation, Partizipation, Kapitulation. Und die körpereigene Abwehr? Außer Kraft gesetzt. Dennoch blieb man durch die Haut getrennt.
Was sich festsetzte, war das Bild, das Bild jenes anderen, das man an seiner statt in Besitz nahm. Schon hatte man ihn vereinnahmt, sich so seine Zuneigung gesichert, sich seine Berührungen vorgestellt. Man trotzte ihm Worte ab, Worte für sich selber, und zwang ihn, einen so zu sehen, wie man sich selbst gefiel.
In einem Restaurantspiegel hatte sie sich einmal so vor Augen gehabt, wie sie sich gerne gesehen hätte. Sie schaute mehrmals hin, bis sie es glauben konnte. Kein Zweifel – da saß sie und lächelte. Das Licht, der Abstand, die Stimmung, alles war auf ihrer Seite.
Irene erkrankte immer wieder an einem Gesicht, einem Körper, einer Stimme. Ohne Vorwarnung. Jemand stolperte auf sie zu, sagte etwas, noch wiegte sie sich in Sicherheit, antwortete, lachte, ohne zu ahnen, daß sie sich bereits angesteckt hatte.
Wenn das Gesicht des anderen zum ersten Mal den Weg in ihre Träume fand, wurde sie stutzig. Manchmal starben die Keime wieder ab, aus Mangel an sinnlicher Nahrung. Dann war es bloß ein Gesicht, das ihr hätte gefährlich werden können.
Andernfalls begann das Gesicht des anderen sich an ihrer Aufmerksamkeit zu mästen, nahm zusehends Platz in ihren Gedanken, erzeugte Hitze. Sie ging, ohne ein Gewicht zu spüren. Ihr war zum Singen, sie lachte mit sich selber.
Irgendwann sah sie das Gesicht dann nicht mehr deutlich vor sich, und wenn sie ihm wiederbegegnete, stellte sich die entscheidende Frage, ob es tatsächlich das Gesicht war, das den Weg in ihre Träume gefunden hatte, oder hatte sich ihr Bewußtsein geirrt?
Wenn Irene das Gesicht des anderen in der Wirklichkeit wiedererkannte, war es schon zu spät. Da half kein Zungezeigen mehr. Also versuchte sie, es mit ihrem Leben zu verknüpfen, es dort festzuhalten, wo sie gerade stand. So freien Umgang sie mit ihm in der Vorstellung auch gepflegt hatte, so umsichtig stellte sie sich dem lebendigen Gesicht gegenüber an.
Eine fieberhafte Zuneigung ließ sie den Blick senken, eifrig erkundete sie jede Geste, die in ihre Richtung wies, wartete auf das geringste Zeichen von Gegenseitigkeit.
Ihr Blick verklärte nichts. Von Peinlichkeit geschüttelt, nahm sie jede Schwäche, selbst eine grammatikalische, zur Kenntnis, und doch gab es kein Zurück. Da existierte keine andere Richtung als die auf den anderen zu. Als Ziel galt einzig die Vereinigung, egal, wie unmöglich sie erscheinen mochte. Der Versuch, die Grenzen der Haut zu überwinden, einzufallen, wenn es sein mußte, mit Sengen und Brennen.
Alles tat weh an dieser Bewegung, die Erfüllung ebenso wie die Enttäuschung, und daß kein Weg in den anderen führte, auf dem man ankommen konnte. Wo das Ziel sich entzog, gewann der Weg an Bedeutung. Was folgte, war die euphorische Einstimmung auf das Scheitern, all die hingebungsvollen Zuckungen, das Süchtigmachende des Einander-Ansehens, das die beginnende Ermüdung am Anblick des anderen längst vorausgeahnt hatte.
Dennoch mußte die Liebe geliebt werden. Liebe? Die Krankheit hieß Verliebtheit. Das ver bedeutete den Erreger und gleichzeitig die einzige Hoffnung – nämlich daß er wieder vergehen, verlöschen, verschwinden würde.
Jetzt hatte sie so viele verrenkte Wörter gebraucht, um es Anna in Gedanken zu erklären. Anna oder jemandem, der von einem anderen Stern kam. Wahrscheinlich würde Anna denken, daß ihr das auch nicht weiterhalf, weil es nichts mit ihr zu tun hatte, und daß sie ihr viel zu unähnlich wäre, um aus dem Vergleich zu lernen. Doch wenn sie schon all diese Wort-Kapriolen schlagen mußte, sollte Anna ihr doch wenigstens zuhören.
Früher hatte sie noch versucht, damit in den Himmel zu kommen, daß sie aus den Träumen vom Gesicht des anderen an dessen Schulter erwachte. Man konnte dem Paradies ziemlich nahe kommen, für einen Augenblick oder so. Aber es betreten? Nicht bei vollem Bewußtsein. Und sobald man denken konnte, hatte man den Fuß aus der Tür.
Dennoch hatte sie den Blick des anderen immer wieder angenommen und zurückgeblickt. Es lag in ihrer Natur. Vielleicht, dachte sie, gab es doch eine Schwelle, eine Schwelle nur für sie, die sie eines Tages überschreiten würde. Hinter der sich der Magnetberg befand, ihr persönlicher Magnetberg, auf den sie sich zeitlebens zubewegt hatte.
Aber die Wahrscheinlichkeit nahm ab. Mit einem Mal war sie an dem Punkt, an dem es nur mehr darum gehen konnte, ob ein letztes Mal möglich wäre. Und ein weiteres letztes Mal und so fort. Noch zitterten ihr die Knie vom vorletzten letzten Mal. Wie lächerlich – eine alte Frau, die begehrt. Die sich vor ihrem Begehren nicht zu schützen weiß? Sie pfiff auf jede Art der begleitenden Abschwächung, Tatsache war …
Man mußte es sich auf der Zunge zergehen lassen, Sex als soziale Geste, altersbedingt. Nur zu, guter Mann, scheuen Sie sich nicht! Wir sind alle bloß Hampler in der Statistik. Darum die Lichter aus und schnell noch einen Schluck, damit uns die Nacht nicht zu lang wird.
Selbst die Phantasie war korrupt und ging die erbärmlichsten Kompromisse mit der Wirklichkeit ein. Doch es handelte sich um etwas anderes. Was wäre schon Sex? Sex ließ sich nie ausschließen. Selbst Achtzigjährige wurden noch vergewaltigt. Sie wollte die Zeichen sehen, die Blicke, das Flüstern, die heimlichen Berührungen.
Ein Spiel ließ sich nur spielen, wenn die Regeln eingehalten wurden. Mit der Zeit hatte sie immer schlechtere Karten, ihre Schwäche war offenkundig und demütigend. Sollte sie sich weiter vor sich selbst verächtlich machen? Sich immer wieder fragen, wie es denn den anderen Frauen erging? Welchen anderen? Emmi war zu fett und Anna noch zu jung. Außerdem hatte Anna sich wohl abgesetzt, wer weiß, aus welch triftigen Gründen. Zumindest wollte sie das glauben, solange sie nichts anderes glauben mußte.
Sie selbst hatte die Flucht ergriffen, weil sie ihrem eigenen Blick nicht mehr standhielt. Nicht einmal der Spiegel in jenem Restaurant hätte ihr mehr helfen können. Die paar Jahre, die sie dem unausweichlichen Verfall abgetrotzt hatte, führten nur dazu, daß das jeweils letzte Mal immer kürzer dauerte. Wozu dann noch diese enormen Anstrengungen?
War nicht Emmi immer die Klügere gewesen? Die sich rechtzeitig dem Spiel mit der Anziehung widersetzt hatte und nun einer Leidenschaft frönte, bei der sich der andere nicht verweigern konnte. Oder hat man je ein Stück Schokolade erlebt, das geschrien hätte, wenn man es in den Mund schob?
»Männer«, hatte Emmi schon vor Jahren, als Irene sie einmal danach fragte, mit einem perfiden Augenaufschlag gesagt, »Männer schmecken nur halb so gut und sind noch schwerer verdaulich.«
Dabei hatte Emmi seinerzeit auch nichts anbrennen lassen, gemessen am Umfeld. Sie hatte so einiges ausprobiert, bis sie sich nur mehr aufs Essen verlegte. Und auf Anna natürlich. Emmi war die klare Entscheidung für Männer gewesen, die einen dicken Hintern mögen. Insofern war sie sich treu geblieben, auch wenn sie mittlerweile gewaltig übertrieb. Und was sie dazu zu sagen hatte, zeugte von der erbarmungslosen Einsicht eines Menschen, der mit seinem Kühlschrank flirtet. Aber immerhin flirtet, darum aß sie wohl nur mehr heimlich.
»Von hinten kann man dich noch immer für ein junges Mädchen halten«, hatte Emmi neulich zu ihr gesagt, als Revanche für ihre Verblüffung über Emmis jetzige Ausmaße. Jeder weiß, daß man sich in ein Gesicht verliebt, in Augen, einen Mund, vielleicht noch in Ohren, einen Geruch, eine Geste – was half einem da die Hinteransicht?
Die Wahrheit war, daß die Männer jünger wurden, ihr Gesicht aber älter. Wäre sie ein Mann, wäre diese ihre Hölle erst das Fegefeuer, aus dem immer noch der eine oder andere Weg ins Paradies führte. Dabei wollte sie nie ein Mann sein. Männer waren, sofern sie den Blick des anderen hatten, begehrenswerte Wesen, die ihr den Puls in die Höhe trieben. Sie zeigten sich aber auch als die Spielmeister.
Sie war zurückgekommen in diese verschrobene kleine Stadt ihrer und Annas Kindheit. Wenn sie an die Anstrengung dachte, die der Abschied von Berlin sie gekostet hatte, brach ihr noch im nachhinein der Schweiß aus. Sie war einfach ausgestiegen, ausgestiegen aus etwas, von dem sie nicht einmal mehr sicher sein konnte, daß es etwas gewesen war, obgleich ein paar nachgeschickte Briefe es sie glauben machen wollten. Doch sie wußte es besser.
Ausgestiegen mit einem Gesicht im Herzen, dessen Konturen noch scharf waren, und mit schweren nächtlichen Phantomschmerzen. Hätte sie etwa sagen sollen: »Natürlich bin ich in dich verliebt, aber ich bin in einem Alter, wo nicht mehr allzuviel daraus werden muß.« Eine Haltung, die sie sich im Notfall wohl noch abverlangt hätte, aber wozu? Um gleich darauf an ihrer Altersweisheit zu ersticken?
Wenn sie endgültig über dieses letzte Gesicht hinweggekommen sein würde, mußte sie es Emmi erzählen, und wer der Mann war, damit sie sich totlachte darüber, die gute alte Emmi.
Manchmal fragte sie sich, ob es einen Unterschied machen würde, wenn sie wüßten, wo Anna war. Für sie wahrscheinlich nicht. Sie und Anna hatten sich in all den Jahren viel zu selten gesehen, insofern konnte sie nicht einmal sagen, daß sie Anna vermißte. Sie hätte nie gedacht, daß Anna den Mut aufbringen würde, von Mann und Kindern wegzugehen. Doch nicht Anna. Und doch Anna. Hut ab! Wenn es tatsächlich ihre Entscheidung gewesen war.
Sie würde den Mann gerne kennengelernt haben, der Anna dazu gebracht hatte. Sie nahm an, daß es sich um Liebe handelte. So wie Anna seinerzeit Ali aus Liebe geheiratet hatte. Aber selbst die Liebe schaffte es nicht länger als ein paar Jahre, dann war so gut wie immer die Luft raus. So gesehen, hatte sie eine gute Chance, daß sie vielleicht schon in ein paar Wochen davongekommen sein würde. Verliebtsein dauerte bei weitem nicht so lange wie Liebe.
Merkwürdig, was sie Anna nun auf einmal alles zu sagen gewußt hätte. Oder gar nicht merkwürdig, denn in ihrem Kopf hatte sie immer mit Anna geredet. Schließlich war Anna ihre Tochter und somit der einzige Mensch, den ihre Haut je zur Gänze umschlossen hatte. Solange sie mit ihr schwanger ging, waren sie tatsächlich ein Leib gewesen, wie alle Verliebten es sich wünschen. Sie war damals noch keine zwanzig und sehr beeindruckt von den anderen Umständen, von dem Umstand, zu zweit zu sein, nämlich zwei in einem. Durch Annas Geburt wurden sie getrennt, unwiderruflich. Sie hatte darüber eine Woche lang geweint. Doch schon als sie sie nach Hause brachte, war ihr klar geworden, daß sie vollkommen verschiedene Wesen waren.
Emmi war immer dagewesen. Sie war zu träge oder zu uninteressiert, oder vielleicht konnte sie gar keine Kinder kriegen. »Kinder machen dick und zicken beim Essen«, pflegte sie zu sagen. Doch als sie Anna sah, wurde sie vom Hinschauen Mutter. Nicht gleich beim ersten Mal, dafür umso nachhaltiger. Sie atmete ein und zog Anna allein schon dadurch an sich. Und natürlich wußte sie alles besser. »Irene, der Kopf der Kleinen verformt sich, wenn du sie nicht auf den Bauch legst.« Oder: »Sei nicht so ungeduldig und warte, bis sie gerülpst hat. Sonst kotzt sie und erstickt noch daran.«
Emmi war nicht mehr wiederzuerkennen. Sie hatte sich immer darüber gewundert, daß Emmi Lehrerin geworden war. Ausgerechnet Emmi, für die Kinder höchstens zum Erhalt der Art vonnöten waren. Aber vielleicht war sie deshalb so beliebt, weil ihr jede Form der Anbiederung fremd war und sich ihr Idealismus bereits in ihrer Junglehrerzeit in Grenzen gehalten hatte. Sie erwartete wenig und freute sich, wenn doch etwas zustande kam. Das machte sie fair in ihrem Verhalten den Schülern gegenüber.
Bei Anna war es anders, Anna liebte sie. Sie liebte sie an ihrer, Irenes, statt. In Gedanken entschuldigte sie sich bei Anna dafür, aber sie hatte lange darüber nachgedacht, bis sie es begriffen hatte. Emmi war immer ihre beste Freundin gewesen, zumindest bis sie nach München ging. Es muß sie sehr gekränkt haben, daß sie nicht gesagt hatte: »Was ist, Emmi, kommst du nicht mit? Laß uns gemeinsam etwas aus unserem Leben machen.« Das hätte sie natürlich sagen können, aber sie sagte es nicht. Auch hatte sie Angst davor, mit Emmi zusammen zu wohnen. Emmi hätte Anna um keinen Preis zurückgelassen, und wenn sie sie mitgenommen hätte, wären sie auf jeden Fall beisammengeblieben. Dann hätte sie gar nicht erst wegzugehen brauchen.
Sie war damals noch immer in Mario verliebt, auch wenn klar war, daß sie nicht heiraten würden. Er machte sich nichts aus Kindern. Und aus Dankbarkeit dafür, daß sie ihn Annas wegen nicht belangte, erleichterte er ihr den Start in München, und zwar entscheidend. Bis er dann nach Australien gegangen und dort geblieben war.
Irene hatte sich nie gefragt, ob Anna viel oder überhaupt etwas von Mario haben könnte. Nur jetzt dachte sie manchmal darüber nach, seit Anna verschwunden war. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, daß sie sich an Mario nie als an Annas Vater erinnerte und ihr auch nichts von ihm erzählt hatte.
Auch ihr hatten die Eltern, die nicht ihre Eltern waren, nichts von ihrem Vater erzählt. Genausowenig von ihrer Mutter. Wahrscheinlich wußten sie gar nicht, wer sie waren, als sie sie adoptierten. Sie war Treibgut gewesen, angeschwemmt vom Krieg, ein herrenloses Stück Leben, das Fürsorge brauchte. Und die beiden, die sich zu dieser Fürsorge bereit fanden, erledigten die Formalitäten und nahmen sie zu sich.
Sie gewöhnten sich aneinander. Und obwohl sie schon drei Jahre alt gewesen war, erinnerte sie sich an nichts aus der Zeit davor, was wahrscheinlich gut war. Das Zimmer, das von nun an ihres sein sollte, kam ihr riesengroß vor, und im Dämmerlicht ängstigte sie sich vor den Astlöchern in der hölzernen Decke.
Sie hätte nicht sagen können, daß diese Eltern sie nicht geliebt hätten. Sie waren, wie sie waren, aber sie waren für sie da. Und obwohl sie Irene nie verzeihen konnten, daß sie weggegangen war, war klar, daß sie auch für Anna dasein würden. Natürlich hatte Emmi, vernarrt, wie sie in Anna war, ihnen vieles abgenommen, aber gewohnt hatte Anna bei diesen Eltern, die einst auch für sie gesorgt hatten. Sie hätten nie zugelassen, daß sie Anna damals zu sich geholt hätte. »Entweder du kommst zurück, dann kannst du mit deinem Kind bei uns bleiben, oder es ist unsere Tochter, so wie du unsere Tochter gewesen bist. Ein Kind braucht Familie«, hatte der Vater gesagt, und die Mutter stand neben ihm und hielt Anna fest im Arm.
Es stimmte schon, sie hatte nie um Anna gekämpft. Es waren zu viele Mütter um sie herum. Eine Mutter, die anstatt Großmutter noch einmal Mutter wurde, und Emmi, der man Anna ohnehin eher geglaubt hätte. Wenn sie zu Besuch kam und sie gemeinsam mit Anna spazierengingen, schob immer Emmi den Kinderwagen und brabbelte mit Anna, während sie sich neben den beiden wie verloren vorkam. Auch hatte Emmi damals schon die Figur einer Frau, die in der Schwangerschaft wesentlich mehr zugenommen hatte, als das Kind wog. Aber es stand ihr, und sie sah aus, als würde sie noch viele Kinder kriegen. Während sie, Irene, neben Emmi mager und unreif wirkte, wie die kleinere Schwester, die sie zum Spazierengehen überredet hatte, um mit ihr über Familienangelegenheiten zu sprechen.
Die Frage war, warum sie jetzt trotzdem zurückgekommen, besser gesagt, hierher geflüchtet war. Sie war immer dafür, die Dinge beim Namen zu nennen. Ja, sie war geflüchtet, und das nicht zum ersten Mal. Sie hatte in ihrem Leben schon viele Adressen gehabt. Doch irgendwann stellte sich heraus, daß die Erde tatsächlich rund war und man immer wieder auf die gleichen Längen- und Breitengrade stieß. Also kam man unweigerlich eines Tages an den Ausgangspunkt zurück.
Da war nichts mehr, was sie anderswo gehalten hätte, bis auf dieses Gesicht, das ihr noch immer zu schaffen machte. Sie wollte sich nicht mehr lächerlich machen, und der Trost einer vollkommen neuen Adresse mit all ihren Möglichkeiten griff nicht mehr.
Plötzlich hatte sie daran denken müssen, daß sie Großmutter war. Großmutter von Kindern, deren Mutter weggelaufen war und die sie viel zu selten in die Arme genommen hatte. Und obwohl ihr klar war, daß sie ihnen Anna nie würde ersetzen können, wollte sie sich zumindest nützlich machen.
Nicht um irgend etwas – lassen wir das – nachzuholen oder gutzumachen, einfach so. Weil ihr ihre Gesichter mit einem Mal unter die Haut gingen. Anders als die Gesichter, die all die Jahre hindurch so wichtig für sie gewesen waren. Ja, sie empfand etwas, wenn sie Annas Kinder ansah. Nur darum ging es. Sie mußte etwas dabei empfinden, wenn sie mit Menschen zusammen war. Und sie konnte für Annas Kinder etwas empfinden, ohne sich der Lächerlichkeit preiszugeben.
Inimini
»Finde ich geil«, sagte Hülya, »eine Großmutter, die vom Baum hängt.«
»Wie eine taube Nuß, genau so. Zuerst dachte ich, es ist ein Paragleiter, der sich in unserem Nußbaum verfangen hat«, fügte Inimini hinzu.
»Paragleiter? Die gibts hier gar nicht. Sind verboten.« Bei Nermin war immer alles verboten. Was sie nicht kannte, was sie nicht wußte, was sie nicht mochte, alles war verboten.
»Einer, der sich verflogen hat. Wenn der Wind danach ist, kommen sie ziemlich weit.«
»Aber nicht so weit.« Nermin packte die Schulsachen aus, Buch um Buch, Heft um Heft.
»Egal, geht doch nur drum, was ich gedacht habe, daß es ist. Und kreischte auch noch, da wußte ich, daß es eine Frau war.«
»Wie ist sie denn raufgekommen?« Hülya war noch immer begeistert. »Geflogen?«
»Geklettert, wie damals, als sie Mädchen waren, sie und die dicke Emmi.«
»Die Lehrerin, die nicht mehr aus dem Haus geht?«
Inimini nickte.
»Wir haben sie noch gehabt, in der ersten Klasse. War bei weitem nicht so schlimm, wie sie ausgesehen hat.« Hülya stellte ihre Schultasche auf den Kopf, und alles fiel heraus, auch ihr angebissenes Pausenbrot.
Nermin zeigte mit dem Finger drauf. »Bist du vom nackten Affen gebissen? Brot auf dem Boden! Wenn Allah das sieht.«
»Halt doch die Luft an, Nermin. Allah hat sicher anderes zu tun, als sich um mein Brot zu kümmern. Kannst es ja aufessen, wenn dir so leid ist drum.« Hülya hielt ihr den Rest von dem Käsebrot unter die Nase, aber Nermin wendete sich angewidert ab. »Vergiß nicht, daß Allah alles sieht, ganz automatisch.«
»Und du nervst ganz automatisch.«
Sie sollten zusammen lernen, weil Inimini bessere Noten hatte als Nermin und Hülya. »Du kannst immer bei uns essen«, hatte Tante Emine gesagt. Sie wollte, daß Inimini Türkisch mit ihr sprach. Wenn sich ihr Vater schon nicht darum kümmerte.
»Ali baba macht das schon, er hat nur wenig Zeit.«
»Und überhaupt«, sagte Tante Emine, aber Inimini hörte nicht zu.
Sie wußte auch nicht, warum sie Ali baba immer in Schutz nahm. Auch wenn sie oft böse war auf ihn. Nicht nur auf ihn, auf alle anderen auch. Bis auf Hülya. Auf Hülya war sie so gut wie nie böse. Hülya auf sie auch nicht, glaubte sie zumindest.
Wenn Inimini böse war, sah sie die Menschen als Tiere, Nermin als Waldkauz, Tante Emine als schwarze Büffelkuh, Onkel Haluk als Waran, die dicke Emmi als schokoladefarbene Perserkatze, die neue Großmutter als Kakadu und Omo als Eisbären. Dann mußte sie lachen, weil die anderen nicht wußten, wie sie ihr vorkamen.
Ali baba stellte sie sich manchmal als Widder vor, das war auch sein Sternzeichen, oder als Kranich. In den Gedichten, die er nachts schrieb, kamen viele Kraniche vor. Omo las das alles heimlich, und dann schauten sie gemeinsam die Wörter nach, die er nicht verstanden hatte.
»Was kommt noch drin vor?« hatte Inimini ihn gefragt.
»Alles mögliche.« Omo war rot geworden.
»Sag schon, was?«
»Irgendwas mit Sehnsucht.«
»Und mit Liebe?« Er nickte.
»Also Liebesgedichte können mir gestohlen bleiben«, sagte sie mit Nachdruck.
Als Inimini und Omo noch klein waren, hatte ihnen Ali baba Geschichten erzählt, in seiner Sprache. Er hatte sie ihnen so lange erzählt, Wort für Wort, bis sie verstanden, was er sagte. So hatten Omo und sie die Sprache gelernt. Später dann auch von den Haluks. Aber wenn sie allein waren, Nermin, Hülya, Omo und sie, sprachen sie deutsch wie in der Schule.
Ali baba hatte immer so getan, als würde er ihnen die Geschichten vorlesen, aber als sie ihn später einmal nach dem Buch fragte, konnte er es nicht finden. Sie glaubte inzwischen, daß er sich die Geschichten, während er sie erzählte, ausgedacht hatte. Da er ihnen ja immer erst die Wörter erklären mußte, hatte er wohl auch genügend Zeit dazu.
Es war Nacht, und Inimini konnte Omo weinen hören. Da ging sie in sein Zimmer hinüber und legte sich zu ihm. Natürlich stritt er es ab, aber sein Taschentuch war naß. Und dann redeten sie wieder wie früher, als sie noch im selben Zimmer geschlafen hatten. Nämlich darüber, wie die Welt entstanden sein könnte. Ob Allah wirklich nur gesagt hatte, »komm zustande!« und dann alles da war. Wer aber hatte dann das Wasser gemacht? Die Haluks sagten, daß sein Thron auf dem Wasser stand. Und die dicke Emmi meinte, in der Bibel würde es so ähnlich stehen, nämlich daß Gottes Geist über den Wassern schwebte.
»Erinnerst du dich noch an die Geschichte, die Ali baba uns erzählt hat, von Gott, der mit einer Art Vogel, den er schon erschaffen hatte, über den Wassern dahinflog und dann dieses Wesen nach Lehm schickte, um die Welt und uns Menschen zu machen? Das Wesen kam aber nicht wieder, weil es seine eigene Welt erschaffen wollte. Zur Strafe mußte es dann in die Unterwelt.«
»Klar«, sagte sie, »aber das ist nur eine Geschichte im Gegensatz zu dem, was die Haluks sagen. Das steht nämlich im Koran, während Ali baba sich seine Geschichten alle ausgedacht hat.«
»Und was, wenn die Haluks und die dicke Emmi sich diese Geschichten auch nur ausdenken?«
Zum Glück war niemand von den Haluks da.
»Glaub ich nicht. Was die Haluks sagen, kann man nachlesen. Und das von der dicken Emmi auch. Trotzdem ist da noch immer die Geschichte mit dem Wasser.« Omo war der einzige Mensch, bei dem Inimini nicht aufpassen mußte, was sie sagte. Zumindest solange sie alleine waren.