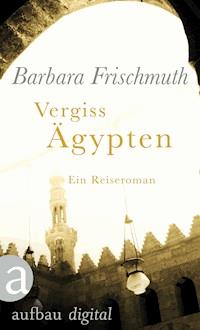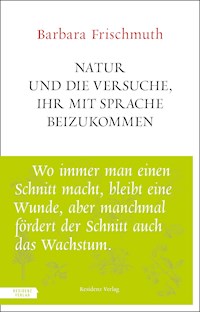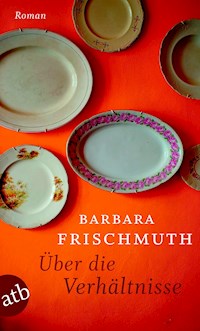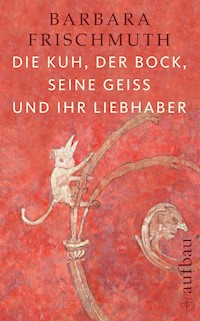
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Von Affenliebe bis Katzenjammer
In diesem frischmuthschen Bestiarium verstricken sich Redewendungen und Sprichwörter plötzlich zu absurden Tiergeschichten. Nichts Animalisches ist diesen Tieren und denen, die es sein könnten, fremd - und natürlich auch nichts Allzumenschliches. Barbara Frischmuth lässt sich von der Sinnlichkeit der Sprache verführen, sie nimmt sie beim Wort und geht den Wendungen der Rede nach, dass man unentwegt gleich ihren Tieren im Hausgebrauch die Ohren spitzt, um nicht in Fallen zu tappen oder die Eselsbrücken zu verpassen. Wozu führt das nicht alles: zum dicken Hund, zum Kroko-Deal, zur Busenschlange, zum Katzenjammer, zu Schwanenseen oder dem Otterndilemma. Der Sprachwitz inspiriert zu Charakteren, Situationen und Bekenntnissen, die stets aus Zwiespältigkeiten erwachsen und Mehrdeutigkeiten nicht scheuen. Kurz, hier ist man auf der hohen Schule von Nonsens und Schwarzem Humor, auf der man amüsiert so manches lernt über den Nager in uns, Verwirrungen der Affenliebe und wie eine junge Geiß den Schäfer nach ihrer Pfeife tanzen lässt. "Es war Freitag und das Krokodil füllte an der nächsten Tankstelle seine Tränensäcke fürs Wochenende auf, um für die emotionalen Herausforderungen [, die ihm zustoßen würden,] gewappnet zu sein." "Kein Schwein sein oder ein Schwein sein, diese Entscheidung muss natürlich jedes Schwein für sich selber treffen." "Was soll's", sagte die Kuh, die am Herd stand, "von einem Ochsen kann man nicht mehr verlangen als ein gutes Stück Rindfleisch."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Ähnliche
Barbara Frischmuth
Die Kuh, der Bock, seine Geiß und ihr Liebhaber
Tiere im Hausgebrauch
Mit 19 Graphiken von Wouter Dolk
Impressum
ISBN 978-3-8412-0049-5
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2010
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2010
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung heilmann/hißmann, Hamburgunter Verwendung eines Motivs von Wouter Dolk
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Impressum
Inhaltsübersicht
DIE KUH, DER BOCK, SEINE GEISS UND IHR LIEBHABER
KATZENJAMMER
GANZ FUCHS UND GANZ GANS
DU LIEBER GOCKEL
DER TRAMPEL
DICKER HUND
FROSCHSCHENKEL
AFFENLIEBE
DER GEDÄCHTNISTRAINER
DIE BUSENSCHLANGE
KEIN SCHWEIN SEIN
KROKO-DEAL
DER NAGER IN MIR
DAS OTTER-DILEMMA
PFERDEARSCH
SPINNEN SPINNEN
SCHWANENSEEN
TRAUMBÄR – BÄRENTRAUM
DIE KUH, DER BOCK, SEINE GEISS UND IHR LIEBHABER
»Was soll’s«, sagte die Kuh, die am Herd stand, »von einem Ochsen kann man nicht mehr erwarten als ein gutes Stück Rindfleisch.« Sie kochte auf dem Hof, nicht gerade auf dem Gerichtshof selbst, aber der Hof war eine Außenstelle der Exekutive, in die straffällig gewordene Jugendliche und Ex-Junkies auf Bewährung kamen.
Das funktionierte so recht und schlecht. Allerdings war das ursprüngliche Ziel, eine autarke Versorgung auf die Beine beziehungsweise in den Stall und auf die Beete zu stellen, noch nie seit Bestehen erreicht worden.
Der Ochse hatte die Ochsentour in der Verwaltung nicht durchgestanden und brodelte nun in der Suppe herum. Der Geißbock aber hatte die Bestellung zum Gärtner nicht ernst genug genommen und sich die ganze Petersilie reingezogen, was die Suppe jetzt ausbaden musste. Er machte sich erbötig, Liebstöckl und Gundlrebe zu ernten anstatt der Petersilie (er sagte tatsächlich ernten).
Da lachte sogar die Kuh. »Was heißt anstatt? Die gehören, wenn schon, dann von Haus aus rein. Und jetzt raus mit dir!«
Gerade trippelte die junge Geiß mit schwingendem Euter am Küchenfenster vorüber. Ihr Liebhaber, der Schäfer, war um Lecksteine zum Landmarkt gefahren, und sie wollte sehen, was ihr Bock vom Kräuterbeet übriggelassen hatte.
Der Schäfer hieß deswegen ihr Liebhaber, weil Schäfer, die die Schafe noch in die Berge trieben, sich immer eine Geiß mitnahmen, um unterwegs eine Ansprache zu haben und unter so vielen Schafsköpfen nicht trübsinnig zu werden.
Klar, dass der Schäfer daran interessiert war, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen, aber angesichts einer so kompakten und undurchlässigen Ethnie wie den Lämmernen war eben nicht für Unterhaltung gesorgt. Die oblag der jungen Geiß. Und da ihr Bock sie höchstens zwei- bis dreimal im Jahr ernsthaft brauchte, konnte sie es sich leisten, in ihre Kompetenz als Gesellschafterin (die Japaner würden sagen Geisha) zu investieren. Erst vorhin hatte sie wieder ein paar kleine Tricks trainiert, mit denen sie den Schäfer nachts am Lagerfeuer überraschen wollte.
Die Kuh war nicht die einzige Kuh im Gestrauchelten-Camp, aber die einzige, die gelegentlich den Kochlöffel schwang. In den Unterständen lungerten jede Menge ausgewachsene Kälber herum, die Gras nicht nur fraßen, sondern auch rauchten und sich im gegenseitigen Bespringen übten.
Die paar anderen Kühe arbeiteten als Erzieherinnen und waren mit der Produktion von Nahrungsmitteln, nicht mit deren Verarbeitung, beschäftigt.
Der ehemalige Direktor, ein im Stier Geborener, hatte den Aufstieg in der Hierarchie geschafft und arbeitete jetzt im Ministerium. Das Schicksal seines Nachfolgers, jenes Herrn Ochs, wurde schon erwähnt. Im Augenblick war das Direktionsbüro herrenlos, zwei ältere Ziegen arbeiteten auf Teilzeit und erledigten den Papierkram.
Kriminelle Energie ist in allen Gesellschaften ein beinah gleichbleibender statistischer Wert. Schlägt er in die eine oder andere Richtung aus, hat das meist mit der Intelligenz von Einzelnen zu tun, die sich erwischen oder nicht erwischen lassen. Dasselbe Muster spiegelte sich in der Belegschaft der Außenstelle. Dass Kaninchen, Ratten und Mäuse in der Überzahl waren, hatte weniger mit ihrer Kriminalitätsrate zu tun als mit der Tatsache, dass sie sich sogar in Verwahrung vermehrten. Was auch bei anderen Gruppen vorkommen konnte, aber die brauchten einfach länger.
Aus verwaltungstechnischen Gründen war Reproduktion in allen Lagern verboten, aber das war der Tanz ums Goldene Kalb auch. Dennoch trampelten sich die jungen Rindviecher im Saturday night fever die Hufe wund, wenn die Hühner zur Gitarre gackerten und ein Neufundländer von außerhalb an den drums rackerte.
Nur die Schafe gehörten nicht in diesen Kontext. Weder wurden sie von einem neuen Scheunentor verunsichert, noch soffen sie wie eine Häuslerkuh, nicht einmal die schwarzen unter ihnen. Das Einzige, was sie vor den Kadi brachte, war, dass sie dem Wolf gelegentlich das Wasser trübten. Aber nicht etwa eines allein, sondern immer gleich der ganze Haufen, darum wurden sie auch herdenmäßig interniert.
Doch wie das Sprichwort vom Weidewesen sagt: »Rind und Schöps gibt keine Möps.«
Und so schickte man sie mit zwei Hütehunden und einem Schäfer in die Berge, wo sie das Gras mähten und die Almwirtschaft am Laufen hielten, so dass sie den Staat von allen jugendlichen Delinquenten am wenigsten kosteten. Gelegentlich wurde ihnen zum Vorwurf gemacht, dass sie in einer Parallelgesellschaft lebten, aber in Wirklichkeit war man behördlicherseits heilfroh, sich nicht weiter um sie kümmern zu müssen.
Die Redewendung vom Feind des Feindes, der ein Freund ist, kannte auch die junge Geiß, die, als der Schäfer mit den Lecksteinen zurückgekommen war, wiederum mit ihm und der Herde aufbrach. Es war zwar ein wenig übertrieben, die Schafe für ihre Feinde zu halten, dennoch erschien es ihr klug, sich mit den Hunden zusammenzutun.
»Wenn ich nicht wüsste, dass du kein Fleisch magst«, sagte der Schäfer manchmal, »müsste ich annehmen, du würdest heimlich ganze Filetstücke runterschlingen.«
Da die beiden Border Collies als besonders treu und dem Schäfer ergeben galten, war es für ihn undenkbar, dass sie das Fleisch, von dem er nicht wusste, wo es hingekommen war, gefressen hätten. Sie aber hatten kein schlechtes Gewissen, da ihnen das Fleisch ja von der Ziege zugeschanzt worden war.
Die junge Geiß war eine hübsche Schwarze mit glänzendem Haar und grünen Augen. Und wenn sie tanzte, stoben ihre Grannenhaare im Luftzug auseinander, und die beiden zierlichen Glöckchen unter ihrem Kinn schlenkerten im Rhythmus ihrer Tanzschritte.
Der Schäfer, der tagsüber recht grob sein konnte und nicht nur den Schafen, sondern auch sich selbst, den Hunden und der jungen Geiß lange und anstrengende Fußmärsche zumutete und nicht davor zurückschreckte, seinen Kommandos mit dem Hirtenstab Nachdruck zu verleihen, wobei auch die Geiß den einen oder anderen Schlag abbekam, wurde nach Einbruch der Dunkelheit weich wie ein Camembert und haderte mit seinem Schicksal, weder Weib noch Kind zu haben. Aber welche Frau kann schon einen Mann gebrauchen, der die ganze warme Jahreszeit über durch die Berge stapft und, wenn er endlich heimkommt, wie eine Schafhürde mit einem Hauch von Ziege stinkt.
Das war nun die Stunde der jungen schwarzen Geiß, die den Schäfer gerne mit ihrem seidenweichen Bärtchen am Ohr kitzelte, ihn dann mit ihren grasgrünen Augen fixierte, um danach vor ihm in die Knie zu gehen, als wolle sie ihm jeden Wunsch von den Augen ablesen. Manchmal las er ihr erst etwas aus der Zeitung vor, wenn sie unterwegs eine von Touristen liegengelassene gefunden hatten.
So wie neulich, als da glatt zu lesen stand, dass, neuesten wissenschaftlichen Versuchsserien zufolge, Schafe sich die Gesichter von bis zu fünfzig Artgenossen und das des Schäfers zwei Jahren lang merken könnten. Dafür sollten spezielle Zellen für das Erkennen von Gesichtern verantwortlich sein, ähnlich wie bei Affen und Menschen.
Darauf die Geiß ein wenig spöttisch: »Die kennen die unsrigen nicht!«
Der Schäfer zog sie hoch und an sich heran. »Und wie ist es bei dir, kleiner Teufelsbraten?«
»Dein Gesicht merke ich mir natürlich. Aber bei den Schafen hätte ich gewiss Schwierigkeiten. Die schauen tatsächlich eines wie das andere aus. Ich meine, ich erkenne Daisy, weil sie alle rumkommandiert, und Herta, die Kontakt zu den Hunden hält, aber die anderen …«
»Und woran erkennst du mich?« Der Schäfer hatte die junge Geiß, die in der Außenstelle Aglaja gerufen wurde, genötigt, sich auf seinen Schoß zu setzen. Er legte ihr den Arm um die Schulter, so dass ihre Wange auf seiner Brust zu liegen kam. So konnte sie sogar sein Herz pochen hören, es klang wie ein Schmied, der Eisen auf Pferdehufe hämmert.
Anstatt zu antworten, fragte sie ihn, ob sie ihm etwas auf der Panflöte vorspielen solle. Sie fand, er mache es sich einfach zu leicht, und wollte, dass er sich zumindest zum Vorspiel bequemte.
»Mh!«, meinte er, und schon seufzte sie ihm, gleich dem Wind, der durchs Rohr streicht, eine Melodie ins Ohr, die sein Knochenmark in Vibrationen versetzte und sein Gemüt in einen schmelzenden Camembert verwandelte, der langsam Blasen bildete.
»Komm!«, rief die junge schwarze Geiß schelmisch zwischen zwei Melodiefetzen. »Ich möchte, dass du nach meiner Pfeife tanzt, so komm schon!«
Der Schäfer konnte sich ihrer Koketterie nicht entziehen und den Weisen, die sie ihm in abrupter Folge auf der Flöte blies, schon gar nicht. Er nahm einen gewaltigen Schluck aus dem Bocksbeutel, den er immer in der Hosentasche stecken hatte. Es war Meisterwurzschnaps, den er im Winter selbst brannte und auf Wanderschaft des Öfteren als Medizin zu sich nahm.
Aber wahrscheinlich war der Schluck zu gewaltig, eigentlich war es eine Folge von Schlucken gewesen, denn als er der Melodie mit seinen Beinen zu folgen versuchte, stolperte er andauernd und schwankte, dass die junge Geiß, die sah, dass er bald stürzen würde, darauf achten musste, dabei nicht unter ihm zu liegen zu kommen. Er war ein ziemlich harter Knochen, der Schäfer.
Doch bevor er fiel, spitzte er die Lippen und lallte etwas von seinem geliebten Schnuckelchen, wobei er die Arme nach ihr ausstreckte.
Die Geiß war zwar jung, aber nicht blöd. Sie wusste, dass in manchen Gegenden die Schafe Heidschnucken genannt wurden, und machte auf beleidigt. Sie hörte sogar zu spielen auf, und das warf den Schäfer nun vollends aus der Bahn. Er rief nach ihr, und als sie nicht sofort angetanzt kam, um ihm wie sonst die Zehen zu lecken, begann er zu heulen. Die Hunde, die bis jetzt Ruhe bewahrt hatten, heulten mit, und die junge Geiß schüttelte, mehrmals peinlich berührt, den Kopf.
Zum Glück war der Bocksbeutel heil geblieben, obwohl er mit dem Schäfer zu Boden gegangen war, und so flößte sie ihm einen weiteren mächtigen Schluck ein, in der Hoffnung, der Schäfer würde dann auf der Stelle einschlafen. Ihr war klar, dass aus dem Abend nichts mehr werden konnte, und sie hatte keine Lust, ihre Talente an einen Sturzbetrunkenen zu vergeuden.
So geschah es auch. Die Hunde machten sich auf zu ihren Kontrollgängen, und die junge schwarze Geiß deckte den bereits schnarchenden Schäfer zu.
In dieser Nacht träumte sie seit langem wieder einmal von ihrem Bock. Und der roch nicht nach Schafen oder Meisterwurzschnaps, sondern duftete herrlich nach Petersilie, die er zu einem Kranz gewunden um den Hals trug.
KATZENJAMMER
Die Katze im Hausgebrauch degeneriert zusehends. Ihre ganze Wissenschaft geht in die Fellpflege, und sie schert sich einen Dreck um neue Strategien in der Nagerjagd. Hausgeburten werden immer seltener, die nächste Generation wird vom Hersteller direkt geliefert, geimpft, registriert und mit Herkunftszertifikat versehen. Da gibt es nichts dran zu kratzen.
Selbst wenn der stille Winkel in so einer Wohnung noch vorhanden wäre, in dem die Katze ihre zwei Würfe pro Jahr ablegen und die Brut kätzisches Benehmen lehren könnte, wie soll sie in eben so einer Wohnung unverhofft dem entsprechenden Kater begegnen, der ihr erst einmal zu Nachwuchs verhelfen muss?
All die nicht mehr rückgängig zu machenden Eingriffe des Menschen ins kätzische Sexualleben zeigen zweierlei: Einerseits, dass Kastraten eher an Adipositas erkranken als die üblichen Schnellficker, und andererseits, dass Sexualität nicht alles bedeutet. Oder sind Sie der Meinung, Sie würden Ihr Katzentier auch nur um fünf Gramm weniger lieben, bloß weil seine Samen- und Eileiter verschweißt sind? Also gibt es auch ein Leben jenseits der Sexualität, unglaublich, aber erwiesen!
Ist das jetzt eine tröstlich oder eine untröstlich stimmende Ansage? Der Katzenbaron legt die Ohren an, schließlich gehört er zu den Leidtragenden, was ihn aber nicht daran hindert, gelegentlich eine ganze Miezen-Gang anzuschmachten. Und hin und wieder fängt sich auch einer dieser glamourösen Katzenkörper, der nichts gegen Markieren hat und schon gar nichts gegen Markiertwerden, in seinem Kommunikationsnetz.
Die Katze als solche hat wohl den größten Tribut an den Luxus eines Lebens innerhalb der Zivilisationsgrenzen entrichtet. Um dermaßen verwöhnt zu werden, hat sie sogar auf das Leben außer Haus verzichtet. Der Grundpfeiler ihres Gesellschaftsvertrags lautet: Katzenklo! Seither ist die Katze im städtischen Bereich internierbar, verdammt, in ihrem Fünf-Sterne-Arrest bis ans Ende auszuharren, meist ohne die geringste Aussicht, in Sachen Privatleben von Zeit zu Zeit aufs Dach zu huschen.
Dennoch gilt die Katze als diejenige, die das große Los gezogen hat, keine Existenzängste kennt, permanent in medizinischer Betreuung steht und deren Zicken als charakterimmanent gelten, was so viel heißt, wie dass man sie ertragen muss, ohne sie wirklich ernst zu nehmen.
Wie gesagt, hier ist von einer satten Mehrheit der Feliden im städtischen oder stadtähnlichen Bereich die Rede. Auf dem Lande mag zwar die persönliche Freiheit ein wenig größer sein, dort vergraben die Katzen ihre Fäkalien noch im nachbarlichen Garten, sie sind aber ansonsten genauso der Haushaltung unterworfen. Einige brauchen nicht einmal mehr fließende Gewässer, da sie gelernt haben, aus dem Spülbecken zu trinken.
Dass es bei ihnen wenig gegen ihre Halter gerichtete Gewalt gibt, von rituellen Kratzern abgesehen, hat mit ihrer Phantasie zu tun, in der sie sich noch immer als dominante Raubkatzen sehen, mit einem Hang zum Exzentrischen, der gemocht, bewundert und toleriert wird.
Nicht die Katze muss am Katzentisch sitzen, wenn sie sich danebenbenommen hat, sondern die Kinder bekommen auf diese Weise zu spüren, wer da die Sitzordnung macht. Dennoch werden in Familienverbänden mit Kindern die Dominanzgelüste der Katze etwas zurückgestutzt, wohingegen in kinderlosen die Katze bestimmt, was auf den Tisch kommt.
Wie jeder erfolgreiche Dompteur arbeitet auch die Katze mit Zuckerbrot und Peitsche, gibt einerseits die Schmeichelkatze, während sie andererseits ihren Wünschen dadurch Nachdruck verleiht, dass sie auf dem Schreibtisch Wasser lässt oder ihren Haufen im Spalt zwischen den Ehebetten ablegt.
Und anstatt sie einfach vor die Tür zu setzen, reagieren die so Bestraften meist auch noch willfährig und suchen die Schuld am Pissverhalten ihres Fellträgers in Kommunikationsschwierigkeiten, die eben zu Missverständnissen führen würden.
Von da aus ist es nur mehr ein Katzensprung bis zur vollkommenen Abhängigkeit. Es soll Menschen geben, die eher vom Tropf kommen, als auf ihre tägliche Katzbuckelei verzichten zu können.
In Kanada habe ich vor Jahren einen Professor der Kulturwissenschaften kennengelernt, der sich bitter darüber beklagte, wie schlecht er von seiner Katze behandelt werde, wie wenig Beachtung sie ihm schenke, von Zärtlichkeiten gar nicht zu reden. Das sei zwar nicht immer so gewesen, aber mit irgendetwas habe er es sich mit ihr dermaßen verscherzt, dass sie sogar das Zimmer verlasse, das er gerade betrete.
Ich fragte ihn, ob er sich denn bei seiner Katze entschuldigt habe. Er erwiderte, das könne er nicht, da er nicht wisse, womit er sie so gekränkt habe. Er komme einfach nicht dahinter. Nicht einmal sein Psychiater wisse Rat, dabei habe er ihm das Zusammenleben mit seiner Katze über mehrere Sitzungen hinweg bis ins kleinste Detail geschildert.